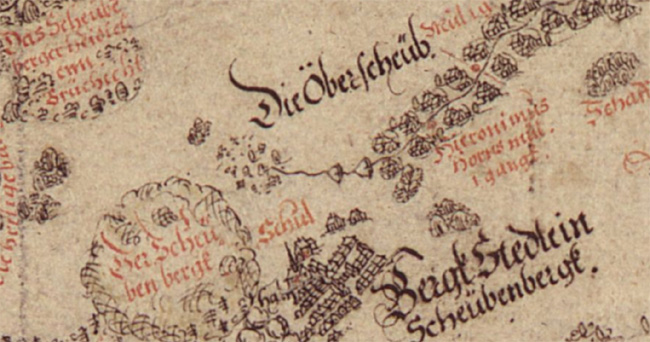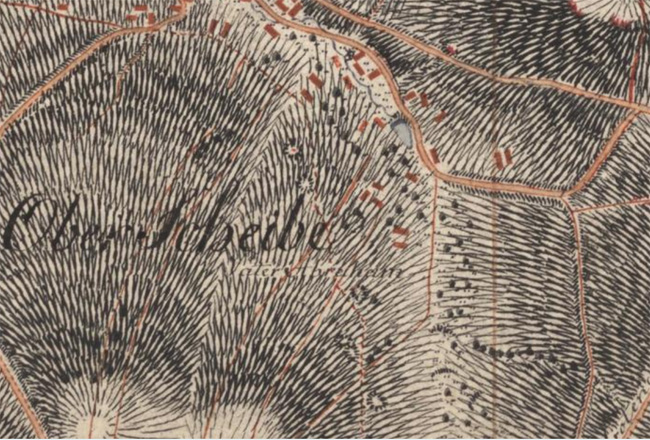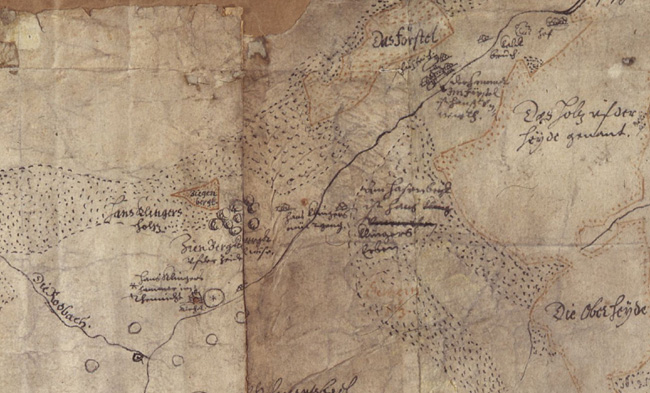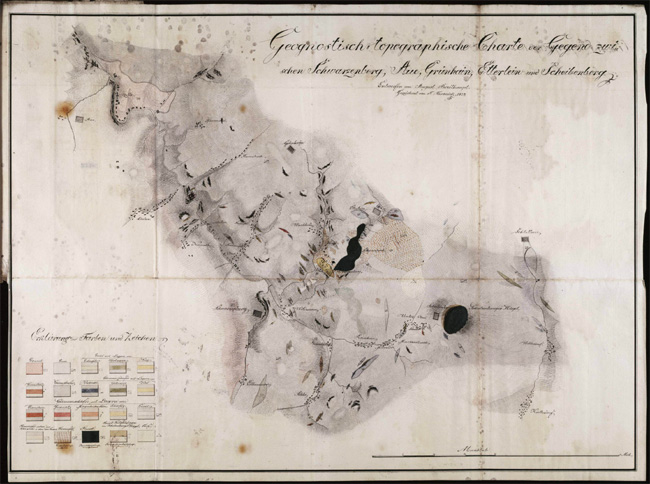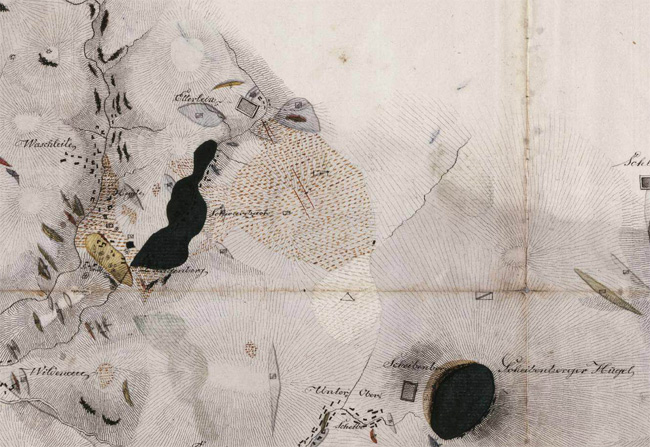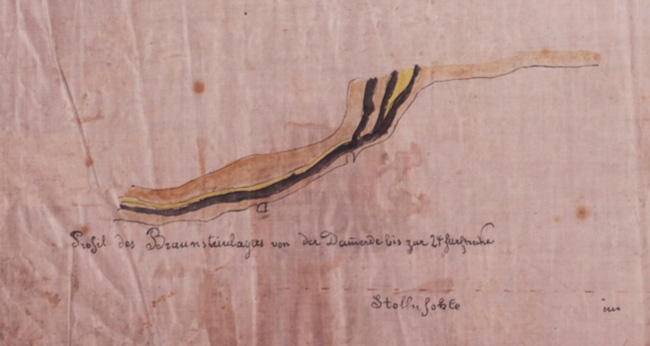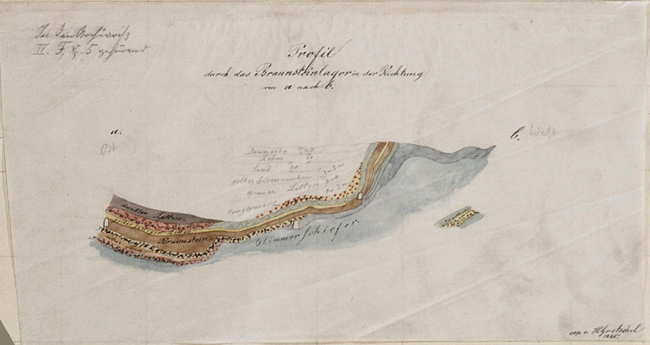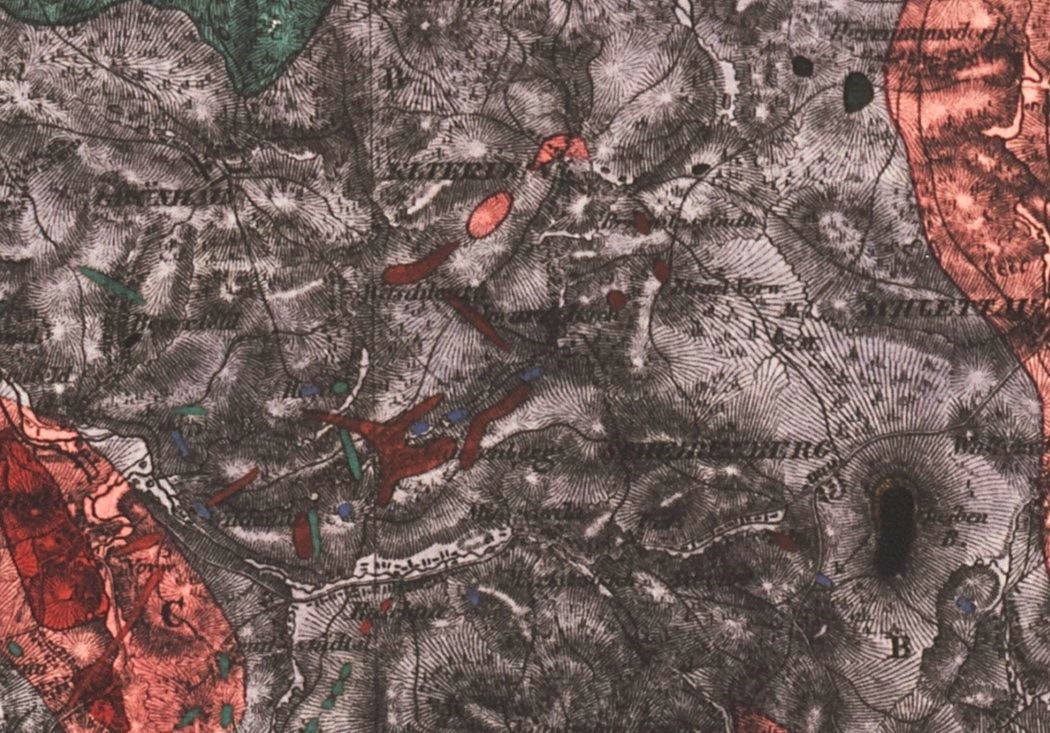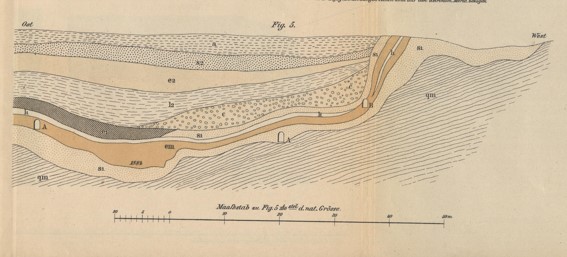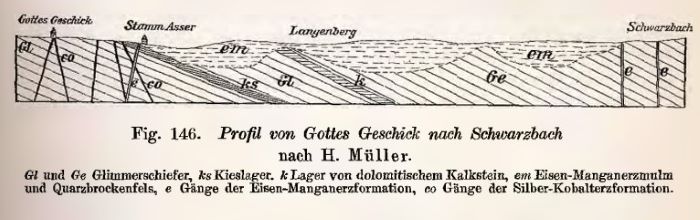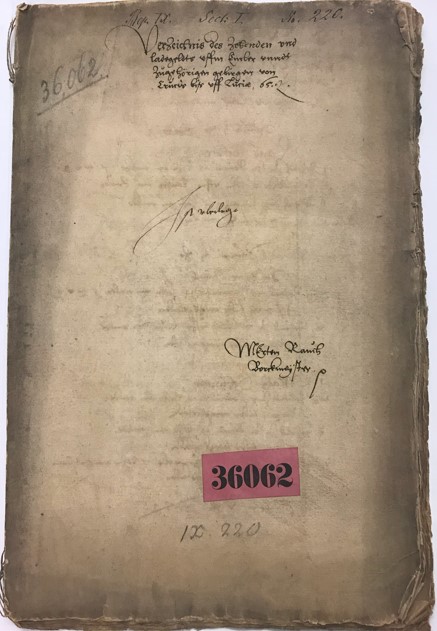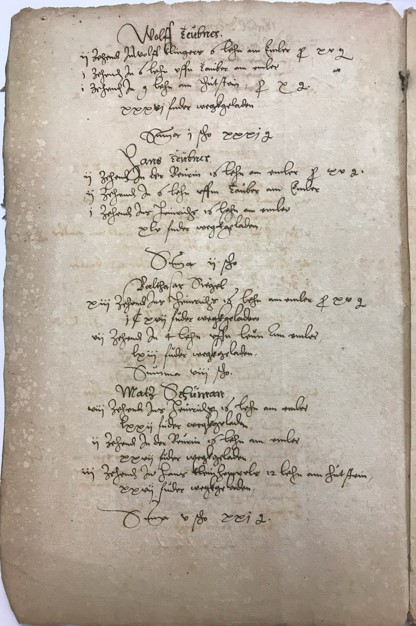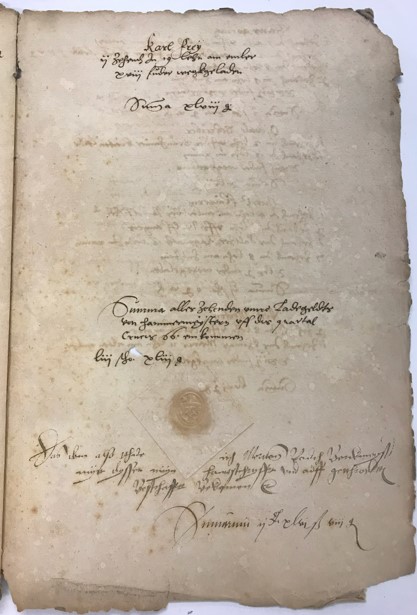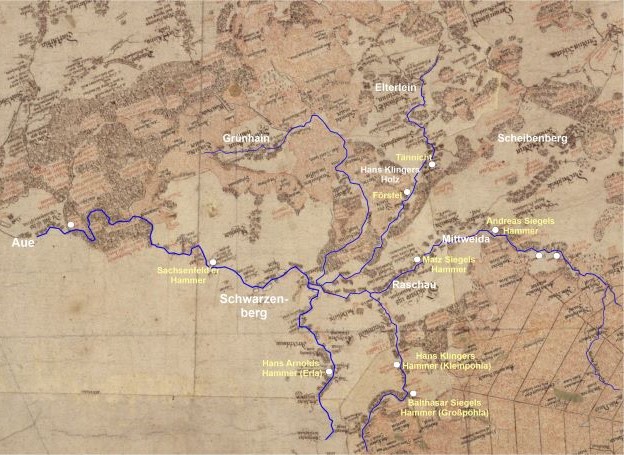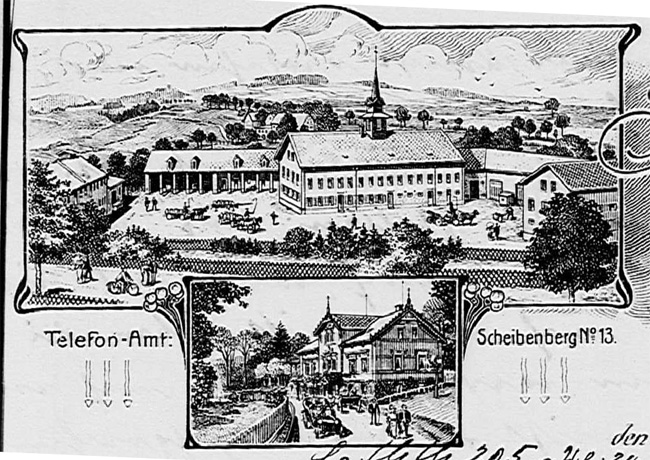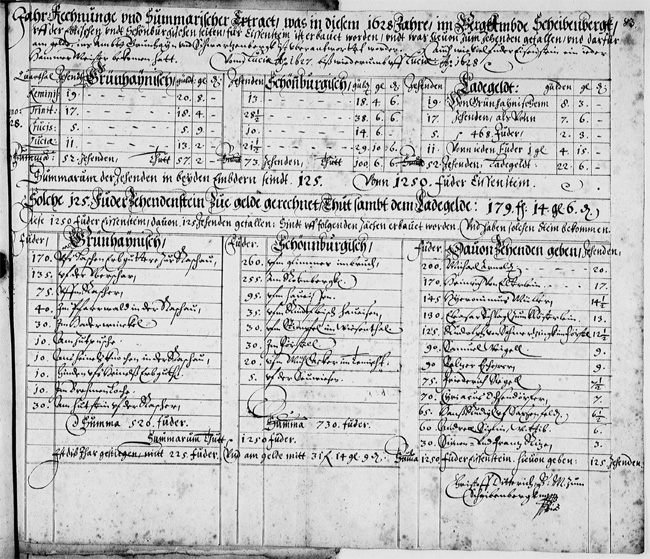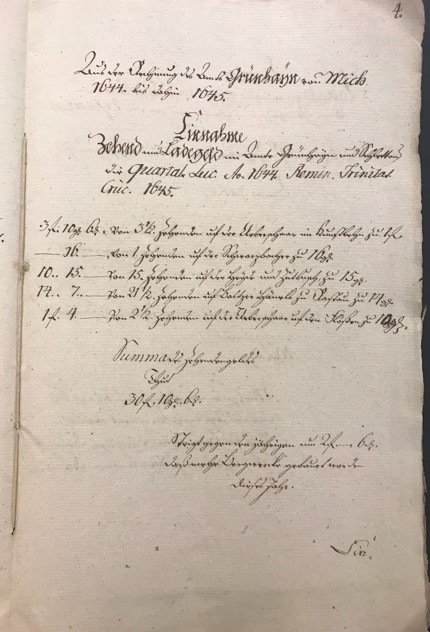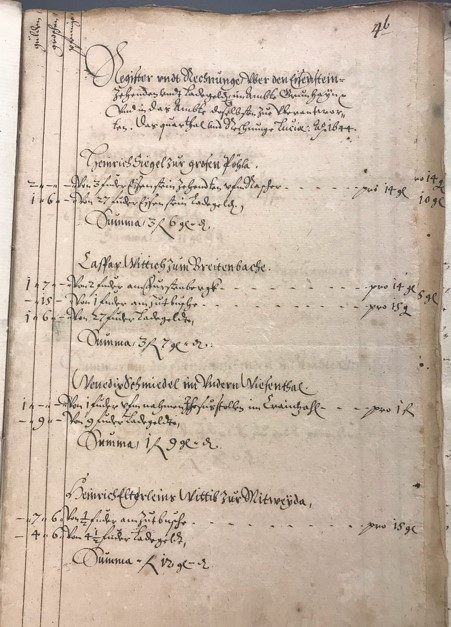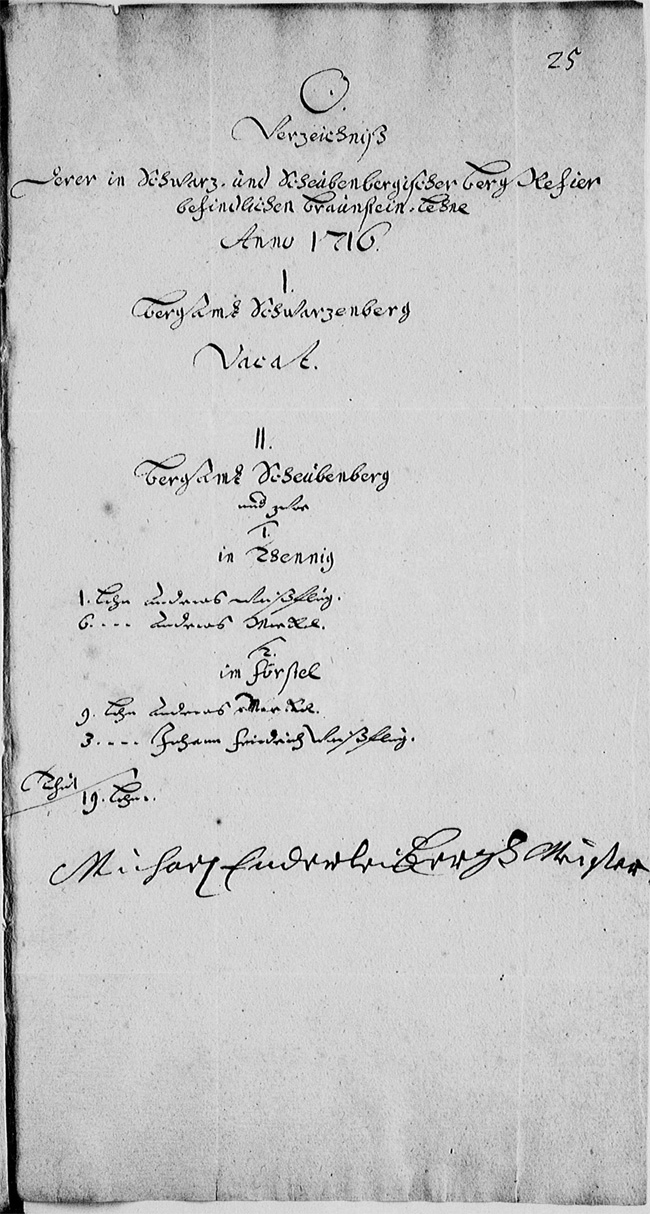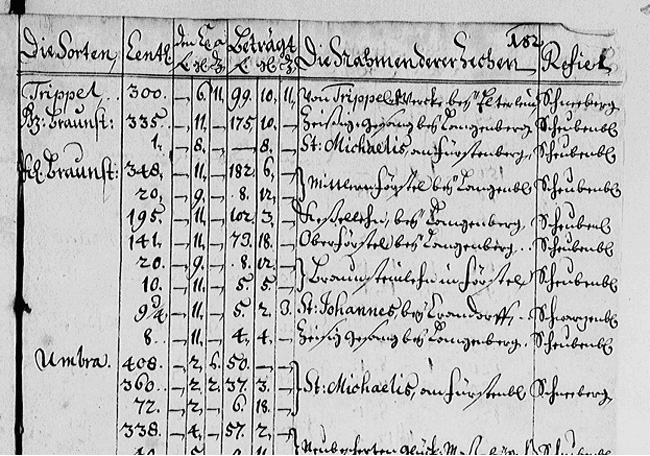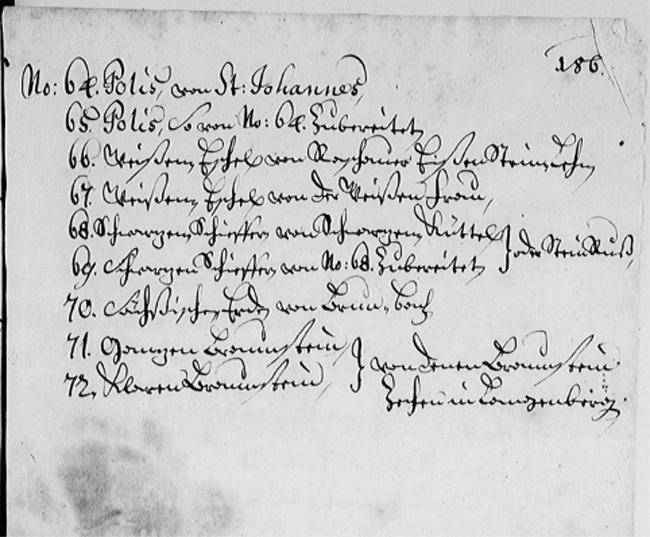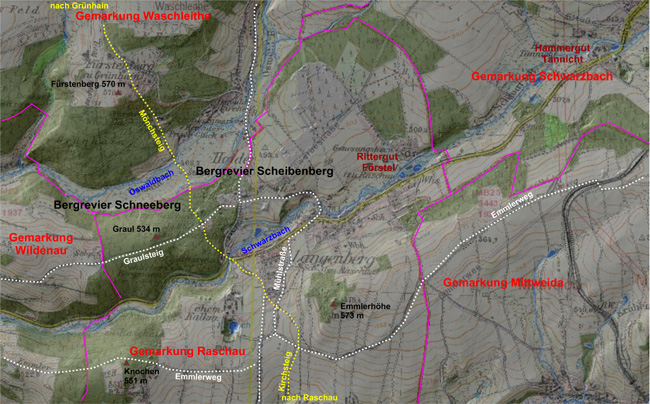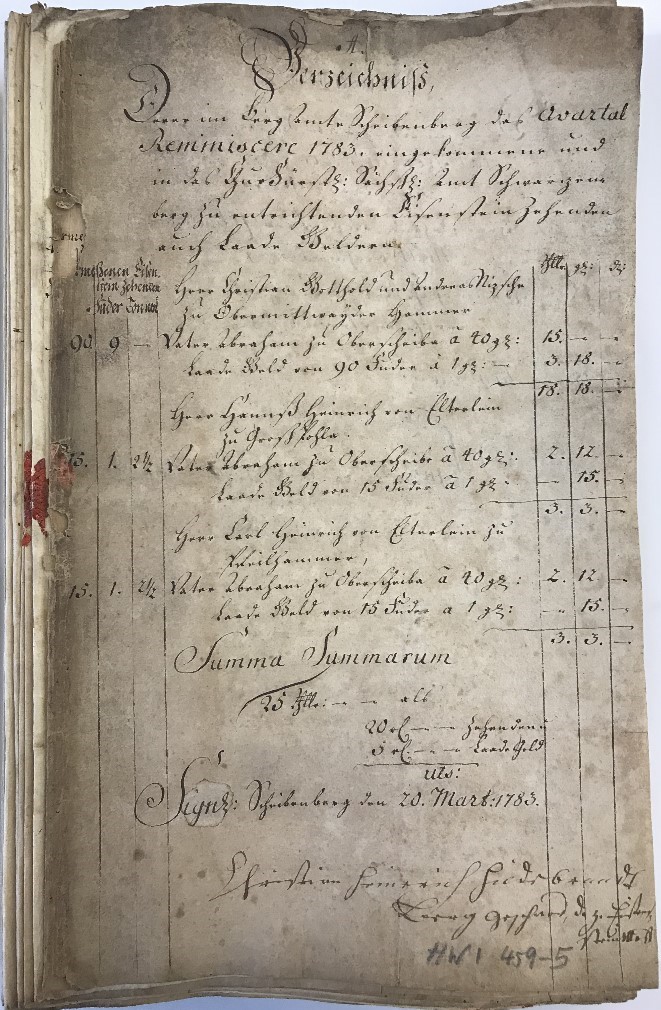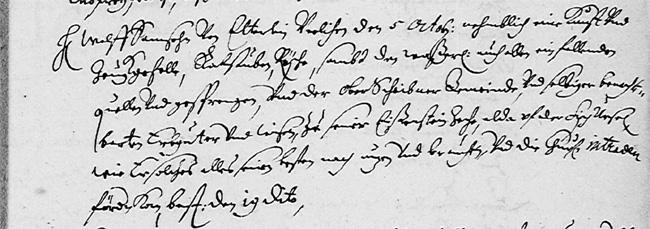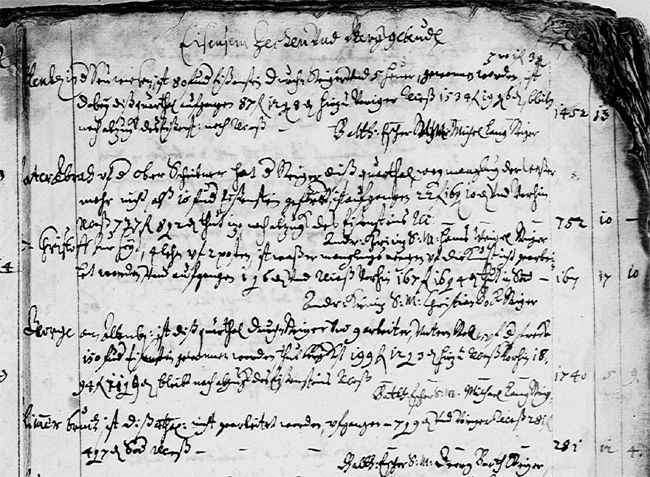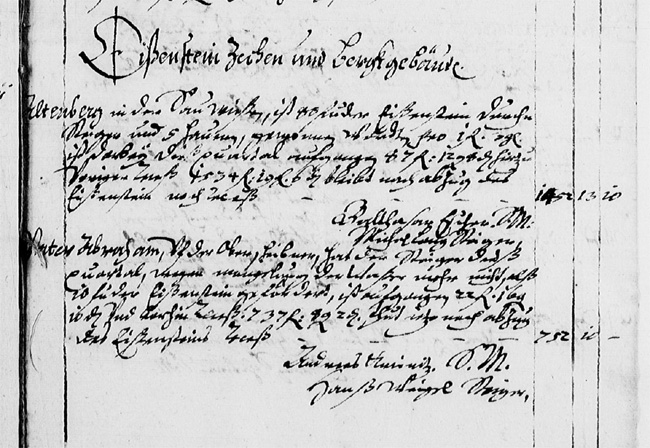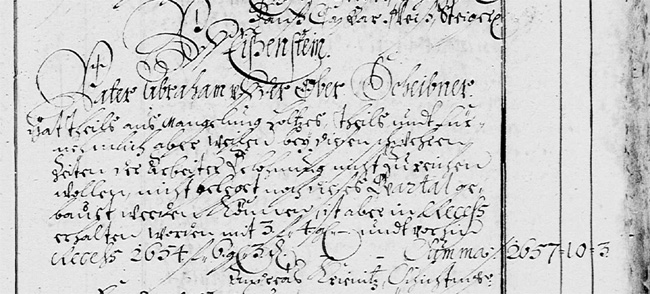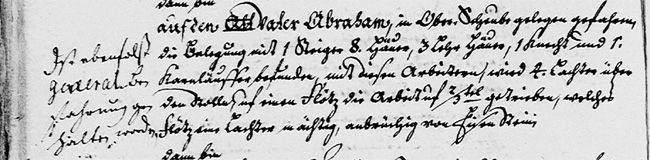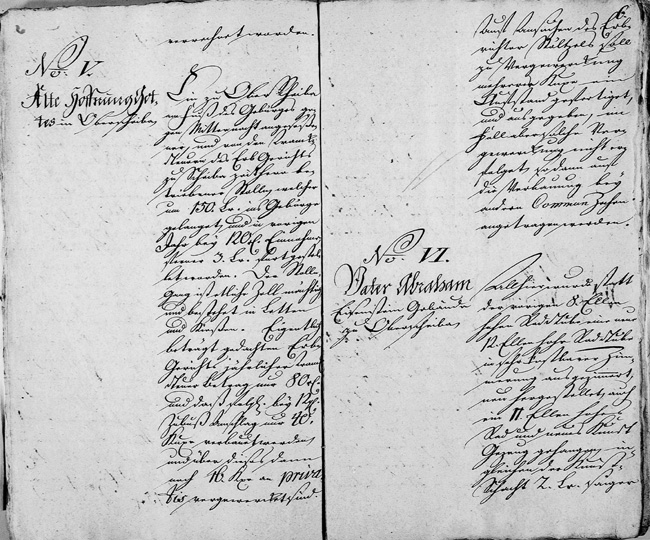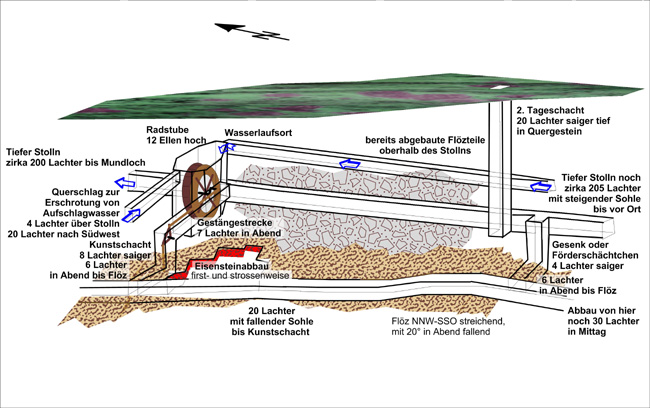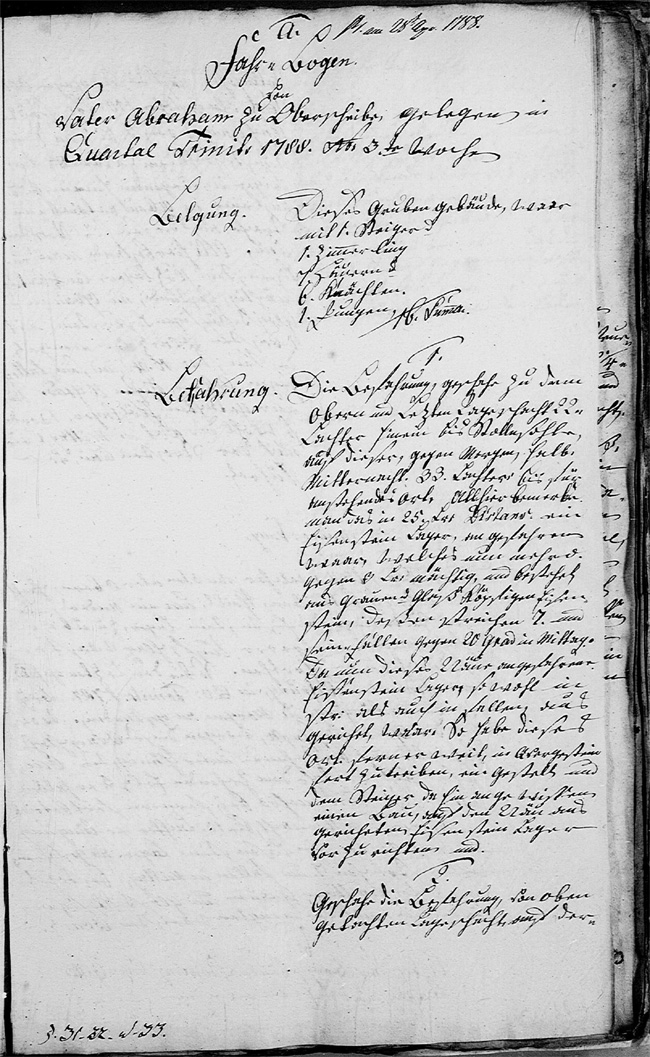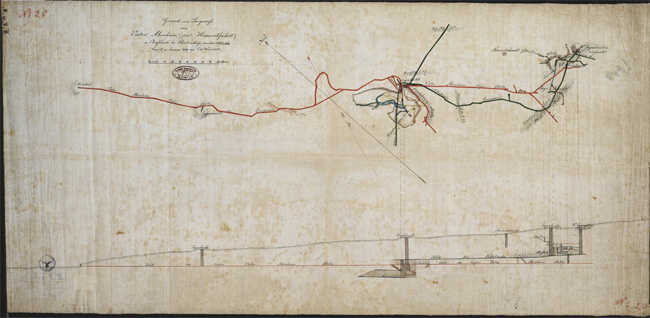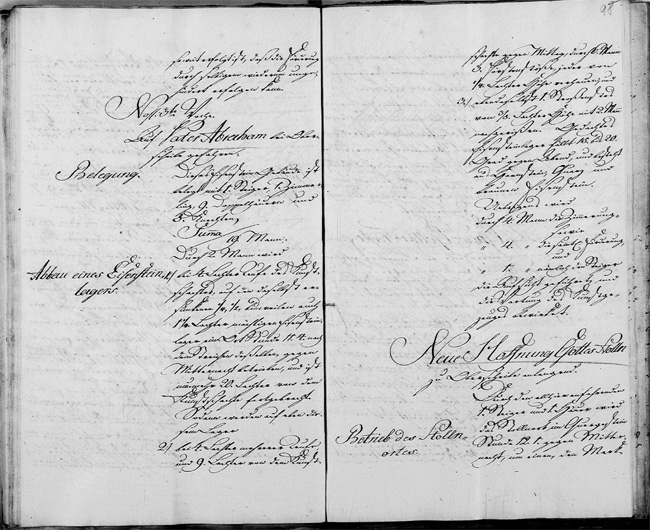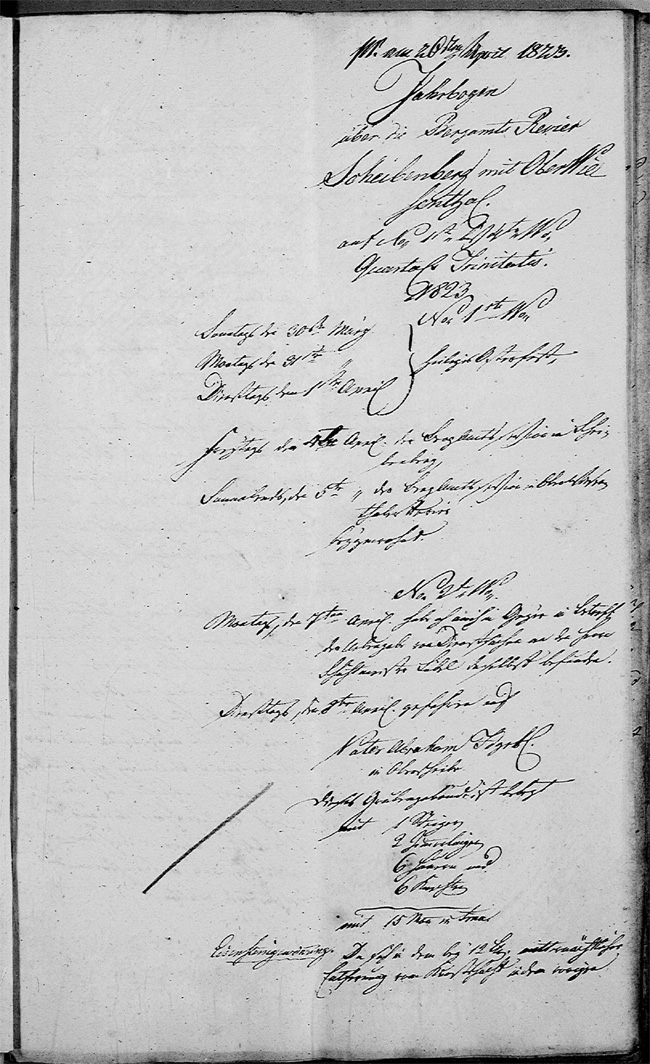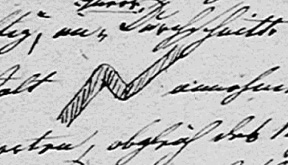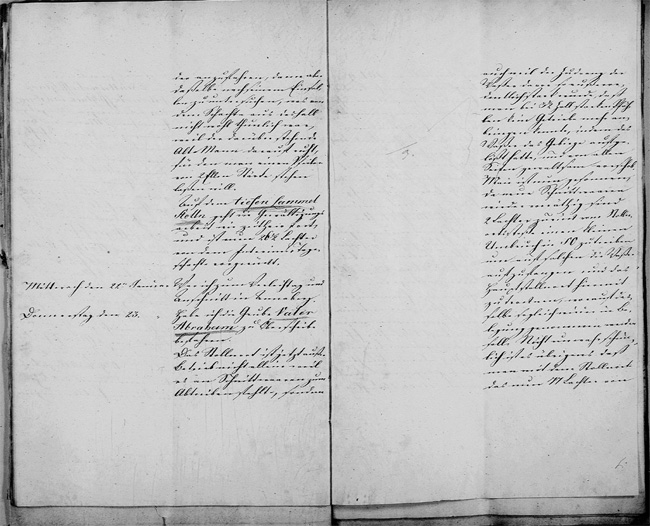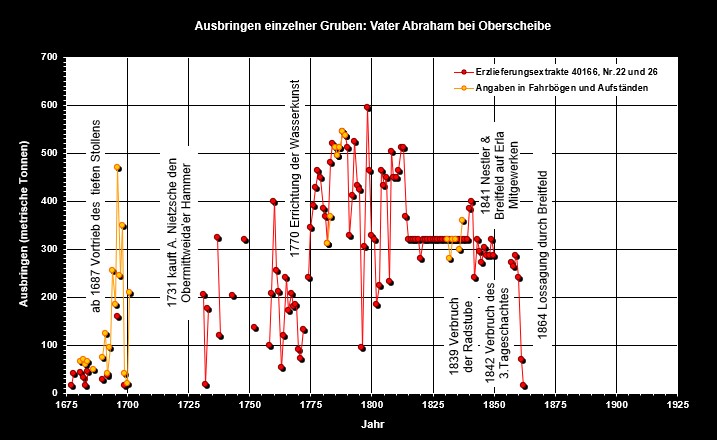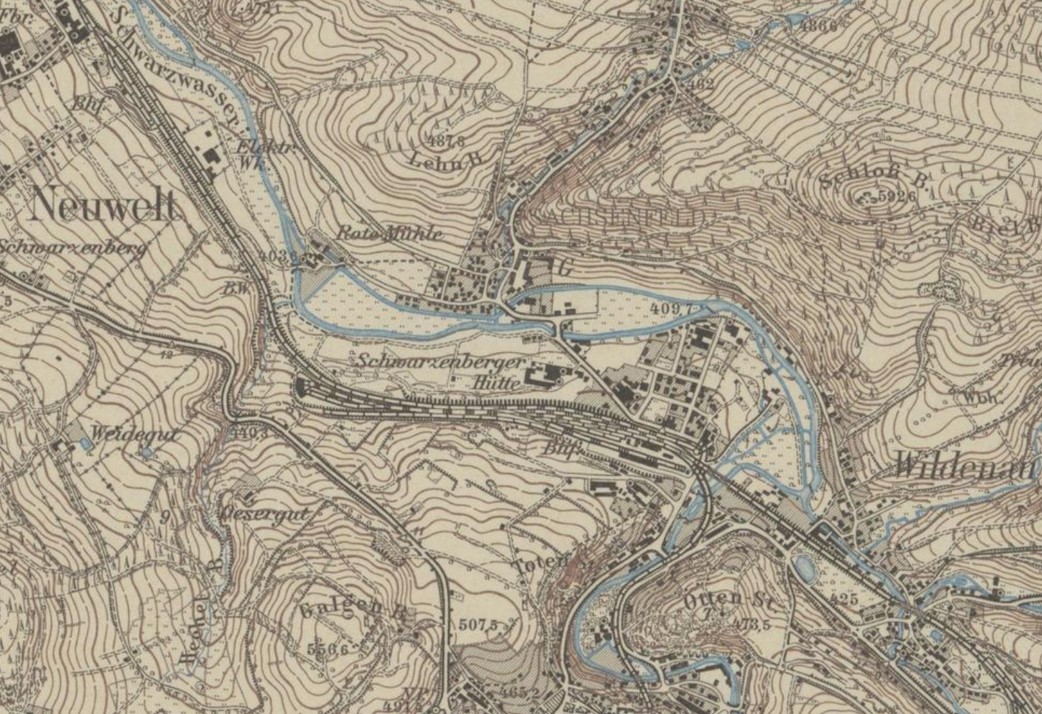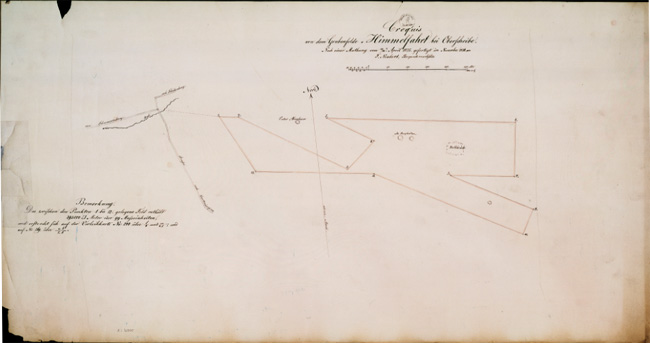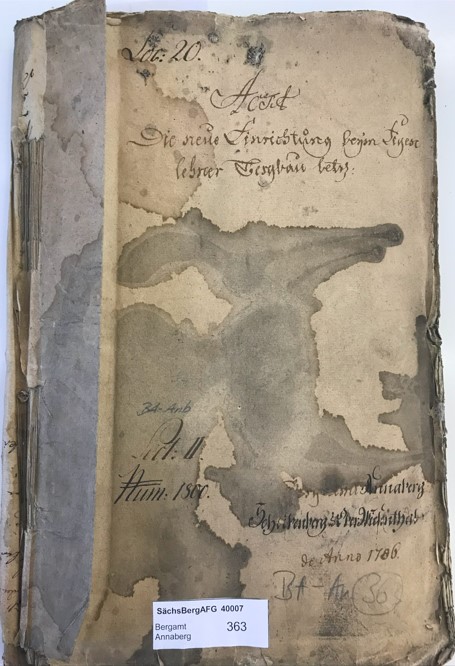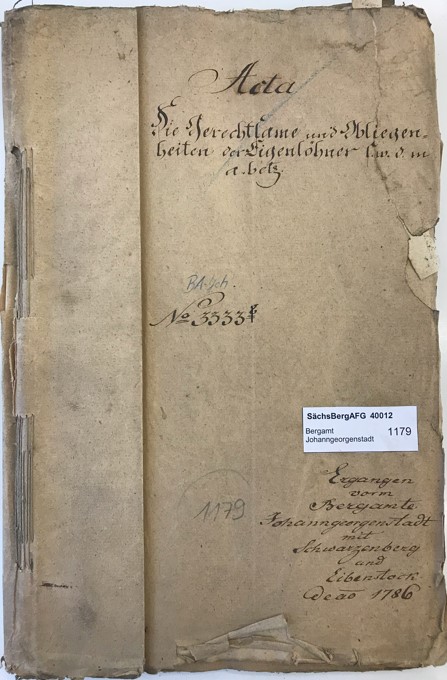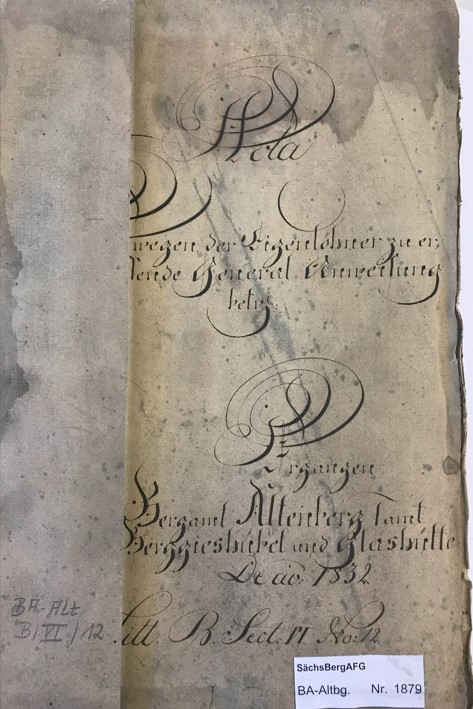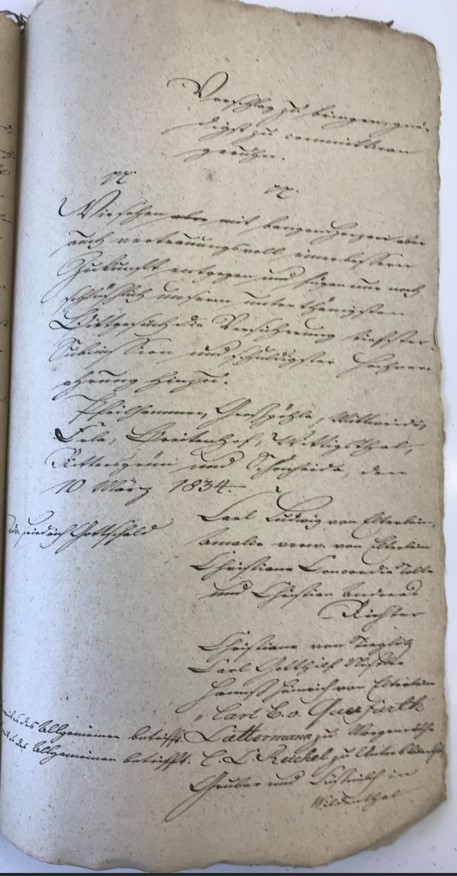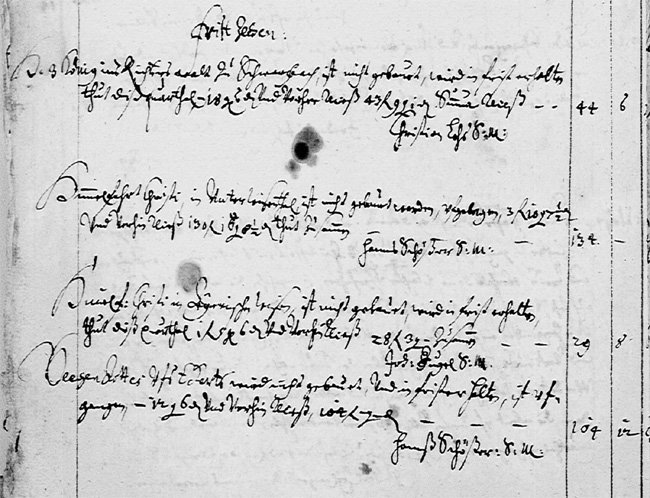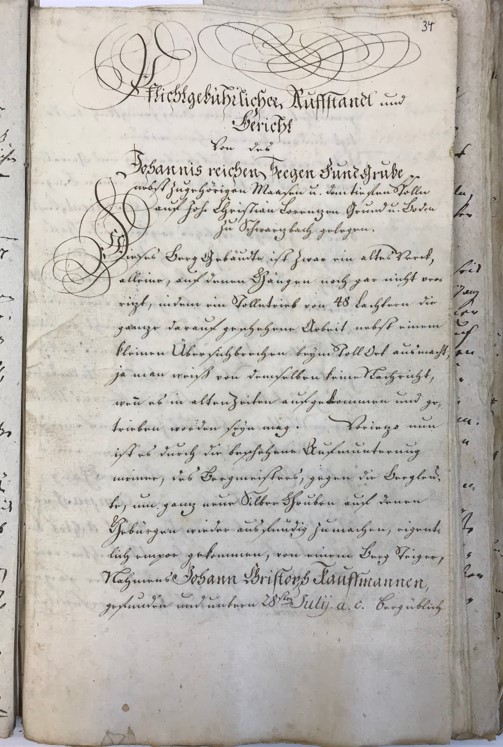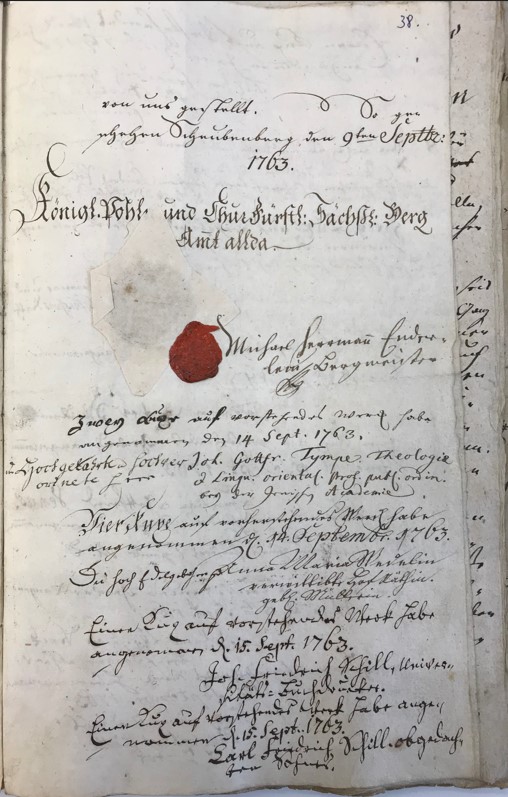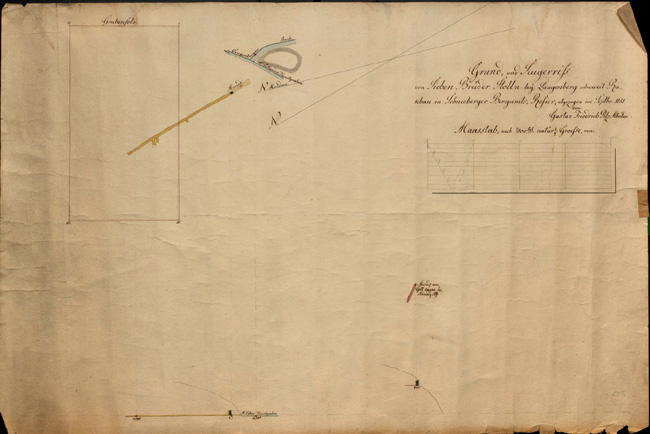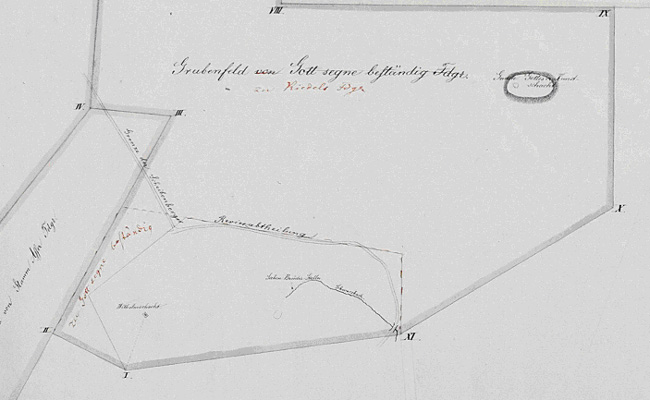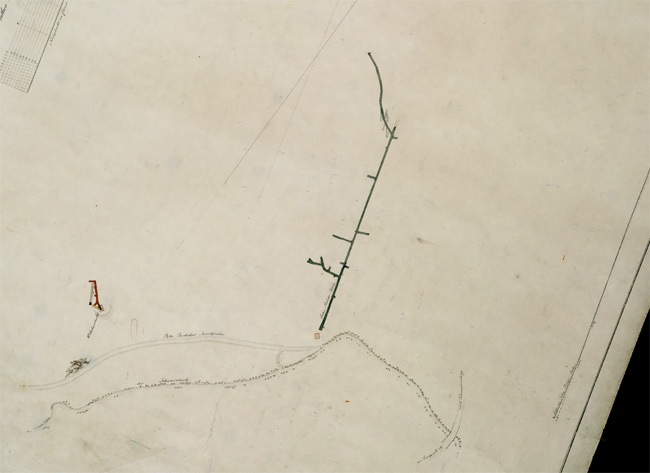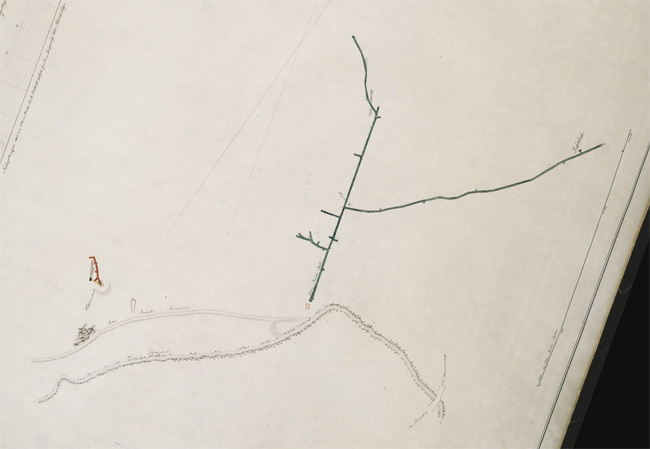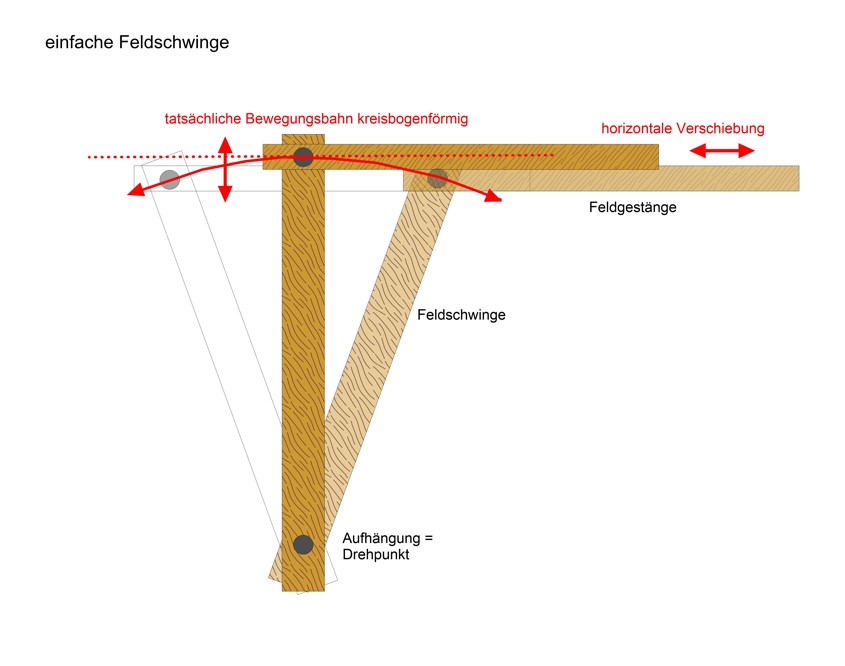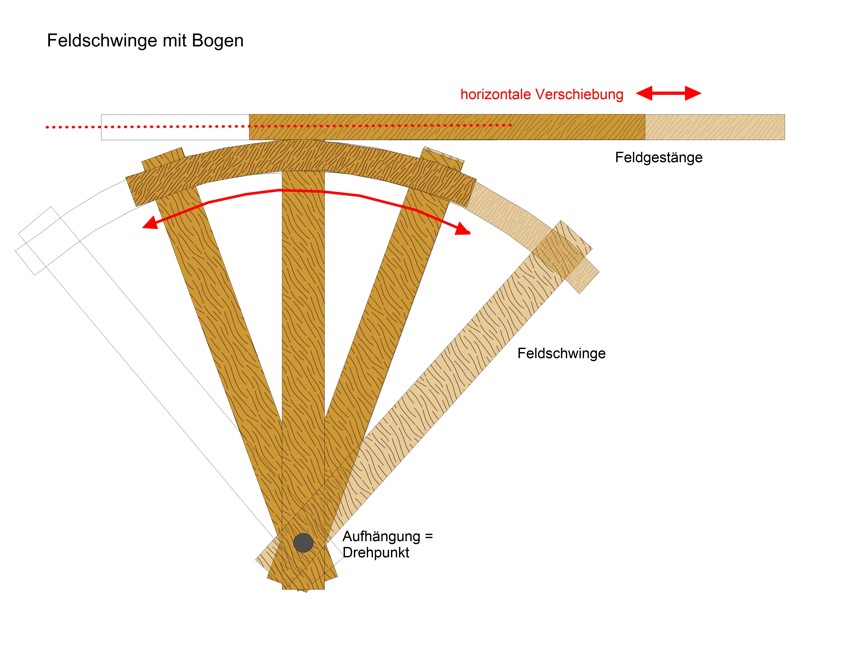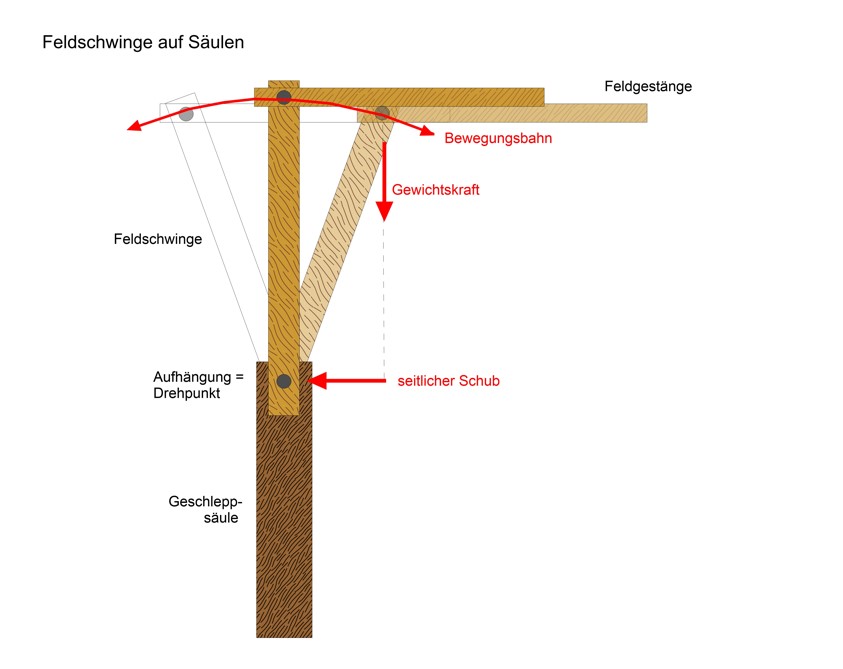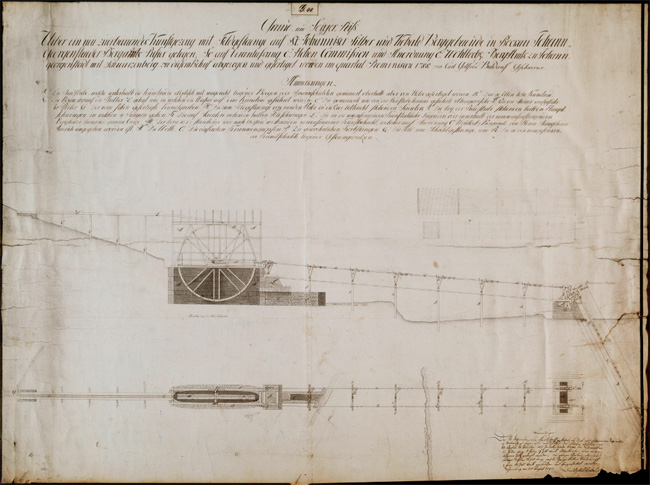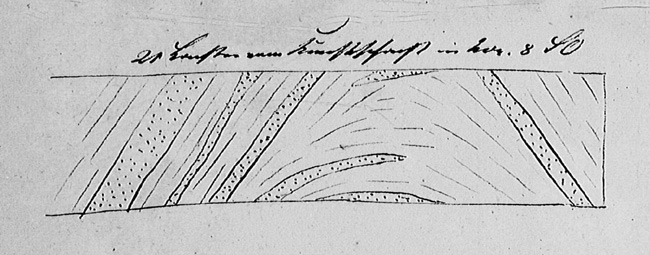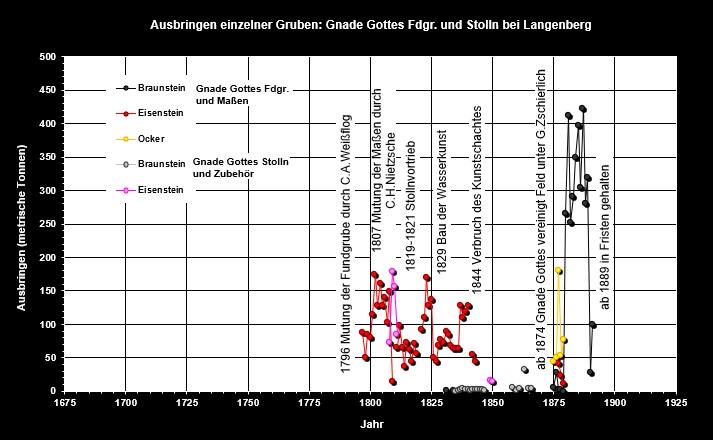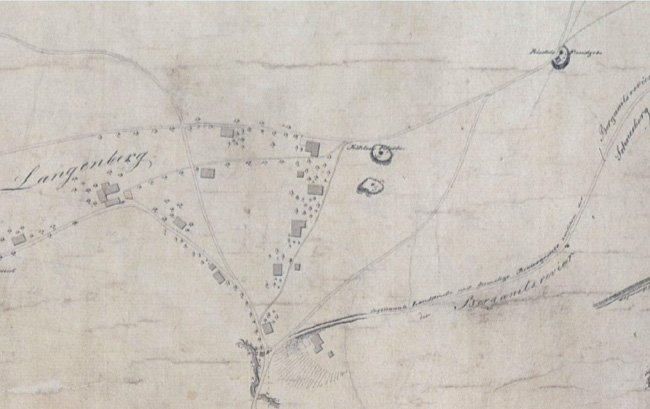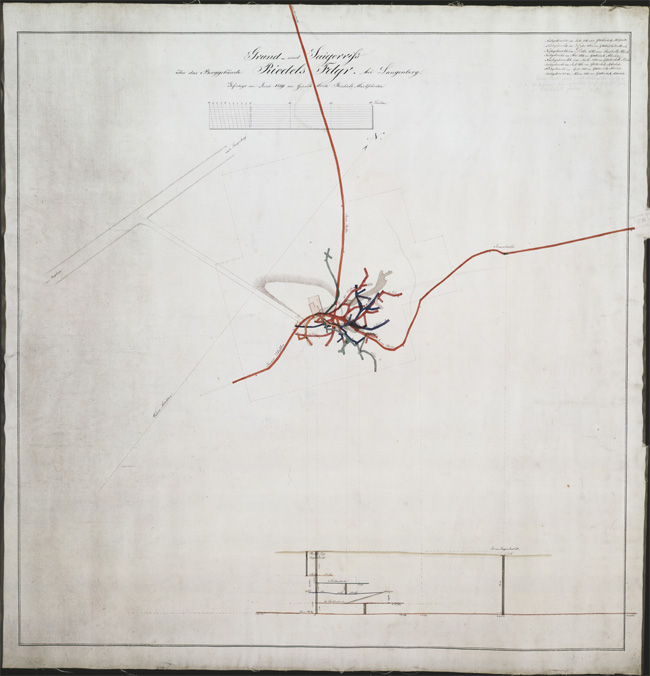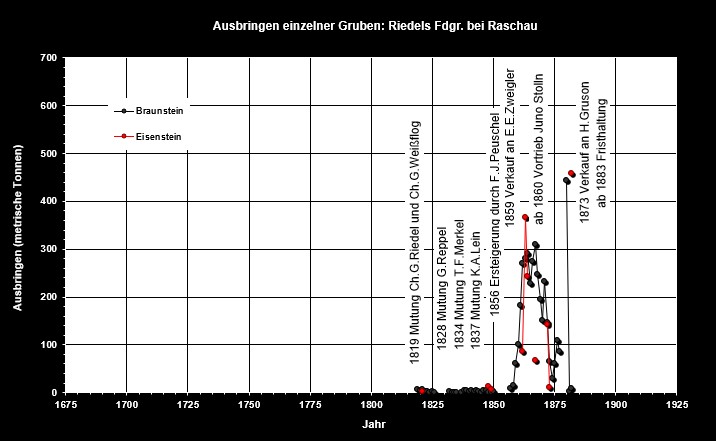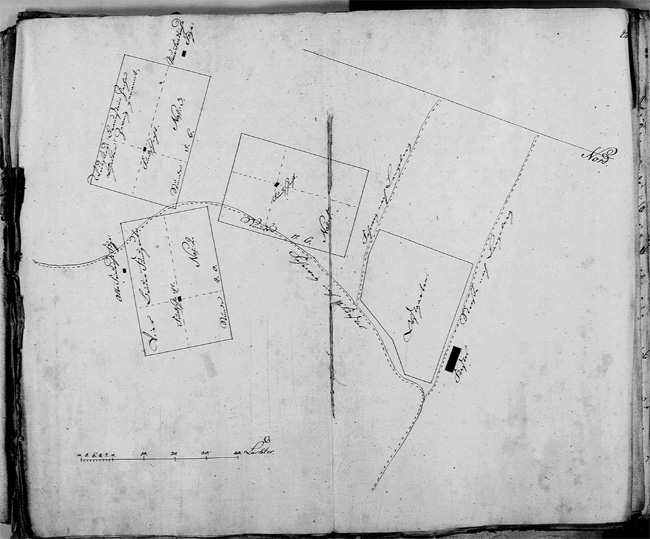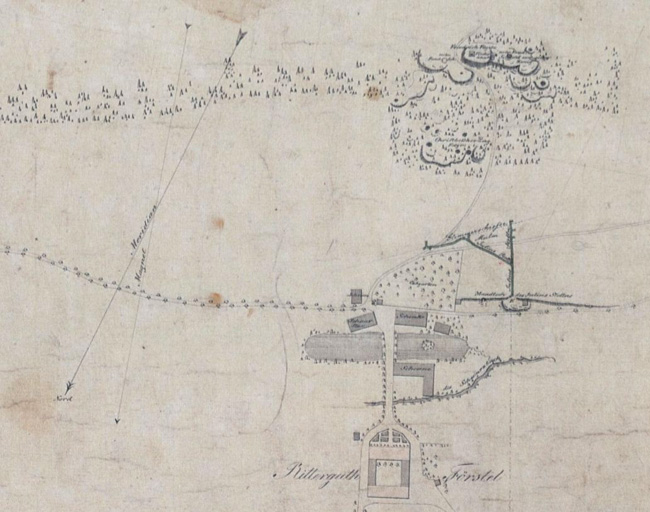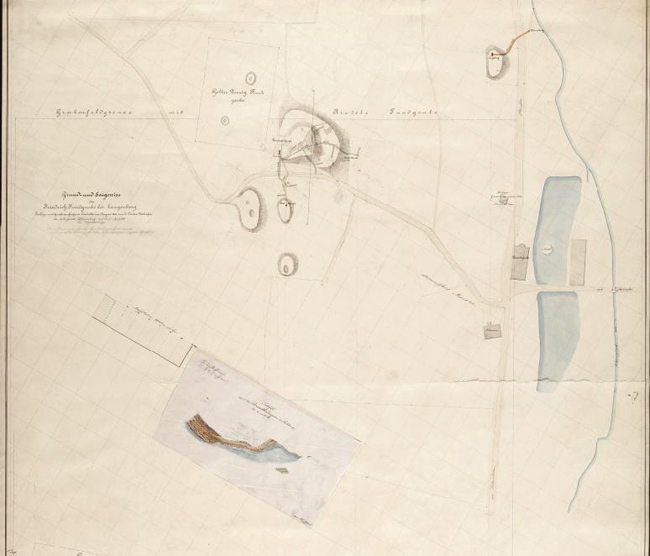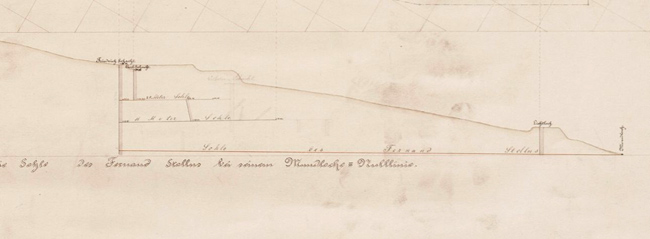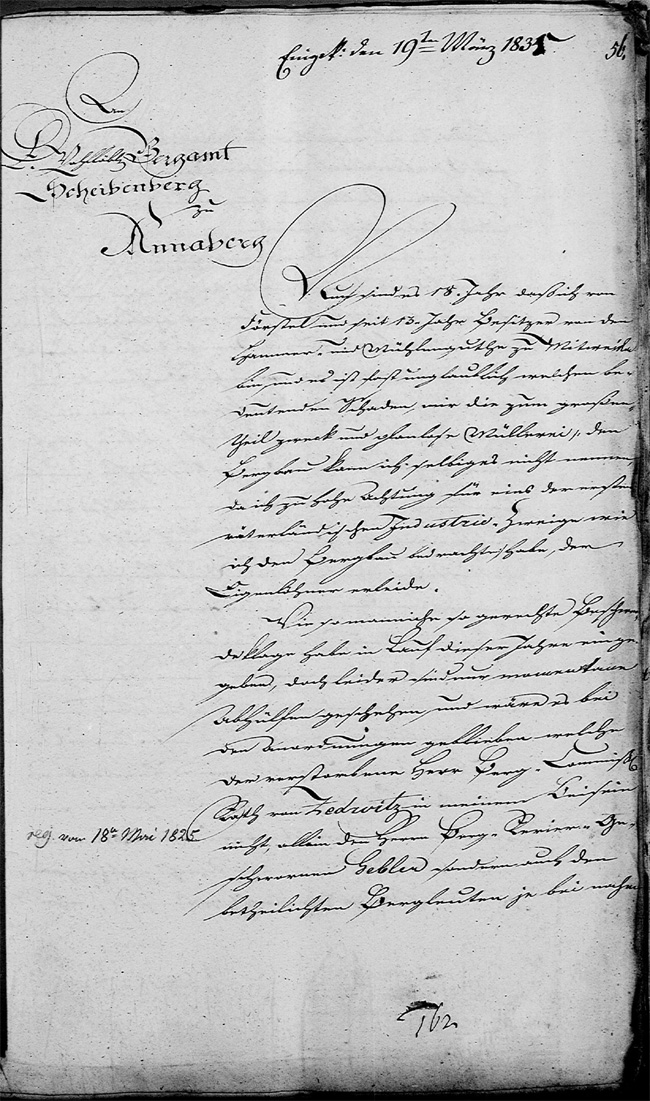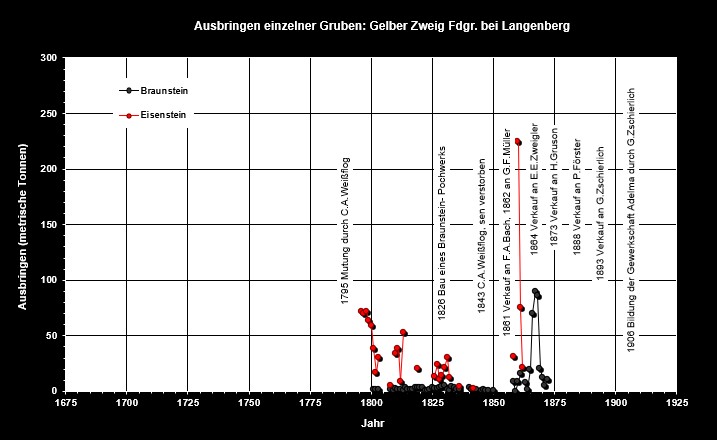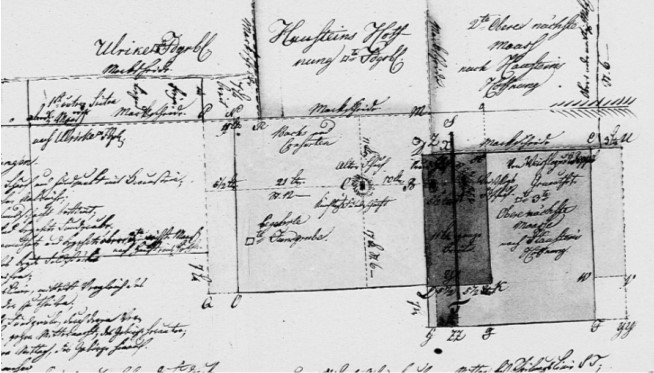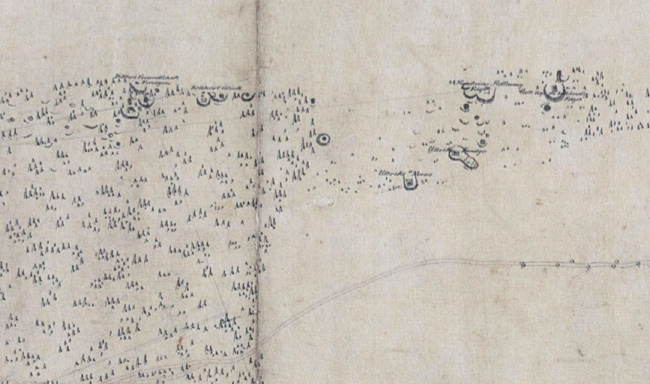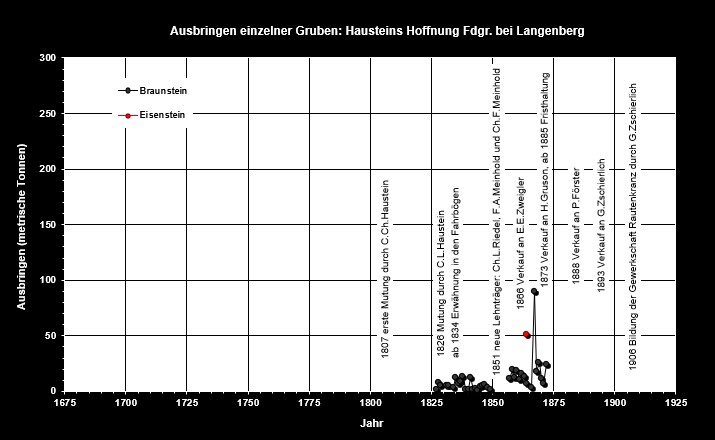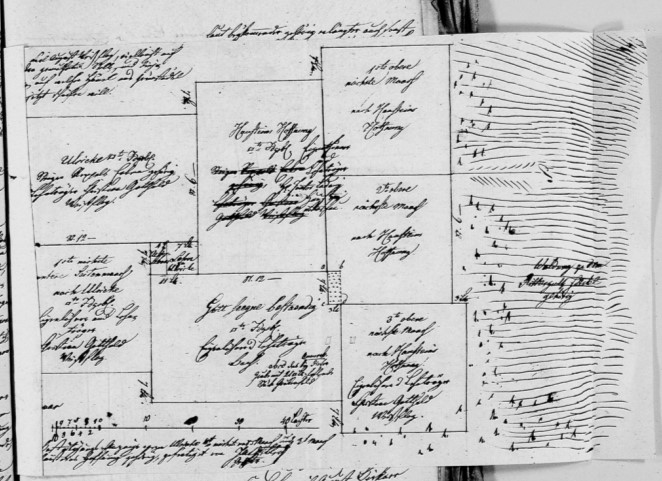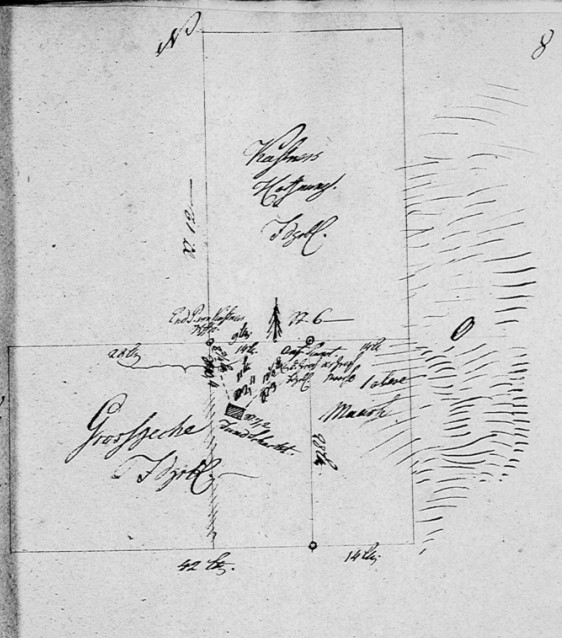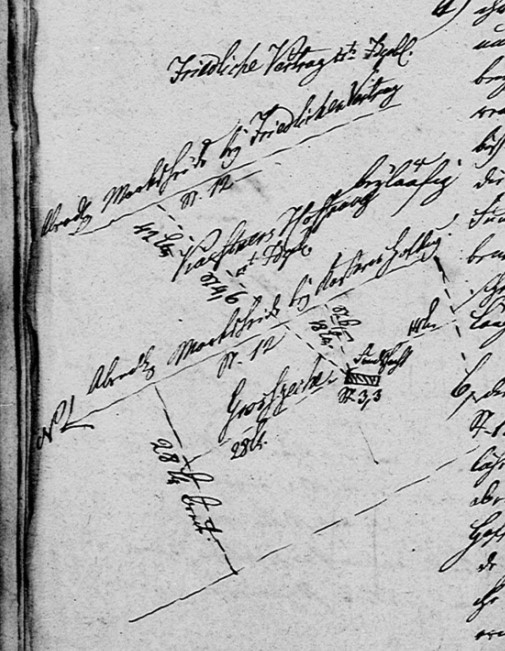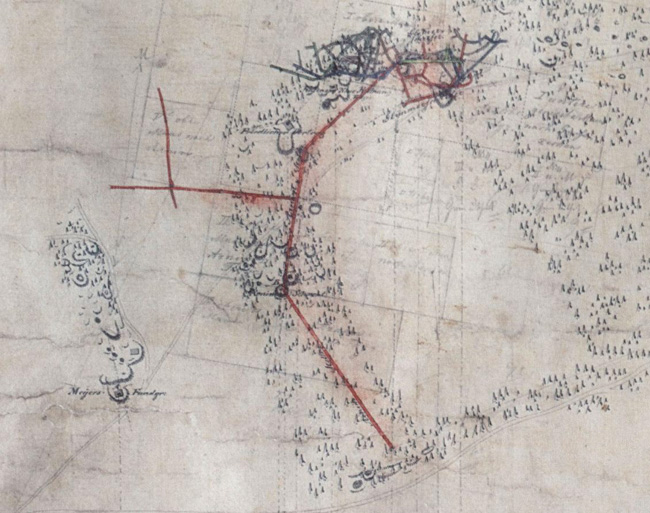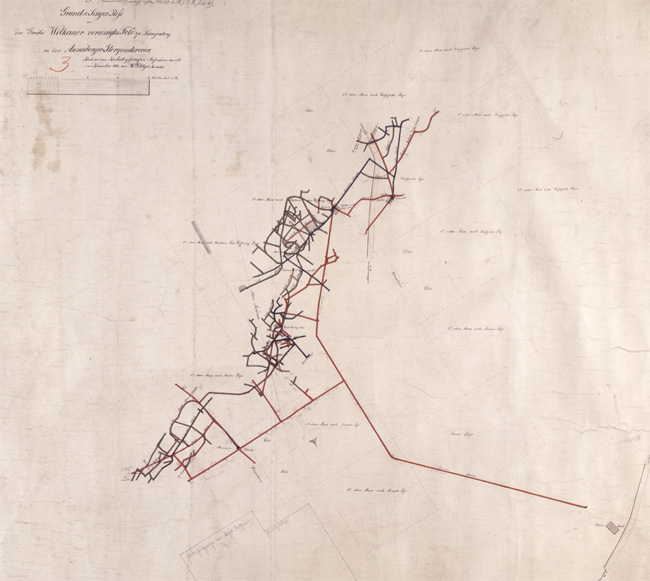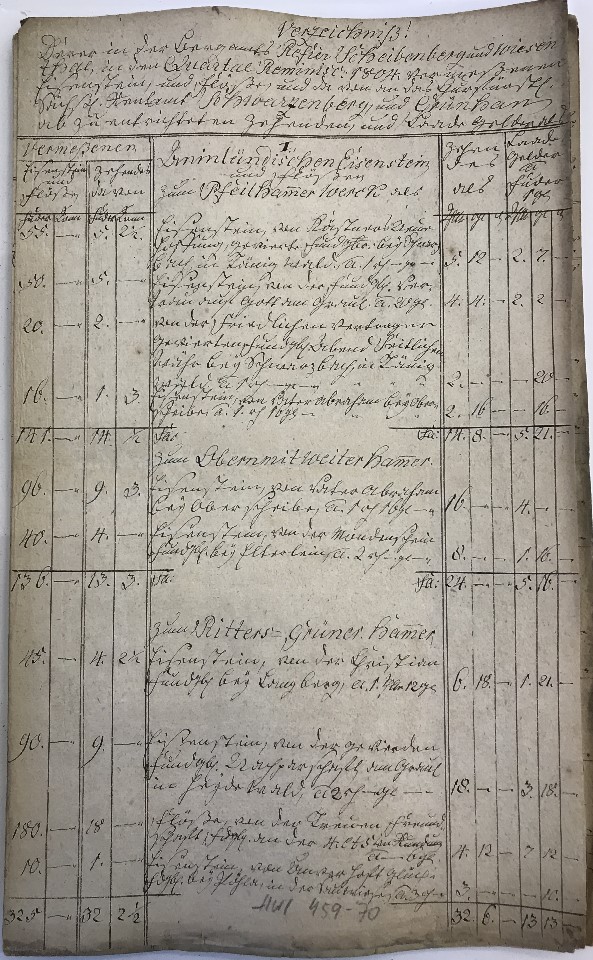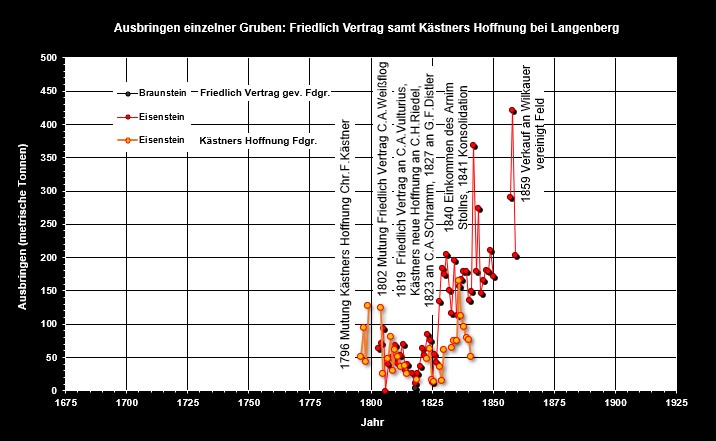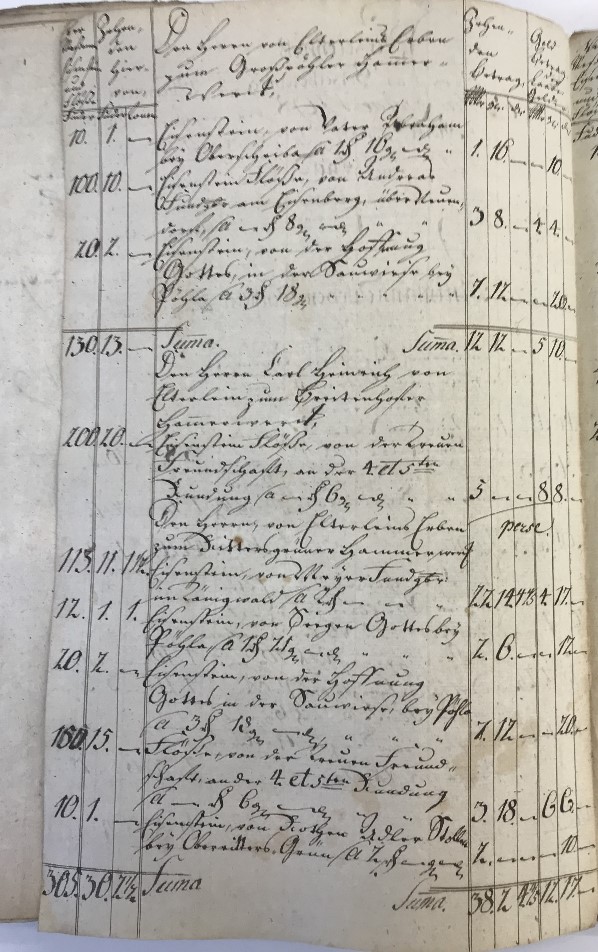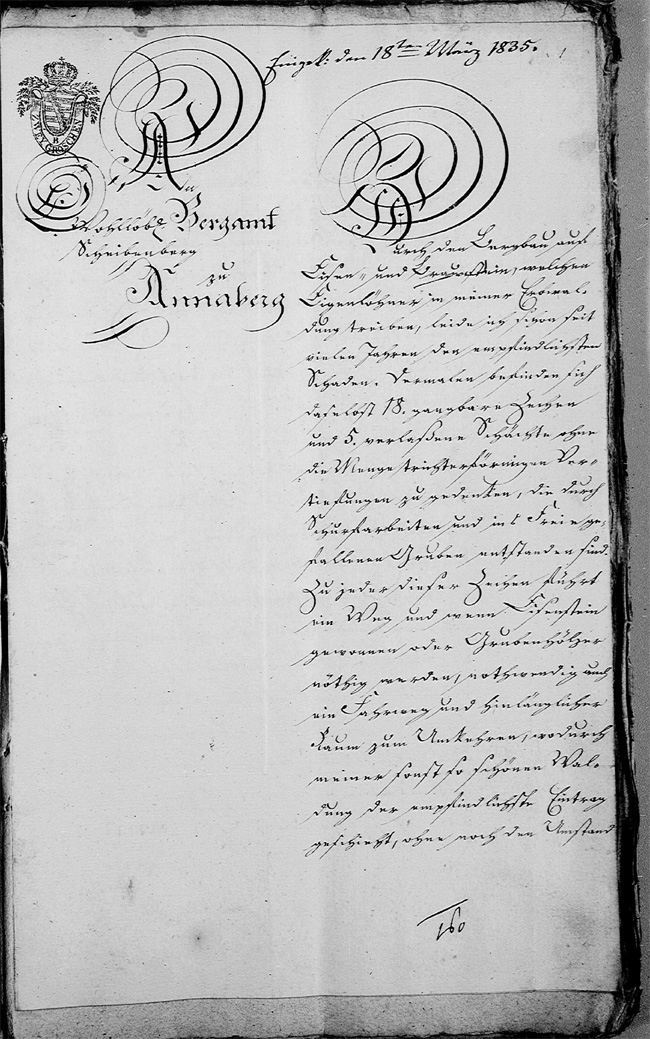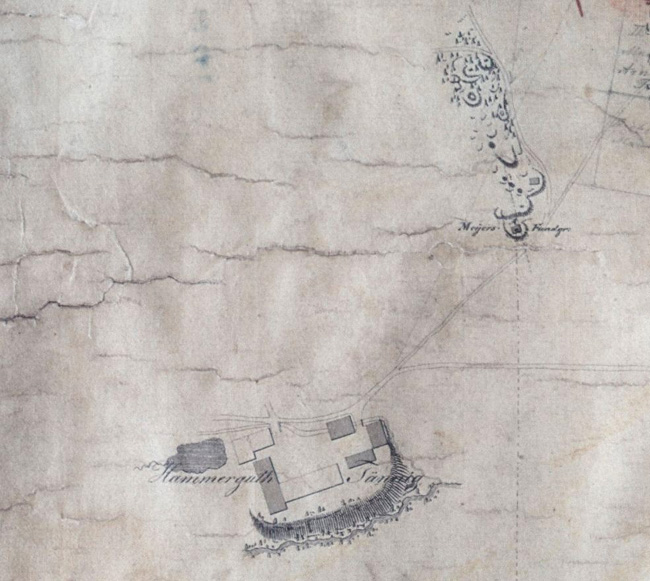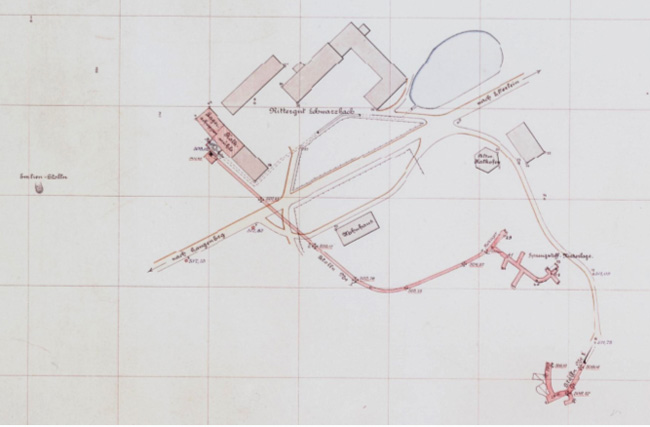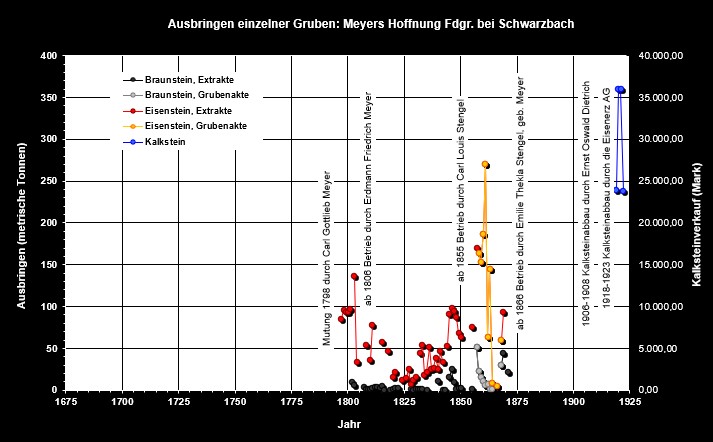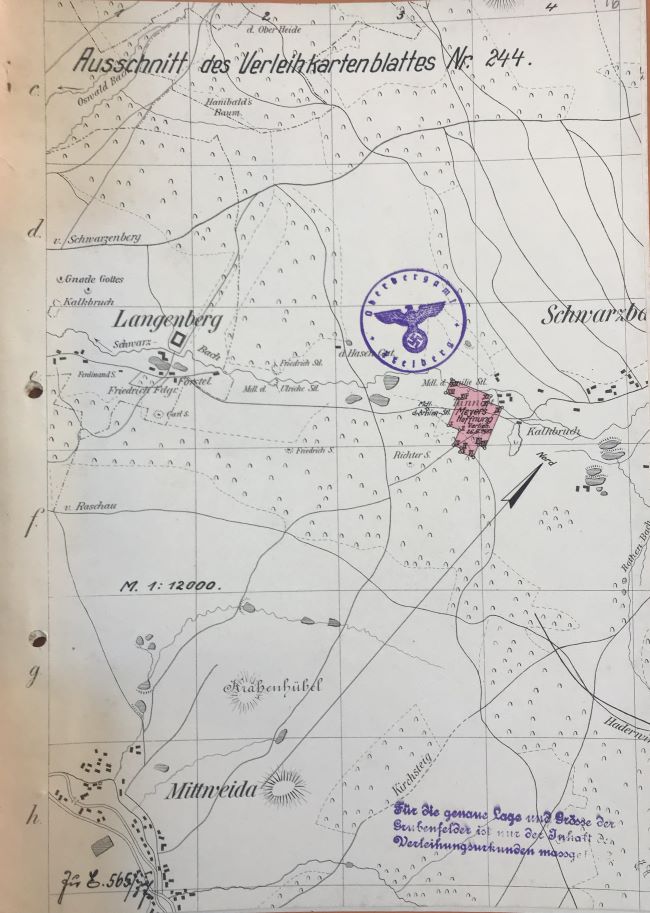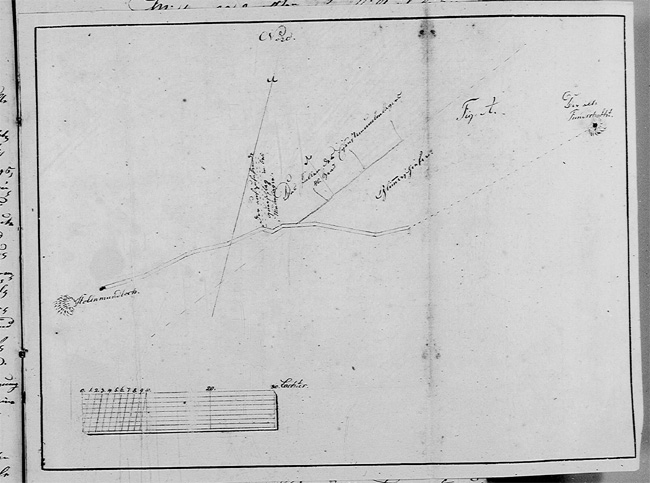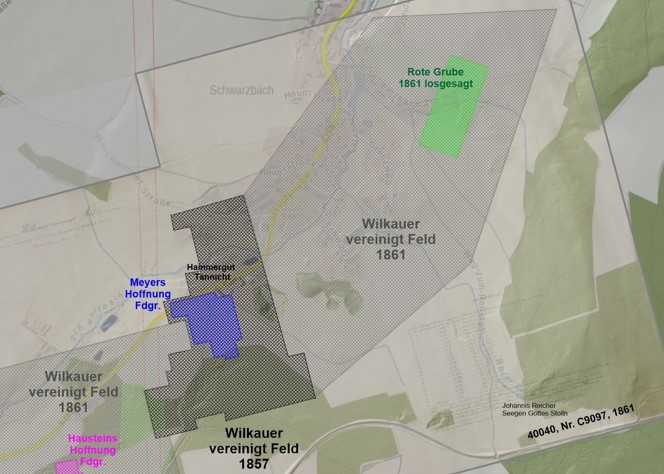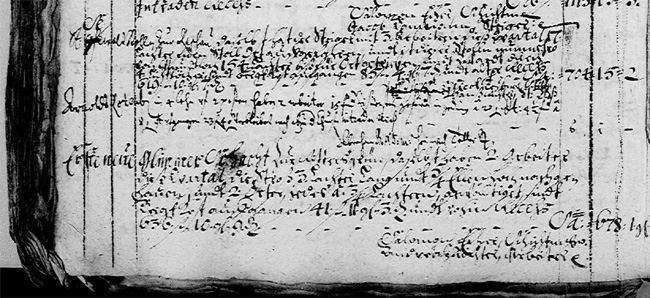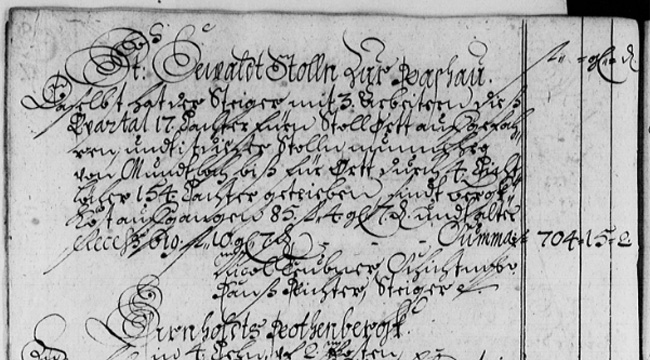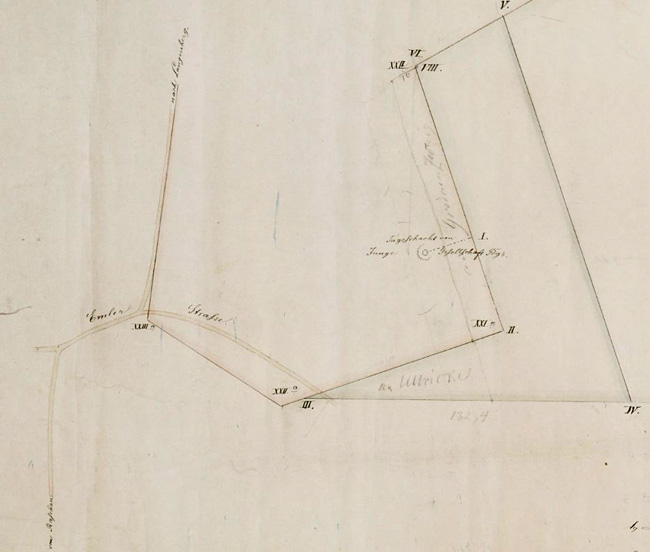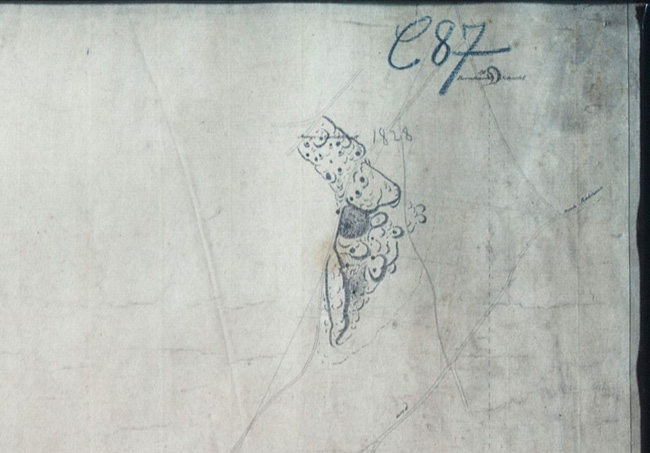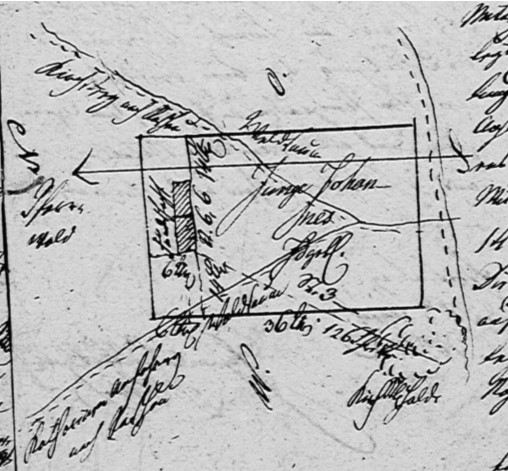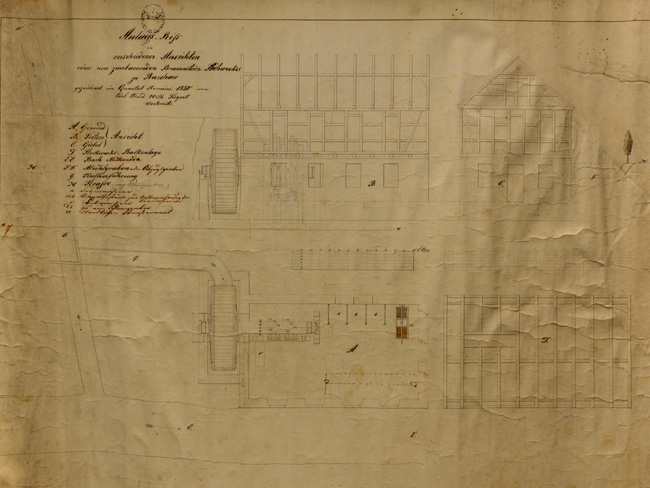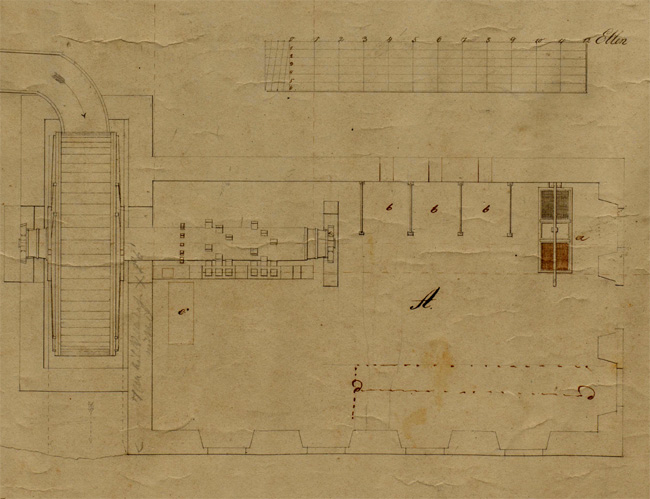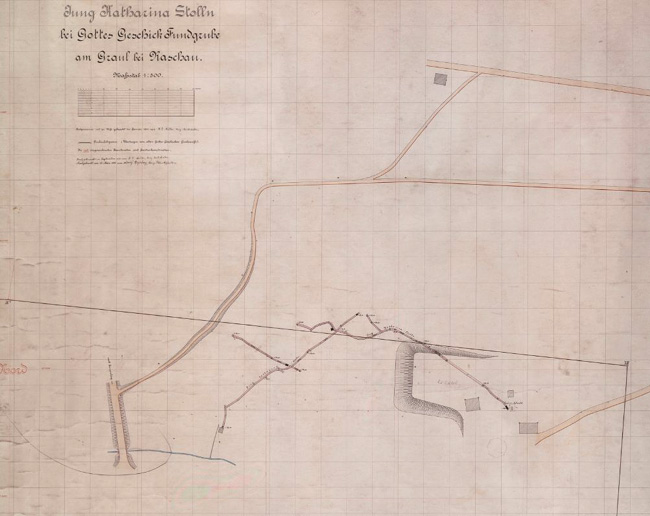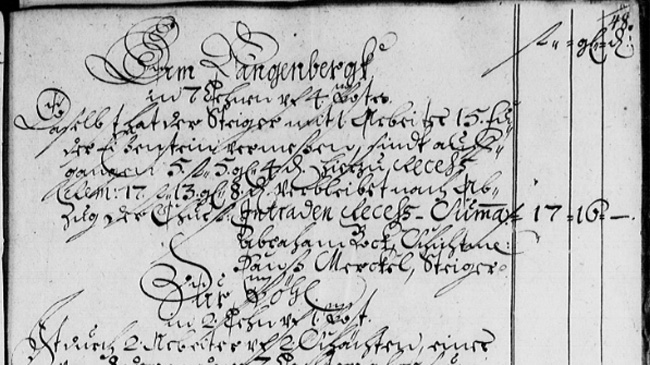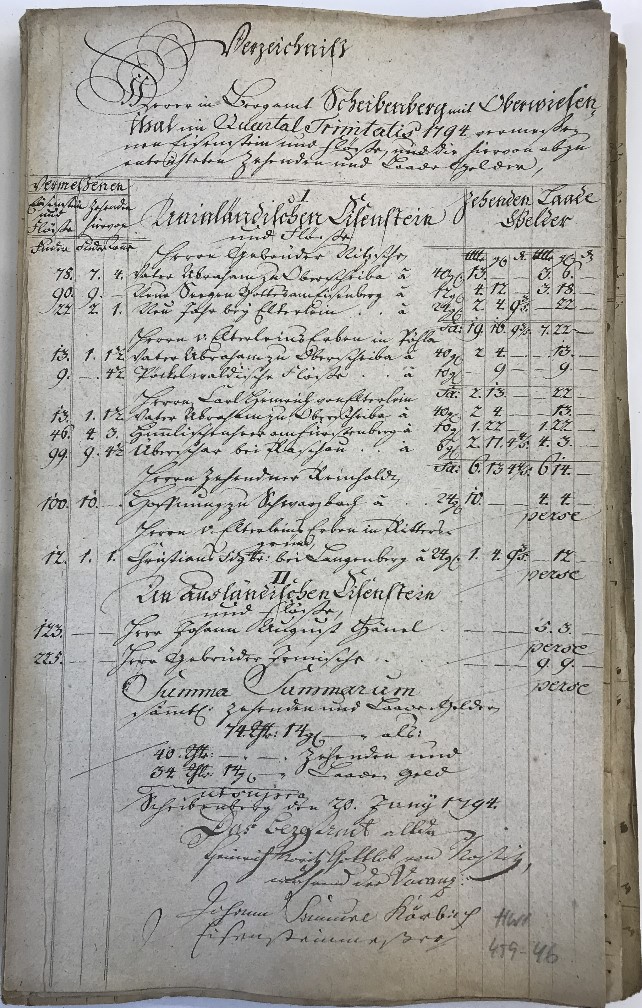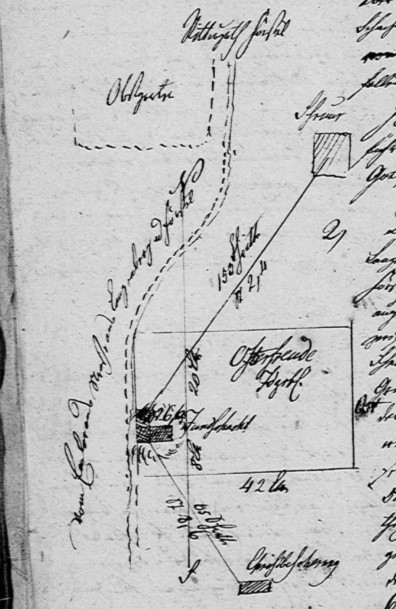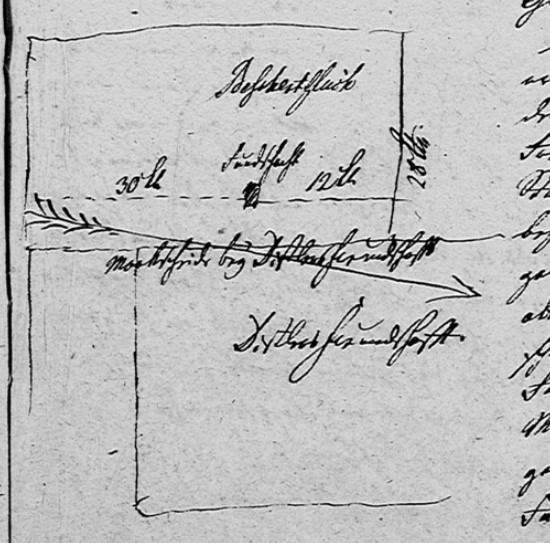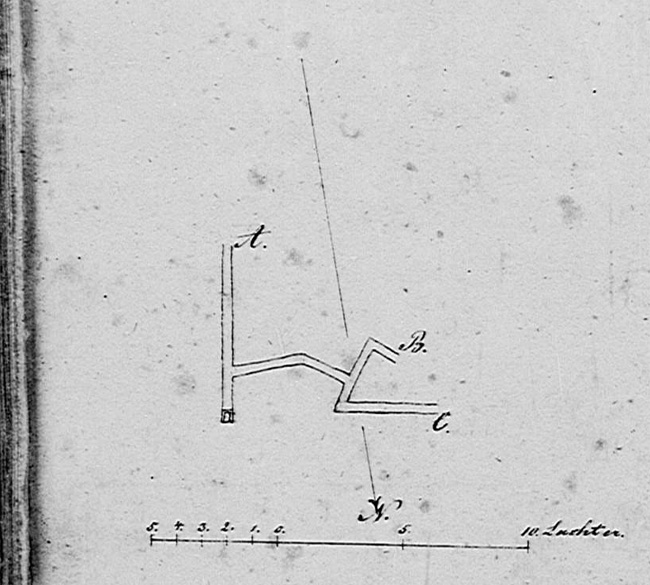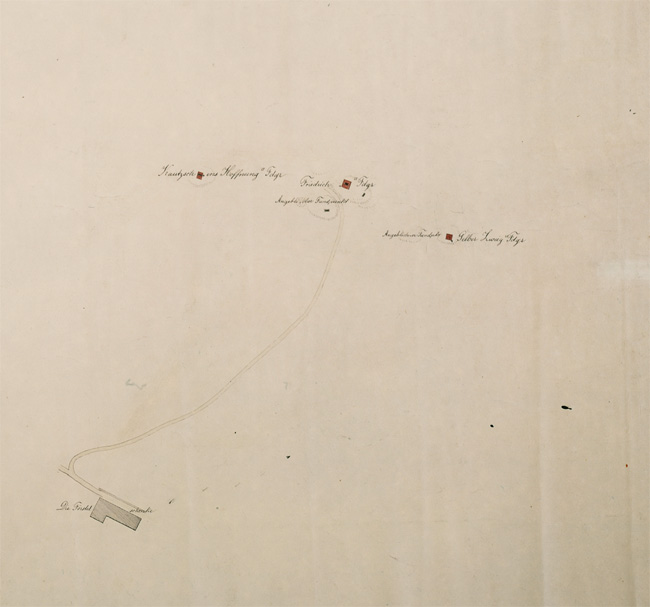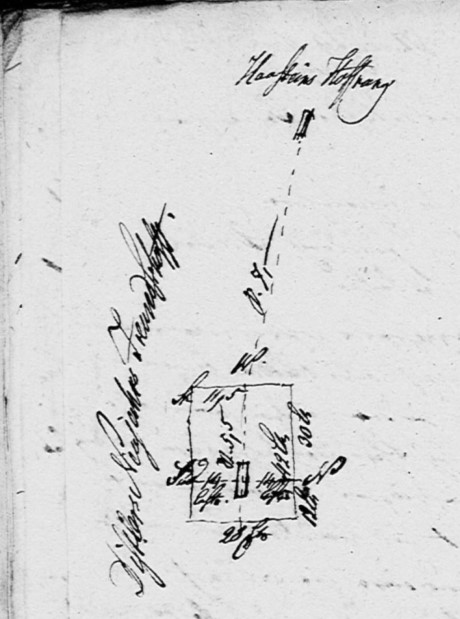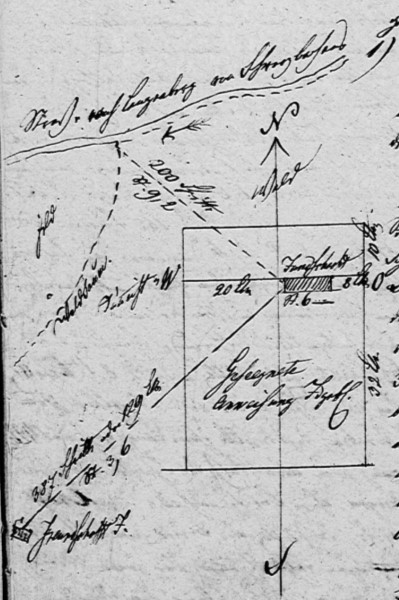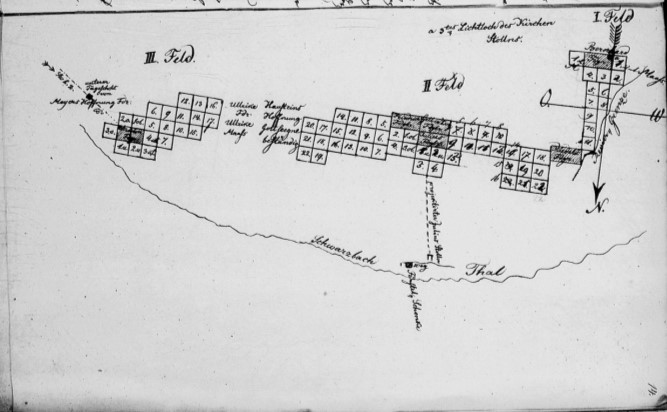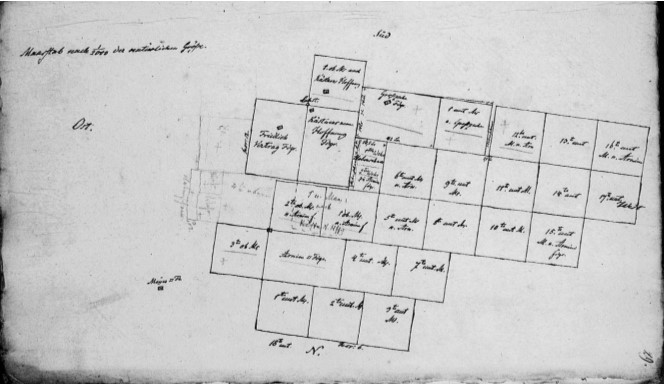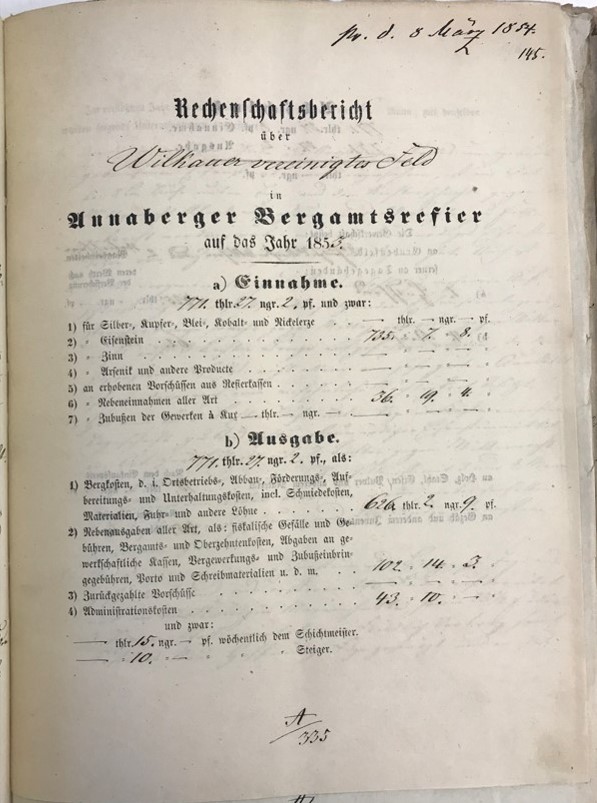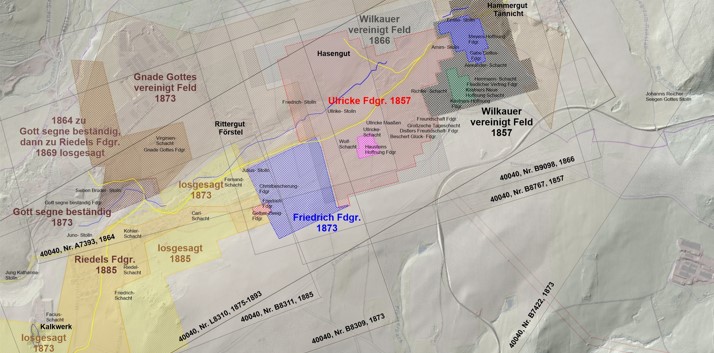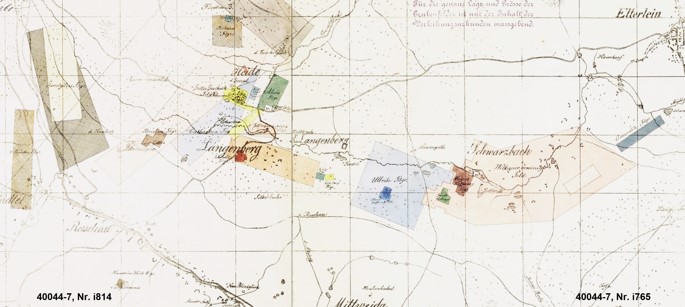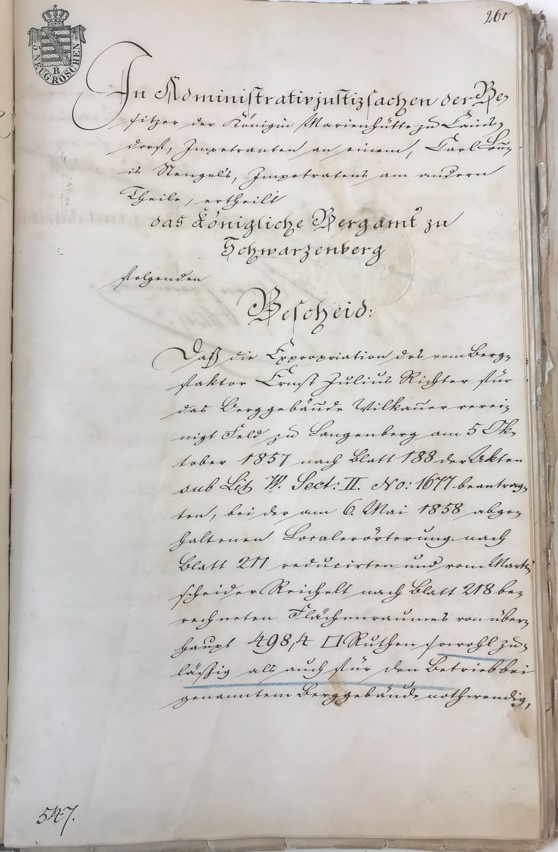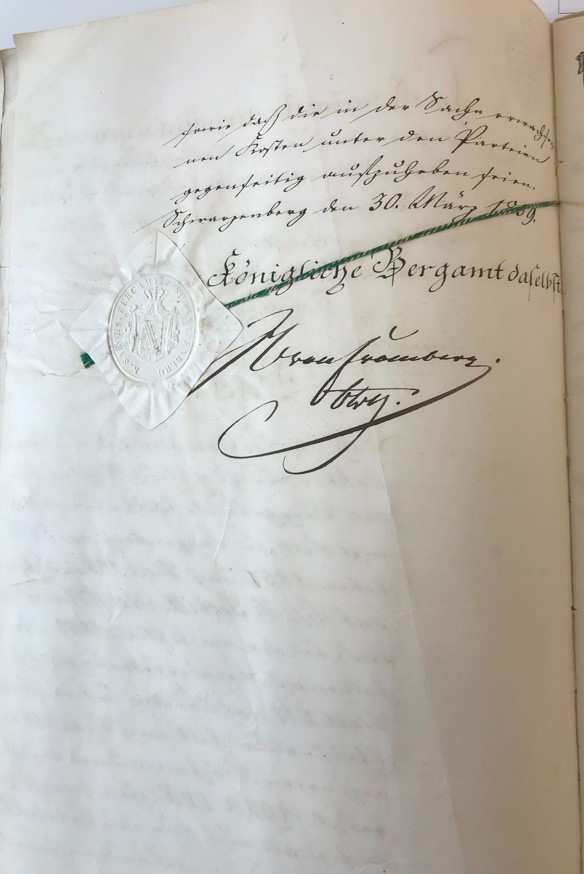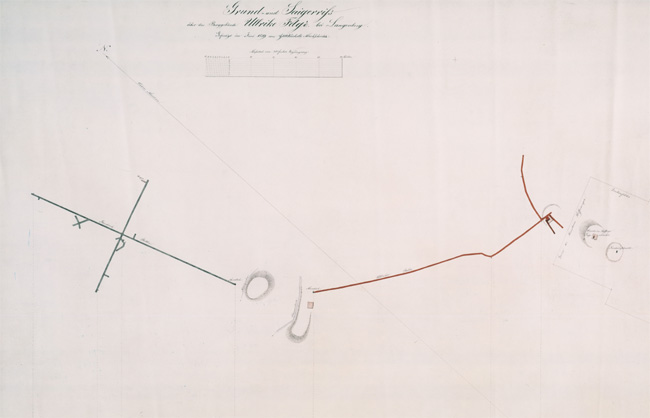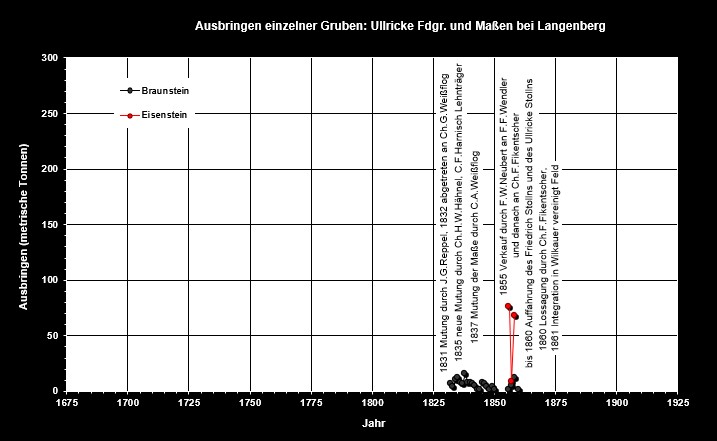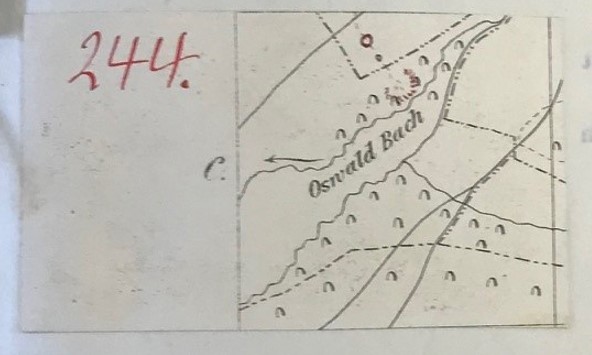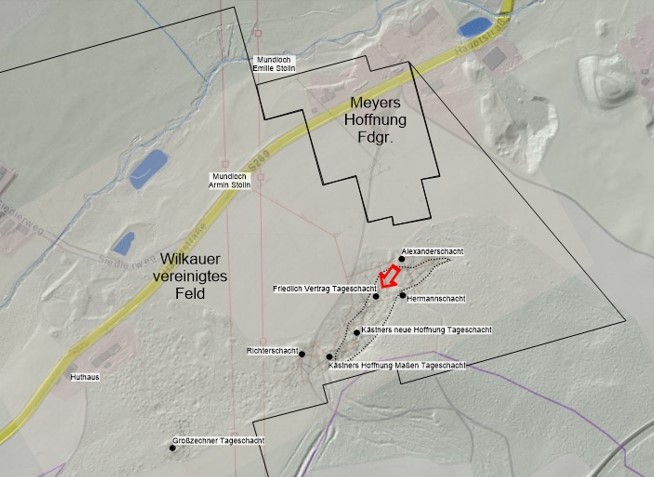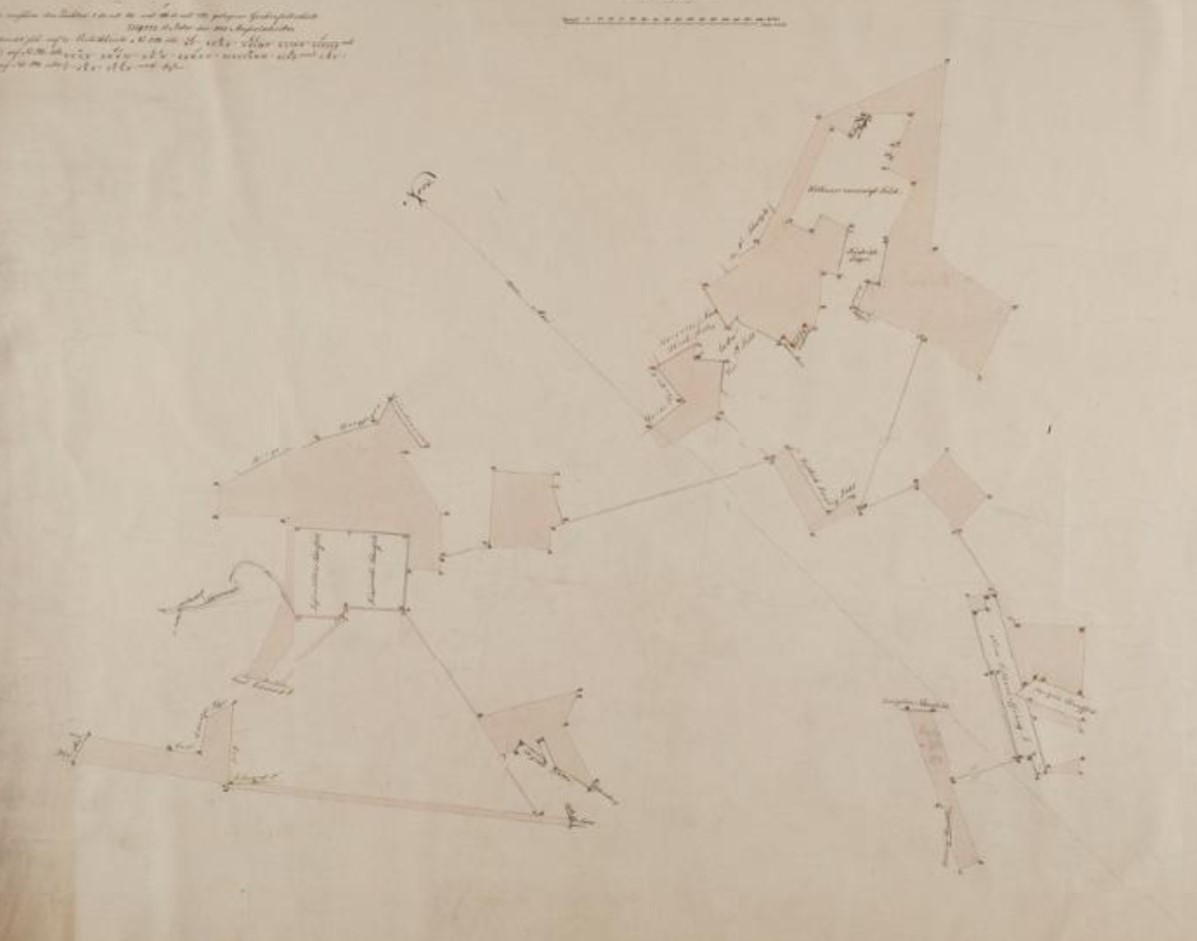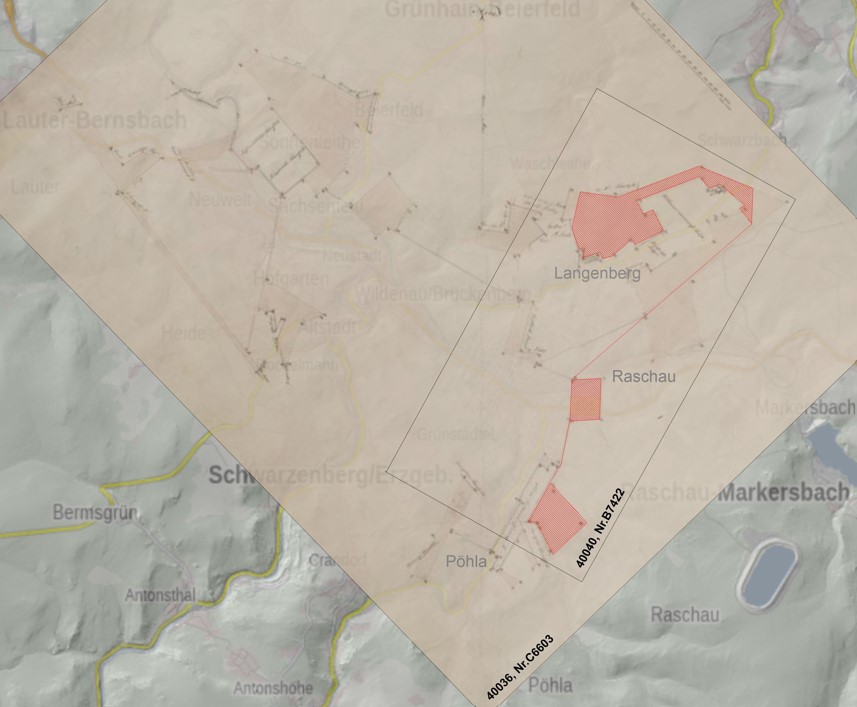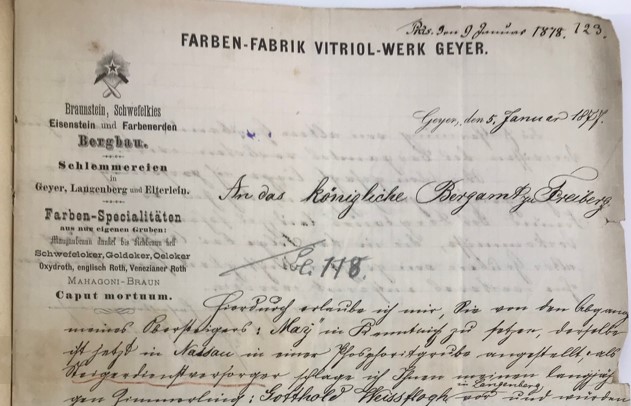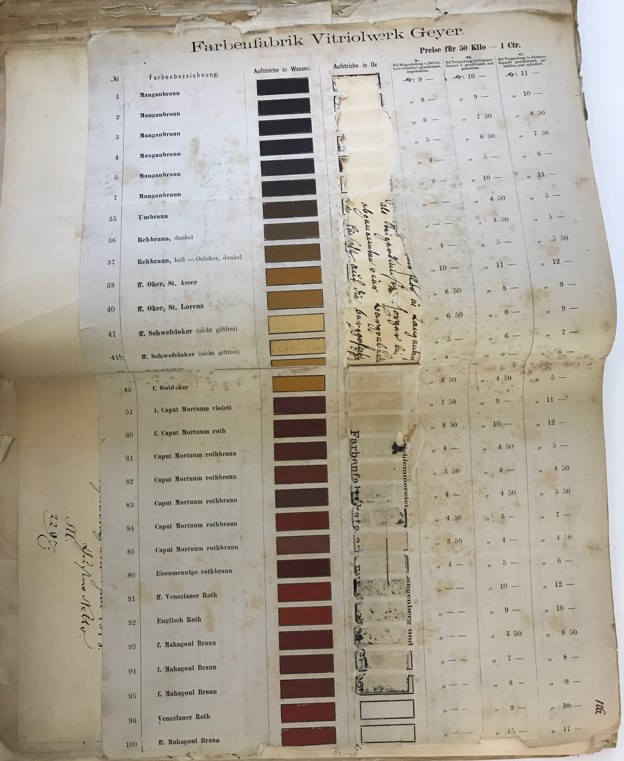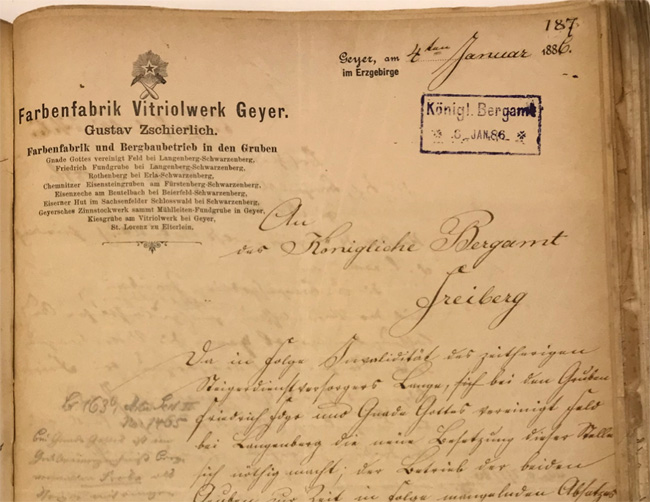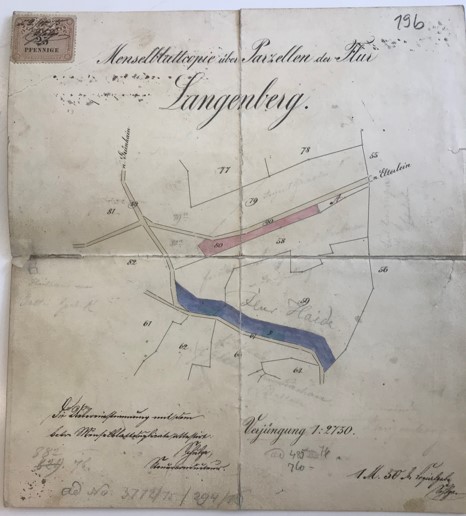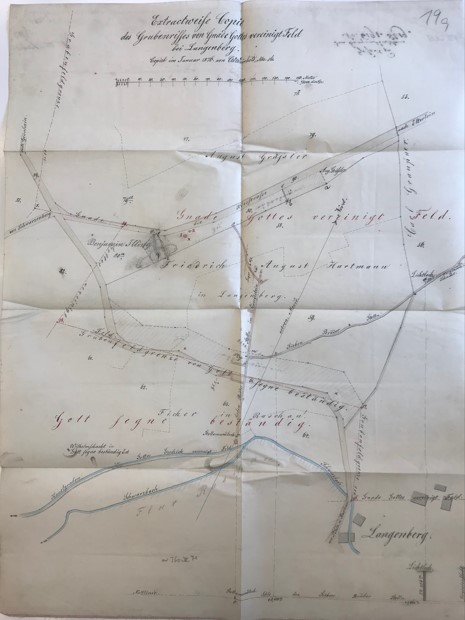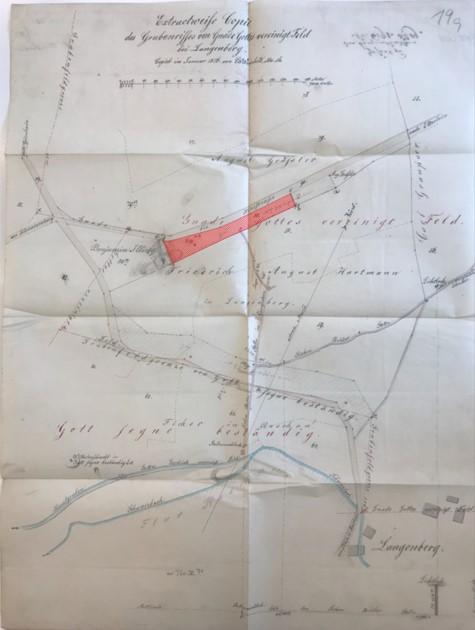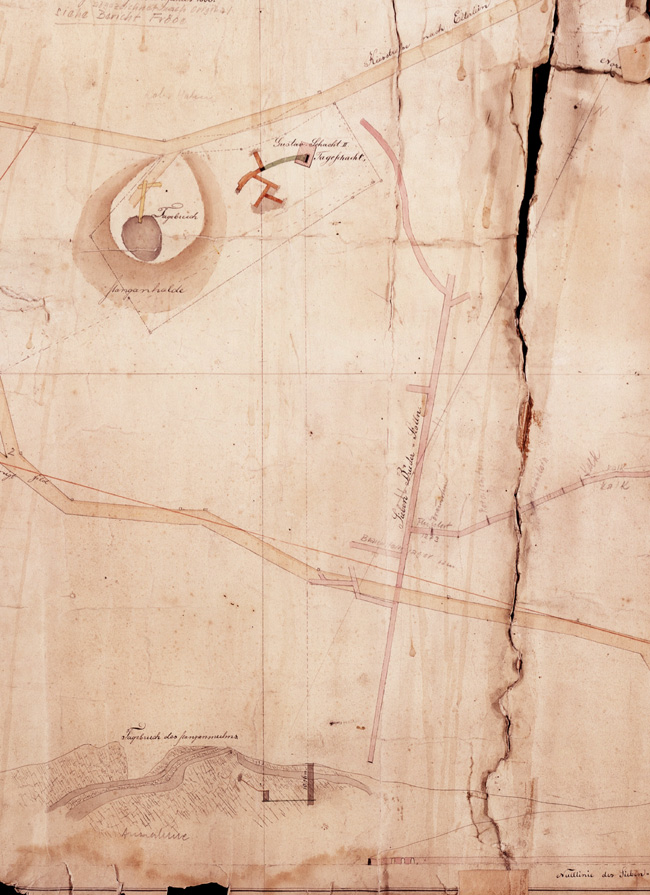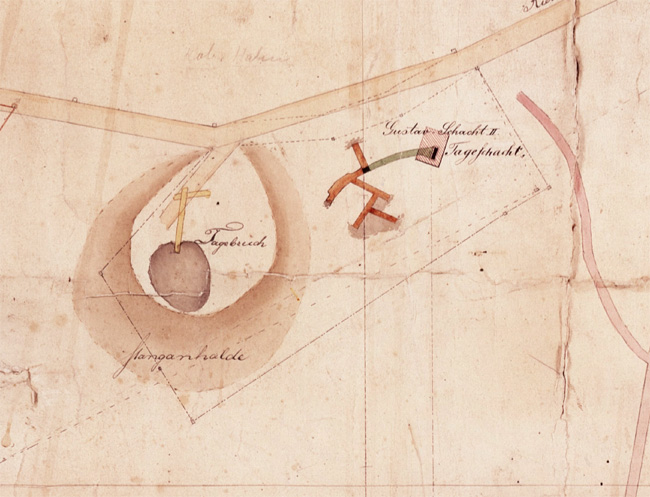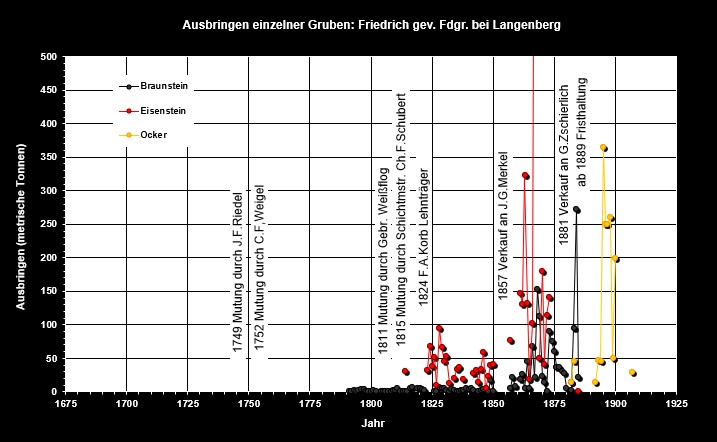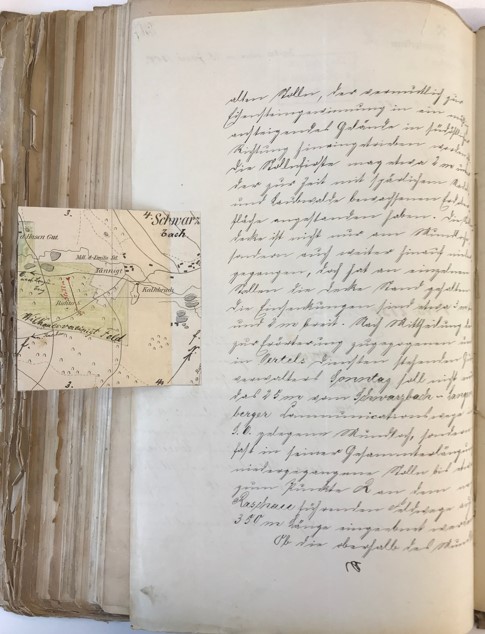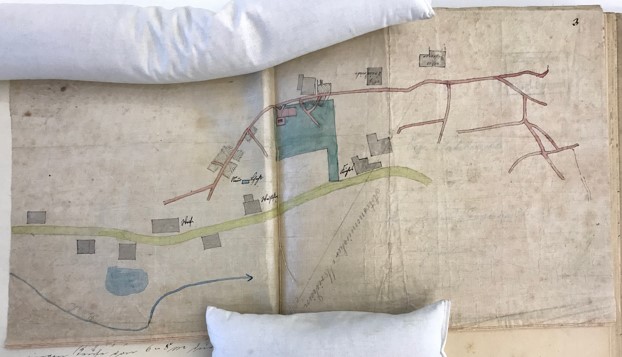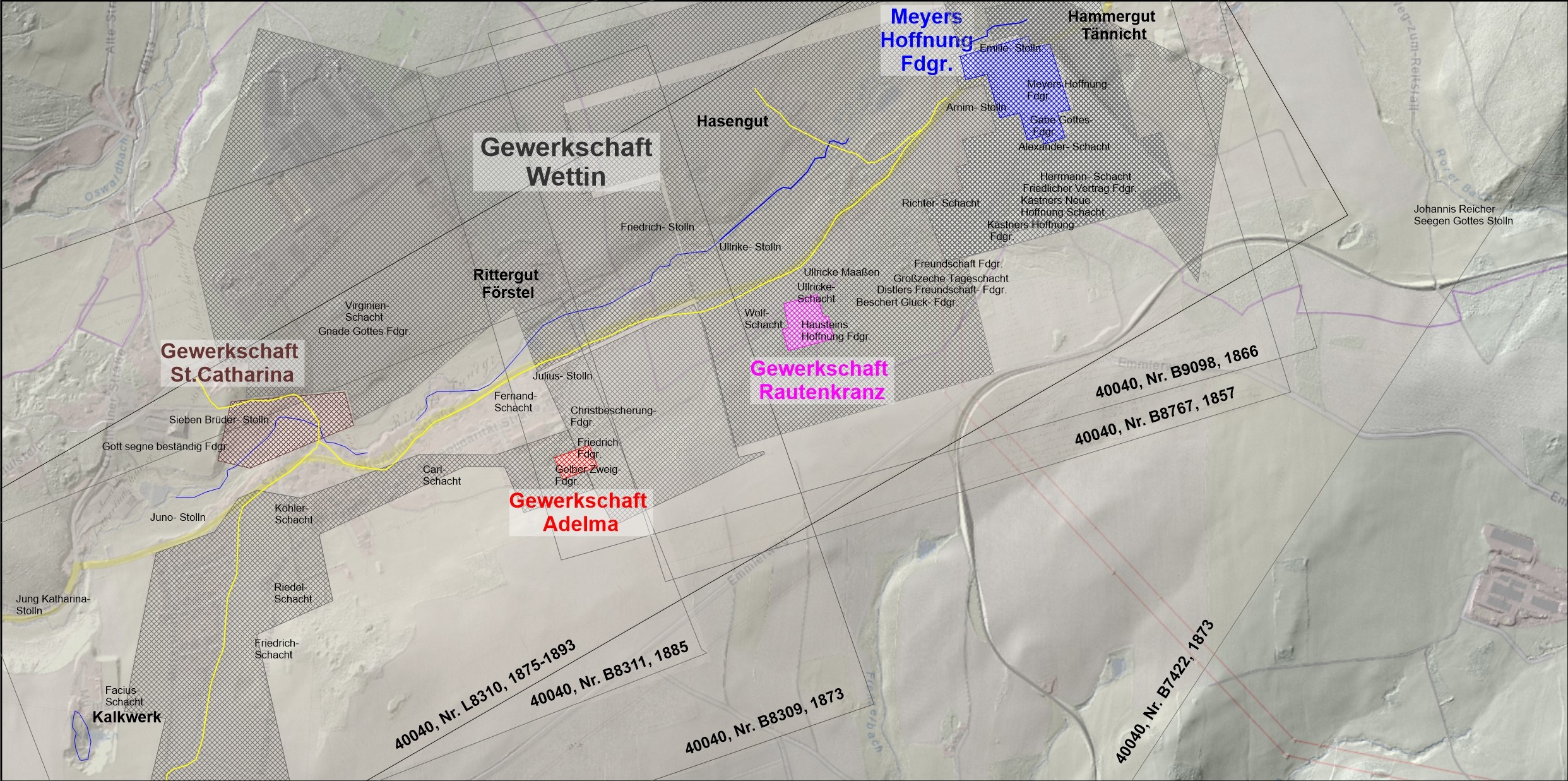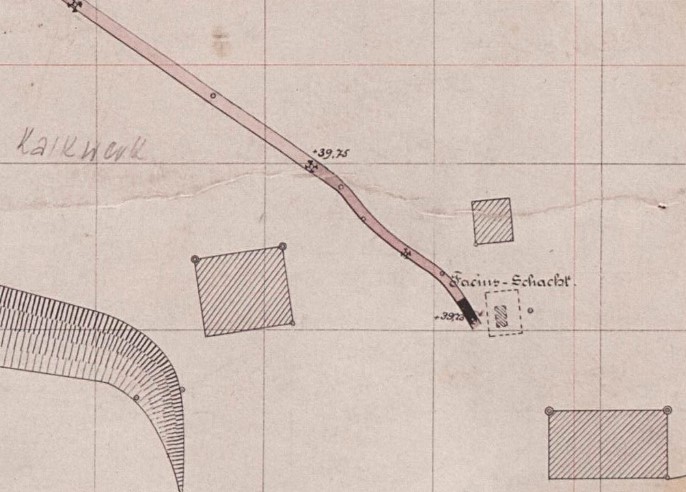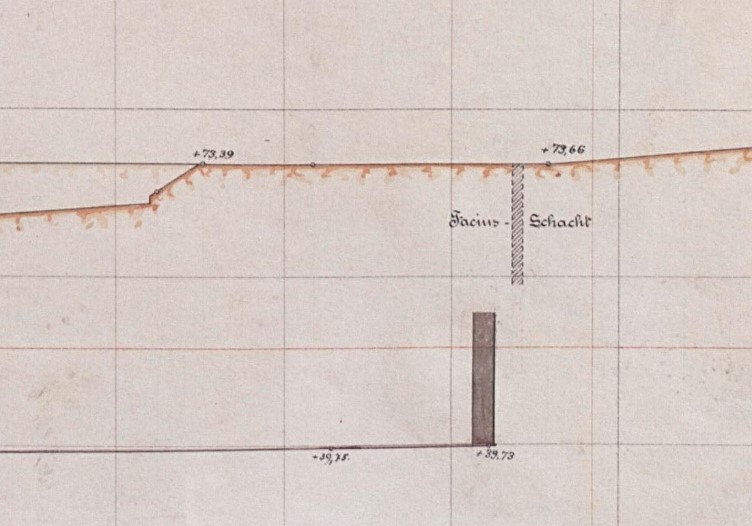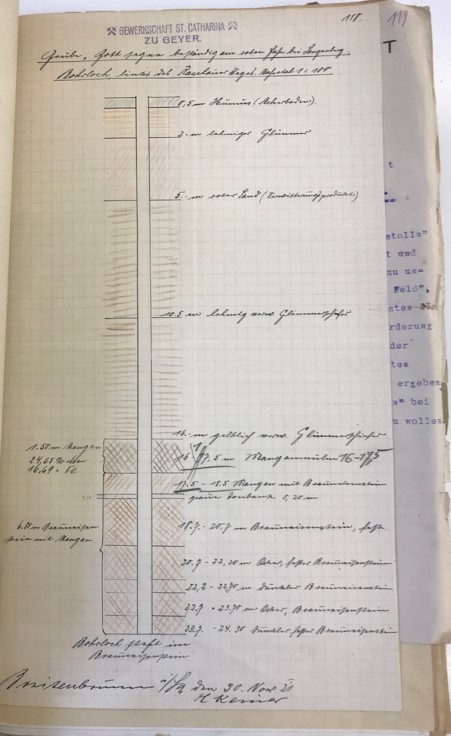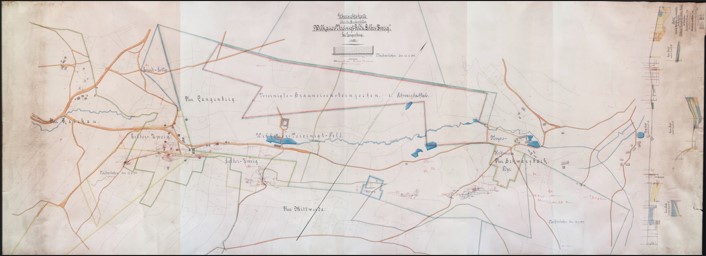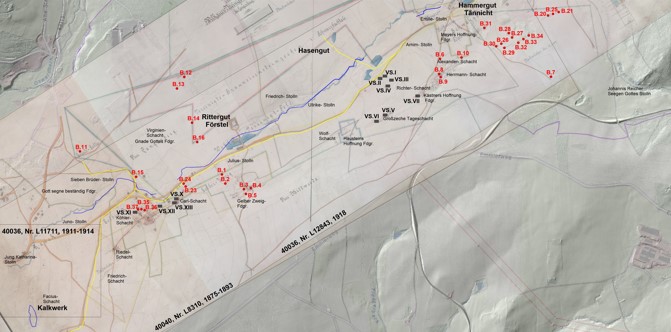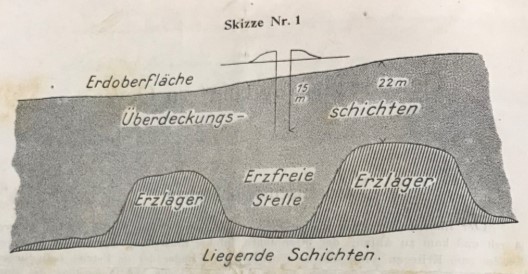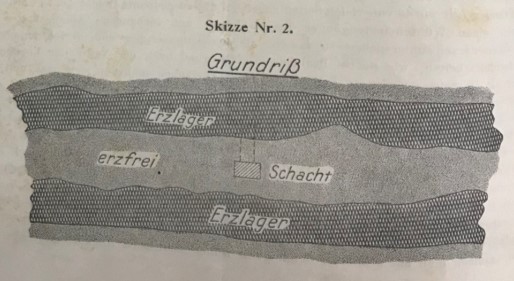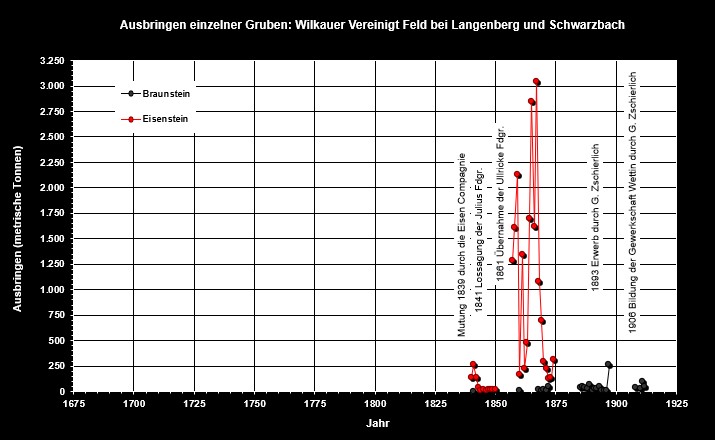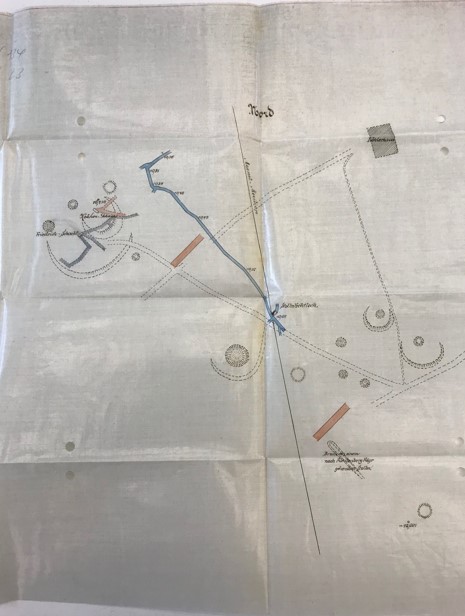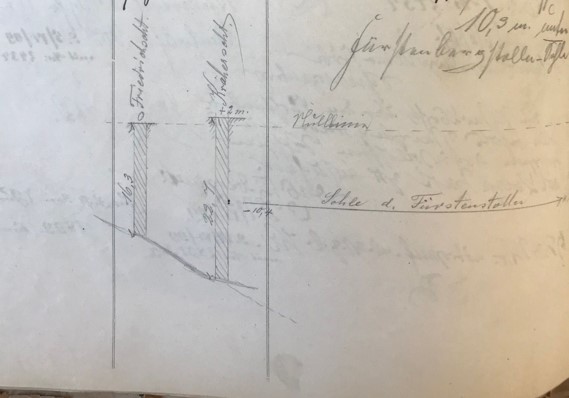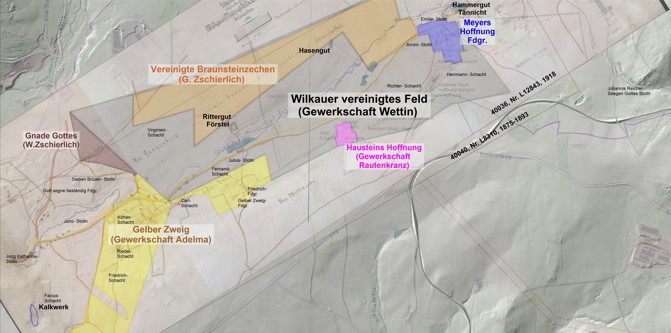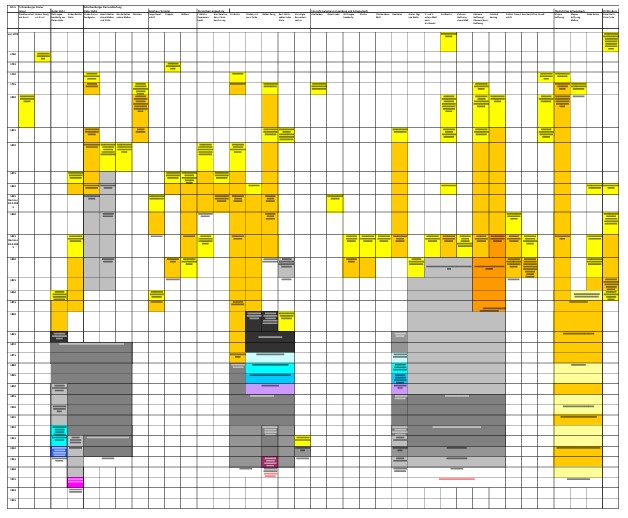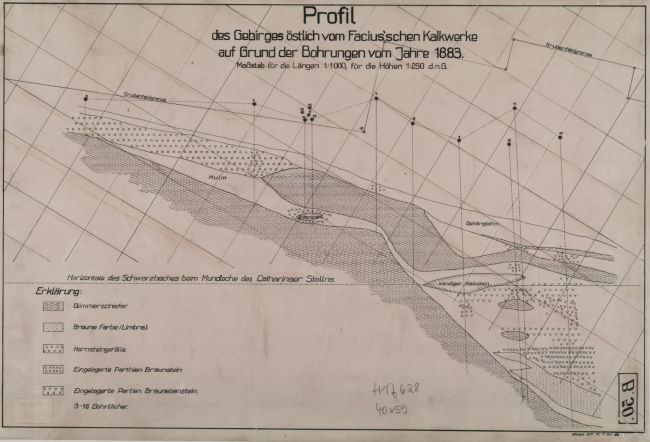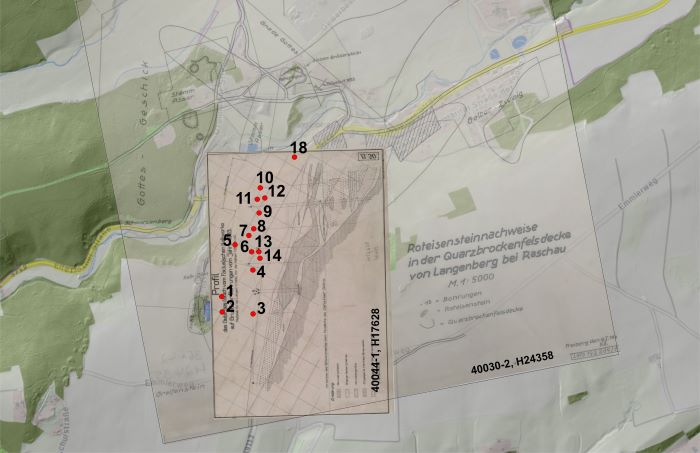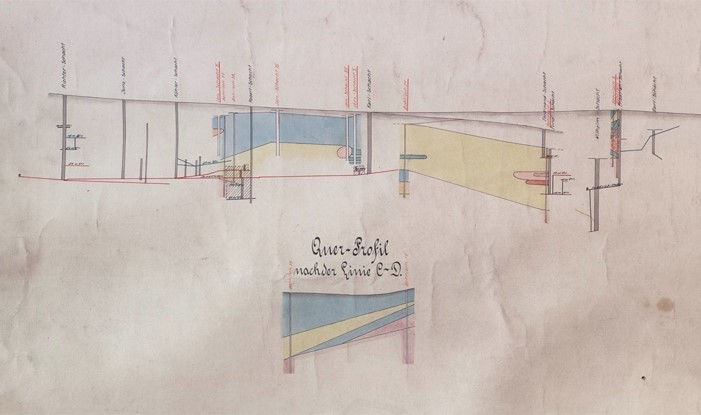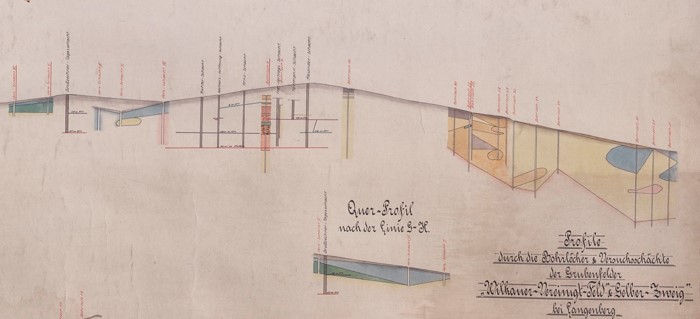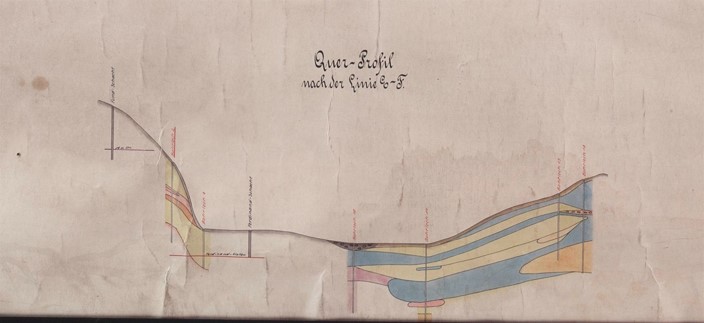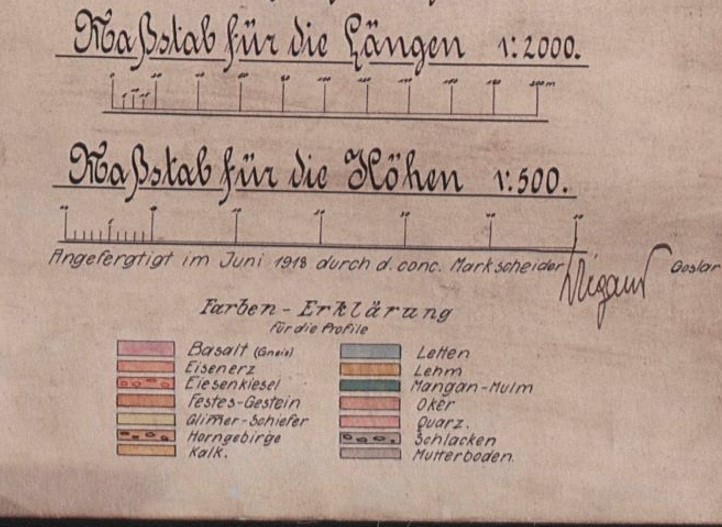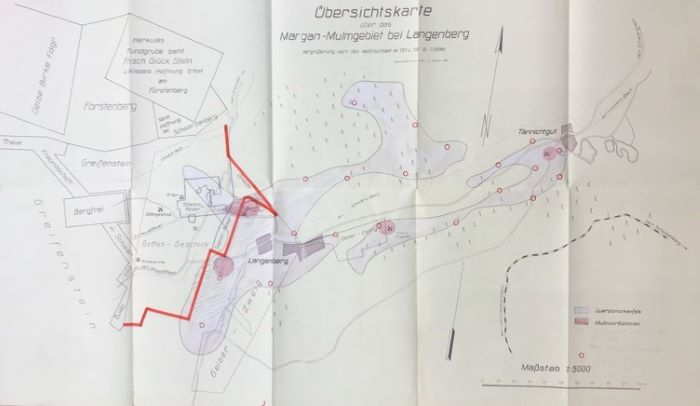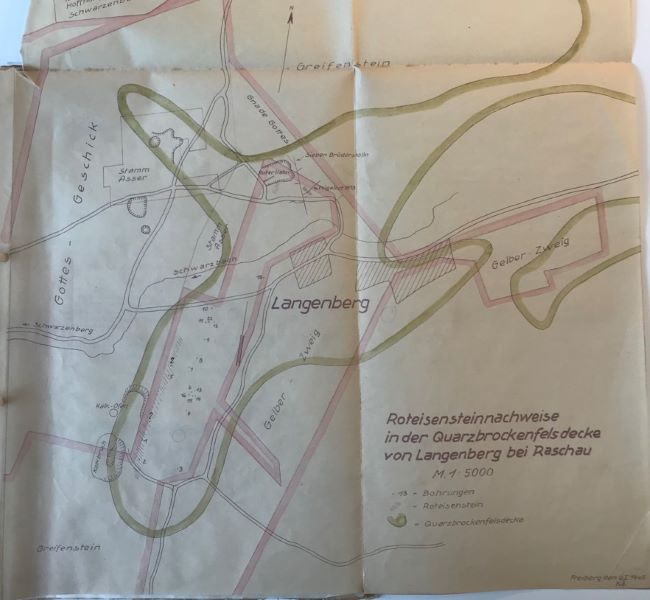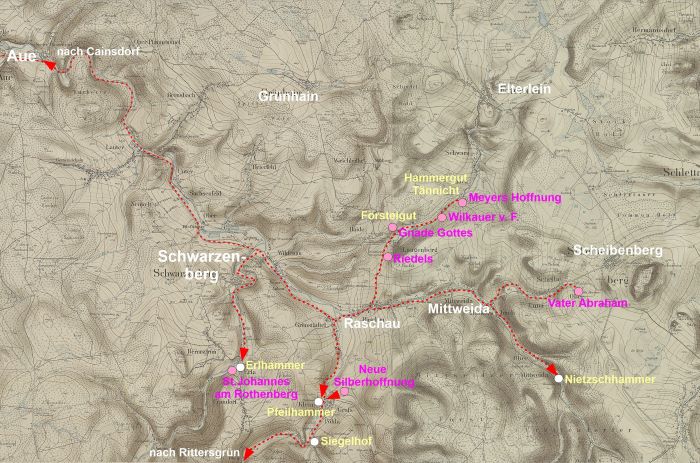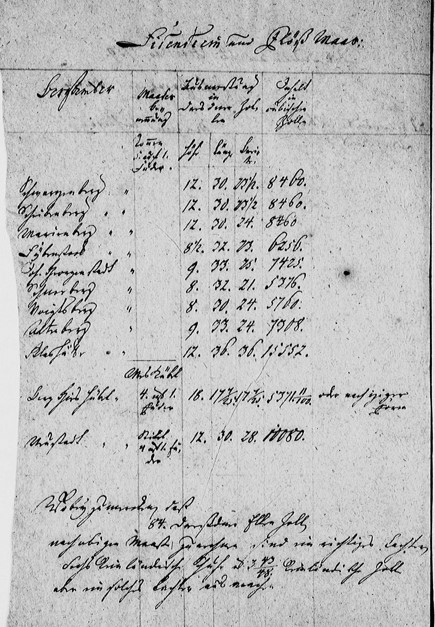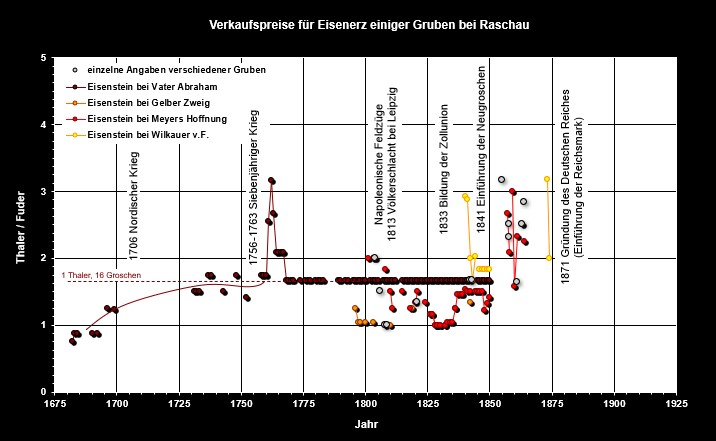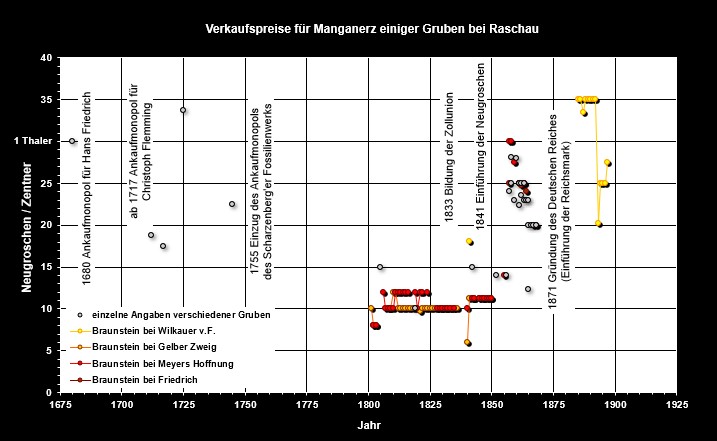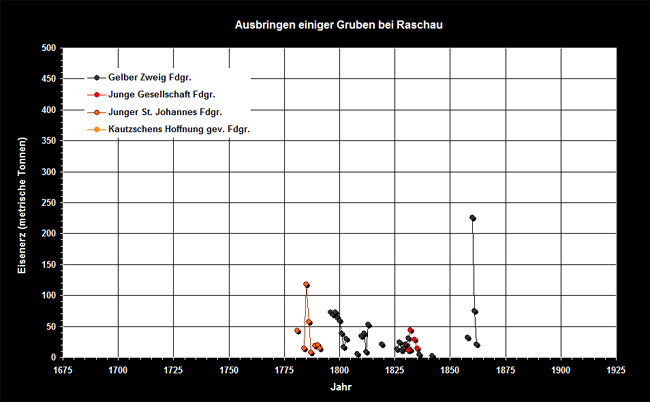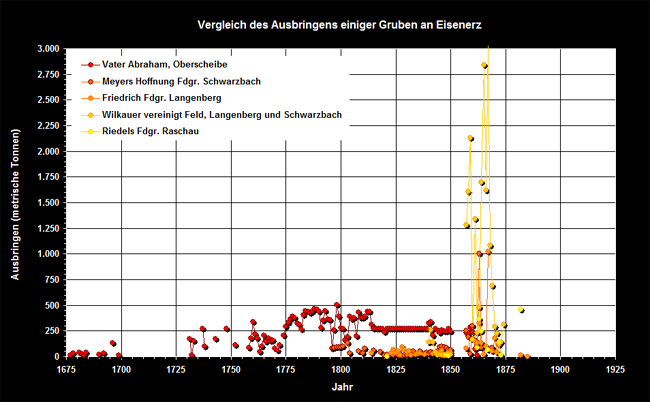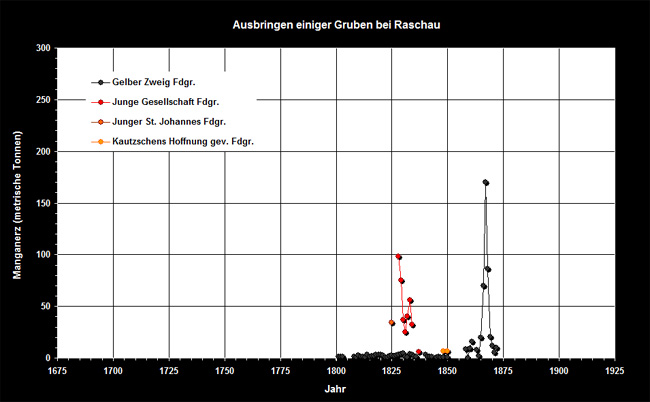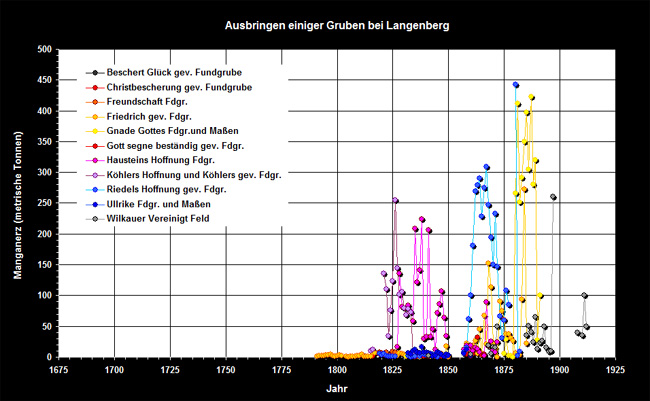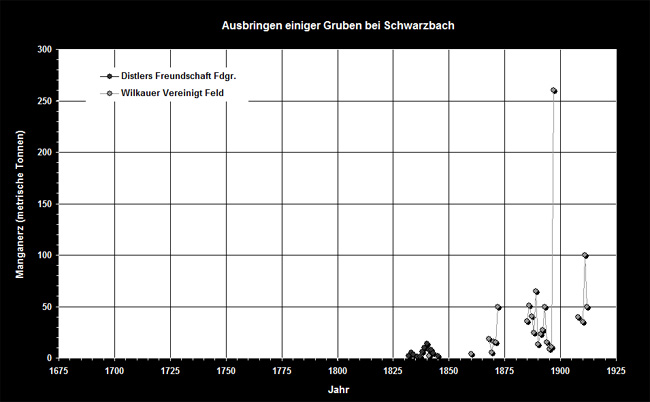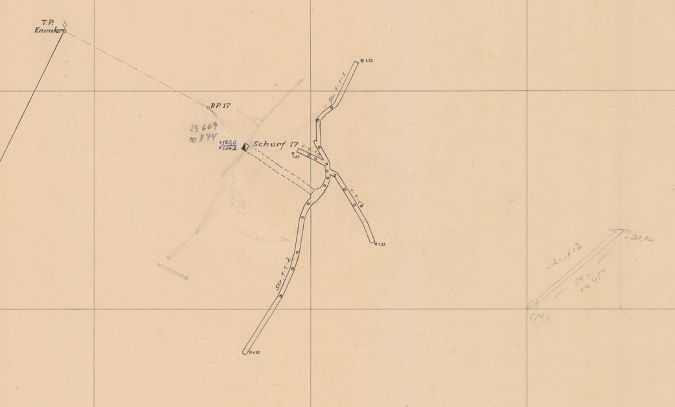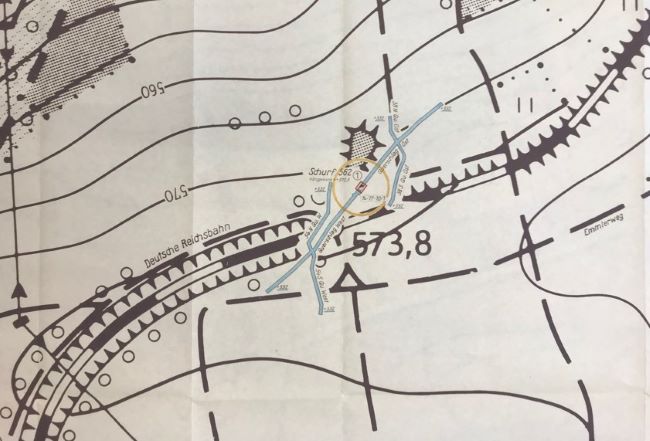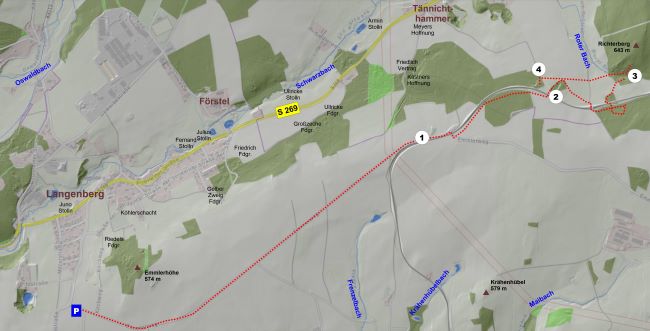|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Eisenstein- und Braunsteinbergbau
am Emmler bei Langenberg und Schwarzbach sowie bei Oberscheibe
‒ eine wahrscheinlich längst noch nicht
vollständige Materialsammlung
Das Material für diesen Beitrag haben wir
ab 2022 gesammelt.
Der Umfang des zu diesem Thema zu findenden Materials hat uns überrascht,
letztlich aber gefreut. Erfreulich war vor allem, daß eine Fülle von Unterlagen
inzwischen vom Sächsischen Staatsarchiv digital bereitgestellt wird ‒
Digitalisierung ist ja nicht grundsätzlich schlecht ‒ und hier
erleichterte sie uns unsere Recherchen natürlich erheblich. Über die
Suchfunktion in der Internetpräsenz des Sächsischen
Dieser Beitrag unterscheidet sich deshalb aber auch dahingehend etwas von früheren Beiträgen, daß wir diesmal sehr systematisch fast sämtliches verfügbares Material durchgesehen haben. Allerdings machte gerade die Menge der Unterlagen auch Beschränkungen notwendig: Es ist wahrscheinlich völlig unmöglich, dieses Thema in irgendeiner Weise abschließend zu behandeln. Wir sind uns bewußt, daß es im Umfeld der von uns hier betrachteten Region noch etliche weitere Bergbauunternehmungen gegeben hat. Für weitere Ergänzungen zu diesem Thema gibt es noch viel Stoff zu finden und für unsere Nachfolger noch genug zu tun. Der folgende Text ist auch deshalb umfangreich geworden, weil wir in großem Umfang die Originalquellen ungekürzt zitieren. Das tun wir zum einen aus Respekt vor unseren Vorfahren, die uns gerade das hinterlassen haben, was sie zu ihrer Zeit für des Aufschreibens wert erachtet haben. Wir tun es aber auch, weil darin zahllose kleine Episoden enthalten sind, die verborgen blieben, würden wir nur allein Wesentliches herausziehen. Was denn eigentlich das Wesentliche ist, liegt nämlich im Auge des Betrachters und das kann ja bei jedem anders sein. Außerdem liebe ich die immer etwas schwülstige und dreimal geschraubte Schriftsprache unserer Altvorderen. Nur, wenn ich selber drei Anläufe brauche, um zu verstehen, worauf der Verfasser mit seinem Satz eigentlich hinaus will, erlaube ich mir, in meinen Transkripten ein paar Kommas hinzuzusetzen, um unseren Lesern das Verständnis leichter zu machen. Für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrages bedanken wir uns (in alphabetischer Reihenfolge) bei:
Letzte Ergänzungen
unseres Textes erfolgten im Juli
Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand von Oktober 2024 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Lage und Regionalgeschichte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier waren wir schon einmal unterwegs, zunächst aber auf den Spuren des Kalksteinabbaus: Wir sind im oberen Teil des Westerzgebirges, wo das Schwarzwasser und seine Nebenflüsse ihre Täler in Quarzphyllit, Glimmerschiefer und Gneis eingetieft, im Zentrum der kuppelförmigen Schwarzenberg'er Kuppel den grobflaserigen Augengneis freigelegt und eine sehr abwechslungsreiche Landschaft geschaffen haben. Die markanteste Höhe im Osten ist der Scheibenberg mit seinen berühmten Basalt- „Orgelpfeifen“ und südlich des Mittweidatales liegen der Große und Kleine Hemmberg und das weithin sichtbare Oberbecken des Pumpspeicherwerkes. Diese Berge erreichen über 800 m Höhe. Nordwestlich bildet der Spiegelwald mit dem markanten König Albert- Turm eine weithin sichtbare Landmarke. Über den Scheibenberg und den Richterberg bei Schwarzbach verläuft auch die Wasserscheide zwischen dem Schwarzwasser und der Zwickauer Mulde im Westen und der Zschopau im Osten. Die Rote Pfütze unterhalb von Scheibenberg fließt bereits der Zschopau zu. Der Oswaldbach bei Haide hat sich bis auf etwa 480 m, der Schwarzbach bei St. Katharina auf 470 m, die Große Mittweida bei Grünstädtel auf 440 m eingeschnitten und das Schwarzwasser liegt in Schwarzenberg an der Einmündung der Großen Mittweida auf nur noch 414 m Seehöhe. Am Südhang des Mittweidatales verläuft die B 101 von Schwarzenberg nach Scheibenberg und weiter nach Annaberg. Den Nordhang des Tals der Großen Mittweida bildet der Emmler, ein Höhenrücken zwischen den Tälern der Mittweida und des Schwarzbaches, der sich in Richtung Westen verschmälert und am Knochen noch einmal einen relativen Hochpunkt erreicht. Am Nordhang des Emmlerrückens zum Schwarzbachtal hin lagen neben Kalksteingruben vor allem auf Eisenerz und Braunstein bauende Bergwerke. Am oberen Talschluß des Schwarzbachtales liegt schließlich das Städtchen Elterlein. Warum so oft die Bezeichnung „Silber- Emmler“ kolportiert wird, bleibt uns auch nach unseren Nachforschungen für diesen Beitrag verborgen, denn Silbererzbergbau haben wir – zumindest an der Nordseite dieses Bergrückens – nirgends gefunden; dagegen aber einen über mehrere Jahrhunderte sehr umfänglichen Bergbau auf Eisenerz und Braunstein. Vielleicht lagen ja an seiner Südseite einige Gruben, die tatsächlich auf Silbererze fündig geworden sind. Noch im Jahr 1891 wurde übrigens ein Schurffeld unter dem Namen „Silber- Emmler“ südwestlich des früheren Riedelschachtes bestätigt (40036, Nr. C12554). Dahinter stand in diesem Fall der uns aus dem weiteren Umfeld (etwa von Gelbe Birke und im Ehrenzipfel) bekannt gewordene, schlesische Bankier Rudolf Wiester. Die Geschichte dieser Schurffelder (es gab besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch einige mehr davon) verfolgen wir aber nicht weiter, weil hier eigentlich nie wirkliche bergmännische Arbeiten aus diesen Erkundungsbewilligungen hervorgegangen sind. Im Rahmen dieses Beitrages betrachten wir in erster Linie das Schwarzbachtal und den Nordabhang des Emmlers. Eine Ausnahme bildet der Ort Oberscheibe: Westlich unterhalb der Stadt Scheibenberg liegt das ältere Dorf Oberscheibe und auf dessen Flur lag mit Vater Abraham eine der bedeutendsten Eisenerzgruben der Umgegend. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Frühgeschichte der Region um Schwarzenberg liefert uns der 1823 erschienene, 10. Band des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ folgende Informationen: „Als ein Haupttheil des ungeheuern Miriquiduiwaldes, nachher die Böhmischen Wälder genannt, war der Bezirk in frühen Zeiten nur schwach bevölkert; nur hier und da mag ein Gasthof oder eine Köhlerhütte an den wenigen Straßen gestanden haben, welche durch den Wald nach Böhmen führten. Wälder achtete man aber damals wenig und so mag gar lange über diese Gegend kein Oberherr geboten haben; die wenigen Bewohner mögen Deutsche gewesen sein, welche sich den Verdrückungen der Serben*) entzogen hatten; wenigstens wurde die Gegend zu keinem serbischen Gau gerechnet. Nur einzelne Orte sind serbischen Ursprungs: Schwarzenberg (früher Czurnitz), Albernau, Bockau, Raschau, Sosa, wahrscheinlich auch Aue. … Im 10. Jahrh. aber, unter den Königen Heinrich I. und Otto I. kamen niedersächsische Familien auch hierher und eine derselben, nach Böckler, die der Grafen von Osterroda am Harz, baute bei Czurnitz ein festes Schloß und bildete eine Herrschaft, die östlich bis zur Pöhl; südlich ein Stück ins heutige Böhmen hinein (nämlich bis zum Hochgebirgskamm bei Abertham), westlich bis zur (Zwickauer) Mulde reichte; Burg und Herrschaft wurde nun häufig deutsch, folglich Schwarzenberg (denn czorny heißt schwarz) genannt. ... Das hiesige kathol. Decanat trans Muldam soll bereits im Jahr 968 errichtet worden sein.“ *) Gemeint sind hier natürlich nicht die heutigen „Serben“, sondern die „Sorben“ als Oberbegriff für die elbslawischen Stämme, in diesem Raum der Stamm der Chutizer. Die mittelalterliche Gaugrafschaft Chutizi mit Siedlungszentren bei Schkeuditz und Zwickau gelangte 974 durch Schenkung König Ottos, des II. an das Bistum Merseburg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Region um Schwarzenberg wurde vermutlich schon vor 1200 durch fränkische Bauern besiedelt. Die Stadt Schwarzenberg wurde erstmals 1282 als „civitas Swartzenberg“ urkundlich erwähnt. Man geht aber davon aus, daß bereits deutlich früher eine Siedlung auf dem benannten Gebiet bestanden hat. Die Stadt selbst ist aus einer Befestigungsanlage entstanden, die vermutlich durch Herzog Heinrich II. von Österreich (*1107, †1177) als ersten urkundlich nachgewiesenen Besitzer der späteren Herrschaft Schwarzenberg, zum Schutz des wichtigen Handelsweges zwischen dem Pleißenland und Böhmen in dem bis dahin noch kaum besiedelten Gebiet angelegt wurde. Die Herrschaft Schwarzenberg stand deshalb unter Lehnshoheit der böhmischen Krone. Bereits 1170 soll die Herrschaft Schwarzenberg in den Besitz von Kaiser Friedrich, des I., genannt Barbarossa, übergegangen sein, der es wiederum seinem Sohn Kaiser Heinrich, dem VI. vererbte. Die Herrschaft wurde damit zeitweise zu einem Bestandteil des Pleißenlandes. Danach wechselten die Besitzer mehrfach: Im Laufe der Zeit waren die Vögte von Gera und Plauen, 1334 die Familie von Lobdeburg auf Elsterberg und schließlich die Burggrafen von Leisnig mit der Herrschaft als meißnische Lehnsträger von Stadt und Herrschaft Schwarzenberg nachgewiesen. Von diesen erwarb 1488 Wilhelm von Tettau die Herrschaft. Anfangs des 15. Jahrhunderts fielen die Hussiten auch in dieser Region ein und zerstörten 1429 die Burg Schwarzenberg. Schon bald aber kam es wieder zu einem Aufschwung. Auch der Bergbau florierte erneut. Am 30. Mai 1533 erkaufte Kurfürst Johann Friedrich, I. genannt der Großmütige, die Hälfte der Herrschaft Schwarzenberg von Georg von Tettau für 10.700 Gulden. Am 17. September verkauften die Brüder Albrecht und Christoph von Tettau für die Summe von 10.000 Rheinischen Gulden auch die andere Hälfte der Herrschaft an den Kurfürsten. Nach der Niederlage der Ernestiner im Schmalkaldischen Krieg teilten sich der jetzige Kurfürst Moritz von Sachsen (aus der albertinischen Linie) und Ferdinand, I. (der jüngere Bruder des Kaisers Karl, V., seit 1521 im Besitz der österreichischen Erblande, damit auch König in Böhmen, und nach dem Rücktritt seines Bruders 1556 selbst Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) die Herrschaft Schwarzenberg als Kriegsbeute. Das Gebiet um Platten und Gottesgab hatte – damals noch als Herzog von Sachsen – Moritz schon zuvor im Prager Vertrag vom 15. Oktober 1546 Kaiser Karl, V. zugesagt. Im Gegenzug sollte er für seine militärische Neutralität im Schmalkaldischen Krieg Ländereien der Ernestiner und die Kurwürde erhalten, was mit der Wittenberger Kapitulation vom 19. Mai 1547 auch umgesetzt wurde. So gelangte der südliche Teil der Herrschaft Schwarzenberg wieder an die böhmische Krone, während deren nördlicher Teil von nun an endgültig bei Sachsen verblieb. Kurfürst August, I. ließ von 1555 bis 1558 die Burg zu einem kurfürstlichen Jagdschloß umbauen und erwarb im Jahr darauf das Dorf Sachsenfeld hinzu. Die amtssässige Bergstadt wurde nun Sitz des gleichnamigen kurfürstlichen Amtes, dessen Verwaltung vom Schwarzenberger Schloß aus erfolgte und entwickelte sich im Verlauf des 16. Jahrhunderts zu einem Verwaltungszentrum. Unter dem Stichwort des Amtes Schwarzenberg kann man im Postlexikon dazu lesen: „Schwarzenberg, und zwar das Kreisamt für das königl. sachs. Obererzgebirge, begreift eigentlich zwei Amtsbezirke: Schwarzenberg und Crottendorf, welche auch noch jetzt in Forst- und Jagdsachen getrennt sind, und durch die Pöhl voneinander geschieden werden… Dieser Bezirk, einer der größten und volkreichsten, der rauheste, waldigste und höchste, auch der städtereichste, aber dorfärmste in Sachsen, der südlichste im Erzgebirge, und überdem eine der interessantesten Gegenden Deutschlands, stößt westlich an die Aemter Voigtsberg und Plauen, nordwestlich an Wiesenburg, nördlich an Wildenfels, Stein, Hartenstein und Grünhayn, nordöstlich an Schlettau, östlich und südlich an Böhmen…“ Aus den Bezirken der Gerichtsämter Eibenstock, Grünhain, Johanngeorgenstadt, Oberwiesenthal, Scheibenberg, Schneeberg und Schwarzenberg wurde schließlich 1874 die Amtshauptmannschaft Schwarzenberg gebildet. 1878 kam die Schönburgische Herrschaft Stein dazu. Die Amtshauptmannschaft wiederum unterstand der Aufsicht der Kreishauptmannschaft Zwickau. Die amtshauptmannschaftliche Organisation bestand mit geringen Änderungen noch bis 1945 (30049, 32957).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der einst bedeutende Eisen- und Zinnbergbau in
der Region zog schon bald auch die Bildung eines Bergamtes in Schwarzenberg
nach sich. Im heutigen Stadtteil Erla wurde bereits 1380 ein erstes Hammerwerk
erwähnt. Ab 1515 ist mit
Georg Brosius auch ein Bergmeister in Schwarzenberg nachweisbar.
Verleihungen auf edle Metalle fielen jedoch noch in die Kompetenz der
kurfürstlichen (ernestinischen) Bergmeister in Schneeberg bzw. in Buchholz. Nach
dem Erwerb der Herrschaft Schwarzenberg 1533 durch Kurfürst Johann Friedrich,
I. genannt der Großmütige, erhielt der Bergmeister zu Schwarzenberg 1537
auch das Verleihungsrecht auf Silber und andere Metalle außerhalb der Bannmeile
um Schneeberg (32957, 40012, 40052).
Bereits 1529 wurden das Bergrevier Gottesgab und 1532 das Revier Platten aus dem südlichen Teil des Bergreviers Schwarzenberg ausgegliedert. Zwar bestätigte Kaiser Karl, V. dem jetzigen Kurfürsten Moritz im jüngeren Prager Vertrag von 1549 die halbe Bergwerksnutzung, jedoch gestaltete sich die Wahrnahme dieser Rechte sehr strittig, weil die böhmische Seite aus dem Erlaß der Bergordnung für die Zinnbergwerke Hengst, Platten und Gottesgab von 1548 durch Ferdinand I. später eine alleinige Ausübung des Bergregals herzuleiten versuchte (40012). Die Bergbauerträge aus den nun böhmischen Revieren wurden noch bis 1556 an die sächsischen Kurfürsten abgeführt, danach teilten sich Sachsen und Böhmen den Zehnten. 1579 wird erstmals auch eine Schwarzenberg'er Knappschaft erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und ebenfalls im Postlexikon finden wir auch die „Producte des Mineralreichs“ aufgeführt, „durch welche der Amtsbezirk ein vorzügliches Interesse erhält“: „Ohne allen Zweifel gehört dieser Amtsbezirk zu denjenigen Gegenden auf unserer Erde, welche die meisten Arten von Mineralien aufzuweisen haben. Ausgezeichnet ist schon die Manchfaltigkeit der Gebirgsarten, indem man außer Granit und Gneus, woraus die meisten Berge bestehen, auch Grünstein (in Nordwest), Grauwacke (am Fichtelberq), Sandstein (bei Aue), Glimmerschiefer, Basalt (bei Scheibenberg), Kalkstein und Marmor, Quarz u. s. w. findet…“ Für das von uns näher betrachtete Gebiet werden u. a. aufgezählt: „Braunsteinerz (bei Scheibenberg), gediegener Arsenik und Arsenikblüte, (...) natürlicher Vitriol (bei Markersbach), Pinit (bei Schwarzenberg, wo auch Diopsid, Sahlit, Kolophonit und Allochroit zu erwähnen sind), trefflicher Marmor bei Crottendorf, Bärenloh und Scheibenberg), u. s. w. (...) Das Eisen dagegen ist das Hauptproduct der Reviere Schwarzenberg, Eibenstock und Scheibenberg und ernährt in den Gruben und Waldungen, auf den Hammerwerken, Köhlereien, in den Stab-, Blech , Zain-, Drath- und Schaufelhämmern, auch durch das Bau- und Fuhrwesen mehrere tausend Familien.“ Unter den „Fabriken für Mineralproducte“ im Amtsbezirk werden 1823 außerdem „3 große königliche*) und mehrere kleine Kalköfen“ aufgeführt. *) Oberscheibe und Crottendorf sowie eines an der Bärenlohe bei Hammerunterwiesenthal waren damals bereits „fiskalische“ Kalkwerke.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits 1215 wurde östlich von Schwarzenberg die Burg Grünhain, spätestens 1233 auch das Zisterzienser- Kloster Grünhain gegründet – Keimzelle des späteren Amtes Grünhain. 1240 stattete der damalige Klosterstifter, der Burggraf Meinher von Meißen, das Kloster mit umfangreichen Ländereien aus, darunter einige der im Weiteren genannten Orte. Die Meinheringer stellten von 1199 bis zum Erlöschen der Linie 1425 über acht Generationen die Burggrafen von Meißen und bildeten als königliche Beamte gemeinsam mit dem Bistum gewissermaßen einen „Gegenpol“ zum markgräflichen Machtanspruch. In ihrem Besitz waren umfangreiche Ländereien, damals u. a. auch die später schönburgische Grafschaft Hartenstein. 1267 wird Grünhain erstmals auch als Städtchen urkundlich genannt und bereits seit 1339 sind im Gebiet des Klosters auch Erzgruben aktenkundig. Aus Geldmangel und aufgrund von Streitigkeiten der reichsfreien Herren von Wildenfels mit dem sächsischen Haus Wettin wurde die Grafschaft Hartenstein 1406 von Burggraf Heinrich I. von Hartenstein an das Haus Schönburg verpfändet. Da er die Grafschaft Hartenstein bis 1416 nicht zurückkaufen konnte, fiel sie endgültig an die Schönburger und wurde Teil der Schönburgischen Herrschaften. Allerdings kam es danach noch zu lang anhaltenden Besitzstreitigkeiten zwischen den Schönburgern und den Wettinern. Mit dem Preßburger Machtspruch 1439 erhielten die Wettiner indirekt die Lehnshoheit über die Grafschaft Hartenstein und 1456 bzw. 1457 wurde der Übergang in ein kursächsisches Afterlehen von Kaiser Friedrich III. nochmals bestätigt (wikipedia.de). Nach der Leipziger Teilung 1485 gehörte Grünhain zunächst zur ernestinischen Linie der Wettiner. Nach der Reformation wurde das Kloster Grünhain 1533 säkularisiert. Im Jahr darauf taucht erstmals die Bezeichnung Klosteramt Grünhain auf. Nach der Niederlage der Ernestiner im Schmalkaldischen Krieg 1547 wurde das Amt Grünhain dann albertinisch. 1566 erhält Grünhain die Bergfreiheit, die 1694 vom Kurfürsten nochmals bestätigt wurde. Zum Amtsbezirk Grünhain gehörten auch die Dörfer Wildenau, Raschau, Waschleithe und Langenberg. Das Amt Grünhain bestand noch bis 1856 als eigenständiger Teil des Erzgebirgischen Kreises und ging danach in den Amtshauptmannschaften Schwarzenberg, Annaberg (Pflege Schlettau) und Chemnitz (Gebiete nördlich von Stollberg/Erzgeb.) auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elterlein ist als Ansiedlung an der historischen „Salzstraße“ von Halle nach Prag entstanden und sternförmig von dem auf einem Hochplateau befindlichen Marktplatz ausgehend, gegen Westen bis auf fast 750 m ansteigend und nach drei Seiten abfallend, in die den Ort umschließenden Auen von Schlangenbach und Schwarzwasser mündend, angelegt. Entlang der Gewässer im Tal haben sich sehr früh Hammerwerke, Hütten, Mühlen und später Industrie angesiedelt (elterlein-stadt.de). Der Name Elterlein wird meist von Altarlein, also einem kleinen Altar an diesem Weg, abgeleitet. Erstmals wurde Elterlein 1406 urkundlich erwähnt. Angaben, wonach der Ort bereits 1118 bestand, sind nicht belegt. Auch die Ersterwähnung als Stadt ist erst für 1483 schriftlich belegt, als Kurfürst Albrecht und Herzog Ernst auf Bitten von Ernst von Schönburg die Privilegien der Stadt bestätigten, nachdem die vorher verliehenen Privilegien verbrannt waren (wikipedia.de). Zu dieser Zeit gehörte Elterlein ‒ wie das 1522 von den Schönburgern begründete Scheibenberg ‒ zur Grafschaft Hartenstein. Die Schönburger unterhielten hier um 1500 ein eigenes Bergamt, das später aber im Bergamt Scheibenberg aufging. Am 2. Mai 1559 wurde der obere Teil der Grafschaft Hartenstein von den Schönburgern an die Wettiner verkauft und daraus das kursächsische Amt Crottendorf gebildet. Das Bergamt Scheibenberg wurde ‒ zusammen mit den ebenfalls schönburgischen Bergämtern Oberwiesenthal und Hohenstein- Ernstthal ‒ nach dem Hauptrezeß zwischen Wettinern und Schönburgern von 1740 dem kombinierten Bergamt Annaberg zugeschlagen. Die Stadt ist auch Stammsitz der gleichnamigen Adelsfamilie. Schon Heinrich von Elterlein (*1485, †1539) war selbst Berg- und Hammerherr in Elterlein und darüber hinaus Zehntner in Annaberg und Marienberg. Wohl das bekannteste Mitglied des Hauses Elterlein war zweifellos Heinrichs Tochter Barbara, verh. Uthmann, die – erst als Witwe – zu eigenem unternehmerischen Erfolg und hohem Ansehen, insbesondere durch die Einführung des Spitzenklöppelns in Annaberg, gelangte. Auch Johann (Hans) von Elterlein war nicht nur Hammerherr in Elterlein, sondern auch Landvogt, Stadtvogt, Bergamtsverwalter sowie Richter in Annaberg. Er war es, der am 24. Mai 1514 vom Hofpfalzgrafen Wolfgang Steinberger den bürgerlichen Wappenbrief erhielt. Am 28. Oktober 1766 wurde mit Hans Heinrich von Elterlein, Konsistorialrat des Stiftes Meißen, das erste Familienmitglied auch in den Reichsadelstand erhoben. Von 1997 bis 2008 bildeten dann Elterlein, Geyer und Tannenberg eine Verwaltungsgemeinschaft. Seit dem 1. Januar 2009 bildet Elterlein mit seinen Ortsteilen Schwarzbach und Hermannsdorf nun eine Verwaltungsgemeinschaft mit Zwönitz und Hormersdorf (erfüllende Gemeinde ist Zwönitz).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberscheibe, in diesem Beitrag der östlichste Punkt, ist wahrscheinlich auch schon Ende des 12. Jahrhunderts als Waldhufendorf entstanden. Die urkundliche Ersterwähnung des Dorfs als Schybe fällt aber erst auf das Jahr 1402, als es von der Grafschaft Hartenstein an das Kloster Grünhain verkauft wurde. Später wurde das Territorium jedoch von der Grafschaft Hartenstein wieder eingelöst. Die Oberscheibner Einwohner gingen ursprünglich nach Markersbach in Kirche, mußten während der Reformationszeit eine katholische Kapelle in Mittweida besuchen und wurden schließlich 1539 nach Scheibenberg umgepfarrt. Nach dem Schönburgischen Erbbuch gab es im Jahr 1559 im Ort ‒ jetzt Scheuba genannt ‒ 31 besessene Mann. Oberscheibe besaß ein Erbgericht mit eigener Brauerei (heute Privatbrauerei Fiedler), eine eigene Winkelschule und zwei bereits 1547 bezeugte, vom Scheibner Bachel getriebene Mühlen. Auf heutigen Karten ist der Scheibner Bach auch als Abrahamsbach benannt, was auf das hier gelegene Eisenerzbergwerk Vater Abraham zurückgeht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei August Schumann liest man 1820 über
den Ort: „Oberscheibe, ein Dorf des Amtes Crottendorf oder jetzt des
Kreisamts Schwarzenberg im sächsischen Obergebirge, ist demselben unmittelbar
unterworfen, und liegt in einem flachen Grunde, der nächst unterm Orte zum Thal
wird, am Anfang des Scheibenwassers oder Markersbaches, am südwestlichen Fuße
des Scheibenberges, der ursprünglich vom Dorfe seinen Namen hat, nur 1.000
Schritt südwestlich vom Städtchen Scheibenberg, an der Chaussee von
Schwarzenberg nach Annaberg... es erstreckt sich ¼ Stunde lang in westlicher
Richtung bis dicht an denjenigen Theil von Markersbach hinunter, welche
Unterscheibe genannt wird. Der Ort enthält meist Güter, die aber enge beisammen
stehn, und überhaupt in etwa 40 Häusern gegen 260 Einwohner... (die) außer der
Feld- und Viehwirthschaft und der Klöppelei auch den Bergbau, das Nägelschmieden
und allerlei andre Eisenarbeit treiben.
Das Erbgericht ist ein ansehnliches Gut an der Chaussee, jenseits welcher vor einiger Zeit ein ausgezeichnet schönes Brau- und Malzhaus angelegt wurde; die Brauerei ist stark, und das Bier recht beliebt. Noch giebt es hier 2 Mühlen und ein Wirthshaus. Ueber dem Dorfe liegt die bekannte Grube Vater Abraham, welche durch einen Stolln bei Unterscheibe gelößt ist; der hier gewonnene Eisenstein wird vorzüglich auf dem Obermittweider Hammer ausgeschmolzen und das Eisen eben da und in Mittweide verarbeitet. Bei diesem Dorfe ist ein Kalkbruch, aus welchem man jährlich über 1.000 Fässer Kalk gewinnt. — Das sogenannte Zwergloch, von welchem man sich in der Gegend gern schauerliche Geschichten erzählt, ist nichts als ein verfallener Stolln.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch Schwarzbach gehört zu den Dörfern, die am Ende des 12. Jahrhunderts durch planmäßige Besiedlung, vermutlich durch mainfränkische Bauern, angelegt wurden. Die erste urkundliche Erwähnung findet sich im Jahr 1240, als Schwarzbach (damals Swartzpach) mit einer Reihe weiterer umliegender Dörfer dem Kloster Grünhain geschenkt wurde. Ein Exemplar einer lateinisch geschriebenen Urkunde aus demselben Jahr 1240, wohl aufgesetzt vom damaligen Abt Brüning des Klosters und gesiegelt von Meinher, II., Burggraf zu Meißen, ist im Sächsischen Staatsarchiv erhalten geblieben (10024, Loc. 08936/44, Blatt 36f). Darin bestätigte Meinher, daß der ehrwürdige Herr Brunigus, Abt des Klosters zu Grünhain, die Dörfer Raschau, Markersbach und Schwarzbach als dauerndes Eigentum für das Kloster angekauft habe. Verkäufer war Albertus von Oriwineßdorf (Ortmannsdorf), der diese drei Dörfer innehatte, wobei Markersbach und Schwarzbach Afterlehn von Henricus de Zedelitz (Heinrich von Zedtlitz) als Lokator waren, welcher seinerseits damit von dem Burggrafen belehnt war, mit Raschau war Albertus dagegen direkt vom Markgrafen belehnt. Albertus erhielt 106 Mark, der Burggraf und seine Erben erhielten für ihre Einwilligung 30 Mark. 17 Mark wurden für Heinrich von Zedelitz bestimmt. Mit den Orten gingen auch der jährliche Zins an Geld, die Wälder, Jagden, Fischgewässer, Weiden und Muthen in das Eigentum des Klosters über (chronik-raschau.de). Nach einer Feuersbrunst und der Zerstörung des Ortes im Jahre 1322 wurde durch die Unterstützung der Grünhain'er Mönche, die dazu einen Ablaß von Papst Johannes XXII. erwirken konnten, Schwarzbach neu aufgebaut. Der Hammerherr Hans Klinger (im Hammergut Tännicht) wird auch in der Ablaßbulle als eine für die Ausstellung des Ablaßbriefes maßgebliche Persönlichkeit genannt. Nach der Reformation und der damit verbundenen Säkularisierung des Klosterbesitzes kam Schwarzbach 1536 an das aus dem Kloster hervorgegangene Amt Grünhain. Nachdem Anfang der 1520er Jahre in den Dörfern des Klosters Grünhain der neue lutherische Glaube eingeführt worden war, verlief zwischen den nun evangelischen Klosterdörfern Raschau, Markersbach und Unterscheibe und dem katholisch gebliebenen, schönburgischen Dorf Mittweida nicht nur eine Herrschafts-, sondern auch eine Konfessionsgrenze. Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts verdingten sich immer mehr Einwohner im aufstrebenden Bergbau. Rings um das Dorf entstanden zu dieser Zeit Berg- und Hammerwerke, die die Lebensgrundlage der gesamten Region wurden. Bereits infolge des 30jährigen Krieges und erneut durch den Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 kam der Bergbau fast ganz zum Erliegen. Am Ende des 19. Jahrhunderts verlor der Bergbau endgültig seine Bedeutung, so daß viele Schwarzbach'er Einwohner nun ihren Lebensunterhalt in der Holz- und Blechindustrie bestreiten mußten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im 1825 erschienenen 10. Band des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ kann man zum Dorf Schwarzbach lesen: „Es liegt in weitschichtiger Bauart nahe bei Elterlein, welches eine Gasse in südlicher Richtung bis hierher vorschiebt, längs der Straße nach Raschau und Schwarzenberg, auch nach Scheibenberg - in einem oberwärts engen, unten aber freundlichern, tiefen, stark gewundenen, steil abfallenden Thale… Es treibt auf seiner starken, nur mäßig fruchtbaren und höchst bergigen Flur guten Flachsbau, hat nach Südost hin bedeutende Holzung, und nährt sich zum Theil von Holz- und Blecharbeit, Bergbau u. s. w. Zur Kirche geht der Ort nach Markersbach; nur das Tännicht (siehe diesen Artikel) am untern Ende des Dorfes ist nach Elterlein gepfarrt... Das oberste Haus ist die, sehr vortheilhaft bekannte, mit doppeltem Gezeug versehene, durch Blitzableiter gesicherte, schön gebaute Papiermühle; nächst bei ihr steigen einige Felsklippen an. Noch giebt es 2 Mahlmühlen, 1 Bretmühle, ein Erbgericht, welches 1803 auf 10.664 Thlr. (gewürdigt ?) wurde, und im Tännicht ein Hammergut nebst starker Kalkbrennerei.“ Natürlich sehen wir uns auch den Artikel zum Tännichthammer an und schlagen dazu den 1826 gedruckten Band 11 des Postlexikons auf: „Tännicht, in ältern Zeiten Tennicht, ein Oertchen im erzgebirg. Amte Grünhayn, am Schwarzbache, zwischen Grünhayn und Scheibenberg, unweit Förstel und am westlichen Fuße des hohen Kräuselbergs in einem schönen tiefen Thale gelegen, wird zur Commun Schwarzbach gerechnet, welches weiter oben liegt, und begreift ein Hammergut mit einigen Häusern, die nach Elterlein gepfarrt sind. Das Gut legte 1500 als ein bedeutendes Hammerwerk der reiche Elterleiner Caspar Klinger*), an, von welchem der Ablaßbrief in der Markersbacher Kirche herrührt, und dessen Ansehen 1525 die Bauernunruhen hiesiger Gegend dämpfte. Das Gut besitzt einen trefflichen Kalkbruch, wo das Lager 7 Ellen mächtig ist, dessen Product jedoch viel Holz beim Brennen, wozu hier ein Ofen steht, erfordert.“ *) Hier irrt der Verfasser: Zumindest das Hammerwerk Tännicht wurde bereits von dessen Vater Hans Klinger angelegt. Das benachbarte Förstelgut finden wir im zweiten Band anno 1815 nur kurz erwähnt: „Förstel, Förstelguth, das; ein amtssässiges Rittergut ohne Unterthanen im Erzgebirgschen Kreise, im Amte Grünhain, ¾ Stunden westl. von Scheibenberg gelegen. Es gehört zu demselben das Dorf Langenberg.“ Bereits 1909 wurden das ehemalige Hammergut Tännigt und das 1540 gegründete Hammergut Förstel aus dem Nachbarort Mittweida nach Schwarzbach eingemeindet. Am 1. April 1996 verlor Schwarzbach seinen Status als selbstständige Gemeinde und wurde ein Ortsteil der Stadt Elterlein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Tännichthammer auf dem Blatt 22 der Öder- Zimmermann'schen Karten, Norden ist unten. Beim Hammer ist auch schon auf den noch älteren Öder'schen Karten ein Ziehn bergkwergk eingezeichnet, obwohl es ein solches hier aus geologischen Gründen kaum gegeben haben kann. Vielleicht meinten die Zeichner der Karten aber ein Eisenerzbergwerk und einen Zainhammer... Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auf den ab 1780 entstandenen Meilenblättern von Sachsen (Blatt 250 des Berliner Exemplars) ist dann auch schon ein Kalck Bruch beim Tännichtgut verzeichnet, jedoch kein einziges Erzbergwerk. Norden ist auf diesen Karten rechts oben. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Förstel auf dem Blatt 22 der Öder- Zimmermann'schen Karten, Norden ist unten. Auch hier finden wir nicht einen einzigen Verweis auf den Erzbergbau am Emmler zwischen Mittweida und dem Schwarzbach. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
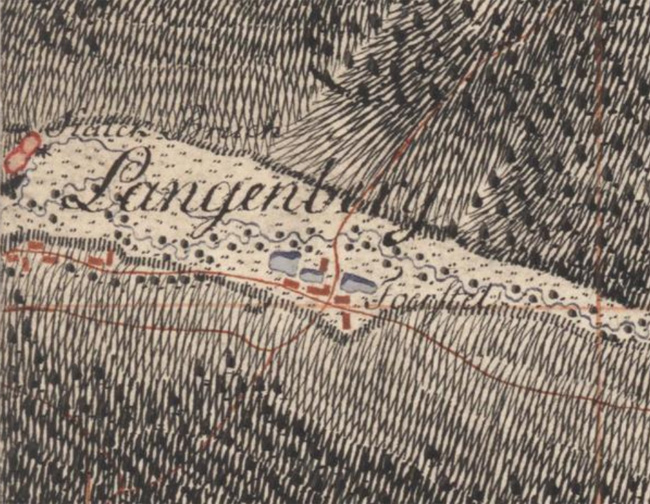 Auch westlich des Förstelgutes ist ein Kalck Bruch auf Meilenblatt verzeichnet, jedoch kein einziges Erzbergwerk (Blatt 250 des Berliner Exemplars, Norden ist auf diesen Karten rechts oben). Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
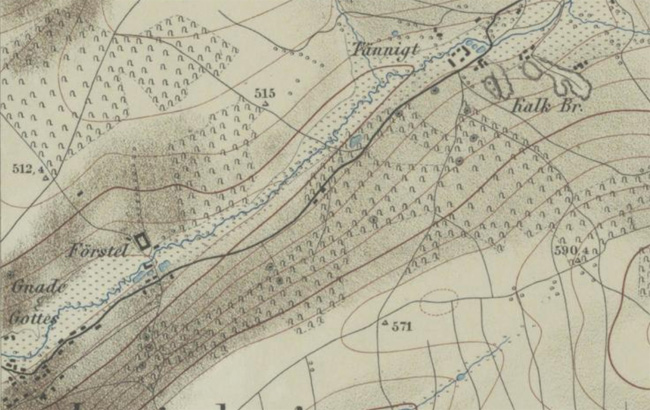 Auf den ab 1875 entstandenen Äquidistantenkarten, Blatt 138: Elterlein, finden wir im Forst zwischen Tännicht und Förstel nur einige kleine Halden der zumeist schon wieder eingegangenen Bergwerke. Nur am linken Blattrand ist noch die Grube Gnade Gottes bezeichnet. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
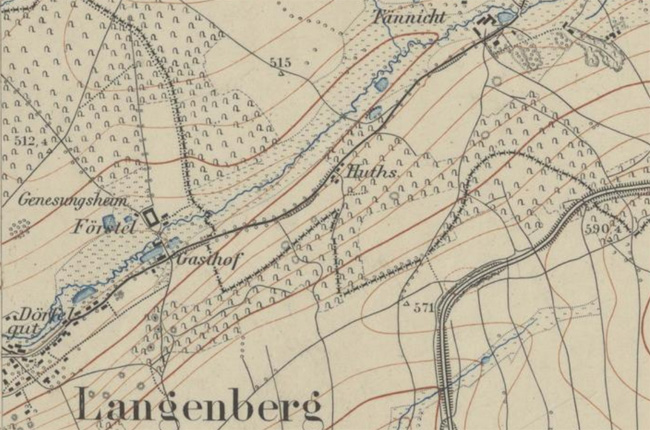 In der Ausgabe dieses Blattes aus dem Jahr 1911 ist aus dem einstigen Rittergut bereits ein Genesungsheim geworden und die Bahnlinie von Annaberg über Scheibenberg nach Schwarzenberg hinzugekommen. Vom Bergbau zeugt außer einigen winzigen Halden nur die Bezeichnung Huthaus, welche dasjenige von Wilkauer vereinigt Feld meint. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Markersbach gehört zu den sogenannten „Ur-Pfarren“ im Erzgebirge. In der Chronik des Klosters Grünhain, niedergeschrieben vom Mönch Conrad Feiner am Ende des 15. Jahrhunderts, heißt es: „Anno 1249 thaten die Böhmen große Wallfahrten ins Closter zum Heiligen Niclas (in Grünhain) und waren so freigiebig, daß aus ihren Geschenken die Closter- Kirche erneuert und ausgemalet werden konnten. Um diese Zeit legte der Abt Henricus von Myla den Grundstein zur Peter & Paul Kirche in Markersbach und nach deren erfolgtem Aufbau wurde sie im Jahre 1250 in seiner und vieler Menschen Gegenwart von Bischof Engelhardt zu Naumburg... eingeweyhet, auch dem Abt und Convent das Patronats-Recht darüber gegeben.“ Dieses Gründungsdatum ist auch durch bauhistorische Untersuchungen an der Kirche belegbar. Allerdings ist davon auszugehen, daß es vor dem Steinbau schon einen schlichteren Vorgängerbau gegeben hat. Insbesondere wird dies durch die siedlungsgeschichtliche Besonderheit gestützt, daß zum Pfarrland hier eine ganze Hufe aus dem Siedlungsgebiet gehörte, so daß man davon ausgehen kann, daß die Gründung der ursprünglichen Kirche tatsächlich schon zusammen mit der Niederlassung fränkischer Bauern um 1200 erfolgt ist. Zu dieser Zeit war das Umland östlich und südlich überhaupt noch nicht besiedelt. Beim Einfall der Hussiten 1429 wurde die ursprünglich romanische Kirche ihrer Ausstattung beraubt. Nach deren Vertreibung wurde die Kirche neu und nun der Heiligen Barbara geweiht. Dafür ist wohl der inzwischen entstandene Bergbau ausschlaggebend gewesen (Kirchgemeinde Markersbach, 2000). Das Waldhufendorf Mittweida wird 1286 in einer fragmentarischen Matrikel des Bistums Naumburg erwähnt. Wahrscheinlich ist es aber zur gleichen Zeit wie die benachbarten, direkt an die Mittweidaer Dorffluren angrenzenden Dörfer Markersbach, Schwarzbach und Raschau auch um 1200 entstanden. Anders als die letztgenannten Dörfer wurde Mittweida 1240 jedoch nicht dem Kloster Grünhain verschenkt und gehörte nie zu dessen Besitz. Es war dagegen ein Bestandteil der Grafschaft Hartenstein und wurde als solcher 1406 mit an die Schönburger verpfändet. Seit dem Verkauf des oberwäldischen Teils der Grafschaft an das Kurfürstentum Sachsen 1559 gehörte Mittweida danach zum Amt Crottendorf und später zum Amt Schwarzenberg. Besondere Bedeutung hatte das Dorf durch die hier betriebene Eisenerzeugung und Verarbeitung. Zeitweise wurden in Mittweida sieben Eisenhütten betrieben, darunter das noch bis 1860 aktive Nietzsche'sche Hammerwerk Obermittweida, der Pökelhammer sowie ein Drahtwerk. Der Ortsteil Obermittweida ist weitgehend der Anlage des Unterbeckens des ab 1970 errichteten und 1979 in Betrieb gegangenen Pumpspeicherkraftwerkes zum Opfer gefallen. Mit einer Leistung von 1.050 Megawatt ist es das zweitgrößte seiner Art in Deutschland. Eine Besonderheit stellt seine Anlage als Kavernenkraftwerk (die Turbinen- und Generatoranlagen sowie die Wasserleitungen zwischen Ober- und Unterbecken liegen untertage) dar. Der Name des Dorfes Mittweida ist nach dem Zusammenschluß der Gemeinden Raschau und Markersbach verloren gegangen und lebt nur noch im Namen des Flüßchens fort. Auch das Dorf Raschau wurde nach Recherchen der Ortschronisten im Zuge der Ostbesiedlung gegründet (raschau-markersbach.de). Im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts hatte der Reichsministeriale Henricus de Zedelitz als Lokator 22 Bauernfamilien, wohl mainfränkischen Ursprungs, in den Talgrund der Mittweida gebracht. Er kam aus seinem Heimatort Zedtlitz an der Whyra bei Borna, wo sich schon Jahrzehnte zuvor mainfränkische Bauern angesiedelt hatten. Es waren wohl deren Nachkommen, die nun als Siedler hierher ins Erzgebirge kamen. Henricus de Zedelitz, der Lokator, behielt wahrscheinlich zwei Hufen Land in der Mitte des Dorfes. Dort wurde auch die erste Kirche errichtet. Bei der Sanierung derselben fanden die Bauleute 2008 dort Holz von einem Baum, dessen Fälldatum dendrochronologisch auf den Winter 1205/06 bestimmt wurde. Demnach bestand schon seit jener frühen Zeit eine hölzerne Kirche. Auch die erste Mahlmühle (die heutige „Süßmühle“) entstand schon damals. Der älteste schriftliche Nachweis des Dorfes geht ebenfalls auf den oben schon erwähnten Bestätigungsbrief aus dem Jahr 1240 zurück. Er nennt 10 Dörfer, unter ihnen Raschau und Markersbach, die in diesem Jahr dem Kloster Grünhain zugeschlagen wurden. Außerdem liegt die Kaufurkunde aus demselben Jahr vor, nach der Raschau, Markersbach und Schwarzbach vom Kloster als dauernder Besitz gekauft wurden. Im 1821 erschienenen Band 8 des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ kann man zum Dorf Raschau lesen: „Raschau, auch vulgo die Rasch genannt, ein nicht gar großes, aber überaus bevölkertes und in vielen Beziehungen merkwürdiges Dorf des im erzgebirg. Kreise gelegenen Amtes Grünhayn des Königr. Sachsen, dem es unmittelbar unterworfen, und zu welchem es durch Säcularisirung der Grünhayner Abtei gekommen ist. Es liegt, meist vom Schwarzenberger Amtsgebiet umgeben, 2 Stunden südsüdöstlich von Grünhayn, … an der Mittweide, die sich am untern Ende des Orts mit der Pöhl vereinigt; längs der neuen Chaussee von Schwarzenberg nach Annaberg; in einem angenehmen Thale, welches nördlich vom steilen Raschauer Knochen, südöstlich vom sanftern Ziegenberg (an welchem vor 100 Jahren die Fundgr. Christian im Umtrieb war) begrenzt wird, südwestlich hingegen wegen des Zusammentreffens mit dem Pöhlthale zu einer weiten, anmuthigen und fruchtbaren Aue wird… Auf dem Raschauer Knochen, der Knack, nordwestlich von der Kirche und etwa 100 Ellen über dem Dorfe, steht dicht bei der Allerheiligen Fundgrube (am Schwarzsteig; 1632 baute man daselbst auf Zinnzwitter) das Vitriolwerk, in welchem nicht allein Eisen- und Kupfervitriol, sondern auch Vitriolöl und Schwefel bereitet wird. … Unter mehrern Eisengruben auf dem Dorfgebiet zeichnet sich die hinter der Allerheiligenzeche aus; ehehin waren deren mehr im Gange, als jetzt, und überhaupt ist der hiesige Bergbau gegen frühere Jahrhunderte gesunken, weshalb auch nur noch 2 Schichtmeister hier wohnen; der Bergbau gehört größtentheils ins Schneeberger Bergrevier; nur der Antoniusstolln am Silberemmlergebirge gehört zum Annaberger, und der Gesellschaftstolln zum Scheibenberger Specialrevier. … Wichtiger als die genannten Gruben sind die am Graul gelegenen, welche ebenfalls zu Raschau gerechnet werden müssen, da sie im Umfang des großen Raschauer Communwaldes liegen; gleichwohl sind sie ¾ Stunde (nördlich) vom Dorfe entfernt, jenseits des Schwarzbachs nahe bei Wildenau, Langenberg und Waschleithe. In alten Schriften wird der Graul immer Kraul geschrieben, und er enthielt im J. 1433 eine eigne Schmiedegasse, war also wohl beträchtlicher, als jetzt. Hier ist besonders das uralte und immer noch überaus wichtige, aus mehrern Zechen bestehende Bergwerk „Stamm Aßer am Graul“ zu bemerken, welches eine große Menge von Bergleuten beschäftigt, und mit den Wohnungen derselben dem Ansehen nach ein ganzes Dörfchen bildet. Es gehört dem Besitzer des Beyerfelder Vitriol- und Schwefelwerkes, Herrn Köhler, und liefert diesem größten Werke seiner Art in Sachsen die meisten seiner benöthigten Kiese. Außerdem gewinnt man daraus eine Menge Arsenicalkiese, welche bis 1802 nach Geyer gesendet wurden; damals aber legte Herr Köhler neben dem Stamm Aßer ein besondres Arsenikwerk an, welches sehr rasch empor kam, treffliches Product liefert… In der Nähe findet sich häufig schöner Wurststein, und der Braunstein des Johannes (unweit der Katharina doch näher nach Langenberg hin) wird meist nach Böhmen verkauft.“ Raschau ist heute mit seinen Ortsteilen Markersbach, Mittweida und Unterscheibe (Oberscheibe gehört dagegen heute zur durch Wolf und Ernst von Schönburg am 4. Mai 1522 begründeten Stadt Scheibenberg.) zu einem langgestreckten Ort verwachsen, bildete bereits einige Zeit eine Verwaltungsgemeinschaft und seit 2008 eine Gemeinde mit Markersbach. Was der Autor des Postlexikons, August Schumann, hier als „Wurststein“ bezeichnet, war uns zunächst nicht klar. Eine Erwähnung eines solchen „Fossils“ haben wir aber inzwischen noch in anderem Zusammenhang gefunden: Der Dresdner Arzt Christian Friedrich Schulze nämlich berichtete 1796 in einer Zeitschrift unter dem Titel „Nachricht von den in der dreßdnischen Gegend vorhandenen Mineralien und Foßilien“ unter anderem über die Mineralführung der Elbe; wo es über die Gerölle vom Grund des Flusses heißt: „Hieher gehöret auch noch ein gewisser conglomerirter Stein, der unter den so genannten Wurststeinen eine Stelle findet, in welchen der Grund entweder roth, oder braunlich ist, da hingegen die Flecke eine weiße Farbe haben, und aus verschiedenen Quarzgeschieben bestehen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am wahrscheinlichsten erscheint uns nach dieser Beschreibung jedenfalls, daß hier von August Schumann die am Emmler ausstreichenden Quarzite, insbesondere aber die „Quarzbrockenfelse“ gemeint wurden, in denen sich so häufig Brauneisenstein und Braunstein finden, daß sie zeitweise recht intensiv bergmännisch abgebaut wurden. Auf die Entstehung des Begriffs ,Brockenfels' kommen wir weiter unten noch ausführlicher zurück. In seinem geognostischen Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1836 (40003, Nr. 146) hat auch Bernhard Cotta diesem Gestein eigenes, wenn auch nicht langes Kapitel gewidmet (ab Blatt 40): Brockenfels und Eisensteingänge. „Ein sehr sonderbares und rätselhaftes Gebilde ist der sogenannte Brockenfels, welcher an einigen Orten im Gebiet des Glimmerschiefers auftritt, ohne daß man über seine wahren Lagerungsverhältnisse zu einer klaren (Antwort?) zu gelangen vermag. Gewöhnlich findet man ihn nicht anstehend, sondern es bedecken nur unzählige große und feste Blöcke desselben die ganze Gebirgsoberfläche, so bei Langenberg und am Raschauer Knochen. Doch ist aus mehreren Gründen, besonders durch die darin niedergehenden Grubenbaue, höchst wahrscheinlich, daß er tief zwischen den Glimmerschiefer niedersetze. Der Brockenfels ist ein Brekziengestein, dessen nuß- bis (?) große Glimmerschieferfragmente durch Quarz, Amethyst und Hornstein fest mit einander verkittet sind. Diese ungewöhnliche Masse ist dann wieder von Eisenkiesel, Eisenoxyd und schwarzem Braunstein durchdrungen und abermals brekzienartig zertrümmert, so daß dann die Schiefer- und Quarzbrockenfragmente durch Eisenkiesel und jene Oxyde aufs neue verkittet sind. Häufig ist der Eisen- und Mangangehalt dieses Gesteins so bedeutend, daß es abgebaut wird, und es scheinen in der That die Rotheisensteingänge der ganzen Gegend eine analoge Erscheinung zu seyn. Die nicht schmelzwürdigen Theile des hora 2 streichenden, steil gegen West fallenden, über 2 Ellen mächtigen Rothen Löwner Ganges, welche man auf die Halden stürzt, sind meistentheils eine Art Brockenfels, in welchem Quarz und (?) oder Gesteinsfragmente durch Eisenkiesel und Eisenoxyd mit einander verbunden sind. Wo das Bindemittel Eisenoxyd vorwaltet und die Bruchstücke endlich ganz (?), entstehen jene überaus bauwürdigen Eisensteinniederlagen, von denen der Rothenberger Gang ein schönes Beispiel abgiebt.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Langenberg ist dagegen ein für erzgebirgische Verhältnisse sehr junges Dorf. Spätestens ab Anfang des 16. Jahrhunderts ging hier umfangreicher Bergbau auf Kalkstein und Eisenstein in Gruben am Emmler und dem Langenberg, aber auch am Graul und am Roten Hahn um. Das Erz wurde laut dem 1559 aufgestellten Amtserbbuch für das Amt Crottendorf in den Hammerwerken im Mittweida- und Pöhlwassertal geschmolzen. Ausgangspunkt für die Entstehung des Ortes aber war der nördlich gelegene Förstelhammer. Der Hammerherr Rudolph von Schmertzing erhielt am 12. März 1619 in einem kurfürstlichen Privileg zwei als „Holzspitzen“ bezeichnete Waldstücke und die niedere Gerichtsbarkeit über alle seine Grundstücke verliehen sowie die Berechtigung eingeräumt, für die Hammerschmiede und Bergleute zwölf Häuser errichten zu dürfen. Diese bildeten den Ursprung des Parzellendorfs Langenberg, das sich in der Folge nur spärlich weiter entwickelte. Auch im Postlexikon finden wir nur eine kurze Notiz (Band 5, 1818): „Langenberg, ein Dorf in dem Königr. Sachsen, in dem Erzgebirgischen Kreise, im Amte Grünhain, ½ Stunde westl. von Scheibenberg, auf dem Wege nach Grünhain gelegen. Es hat 15 Häuser und 190 Einwohner, gehört amtss. zu dem Rittergute Förstel, und ist nach Markersbach eingepfarrt.“ Langenberg verlor bereits 1924 seine Eigenständigkeit und wurde nach Raschau eingemeindet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur geologischen Erforschung der Region
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regionalgeologisch befinden wir uns in der Erzgebirgs-Nordrandzone, einem Teilgebiet der Fichtelgebirgisch- Erzgebirgischen Antiklinalzone. Als lokale geologische Einheit ist die unmittelbar westlich gelegene, aus Gneisen bestehende, „Schwarzenberger Kuppel“ zu nennen. Altersmäßig sind die anstehenden Gesteinsschichten der Raschauer Folge der Keilberg- (Klinovec-) Gruppe und damit dem Unteren Kambrium zuzuordnen. Das vorherrschende Gestein der Raschau- Formation (Raschauer Folge) sind granatführende Muskovit- bis Zweiglimmergneise. Einschaltungen von Zweiglimmer- Paragneis bzw. Feldspatglimmerschiefer sind besonders im unteren Teil weit verbreitet. Die verschiedenen Gesteinsarten sind Ausdruck unterschiedlicher Edukte (Grauwacken, Granitoide usw.). Anhand von Altersbestimmungen hat man inzwischen festgestellt, daß auf Grund von Krustenstapelungen (von vier Stapeln bzw. Decken) weniger regionalmetamorph überprägte Gesteine unter höher metamorph überprägten liegen können. Als charakteristische Einlagerung tritt fast im gesamten Verbreitungsgebiet und häufig in großer Mächtigkeit ein teilweise stark aufgegliederter Karbonathorizont, das „Raschau- Karbonat“, vorwiegend aus Dolomitmarmor (regionalmetamorph überprägter Dolomit), auf. Dieser Karbonathorizont wird im Hangenden in weiten Gebieten von einem Quarzglimmerschiefer bis Quarzitschiefer, dem „Emmler- Quarzit“ begleitet. Eingeschaltet sind auch bis zu 10 m mächtige, verskarnte Bereiche. Die Vergesellschaftung von „Raschau- Karbonat“ und „Emmler- Quarzit“ bildet einen charakteristischen lithostratigraphischen Leithorizont im Erzgebirge (Pälchen, Walter, 2008). Am Knochen und an der Emmlerhöhe liegt das namengebende Typusgebiet dieser „Raschau- Formation“. An den Ausstrichen des Emmlerquarzits finden sich die schon erwähnten „Quarzbrockenfelse“, in deren Zwickeln und Klüften es zu unregelmäßig nesterförmigen Anreicherungen von Eisenerzen (Limonit) und Manganerzen (Psilomelan, Pyrolusit) gekommen ist. Diese sind der Hauptgegenstand des Bergbaus nördlich der Emmlerhöhe gewesen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Ursprung der Bezeichnung „Quarzbrockenfels“ bilden vermutlich die Reiseberichte aus der Hand von August Breithaupt (*1791, †1873, ab 1826 Professor für Mineralogie an der königl.- sächs. Bergakademie zu Freiberg), welcher im September 1818 in Begleitung der damaligen Bergakademisten Schütz und Scheidhauer durch die Geognostische Landes- Untersuchungskommission beim Oberbergamt in die Region östlich Schwarzenbergs entsandt worden ist (40003, Nr. 61 und 217). Jedenfalls beschrieb er als Erster diese ungewöhnliche und vor allem im Schwarzbachtal vorkommende Gesteinsart näher. Weil er dabei natürlich auch die uns hier interessierenden, zu seiner Zeit gangbaren Eisen- und Braunsteinzechen befahren und mehr oder weniger ausführlich beschrieben hat, zitieren wir folgende längere Auszüge aus seinem chronologischen Abriß der Reise (40003, Nr. 217, Seite 58ff): Reppels Fdgr.: Glimmerschiefer, Eisenstein und Mulm Lager. „Am 9ten September. Nachdem ich Schützen und Scheidhauer besonders angewiesen, auch Mineralien gepackt worden, begann ich die Gegend des linken Gehänges des Schwarzbachthales, welche seit Jahrhunderten durch Eisenstein- und Braunstein- Bergbau bekannt ist, zu untersuchen, und fuhr zu dem Ende zunächst auf Reppels Fdgr. an, die auf dem linksseitigen Abhange unterhalb Langenberg liegt. Diese Grube ist ehemals wahrscheinlich nicht blos des Eisensteins, sondern auch des Kieses wegen betrieben worden. Der hier vorkommende Eisenstein ist theils ein aus strahligem Sahlit umgewandelter Rotheisenstein, der hier wegen der ursprünglichen und jetzt noch erkenntlichen Struktur Feierstein heißt, theils ein Übergang von dichtem Eisenglanz in dichten Rotheisenstein, welcher längere Zeit an der Luft gelegen eine Neigung ins Blaue zeigt und deshalb Blaueisenstein genannt wird. Das sonst in der Farbe enthaltene Roth scheint nämlich an der Oberfläche ausgewaschen zu werden, denn unlängst geförderte Stücke waren nicht so bläulich. Der Schacht ist 8 Lachter tief in Glimmerschiefer niedergebracht. Durch aufgegangene Wasser war das Tiefste aber nicht fahrbar. Vom oberen Füllort fuhr ich 15 Lachter in Nord. Hier stand der Glimmerschiefer in der Förste noch aus, dann kam eine Lage Feierstein ¼ bis ½ Lachter mächtig, darunter ein Braunsteinmulm, eben so mächtig, dann eine Lage graue Wacke, wie es schien ein aufgelöstes Trappgestein, 8“ bis 10“ mächtig, aber nicht noch mit Mulm durchzogen. Zuunterst der sogenannte Blaueisenstein, der um so reiner, je fester und horniger die Wacke darüber war. Die Mächtigkeit des untersten Eisensteins war hier nicht ersichtlich, doch soll sie über ½ Lachter betragen. In der Teufe ist man mehrmals auf Kiese und nahmentlich vom Schachte gegen Morgen auf Arsenickkiese gekommen. Dieses Eisen- und Braunsteinlager machte hier, bey übrigens sehr geringer Abweichung von der Horizontallinie, einige wellenförmige Biegungen, so daß eine Hauptrichtung schwer zu bestimmen war, die ich indessen doch noch als eine östliche erkannte. Wenig Lachter von Reppels Fdgr. in N.O. wird ein neuer Schacht abgesunken, welcher bis in die Teufe von 7 Lachter gebracht, blos in Glimmerschiefer steht.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit den folgenden Sätzen A. Breithaupt's wird nicht die Felsklippe auf dem Emmler- Rücken, sondern der „Knochen“ westlich des Sattels, über welchen heute der Mühlweg von Raschau nach Langenberg verläuft, beschrieben (40003, Nr. 217, Seite 61ff). Brockenfels am Raschauer Felsen. „Von hier wendete ich mich nach der vorliegenden Anhöhe des Seitenjochs zwischen dem Schwarzenberger und dem Raschauer Thale und zwar zunächst nach dem Felsen, welcher hier der Raschauer Fels heißt. Gleich im Walde stieß ich auf einen noch offenen Schurf, welcher in einem grosbröcklichem, quarzigen Gestein aufgeworfen worden war, und man scheint etwas grauen Brauneisenstein gefunden zu haben. Dieses quarzige Gestein, welches wir in hiesiger Gegend noch so häufig getroffen, bezeichne ich, um die Beschreibungen abzukürzen, unter dem Nahmen Brockenfels. Es besteht derselbe stets aus einer quarzigen Hauptmasse, gemeinkörnigem bis dichtem Quarz, Hornstein, grau und roth, und Jaspis, besonders roth. Der eigentliche Quarz ist immer vorwaltend. Diese Gebirgsmasse haben wir kaum einmal von einer anderen Struktur als der der Zerklüftung angetroffen, gemeiniglich hat sie das Ansehen von durch und über einander gestürzten scharfkantigen Wänden und Brocken, die man für Konglomerattheile erkennen würde, wenn sie stumpfkantig wären. Alte Halden. Weiter hinauf bis nahe an den Felsen lagen viele kleine und sehr alte Halden, bey denen man nicht mehr auffinden konnte, worauf man hier gebaut hatte. Wahrscheinlich sind es aber Braunstein- und Eisensteingruben gewesen. In südlicher Richtung lag der Jlling’sche Kalkbruch auf nämlichen Seitenjoche vor mir...“
Dem Abbau des Kalksteins in dieser
Region haben wir bereits einen separaten
„Auf dem Wege dahin vom Felsen bis so weit der Busch reichte, war das ganze Terrain mit alten Halden gleichsam übersät. (Ich) konnte jedoch nicht bestimmt Züge derselben erkennen. Von Erzen fand ich nur bei einigen Rotheisenstein. Es ist hier also wahrscheinlich auch Eisensteinbergbau gewesen, und vielleicht, daß man auch Kiese hier gehabt. Überhaupt ist in dieser ganzen Gegend zwischen Schwarzenberg und Elterlein eine nicht zu zählende Menge kleiner Halden.“ Interessanterweise geht Breithaupt auf den Kieserzabbau entlang des Allerheiligen Gangzugs unmittelbar am Kochen hier nicht ein. Aber hier interessiert uns ja der Eisensteinbergbau ‒ also lesen wir weiter:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brockenfels im Thale zwischen Reppels Fdgr. und dem Graul. „Von hier kehrten wir nun über Reppels Fdgr. und dann in gerader Richtung nach dem Graul zurück. Hier fand sich im Thale zu Tage anstehend wieder Brockenfels, der allermeist aus Jaspis bestand und auf dessen Klüften Roth- und Brauneisenstein lag. Man hatte auch dicht dabey, mehr nach Stamm Asser zu, einen Schacht, den Hahn, darin abgesunken, der nun wieder zusammengebrochen war. Die hier erlangten Erze waren hauptsächlich dichter Eisenglanz, auch Eisenglimmer mit Schwarzeisenstein und Braunstein. Der Anbruch soll sehr regelmäßig und der Bau wegen großer Festigkeit des Gesteins zu kostspielig gewesen sei (...) Weiter aufwärts verlor der Brockenfels das Eisenschüssige und wurde reinerer Quarz, stellenweise sogar amethystartig. Der Brockenfels stand zwar bis zur Grauler Arsenikhütte nicht mehr an, lag in einer Menge Stücke herum. Ich suchte nun die weitere Verbreitung dieses sonderbaren Gesteins auszumitteln und fand, daß es sich von der Grube Hahn wohl noch auf 1000 Schritte im Thale und dessen nordöstlichen Gehänge aufwärts ziehe. Auch in dieser Ausdehnung lagen einige kleine alte Halden, wo man auf Eisenstein und Braunstein gegraben haben soll. Es scheint also, daß das Vorkommen des Eisensteins und Braunsteins, wo sich der Brockenfels hier findet, durch diesen besonders bedingt sey.“ Der hier genannte Schacht namens ,Hahn' steckt übrigens auch in der Flurbezeichnung für den Straßenübergang von Langenberg nach Waschleithe am niedrigsten Punkt des Sattels zwischen Schwarzbach- und Oswaldbachtal, der vielen Einheimischen noch heute auch als Roter Hahn bekannt ist. Weitere Verbreitung des Brockenfelses am Graul. Gnade Gottes Fdgr.; eine Eisensteingrube. „Fortsetzung am 10ten September. Selbst bey und hinter den Gifthütten*) am Graul ist der Brockenfels verbreitet und es sind dabey überall kleine Pingen und Schürfe zu finden. Von hier weiter in N. O. erschien er auf der Mitte des Trennjochs zwischen dem Schwarzbachthale und Oswaldsthale, welches letztere den Graul von dem Fürstenberge trennte, in starker Verbreitung und schien lichte Stellen im Walde, vermöge seiner Steilheit, zu verursachen. Dicht vor dem Busche liegt auch die noch gangbare Eisensteingrube Gnade Gottes Fdgr. Eigenthum des Herrn von Elterlein.*) Man gewinnt hier dem Brockenfels, aus Eisenkiesel, Quarz und Jaspis bestehend, samt den darin in Gangklüften und unregelmäßigen Nestern brechenden, ockrigen, dichten und fasrigen Eisenstein zusammen herein, und liefert auch ziemlich dies Ganze, etwa den reinen Quarz in größeren Massen ausgenommen, zur Hütte. Braunstein und Schwarzeisenstein sind hier selten. Bey dem geringen Eisengehalte des Eisenkiesels und des Jaspis kann ich mir jedoch es nicht anders denken, als daß die Mitanlieferung dieses Gesteins in jeder Art Nachtheil hervorbringen müsse. Daher mag es auch kommen, daß der hiesige Eisenstein als ein geringer in keinem besonderen Werthe steht. Dermalen war die Grube nicht belegt und konnte ich solche nicht befahren. Neben der von Zeit zu Zeit noch bebaut werdenden Grube sind noch drey sehr große Pingen, welche deutlich dafür zeugen, daß hier große Quantitäten Eisenstein müssen gefördert worden sein.“ *) Hier irrte Herr Breithaupt: Die Gnade Gottes Fundgrube befand sich zu dieser Zeit im Eigentum des Hammerherrn und Bergkommissionsrates Carl Heinrich Nitzsche auf Erla – aber darauf kommen wir im montanhistrischen Kapitel noch ausführlich zurück. Mit den ,Gifthütten' ist das Vitriol- und Arsenikwerk am Graul gemeint. Ein zweites solches Werk bestand übrigens auf Raschauer Seite unterhalb des Knochens und verarbeitete die Kieserze aus den Gruben, die auf dem Allerheiligen Gangzug bauten. Zurück zum Text: Förstel. Brockenfels und Basalt. „Von hier wendete ich mich nach dem Ritterguthe Förstel bey Langenberg, welches im Schwarzbachthale liegt, bis wohin auf den Feldern der Brockenfels umher liegt, und besonders dicht vor Förstel sind ungewöhnlich große Blöcke davon anzutreffen. Im Thale selbst nahe von dem Bache findet sich auch immer fast nichts als Basalt in einer Anzahl von kleinen abgerundeten Blöcken, wie er fast allenthalben und auch dicht bey anstehenden Massen desselben vorzukommen pflegt. (...)“ Die heutige geologische Karte weist kein Basalt- Vorkommen im Schwarzbachtal aus. Möglicherweise waren es ja Gerölle jener längst von der Erosion abgetragenen Basalt- Decke, deren Rest heute der Scheibenberg bildet, was Herr Breithaupt hier beschrieb. Auch oberhalb Schwarzbach's in Richtung Elterlein will er zu seiner Zeit große Blöcke und Säulen davon gefunden haben, wenngleich nirgendwo anstehend. Deshalb aber weist er auch auf der seinem Reisebericht beigefügten Karte (40003, Nr. 217, Blatt 330) im Schwarzbachtal mit schwarzer Farbe dieses Basaltvorkommen aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kehren wir wieder zu dem Text August
Breithaupt's aus dem Jahr 1818 zurück (40003, Nr. 217, Seite 71ff):
„Ich nahm nun meinen Weg nach den Braunstein- Eisenstein- Gruben, die am linksseitigen Gehänge des Seitenjochs und zwar meist in dem hier sehr ausgedehnten Busche liegen.“ Braunstein und Eisensteingruben oberhalb Förstel. „In diesem Busche liegt hier eine kleine Pinge an der anderen, aus älterer und neuerer Zeit. Drey Gruben sind hier noch gangbar, zuerst bin ich zur Christbescherung Fdgr., etwa 20 Lachter weiter hinauf zu Friedrich Fdgr. und endlich von beyden etwa 40 bis 45 Lachter in Abend Gelber Zweig Fdgr. Zuerst fuhr ich auf Friedrich Fdgr., deren Lehnträger Schubert heißt. Der lange Stoß des Fahrschachtes stand in St. 3,3, dieser selbst war beyläufig 7 Lachter tief. Ich fuhr vom Füllort 11 Lachter vom kurzen Stoß weg in N. W. und fand überall vorherrschend ein aufgelöstes Gestein mit vielem Glimmer, so daß ich geneigt bin, es für aufgelösten Glimmerschiefer zu halten. Ferner ist in wenig geringern Frequenz ein konglomeratartiges Gestein, was sich von den bisher gefundenen Abänderungen des Brockenfels durch Beimengung von Glimmer und kleinern Brocken unterschied. In dem erstern, meist gelblich grau gefärbten, aufgelösten Gestein, das die Bergleute hier bald Wacke, bald Mulm oder Gilbe nennen. ist der Braunstein im zerreiblicher Konsistenz zu Hause. Er bildet darin in verschiedenen Richtungen und Lagen, so daß an eine Schichtung oder an eine andere Struktur- Regelmäßigkeit nicht zu denken ist, die meist mehr söhlig, wohl nie saiger sind, Trümer, die sich selten ganz verlieren, wohl aber bis zu 2 und 1 Zoll schwach werden, sich aber auch manchmal zu einem halben Lachter und noch mehr ermächtigen. Eine darüber hinaus gehende Mächtigkeit ist sehr selten. Es erscheinen daher solche Trümer wie schwach, aber doch unter einander zusammenhängende Nester. Nur in den größern dergleichen Nestern liegt nach der Mitte derselben zuweilen fester und dann strahliger fasriger weicher Braunstein, selten Schwarzeisenstein. Auch findet sich hin und wieder Brauneisenstein, besonders dichter, mit Eisenkiesel und Quarz, dazu ein. Die Gewinnung des Eisensteins ist zufällig und Nebensache, und dies umso mehr, da er nur als ein sehr geringer erachtet wird. Eine Merkwürdigkeit bey diesem Bergbau ist, daß es trotz der geringen Teufe der Schächte gewöhnlich an Wettern mangelt, so daß jede Grube zwei nur wenig von einander getrennte und mit einander durchschlägiger Schächte nöthig hat, um Wetterzug zu bekommen. Und liegen diese zwey Schächte über 6 bis 8 Lachter aus einander, so sollen die Wetter oft schon stocken. Ich erkläre dies durch die Natur des Braunsteins, der in der ursprünglichen Entstehung gewöhnlich noch nicht mit Sauerstoff vollkommen gesättigt, denselben frisch angebrochen aus dem Grubenbauen absorbiert und dies kann hier um so leichter der Fall seyn, da der Braunstein meist in mulmiger Beschaffenheit vorkommt, welche das Eindringen des Sauerstoffs erleichtert. Der Bergbau ist hier meist nur eine verkrüppelter Raubbau, wie von armen Eigenlehnern nicht anders zu erwarten. Ich möchte hinzufügen, zu fordern ist. Friedrich Erbstolln hatte indessen, wie ich mich bald überzeugen konnte, noch die besten Verrichtungen und auch ziemlichen Anbruch. Eine solche Grube geht überhaupt nur wenige Jahre und oft wird eine in 10 bis 20 Jahren zwey und dreymal verlassen, und wieder aufgemacht. Ferner fuhr ich auf Christbescherung Fdgr. unterhalb Friedrich Fdgr. liegend, deren Lehnträger der Steiger Weißflog ist. Der lange Stoß des Schachtes stand in St. 2, die Teufe betrug 6 Lachter. Vom Füllorte in Ost 10 Lachter gefahren, fand ich die Verhältnisse fast ganz wie auf Friedrich, nur daß hier das aufgelöste Gestein noch lockerer und zusammenhängend war. Obschon die Grube länger als andere in Betrieb gestanden haben soll, so war hier doch keine Strecke und kein Ort weiter zu befahren, da diese Räume, wenn ein Abbau eingestellt wird, gleich wieder mit Bergen eines neuen Orts versetzt werden, obschon die Tageförderung keine sonderlichen Schwierigkeiten haben kann. Der gelbliche Mulm war hier mehr lettig, auch kommt hier mehr Brauneisenstein vor, aber sehr mit Quarzarten untermengt, selten rein. Noch muß ich gedenken, daß ich auf dem kieseligen Brauneisenstein, den man hier den hornigen nennt, ein eignes Fossil in flach nierenförmiger Gestalt fand, was bey einer genaueren oryctognostischen Untersuchung mit keinem anderen specifische Identität hat, und wahrscheinlich ein natürliches Zinkoxyd ist. Von Farbe kam es hier gelblichweiß bis gelblich und lehmbraun, ja auch ölgrün vor, im Bruche aber eben bis muschlig, halbhart in hohem Grade. Endlich fuhr ich hier noch auf Gelber Zweig gevierde Fdgr., deren Lehnträger auch einer nahmens Weißflog ist, und die eigentlich drey Schächte hat, deren doch die beyden oberen dermalen nur als Wetterschächte dienen. Der lange Stoß des untern Schachts, wo ich fuhr, stand in St. 12, die Teufe betrug 6 Lachter. In diesem Gebäude war fast gar kein Bau im frischen Felde zuerkennen, sondern neuer Raubbau, in dem zu Bruche gegangenen der Alten. Übrigens war die natürliche Beschaffenheit wie auf Christbescherung. Der auf diesen Gruben vorkommende Braunstein bedarf keiner sonderlichen Aufbereitung, um Kaufmannsgut zu werden. Zu Tage gefördert, wird er, die natürliche Feuchtigkeit auszutreiben, in der Sonne und an der Luft auf kleinen, hölzernen Bühnen getrocknet, sodann der Eisenstein und die Gilbe ausgeklaubt, und nun, nachdem er vom Geschworenen taxiert worden, zu Centnern in Fässer verpackt, die um 20 Groschen bis 1 Thaler verkauft werden.“ Auf die Geschichte der einzelnen, hier genannten Gruben gehen wir in unseren montanhistorischen Abschnitten noch ausführlich ein. Interessant sind für uns hier aber auch Breithaupt's Angaben zur Aufbereitung, welche ebenso einfach, wie der ganze Bergbau dieser Zeit gewesen ist; der in den Fahrbögen der Berggeschworenen oder in den Grubenaufständen aber nur sehr selten überhaupt erwähnt wird. Keine Erklärung haben wir bis jetzt für den immer wieder ‒ namentlich in den Sommermonaten ‒ und auch hier beklagten Mangel an natürlichem Wetterzug und Frischwettern in den doch eher winzigen Bergwerken. Die Vermutung, daß dieser chemische Ursachen haben könnte (nämlich die Aufoxydation der Manganoxyde im Kontakt mit Luft), lag dem Mineralogen A. Breithaupt sicherlich nahe ‒ wir teilen sie aber, auch wenn wir noch keine bessere Erklärung haben, nicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Herr Breithaupt nun also die Gruben zwischen Langenberg und Raschau besichtigt hatte, wandte er sich weiter talaufwärts in Richtung Schwarzbach (40003, Nr. 217, Seite 78ff): Edelfrau Waldung, Brockenfels, Glimmerschiefer, Braunstein und Eisenstein Bergbau. „In Begleitung des Lehnträgers Schuberts ging ich in dem Gehölze und Busche am Gehänge aufwärts in nordöstlicher Richtung. In der schlecht bestandenen, stellenweise lichten Waldung, welche die Edelfrau heißt, lagen eine Menge Blöcke des Brockenfelses umher, welcher hier meist aus röthlichem, splittrigen Hornstein bestand, und nun stieß ich bald wieder auf viele Schürfe und kleine alte Halden. Die Klüfte des Hornsteins waren oft mit Braunstein belegt. Nun kam ich bald an Schubert Fdgr., eine Fristzeche, wo ein fester und mulmiger Braunstein gebrochen haben soll. Schubert sagte mir, daß hier unter dem Mulm, worin die Braunsteine wie auf den Langenberger Gruben vorkommen, fester Schiefer läge, in dem Gänge anzutreffen seyen, wie der von Stamm Asser und Gottes Geschick. Weiter aufwärts fand sich auch wirklich wieder eigentlicher Glimmerschiefer, wenngleich schon zerstreut in einer Anzahl von das ganze Gebirge bedeckenden scharfkantigen Stücken und Blöcken aus Brockenfels. Hierauf kam ich zu Trommlers Fdgr., jetzt Fristzeche, wo man viel Brauneisenstein und Eisenkiesel gefördert hatte, auch etwas Schwarzeisenstein und Braunstein, letzteren sehr mehr stengelig und fasrig. Oberhalb dieser Grube war wieder die Gegend wie mit Hornstein Brockenfels übersäet, und eine Menge kleiner Halden und Schürfe zeigten auch hier, daß in solchem Gebirge fast überall Eisenstein und Braunstein zu finden sey. Auch hier bey Trommlers Fdgr. soll man bey mehrer Teufe auf festen Schiefer gekommen seyn. Schade, daß alle diese Gruben zu wenig Tiefe dermalen bauten, als daß man mit Gewißheit auf die in der Teufe vorkommende Gebirgsart schließen konnte, ob es Schiefer oder festre Masse des Brockenfels war, wie ich aus Mangel an vorkommenden Glimmerschieferstücken vermuthe. Von Trommlers Fdgr. nahm ich die Richtung nach Schwarzbach. Gerade da, wo noch unterhalb Schwarzbach ein Stück Feld einen spitzen Winkel in den Busch hinein macht, befand sich unter den Brockenfels viel stänglicher Quarz und Amethyst. Auf meinem Wege berührte ich noch die Fristzeche Kästners gev. Fdgr., wo unter den schon erwähnten Verhältnissen Brauneisenstein, Eisenkiesel, Jaspis, auch Braunstein vorkommen, alles auch nur in Nieren und Nestern in braunem und gelbem Mulm. Da ich nach dem Bache zu wieder größere Blöcke wahrnahm, so ging ich bis dahin und fand das Gestein meist hornsteinartig vorstehend. Mein Begleiter gab vor, daß man in trockener Zeit schöne Eisensteinstückchen im Bache finden könne. Es ergab sich also bis hierher eine große Identität der Gebirgsmasse und dem darin vorkommenden Erzen in dem begangenen Distrikte. Nun kam ich nach Schwarzbach und hier lag zunächst Meiers gev. Fdgr. an der Ecke des Tännig genannten Waldes, der östlich vom Dorf liegt. Obwohl sie in Betrieb stand, konnte ich sie doch nicht befahren, weil die Arbeiter schon ausgefahren waren. Es soll hier der Brauneisenstein in bessrer Qualität und Quantität vorkommen, und der Braunstein, welcher bey vorerwähnten Gruben die Hauptsache ist, wird hier nicht berücksichtigt.“ Nun, das stimmt nicht ganz: Bauwürdige Braunstein- Vorkommen haben auch die Betreiber von Meyers gevierter Fundgrube natürlich nicht liegengelassen, sondern bei Gelegenheit ebenfalls ausgebracht und dann verkauft. Die Schreibweise dieses Grubennamens ist übrigens bei jedem Geschworenen (und manchmal sogar in jedem Fahrbogen) anders: Unserer Kenntnis nach schrieb der damalige Besitzer des Tännichtgutes, Karl Gottlieb Meyer, seinen Namen selbst aber mit dem Ypsilon. Doch noch ein letzter Abschnitt aus Breithaupt's Bericht: „Ich ging nun durch Meiers Gut (dies Gut war ehedem, so wie Förstel, ein Hammerwerk) ins Dorf Schwarzbach und traf hier allenthalben auf Basalt, daß man kaum einen andern Stein sahe. Die Blöcke und Säulen waren hier meist größer und dicker, als zu Förstel. Er ist von der ihm gewöhnlichen schwarzen Farbe und enthält Augit häufig eingesprengt. Olivin habe ich nicht darin gesehen. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß Dorf und Thal ihren Nahmen von dem schwarzen Stein erhalten haben. Zu Tage ausstehend in zusammenhängenden Massen oder Säulen traf ich zwar keinen Punkt, daß jedoch diese mächtige noch über das Dorf hinaus besonders rechtsseitig vom Bache verbreitete Steinmasse hier umso (?) aufgelagert seyn müsse, ergab sich aus mehreren Gründen. (...)“ Damit sind wir erneut beim Basalt angelangt... Die nachstehenden Erklärungen schenken wir uns, wer will, kann im Originaltext ja selbst weiter lesen. Wir müssen bei unseren eigenen Exkursionen in dieser Region aber unbedingt darauf achten, ob es hier tatsächlich Basalt- Gerölle in diesem Umfang gibt... Auch der hier von Breithaupt gebrauchte Flurname ,Edelfrau Waldung' ist uns neu, allerdings muß es hier auch kurfürstl.- königlichen Forst oder eben einen ,Königswald' gegeben haben. Die Befahrung auf Meyer's Fundgrube holte Herr Breithaupt später nach (40003, Nr. 217, Seite 240f):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meyers Hoffnung Fdgr. Brauneisenstein und Brockenfels „Auf Meyers Hoffnung fuhr ich 5 Lachter hinein und allda in St. 8,5 S. O: auf der Strecke ¾ Lachter fort bis an eine in St 1,1 S. W. abgehende Strecke, auf derselben und bis vor Ort, wo etwa ¼ Elle mächtig Brauneisenstein anstand, als eine ganz unregelmäßige Lagerstätte, deren Umgebung aus eisenschüssigem Gruse und Sand zu bestehen schien. Von hier kehrte ich nach dem Schachte zurück und fuhr in demselben 2 Lachter höher, dann 1 Lachter St. 1,3 gegen N. O. bis zu einer abgehenden Strecke, auf dieser 2 ½ Lachter in St. 8,6 N. W., weiter und endlich 4 Lachter in St. 11 ging vor Ort ein 1 ¼ Lachter tiefes Gesenke nieder, worinnen die Waßer aufgehen wollten. Das Lager besteht hier aus einem eisenschüssigen Gneuse mit viel Quarz in großen ockrigen Stücken und scheint hier unter 15 bis 20° in St. 10,5 in N. W. zu fallen. Von da zurück bis auf die in St. 11 getriebene Strecke, von dieser in St. 2,4 S. W. fuhr ich auf einer ansteigenden Strecke, wo das Lager unter 35° in St. 2,4 S. W. zu fallen schien. Vor dem Orte dieser Strecke war wieder das Fallen in St. 7,4 in N. W. unter 25° und hier bestand das Gestein mehr unfesten (?) Quarze Hornstein und Glimmerschiefer und es schien, als sey man in das Dach des Lagers gekommen. Da so abweichende Fallen hängt wahrscheinlich von einem von dem Grundgebirge empor geschobenen Buckel ab, denn fast nach allen Seiten hin (abfällt?). Hiermit war ich die ganzen Baue durchfahren. Das hier gewonnen werdende Eisenerz ist theils ein beßrer harter dichter Brauneisenstein von muschlichem Bruche, theils ein von Eisen nur sehr stark durchdrungener Eisenkiesel in gemeinem Jaspis übergehend. Auch soll Stilpnosiderit gefunden worden sein.“ Die Mineralbezeichnung Stilpnosiderit haben wir auch unter historischen, heute ungebräuchlichen Namen suchen müssen und herausgefunden, daß damit früher erdige, wasserhaltige Aggregate von Limonit benannt worden sind. Auch die Bezeichnung ,Pecheisenerz' wird als Synonym dafür angeführt. Die chemische Zusammensetzung wird mit FeOOH · n H2O angegeben (mindat.org). Fehlt uns noch die alte Eisensteingrube Vater Abraham bei Oberscheibe, die zu dieser Zeit ebenfalls in Umgang stand. Diese hat Herr Breithaupt am 2. Oktober 1818 besichtigt und berichtete darüber (40003, Nr. 217, Seite 267f):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brauneisensteinlager auf Vater Abraham Fdgr. „Auf der Halde von Vater Abraham lag eben ein ziemlicher Vorrath frisch geförderten Eisensteins und ich will daher diesen zunächst beschreiben. Der größte Theil ist ein dichter Brauneisenstein, im Großen meist dicht und undeutlich schiefrig. Nicht selten sind die Klüfte der schiefrigen Klüfte losgezogen und bilden so kleine flache Trümer, welche meist mit fasrigem Brauneisenstein erfüllt sind, der gewöhnlich stalaktitische Gestalten annimmt. Jene Klüfte sind aber auch zuweilen von Stilpnosiderit ausgefüllt, der sich hier in der größten Auszeichnung findet und ebenfalls in seltenen Fällen stalaktitisch gebildet ist. Noch soll zuweilen Schwarzeisenstein sehr schön mit beybrechen, doch konnte ich davon nur schwache Spuren auffinden. Der Eisenstein ist übrigens zu Stabeisen von vorzüglicher Güthe, zuweilen, wenn er rein bricht und nicht von schwachen Lagen aus Gebirgsgestein durchzogen wird, was zuweilen der Fall ist. Ich fuhr 18½ Lachter im Tageschacht hinein und dann in N. 3 Lachter bis Radstube, von hier in S. W. 12 Lachter bis Kunstschacht und diesen 8½ Lachter hinein. Hierauf hatte ich noch 12 Lachter bis zum dermaligen Abbau, welcher sich 5 Lachter in S. erlängt hatte, und von wo bis Ortstoß ungefähr 9 Lachter seyn möchten. Der Abbau zeigte keine sonderliche Regelmäßigkeit der Gebirgsstruktur und namentlich war eine deutliche Schichtung umso weniger zu erkennen. Als das Eisensteinlager hier (?) Biegungen machte und von schnell abweichender Mächtigkeit war, nahm ich ½ bis 1¼ Lachter. Und darüber blieb mir kein Zweifel, daß die Erzlagerstätte ein Lager sey. Die Schichtung lag zum Theil horizontal, zum Theil schien es sich bis zu 15° in S. zu neigen. Ich durchfuhr nun noch alle fahrbaren Örter und Schächte der Grube, ohne auf eine geognostische Merkwürdigkeit zu stoßen. Das Hauptgestein war Glimmerschiefer. Daß auch Gneis im Gebiete der Grube vorkomme, vermuthe ich sehr, weil das zu Tage umherliegende Gestein allermeist aus Gneis bestand.“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Grubenakten zu Friedrichs gevierter und
Gnade Gottes
Fundgrube bei Langenberg aus dem Bestand des Bergamtes Schwarzenberg (40169,
Nr. 95, Blatt 8ff weitere Abschriften in 40169, Nr. 128, Blatt 21ff
und 40169, Nr. 138, Blatt 2a sowie in 40169, Nr. 286, Blatt 1f) haben wir folgenden Auszug aus einem Generalbefahrungsprotokoll des Bergamtes Annaberg über die bei Langenberg
gelegenen Eigenlöhnergruben vom 7. Juli 1820 gefunden, dessen Verfasser wir aber
nicht kennen. Hierin sind die örtlichen Verhältnisse ebenfalls beschrieben.
Kurze Beschreibung des Langenberger Eisen- und Braunsteinlagers. „Die beiden jetzt bekannten Eisen- und Braunsteinlager, auf welchen in neueren Zeiten so bedeutender Eigenlöhnerbergbau betrieben wird, setzen am linken Ufer des Schwarzbachs auf. Die Lager selbst gehören zu denen, welche aus mehreren Erzarten zusammengesetzt sind, bei welchen die eine mehr als die andere vorwaltet, ohne das selbige abwechselnd in gleichen Verhältnissen gemengt sind. Die Extension in die Länge und Breite ist durch die vielen, auf selbigen angelegten Eigenlöhnergruben, als auch die noch mehrern Schurfarbeiten ziemlich bekannt geworden, so daß mit Gewißheit folgendes anzugeben ist. Sie ziehen sich aus Morgen gegen Abend ziemlich parallel zu dem dasigen Gebirgsrücken, an dessen nördlichen Abfalle nach dem Schwarzbach auf ½ Stunde hin, haben daher ein verschiedenes Streichen, wie denn auch ihre Mächtigkeit und die Teufe, in welcher sie gefunden werden, hiernach verschieden sind. Gegen Morgen sind sie weiter nicht bekannt und müssen daselbst entweder unter dem kaum 120 Lachter von Meyers Hoffnung östlich gelegenen, stark bebauten, dem Anschein nach in den dasigen Gneus muldenförmig eingelagerten Kalkstein oder über denselben fortsetzen, welches letzteres indes, weil das Gebirge zwischen gedachter Grube und dem Kalkbruch keine Biegung macht... nicht ganz gut anzunehmen sein möchte. Und wie die östliche Fortsetzung dieser Lager zur Zeit noch nicht eruiert worden, so ist auch die ernstliche Extension des Kalklagers ebenfalls unbekannt und von beiden zu vermuthen, daß sie sich zwischen dem Kalkbruche und Meyers Hoffnung auskeilen dürften, worüber der weitere Betrieb bei Meyers Hoffnung erst nähern Aufschluß geben muß. Das erstere derselben, ein Braunsteinlager, worauf die Gruben Meyers Hoffnung, Friedlich Vertrag, Freundschaft, Christbescherung, Friedrich, Gelber Zweig, Köhlers Hoffnung, Riedels und Grün Zweig bauen, setzt in ohngefähr 8 bis 15 Lachter saigerer Teufe, über dem Bette des Schwarzbachs auf, wechselt in seiner Mächtigkeit von ⅓ bis 1½ Lachter und 2 Lachter und darüber ab und fällt gewöhnlich zwischen 10 und 20 Graden gegen Mitternacht, verändert sich aber hierin... sehr verschiedentlich nach den Neigungen des Gebirges. Über die Bestandtheile des Braunsteinlagers hat man bei... Meyers Hoffnung die besten Aufschlüsse bekommen. Es ist gegen 1 Lachter mächtig, fällt ziemlich unter 15 bis 20 Graden in Mitternacht und besteht von der Sohle weg aus mildem, sehr eisenschüssigen Gneus, Quarz, braunem Hornstein, gelbem Ocker, Braunstein und dichtem Brauneisenstein, welche Bestandtheile sämtlich sehr verschiedene unbestimmte Mächtigkeit haben, daher die Eigenlehner, wie es die Verhältnisse mit sich bringen, bald auf Eisenstein, bald auf Braunstein ihre Baue verführen. Das zweite dieser Lager hat man bei Reppels Fundgrube in dasigem Fundschachte sowohl, als auch vor dem aus selbigem gegen Mitternacht getriebenen Orte sehr regelmäßig geschichtet, gegen 14 Grad in Morgen fallend, auf ¾ Lachter mächtig befunden mit folgenden Verhältnissen von der Sohle weg: 13 Zoll mächtig
gelber Ocker, Der Braunstein bricht bald in der Gestalt von Schwärze, bald derb, bald strahlig und crystalisirt, der Brauneisenstein nur derb, nicht selten aber auch als Glaskopf.“ Anmerkung: Die Angabe in diesem Text, daß die Lager im ,Gneus' aufsetzen, ist unzutreffend, in ihrem Liegenden findet sich Glimmerschiefer, wie es auch die alten Geologen schon richtig beschrieben haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein weiterer geognostischer Reisebericht
stammt aus der Feder von
August Nicolai und aus dem Jahr 1834 (40003, Nr. 159). Darin
berichtete dieser unter anderem über den:
Brockenfels bei Raschau. „Nördlich vom Raschauer Bade erhebt sich auf dem Gebirgsjoch zwischen der Mittweida und der Schwarzbach eine steile Felsenkuppe von Brockengestein, an deren südöstlichem Abhang ein Alaunwerk und am östlichen und nördlichen mehrere Gruben, welche auf Rotheisen und Braunstein, sowie Schwefel- und Kupferkieslagern theils gebaut haben, theils noch getrieben werden. Der Brockenfels steht in großmassigen, scharfkantigen Blöcken zutage aus, dessen Hauptmasse aus Hornstein von perlgrauer bis röthlich schwarzer Farbe besteht, in welchen überall Parthien von weißen, dichten und crystallinischem Quarz mit einer schwarzen Kruste von Rotheisenstein überzogen (der Quarz ist gleichsam eingewickelt) inneliegen. Hinter den Hütten des Alaunwerkes ist ein Stolln zur Erschrotung von Wasser angesetzt und bis 17 Lachter in den Berg fortgebracht. Vom Tage herein steht dieser Stolln in Zimmerung, da wo dieselbe endiget, erscheinen Bruchstücke von Glimmerschiefer ähnlichem Gestein und Brockengestein ganz wirr unter einander, je weiter man aber fährt, je seltener werden diese schiefrigen Gesteinsparthien und endlich ist der Stolln bloß in Brockenfels getrieben. Die über die Verhältnisse des Glimmerschiefers zu dem Brockengestein den einfachsten Aufschluß gebenden Baue von Allerheiligen Fdgr. sind jetzt größtentheils verbrochen und bloß in einem, am nördlichen Gehänge bis auf den Oberen Bruder Breslau Stolln niedergefahrenen Tageschacht ist das Einschießen der Glimmerschieferschichten Std. 5,6 unter 25° - 27° in O. abzunehmen. An einem Puncte des Stollns erschien im Liegenden das Brockengestein auf dem Glimmerschiefer aufgelagert. Der Glimmerschiefer ist im Schacht sowohl als auf dem Stolln sehr porös und die ausgehauenen Räume erscheinen gleichsam verglast. Westlich vom Mundloch des Bruder Breslau Stollns stehen am linksseitigen Gehänge des Schwarzbachthales mehrere Felsen eines Glimmerschiefergesteins zu Tage aus, dessen obere Schichten mehr in Thonschiefer und dessen untere in Gneus übergehen…“ Aus all diesen Berichten wurden sukzessive verschiedene Kartenwerke zusammengestellt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Verleihkarte mit der Lage der Gruben und Vorkommen von Brockenfels und Kalkstein, Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003, Nr. i443, Ausschnitt, Norden ist rechts oben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Übertragung geologischer Erkenntnisse in die Verleihkarten, Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003, Nr. i494 und Nr. i487, aneinandergefügte Ausschnitte, Norden ist rechts oben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Zusammenfassung bildeten schließlich die
großmaßstäblichen geognostischen Karten des Königreichs Sachsen. Die Region und auch die am Knochen auf Kieserze bauenden
Gruben wurden auf Grundlage dieser Reiseberichte dann auch im 2. Heft seiner Erläuterungen zu den geognostischen Karten des Königreichs Sachsen 1845 von
Carl Friedrich Naumann erwähnt (S. 227, unter d.) Die Raschauer Lagergruppe.).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der Industrialisierung ab den 1830er Jahren
hatte der Eisenstein- und Braunsteinbergbau noch einmal an Bedeutung gewonnen. Aufgrund
der Lagerstättensituation und dem schon lange zurückreichenden Bergbau hielt
diese letzte Phase aber bei den meisten Gruben, die nur noch Restpfeiler in
alten Bauen hereingewannen, nicht mehr lange an. Bereits mit dem Ende der
Gründerzeit in den 1870er Jahren ging der aktive Bergbau wieder stark zurück.
Nur einige wenige Gruben hatten noch bis Ende des 19. Jahrhunderts Bestand.
Der Berggeschworene Johann August Karl Gebler, der in den 1830er Jahren im Bergamt Scheibenberg für die Aufsicht über die im Umgange stehenden Gruben zuständig gewesen ist, führte ab 1835 Tabellen über den Betrieb der einzelnen Gruben (40014, Nr. 289, Film 0138). Hinsichtlich der Eisenstein- und Flößzechen findet man darin wiederholt die fast wortgleiche Bemerkung: „Die übrigen Eisensteinzechen, ingleichen die Braunsteinzechen sämtlich hier anzutragen, würde ihrer geringen Bedeutung wegen und besonders wegen der in der Natur der Sache gegründeten Unregelmäßigkeit der Abbau Methode auf denselben unräthlich bleiben. Die vorzüglichsten derselben sind:
An Eisensteinflößzechen verdienen
Sie sind sämtlich mit 2 bis 5 Mann belegt. Sämtliche Eisenstein- und Braunsteingruben dieser Revier Abtheilung bauen nicht sowohl auf eigentlichen Lagern, sondern anscheinlich mehr nur auf einzelnen, nach verschiedenen Richtungen... vorkommenden Lagerstücken, Brocken oder Batzen des Hauptlagers, welches in dergleichen an einander gereihten (unleserlich ?) in das hiesige Gebirge eingeschobenen Stücken zwischen dem Scheibenberg und dem Fürstenberg, mithin in der Richtung von Std. 6 bis 8 vorhanden zu seyn scheint.“ Der wieder abnehmenden Bedeutung geschuldet, erwähnte auch C. Gäbert in den Erläuterungen zur geologischen Karte, Blatt 138, das Auftreten des Quarzbrockenfelses und Eisensteins schon in der 2. Auflage der Erläuterungen 1901 nur noch kurz (am Ende des Kapitels zum Muskovit- Glimmerschiefer). Hinsichtlich der Erzgänge verwies er nur noch auf die Abhandlung von Carl Hermann Müller in der 1. Auflage von 1894.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blatt 137
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnittsvergrößerung aus der Geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen, Blatt 137: Section Schwarzenberg-Aue, 1. Auflage. Mit der roten Kreuzschraffur und einem ,Q´ ist hierin das Auftreten der Quarzbrockenfelse am rechten Blattrand gekennzeichnet. Riedels Fundgrube ist 1882 noch vermerkt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Östlich angrenzender Ausschnitt aus der Geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen, Blatt 138: Section Elterlein-Buchholz, 2. Auflage 1900. Wir finden hier noch Gnade Gottes (am linken Blattrand nördlich des Schwarzbachs), Ulrike und ihr gegenüber Friedrich Stolln, Wilkauer vereinigt Feld und neben den dunkelblau eingetragenen Kalksteinbrüchen am Tännichtgut Meyers Hoffnung Fdgr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnitt aus der Geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen, Blatt 138: Section Elterlein-Buchholz, 2. Auflage 1900. Nordwestlich der Oberscheibe'ner Kalksteinbrüche (dunkelblau, südwestlich des Scheibenbergs) finden wir hier auch noch immer die Eintragung der Grube Vater Abraham (etwa Bildmitte). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der oben schon genannte C. H. Müller
beschrieb in dem 1894 gedruckten Ergänzungsheft der Erläuterungen zu den
geologischen Spezialkarten zu den Erzvorkommen im Annaberg'er Bergrevier unter
anderem auch die (a. a. O., S. 104ff):
d. Gänge und Lager der Eisen- und Manganerz- Formation. „Gänge der Eisen- und Manganerz- Formation... finden sich über das ganze Territorium (des Annaberger Bergreviers) theils vereinzelt, theils in Gruppen vertheilt, sowohl in der Gneissformation, als auch in der Glimmerschieferformation. Von erzreicher Entwickelung und bergmännischer Wichtigkeit haben sich aber nur einige in der Scheibenberger Revierabtheilung aufsetzende Eisen- Manganerzgänge und die mit solchen in enger Verbindung stehenden eigenthümlichen Eisen- und Manganerzablagerungen des Quarzbrockenfelses erwiesen... Die ganze Gegend zwischen Scheibenberg, Schwarzbach, Waschleithe, Gottesgeschick und Markersbach giebt ein grosses Bild vielfältiger Entwickelungserscheinungen der Eisen- und Manganerz- Formation, deren Erzgänge und Erzlager dort ein umfängliches Gangfeld im Glimmerschiefergebiet einnehmen. Quarzbrockenfels steht in jener Gegend mit typischer Ausbildung auf der Gebirgsoberfläche an zwei Punkten in größeren Partien an, an dem schon außerhalb des Annaberger Bergreviers gelegenen Raschauer Knochen bei Allerheiligen und am Rothen Hahn... An beiden Punkten stellt sich der Quarzbrockenfels als ein aus krystallinischem, seltener krystallisirtem... Quarz, grauem und rothem bis braunem, sehr eisenschüssigen Hornstein, Eisenkiesel und Jaspis bestehendes, oft zellig- drusiges Gestein dar, welches gewöhnlich durch die stückelige und knorrige Form und regellose Struktur dieser Gemengtheile das Aussehen einer Breccie erhält. Die Zwischenräume und Klüfte, welche letzteren sich zuweilen bis zu förmlichen kleinen Gängen ermächtigen, sind theils mit körnigkrystallinischem oder krystallisirtem Quarze, theils mit Erzen, zumal mit Brauneisenserz, Rotheisenerz, Gelbeisenerz, Stilpnosiderit, sowie mit Psilomelan, Pyroluosit, Polianit oder Wad erfüllt, welche Erze häufig an den Grenzen und in der weiteren Umgebung der Brockenfelsmassen zu förmlichen Nestern, Putzen, Stöcken oder lagerähnlichen Streifen concentrirt und dann von ockerigem Gelbeisenerz, auch erdigem Braunstein, sogenanntem Mulme, in größeren, zum Theil ziemlich mächtigen und umfänglichen Massen begleitet zu sein pflegen. In diesen bekunden häufig eingemengte, weiße Glimmerblättchen, auch größere Brocken von Glimmerschiefer den wenigstens theilweise klastischen Charakter des Brockengesteins, während andrerseits Anhäufungen von grauem, gelbem und weißem Letten oder Kaolin die resultate der Zersetzung und Stoffzuführung durch circulirende Wässer repräsentiren. Merkwürdige mineralogische Erscheinungen in diesen brockenfelsgebilden sind die hier, wie in vielen Eisensteingängen, häufig vorkommenden Pseudomorphosen von Quarz, Hornstein, Brauneisenerz, Rotheisenerz, Psilomelan und Polianit nach jetzt nicht mehr in frischem Zustande dort vorkommenden Kalkspath, Braunspath, Schwerspath und Flußspath, welche Zeugnis von deren ehemaliger Frequenz und zugleich dafür ablegen, daß der ursprüngliche Bestand der sie enthaltenden Ablagerungen mannigfaltigen Umbildungs- und Verdrängungsprocessen unterlegen ist. Unter Berücksichtigung dieser Pseudomorphosen und der beobachteten Superpositionen kann man in den Quarzbrockenfels- und Mulmmassen folgende Altersfolge der hauptsächlichen Mineralien aufstellen:
Interessant ist hierbei, daß der hier vorkommende Psilomelan durch einen beträchtlichen Gehalt (8,7 bis 16 Procent) an Baryterde sich auszeichnet.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat im Heft bei der
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nebenbei erwähnte Herr Müller hierin
auch (S. 45):
Die Gewinnung von verschiedenen Nebenproducte. „Einen Nebenzweig des Annaberger Erzbergbaus bildete ehemals die Gewinnung von Eisensteinflössen, d. h. von eisenoxydul- und kalkerdereichen Gesteinsmassen, wie Amphibolit, Granatfels, Kersantit, Basalt, Kalkstein, welche bei dem Hohofenbetriebe der Eisenhammerwerke zur Bildung einer geeigneten Schlacke zugeschlagen wurden. Solche Eisensteinflösse wurden vormals allgemein als Bergregal- Mineralien angesehen und dementsprechend auch die betreffenden Lagerstätten seitens der Bergämter bergrechtlich verliehen. Durch das Regalberggesetz vom 22. Mai 1851 sind diese Eisensteinflösse aber aus dem Bereiche der Bergregalität ausgeschlossen und dem ausschließlichen Verfügungsrechte der betreffenden Grundbesitzer überlassen worden. Seitdem wird das Ausbringen von Eisensteinflössen nicht mehr in der officiellen Statistik über den Erzbergbau mit angeführt, was übrigens auch ohnedem mit dem Aufhören des Eisenhohofenbetriebes... sich erledigt hat. Die Gewinnung der Eisensteinflösse wurde meistens in steinbruchartigen Tagebauen betrieben. Als die am längsten und stärksten betriebene Flösszeche im Bereiche des Annaberger Bergamtes wird die Treue Freundschaft Fundgrube oberhalb Mittweida... aufgeführt, welche schon im vorigen Jahrhundert gangbar war und nebst den angrenzenden Treue Freundschaft Maaßen in der Zeit von 1801 – 1850 insgesamt 29.072 Fuder (zu circa 13 – 15 Centner Gewicht) gefördert hat.“ Der hier insonderheit wieder genannten Flößzeche
Treue Freundschaft haben wir bereits einen ausführlichen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinsichtlich der Genese der Eisen- und
Mangan- Erzlager kam
Herr Müller zu dem Schluß (a. a. O., S. 118):
„Nach all diesen hier geschilderten Verhältnissen muß die Gegend von Langenberg und Scheibenberg einstmals der Heerd intensiver Processe der Erzgangbildung gewesen sein. In Anbetracht besonders dessen, daß 1. mehrere von den erwähnten Quarz- und Eisensteingängen mit den Quarzbrockenfelslagern zusammentreffen, 2. daß beide Gebilde den gleichen mineralischen Charakter offenbaren, 3. daß bei der bedeutenden Mächtigkeit und Längenerstreckung dieser erzgänge auch eine größere Tiefenerstreckung derselben und damit für die erste Zeit nach der Aufreißung ihrer Spalten die Bedingungen für die Entstehung heißer, mit Mineralstoffen beladener Mineralquellen gegeben warten, ferner 4. daß die mit dem nordwestlichen Hauptzuge des Quarzbrockenfelses bei Langenberg verbundenen Mulmlager in flachen beckenförmigen Vertiefungen des Grundgebirges abgelagert und ausgebreitet sind, in ihrer mineralischen Zusammensetzung den Typus hydrochemischer Ausscheidungen an sich tragen und sich den Sinter- und Ockerabsätzen in der Umgebung noch jetzt thätiger heißer Mineralquellen in anderen Ländern an die Seite stellen lassen, liegt wohl nichts näher, als hinsichtlich der Entstehung unserer Eisen- und Manganerz- Lagerstätten an deren Bildung durch einstige Thermen zu denken. Darüber, in welcher geologischen Zeitperiode diese Quellenthätigkeit begonnen hat, liegen in der hiesigen Umgegend keine directen Beobachtungen vor. Aber bei der großen Verwandtschaft der hiesigen Eisenerzgangbildungen mit den Quarz- und Hornsteingängen, aus welchen im benachbarten Böhmen wichtige Thermalquellen entspringen, die als Folgeerscheinungen der vulkanischen Thätigkeit der dort in der Tertiärzeit emporgedrungenen Basalte anzusehen sind, darf wohl für den Beginn der Quellenthätigkeit und der Mineralabsätze in den Gängen und Lagern der Eisen- und Manganerz- Formation bis auf Weiteres die Tertiärperiode angenommen werden. Daß die Gangverhältnisse der näheren Umgegend von Langenberg der Entstehung von Mineralquellen besonders günstig waren, beweist das Hervortreten mehrerer an Kohlensäure reicher Mineralquellen nahe an der Grenze der Quarzbrockenfelsregion, früher in der 2. Gezeugstrecke und später in der ½ 5. Gezueugstrecke der Grube Gottes Geschick am Graul, in dem... Gottes Geschick Stehenden Gange. Die dortige Hauptquelle ist den alkalisch- salinischen Säuerlingen beizuzählen... Die jetzige Thätigkeit der obgedachten Mineralquellen kann freilich nicht mit derjenigen in den früheren Entwickelungsperioden der dortigen Erzgänge in Vergleich gebracht, darf vielmehr nur als der letzte schwächelnde Act des Gangbildungsprocesses angesehen werden.“ Ob Herrn Müller's Folgerungen zur
Genese der Lagerstätten so zutreffen, wissen wir auch nicht zu sagen. Aber er
hinterließ uns in diesem Heft auch noch eine Zusammenfassung seiner Kenntnisse
über die
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Geologe Richard Beck, Professor an der
Bergakademie, widmete den Langenberg'er Lagerstätten in seinem Buch ,Lehre von
den Erzlagerstätten', dritte Auflage im Jahr 1909, im Kapitel B. Besondere
Schilderung der einzelnen Gangvorkommnisse, Abschnitt a) Formationen mit
wesentlich oxydischen Erzen und darin unter
I. Gänge der Eisen-
und Manganerzformation ebenfalls einen Absatz (S. 268f). Hier heißt es unter
der Überschrift:
4. Gänge von Manganerzen. „In Sachsen finden sich zahlreiche, jetzt aber so gut wie gar nicht mehr aufgeschlossene Vorkommnisse dieser Art in der Gegend von Schneeberg, Aue und Schwarzenberg, die teils im Granit, teils im kontaktmetamorphen Schiefer der Phyllit- und Glimmerschieferformation aufsetzen und, wie schon S. 265 angedeutet wurde, durch Übergänge mit den Eisenerzgängen verknüpft waren. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auf Braunstein bebaut die Gänge auf dem Rothen Felsenstolln und Clarastolln bei Oberschlema und bis auf die neueste Zeit einige bei Langenberg unweit Schwarzenberg. Früher standen die Gruben Spitzleithe, Führung Gottes u. a. in Blüte. In der Gegend von Langenberg trifft man die Gänge der Eisen- und Manganerzformation nach oben hin in direkter Verbindung mit sehr eigentümlichen, schichtig ausgebreiteten Lagerstätten eines Eisen- Manganerzmulmes. Diese Ablagerungen sind teils als Ausfüllungen flacher, beckenförmiger Vertiefungen dem dort herrschenden und von den Gängen durchschnittenen Glimmerschiefer aufgelagert, teils auch bilden sie inmitten der Schiefer Lagerstöcke, welche durch seitliche Imprägnation und metasomatische Verdrängung gewisser Bänke des Nebengesteins entstanden zu sein scheinen (Fig. 146). Sie stehen in engstem Zusammenhang mit mächtigen, oft stockförmig anschwellenden Gängen der Eisen- und Manganerzformation, die wegen ihrer Brekzienstruktur als Quarzbrockenfelse bezeichnet werden.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch Beck ging demnach davon aus, daß Partien der
sedimentgefüllten Taschen in der Glimmerschieferoberfläche einst durch
Imprägnation und Metasomatose in die erzführenden Mulme umgesetzt worden sind.
Da sich diese Lager auf einer Längserstreckung von etwa 2 bis 3 Kilometern in
Südwest- Nordost- Richtung vom Graul bis zum Rothenbach bei Schwarzbach
hinziehen, erscheint es uns aber immer noch unwahrscheinlich, daß sich
metallhaltige Lösungen von den (bei Elterlein und am Graul ja bekannten)
Erzgängen ausgehend über eine solche Distanz ausgebreitet haben sollten, ohne
daß der Metallinhalt auf dem Weg durch Oxydation ausgefällt worden wäre.
Zumindest müßten im Untergrund noch mehrere solcher primärer Eisensteingänge,
bis heute unerkannt, im Glimmerschiefer vorhanden sein... Die geschilderten
Vorstellungen scheinen uns durch die Bildung von Quelltuffen (Kalksande und
Travertin) ‒ was man auch heute noch an zahlreichen Orten unmittelbar beobachten
kann ‒ beeinflußt gewesen zu sein.
Was die Geologen bis 1939 noch herausgefunden haben,
berichten wir am
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die abgebauten Erze
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei dem hier umgegangenen
Bergbau reicht insbesondere der Abbau von Eisenerz weit in die Geschichte
zurück. Doch erst mit dem Aufkommen von Stück- und Hohöfen im 16. Jahrhundert gewann
dabei der Brauneisenstein als Erz an größerer Bedeutung, da in den frühen
Rennöfen das wasserfreie Oxyd des Eisens (der Roteisenstein) besser verhüttbar
gewesen ist (wikipedia.de).
Die Vorkommen wurden
hier meist als ,Lager' beschrieben, wahrscheinlich überwogen aber lateral
wenig aushaltende, teils linsenförmig, teils gänzlich unregelmäßig geformte
Anreicherungen im Brockenfelsgestein. Aufschlüsse übertage sind heute nicht mehr
vorhanden, auch wenn der Bergbau hier nie eine erhebliche Teufe erreichte,
sondern bis weit ins 19. Jahrhundert hinein nur auf den oberen 10 m bis 30 m
umgegangen ist. Nur, wenn heutzutage ab und an wieder ein neuer Tagesbruch entstanden ist und dann
saniert wird, ist heute ein
Der im Quarzbrockenfels natürlich immer gegenwärtige Quarz ist verbreitet ebenfalls eisenhaltig und dichte Varietäten (,Hornstein') sind dann braun oder tiefrot bis schwarz gefärbt. Vorkommen von Roteisenstein (Hämatit, Fe2O3) werden aber eher selten erwähnt. Solches Erz wurde von den Hammerwerken auch höher bezahlt. Nur ganz selten wird auch ,Eisenglanz' (kristallisierter Hämatit) beschrieben. Ab und an wird von den Geschworenen daneben ,Eisenpecherz' (auch ,Pecheisenerz') genannt. Die Bezeichnung ,Pecheisenerz' wurde als Synonym für den (heute ebenfalls ungebräuchlich gewordenen) Mineralnamen Stilpnosiderit gebraucht, womit früher erdige, wasserhaltige Aggregate von Limonit benannt worden sind. Dessen chemische Zusammensetzung wird mit FeOOH · n H2O angegeben (mindat.org). Mit diesem Synonym wird aber auch das Mineral Triplit bezeichnet, ein Phosphat mit der Zusammensetzung (Fe, Mn)2 [F, PO4]. Beim abgebauten Eisenerz überwog hier der Brauneisenstein (Limonit, FeOOH) bei weitem. Er kam teils erdig (,ockerig'), teils dicht, fast immer gelblich- braun gefärbt und eher selten auch als brauner Glaskopf vor. Limonit ist eigentlich ein Mineralgemenge, das sich im wesentlichen aus den Mineralen Goethit und Lepidokrokit sowie weiteren Eisenhydroxiden zusammensetzt. Es entsteht fast überall bei Verwitterung eisenhaltiger Minerale bzw. Gesteine und reichert sich dann auf Klüften oder in Zwickeln an. In erdiger Form ist es stets gelblich- braun, wenn sich dichte Aggregate bilden, weisen sie grauschwarze Farbe, immer jedoch einen braunen Strich auf (im Unterschied zum schwarzen oder roten Glaskopf). Die Bezeichnung ,Glaskopf' verweist dabei auf deren nierig- traubigen, im Innern radialstrahligen, an ihrer Oberfläche aber rundlich und glatt ausgebildeten Habitus. Goethit, synonym ,Nadeleisenerz' ist das rhombisch kristallisierende Hydroxyd des dreiwertigen Eisens (α-Fe3+OOH) und tatsächlich nach dem Dichter benannt, welcher im Herzogtum Sachsen- Weimar- Eisenach ja als Minister selbst auch für den Bergbau zuständig und überhaupt naturwissenschaftlich sehr interessiert gewesen ist. In reiner Form bildet es meist stenglige oder nadelförmige dunkelbraune Kristalle, die häufig zu kugeligen Aggregaten arrangiert sind. Lepidokrokit, synonym ,Rubinglimmer' ist chemisch von gleicher Zusammensetzung, jedoch von etwas anderem Gitteraufbau (γ-Fe3+OOH) und bildet meist taflige Kristalle, die in dünnen Plättchen durchscheinend und dann von tiefroter Farbe sind. In reiner Form kommt es nur selten vor (mineralienatlas.de).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Grubenakten haben wir die folgende
Analyse des durch Wilkauer vereinigt Feld abgebauten „Mulms“ aus
den 1850er Jahren gefunden, die wir an dieser Stelle einfügen wollen (40169,
Nr. 142, Blatt 56f):
Qualitativ und quantitativ chemische Untersuchung A) Durchschnittsprobe
von Eisenmulm „Außer Eisenoxid wurden durch präliminäre Untersuchung überhaupt folgende Erdarten und Metalloxide aufgefunden:
Durch Glühen verändert der Mulm seine gelbe Farbe in eine braunrothe, entwickelt dabei Waßer und erleidet einen Gewichtsverlust von 5,25%. 100 Theile dieses Mulms enthalten:
Die Tiegelprobe giebt: 21,0% Roheisen. Nach dieser Untersuchung ergiebt (sich): 1.) daß dieser Eisenmulm zu dem sehr quarzigen Brauneisenstamme zu zählen ist, 2.) daß er dem Eisen schädliche (Anteile) in Menge nicht enthält, und 3.) daß er seines großen Kieselerdegehalts, wie das auch Schmelzversuche ergeben haben, zu den armen und sehr strengflüssigen Eisensteinarten gehört.“
1.) Mulm von Julius St. zu Förstel. „In diesem Eisenstein wurden dieselben Bestandtheile aufgefunden, wie in A. Im Glühfeuer verhält er sich wie der vorige, erleidet eine Gewichtsabnahme von nur 3,75%, bestehend in ausgeschiedenem und verflüchtigtem Wasser. 100 Theile dieses Eisensteins bestehen aus
Die Tiegelprobe giebt 8% Roheisen und ist (er) noch strengflüssiger als der vorhergehende.“
2.) Rotheisenstein von Hohenstein (Null der Specification) „Außer Kieselerde konnten weiter keine Beimengungen aufgefunden werden, vielmehr ergebet sich, daß es nur ein mit geringen Mengen von Quarz vermengtes Eisenoxid ist und so auch ein vorzüglicher und gutartiger Eisenstein ist. In 100 Theilen dieses Eisensteins sind enthalten
Die Tiegelprobe gab einen Roheisengehalt von 61,5%. Durch geringen Zuschlag von kohlensaurem Kalk im Kohlentiegel unter Abscheidung eines guten (?) leicht schmelzbar. Res porgit. (Vornamenkürzel unleserlich) Fritzsche“ Die lateinische Schlussklausel konnten wir noch nicht deuten: Vielleicht meint sie „bereinigte Angelegenheit“ (von ,purgito‘, lat. für ,gereinigt‘) oder auch „sich ausdehnende Sache“ (von ,porgere‘, lat. für ,sich erstrecken‘ bzw. ,sich ausdehnen‘), da es sich wahrscheinlich nur um einen Extrakt aus einem umfangreicheren Schriftstück handelt. Das hier zum Vergleich herangezogene Roteisensteinvorkommen in Hohenstein- Ernstthal (das frühere Bergamt Hohnstein wurde schon durch die Schönburger dem Bergamt in Scheibenberg zugeschlagen) geht – deren Erwähnung in den Akten von Wilkauer vereinigt Feld zufolge – wahrscheinlich auf eine zeitgleich dort verliehene Constantin Fundgrube zurück, die aber offenbar durch die Sächsische Eisencompagnie nur in Fristen gehalten worden ist, denn Grubenakten zu dieser konnten wir noch nicht auffinden. Zu dieser Zeit war es in chemischen Analysen noch üblich, nicht die wahren Elementgehalte (die sich bei bekannter Zusammensetzung der Oxyde aber auch leicht errechnen ließen) anzugeben, sondern die einfacher zu bestimmenden Oxydgehalte. Leider ist hier nicht angegeben, ob sich die Prozentangaben auf den Masse- oder auf den Mengen- (Mol-) Anteil der Stoffe in der Probe beziehen. Der Begriff ,Oxidul‘ ist heute veraltet und meinte dabei dasjenige Oxyd eines Elements, in dem es mit seiner niedrigsten Wertigkeit auftritt. Beim Mangan, welches im Periodensystem in der 7. Nebengruppe zu finden ist, wäre es also eigentlich das Oxyd des einfach positiv geladenen Manganions Mn+2O2-. Weit häufiger treten jedoch zwei-, drei-, vier- oder sechswertige Manganionen in Verbindungen auf, unter denen das Mn2+-Ion in wäßriger Lösung besonders stabil ist. Wahrscheinlich ist deshalb die Verbindung des zweifach positiv geladenen Manganions mit dem Sauerstoff Mn2+O2- hier gemeint. Die hier ermittelten Eisengehalte belegen jedenfalls, daß es sich zumindest bei dem ,Mulm‘ um ein ziemlich armes Eisenerz gehandelt hat, welches seines hohen Quarzgehaltes halber zudem noch „strengflüssiges“ Eisen ergeben hat. Wirklich abbauwürdig war dieser eigentlich nicht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Kugelig ausgebildete Aggregate von feinnadeligem Goethit auf Ankerit von Paitzdorf (Ronneburg). Fund Anfang der 1980er Jahre, Breite des Bildausschnitts zirka 12 cm, Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Nahaufnahme einiger der 2 mm bis 3 mm großen Aggregate in den Zwickeln der Ankeritkristalle. Sie sind außen mattschwarz, innen aber rotbraun gefärbt und von radialstrahligem Aufbau. Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Stufe Roteisenstein mit etwas Baryt besitzt ebenfalls den Habitus des ,Glaskopfs' und verrät anhand ihrer schwarzgrauen Farbe überhaupt nicht, warum dieses Eisenerz so heißt. Breite der Stufe zirka 12 cm, Atterode in Thüringen, Fund Anfang der 1980er Jahre. Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nur bei feinkörnig- dichten oder erdigen Aggregaten des Hämatits - oder anhand der Strichfarbe - wird die tiefrot durchscheinende Farbe des Hämatits sichtbar, welche im Übrigen auch für dessen wissenschaftlichen Namen verantwortlich ist, indem dieser sich vom altgriechischen αἷμα [haima] = „Blut" oder auch „Blutvergießen" ableitet. Im Bild eine Eisensteinbrekzie mit Quarz, dichtem Roteisen und kleinen Partien von Glaskopf aus dem Crandorf'er Gang in Erla, Fund während Sanierungsarbeiten 2011, Breite zirka 10 cm. Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
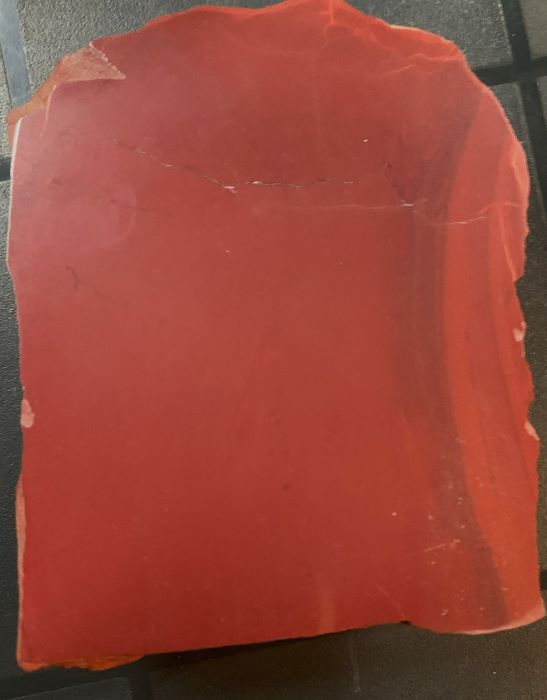 Ein poliertes Stück dichten Hämatits aus dem Urbanus Stolln in Oberwildenthal. Es ähnelt sehr einem Jaspis. Breite der polierten Fläche zirka 12 x 16 cm, Fund während Sanierungsarbeiten 2010, Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch diese Aggregate sehr dünntaflig kristallisierten Hämatits auf Quarz in einer Druse im Amphibolitskarn von Pöhla lassen die tiefrote Farbe des Minerals durchscheinen. Haldenfund Anfang der 1980er Jahre, Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Nahaufnahme obiger Stufe: Das Erscheinungsbild ähnelt sehr dem Mineral Lepidokrokit. Größe der Aggregate zirka 2 mm, Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Braun- Eisenstein
nicht zu verwechseln ist der Braunstein. Dabei handelt es sich um ein
Manganerz, welches in kleinen Mengen eigentlich überall zu finden ist. In
bauwürdiger Konzentration kommt es dagegen relativ selten, hier am Emmler aber
zusammen mit dem Eisenerz oder in eigenständigen ,Lagern' und ,Nestern'
vor. Die Vorkommen am Emmler waren wenigstens im 17. Jahrhundert schon bekannt
und ausweislich der Zusammenstellungen in den Erzlieferungsextrakten (40166,
Nr. 22, Blatt 243ff) ist allein im Zeitraum von 1693 bis 1698 eine Menge von
128 Zentnern davon hier ausgebracht worden.
Auch der Name Braunstein bezeichnet dabei eigentlich eine ganze Mineralgruppe verschiedener Manganoxyde. Da Mangan- Ionen verschiedene Wertigkeit annehmen können (2+, 3+, 4+, 6+), wechseln auch die chemische Zusammensetzung der Verbindungen, sowie zusätzliche eingelagerte, andere Kationen und damit die Gitterstruktur dieser Manganoxide sehr stark. Neben den Ionen der Erdalkalien Kalium, Barium und Natrium können auch Blei- Ionen eingebaut sein (wikipedia.de). Gewöhnlich wird dabei zwischen Hartmanganerzen und Weichmanganerz unterschieden. Aus den alten Beschreibungen ist nicht mehr sicher herauszufinden, welche Art der Manganerze hier am Emmler im Abbau überwog. Bei heutigen Lesesteinfunden überwiegen ‒ allein schon wegen deren besserer Verwitterungsbeständigkeit ‒ aber Hartmanganerze. Hartmanganerz steht dabei synonym für Psilomelan, seinerseits selbst eine heute unter den Mineralogen nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für eine Gruppe von Manganoxyden, deren chemische Zusammensetzung ungefähr mit der Formel (Ba, H2O)2Mn5O10 angegeben wird. Anstelle Psilomelan wurde später der Name Hollandit üblich, welcher eine Mischkristallgruppe bezeichnet, deren Endglieder die Minerale Hollandit Ba(Mn4+6Mn3+3)O16 und Ferrohollandit Ba(Mn4+6Fe3+3)O16 bilden. Wenn auch das erstgenannte häufiger vorkommt, so sind doch dazwischen alle Mischungsverhältnisse der dreiwertigen Eisen- und Mangan- Ionen möglich. Ein anderer, recht verbreiteter Vertreter dieser Mineralgruppe ist Kryptomelan, bei dem anstelle des Bariums Kalium eingebaut ist: K(Mn4+7Mn3+)O16 Alle Manganomelane bilden meist feinkörnig- dichte, erdige Massen oder stalaktitische oder dendritische Aggregate (,schwarzer Glaskopf') von stets schwarzgrauer Farbe. In erdiger Form werden sie auch als ,Wad' bezeichnet. Im Gegensatz zum braunen Glaskopf weisen solche Aggregate aber immer einen schwarzen Strich auf (mineralienatlas.de).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die ,Strichfarbe' meint die Färbung kleinster Körnchen des Minerals, die manchmal von der Farbe größerer Aggregate desselben Minerals deutlich abweicht, weil dünne Plättchen lichtdurchlässig bzw. durchscheinend sein können. Die Mineralogen ermitteln sie unterwegs am einfachsten mit Hilfe eines unglasierten Porzellanplättchens, das man in der Hosentasche dabei hat und auf dem die zu untersuchende Stufe kurz gerieben wird, wobei sich feine Splitterchen ablösen. Auf dem weißen Untergrund erkennt man dann gut, ob diese eine andere Färbung annehmen. Hier links und rechts der ,Strich' einer Brauneisensteinstufe und in der Mitte der einer Hartmanganerzstufe. Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hollandit auf Quarzbrockenfels aus dem Sieben Brüder Stolln bei Langenberg. Sammlung und Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radialstrahlige Aggregate von Hollandit aus dem Sieben Brüder Stolln bei Langenberg. Sammlung und Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Oberfläche der zuvor abgebildeten Stufe zeigt die typische nierig- traubige Form. Sammlung und Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hollandit und erdiger Wad aus dem Sieben Brüder Stolln bei Langenberg. Sammlung und Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Psilomelan auf Quarzbrockenfels aus dem Sieben Brüder Stolln bei Langenberg. Sammlung und Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dendritisch ausgebildete Manganomelane (wegen ihres farnartigen Aussehens auch als ,Pseudo- Fossilien' bezeichnet) auf einer Kluftfläche in Porphyr, Triebischtal bei Tannenberg, Breite der Fläche zirka 5 cm. Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Begriff Weichmanganerz bezeichnet dagegen nur das eine Mineral Pyroluosit, das Oxyd des vierwertigen Mangans (β-MnO2). Die Mohs'sche Ritzhärte des Pyroluosits ist mit >2,0 wesentlich geringer, als bei Hartmanganerzen (5,0 bis 5,5) ‒ daher diese Bezeichnung. Auch dieses Mineral ist von schwarzer Farbe, kann erdige oder nierig- traubige Massen, relativ häufig aber auch prismatische Kristalle, im frischen Zustand mit schönem Metallglanz, bilden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bruchfläche einer Weichmanganerzknolle mit wirrstrahlig angeordneten, dünnprismatischen Kristallen von Pyroluosit, Elgersburg, Thüringen, Breite der Stufe zirka 6 cm. Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Verwendung des Eisenerzes muß an dieser
Stelle wohl nichts gesagt werden. Interessant ist hierzu nur, daß besonders im
19. Jahrhundert einige Gruben am Emmler auch den ,Eisenocker' zeitweise
separat aushielten und als mineralisches Farbpigment an die Hersteller von
Anstrichfarben verkauften.
Obwohl Manganminerale eigentlich überall verbreitet sind, sind bauwürdige Vorkommen mit genügender Anreicherung der Nutzkomponente eher selten. In Sachsen sind uns ‒ außer den Gruben am Emmler ‒ derzeit keine anderen Bergwerke bekannt, in denen (vorrangig oder ausschließlich) auf Braunstein gebaut wurde. Als nächstgelegene Standorte, wo Manganerze abgebaut worden sind, fällt uns Oehrenstock bei Ilmenau oder Elgersburg in Thüringen ein. Auch in den Eisenerzgruben bei Trusetal kam Braunstein vor, wurde dort aber nicht als solcher abgebaut, bestenfalls als Nebenprodukt mitgewonnen. In Sachsen wurde Braunstein als Nebenprodukt zum Beispiel auf der Fundgrube Clara in Schlema oder auf der Michaelis Fundgrube zu Breitenbrunn mit gewonnen (Information von Herrn J. Stark). Dem ungeachtet ist Braunstein nicht nur Ausgangsstoff zur Herstellung metallischen Mangans, einem wichtigen Stahlveredler, dessen Zusatz u. a. Werkzeugstählen eine größere Härte verleiht. Der Mineralname Pyroluosit verweist noch auf eine andere Anwendung, für die dieses Mineral auch heute noch verwendet wird: Er leitet sich von den griechischen Wörtern „pyro“ (Feuer) und „louein“ (waschen) ab, da dieses Mineral bereits im Altertum zur Bindung störender Ionen in der Glasschmelze und damit zur Entfärbung von (grünen) Gläsern benutzt wurde. Daher rührt auch die Bezeichnung ,Glasmacherseife' für den Braunstein. Aber auch zur Herstellung brauner Glasuren auf Tonwaren oder zur Farbgebung von Klinkern kommt Braunstein zum Einsatz. Heute ist Braunstein vor allem eines der wichtigsten Kathodenmaterialien für die Herstellung von Batterien. Der Grund liegt in der Kombination seiner physikalischen und elektrochemischen Eigenschaften mit guter Umweltverträglichkeit und einem relativ niedrigen Preis. Außerdem kann Braunstein bei einigen chemischen Prozessen als Katalysator angewandt werden (wikipedia.de). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wie man sich die Erzlager vor Ort vorstellen muß, zeigen diese Fotos aus dem Querschlag West des Sieben Brüder Stollns am Nordhang des Schwarzbach- Tales. Hier sieht man noch anstehend dichtes, nahezu plastisches Manganerz und breitständige Arbeitsspuren durch die Keilhaue. Im unteren Bildteil ist eine Lage gelblichen Eisensteins über Quarzbrockenfels zu sehen. Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für dieses seltsam anmutende, erdig- dicht ausgebildete und sehr weiche Gestein verwendete schon Breithaupt in seinem geognostischen Reiseberichten im Jahr 1818 den Begriff ,Mulm'. Dem Eintrag in Pierer´s Universallexikon von 1880 (Band 11) zufolge meint dieser Begriff allgemein: „1.) trockene, lockere Erde; 2.) ausgewittertes Erz in lockerer, staubiger Gestalt, 3.) besonders ein dunkeles, trockenes, abrußendes Erz“, aber auch: „4.) die Fäulniß im Holze, oder auch verfaultes, zu Pulver gewordenes Holz.“ (peter.hug.ch) Solches Gestein ist wahrscheinlich durch intensive Oxydationsvorgänge im Bereich der Ausbisse der Erzlager entstanden und setzt sich in erster Linie aus limonitischen Eisenerzen zusammen, die von ,Manganmulmen' (erdigen, oxydischen Manganerzen) begleitet werden (mineralienatlas.de). Das Lösen dieses Materials und die Gewinnung der Erze ist auf allen Gruben nahezu ausschließlich mit der Keilhaue erfolgt („Hackfels“) und die Berggeschworenen betonten es in ihren Fahrbögen besonders, wenn es ausnahmsweise einmal größere Gesteinshärte gab und man wieder zu Schlägel und Eisen oder gar zu Sprengstoff greifen mußte. Von Wilkauer vereinigt Feld ist bekannt, daß dort nach 1840 auch Schießarbeit vorkam, als man Rücken bzw. Aufwölbungen des unterlagernden Glimmerschiefers durchfahren wollte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch hier steht dunkelbraunes Mangan- und gelbliches Eisenerz im Wechsel an. Unter den farbenprächtigen Lagen erkennt man den Quarzbrockenfels. Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Daß diese ,Erztaschen' das Gestein ziemlich regellos durchsetzen, erkennt man auf diesem Bild recht gut. Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Diesen irregulären Ablagerungen folgte natürlich auch der Abbau und so entstanden auch ziemlich regellose Abbauweitungen unterschiedlichster Dimension. Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hier noch zwei nebeneinanderliegende, halb ausgeerzte ,Taschen' im Quarzbrockenfels. Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lesesteinfunde der genannten Minerale sind ‒ besonders nach dem Pflügen und einem regnerischen Tag im Frühjahr ‒ auf den Feldern rund um Langenberg noch immer möglich. Auch in einigen kleinen Steinbrüchen am Nordhang des Emmlerrückens findet man noch Belegstücke von Eisenstein, Manganomelanen, Eisenocker und Quarzbrockenfels. Gelegentlich sind auch durch Forstarbeiten oder Wegebau in den Wäldern Halden angeschnitten. Da die kleinen Halden aber durch die stetige Bewirtschaftung auf den Feldflächen schon längst ganz verschwunden sind und dieses allmähliche Verschwinden in den Waldflächen einfach nur länger dauert, empfehlen wir nicht, selbst Schürfe in den Halden anzulegen, sondern die wenigen Zeugnisse dieses Kapitels der Bergbaugeschichte besser, so lange es geht, für die Nachwelt zu erhalten. Auch sind die Halden schon in der Vergangenheit mehrfach durchgekuttet worden, so daß hier wirklich nur noch Funde von Belegstücken möglich sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein schöner Fund „Quarzbrockenfels“ - der typischen Brekzie aus derbem Roteisenstein (Hämatit) und Quarz vom ehemaligen Christianus Schacht nördlich unterhalb des Knochens. Solche Stücke wurden früher auch als „Wurststein“ bezeichnet, wohl deshalb, weil der Anblick irgendwie an Blutwurst erinnert... Sammlung und Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 In diesem Trümchen aus milchig- trübem Quarz in einer Matrix aus verkieseltem Nebengestein und Hornstein (aus einem kleinen Steinbruch bei Schwarzbach) sieht man noch „Negative“ ‒ Abdrücke bereits wieder herausgelöster, anderer Minerale ‒ hier wohl Calcit. Belegstück aus einem Steinbruch bei Kästners Hoffnung oder Friedlicher Vertrag Fdgr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quarz ist im ,Quarzbrockenfels' natürlich allgegenwärtig. Sehr selten sind dagegen solche blaßblaue bis violette Amethyste gefunden worden, wie diese Stufe aus dem Bereich der Grube Hausteins Hoffnung. Sammlung und Foto: J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 In Zwickeln des Quarzbrockenfelses findet man gelegentlich auch als „Glaskopf“ ausgebildeten Eisenstein, bei dem es sich zumeist um Limonit („Brauneisenstein“) und nicht um Hämatit handelt. Belegstück aus einem Steinbruch bei Kästners Hoffnung oder Friedlicher Vertrag Fdgr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch bei diesem Stück ziehen sich kleine Adern von derbem (schwarzen) Brauneisenstein durch die Gesteinsmatrix. Daneben fällt der gelbliche Eisenocker ins Auge, welcher bei einigen Gruben in der Region besonders im 19. Jahrhundert zeitweise ebenfalls Gegenstand der Gewinnung gewesen und zu feinem Pulver gemahlen als Farbpigment verkauft worden ist. Belegstück aus einem Steinbruch bei Kästners Hoffnung oder Friedlicher Vertrag Fdgr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch an diesem Stück verrät nur die grauschwarze Strichfarbe, daß es sich nicht um roten oder braunen Glaskopf (also Eisenerze), sondern um Manganerz handelt. Die Manganomelane können ebenfalls den nierig- traubigen Habitus der „Glasköpfe“ besitzen und werden dann auch als ,schwarzer Glaskopf' benannt. Belegstück aus einem Steinbruch bei Kästners Hoffnung oder Friedlicher Vertrag Fdgr. Sammlung und Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hartmanganerz- Krusten auf eisenschüssigen Hornstein. Lesesteinfund bei Gott segne beständig Fundgrube am Roten Hahn, 2024. Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Derbes Hartmanganerz in eisenschüssigem Hornstein. Lesesteinfund bei Gott segne beständig Fundgrube am Roten Hahn, 2024. Foto: J. Boeck.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur älteren
Montangeschichte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu den Eisenhämmern
und zum Bergbau im 16. Jahrhundert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über die Entstehung und die Besitzer der
Eisenhämmer
Förstel bei Langenberg, Tännigt bei Schwarzbach und den
Nietzsche'schen Hammer bei Obermittweida haben wir auch in unserem Beitrag
zum Der Bergbau am Abhang des sogenannten „Silber- Emmler“ zum Schwarzbachtal, südwestlich des „Bergfleckens Elterlein“ ist untrennbar mit den Hammerwerken verknüpft. Neben dem Eisenhammer in Erla im Schwarzwassertal, der bereits 1380 erstmals erwähnt wurde (Blechschmidt, 1989), zählt auch ein „Raschau‘er Hammer“ im oberen Mittweidatal zu den ältesten urkundlich nachweisbaren Standorten der Eisenverhüttung. Er wird in einem am 3. Advent 1401 ausgestellten Gunstbrief des Abtes des Zisterzienserkloster Grünhain, Nikolaus, für Veit, I. von Schönburg- Glauchau (*vor 1370, †1423) erstmals urkundlich erwähnt (Richter, Frank). Die Hammerwerksbesitzer waren, wo sie nicht selbst Eigner oder Gewerken der Berg- und Kalkwerke waren, von Beginn an auch die wichtigsten Kunden der Bergwerksbesitzer und Abnehmer für das Eisenerz wie für den ungebrannten Kalk. Zum einen kamen hier in dieser Region Eisenerze und Kalkstein nahe beieinander vor, so daß der Handel „auf kurzem Wege“ abgewickelt werden konnte – in Zeiten, da als Transportmittel nur das Pferdefuhrwerk zur Verfügung stand, ein wichtiger Standortvorteil. Zum anderen wurde der Kalk als Zuschlagstoff bei der Verhüttung von Eisenerzen (nämlich als Schlackebildner), spätestens mit Einführung der Hochofentechnologie mehr als zuvor, benötigt. Aber auch die Wasserkraft der Flüsse und der Holzreichtum der Wälder (als Brennstoff) waren Faktoren, die das Entstehen der Eisenhämmer in dieser Region begünstigten. Ein zweites Mal findet ein Hammerwerk bei Raschau in einem Kaufvertrag zwischen dem Burggrafen Heinrich von Meißen (wahrscheinlich Heinrich, I. von Hartenstein, *vor 1381, †1423) als Verkäufer und dem Abt Nikolaus in Grünhain im Jahre 1402 Erwähnung (30570, Nr. 4). Wie einleitend schon erwähnt, befinden wir uns im betrachteten Gebiet im 15. Jahrhundert noch auf Klosterland, das die damaligen Besitzer der Grafschaft Hartenstein, die Meinheringer, dem Kloster Grünhain gestiftet hatten. 1416 kam die Grafschaft Hartenstein nach Verpfändung an das Haus Schönburg. Johannes, III. von Luckau, der 1409 Abt in Grünhain geworden ist, bestätigte 1417, am 17. Juli 1419 und nochmals am 14. August 1421 Veit von Schönburg, der die Herrschaft Hartenstein zwischenzeitlich gekauft hatte, den Kaufvertrag mit Wiederkaufsrecht mit Abt Nikolaus. Die Grafschaft Hartenstein wurde durch kaiserlichen Machtspruch 1457 als Afterlehn in das wettinische Herrschaftsgebiet integriert. Nach der Leipziger Teilung zwischen den Brüdern Ernst (*1441, †1486) und Albrecht (*1443, †1500) im Jahr 1485 gehörte die Grafschaft Hartenstein zunächst zum ernestinischen Hoheitsgebiet. Auch Petrus Albinus erwähnte den Ort Raschau in seiner 1590 erschienenen Meißnischen Bergchronik gleich mehrfach. So heißt es zur Geschichte des Bergbaus im V. Titel. Von den folgenden Bergkwercken / so nach dem Schneeberg auffkommen / fürnemlich aber Annenberg und Marienbergk. auf S. 49: „Von dem Lawenstein und Bergishübel / unter welchen dieses ein Kupffer- Bergwerck / jenes ein Zienbergwerck / aber auff beyden auch das beste Eysen gemacht / und Eyserne Ofen gegossen werden / kann ich auch keinen Bericht thun. Desgleichen von dem Bergwerck umb Schwartzenburg / welches mit einem eigenen Bergampt bestellet / wie auch Grunenhayn. Es sind auch umb solche gegent zwey fürneme Eysenbergwerck für andern beruffen / nemlich die Burgartsleiten bey dem Dorff Pela / wenn man in den Joachimsthal gehen will zur rechten seiten / darnach der Memler / zwischen Raschaw und Grüenhayn.“ Im Kapitel: Der XVI. Tittel: Von den Metallen / so im Lande zu Meysen gefunden werden. schrieb Albinus speziell zum Eisenerzbergbau (S. 134): „Gleichergestalt ist derselben neben anderer Metallen herrlichen Bergwercken auch ein überfluß im Lande Meyssen / in welchem doch dieses die fürnembsten örter sein / so wegen desselben berufen. Erstlich hat man viel Eisen Hämmer nicht weit von dem Dorfe Pela (Pöhla) / auff der rechten hande der Straßen / da man in den Joachimsthal zeuhet / welches man auff der Burghartsleiten / von deme so den Eisenstein erfunden / wie Agricola meldet / und wo des orts gelegenheit / ernennet. Das ander Eisenbergwerck ist zwischen dem Dorff Rascha und Städtlein Grünhain / da vorzeiten ein stadtlich Benedictiner Kloster gewesen / dieses nennet man auffm Memmler / wie es Agricola schreibt / andre nennen es den Emmler. Das dritte und fürtrefflichste Eisen wird zum Lauenstein und Berggieshübel und Glashütten gemacht / sind alle drey nicht weit von Dresden und Pirna den Städten gelegen. Derwegen etlich das Eisen / so daselbst gemacht / Pirnisch nennen / und rühmen davon es sey geschmeidiger als das Lausitzer / so doch sonsten auch weit verführt wird. (...)“ Eigentlich ist Grünhain eine Zisterzienser- Abtei gewesen, aber das Kloster war zu dieser Zeit ja bereits aufgelöst ‒ da hat sich Herr Albinus wohl geirrt. Da Albinus aber auch auf Agricola verwies, haben wir beim Nachsuchen eine ganz ähnlich lautende Erwähnung in Agricola’s De veteribus et novis metallis aus dem Jahr 1546 gefunden. Dort heißt es über die Vorkommen von Eisenerz im sächsischen Erzgebirge nämlich (S. 58 der Übersetzung aus dem Lateinischen): „In Meißen (Erzgebirge) bricht der köstlichste Eisenstein auf Burkhardts Fundgrube, nicht weit vom Dorfe Pöhl, rechts am Wege nach Joachimsthal; ferner zwischen Raschau und dem Kloster bey Grünhayn; der allerschönste bey Lauenstein, und, nicht weit von Pirna gegen Mittag, bei Berggieshübel (...)“
Zu der von beiden Autoren hier zuerst genannten
,Burghartsleite' (oder bei Agricola: ,Burkhardts Fundgrube'
an der Straße von Pöhla nach Joachimsthal), vorrangig aber zum Uranerzbergbau,
gibt es einen weiteren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
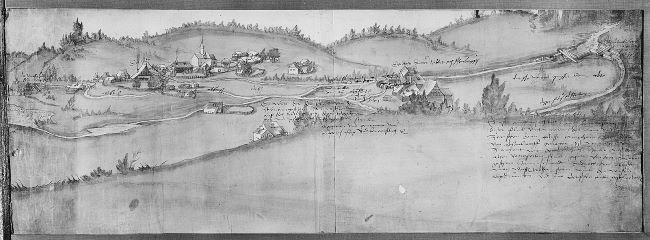 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
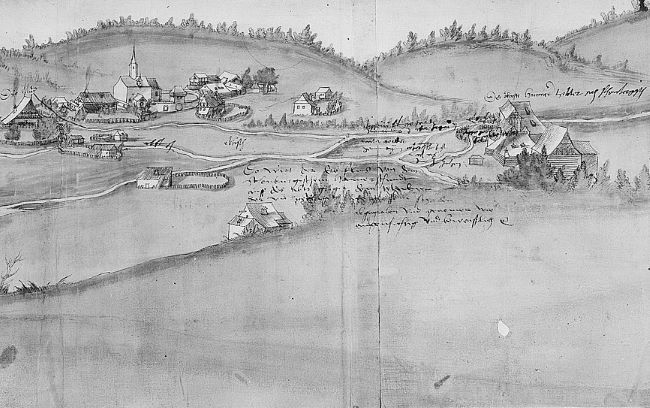 Auf dieser zeichnerischen Darstellung des Grenzverlaufs zwischen den Ländereien des Klosters Grünhain und der Herrschaft Schönburg, datiert auf das Jahr 1530, ist flußauf der Markersbach'er Kirche bereits ein Hammer verzeichnet. Leider ist das Digitalisat der Fotographie eines nicht bekannten Fotographen nicht besonders gelungen oder vielleicht war auch das Original so schwach, daß die Beschriftungen nur schwer zu lesen sind. Quelle: Hauptstaatsarchiv Dresden, Inventar- Nr. Abt. XI, I, 3, Nr. 1 (in der Fotothek bezeichnet als ,externer Sammlungsbesitz'), oben: Gesamtansicht, unten: Ausschnitt. Vermutlich identisch mit dem Blatt mit der Signatur 12884, Schr. 001, F. 003, Nr. 001 im Hauptstaatsarchiv.
Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1502 entzog der Abt des Klosters Grünhain, zu dieser Zeit Paulus Morgenstern, den Bauern die Hutweide auf dem Hutstein, was als Hinweis auf den zu dieser Zeit aufkommenden Bergbau am Emmler gedeutet wird (chronik-raschau.de). Eisensteingewinnung bei Unterscheibe, Markersbach und Raschau findet auch in einer Akte aus dem Jahr 1523 wieder Erwähnung (10024, Loc. 08425/07). Der Bergbau muß zu dieser Zeit bereits einen bedeutenden Umfang besessen haben, denn nach einem Streit im Jahr 1534 um die Lieferung und den Besitz von Eisenstein zwischen dem letzten Abt des Klosters vor der Reformation, Johannes, V. (bürgerlicher Name Johannes Göpfert) und Ernst, II. von Schönburg (*1486, †1534), erließ Abt Johannes mit Unterstützung von Kurfürst Johann Friedrich, I., genannt der Großmütige (*1503, †1554), noch im gleichen Jahr eine Bergordnung für ,ein trostlich Bergkwergk von Eysenstein, auf unser der abtey gutter, der Emmler vnd Hutstein gnannt' (Jaschik, 2024).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Einleitung dieser Bergordnung wurde deutlich gemacht, daß der geförderte Eisenstein nicht in die Herrschaft Schönburg, sondern ausschließlich in das Kurfürstentum Sachsen geliefert werden durfte: „Nach dem der durchlauchtigste Churfurste zu Sachssen cc. vnser genedigster herr, auß furstenden bewegenden vrsachen, haben gebieten vnd vorbieten lassen, allen so auff diesen vnsern Bergkwergen dem Emler vnd Hutstein pauen, eissenstein gewÿnnen den furder vortreiben vnd vorkauffen, das kein Eÿssenstein In die herschafft von Schonburgk sol vorkaufft noch gestat werden, dahin zufurn welchs sich auß dem geursacht das gemelter her Ernst von Schonburgk gleich fals, mit gebieten vnd verbieten erstlich vnterfangen, das aus seiner Herschaft, kein Eÿssenstein auf die hemer, so Im Churfurstenthumb, zu Sachssen cc. gangkhaftig, hat zulassen wollen, dahin zufuren noch zuverkauffen, darauff ordnen vnnd wollen wir, das dem also gelobt vnnd nachgegangen werde...“ In den folgenden 13 Paragraphen wurde der Grubenbetrieb geregelt. So wurden etwa die Größe der stehenzulassenden Bergfeste festgelegt und die Regeln für den Vortrieb von Stolln genannt: „Es sollen auch die pauenden gewercken sich vntersteen, den Eÿssenstein zu praittem plick, auß zuhauen vnnd kein Berckfesten steen lassen, sunderlich auch an den enden do der stoln in die zechen durchschlagen hat, dadurch das gebirg nicht zuerhalden, vnd also die Zechen, vnnd der stoln zu grunde vergeet, vnd das gemelte Bergkwergk, durch solche weise, verwustet vnd verderbt wirdet Ordnen vnd wollen wir, das furthin ein Ides lehen, ader massen, darinnen der stoln Itzo ist, auch kunfftig komen wirt, ein Bergkfeste vierthalb lachter Ins hangende vnd vierthalb lachter Ins liegennde, darzu zwu lachter in der fierste, vnaußgehauen sollen steen lassen, dadurch der stoln Inn ganzem stein vnd gebirge, seine wasser seige, stollen fierst auch hangendes vnnd liegendes, sambt dem mundtloch offen moge halden, cc. vnnd solche Berckfesten sollen an unnser vnnd vnnsers Bergkmeisters gnedige zulassunge nÿmandes vntersteen zuvorhauen beÿ ernster pen vnd straff.“ Anmerkung: Mit dem ,praittem plick' (breitem Blick) ist eine besondere Art des Strebbaues gemeint, bei welcher der Abbaustoß in der Richtung des Einfallens der Lagerstätte sehr breit genommen wird, was natürlich Nachbrüche des Hangenden provoziert (vgl. Wenckenbach, 1864, S. 1, Lueger, 1905, S. 256) ‒ ein Verfahren, das aufgrund der begrenzten Ausdehnung und nieren- oder nesterartigen Struktur der Erzvorkommen am Emmler eher wenig zum Einsatz gelangt sein dürfte. Sinngemäß ist hier aber darunter ein Raubbau ohne das Belassen von Sicherheitspfeilern zu den sicherheitsrelevanten Grubenbauen, wie Stolln oder Schächten, zu verstehen. Zu den 1534 erlassenen Regelungen gehörte auch, daß ein Stolln ohne Gesprenge gefahren werden mußte, wenn er das Stollnneuntel erhalten wollte. Interessant ist, daß zu dieser Zeit überhaupt bereits Regelungen zum Stollnbetrieb erforderlich waren, wo wir doch im weiteren Text noch sehen werden, daß zumindest im 18. und noch bis weit ins 19. Jahrhundert der Eisensteinbergbau fast ausschließlich durch Eigenlehner betrieben worden ist, für die ein aufwendiges und längere Zeit nur kostenträchtiges Projekt, wie der Vortrieb eines Wasserlösestollns, kaum infrage kam. Es klingt im Text der Bergordnung dabei jedoch so, als ob der Stollnvortrieb zwar erwünscht, doch nicht selbstverständlich war: „Nach dem auch vil lehen vnd massen vffem Emler vnd hutstein verliehen, die wassers halben nicht pauen konnen, wollen wir das durch vnsern Berckmeister denselben lehenn vnd massen, woochentlich nach gelegenheit, Ider Zech, stolnn steuer, soll aufgelegt werden, damit der stoln dester rustiger vnd statlicher fort getrieben mag werden.“ Das hört sich sehr nach einer behördlichen Umlage an, mit deren Hilfe ein Stollnbetrieb gefördert ‒ und vielleicht auch erst in Gang gebracht ‒ werden sollte. Aufgeführt wurden 1534 auch die Pflicht der Zubußzahlung sowie die Vorschriften beim Vermessen des Eisensteins. Den Bergleuten wurde aber auch gestattet, den geförderten Eisenstein selbst zu verkaufen ‒ eben lediglich mit der Einschränkung, daß er im (damals ernestinischen) Kurfürstentum bleiben müsse: „Es ist auch allen gewercken vnd pauleutten hiemitt zu gelassen, Iren Eÿssenstein selbs zu gut zu machen, ader andern vffem berck zuuor kauffen, doch Nÿmandes anders dan denen, so Im Churfurstenthumb zu Sachssen cc. Hemer [(Eisen-) Hämmer] haben...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im gleichen Jahr 1534 erließ Kurfürst Johann Friedrich selbst auch für die 1533 gerade erkaufte Herrschaft Schwarzenberg eine Bergordnung (Jaschik, 2022). Darin ist Eisensteinbergbau im Artikel (20), jedoch nur in Zusammenhang mit der Verzehntung erwähnt: „Im fal auch, so sichs zuntragen thete, woln wir unsern zehenden von allen andern geringen metaln als eisenstein, wißmet, und bleikis, kuper ertzt, das unsern geordenten das zehende fuder davon sol von unserntwegen überraicht und zugestelt (werden)...“ Dem Kurfürsten stand hiernach also ein Zehntel des ausgebrachten Erzes, gewissermaßen ,in natura' zu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Verbot der Ausfuhr des Eisensteins aus dem Jahr 1534 wurde allerdings schon 1537 wieder zurückgenommen. In einer Sammlung alter Abschriften des Oberbergamtes zu Freiberg haben wir dazu den folgenden Rezeß zwischen Kurfürst Johann Friedrich, Herzog Georg als Vormund für Ernst von Schönburg sowie Wolf von Schönburg gefunden (40001, Nr. 3352, Filmbildnr. 0183ff): Die freye
Zufuhr des Eisensteins aus den Chursächsischen Landen in das Schönburgische „Zu wissen das (?) Jahren aus fürfallenden, bewegenden ersahen wir, der Durchlauchtigste hochgeborene Fürsten und Herrn, Herrn Johann Hertzogen zu Sachsen, des Heiligen Römischen Reichs Ertzmarschall und Churfürst, hochloblicher und seliger Gedächtnis, auch dem Edlen und wohlgeborenen Herrn Ernsten von Schonburgk, Herr zu Glauchau und Waldenburg seligen, unseres gnedigsten und gnedigen Herrn gebot und verbott des eysensteins halber sich zugetragen, als das aus unserers gnedigsten Herrn itzigem Ampt Grünhayn inn die Herrschaft Schonburgk keine Eysenstein (?) mehr hat volgern wollen lassen, des gleichen herwiederumb in unseres gnedigsten Herrn obgehortt Ampt aus der Herrschaft Schonburgk man auch keine Eysenstein Zufuhren gestatt, daraus allerley unrichtigkeit fürgefallen, innsonderheit Steigerung des eysenkauffs, welch itziger tzeith der durchlauchtigst hochgeborne Fürst und Herr, Herr Johann Friedrich, Hertzog zu Sachsen, des heyligen Römischen Reichs Ertz Marschalk und Churfürst, desgleichen der durchlauchtige hochgeborene Fürst und Herr, Herr George Hertzog zu Sachsen, als oberster vormundt des Edlen und wohlgeborenen Herrn Ernsten von Schonburgk nachgelassenen jungen Herrn, unser gnedigster und gnediger Herr, bewogen und bedacht, auch auff umsigk suchen und anhalten der Hammerschmidt inn der Herrschaft Schonburgk Ihr churfürstlich und fürstlich gnade, als der Churfürst, uns, Hannsen von Wiesenbach, Ritter pp. Paulus Schmidt, Amptmann und Amptsversorger aufm Schneeberge und (?) mir Wolffen vonn Schönburg, dyser tzeit der Herrschafft Schönburg Ober Hauptman (?) gethan, diese dinge zuberadtschlagen und furwendung zu thun, wie es hiefort inn hochgedachts unseres gnedigsten Herrn Ampt Grünhayn und der Herrschaft Schönburg mit Abfuhrung des Eysensteins gehalten soll werden, und was wir uns des vergleichen wurden, darüber einen recess aufftzurichten, zu underthäniger volge thuung, sulchs schaffens haben wir beiderseits uns des vereinigt, nämlich also, das das vorgeschehene verbot hiermit auffgehoben sol sein und hinfort der Eysenstein, so in des Churfürsten zu Sachsen, unseres gnedigsten Herrn, Ampt Grünhayn bricht und gewonnen wird, (?) den Hammerschmiden in die Herrschaft Schönburg auszufuhren volgen soll lassen, gleichfalls soll aus der Herrschaft Schönburg unseres gnedigsten Herrn, Hammerschmiden derselbten Fürstenthümer der Eysenstein zu fuhren, auch gestatt werden, damit es an einem ortt, wie an dem andern, inn gleichheit gehalten, alles an einiche, weither verbiethung, (?) geschehe, doch mit dieser maß, so unsere gnedigsten Herrn Hammerschmide inn der Herrschaft Schönburg Eysenstein laden würden, das der lade groschen daselbst gegeben, gleichfalls sollen die Schönburgische Hammerschmide im Ampt Grünhayn auch thun, und bederseitz der Zehend gereicht werden, wie vor alters herkommen, (?) dis soll uff keinem Eysenberge benannter artt Eysenstein aus dem Steinbett geladen oder gefuhrt, es seihe denn, derselbe zuvor durch den geordneten Bergkmeister gestürtzt und der lad groschen gegeben, zu verhütthung (unrechten?) vorteils. Es sol auch hinfort durch unsern gnedigsten Herrn dem Churfürsten zu Sachsen derselbige volge, desgleichen der Herrn von Schönburg oder ire nachkommende, den Eysenkauff in gleichheit gehalten werden, und kein teils ohn des andern mitverwilligung Steigerung im Eysenkauff machen oder nachlassen. In betrachtung der gemeinen nutz und haben auff vorgethaner bederseitz unseres gnedigsten und gnedigen Herrn geschenen (?) wie Hannß von Wiesenbach, Ritter und Paulus Schmidt, Amptman und Amptsverweser ufn Schneeberge dergleichen. Ich, Wolff von Schönburg, als dertzeit der Herrschafft Schönburg zu Glaucha Oberhauptmann diesen entlichen vertragk in gewissenhafte schrifft gebracht, in churfstl. und fürstlichen gnaden undertheniglich denselbigen fürgetragen. Darauff gebeten, diesem vertragk mit ir churfstl. und fürstl. Gnaden, brieff und siegel zu berechtigen, das also in churfstl. und fürstl. Gnade gethan, insonderlichen brieffen hierüber ausgereicht, darnach man sich hinfort halten und richten soll. (...) Ist geschene
nach Christi unseres lieben seligmachers geburd Man hatte sich also geeinigt, die Ein- und Ausfuhr von Eisenstein zwischen den schönburgischen und den kursächsischen Besitzungen wieder zuzulassen. Der Zehnte und der Ladegroschen sollten jeweils dort gezahlt werden, wo der Eisenstein geladen, wo er also zuvor auch gewonnen worden ist. Bei der Zuordnung der hier genannten Wolf und Ernst von Schönburg innerhalb der weit verzweigten Familie von Schönburg haben wir allerdings Schwierigkeiten, da ‒ wenn die Angaben im Internet richtig sind ‒ Wolf, I. von Schönburg bereits 1529 gestorben, Wolf, II. aber erst 1532 geboren ist. Auch Ernst, II. von Schönburg lebte zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr. Auf die Brüder Wolf, I. (*1482, †1529) und Ernst, II. von Schönburg (*1486, †1534) geht übrigens auch die Einrichtung des Gesamthauses Schönburg im Jahr 1524 zurück (wikipedia.de).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wenige Jahre später hielt unter Herzog Heinrich, dem Frommen (*1473, †1541, Kurfürst ab 1439) im albertinischen Sachsen die Reformation Einzug. Bereits 1533 hatte eine kurfürstliche Kommission die Auflösung des Klosters Grünhain beantragt. Drei Jahre später gingen die Besitzungen an den sächsischen Kurfürsten, wurden um einige Dörfer und Städte reduziert und in das kurfürstliche Amt Grünhain umgewandelt. Heinrich's Sohn, Herzog Moritz (*1521, †1553), erhielt schließlich im Ergebnis der Schmalkaldischen Kriege 1547 die Kurwürde zugesprochen. Zugleich verzichtete der bisherige Kurfürst Johann Friedrich I. in der Wittenberger Kapitulation 1547 auf große Teile des ernestinischen Besitzes; auch die Grafschaft Hartenstein fiel dadurch formal bereits an die Albertiner. Den oberen Teil der Grafschaft mit Scheibenberg und Oberwiesenthal haben sie aber erst 1559 von den Schönburgern auch erkauft und daraus dann das Amt Crottendorf gebildet. Im Zuge der erforderlichen Neuordnung der Verwaltung setzte der nunmehrige Kurfürst Moritz von Sachsen für den obergebirgischen Kreis und damit auch für die Verwaltung der dortigen Bergwerke Heinrich von Gersdorff, der seit 1540 schon Berghauptmann in Annaberg, 1547 zugleich Amtmann in Wolkenstein gewesen ist, als Oberhauptmann ein. Auch das Territorium des früheren Klosters Grünhain gehörte in dessen Verwaltungsbereich. Heinrich von Gersdorff erließ während seiner Amtszeit (1547 bis 1554, ein genaues Datum ist leider nicht überliefert) eine zweite ,Eyßen- bergwergks- ordnung ufm Emmler' (Jaschik, 2024). Einleitend heißt es diesmal, „daß uns fürkombt, wie bißhehro uf dem bergkwergk viel unrichtigkeiten zu nachtheil unsers gnedigsten herren zehendten undt gemeines bergkwergs sich zugetragen haben. Demselben fürzukommen haben wier etzliche articul stellen laßen, der sich hinfort jedermenniglich, so sich der bergkwergk gebrauchen, bey vormeydung unsers gnedigsten churfürsten undt herren straf und ungnade gemeß vorhaldten sollen...“ In all den Wirren der vorausgegangen Zeit haben sicherlich die Bergleute, wie alle anderen Bewohner der Region auch, zusehen müssen, über die Runden zu kommen und sich dabei nicht immer so ganz an die Regeln gehalten ‒ ein Umstand, der im Übrigen auch in den nachfolgenden Jahrhunderten immer wieder von der Bergverwaltung beklagt wurde. Die Ortsbezeichnung ,Hutstein' ist hier nicht mehr genannt. Der Name des kleinen Hügels taucht auch in keinem jüngeren Kartenwerk auf und ist wohl nur noch Einheimischen bekannt. In den zwölf Paragraphen dieser Bergordnung wurde ausführlich auf eine ordentliche Verleihung der Gruben, auf die Größe der Gruben sowie auf die Pflicht zum Bergbau eingegangen. Weiterhin wurde die Einhaltung der Arbeitszeit und das Verfahren voller Schichten gefordert sowie das Biertrinken auf den Zechen verboten. Es wurde darauf hingewiesen, daß der Zehnte pünktlich zu entrichten sei und daß bei der Auffindung von Silbergängen der eingesetzte Eisenbergmeister unverzüglich den Bergmeister in Annaberg verständigen solle. Der Bergbau auf Eisenstein unterlag dabei anderen, teilweise erleichterten Bestimmungen. Unter anderem heißt es im Artikel (2): „Zum andern soll auch keinen forthin, wie bißhehro geschehen, gestadt undt nachgelaßen werden, daß sie in 14 tagen, auch wohl lenger nicht einmahl anfahren undt damit ihre gebeude bauhaftigk zu halten vormeinen. Sondern, welcher sein gebeude oder lehen nicht stadtlich treibet, undt man würde in 14 tagen keinen arbeiter in der zechen oder lehen befinden, so soll der bergmeister von einen ieden muetung ahnnehmen. So alßdann nach geschehener muetung der bergmeister in 14 tagen keinen arbeiter findet, soll er es dem muther vor frey vorleyhen undt bestetigen, eß wehre dann, daß man wetters, waßers oder anderer noth halben nicht bauen köndte, soll er deroselben gewergken ihre gebeuthe vormöge churfürstlicher bergkordtnung in frist nehmen.“ Darin kommt eine deutliche Abweichung gegenüber gleichaltrigen Bergordnungen für den Silberbergbau zum Ausdruck, denn solche Gebäude hätten nicht mehr als drei Tage unbelegt bleiben dürfen. So heißt es schon in der Bergordnung Herzog Georg's, des Bärtigen (*1471, †1539) für Annaberg im Jahr 1509 (mehrfach ergänzt bis 1536) im siebenten Artikel: „Wurde yemandt Alde zechen / vor unser freyes mutten / der soll in der muttung zum wenigsten / mit zweyn Geschworenen beweisen / das dieselbige zech / one des Bergkmeisters zulassen / drey anfarende Schicht nicht bauhafftig gehalden sey...“ Eine gleichlautende Bestimmung gibt es im 23. Artikel der Bergordnung Kurfürst August's (*1526, †1586) von 1574. Auch diese Regelung wird in der Bergordnung für den Eisensteinbergbau am Emmler zudem noch durch die Ergänzung eingeschränkt, daß die Lehnsträger ja vielleicht auch ,wetters, waßers oder anderer noth halben nicht bauen köndte(n)' ‒ übrigens auch dies ein Umstand, der namentlich die Gruben am Emmler ständig heimsuchte und vermutlich auch Heinrich von Gersdorff bereits bekannt gewesen ist. Eine andere Regelung in dieser Bergordnung wirkte sich dagegen nachteilig auf den Eisensteinbergbau aus. Im Artikel (3) heißt es nämlich: „Zum dritten mit einen schacht sollen nicht mehr dann 4 lehen oder alß viel der bergmeister befindtet, daß sich nach gelegenheit leiden will, bauhaftigk gehalden werdten, und waß darüber, auch nach ordtnung nicht in frist genommen, frey geacht sein. Deßgleichen durch einerley gebeude nicht zweyerley lehen undt maßen ohne deß bergmeisters nachlaßen gebauet und damit bauhaftigk gehalten werdten. Durch welchen solches anders befunden undt die ungebaueten lehen jemandt zu mueten begehret, sollen dieselben vor frey vorliehen werden.“ Unabhängig davon, wieviel ,der bergmeister befindtet', entsprach die hier zur Regel erhobene Grubenfeldfläche von vier Lehen gerade einmal einer Maß oder der vergleichsweise winzigen Fläche von 196 Quadratlachtern bzw. rund 784 m² ‒ eine Fläche, auf der man neben dem Schacht vielleicht noch eine Bergehalde schütten und einen Ausschlageplatz einrichten konnte, mehr aber auch nicht. Für einen wirtschaftlichen Grubenbetrieb war dies eigentlich viel zu wenig und förderte damit indirekt den Bergbau durch Eigenlehner. Der eigentliche Sinn dieser Regelung ist andersherum zu sehen: Der Muter, dem ein solches Feld verliehen wurde, sollte damit gezwungen werden, innerhalb dieser kleinen Fläche auch mindestens einen Schacht zu teufen und sie somit auch wirklich in Belegung zu nehmen. Es sollte damit verhindert werden, daß Einzelne große Grubenfelder besitzen, die sie aber gar nicht oder nur punktuell nutzen konnten; sie zugleich aber der Nutzung durch andere entzogen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch die Regelung, daß der Ladegroschen am Ort der Gewinnung des Erzes gezahlt werden müsse, wurde von den Wettinern im Jahr 1554 wieder zurückgenommen, worüber wir die folgende Anweisung an den Amtmann in Schwarzenberg, Wolf von Schönburg, gefunden haben (10036, Loc. 36067, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 0332, Blatt 1f). Bei dem Adressaten kann es sich nach den Lebensdaten eigentlich nur um Wolf, II. von Schönburg- Penig (*1532, †1581) gehandelt haben, der offenbar 1554 schon in jungen Jahren die Funktion des Amtmanns in Schwarzenberg ausübte. An Wolfen von Schönburgen, Amtmann zu Schwarzenberg. „Lieber getreuer, Mit was Nachtheil die Eisen- und Blechhämmer in Unseren Aemtern Schwarzenberg und Grünhayn daher geduldet, Unsere Wälder und Gehöltze dadurch auch verwüstet, das giebet der Augenschein und darum und zu Verhütung allerley künftiger nachtheiliger Beschwerung willen, wie daß es hinfort in berührten beiden Aemtern mit den Eisen- und Blechhämmern zusamt dem Kohlen- und Holtzkauf und andern nachfolgender Maß und gar nicht anders gehalten werden soll, solches wollest Unserthalb, auch sobalde nach Empfangung dieses Unseres Befehlichs also verordnen und schaffen, und dich durch keinerley Weise noch Wege davon abhalten laßen. Un soviel Waag Eisen in den Eisenhämmern würklichen wöchentliche und ein Jahr geschmiedet und gefertiget werden, von denselben allen sollen die Hammermeister Uns, Unseren Erben und Nachkommen in Unser Amt Schwarzenberg einen Waagegroschen, und darüber in Unser Amt Grünhayn von iedem Fuder Eisenstein einen Ladegroschen geben, und es soll solch Waag- und Ladegeld in allermaßen und dergestalt einbracht werden, wie es die Herren von Schönburg von ihren Hammermeistern einbringen pp. Dieweil auch der Herren von Schönburg Hammermeister einestheils sich Eisensteins in Unsrem Amt Grünhayn erholen, und davon ihren Herren von iedem Fuder einen Ladegroschen geben müßen, da er doch, weil er uf Unserm Grund und Boden geladen, vielmehr Uns gebühret, so wollest denselben auflegen, hinfort den Ladegroschen in Unser Amt Grünhayn zu erlegen, hätten die Herren aber gnugsamen Schein vorzulegen, warum sie deßelben befreyt, so wollest die denselben vorlegen laßen, und Uns davon Bericht thun. Datum Dresden, den 20ten Novembr. im 54ten Jahre.“ Demnach gingen die Ladegroschen sowohl auf erzeugtes Eisen, als auch auf das dazu benötigte Eisenerz, so es aus dem Amt Grünhain kam, bis dahin noch an die Schönburger (der Zehnte auf das Erz wurde schon immer an das zuständige Bergamt bzw. an die jeweilige Bergkasse entrichtet). Das Schreiben fällt in die Regierungszeit von Kurfürst August (*1526, †1586, ab 1553 Kurfürst), welcher hiermit nun – das war übrigens immer noch vor dem Kauf der oberen Grafschaft Hartenstein im Jahr 1559 – festlegte, daß das Ladegeld aus den Ämtern Schwarzenberg und Grünhain doch ihm zustehe. Interessant ist an diesem Schreiben auch, daß schon damals der Raubbau an den Wäldern zur Gewinnung von Kohl- und Feuerholz für die Hammerwerke beklagt und zur Begründung dieses Befehls mitbenutzt wurde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie uns dann wieder etwas später eine Aufstellung des damaligen Bergmeisters Merten Rauch zu Scheibenberg aus dem Zeitraum Luciae 1565 bis Crucis 1566 über den eingenommenen Zehnten und die Ladegelder auf Eisenstein von den Gruben am Emmler und am Hutstein berichtet, umfaßten die größten damals vergebenen Grubenfelder tatsächlich nur 19 Lehn Fläche ‒ die meisten nur 4 bis 8 Lehn. Nur ein einziges mal ist Crucis 1566 auch eine Fundgrube „an der Miltenauer Leiten“ in dieser Liste aufgeführt, sonst werden ausschließlich Lehn angeführt (10036, Loc. 36062, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 0220). Vielleicht hatte der Bergmeister doch ab und an befunden, daß 4 Lehn wirklich arg klein sind...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese gleichermaßen ausführliche, wie
ziemlich einmalige Aufstellung (vielleicht gab es noch mehr davon, aber es ist bislang die
einzige aus dieser Zeit, die uns bekannt geworden ist) berichtet uns auch von einem wirklich erstaunlich hohen
Ausbringen der darin erfaßten, reichlich 30 Gruben (deren Anzahl innerhalb der vier Quartale
mehrfach wechselte). Allein binnen des einen Quartals Luciae 1565 erreichte die
Eisensteinförderung eine Menge
von 1.466¼ Fudern; auch im darauffolgenden (Winter-) Quartal Reminiscere
1566 waren es 1.167¼ Fuder, Trinitatis 928 und Crucis 929½
Fuder, respektive waren es in dem gesamten, ein Jahr umfassenden Zeitraum
4.491 Fuder !!
Dabei fehlen in der Auflistung sogar noch einzelne Angaben, wo die Gesellen vom Ladegeld ganz oder zur Hälfte befreit gewesen sind... Und diese Menge ist ausschließlich auf Raschau'er Flur, in der Heide, am Emmler und am Hutstein ausgebracht worden. Erst Crucis 1566 taucht auch einmal die Grubenbezeichnung „2 lehn uff der grunhayner breitenfelde“ auf. Wenn wir richtig zusammengezählt haben, sind von den Hammermeistern auf diese Menge übrigens Zehnt und Ladegeld in einer Höhe von insgesamt 269 Thalern, 18 Groschen und 9 Pfennigen an das Bergamt eingezahlt worden. Unter den aufgeführten Einzahlern ‒ das scheinen hier nur selten die Eigenlehner selbst gewesen zu sein; vielmehr haben offenbar bei den meisten Gruben die Hammerwerksbesitzer und Gewerken auf den jeweils von ihnen ver- bzw. erkauften Anteil des Eisensteins den Zehnten entrichtet ‒ finden wir bekannte Namen von Hammerherren, wie Wolf Klinger, Balthasar Siegel und Hans Röhling, aber auch der (nicht namentlich angeführte) Münzmeister zu Schneeberg war an einer Grube von 8 Lehn am Hutstein beteiligt. Wolf Klinger ist in dieser Aufstellung allerdings der einzige aus der illustren Runde, der selbst „sein 6 lehn am emler“ besaß, bei allen anderen Gruben waren er und die anderen Hammerherren offenbar nur mit einem Anteil beteiligt. Eigenes Grubenfeld besaß auch Thomas Teubner in einem Umfang von 6 Lehn, bei dem Lorentz Teubner mitbeteiligt war, und auch Hans Kleinhempel baute auf einem eigenen Feld von 12 Lehn Größe am Hutstein, auch der zusammen mit den Gesellen Nickel Kleinhempel, Matz (oder Matthes) Schumann, dazumal Besitzer des Obermittweida’er Hammers, und Joachim Hege. Insgesamt haben wir in dieser Liste wenigstens 25 verschiedene Personen gefunden, die gewöhnlich mit anderen gemeinsam bis zu 32 verschiedene Gruben zeitgleich in der Region betrieben oder zumindest auf den dort ausgebrachten Eisenstein den Zehnten entrichtet haben. Das können nicht alles nur Hammerherren, das müssen auch Bergleute und deren Gesellen gewesen sein. Außerdem finden in den Ortsangaben auch einige Grundbesitzer Erwähnung, wie etwa Thomas Meier, Wolff Anger und Baltzer (Balthasar) Ragewitz. Obwohl diese Grubenfelder meist nur klein gewesen sind, umfaßte die insgesamt verliehene Grubenfeldfläche weit über 200 Lehn. Wenn wir richtig gezählt haben, waren es z. B. Luciae 1565:
Auch diese Zahl schwankte natürlich über die vier dokumentierten Quartale mit der Anzahl der gangbaren Gruben. Die pauschale Angabe so und so viele Lehn „am emler“ oder „am hutstein“ bei den meisten Gruben hilft uns natürlich wenig dabei, sie zu verorten. Auch taucht mehrfach die Bezeichnung „am alten emler“ auf. Konkret benannt werden unter anderem eine „Kießzeche am emler“ oder eine Grube des Namens „Lieb Oßwald am emler.“ Anstelle der Luciae 1565 noch genannten Grube „Hülfe Gottes“ erscheint im Quartal Reminiscere 1566 dann eine neue Grube namens „Neues Glück“ mit derselben Ortsangabe „uff der heyde“ mit allerdings auch nur 3 Lehn Fläche. Eine Kapelle, die dem St. Oswald geweiht war, hat es auf der nördlichen Seite der „Heide“ – schon auf Waschleither Flur – gegeben, die heute noch als Ruine fortbesteht (auch als „Dudelskirche“ bekannt). Wie dieser Heilige allerdings ins Erzgebirge gelangt ist, ist uns unklar, denn die katholische Kirche kennt zwei dieses Namens, die beide keinerlei Verbindung zur Region hatten, nämlich einen nordostenglischen König und Märtyrer (*604, †642) sowie den Bischof Oswald von York (*925, †992), auch kein Sachse... (wikipedia.org) Interessant ist ferner, daß es am Hutstein Luciae 1565 und Reminiscere 1566 eine „Stolner Oberschar“ gegeben hat. Gelegentlich hat der Bergmeister dem auch ausführlicher hinzugesetzt „uff der schneppen unten am emler.“ Ein Stolln selbst findet an dieser Stelle allerdings keine Erwähnung. Das könnte aber dennoch darauf hinweisen, daß der später unter dem Namen Catharinaer oder Kirchenstolln bekannte, von Süden her unter den Emmler hindurch getriebene und später auflässig gebliebene Stolln bereits in dieser frühen Phase Vorgänger hatte. Schließlich konnte der Abt zu Grünhain beim Einzug der Hutweide im Jahr 1502 ja nur auf kirchliche Ländereien zugreifen und nicht auf weltlichen Besitz. Wie wir wissen, zog sich der Raschau’er Pfarrwald über den Hutstein und den Emmler hinweg bis fast nach Langenberg, während sich der Raschau’er Gemeindewald sogar bis hinüber zum Graul ausdehnte. Auch der langjährige Ortschronist von Raschau S. Hübschmann (2004) meinte, daß nach seinen Recherchen der Kirchenstolln auf das 16. Jahrhundert zurückgehe und daß 1557 der Raschau’er Pfarrer Johann Grabner selbst am 1. Lichtloch des Stollns an der Haspel gestanden habe. Später sei der Kirchenstolln von einem Cuntz Tirolf weitergetrieben worden. Dessen Erben, Martha und Wolf Osterland, verkauften ihn 1570 für 50 Gulden an die Klinger’s, die den Stolln jedoch liegen ließen. Übrigens wird in der Liste aus dem Jahr 1565 auch der „Zeisigkgesang“ dem Hutstein zugeordnet. Ähnliche Aufstellungen haben wir bisher
erst wieder aus dem Jahr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So richtig scheint es aber schon damals
wohl doch nicht mit der Abrechnung von Zehntem und Ladegeld geklappt zu
haben und so sah man sich schon Ende des 16. Jahrhunderts erneut genötigt,
Verordnungen über das ordnungsgemäße Vermessen des ausgebrachten
Eisenerzes zu treffen. Die folgende geht auf die Zeit des noch unmündigen
Kurfürsten Christian, II. (*1583, †1611, seit 1591 Kurfürst in
Sachsen) zurück und ist in Abschrift in einer Oberbergamtsakte zu finden
(40001, Nr. 3287, Blatt 1f):
An Schösser zu Schwartzenbergk undt Wolff Petzoldt, Berckverwalter. Verordnung Friedrich Wilhelm, Administrator pp. „Wir werden berichtet, daß biß anhero in Ampt Schwarzenberge, Schneeberge undt Scheubenberge der Berckleutte ansagen undt bericht wegen deß gewunnenen Eisensetein mit den Hammermeistern, so den Zehenten und künftig in gedachte Ämpter hiervon zu endtrichten schuldigk, allerdings nicht Übereingetroffen, weil das durch solche Ungewißheith an itzgedachter Amptsgebühr wohl etwas versehen undt zurück bleiben kann, So bringen wier vor Uns undt dem hochgebohrnen Fürsten, Herrn Johanns Georgen, Markgrafen undt Churfürsten zu Brandenburg, in gesamter vormundschaft, ihr wollet an Jedem orte zweu Steinmeßer verordtnen, dieselben gebührlich vereyden undt ihnen auferlegen, das sie allen gewonnenen Eisenstein vermessen, richtige Verzeichniß, was iederzeith vermessen, darüber halten undt dieselben alle Quartale iedeß orts (den) Berckmeistern zustellen, ingleichen den Hammermeistern undtersagen, daß sie sich bey einer gewißen poen an den ungemeßenen Eisenstein nicht vergreifen undt wenn solches von einem oder den anderen beschehn, solches die Steinmeister den Berckmeistern alsobald anzuzeigen schuldigk sein sollten, damit also die Berckmeister, den Schößern in den Ämptern hierüber bestendigen Bericht einsenden undt die Schößer den Zehendten undt Ladegroschen von den Hammermeistern richtigk einfordern mögen. Was auch der Steinmeßer Lohn anlangett, wollet ihr es gleich der ufm Berck Gußhübel*) gemachten anordtnung dahin richten, daß ihnen von ieder Fuhre 2 (Pf.?) Meßergeldt von den Gewercken undt Hammermeistern zugleich entrichtet undt gedachte Unser junge Vettern mit solchen Kosten verschonett werden. An deme vollbringet ihr (Unseren Willen...) pp. Datum Dresden, den 24. Marty 1592“ *) Gemeint ist der Ort Berggießhübel im Osterzgebirge. Zur Erläuterung muß hier noch hinzugefügt werden, daß die Vormundschaft über den ,jungen Vetter‘ damals von Friedrich Wilhelm von Sachsen- Weimar (*1562, †1602) aus der ernestinischen Linie gemeinsam mit Kurfürst Johann Georg von Brandenburg (*1525, †1598) ausgeübt wurde. Der Zusammenhang erklärt sich daraus, daß die Mutter von Christian, II. die Tochter von Johann Georg von Brandenburg gewesen ist. Die zusätzlichen Kosten für das Vermessen des Erzes den Grubengewerken und Hammermeistern zu gleichen Teilen aufzuerlegen, war natürlich eine für den Fiskus sehr angenehme Lösung... Schon früher wurden aber auch immer wieder einige Hammermeister auf deren Antrag hin von dem halben Ladegroschen befreit, um ihnen Investitionen zu erleichtern (vgl. 10036, Loc. 36138, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 2203 und 2216).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl sie in der oben genannten Liste noch nicht auftaucht, machte sich schon ab dem 16. Jahrhundert auch die Familie von Elterlein durch den Betrieb von mehreren Hammerwerken in der Region einen Namen. Die von Elterlein vereinigten u. a. die beiden bedeutenden Pöhla'er Hammerwerke Siegelhof und Pfeilhammer, die andere Linie der Familie dagegen den Arnoldshammer mit dem Rothenhammer in Rittersgrün. Im 18. Jahrhundert erreichten diese Eisenhämmer unter denen von Elterlein ihre größte wirtschaftliche Blüte. 1727 wurde Johann Christoph von Elterlein sogar zum Hammerwerksinspektor für die Ämter Schwarzenberg und Crottendorf ernannt (10036, Loc. 36159, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 2686). Gleich gegenüber
vom Pfeilhammer
auf der Großpöhla'er Seite war Carl Ludwig von Elterlein später auf der
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Zeichnung des Siegelhofes zu Pöhla um die Mitte des 19. Jahrhunderts, damals schon im Besitz von Nestler & Breitfeld. Aus: Ludwig Oeser: Album der sächsischen Industrie, Band 2, S. 13ff. Bildquelle: Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
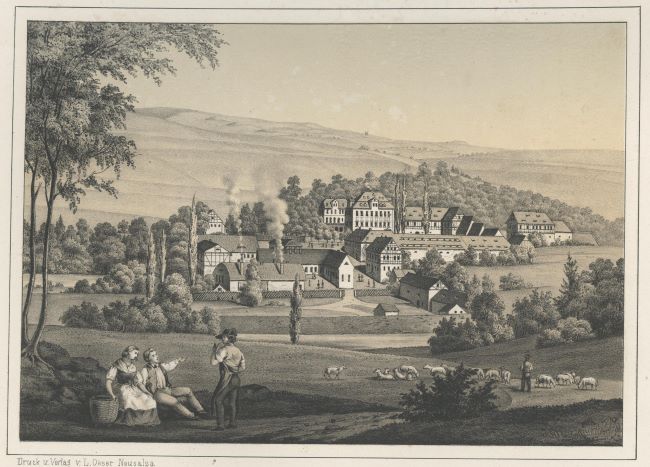 Der Pfeilhammer zur gleichen Zeit, damals im Besitz des Herrn Porst & Co. Aus: Ludwig Oeser: Album der sächsischen Industrie, Band 2, S. 27f. Bildquelle: Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Herrenhaus des Pfeilhammers zu Pöhla im Jahr 1924, Foto: Walther Möbius, Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Sitznischenportal des Gutspächterhauses Eisenhammerwerk Pfeilhammer im Jahr 1926, Foto: Walther Möbius, Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Wappentafel mit den Initialen I H V E (Iohann (oder Hans) Heinrich von Elterlein) und der Jahreszahl 1687 über dem Portal des ehemaligen Gutspächterhauses im Jahr 1986. Foto: Hans Reinecke, Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Hammerwerk Obermittweida befand sich unterhalb der Vereinigung von Kleiner Mittweida und Großer Mittweida und ist als Eisenhütte mit einem Zerrennfeuer erstmals 1546 urkundlich erwähnt. Dem ersten bekannten Besitzer Matthes Schumann gehörte außerdem noch eine weitere Eisenhütte, die sich flußabwärts, an der Mündung des Roßbachs in die Große Mittweida, befand. Wie wir oben gelesen haben, bezog er zumindest einen Teil des Eisenerzes von einer der Gruben am Hutstein. Wolf von Elterlein übernahm 1588 die dazumal gerade abgebrannte Hütte, für die er 1594 die Konzession zur Errichtung eines Hochofens erhielt (10036, Loc. 36278, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 3802). Ihm verdankt der Hammer seine Beinamen „Wolfshammer“ oder „Hammer Löwenthal“, denn die Familie von Elterlein führt einen Löwen in ihrem Wappen. Wolf Samson von Elterlein mutete nach 1673 die Eisenerzgrube Vater Abraham in Oberscheibe. Nach dem Tod des Johann Heinrich von Elterlein, dem Älteren, bereits gewesener Besitzer des Pfeilhammers zu Kleinpöhla, hat dann der Schwager der Familie, Friedrich Siegel, seinerseits damals Besitzer des Großpöhla’er Hammerwerks, zunächst den Hammer Löwenthal übernommen (12613, Amtsgericht Schwarzenberg, Nr. 178, Blatt 11f). Er erhielt 1685 von den Erben zugleich 1 Schicht zu 32 Kuxen an der Erla’er St. Johannis Fundgrube, respektive ein Viertel der Anteile. 1686 gehörten den Erben des Pfeilhammers, die in dieser Urkunde angeführt sind, als (12613, Amtsgericht Schwarzenberg, Nr. 178, Blatt 13f):
an „Bergtheilen“ darüber hinaus noch:
Wahrscheinlich beabsichtigten die Erben schon 1691, den Obermittweida‘er Hammer zu verkaufen (30016, Nr. 1459). Zunächst wurde er aber an Johann Benjamin Hennig, damals Besitzer der Carlsfeld'er Hammerwerks, nach 1726 dann an den Schwarzenberg’er Steuereinnehmer Gottfried Leschke verpachtet (12613, Amtsgericht Schwarzenberg, Nr. 178, Film 0104). Der letztere kaufte den Erben den Hammer 1721 ab (12613, Amtsgericht Schwarzenberg, Nr. 164, Film 0053). Die Familie von Elterlein drückten Anfang des 18. Jahrhunderts offenkundig Schulden und so notierte Bergmeister Michael Enderlein am 23. Februar 1704 auch einen „Consens“ zwischen „Frau Rosine verwittibte von Elterlein zur Obermittweyda und deren Curator Hrn. Samuel Schaarschmidt, Berggeschworner in Eybenstock, wegen des Frau Annen Catharinen Röhlingen zu Elterlein schuldigen Capitals von 3.600 Thaler“ über die Verpfändung von Berggebäuden an letztere, worin die beiden Gruben Andere Heinzenbinge am Erla‘er Rothenberg und Vater Abraham zur Oberscheibe als Besitz und Zubehör wieder als Zugehörungen zum Obermittweida’er Hammer genannt werden (12613, Amtsgericht Schwarzenberg, Nr. 178, Rückseite Blatt 63).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem das Hammerwerk Obermittweida mehrfach durch Hochwasser (u. a. 1661) und Brände (u. a. 1613, 1667, 1673 und 1724) zerstört worden war, erwarb es von Herrn Leschke zehn Jahre später schließlich Andreas Nietzsche. Daraufhin kam bald die bis heute gebräuchliche Bezeichnung „Nietzschhammer“ auf. Der Kaufvertrag ist in den Gerichtsbüchern des Amtsgerichtes Schwarzenberg erhalten geblieben (12613, Amtsgericht Schwarzenberg, Nr. 164, Film 0053): Obermittweyde
Herrn D. Andreas
Niezschens Kauff über das Obermittweyder Hammerwerck „Kund und zu wißen sey hiermit männigl sonderl. denen (?) gelegen, was maßen zwischen unterschriebenen (?) Kauff Contract geschloßen und verabhandelt worden, nehmlich es verkauffet Hr. Gottfried Leschke, Königl. Poln. u. churf. (?) bestallter Ambt Steuer Einnehmer zu Schwarzenberg, das von Hrn. Johann Heinrich von Elterlein und Consorten unterm 27. Juni ao. 1721 erhandelte, unterm wohll. Kreysamte Schwarzenberg gelegene Obermittweyder Hammerwerck, und Hammerguth, benebst angehangenen Inventario und Zugehörungen, wie alles in Rainen und Steinen bestund, benebst denen Beygüthern, als Schumanns und (Dreydlich?) Guth samt allen Freyheiten und Gerechtigkeiten, einen Hohenofen, einer gangbaren und 2 caduc. Stech Hütten, die Berechtigung zweyer Blech Hütten und eines Zinnn Haußes, einer Mahl Mühe und 2 caduc. Zerrenn Feuern, auch einer gangbaren und einer caduc. Brett Mühlen, über welche letztere aber die (...?), Hr. Verkäuffer keinesweges gehalten ist, ingl. den gesamten Wohn Gebäuden, Häußgen, (?) Ställen, Hütten (?) und Vieh Häußgen, Gärten Hohenofen und Hütten Geräth, ingl. denen oberen und unteren alten anoch vorhandenen (Schlacken?) über welche letztere sich diesfalls besonders verglichen worden, ferner alles (...?) was nicht niet und nagelfest ist, wie auf denen Feldern und Wiesen (...?) alles von langen Zeithen her übl. Und zu nutzen gewesen, (...?) ingl. das sogenannte Roß Bächlein, so weit die betr. Refier gehet, ferner (3?) Schichten auf der Eisenstein Zeche, die 1te Heinzenbinge genannt, benebst der darzu gehörigen oberen Johannis Zeche am Erlaer Rothenberg, weitere 3 Schichten auf der Vater Abraham Zeche zu Oberscheube, ferner die Flöß Grube aufm Pöckelguth, welche bey ehemaliger Alimation solche vom Pöckelguthe reserviret worden, und wie der Raum über der Breth Mühlen am Groß Mittweyder Waßer gelegen, vor einiger Zeit an Christian und Hanß Georg Meyer verpfändet und auf gewiße Art veralieniert worden, so soll Herr Käuffer gleichfalls frey stehen, solches zu relinieren, (...) an Herrn Andreas Niezschen bey der Rechten Doctoren, zum Pfeilhammer um und vor 7.000 Thl. sogen. Siebentausend Thaler, folgendergestalt zu bezahlen, alß Dreytausend Thaler baar bey der Tradition und Übergabe und 400 Thl. jährl. Nachzahlung, womit Neujahr 1732 der Anfang zu machen und bis zu gänzlicher Befriedigung zu continuiren… auch alle zum Hammerwerck gehörige Documenta, privilegia, Kauff- und Lehn Briefe… Herrn Käuffer zu überlassen, ihm auch die zwey Fenster im Elterleinischer Kirchen Stübgen unter obiger Kauff Summe zu überlassen... So geschehen aufn Pfeilhammer zu Kleinpöhla, den 2ten Jan. 1731“ Zum Besitz gehörten demnach noch immer drei Viertel der Kuxe der 1. Heinzenbinge in Erla, ebenso drei Viertel der Kuxe von Vater Abraham sowie eine Flößzeche am Pökelwald. 1741 ersuchte Dr. Andreas Nitzsche um die Erneuerung des seinem Vorgänger auf dem Hammerwerk, Wolf Samson von Elterlein, 1664 erteilten Privilegs zum Bau zweier Blechfeuer und eines Zinnhauses sowie zum Erhalt von jährlich 300 Schragen Holz (10036, Loc. 38999, Nr. 0117 und Nr. 0237). Zwischen 1765 und 1772 ging der Nietzschhammer durch Verkauf an dessen Söhne Christian Gotthold und Christoph Andreas Nietzsche über (12613, Amtsgericht Schwarzenberg, Nr. 166). 1788 bestanden in Obermittweida ein Hochofen, zwei Frisch- und Stabfeuer, ein Blechfeuer und ein Zinnhaus. Dieses Eisenwerk war noch bis 1860 in Betrieb. Später betrieb Carl Heinrich Nietzsche, zu dieser Zeit Bergkommissionsrat und Eigentümer des Erla'er Hammers bei Schwarzenberg, die Grube Gnade Gottes bei Langenberg. Sowohl die Nietzsche's, als auch die von Elterlein bezogen bis zur Einstellung der Grube Vater Abraham im Jahr 1866 aber einen Teil des auf ihren Hammerwerken benötigten Eisenerzes noch aus Oberscheibe.
Der Name Nietzsche
ist uns auch in Zusammenhang mit dem Raschau'er
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg findet sich unter den Abnehmern des in Oberscheibe, Schwarzbach, Raschau und Langenberg geförderten Eisenerzes dann kein Eisenhammer in Raschau mehr. Wo diese Eisenhämmer nicht zu Landgütern geworden sind (wie der Tännicht'er und der Förstel'er Hammer), sind aus ihnen meist Verarbeitungsbetriebe geworden (z. B. Draht- und Schaufel- Hämmer, wie sie etwa das Unternehmen von Nestler & Breitfeld um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Raschau noch betrieb). Diese stellten das Roheisen nicht mehr selbst her, sondern kauften es bei anderen Werken ein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Nachfahren der von Elterlein’s in Pöhla dagegen erwarben 1752 noch den – zwischenzeitlich in den Besitz der Familie Biedermann und schließlich eines Dr. jur. Christoph Carl Pistorius gekommenen – nach dessen Vorbesitzer schon „Siegelhof“ genannten Hammer in Großpöhla. Auch dieser Kaufvertrag ist noch in den Gerichtshandelsbüchern zu finden und nennt uns unter Punkt 4. den bestehenden Bergwerksbesitz des Verkäufers (12613, Amtsgericht Schwarzenberg, Nr. 164, Film 0738): Großpöhla
Hrn Hannß Heinrich
von Elterlein Hammerwerck und (?) Kauff „Kund und zu wißen, daß untengesezten dato zwischen Hrn. Christoph Carl Pistorio, führnehmen Rechts Consulenten und Hammer Wercks Besitzer zu Großpöhla, Verkäuffer, (?) Hrn. Hannß Heinrichen von Elterlein, auch führnehmer Hammer Wercks Besitzer zum Pfeilhammer, Käuffer, (...) verhandelt und geschlossen worden, nehml. Es verkauft gedachter Herr Pistorius 1.) sein zeither in Besitz gehabtes sogenanntes Biedermann’sches Hammerwerk zu Großpöhla, nebst dem damit combinirten (Klötzischen?) Guthe allda, (...) 4.) nebst denen darzu gehörigen (?) gehörigen Eisenstein Gebäuden, als - 4 Schichten in der Fundgrube am Erlaer Rothenberg, die erste Heinzenbinge genannt, - 4 Schichten in dieser Heinzenbinger Gegendrum, von Mittel des Schwarzwaßers an gegen Bermesgrün, - 4 Schichten in einer Fundgrube am Erlaer Rothenberg neben dem ehemals so genannten neuen Kunst- und Wetter Schacht im Hangenden, so am 7. Junii 1684 gemuthet und - 4 Schichten in einer Maaß noch allda im Hangenden, hierüber noch - 2 Schichten oder 64 Kuxe in der zu denen Erla Rothenberger Eisenstein Zechen erbaueten Berg Schmiede bey Crandorff... mit allen Freiheiten und Gerechtigkeiten (...) zu Sechs Tausend Thaler baares Geld, (...) Sigl. Pfeilhammer den 25. April 1752“ Die Grube Vater Abraham zu Oberscheibe ist an dieser Stelle natürlich nicht genannt, denn sie gehörte ja zum Bergwerksbesitz des Nietzschhammers in Obermittweida und des Pfeilhammers in Pöhla.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch das Hammergut am Tännigt wird bereits Ende des 15. Jahrhunderts urkundlich genannt. Zu dieser Zeit ist Johann (oder kurz Hans) Klinger aus Elterlein der Besitzer. Der Tännigthammer war mehr als ein Jahrhundert im Besitz der Klinger’s. Auch die Familie Klinger war offenkundig sehr unternehmungsfreudig und im Bergbau der ganzen weiteren Umgebung aktiv. Peter Klinger war 1532 sogar Bergmeister im schönburgischen Bergamt zu Elterlein (40014, Nr. 1). Das Hammergut Tännigt fiel nach dem Tod von Hans Klinger an dessen Sohn Caspar Klinger, für den Hans Klinger außerdem 1540 den benachbarten Förstelhammer eingerichtet hatte. Für seinen um 1551 geborenen, ältesten Sohn Nikolaus (oder kurz Nicol) Klinger erwarb Caspar Klinger 1569 den Pfeilhammer in Pöhla. Den Tännigthammer vererbte Caspar nach seinem Tod 1546 dagegen seinem Sohn Wolfgang (oder kurz Wolff) Klinger. Nach 1580 wird Michael Klinger als Hammerherr „am Emmler“ genannt. Auch der bekannte Annaberg'er Bergamtsverwalter Markus Röhling war hier an den Eisenhämmern beteiligt (10036, Loc. 36278, Rep. 09, Nr. 3809). Für Nicol Klinger erwies sich insbesondere seine Heirat 1583 mit Anna von Elterlein als vorteilhaft, denn mit Hilfe der Kontakte der (seit 1514) adligen Familie konnte auch er seinen Besitz fortan stetig erweitern. 1586 erwarb er zusammen mit Carl Frey (oder Freier, auch dies übrigens ein Name, der schon in der Auflistung des Eisenstein- Zehnten aus dem Jahr 1565 auftaucht) den Brennerhammer in Hammerunterwiesenthal, um 1590 den Kugelhammer zu Schwarzenberg, 1593 den Sachsenfelder Hammer, 1597 den Eisenhammer Erla und den Höllhammer in Voigtsberg. Auf dem Obermittweida'er Hammer war er Pächter. Daneben betrieb er das Eisenbergwerk St. Sebastian in Böhmen, außerdem Holzflößerei auf dem Pöhlbach. Für das Werk in Hammerunterwiesenthal wenden sich die Hammermeister Carl Freier und Caspar Klinger, der Jüngere 1586 in einem Schreiben an den Kurfürsten, worin sie unter Bezug auf ihren Nachbarn, den Hammermeister Hans Röhling zu Unterwiesenthal, um ein gleiches Privileg nachsuchten. Dem wurde offenbar stattgegeben, denn zwischen 1586 und 1592 wurde hier der erste Hochofen in der Annaberg'er Region errichtet. Der Schwiegersohn des Wolff Klinger, Melchior Siegel, verheiratet mit Barbara Klinger, wird 1591 als Bergwerksbesitzer auf der Unruh bei Eibenstock genannt. Die Klinger’s waren also sowohl mit denen von Elterlein, als auch mit den Siegel’s verschwägert. 1587 übernahm Wolfgang's Sohn Hans Klinger den Tännigthammer, der zu dieser Zeit nur ein Rennfeuer besaß. Das Rennwerk konnte jedoch nicht mehr betrieben werden, da seine Bergwerke „fast kein weichschmelziges Eisenstein, so man zum Zerrennfeuer haben muß“ mehr lieferten. 1613 erhielt auch er deshalb die Konzession für den Bau eines „Hohen Ofens“ und die Zuteilung der benötigten Kohlhölzer (10036, Loc. 32278, Rep. 09, Nr. 3815). Trotzdem ging es wirtschaftlich weiter bergab. Nach Wolfgang's Tod 1616 verkaufte die Witwe den Hammer schließlich an Samuel Weigel, selbst Hammermeister in Markersbach, welcher sich damit zumindest unliebsame Konkurrenz vom Halse schaffte. Zunächst wurde das Tännigter Hammerwerk aber als solches noch weitergeführt, denn 1624 wird Samuel Weigel als Hammermeister im Tännigt noch genannt (10036, Loc.36070, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 0430).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während des Dreißigjährigen Krieges wurde der Tännigthammer 1632 durch die kaiserlichen Söldner des berüchtigten Generals Heinrich Holk zerstört. Danach wechselten die Besitzer des Gutes mehrfach. 1688 war es im Besitz von Johann Ernst Häßler (10036, Loc. 36071, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 0437). Auch zwischen 1711 und 1720 wird dieser noch als „Hammerherr im Tännicht“ erwähnt (30008, Nr. 909). In seiner schon einmal zitierten, 1699 erschienenen Beschreibung des Obererzgebirges erwähnte der Scheibenberg'er Pfarrer Christian Lehmann neben anderen Vorkommen auch den Kalksteinabbau am „Dennicht“. In seinem Kapitel Von Kalck- Brüchen schrieb er dazu: „Am Schwarzwasser und seinen Einfällen (Zuflüssen) liegen 2 Kalck Brüche / der eine über dem Ursprung und Quell des Marcker Bachs auff der Ober Scheibner / welcher aber nur ein Trum vom Crotendörffer Hauptgang ist / und wegen Mangel des Holtzes liegenblieben / soll zu Marmor versparet werden. Der andere ist am Schwarzbach unter dem Dennicht zu finden / ist grau / und liegt flötzweiß nur 2 Lachtern tieff / hält fester am Wetter als der weiße. Er färbet nicht weiß / sondern dienet nur das rauche zu bewerffen / dahero er auch selten wird gebrant / dieweil man zu iedem Brand muß 10 Schragen Holtz haben / und gilt ein Faß nur 18 gr. …“ Auf den Eisenerzbergbau geht Pfarrer Lehmann leider nicht ein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1739 schließlich erwarb das
Hammergut Gottfried Heinrich Meyer. Die Familie Meyer war zuvor schon in
Schwarzbach ansässig, wo Georg Meyer 1708 die Papiermühle erworben hatte
(40014, Nr. 81). Nach dem Ableben des Gottfried Heinrich Meyer übernahm
es im Jahr 1774 käuflich sein jüngster Sohn Carl Gottlob Meyer. Der
Kaufvertrag ist ganz interessant, nennt er uns doch das Zubehör des Gutes: Zu
dieser Zeit war es schon kein Eisenhammer mehr, sondern – wie Förstel
auch – ein Landgut. Wir zitieren daraus (12613, AG Schwarzenberg, Nr. 167,
Blatt 88bf):
Meyde (Kürzel für das Erbgericht zu Mittweyda)
Gottfried Heinrich Meyer Kauft das sogenannte Hammer Guth. „Tuend kund zu wisßen, sey hiermit jedermann, sonderlich denen es zu wißen nöthig, daß am unten gesetzten dato allhier im Erbgericht Mitweyda zwischen hernach genannten Contrahenten folgender Erb Guth Kauff, nehmlich verst.(?) Gottfried Heinrich Meyers nachgelaßene Witwe und Erben, als 1.) Fr. Anna Rosina verwittwete Meyern cum curatore constitus Hr. Gottfried Meyern Erbbesitzer des Tännicher Guths allhier, 2.) Fr. Susanna Rosina geb. Meyerin cum curatore marito, Carl Gottlieb Oertel, Erbbegütherter und gerichts Beysitzer hierselbst 3.) Fr. Christiana Carlotta geb. Meyerin cum marito Mstr. Christoph Friedrich Böschmann,, Bürger und (?) in Elterlein, 4.) Christian Friedrich Meyer, Erbbegüterter allhier, 5.) Fr. Johanna Rosina, geb. Meyerin cum curatore marito Johann Gottlieb Müller, Müller und (?) in Rittersgrün, dann 6.) Johanna Concordia Meyerin durch ihren Actoren s. f. Herrn August Friedrich (?) resignirten General Accis Insp. und Adv. immatr. zu Grünhayn... das von ihnen resp. (?) Mann und Vater hinterlaßne und ererbte Hammer Guth wie es solches ad. 1739 den 18. Juny vor 990 (Thaler?) käuflich an sich gebracht und wie es in seinen Rainen und Steinen zwischen dem Erbgerichts Guth der Gemeinde Viehtrift und Christian Friedrich Meyers Erbguth zu befinden, nebst Wohnhauß, Scheune, Stall, Schuppen, Ackern, Feldern, Wießen, (?) und Gehölzen samt allem was dabey heute fand, Erd, Wind und Nagel fest ist, wie auch dem annedicte Inventario mit allen (Gerechtigkeiten, Nutzen und Beschwerungen?) wie dieses ihr Mann und Vater gleich voriger Besitzer inne gehabt, genutzet und gebrauchet, auch nutzen und brauchen möge, an ihren jüngsten Sohn Bruder und Schwager Gottfried Heinrich Meyer vor und um ein tausend sechs hundert Thaler – sage 1600 RThl. –Haupt und Kauf Summa welche Käuffer auf folgende Weiße zu bezahlen verspricht (?), als 900 Thl. zum Angelde, vier Wochen nach der Ratification baar zu erlegen, hiervon zuförderst dasjenige Consens Capital an 200 Thl. so Hr. Christian Gottlob Schubert aus Raschau zu fordern, abgestoßen, hernacher die noch verbleibenden 700 Thl. unter die sämmtlichen Erben pro rata zur Ausgleichung vertheilt werden sollen. Das Residuum ab 700 Thl. aber auf Nachzahlung alljährlich mit 40 Thl. und Ostern 1775 anzufangen, auch damit biß zur völligen Tilgung der Kauf Summa zu continuiren, abzuführen...“ Anmerkung: Die juristischen Anhängsel
charakterisieren die Zeiten, in denen eine Frau allein nicht geschäftsfähig war. Nach dem Ableben von Carl Gottlob Meyer im Jahr 1806 fiel das Gut an dessen Sohn Erdmann Friedrich Meyer. Der letztere hinterließ bei seinem Tod 1855 offenbar keine männlichen Erben. Durch Heirat seiner Tochter Emilie Thekla Meyer gelangte daraufhin das Hammergut nun an Carl Louis Stengel. Nach seiner Gattin ist wahrscheinlich aber auch der um diese Zeit angeschlagene Emilie Stolln bei Meyers Hoffnung Fundgrube benannt. Carl Louis Stengel verstarb schon 1865. Wie wir letztendlich anhand der Grubenakten von Wilkauer vereinigt Feld herausbekommen haben (40169, Nr. 143, Blatt 228), hatten Carl Louis Stengel und seine Gattin Emilie Thekla Stengel, geb. Meyer eine Tochter, der sie tatsächlich die Vornamen ihrer Mutter noch einmal gaben. Diese Tochter ehelichte später den damaligen Zittau'er Bürgermeister Hermann Johannes Oertel, während ihre Mutter am 4. April 1900 verstorben ist. Bereits den Kaufvertrag über das Hammergut vom Jahr 1774 hatte als Zeuge übrigens ein Carl Gottlieb Oertel mit unterzeichnet ‒ möglicherweise kannten sich diese Familien also schon lange. Jedenfalls gelangte das Gut auf dem Wege der Heirat nun an Herrn Oertel. Dieser wiederum ist um 1917 ebenfalls verstorben. Seine Gattin Emilie Thekla Oertel, geb. Stengel folgte ihm 1932 nach (40024-12, Nr. 375). Der letzte Besitzer das Gutes war der seit 1911 von Frau Oertel angestellte Gutsinspektor Richard Conrad Böhme. Dieser legte zwischen 1928 und 1930 sogar noch einmal eine neue Mutung auf Meyers Hoffnung Fdgr. ein, die jedoch abgewiesen wurde (40027, Nr. 0715). Von dem Gut ist nur das um die Wende zum 20. Jahrhundert errichtete Wohnhaus an der Südseite der Straße (in nachstehender Grafik die untere Zeichnung) und ein Wirtschaftsgebäude gegenüber auf unsere Zeiten überkommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etwas umgebaut steht das Wohnhaus des Hammergutes noch heute (untere Zeichnung in der Abbildung oben).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von den Wirtschaftsgebäuden des einstigen Hammergutes steht heute nur noch dieses Stallgebäude.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Förstelgut fiel dagegen nach dem Tod Nikol Klinger's, des Jüngeren (*1551, †1610) durch Heirat der Erbin Esther Klinger (*1591, †1622) im Jahr 1610 an die Familie von Schmertzing. Rudolph von Schmertzing, sächsischer Major und Kriegskommissar, begründete auf kurfürstliches Privileg vom 12. März 1619 den Ort Langenberg als Wohnsiedlung für die Hammerwerksarbeiter. Unter ihm wurde Förstel auch in den Rang eines Rittergutes erhoben. Im Jahr 1622 ließ er noch einen Hochofen mit Frischfeuer errichten (10036, Loc. 36071, Nr. 0458). Zwischen 1669 und 1695 war Förstel im Besitz des damaligen Annaberg'er Bürgermeisters Christian Cronberg (10036, Loc. 38070, Rep. 47, Nr. 0047 und 10084, Nr. 08673), zuletzt seiner Witwe Anna Maria Cronberg. Von ihr kam Förstel in den Besitz von Christiane Barbara Häßler, geb. Cronberg (*1664, †1723). Ihr Ehemann war Johann Christoph Häßler, Herr auf Tännicht. Schließlich übernahm 1701 Johann Heinrich Treutler (*1671, †1764), Christiane Barbara's zweiter Mann, das Gut. In diesem Kaufvertrag ist letztmalig von der Hammergerechtigkeit auf Förstel die Rede (chronik-raschau.de). 1790 kaufte es Johann Heinrich Conrad Querfurth (*1747, †1817), zuvor ebenfalls Bürgermeister in Annaberg. Nach dessen Tod fiel das Förstelgut an seinen Sohn, Carl Christian Edler von Querfurth (*1779, †1845). Dieser erwarb noch Ländereien bis zur Heyde bei Waschleithe hinzu und bewirtschaftete zeitweise auch das Pökelgut in Mittweida, verlegte seinen Wohnsitz später jedoch auf den Schönheider Hammer. Seine Erben verkauften daher das Gut Förstel 1846 an Karl Gustav Flemming, späterer Friedensrichter in Scheibenberg (13888 Nr. 06).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schließlich erwarb das Förstelgut um 1889 der
Leipziger Pharmazeut, Stadtrat und Vorsitzender der Krankenkasse Dr.
Willmar Schwabe und ließ es als „Heimstätte für Genesende“ ausbauen
(30045, Nr. 33 und 20237, Nr. 27617). In nationalsozialistischer Zeit wurde Förstel
zum Müttererholungsheim umprofiliert. Zu einer Zufluchtsstätte für Frauen
und Kinder wurde das Heim ab 1943, als infolge anglo-amerikanischer
Bombenangriffe viele Menschen aus den westlichen Landesteilen nach dem
Osten evakuiert wurden. Im Sommer 1945 war Förstel überfüllt mit
Flüchtlingen aus den Ostgebieten. Im Besitz der Schwabe’schen
Heimstättenstiftung blieb das Heim bis 1959.
Am 1. September 1992 konnte die Dr. Willmar Schwabe‘sche Heimstättenstiftung ihre Rechte wiedererlangen und das Förstelgut als Alterswohnsitz ab 1998 noch weiter ausbauen. Die Förstelschänke wurde dagegen im Jahr 2000 abgerissen (chronik-raschau.de).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das einstige Herrenhaus des Förstelgutes, zu dieser Zeit schon Heimstätte der W. Schwabe- Stiftung, im Jahr 1906 von der Landstraße von Schwarzbach nach Langenberg aus gesehen, Foto: Postkartenverlag Brück & Sohn Meißen, Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese historische Aufnahme des Förstelgutes zeigt dessen Bauzustand um 1910. Links vorn im Bild die frühere Förstelschänke, an deren Stelle sich heute der Gästeparkplatz befindet. Quelle: Informationstafel am Gästeparkplatz vor dem heutigen Alterswohnsitz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Aufnahme im Vorfrühling 2024 ungefähr vom selben Standort aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das repräsentative Hauptgebäude des einstigen Rittergutes wurde denkmalgerecht erhalten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein schlichter Gedenkstein am Gästeparkplatz erinnert heute an die Familie Klinger als Begründer dieses einstigen Eisenhammers.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum
Eisenstein- Bergbau im
17. Jahrhundert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Literaturquellen liest man oft, daß der Bergbau auch am Emmler nach dem Dreißigjährigen Krieg und noch bis nach Ende des Siebenjährigen Krieges mit Preußen (1756 bis 1763) weitgehend brach gelegen habe. Anhand der gleich noch angeführten Liste von Verleihungen im 17. Jahrhundert sieht man aber, daß er hier auch während des Dreißigjährigen Krieges nie ganz zum Erliegen gekommen ist und sehr bald nach dem Krieg erneut in Angriff genommen worden ist – wohl auch deshalb, weil die Gewinnung dieser Erzvorkommen hier nicht unbedingt einen hohen technischen Aufwand erforderte. Deshalb stimmt das nur zum Teil. In den Acta privata des Freiberg'er Bergrats Johann Georg von Wichmannshausen haben wir zum Beispiel die Abschrift einer Zusammenstellung des damaligen Bergmeisters in Scheibenberg, Christoph Dietrich, gefunden, die auf das Jahr 1628 ‒ also mitten im Dreißigjährigen Krieg ‒ zurückgeht (40001, Nr. 2864, Vol. II, Blatt 83) und eigentlich das Gegenteil aussagt. Aus dem unter dem Amt Grünhain stehenden Raschau kamen damals immerhin noch 520 Fuder, aus dem vormals schönburgischen Amtsbezirk Crottendorf (mit Rittersgrün, Wiesenthal und dem Tännicht bei Schwarzbach) kamen in diesem Jahr 730 Fuder Eisenstein. Das waren nach der Aufstellung des Bergmeisters sogar 225 Fuder mehr, als ein Jahr zuvor.
Gegenüber einer ähnlichen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurz vor dem Ende
des Dreißigjährigen Krieges wurde zu Michaelis 1645 im Amt Grünhain erneut eine Abrechnung
über den eingenommenen Zehnten auf Eisenstein zusammengestellt (10036, Loc. 36067, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 0332, Blatt
4ff). Die Einnahmen aus dem Zehnten auf Eisenstein beliefen sich in dem
vorausgegangenen Jahr demnach im gesamten Amtsbezirk nur noch auf 30 Thaler,
10 Groschen, 6 Pfennige.
Angeführt werden hier als Herkunftsorte des Eisensteins die Grube Überschaar (zwischen Raschau und Pöhla), das Schwarzbach'er Tal, die Heyde, der ,Hutbusch', sowie Baltzer Hänel's Grund zu Raschau. Die Grube Überschaar hatte außerdem auf Flöße Zehnten und Ladegeld entrichtet. Am Ende dieser Liste hat der Verfasser noch hinzugefügt: „Steigt gegen den (vor-) jährigen um 2 Th. ‒ 6 Pf., daß mehr Bergwercke gebauet worden dieses Jahr, laut des Bergmeisters Christoph Dietrichs ufn Scheubenberg unterschriebenen Bekenntnis.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf den folgenden
vier Seiten ist auch des Bergmeisters ,Bekenntnis' in dieser Akte
zu finden: Sein Register über eingenommenen und „in das Ambte
daselbsten zu überantwortenden“ Zehnten und Ladegeld aus den Quartalen
Luciae 1644 bis Crucis 1645. Ausweislich der Ladegeldzahlungen haben in
diesen vier Quartalen, wie schon zuvor bemerkt, aus Raschau, namentlich
vom ,Hutbusch' (sicherlich der alte ,Hutstein') und von Balzer Hänel's Grund, aus der Heyde, sowie von
Schwarzbach und vom Fürstenberg bei Waschleithe nur noch die vier
Eisenhämmer von Heinrich Siegel in Großpöhla, von Caspar Wittich
in Breitenbach (bei Johanngeorgenstadt), von Heinrich von Elterlein's
Witwe in Obermittweida sowie von Christoph Schuchender's Witwe
auf dem Kugelhammer (bei Aue) eine Gesamtmenge von 390 Fudern
Eisenstein abgenommen, davon allein der Großpöhla'er Hammer 171 Fuder. Das
war noch einmal merklich weniger, als 17 Jahre zuvor.
Für das Amt Crottendorf (wo insbesondere das Tännichtgut, aber auch Elterlein und Scheibenberg mit eingegangen wären) konnten wir eine gleichartige Zusammenstellung aus dieser Zeit noch nicht auffinden. Der
Eisensteinbergbau ist natürlich immer mit den Hammerwerken untrennbar
verknüpft gewesen und ist mit den Kriegsereignissen und mit der Zerstörung der
Eisenhämmer ebenfalls zurückgegangen, jedoch offensichtlich nie ganz zum Erliegen
gekommen. Das Metall war einfach zum Überleben zu wichtig.
Auch aus der
nachfolgenden Zeit und bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 sind am Emmler
noch etliche Bergbauversuche bekannt,
wie etwa die St. Sewald
Fundgrube oder die Langenberger sieben Lehne (siehe unsere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ungefähr aus
derselben Zeit könnte auch die Abschrift einer „Ordnung auf Eisen
Bergkwergen im Churfürstentum Sachsen“ stammen, welche der Bergmeister
George Mayer zu Preßnitz / Přísečnice – also eigentlich schon
jenseits der Landesgrenze in Böhmen, was der schönburgischen Herrschaft
halber aber damals irgendwie auch zu Sachsen gehört hat – verfaßt hat. Sie
ist in einer ziemlich umfänglichen Textsammlung enthalten, in der man
leider nur die Daten einiger der ursprünglichen Quellen, nicht aber das der
Entstehung dieser Abschrift findet. Laut Wikipedia amtierte Georg Mayer
jedenfalls als Bergmeister in Preßnitz und in Kupferberg bereits im
16. Jahrhundert, ohne daß man dort darüber genauere Angaben findet. Auch
das Staatsarchiv datiert diese Textsammlung auf das 17. Jahrhundert,
obwohl die Inhalte der von dem Bergmeister angefertigten oder gesammelten Abschriften
bis auf die Zeit zwischen 1539 und 1580
zurückgehen (40001, Nr. 3267).
Bei den Recherchen zu unserem Beitrag über
den Bergbau bei
Diese Bergordnung nun ist gegenüber ihren oben zitierten, vermutlich rund ein Jahrhundert älteren Vorgängern jedenfalls schon auf 19 Paragraphen angewachsen, was auch einen vermehrten Regelungsbedarf in dieser Zeit illustriert. Der einleitende Passus „Ist gleicher gestalt ufn Kaff undt andern Eisen Bergkwergken in der Kron Behmens bis auf dato also gehalten worden.“ ist in dieser Abschrift nachträglich wieder gestrichen worden – selbstverständlich hatte die k. u. k. Monarchie für das Königreich Böhmen eigene Bergordnungen erlassen. Wahrscheinlich stand aber ungefähr dasselbe drin. Gleich im ersten Artikel (und noch einmal im fünften und dreizehnten) dieser Bergordnung (40001, Nr. 3267, Film 0103ff) wurde die früher schon genannte, winzige Flächengröße von vier Lehn für die Eisensteingruben auch jetzt wieder vorgeschrieben: Von Verleihung der Lehn. „Ein itzlicher Bergkman so Er Eisenstein erschürfft, es sein flötz oder Stöcke, undt bey Unserm B. M. Muthung begert, soll Ihm von 4 lehn 1 (fl. gr. ?) gegeben undt der B. M. soll Jedes lehn Sieben Lachter Ins gefier Vorleihen, da aber Kluft und Gänge erschürfft, soll es nach Unser Silber Bergkwergsordnung in Vorleihung gehalten werden.“ Der Eisenstein kam auch bei Preßnitz und Kupferberg / Měděnec weniger auf Gängen, als in flächenhaft ausgedehnten Lagern vor, deshalb kamen hier gevierte Lehn zur Anwendung. Der Silberbergbau unterlag dagegen nach wie vor der sächsischen Bergordnung, die auf die ursprünglich Annaberg'er zurückgeht. Der dritte Artikel belehrt uns, daß jede Grube in 128 Kuxe unter nicht mehr als acht Gewerken aufzuteilen war. Einige der früheren Erleichterungen für die Eigenlehnergruben wurden dagegen beschränkt, indem es zum Beispiel im sechsten Artikel hinsichtlich des Freifallens einer Grube nun wieder heißt: „alß dann die Geschwornen drey anfahrende Frühschichten ungearbeidt befunden, sollen sie die (Grube für) frey erkennen.“ Die Frühschicht war die Hauptschicht. Wurde keine Frühschicht verfahren, konnte keine Mittel- oder Nachtschicht verfahren werden. Und im achten Artikel heißt es: „welche lehn aber in dreyen Quartalen nicht verrecest werden, sollen ohn alle mittell in Unser freies gefallen sein, ihr alter undt gerechtigkeit verlohren haben.“ Im elften
Artikel lesen wir dann, weil „die gewergken geringe lohn geben, davon
der arme Arbeiter sich mit Weib und Kindt zuerhalten nit möglich undt alßo
nothabens zum Bösen, wie das geschick veruhrsacht wirdt, derwegen ordnen
Wier, das hinforder B. M. undt Geschworne den Arbeitern nach Achtung
ihrer Mühe lohn setzen undt ordnen sollen undt nit die Gewergken.“
Gerade über diese Bestimmung gab es noch lange Zeit später immer wieder
Die Artikel 14. bis 18. dieser Bergordnung behandeln allesamt das Vermessen und Verzehnten des ausgebrachten Eisensteins. Diese Regelungen wurden wohl nötig, weil „es kommt Uns auch führ, wie das etzliche Hammermeister sich unterstehen, den Eisenstein ungetheilt oder vermeßen außm Steinbette hinweg zufuhren, welches nicht allein gemeinem Bergkwergk zunachtheil zu machen, auch zu Abbruch unseren Zehenden gereiche...“ Na, das geht natürlich gar nicht. Vergessen wir aber auch nicht, daß wir mit dieser Bergordnung in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts – also noch mitten im Dreißigjährigen Krieg, vielleicht noch früher, sind... Jedenfalls wurde hier auch festgelegt, daß keinem „gewergken beßerer Eisenstein denn dem andern zugetheilt oder gemeßen“ werden dürfe und nur der Bergmeister selbst oder der Geschworene das Vermessen beaufsichtigen dürfe (14. Artikel). Hier steht auch zu lesen, daß 5 Tonnen auf ein Fuder zu rechnen seien. Auch durften die Arbeiter „den guten Eisenstein vom geringen nicht abscheiden,“ damit jeder Gewerke auch gleich gutes Erz bekomme (15. Artikel). Hinsichtlich der Taxierung und Wertschätzung des Erzes bestimmte der 17. Artikel: Vom Stein Probiren undt Versuchen. „Den Hammermeistern soll man nit gestatten, den Eisenstein ihres gefallens zu schätzen oder zu würdigen undt solle der B. M. hierauf fleißig aufsehen undt achtung geben, das der Stein bey unverdächtigen Hammermeistern probirt undt versucht werde, wehr wol guth, das man einen vereideten Hammerschmidt zu solchem verordnete, (...) damit wir undt die gewergken durch der Hammermeister Eigennützigkeit nicht vorvortheilt werden.“ Der 16. Artikel schließlich legte fest, weil „Uns vielmahls Vorkommen, alß sollen die gewergken den geringsten Uns am Zehenden stürtzen (...), soll man Uns keinen Eisenstein hinforder zum Zehenden zutheilen oder vermeßen, sondern die Gewergken sollen durch zusichnehmen undt Inbeschluß der Rechnung, so viel uns zum Zehenden gebuhrdt, das Bahre geldt darvon erlegen...“ Den Zehnten vom Erz generell ,in natura‘ zu erhalten, lohnte sich natürlich für den Kurfürsten auch nur dann, wenn in der Nähe eigene Eisenhütten auf fiskalische Rechnung betrieben wurden. Interessant ist auch die allerletzte Regelung ganz am Ende des 19. Artikels, wo es heißt: „undt welcher Arbter in der Bergwergksarbeit Schaden nimbt, dem soll 3 Wochen das lohn sambt dem Arzt geldt volgen.“ Und zwar auf Kosten der Gewerken. Analoge Regelungen sind auch in der Joachimsthaler Bergordnung (für den Bergbau auf alle Metalle einschließlich Gold und Silber) von 1541 enthalten. Da die Arbeiter auf den Eisensteinzechen (zumindest auf den größeren, die im direkten Besitz von Hammerherren gewesen sind) häufig eben keine selbstständigen und knappschaftlich organisierten Bergleute, sondern einfache „Bergarbeiter“ und Tagelöhner gewesen sind, war eine solche Bestimmung für sie natürlich nur allzu nötig.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Bemerkung zum
Eisensteinbergbau fanden wir auch in einem Grubenaufstand des damaligen
Bergmeisters Georg Dietrich aus Scheibenberg, welchen er am 17.
Februar 1660 ‒ also nur zwölf Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges
‒ für das Oberbergamt in Freiberg aufsetzte. Darin schrieb er in den
letzten zwei Punkten seines Berichtes nieder (40001, Nr. 160,
Rückseite Blatt 14):
13.) „sind in selbiger (im Schwarzenberg'er) wie auch Scheibenberg Refier izt Gott lob, die Eisenstein die Menge und ist dergleichen umb ein billiches gewiß zu bekommen, auch verwichenes iahr 3.900 fuder gefördert worden, wie aus selbigem extract, mitt mehrern zu ersehen.“ Selbiger Extrakt ist leider nicht in dieser Akte mit abgeheftet... Die hier genannte Zahl vom mehreren Tausend Fudern Eisenerz ist aber schon wieder beachtlich, auch wenn sie sich zugleich auf das Scheibenberg'er und das Schwarzenberg'er Bergrevier bezog. 14.) „So sind umb und neben Schwarzenbergk, allerhand feine anweisungen und bergk arten, so in die Teufe wollen, welche sich auch am Tag mitt Silber erweisen, könnde aber denenselben anders nicht alß durch höltz treiben abgebrochen werden, die armen leuthe aber hierbey in Gebürge solche mitt großen Kosten zu bauen, es nicht vermögen, gestalt denn, das langkwürig vergangener Kriegswesen noch nicht überkommen werden kann, und ist die iezige Zubuß mitt schwerer mühe von denen leuthen zu erheben, weil sonst der Herr Gott und Ambts gefelle zu geben, viel gelt sich nicht und vor der häuslichen nahrung, an izo nichts zu nehmen, auch andre gewerbe und händel sehr schlecht zu nuzen sei, (...)“ Ich glaube, diese Sätze zu den Kriegsfolgen bedürfen keines Kommentars.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man machte sich wohl auch in Dresden
Sorgen um den Fortbestand eines ertragreichen Bergbaus, denn mit Datum vom
11. Juli 1667 erging ein kurfürstlicher Befehl an das obergebirgische
Zehntenamt, in Vorbereitung einer
„hohen churfürstlichen
Anwesenheit in Freyberg“
Bericht zu erstatten über „die
Zehnten, Hütten- und andern Bergk Rechnungen, (...und) das
Aufnehmen derer Bergkwerge, und wie dieses höchst schätzbare Kleinodt zu
des Landes Besten im Guten zu erhalten,“
auch „was
bey denen Bergkwergen in derer Bergk Ambts Revier, wegen derer Gruben
Gebäude, Stollen und Schmelzwesen zu erinnern, oder vor Mängel anzugeben
und wie solche zu Aufnahme des Bergkbaues am füglichsten zu remediren“
seien (40017, Nr. 21, Blatt 1ff).
Das obergebirgische Zehntenamt hatte damals seinen Sitz in Annaberg und war zuständig für die Bergamtsreviere Annaberg, Marienberg, Scheibenberg mit Schwarzenberg, Eibenstock, Ehrenfriedersdorf und Geyer. „Weile der Sachen etwas viel sind,“ und sich der Verfasser eigentlich auch außerstande sah, „die Mängel alle zu erzählen,“ faßte der dazumal als solcher amtierende Oberzehntner Christoph Hölzel seinen Bericht vom 26. Juli 1667 zu einem „summarischen General Extract“ zusammen. In der Einleitung dazu heißt es, „wenn der liebe Gott und das liebe Bergkwerg gnädiglich zu segnen und viel Einkunft zu bescheren geruhen möchte...“ Der erste und vielleicht am einfachsten umzusetzende Vorschlag des Oberzehntners war, in den Zehntenabrechnungen die Güldengroschen abzuschaffen und „die Rechnungen richtig uf Gulden oder Thaler“ einzurichten, weil die Umrechnung selbst den Bergräten nur „confusion“ und Mühe mache. Auch werde der Steuersatz ‒ eigentlich ja zehn Prozent ‒ bei den in Ausbeute stehenden Bergwerken willkürlich und unterschiedlich auf Beträge zwischen 14 Thaler und 25 Thaler festgesetzt. Hierzu eine Anmerkung, die uns im Zusammenhang mit den Sicherproben im Zinnbergbau begegnet ist: 1667 wurde im Kloster Zinna südlich von Berlin zwischen Kurbrandenburg und Kursachsen ein Vertrag zur Vereinheitlichung des Münzwesen beider Länder geschlossen. Der 9 Taler- Münzfuß der Reichsmünzordnung von 1559/1569 wurde beibehalten und nur die sogenannten Scheidemünzen in den Stückelungen 1, 3 und 10 Pfennig, sowie ⅙ Kuranttaler, ⅓ Kuranttaler und ⅔ Kuranttaler im nach dem Tagungsort benannten Zinna'ischen Münzfuß geprägt. Die Zeit dieser Prägungen reichte von 1667 bis 1763. Dabei wurde 1690 der Münzfuß nochmals geringfügig abgewertet, ohne daß dies einen Einfluß auf die Größe der Kleinmünzen, außer der üblichen Toleranz durch das Prägeverfahren, hatte (Schier).1765 wurde die Prägung von Silbermünzen in Form von Silberpfennigen (1 Pfennig- Stücke) beendet und ab 1772 durch Kupferpfennige mit etwa 20 mm Durchmesser ersetzt (Becker). Demzufolge waren nur noch 3, 6 und 10 Pfennigmünzen in Umlauf und für die Sicherproben in diesem Zeitraum greifbar. Daß die Umrechnung der Münzen auch den Bergräten Mühe bereitete, dürfte mit daran gelegen haben, daß der Gülden- oder Floren-Groschen sieben kleine Pfennige wert war (Information von U. Jaschik). Eine Primzahl... Im Hinblick auf die Schmelzhütten berichtete Herr Hölzel, sie seien zumindest „mit notthürftigen Kohlen,“ wie auch mit „einem hiesiger Ertze kundigem Schmelzer“ versehen. Sie könnten eigentlich sogar mehr Erz verarbeiten, wenn denn in „selbiger Gegend verhoffentlich balde etwas von neuen Bergkwergen rege werden wird.“ Betreffend die Grubengebäude schrieb Herr Hölzel, daß sie „bey denen entstandenen erbärmlichen Feuersbrünsten, großen Wasserfluthen, darzukommenden Sterben und Kriegsläuften aufläßig“ geworden sind, die Gewältigung aber „der notthurfft nach aus großer Armuth meistentheils (von) Gewerken“ erfolge und „wo manche Zeche wohl erforderte, daß 8, 9, 10 Arbeiter drauf währen, so ist sie kaum mit einem oder zweyen beleget, und ist noch große Noth, die Zubuße einzubringen, daß also ietzo in Jahr und Tag nicht zu erfahren und auszurichten ist, was die Vorfahren haben wohl bey der starcken Belegung und habenden Geld Überfluß in 6 Wochen oder in einem Viertel Jahr erfahren können.“ Besonders ausführlich beschwerte er sich darüber, daß manche Gewerken über mehrere Quartale keine Zubuße entrichten würden oder, wenn die Grube nichts einbringe, die Kuxe wieder ganz fallen lassen, so daß auch die Bezahlung der Bergarbeiter nicht gesichert sei. Der Oberzehntner schlug deshalb vor, dagegen stärker durchzugreifen und die Kuxe bei Nichtbezahlung der Zubußen schon nach einem Quartal ins Retardat zu nehmen. Darüber hinaus beschwerte sich Herr Hölzel über einige Grund- und Mühlenbesitzer, die kein Wegerecht zu den Gruben und Hütten erlaubten, ja sogar einmal die Ladung von Zwitterfuhrleuten als Pfand genommen hätten. Dadurch würden „nicht alleine bauende Gewerken, so sich bereits eingelaßen, sondern auch die Bergleuthe, (die sich) ufs Schürfen zu wenden gedencken und sich einlaßen wollen, abgeschrecket.“ Der Oberzehntner schlug hierzu eine neue Verordnung vor, „weile die hochlöbliche Bergkordnung hiervon kein gewiß Ziel oder Maaß giebt, und zwar vielleicht dahero, nachdeme bey solcher Zeit Wege herzugeben und zu leiden, niemahls in einzige consideration gezogen, noch streitbar worden, sondern iedermann bey Florirung des lieben Bergkbaues alle mögliche Hüllfe und Beförderung gethan hat...“ Freilich müsse auch den Bergämtern genaue Aufsicht darüber anzubefehlen sein, damit niemandem mutwillig oder unnötig Schaden zugefügt werde. Nicht zuletzt bemerkte Herr Hölzel, daß „die Dieberey und Beraubung der Zechen an Gezähe und dergleichen überhand“ nehme. Dazu empfahl der Oberzehntner eine Verordnung an die Verwaltungsämter zu treffen, daß „sonderlich auf (...) Dörffern sitzenden Schmieden, an die es doch unzweifentlich zum Verkauff kömmet, bey Leib und Leben Straf verbothen werden sollte, solches zu Bergkwergen gehöriges Gezähe zu kauffen, sondern (...) daß er denselben (den Verkäufer) alsobalde anhalte und fest machen laße, damit an einem einmal ein Exempel, anderen zur Abkehr, statuiret werden könne.“ Aber auch durch die Schichtmeister werde in den Quartalsabrechnungen der einzelnen Gruben getrickst, indem sie etwa für den Zentner Zinn nur 20 oder 21 Thaler Einnahme verrechneten, die Menge jedoch für 24 Thaler verkaufen würden, was nicht nur zuungunsten der Steuereinnahmen sei, sondern auch den Rezeß unnötig herauftreibe. Eine letzte Bemerkung galt dem Kuxhandel: „Es ist mancher ehrlicher Bergkwerks Liebhaber und Freund (...) durch böse Kuxkränzler und Aufschneider übel angeführet, hoffig betrogen und umbs Geld gebracht und dadurch vom lieben Bergkbau gänzlich abgeschrecket worden.“ Dem entgegenzutreten, fand Herr Hölzel es förderlich, die Kränzler öffentlich zu bestellten und mit Patent auszustatten; ihnen auch aufzuerlegen, für diejenigen Gruben, deren Kuxe sie veräußerten, den Käufern einen ordnungsgemäßen Grubenaufstand vorlegen zu müssen. Diesem Extrakt des Oberzehntners sind dann Anlagen beigefügt, die einzelnen, dem Oberzehntenamt unterstellten Bergreviere betreffend. Die Aktenblätter (40017, Nr. 21) sind nicht durchnummeriert, aber auf Bild Nummer 0015 des Digitalisats, links oben, findet man eine kurze Anlage zum Scheiben- und Schwarzenberg'er Revier. Den eigentlichen Bericht des Scheibenberg'er Bergmeisters Georg Dietrich vom 23. Juli 1667 findet man auf den zwei Seiten ab Filmbild 0028, in welchem er „unterthänigst berichtet:“ „1.) Was die Bergk- und Stöllngebäude anlanget, so beruft man sich auf die vor 8 Tagen eingelieferten Aufstände und beklagen die Gewerken allerseits höchlich, daß über vielfältig beschehenes Anregen bey denen Herren Forstbediensteten, die Gehölze durch die Hammerwerke in der Nähe allenthalben weggetrieben, und mit schweren Kosten izo von ferne angeschafft werden müßen.“ Der Bergmeister geht dann auf einige Gruben näher ein und nannte dabei:
welche ausweislich der Register alle „in großem Receß beruhen,“ da sie alle „Holz benöthiget sein.“ Die Gewerken hofften aber darauf, daß die Berghölzer wieder freigegeben werden mögen. In seinem Zuständigkeitsbereich gab es damals nur eine Zinn- Schmelzhütte zu Schwarzenberg. Für diese beklagte Bergmeister Dietrich dasselbe, wie oben schon angeführt: Es mangelte auch hier an Brenn- und Kohlholz. Die naheliegenden Forste seien binnen kurzer Frist fast gänzlich niedergeschlagen worden, weswegen nun „von weither mit merklichem Nachtheil und großen Kosten“ Kohlen zur Hütte geschafft werden müßten. Nicht nur, daß die Folgen des Dreißigjährigen Krieges noch längst nicht überwunden waren; nun kam, noch verstärkt durch die ,Kleine Eiszeit' vom Ende des 16. Jahrhunderts bis Anfang des 18. Jahrhunderts, auch noch ein wachsender Holz- und Brennstoffmangel hinzu. Auch im Kernzeitraum dieser Klimaperiode gab es aber erhebliche Schwankungen. In der Nordhemisphäre waren namentlich die Zeiträume von etwa 1570 bis 1630 und von 1675 bis 1715 besonders kalt (wikipedia.de). Erst rund 100 Jahre später prägte Heinrich Cotta in der von ihm begründeten Forstfachschule zu Tharandt dann den Begriff der ,Nachhaltigkeit' ‒ damals auf eine effizientere Bewirtschaftung der Forsten bezogen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es brauchte noch weitere Jahrzehnte, die Auswirkungen dieses Krieges zu überwinden. Auch im Jahr 1695 noch klagten alle Bergmeister der obergebirgischen Reviere gemeinsam in folgenden, langen Schreiben an das Oberbergamt (40001, Nr. 2796, Blatt 4ff). Pflichtschuldigste
Erinnerung „Es ist nicht unbekanndt, daß der gantze Obergebürgische district bey vorigen Seculis in lauter wilden Wäldereyn bestanden und das Gebürge nechst Gott sich anfangs von dem lieben Bergbau erhoben und lebendig gemacht, gestalt denn insonderheit aus denen überreichen Silber Gebäuden zu Schneeberg, St. Annen, St. Marien und Scheibenberg, auch anderer Orthe, das ganze hochlöbl. Sachsen Landte mit fast unbeschreiblich großen Schätzen beglückseeligt worden, alß nun dazumahl das Gerücht davon in aller Welt erschallen, haben sich aus nah und fernen Landen Bergleuthe in großer Menge herzugemacht und, weil sie das Gebürge mit denen nothwendigsten äußerlichen requisitis, so da sind Holz und Wasser natürlich ausstaffieret befunden, ihr Heil auch auff bestimmbten Berg Städten mit einschlagen und schürffen mächtig versuchet und hin und wieder insonderheit viel Eisenstein, Zwitter, Kobalt, Wismuth, Kupfer Kieß und andere Berg Gebäude nebst denen Zinn Seiffen rege und fündig gemacht, also, daß man hernach Pochwercke, Schmeltzhütten und Hammerwercke darzu erhoben und den ie mehr und mehr sich ausgebreiteten Bergbau durch die Gnade Gottes biß hierher continuiret, da (ohne das Goldt, welches iedoch dann und wann in Seiffen an gediegenen Flitzschern und Körnern geführet wird, und alß das schwerste Metall nothwendig von nahen Gängen herkommen muß) man alle Metalle und Mineralien, an Silber, Kupfer, Zinn, Bley, Eisen, Wismuth, Kobalt, Arsenic, Schwefel, Vitriol, Alaun, Rauschgelb, Spießglas, als kaum sonst ie in einem Lande hier im Erzgebürge beysammen findet und zuguthe macht, Insonderheit aber ist bekanndt, daß wegen derer meist brechender Eisensteine nach und nach viel Hammerwercke (davon bis dato im Amte Schwarzenbergk und Crottendorf und der benachbarten Voigtsberger Refier 15 Blech und 9 Stabhämmer noch gangbar sindt) in anbau und bey vormahligen vollen hölzern in starckem umtrieb kommen, welche dem Gebürge gute Nahrung gebracht und die Bergleuthe animiret, mehr deren Eisenstein Zechen (wovon die gewonnenen Steine stracks ins geld zu setzen) als denen kostbaren Ertz und Silber Gebäuden nachzugehen, und ob nun solchergestalt das Gebürge in Städten und Dörffern ie mehr und mehr an Mannschafft auch Handel und Nahrung zugenommen, hat man hingegen auch dieselben nebst denen Hammerwercken mit Steuer, contribution und vielen anderen oneribus beleget, auch davon die Bergkleuthe nicht excemt gelassen, also, daß der Erzgebürgische Creiß mit denen Obrigkeiten Intraden die anderen Creiße merklich überwogen, Nach dem aber durch diese vielen Hammerwercke und starck ausgebauten Gemeinden (da immer eine Stadt und ein Dorff manchmahl zu viertel, halbe und gantze Meile lang, an einander liegt) wie auch durch das aus (?) großen Holz Revieren zu Feldern, Wiesen und Räumen und anderer itzund wahr nehmende Schädlichkeiten mehr, die Holz Refiere allzusehr angegriffen, abgetrieben und der Holz wiedermahls gehindert werden, So gibt nunmehro die Erfahrenheit, daß alle Hammerwercke länger in ihrer Gangbarkeit unmöglich bestehen können, die noch etwa bleibenden aber sich mit denen Hölzern auff das genaueste anziehen müssen, weßhalber Churfürstl. Durchl. zu Sachsen, Unser Gnädigster Herr, unlängst eine allgemeine Commission angeordnet, Und wie nun consequenter auch die meisten Eisenstein Gebäude (da die Steine nicht zu consumiren) aufläßig und sehr viel Bergleuthe davon abgeleget worden, wie insonderheit nur neulich das Haupt Gebäude am Rothenberge zu Crandorff umb dieser Ursache willen gutentheils eingezogen worden, das doch über hundert Jahr in stetem umbgange gewesen, also wird die feyernden Bergarbeiter die noth selber lehren, in mangelung andren Gewerbes entweder aus dem Lande zu ziehen, oder aber sich wieder nach denen Silber Gebäuden umbzuthun, und davon ihr Brodt und Unterhalt zu suchen, Allermaßen denn auch das Gebürge Gottlob! hin und wieder darauf herrliche anweisung zeiget, und insonderheit zu Johann Georgen Stadt, Raschau und Bermßgrün binnen etlicher Jahren unterschiedliche dergleichen neue Gebäude von großer Hoffnung aufkommen, ohne was der liebe Gott auffn Marienbergischen so genanndten Kayser Heinrich, St. Barbara und andern vormahls fortuito durch wegbrennung des Göpels stehen gebliebene Haupt Gebäude daselbst, wenn man einst mit dem kostbaren Weiß Taubner tieffen Stolln dahinein durchschlägig werden wirdt, denen nicht gar alten sonderbahren Nachrichten und Auffständen nach, wieder zu erobern aufgehoben haben möchte, Soll aber dieses in decadanz gediehene höchste und aller vortrefflichste Landes Regale (dergleichen in manchen König Reiche und Provincien nicht zu befinden) zuvor kommenden ruin des Erz Gebürges und zu des gantzen Landes Wohlfarth und Bestem, rediviu und wieder empor gebracht werden, wie man auch in allen Kirchen auf öffentlicher Cantzell darum in specie Gott anruft, So wird unsere Pflichtmäßigen Erachtens vornehmlich zu trachten seyn, wie man die Bergleuthe im Lande erhalten und denenselben nötige subsidia zu ihrer sustentation vermittele, und zwar. I. Ist an und vor sich selbst wohl nicht mehr als billig, weil die armen Bergkleuthe auffn am tage keinen Gewerb haben, sondern ihr Brodt mit Lebens gefährlicher Arbeit unter der Erde suchen und verdienen müssen, daß sie auch als privilegierte bergfreye Leuthe über der Erde mit denen allgemeinen Landes Oneribus und praestandis personaliter befreyet werden, darum denn dieselben in andern Ländern davon gänzlich eximiniret sindt, auff daß sie dem Leibe zu desto besserer (Arbeith?) und aus dauerung ihrer unterirdischen schweren profession keinen abbruch thun dürffen und selber etwas zum Bergbau mit anzuwenden haben mögen, woher man auch eben vor alters denen Bergstädten die so genanndte Bergfreyheit als ein sonderbahres Privilegium mitgetheilet, Diese aber ist in hiesigen Erzgebürge tractu temporis dermassen eingezogen worden, daß der arme Bergmann von seinem bloßen Wohnhäuslein nicht nur:
tragen, sondern auch alle frohn und inspecie den gantzen Winter durch die schweren
in starcker anzahl, so gut als die gemeinen Bauers leuthe mit verrichten oder solche praestanda mit Gelde bezahlen, auch nach der (?) Geleits Rolle nothdürftige Lebensmittel fast von einem Dorffe ins andere denen Accis und Geleits Pächtern vergeben müssen, Ja auch die Bergkleuthe, so blosse Hausgenossen sind, wollen alle diese Auflagen nicht erlassen werden, und kömmet nun vollends der Böhmische (?) Getreyde Zoll darzu, und da nun ein solcher armer Bergarbeiter die Woche über etwa 18 Groschen bis 1 Thaler aufs höchste, das er manchmahl von denen hier und da viel Meil Weges herumb wohnen, den Gewercken erst einlauffen, auch wohl lange Zeit entrathen muß, zu lohne, und davon einzig und alleine sein Weib und gemeiniglich viele Kinder zu kleiden und zu beköstigen hat, So ist leichte Rechnung zu machen, daß er zumahl itzo das liebe Brodt nicht Salz (?) erzeugen können, geschweige, daß er auch die allgemeinen Beschwerungen, so jährlich von solch einem bloßen Hüttgen oder Mundhäußlein auff 4 bis 5 Thaler heran kommen, zu erbringen, und noch darzu berührte Jagd- und andere Frohndienste zu verrichten oder mit Gelde zu bezahlen vermögend seyn sollte, Dahero denn bey bißheriger und noch anhaltender Theuerung die armen Bergkleuthe an Leib und Leben sich dermaßen ausgehungert und abgemergelt, auch von denen continuirlichen militarischen Executions pressuren mit genommen worden, daß ihrer viel wie Schemen einherschwämmeln und ihr Brod vorn Thüren suchen, in wohl gar aus Hunger und Gebruch erbärmlich dahin sterben, Werden demnach unseres Orths nach dem triebe unserer Pflicht und Schuldigkeit höchst gemüssiget, von das arme Bergk Volck diesfalls zu intercediren, mit gehorsamst und schuldiger Bitte, Es wolle Eu. Hochlöbl. Herrschafft bey itzigem allgemeinen Convent hochreifflichst erwägen, daß da die Berg- und Hammerwergs Nahrung samt denen davon dependirenden Commercien als des Erzgebürges meiste substanz, so gar sehr gefallen, auch nunmehr ja so höchst nötig, als billig sey, daß die schweren Contributions Contingente mit der Nahrung, darauff sie geleget, zugleich mit gemindert werden mögen, und dahero eine solche vermittelung zu treffen, gnädig und hochgeneigt geruhen, Daß die unansässigen Bergkleuthe, welche sonst keinen andern Gewerb treiben, der Contribution wie anderen Orths befreyet, Die aber eigne Häuser besitzen, damit leidlich beleget und von andern aufflagen und diensten nach der Natur der Bergfreyheit fürdhin eximiret bleiben, in sonderbahrer Erwägung, daß das Gebürge ohne dies mit denen Quatembersteuern allzu hoch angegriffen zu seyn scheinet, und denen Bergk Städtlein unterm Ambte Schwartzenberg daran folgendes, als
auf ieden Quatember zugetheilet ist, die doch ietziger Zeit nicht die Hälfte (?) zu ertragen vermögend, und wenn keine merkliche moderation darinnen geschehen sollte, endlich die alltäglichen vielfachen Executions gebühren die Quatember Abgaben gar absorbiren dürfften, Darumb denn auch die sämtlichen Berg Städtlein dermaßen enerviret sind, daß sie auff ihrer Gemein Stölln, das wenigste mehr zu wenden, und den Bergbau mehrentheils gar eingestellet haben. Wenn nun hierinne denen armen Gebürgern und Berkleuthen rettung geschieht, so können sie auch hernach den Bergbau besser und ordentlicher nachsetzen, solchen aber und zwar wiederumb auf Silber Ertze dem Lande vorträglich an und fort zustellen, ist das bey der so langen theuerung und (?) Böhmischen Getreyde Paß vollends verarmte Gebürge allein natura viel zu ohnmächtig, Derwegen denn Eu. Hochlöbl. Herrschafft umb des ganzen Landes wohlfahrt willen sich bewegen lassen wollen, hierzu aus allgemeiner Landes Casse einen erklecklichen beytrag von itziger bewilligung an, etwa jährlich an Einem halben pfennige vom Schocke gütigst zu disponiren, Zwar ist nicht zu verneinen, daß das ordinar Landes bedürffen ohne dem ungemein groß und man daher sich mit der unmöglichkeit hierunter zu entschuldigen finden möchte, Alleine umb des Werckes großer wichtigkeit und dessen unvermeidlicher Nothdurfft willen, sollte man ia es lieber in sonst wo, als hieran gebrechen lassen, Denn wir haben das feste Vertrauen zu dem grundgütigen Gott im Himmel, er werde noch des Gebürges sonderbahren apparenz hierzu seine gedeyliche Crafft verleihen, daß dadurch große Schätze in dem tieffsten der Erden von neuem rege gemacht und das, was als das gantze Land zu diesem guten absehen gleichsam Vorschußweise steuert, demselben künfftig mit reichem Überschuß accessiren werde, denn unsere Bergmännische intention gehet dahin, nicht mehr, wie lange Jahre her geschehen, Zeit, Kost und Mühe in wieder gewältigung derer verfallenen uralten Stölln und Schächte (worinnen doch die lieben Vorfahren allem vermuthen nach leichtlich keine ergiebigen Erzte stehen gelassen) zu wenden, sondern Parthien Schürffer in unerschrotenes Feldt zu legen, und nechst göttlicher Hülffe vom tage nieder und mit Stölln neue Züge rege und fündig zu machen, gestalt diesseits von Johann Georgenstadt am Rabenberg und dann auff der anderen Seite hinter Breitenbrunn und über dem Ortbach gegen das Träncktrögell, item am Pöhler imtersberge, auff Raschauer und Scheibenberger Refier und anderer Orthe mehr, auff viel Meil weges man über die öfftern starcken Erdwitterungen auch solche Nachrichten bereits entblößte silberhaltige Gänge hat, daß nechst göttlicher Gnade man vortreffliche Gebäude anzulegen und das liebe Gebürge durch die Welt wiederum angenehm und baulustig zu machen abzielet, wenn nur es bis dato nicht am besten fehlete und das Land zu eroberung dieses seines aller edelsten Kleinods selber dem bedürffen darzu freywillig succamirte! Und daß man keinen Zweiffel in des Gebürges innerlichen reichthumb setzen möge, So hat man ia die (?) vor Augen, da seither Anno 1668 binnen 26 Jahren die neuen Silbergebäude zu Johann Georgenstadt 99 Centner 92 Pfund Silber, das einzige Cathariner Gebäude zur Raschau aber binnen 2 Jahren über 18 Centner Silber durch Gottes Seegen geschüttet, anderwärts sind durch privat Gewercken und Bergkleuthe biß anhero auch hin und wieder edele Gänge entblösset, Die aber, weil sie mehrentheils die teuffe haben wollen, und aus unvermögenheit derer Gewercken und Bergkleuthe nicht continuiret werden können, in ihrer Hoffnung ersticken müssen, und wer wollte glauben, daß zu Schneeberg, St. Anna und Marienberg, wo in vorigen seculis die überreichen Schätze erbrochen undt es noch viel unerschrotenes Feldt gibt, für die posterität davon nichts überblieben seyn solle, aber da siehet man umb selbige Refiere weit und breit keinen neuen Stolln treiben, noch aus Furcht der kostbaren Teuffe mit einschlagen und Schürffen neuen Silber Gängen nach gehen, sondern der Bergmann liegt gemeiniglich aus Scheu und Mangel derer Kosten auff alten Stölln und Schächten und suchet, was die Alten entweder weggehauen oder nicht haben wollen, worüber die Gewercken gemeiniglich verdrossen werden, alß daß man selber eine Gewerckschafft findet, dabey nicht Kuxe in retardat stehen und die Zubuße davon denen armen Bergkleuthen zurück bleibet, Wie denn auch sonst nechst Gott natürlicher und menschlicher Weise kein anderer Schluß zu machen, als daß im Erzgebürge der Bergbau wieder floriren und ein frischen müße, denn da kann das Volck (wie in Niederlande) vom Feldtbau oder der Haußhaltung sich nicht ernähren, sondern es hat es seither dieser Anbau die Hammerwercks Nahrung und davon lebendig gemachten Gebürgischen Commercia thun müssen, Nun aber ist, wie obangeführet, dieselbe meist darnieder und aller anderer Gewerb ist auch damit überlauffen, und gleichwohl wird so lange die welt gestanden, leicht kein (?) erhöret worden seyn, daß der liebe Gott Gnade geben, so viel Städte, Flecken und Dörffer anzubauen, mit nüzlichen Volck zu besetzen und nachmahls dieselben bey gesund und friedlichen Zeiten (da andere Gegenden noch ihr leidliches auskommen haben) aus Mangel des Gewerbes und der Nahrung verderben oder wieder öde und wüste werden zu lassen, Ergo so muß nothwendig Göttliche Allmacht in entstehung derer äusserlicher andre unterirdische Mittel vornehmlich aber wohl diese, wovon das Gebürge sich anfangs stabilisirt und erhoben, noch im verborgenen haben, und es nur daran, daß man demselben standhafftig nachbauet am allermeisten liegen, welches, weil es ein allgemeines utile nichts ungleiches, daß auch das gemeine Wesen vorher das in utile derer speben darzu mit contribuire und tragen helfft, weil wir gedacht, dem verarmten Gebürge es alleine zu thun, die wahre unmöglichkeit ist. Die gnädigste theure Landes Herrschafft wird auch respectu Dero Zehenden Intraden nach wahrnehmung der Nothdurfft und des guten Endzwecks das Ihrige Landes Väterlich dabey zu adhibiren, sich gnädigst bewegen lassen, auch durch Dero hohe Berg Raths und Ober Berg Amts Collegio eine solche heilsame Verfassung derer Berg Cassen und des gantzen Bergwesens (wie bisher in vielen Dingen bereits rühmlich geschehen) zu thun geruhen, daß alles, was den edlen Bergbau fördert, veranstaltet und hingegen was demselben nachtheil und Bedrang giebt, exemplarisch abgestellet, die Höltzer vor allem andern zum Bergkwercke und Schmeltzhütten geleget und durch treuen Vorstand gute auffsicht und fleißige Arbeit göttlicher Seegen umb so viel mehr erreichet und erhalten, auch die ausländer in Gewerckschafft zu treten animiret und gereizet werden mögen, allermaßen denn auff solche Weise und wenn man mit Stölln treiben oder auf einschlagen und schürffen da und dort edle Gänge rege machen und gute bergmännische anweisung geben könnte, sich aus nah und fernen Ländern vermögende Gewercken wie vor alters mit Macht herzufinden, das ihrige künfftig lieber in die Silber als vorhin meist in Zwitter und Eisenstein Gebürge anwenden, und dem Gebürge unter die Arme gegriffen würde, Was aber mit denen soeben aus dem Landes Fisco erobert würde, das würde einst wie billig dahin ein zu restituiren und dem Landes Einkommen wiederumb würcklich zu inseriren seyn, und gesetzt, daß auch alsofort dieser intendirte finis nicht zu erreichen wäre (wie denn alles auf Gottes Seegen beruhet und das Bergwerck, wie man schreibt seine sonderliche Zeit haben will, welche wie doch allen Bergkläufftigen Umständen nach, mit Gott gar baldt wieder zu erziehlen hoffen) So bliebe iedennoch inmittelst das darzu angewandte Geldt im Lande, es würden dadurch viel Tausend arme Unterthanen gefördert, ia das gantze Gebürge von dem sonst unnach bleibenden leider sehr bedenklichen ruin gerettet und diese special Bewilligung an Steuer, Contribution und anderen herrschafftlichen praestanta taciti reichlich wieder erschüttet, zu geschweigen derer so viel tausend Vater Unser, die nur einen tag vor der armuth zu Gott im Himmel vor die Landes Wohlfarth gethan würden, da außer dem ihrer viel aus Noth über die grentze (?), Gott und ihren Glauben verläugnen und zu der hiesigen Landes schlechten Ruhm und geding ihren zertlichen und ewigen verderb beschützen müssen! Und wie mit denenselben auch die erfahrenen Bergkleuthe in mangelnder Förderung mit fortgingen, als würden sie so bald nicht wieder zu erlangen und es denn vollends umb das bisher fast verlassen gebliebene und doch aller herrlichste Kleinod, den lieben Bergbau (ohne welchen man in keinen Pflug in die erde bringen, noch folglich einen Bissen Brodt im Mund zu stecken erbauen kann) auff einmahl geschehen seyn, welches Gott in Gnaden väterlich verhüten wolle. II. Sollte auch denen meist gefallenen innländischen Zwitter und Kieß Zechen nechst Gott bald wieder auffzuhelffen seyn, wenn auff die in großer Menge eingehenden Englischen und andere ausländischen Zinne und Mineralia auff denen Grentzen ein starcker Zoll geschlagen, oder deren Kauff und Brauch denen Hammermeistern, Kanngießern, Färbern und andern bey gewisser poen untersagt würde, und ob man wohl in Bedenken ziehen möchte, ob dürffte man unsere auf die See gehende Wahrung, als
und was daß mehr mit dergleichen impost erhöhung ansehen undt der Kauff der Commercien gehindert werden, So ist es doch wohl darumb nicht zu besorgen, weil die Außländer solche unsere Wahre nicht, wie wir die ihrigen entrathen können, sondern dieselben nothwendig haben, und als ehe auch den freyen Paß gestatten, oder aber die impost mit steigerung des Preißes selber tragen müssen, Denn eben umb dieser auswärtigen Zinne willen (deren in einer Masse viel hundert bis tausend Centner nach Leipzig kommen sollen) sind die innländischen binnen sechs Jahren umb den vierdten Pfennig im Preiße gefallen und scheinen auch eher noch mehr herunter als wieder hinan zu kommen, dahero die gemeinen Zinn Gebäude und Seiffen, wie auch die Kieß Zechen, wegen derer gleichfalls häuffig eingehenden Salzburger Goßlarer und Englischen Vitriol und Schwefel meist auflässig und dem Lande jährlich über Tonnen Goldes an seinem Einkommen und Nahrung dadurch entzogen werden. III. So möchte auch Göttliche Barmherzigkeit umb so viel eher und mehr zu wieder auffthuung der edlen Schätze der Erden sich bewegen lassen, wenn dem Mißbrauch des Silbers in dem leidigen allgemeinen Kleider Pracht mit nachdruck gesteuert auff die verportirten und fransirten Kleider derer jenigen, denen sie nicht zukommen, ein starcker tribut geleget und solcher gleichfalls zum lieben Bergbau angewendet werden. IV. Und endlich intercediren bey Eu. Hochlöbl. Herrschafft wir noch insonderheit vor die armen Bergkirche zu St. Annaberg, daß doch die Steuer Schock, welche auff des Berg Predigers Wohnung dabey hafften, nebenst denen davon angewachsenen Landt und Pfennig Steuern (woran vorm Jahr die Hälfte gnädigst erlassen) nunmehro gänzlich ab- und in caduc geschrieben werden möchte, weil dieses die einzige Bergkirche in gantzen Lande ist, welche die antiquität Gott zu ehren und (?) vor seinen vormahligen reichen (?) Seegen erbauet, man auch zu dem Ende noch alle Wochen zwey mahl Berg Predigt darinne halten lässet, und die Schocke aus versehen derer Vorsteher (wie vor der hochlöbl. Ober Steuer Einnahme bereits deduciret) bey vertauschung der Baustadt indebite darauff behalten, auch die Steuern vor dessen von dem zur Bergkirche geschlagenen Eisen Saz Nuzung abgetragen worden, die aber mittler Zeit notorie gantz weg gefallen, daß nunmehro man die Steuern aus dem Klingelbeutell bezahlen und die arme Bergkirche (die man ohne dies vor ihren sehr geschwächten Einkünfften in Dach und Fach nicht mehr wohl erhalten, noch den Berg Prediger seine besoldung auffbringen kann) mit der vom Steuer Einnehmer gedachten militarischen Execution immediale belegen müßte, welches weder zu verantworten noch an der grentze bey denen wiedrigen Religions Verwandten ohne übelln nachklang bleiben würde, Gott der allerhöchste dirigire Eu. hochlöbl. Landschafft wichtigen deliberationes undt Consilia hierüber und sonsten allenthalben, daß Sie zu seinem heiligen Ehren der hohen Landesherrschafft gnädigsten gefallen und die Erzgebürges ia des gantzen Landes großen auffnehmen und besten gereichen, und Deroselben verbleiben wir zu aller treuen Observanz iederzeit schuldigst und verbunden. Datum Schwartzenberg, den 14. February, anno 1695. Dieser Brief ist unterzeichnet von: Balthasar Lehmann,
Z. (Zehntner ?) Das muß man schon als eine ,konzertierte Aktion' bezeichnen, wenn sämtliche Bergmeister der obergebirgischen Reviere gemeinsam einen solchen Hilferuf aufsetzen... Wie schon knapp 30 Jahre zuvor wird auch hier Brennstoffmangel als Grund für das Eingehen der Hammerwerke und in dessen Folge für den Niedergang des Eisensteinbergbaus angeführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Bergamt Scheibenberg stellte
in dieser Zeit (wahrscheinlich um 1692) auch eine Liste
über alte Verleihungen zusammen, deren Originale wohl verloren
gegangen sind (40014, Nr. 15). In dieser Liste, die bis in das
Jahr 1653 zurückreicht ‒ also in ebendiese Zeit, die auch Bergmeister
Dietrich oben charakterisierte ‒ sind in knapper Form Grubenfeldbestätigungen
aufgeführt, fast immer jedoch ohne einen vergebenen Grubennamen und nur
mit wenigen Ortsangaben. Daher können wir die folgenden Auszüge nur
genauso knapp wiedergeben und ordnen sie nur grob nach Zeit und
Ortsangaben. Wir konzentrieren uns dabei ausschließlich auf den Emmler und
lassen Verleihungen weiterer Gruben (etwa in Obermittweida, in Pöhla oder bei Elterlein) bewußt weg, um den Rahmen dieses Beitrages nicht völlig
zu sprengen.
Die Anzahl der Mutungen bereits ab der
Mitte des 17.
Jahrhunderts und das Hin und Her der Muter bei der immer neuen
Wiederaufnahme von Gruben in dieser Zeit ist aber auch so schon
überraschend groß, namentlich deswegen, weil die
zitierten Texte doch eigentlich das völlige Darniederliegen des
Bergbaus bis Ende des 17. Jahrhunderts beklagten. Dabei ist noch
anzumerken, daß sich der unten noch zitierte Bericht Gebler's aus dem Jahre
Vielleicht ist ja ein Grund, warum die Wiederaufnahme des Eisenerzbergbaus demjenigen auf Silber und Kupfer bedeutend vorauslief, darin zu sehen, daß die Gewältigung der alten Silbergruben so kostenaufwendig und eher wenig erfolgversprechend gewesen ist. Das dazu nötige Kapital mußte man nun erst einmal verfügbar haben und das war in der Mitte des 17. Jahrhunderts kaum der Fall. Dagegen aber benötigte jeder Handwerker bei der Wiedererrichtung der zerstörten Wirtschaft natürlich Gezähe und den wichtigsten Rohstoff dafür lieferten die Hammerwerke. Außerdem konnte der tagesnahe Eisensteinbergbau ‒ ganz im Gegensatz zum Silberbergbau ‒ hier noch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein überwiegend durch Eigenlehner und mit höchst einfachen technischen Mitteln betrieben werden. Dabei fallen in dieser Auflistung auch einige Familiennamen immer wieder. Manche Bergmannsfamilien müssen über etliche Generationen schon in der Region ansässig und tätig gewesen sein und manche Namen darunter gibt es noch heute im Ort, auch wenn keiner davon heute noch Bergmann ist. Bevor wir gleich aus dieser Liste zitieren, noch folgende Anmerkungen dazu: Das Kürzel ,eigd.´, welches vom Verfasser dieser Liste vielfach genutzt wurde, meint wahrscheinlich das lateinische eo diem = am gleichen Tage. Die Angabe von ,Posten' ist uns anderswo noch nicht begegnet, könnte aber vielleicht auf eine Aufteilung der vergebenen Lehne unter dem Lehnträger und dessen Mitgesellen verweisen. Wenn die Blätter in den Akten nicht nummeriert sind, geben wir die Filmbildnummer des Digitalisats an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Tännichthammer und bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1654:
1655:
1656:
1657:
1658:
1659:
1660:
1661:
1662:
1663:
1665:
1666:
1667:
1671:
1672:
1674:
1678:
In den nachfolgenden Jahren scheinen die Bergbaulustigen hauptsächlich weiter unterhalb im Tal beim Förstelgut geschürft zu haben, denn es besteht eine mehrjährige zeitliche Lücke bis zur nächsten Eintragung: 1686:
1687:
1689:
1692:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Akte aus diesem Bestand
enthält noch weitere Anträge auf Verleihung aus dem folgenden Zeitraum.
Sie sind etwas ausführlicher, als obenstehende Listenauszüge, aber ohne
Lokalkenntnis über die Lage der Bauerngüter in jener Zeit für uns auch
nicht leichter zu verorten. Wir zitieren einen dieser Anträge und führen
sie ansonsten ebenfalls nur kurz auf.
„Auf Ihrer Churfrstl. Durchl. zu Sachsen meines gnädigsten Herrn freyen undt zwar in der Zeitel Wiesen allwo (?) Nicol Teubners zu Schwarzbach altes feld gelegen will ich Endesermeldter zwey lehn auf eine post auf Eisenstein und alle metalle gemuthet, auch diese Muthung darüber eingeleget, auch solche bergambtswegen anzunehmen dienstlich gebeten haben, signat. Älterlein, den 26. Oct. 1692“ Christian Köhler, Lehnträger daselbst Auf dem Blatt (40014, Nr. 18, Film 0007) findet sich auch gleich noch der Bearbeitungsvermerk: „bezahlt 2 Gr. Muthgeldt und den 9. Dec. 1692 umb 11 Uhr hat bestätiget.“ So also lief das damals... Ein Jahr später kostete es übrigens schon 3 Gr. 6 Pf. und noch 2 Gr. Verschreibegeld (für die Eintragung im Lehnbuch). Es geht natürlich noch weiter: 1693:
Welche Gruben wir aus späterer Zeit
noch gefunden haben, erfährt man in unserer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Förstelgut und in Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1654:
1655:
1656:
1657:
1659:
1660:
1661:
1662:
1666:
1668:
1669:
1670:
1672:
1674:
1676:
1677:
1678:
1680:
1683:
1684:
1685:
1686:
1688:
1689:
1690:
1691:
Diese
letztgenannte Verleihung paßt eigentlich zeitlich und der genannten
Personen halber gut zu den ,Sieben Lehnen am Langenberg', welche
wir auch in den
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die oben schon erwähnte, zeitlich
anschließende Akte aus diesem Bestand enthält noch folgende Anträge auf
Verleihung von Abbaufeldern.
1692:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch die Heyde, der Rote Hahn und der Graul im Nordwesten Richtung Waschleithe, sowie der nordöstliche Teil des Pöhlwassertales gehören bis heute noch zur Raschau'er Flur. Durch die Grenzverschiebung zum Schneeberg'er Bergrevier vom Mönchsteig nach Osten bis zur Alten Grünhainer Straße fielen damals aber namentlich der Graul und der Knochen aus dem Scheibenberg'er Revier heraus. Auch auf Raschau'er Flur gab es noch eine ganze Reihe weiterer Gruben, die wir an dieser Stelle aber weitgehend ausklammern wollen, um den Rahmen dieses Beitrages nicht zu sprengen... 1658:
1660:
1666:
1667:
Entweder hat sich der Abbau in den verliehenen Feldern hier so sehr gelohnt, daß es längere Zeit keiner Neuverleihungen bedurfte oder aber, er hat sich überhaupt nicht gelohnt und die Bergbaukundigen haben es danach lieber wieder auf der Schwarzbach'er Seite des Bergrückens versucht. Eine ähnliche, aber weit kürzere Lücke gab es bei Schwarzbach, wo zwischen 1678 und 1686 keine Felder verliehen worden sind. Nur in Langenberg und am Förstel geht die Reihe der ständig neuen Verleihungen fast ununterbrochen fort. Mit der Ortsangabe ,zu Raschau' haben wir die nächste Eintragung jedenfalls erst im Jahre 1690 in dieser Akte gefunden (ohne natürlich sicher zu wissen, daß diese Auflistung auch vollständig ist). 1690:
1692:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl es offenkundig eine Fülle von
Verleihungen am Emmler zwischen Langenberg und Schwarzbach gegeben hat,
haben wir in einer Auflistung alter Grubenaufstände kaum
„Wobey zu vermerken, als unterschiedliche Eisenstein lehne von denen bergleutten in lehn gehalten und Viertel (quartalsweise?) verrecesieret, auch sonsten einige lehne auch von hammermeistern gehalten, aber nicht belegt, noch Register darüber eingelegt worden, auch keine Aufstände hierüber gefertigt werden können.“ Am gleichen Ort, ein Quartal später, vermerkte der Verfasser dasselbe noch ein zweites Mal (40014, Nr. 12, Film 0011, letzte Eintragung links unten): „Wobey zu vermerken, als unterschiedene Eisenstein lehne sowohl von hammermeister, als bergleutten, in lehn und fristen gehalten, aber unbelegt, noch register dazu eingeben worden, daher auch solche zum Aufstand nicht können gebracht werden.“ Möglicherweise ist ein Teil der Verleihungen also nur erfolgt, um sich die Bergbaurechte selbst zu sichern und nicht den Konkurrenten zu überlassen ‒ ein Umstand, dem eigentlich die Feldbegrenzung auf vier Lehn in den Bergordnungen entgegenwirken sollte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Wiederaufnahme oder zumindest eine
Belebung des Bergbaus war aus verständlichen Gründen natürlich auch schon
vor und während des Siebenjährigen Krieges für das Fürstenhaus stets von
großer Bedeutung für die Rohstoffversorgung und die Steuereinnahmen. So
wurden etwa im Jahr 1733 von höchster Stelle Mittel für
Die Bedeutung der Berufsstände der Berg- und Hüttenarbeiter für die Wirtschaft des Landes geht auch aus einem Schreiben der königlichen Kammer vom 25. August 1753 an das Oberbergamt, welches wir in Abschrift in den Akten des Bergamtes zu Scheibenberg gefunden haben, hervor (40014, Nr. 109, Blatt 6). Darin wurde nämlich festgelegt, „daß diejenigen Berg-, Hütten-, Hammer- und Pochwerks Leute, welche wenigstens zwey Jahre in dergleichen Berg Hütten und Hammerarbeit gestanden, und deßen von Euch und denen Berg Ämtern Zeugniß bey bringen mögen, von aller Werbung und dergleichen Kriegs Diensten befreyt seyn sollen.“ Das war ein wichtiges Privileg für die Bergarbeiter, denn bekanntlich begann 1756 der Siebenjährige Krieg... Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges kam es zu einem neuen wirtschaftlichen Aufschwung, der auch eine Wiederaufnahme des Erzbergbaus, hier in der Region namentlich des Eisensteinabbaus, mit sich brachte. 1782 wies die Königliche Kammer in Dresden das Oberbergamt an, weitere Anstrengungen zur Intensivierung der Eisenerzförderung zu unternehmen (40014, Nr. 169). In den einzelnen Bergämtern wurden daraufhin Untersuchungen vorgenommen, bei welchen althergebrachten Gruben sich eine Wiederaufnahme bzw. in welchen Regionen sich Erkundungsmaßnahmen lohnen könnten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach 1763 wurden dann vorwiegend durch Privatpersonen ‒ auch hier am Emmler ‒ immer wieder alte Gruben neu aufgenommen. So etwa mutete am 22. Februar 1783 ein Christian Friedrich Zahn (oder Jahn ?) im Bergamt zu Scheibenberg zwei Lehn „auf Herr Treutlers Grund und Boden am Förstel gelegen“ auf Braunstein und andere Mineralien (40014, Nr. 153, Blatt 16). Eine ganze Reihe von Mutungen betraf dabei alte, im Bergfreien liegende Halden, etwa durch Ehregott Gottlob Tröger vom 20. April 1796 „zur Ausschlagung noch darin befindlichen Eisensteins“ (40014, Nr. 191, Blatt 11), oder durch Christian Friedrich Korb vom 27. Juni 1796, welcher in Raschauer Kirchwaldung „zwei alte im Freyen liegende Halden zu Ausschlagung des darinnen noch befindlichen Eisenstein zu Beförderung meines gnädigsten Herrn Fürsten Zehenden und Lade Gelder“ mutete (40014, Nr. 191, Blatt 11). Na ja, wenn's zugunsten der Kasse des Landesherrn erfolgen sollte, konnte das Bergamt nichts dagegen haben. Tatsächlich finden sich auch in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22 und 26) Eintragungen mit der Benennung: ,von alten Halden´ bei Schwarzbach und Langenberg, welche offenbar noch mehrfach durchgekuttet worden sind.
In den Akten finden sich noch mehr davon: So reichte
der Herr Erhard Gottlieb Tröger aus Langenberg am 13. September
1796 über den Berggeschworenen Antrag an das Bergamt zu Scheibenberg ein,
es möge ihm doch noch eine alte Halde verleihen. Herr Körbach
notierte dazu: „Solche, im Freyen gelegene alte Halde befindet sich von
Langberg aus an dem in Abend aufsteigenden Gebirge auf churfürstl. Grund
und Boden Königswald benannt.“ Eine weitere Mutung
auf alte Halden etwa ging im selben Jahr durch Chr. F. Weißflog bei
Ende des Jahres 1796 notierte sich der Berggeschworene Körbach dazu, er sei in der „8ten Woche Quartal Luciae a. c. auf Christian Fundgrube zu Langberg gefahren und (habe) zwey Tage Halden Eisenstein im Täennigwald vermeßen...“ Auch am 29. April 1797 notierte er sich, er habe erneut „15 Fuder Eisenstein, so von Trögers alten Halden im Königswald über Langberg, vermeßen laßen...“ (40014, Nr. 196, Film 0027) Weitere Nennungen, die mangels konkreter Hinweise auf die Lage nicht genauer zugeordnet werden können, datieren zum Beispiel auf die Jahre ab 1793. So mutete etwa am 28. August 1793 oben schon genannter Christian Friedrich Korb „eine Fundgrube und drei obere Maßen auf Herrn Querfurths Grund und Boden bey Langenberg.“ Wenn sie auf Herrn Querfurth's Grund zu liegen kommen sollte, so heißt das, daß diese Mutung einen Punkt unweit vom Rittergut Förstel betraf. Mehr als dies ist dem leider nicht zu entnehmen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von einigen der oben aufgeführten (Personen- und
Gruben-) Namen liest man nie wieder etwas in den Akten, so daß es sich bei
vielen wohl um erfolglos gebliebene Schürfversuche gehandelt hat. Manche
Gruben wurden auch unter anderem Namen mehrfach wieder neu aufgenommen.
Andere Gruben dagegen waren über längere Zeit kontinuierlich in Betrieb,
hatten also auch das nötige bergmännische Glück, bauwürdige Vorkommen
aufzuschließen. Auf die Geschichte einiger dieser Eisen- und
Manganerzbergwerke zwischen Langenberg und Schwarzbach wollen wir im
Weiteren noch ausführlicher eingehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der damalige Berggeschworene Johann August Karl Gebler interessierte sich (so wie wir heute) dafür, warum die Überlieferung des dazumal noch der Grafschaft Schönburg- Hartenstein unterstehenden Bergamtes zu Scheibenberg gerade aus der Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts höchst lückenhaft ist. Die Ergebnisse seiner Nachsuche in den Aktenbeständen des Bergamtes faßte er 1825 in einem Bericht zusammen, den wir in einem Band seiner Fahrbögen aus jener Zeit gefunden haben (40014, Nr. 275, Film 0098ff) und aus dem wir die Einleitung seines Textes an dieser Stelle zitieren wollen:
Kleiner Beytrag zur Geschichte des Bergbaues am Scheibenberge „Unter mehrern unglücklichen Bränden, welche die Stadt Scheibenberg seit ihrer Entstehung 1522 an betroffen haben, sind zween für den Bergbau von den allernachtheiligsten Folgen gewesen, als in solchen die Ursachen des Mangels aller bergmännischen Schriften über den ehemaligen Zustand des Scheibenberger Bergbaus enthalten sind. Der erstere derselben hat im Jahre 1677, der zweyte abends den 16ten October 1710 Statt gehabt. Bey jedem derselben ist das Rathhauß und die in demselben befindlich gewesene Berg Amtsstube mit deren Archiv ein Raub der Flamme geworden. Am allerunglücklichsten aber mag ohnstreitig der letzte Brand für dasselbe gewesen seyn, weil bey demselben 53 Häußer in der kurzen Zeit von zwey Stunden in Rauch aufgegangen sind, mithin Rettung von irgend etwas nicht füglich Statt haben können. Hier nun hat alle über den ältern Bergbau der hiesigen Revier vorhanden gewesenen Schriften, so viele deren (?) Registern, an früheren Urkunden, an Tabellen über das ehemalige Ausbringen der gangbar gewesenen Gruben, an Handels- und (?) büchern, brieflichen Urkunden und allen anderen Aktenstücken vorhanden gewesen, Vernichtung getroffen. Alles, was man nun noch über die ältere Periode des Scheibenberger Bergbaus weiß, bestehet theils in einzelnen Nachrichten, welche die damaligen nach dem letztern Brande noch lebenden Beamten, mit solchen genau bekannt und dieselben in frischem Andenken tragend, gelegentlich in der Folge der oder jener Schrift einverleibt haben; theils in solchen, die als kleine Aktenstücke oder einzelne Bogen oder Blätter der erstern, der letzteren oder selbst der zweymaligen Wuth des Feuers entgangen sind. In solchen, welche aufbewahret in dem Archiv des Königl. Oberzehenden, oder in dem Archiv der Gesamt- Regierung der Schönburgischen Lande, gegenwärtig zu Glauchau, ohne allem Zweifel vorhanden sind, würde ein dritter Theil bestehen, allein biß jetzt sind darüber noch keine Nachforschungen angestellt worden. Aus diesen würden sich besonders die Nahmen der früher in Umgange gewesenen im Ausbringen gestandenen Gruben und das von solchen an Silber und Kobold ausgebrachte deutlicher ergeben. Eines der ältesten Aktenstücke ist vom Jahr 1656 von dem damaligen Bergmeister Georg Dietrich verfaßt, enthält in einem Bogen den damaligen Zustand der Scheibenberger Revier und auf einem einzigen Blatt den des Bergbaus am Scheibenberg. Aus diesem gehet hervor, daß der hiesige Bergbau im Jahre 1517 fündig worden, in kurzer Zeit sich sehr gehoben, weiter hin aber sich vermindert habe, indem die Erze, so wie man mit den Abbauen dem Berge näher gekommen, sich verringert und die Gänge sich sehr verschmälert und zerschlagen hätten. Die Kriege und Pestzeiten der damaligen Periode sowohl in der zweyten Hälfte des 16ten als in der ersten und zweyten Hälfte des 17ten Jahrhunderts mögen gleichfalls das ihrige zum Untergange des früher eine kurze Zeit so blühenden Bergbaus am Scheibenberge beygetragen haben, wie solches im Bericht des hiesigen Bergamtes an das Königl. Pohlnische und Churfürstl. Sächsische Oberbergamt, jedoch ohne Angabe von Tag und Jahr, aber unterschrieben von dem Bergmeister Samuel Enderlein und dem Geschworenen Jacob Jentzsch, muthmaßlich aus der Zeiten 1740 nebst einigen andern den alten hiesigen Bergbau betreffenden Gegenständen ergiebt.“ Anmerkung Hrn. Geblers’s an dieser Stelle: „Der Verfasser dieses hat des Geschwornen Jentzsch Unterschrift in einem Register vom Jahr 1740 gefunden und scheint derselbe nicht sehr lange in hiesiger Revier Geschworner gewesen zu seyn.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„Aus diesem Schreiben aber, so wie aus einem anderen
ergiebt sich fernerweit, daß der hiesige Bergbau biß zum Jahr 1699 auf
lange Zeit total gelegen haben müße, da in diesem Jahre erst durch
Veranstaltung Michael Enderleins, früher Reviergeschworner und alsdann
Bergmeister allhier, derselbe durch Wiederaufnahme und Angriff der beyden
Grubengebäude Unserer Lieben Frauen Empfängniß und St. Laurentius von
neuem in Umtrieb gesetzt worden.
Aus dem obangeführten Aktenstücken vom Jahr 1656 scheint ferner der Beweiß hervorzugehen, daß der Bergbau am Scheibenberge so ziemlich in dem ganzen 17ten Jahrhunderte gelegen haben müße und zwar deswegen, Es hat 1) gedachter Bergmeister George Dietrich seiner Schrift im Jahre1656, wie deßen Unterschrift vom 22ten August genannten Jahres beweißt, demnach kurz nach Ende des 30jährigen Krieges, welcher Deutschland, insonderheit auch Sachsen vom Jahre 1618 biß 1648 so grausam verwüstet und entvölkert hat, mithin unmittelbar nach Ablauf der ersten Hälfte gedachten Jahrhunderts geschrieben, also zu einer Zeit, wo Städte und Dörfer entvölkert waren. Hätte der Scheibenberger Bergbau sich aber auch noch vor dieser Zeit in einigen Umtriebe erhalten gehabt, er würde schon deswegen während desselben liegen geblieben seyn. Allein, der genannte Bergmeister spricht 2) von diesem Gegenstande als von einer damals schon nicht mehr genau bekannten, nur als von einer längst dagewesenen Sache.“ Anmerkung Hrn. Gebler’s: „Auch der Fol. 69 seqq. Act. indusierte bergamtl. Aufstand vom 14. Febr. 1610 spricht hiervon nicht als von einem neuerlichen Ereigniß der damaligen, sondern von einem der vergangenen Zeit und nicht in Ausdrücken, welche das Selbstgesehen, Selbsterlebt haben, Selbstwissen bezeichnen. Das würde er aber thun, wenn dieses Liegenbleiben des Scheibenberger Bergbaus in die Jahre von 1610 an rückwärts biß 1580 gehörig wäre. Die Überreste des ganzen ehemaligen Bergbaus haben sich nun, wie aus dem gleichnachfolgenden bergamtlichen Aufstande über die Scheibenberger Revier vom Jahre 1656, so wie aus dem Fol. 62b angezeigten Supplick (?) der Gewerkschaft in der Nassen Roth erscheint, auf Unbedeutendes beschränkt. Hätte sich nun der Bergbau hiesigen Ortes vom Jahre 1600 an auch nur eine Zeitlang in Umtriebe befunden, er würde als ein offenbarer Augenzeuge der damaligen Begebenheiten von ihnen als einem von ihm selbst erlebten, wohlbekannten, und allen damals noch lebenden in frischen Andenken ruhenden Gegenstande geredet haben. Dieß thut er aber nicht. Er spricht hiervon als einem Vorkommniß aus den ältern Zeiten, für dessen genaue Aufhellung die hinlänglichen Mittel zu fehlen scheinen und drückt sich über das alles überhaupt folgendermaßen aus.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr Gebler
fügte an dieser Stelle nun folgenden Abschnitt aus besagtem Bericht ein:
„Aufstand und Bericht des Bergamtes Scheibenbergk,
Wobey zu bemerken, daß in dieses Bergamt noch andere Drey Städtlein gehören, als Älterlein, Oberwiesenthal und Hohenstein, welches letztere unter der Schönburgischen Herrschaft gelegen ist, und vermöge des von ao. 1559 ufgerichten Bergkwerk Vertrages Ihrer Churfürstl. Durchl. zu Sachsen die Hälfte an Silber und auch Zehenden habe. Erstlich so ist ao. 1517 daß Bergkwerk zu Scheibenbergk ufkommen, ehe noch daß Städtlein erbauet gewest, welches Fundtgrube zu Unserer Lieben Frauen Empfaengnis sambt deßen obern 1. 2. 3. 4. biß 10. Maßen, und sind uf der Fdgr. zween reichhaltige Silbergänge beyeinander gewesen, da der eine uff Salomon genannt, ist auch ein tiefer Stolln in diese Gebäude in die 500 Lachter hinan getrieben, da dann hernacher von ao. 1522 biß Luciae 1539 in 17½ Jahren besage der Receße und Bergk Registern 78 Ctr. 19 Pfd. 23½ Loth Silber gemacht, wovon dieß Städtlein erbauet und inzwischen mit Bergkfreyheit und Bestallungen eines Bergkamtes ist begnadet worden. Hernachen aber, als diese Gänge gegen den Hügel und hohen Bergk hinan kommen, sind sie ganz verunedelt, und durch wackrichte, quarzige Gestein verdrücket worden; und nachdem ietzo für vier Jahren von hiesiger Gemeinde der andermaßen Tageschacht, welcher ganz verbrochen war, wieder gewältigt wurde, hat sich befunden, daß derselbe in etzlich 60 Lachter flach biß uffn Stolln gesunken, allwo in 24 Lachter der Hauptgang, welcher sein Streichen uf 9 Uhr gegen Mittag hat, fortgetrieben, uf welchen unzählig viel Strecken, Weiten, Schächte, Querschläge und Übersichbrechen angetroffen, und als man den Steiger in etzliche Tieffste hinein gelassen, hat er befunden, daß immer eine Strecke uff die andere, ingleichen von ein Schacht zum andern, die alten durchschlägig gewesen, und die Erze weggehauen, daß sonderlich keine silberhaltigen Anbrüche mehr zu spüren gewesen, außer etzlichen Ctr. Kobalt, so in einem Tiefsten gefördert worden, ist also dieß Gebäude wieder liegen blieben, und obwohl etzliche alte Bürger berichtet, daß gegen der 6ten Maß annoch Anbrüche stehen sollen, welche in die 6 biß 8 Loth Silber hielten, hat man doch in der Grube von der andern mehr nicht hinauf kommen können, und weil es ein trefflichen Bruch von Tag nieder uf der sechsten Maß gemacht, welcher sehr viel zu gewältigen kosten würde, und aber über der andern Maßer Schacht man ein ziemliches verbaut, ist die Gemeinde hiervon abgeschrecket worden, sonsten sind zwar etzliche andere Stölln allhier gebaut und getrieben, befinde aber niemahle, daß uf einigen Silber gemacht, vielweniger Anbrüche geben worden.“ Anmerkung Hrn. Gebler’s dazu: „Hierauf folgen interessante Nachrichten über den Bergbau in Elterlein, Oberwiesenthal und Hohenstein.“ „Welches aber uf begehren schuldigermaßen ins Churfürstl. Sächs. Zehenden Ambte nach St. Annaberg eingehändiget werden soll, Actum Scheibenbergk, den 22. August 1556, Georg Dietrich, Bergmeister.“ „Dieß die Beschreibung von dem Bergmeister Georg Dietrich, so weit solche Scheibenberg angehet. Der Bergbau am Scheibenberge kann also unmöglich sich lange in Flor befunden und der Umtrieb deßelben – erwägt man die Aussage jener alten Bürger, unter denen doch wohl im Jahre 1656 einige von 65, 70 und 75 Jahren gewesen seyn werden, wie hätten solche außerdem sich alt nennen lassen? – nicht einmal, das Ende des 16ten Jahrhunderts erreicht haben, sonst würde diesen noch etwas davon bekannt gewesen seyn. Vergleicht man damit, was man hier und da noch in alten Schriften in Betreff des Ausbringens aufgezeichnet findet, so erhält diese Annahme volle Wahrscheinlichkeit, in so ferne man wohl verschiedenen Gruben angegeben findet, welche in dem 16ten Jahrhunderte, aber keine, welche in dem 17ten Jahrhunderte in Silberausbringen gestanden. Die Anzahl der zur besten Zeit gangbar gewesenen Grubengebäude soll dem obengezogenen bergamtlichen Berichte, erstattet in Betreff der Sr. damaligen Königl. Majestät und Churfürstl. Durchlaucht angetragenen Annahme des Tiefen St. Laurentius Stollns zum besten der auf demselben bauenden Gewerkschaften; 22 betragen haben, von denen die meisten in Ausbeuthe gestanden hätten. Was das Ausbringen zu den damaligen Zeiten betrifft, so ist aus Ermanglung gnüglicher dahingehöriger Nachrichten bis jetzt nicht mehr als nachstehendes bekannt geworden. Man hat überhaupt ausgebracht bey Unserer Lieben Frauen Empfängnis vom Jahr 1522 biß Crucis 1539, also in 17½ Jahre 78 Ctr. 23½ Loth oder 17.199 Mark, 7 Loth, 2 Quent Silber. Einem bergamtlichen Aufstande vom 13ten Septembr. 1735 nach sollen vormals von Unsere Lieben Frauen Empfängnis 15 biß 20 Fl. gr. Ausbeuthe gefallen, bey diesem Gebäude aber überhaupt 100 Ctr. – Silber geschmelzet, einem anderen bergamtlichen Aufstande vom 10ten Januar 1740 zu Folge aber sollen vormals von St. Laurentius 6, 7 und 8 Fl. gr. Ausbeuthe gegeben worden seyn. Nach einem Aufstand des Bergmeisters Melchior Geßner und des Geschwornen Friedrich Holtzschuh vom 10ten Febr. 1670 hat Unser Lieben Frauen Empfängnis Fdgr. und untere nächste Maß von Trinitatis 1522 bis Trinitatis 1543, also in 21 Jahren, 12.675 Mark, 8 Loth, 12 Quent Ausbeuthe gegeben...“ Herr Gebler hat diesen Bericht am 3. Januar 1826 fertiggestellt und später noch mit einigen kleinen Nachträgen ergänzt. Der weitere Inhalt befaßt sich aber ausschließlich mit den auf Silber und alle Metalle verliehenen Gruben im näheren Umfeld der Stadt Scheibenberg und trägt damit zu unserem Thema hier nichts weiter bei.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abgesehen von den hier angeführten Stadtbränden und den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges könnte es aber noch einen weiteren Grund dafür geben, daß es namentlich zum Eisensteinbergbau der Hammergüter Tännicht und Förstel vergleichsweise wenige Unterlagen aus dessen Anfangszeit gibt. Wir werden im weiteren Text noch mehrfach lesen, daß man den Eisenstein hier oft direkt „unter dem Rasen“ gefunden habe. Selbst 1866 noch beantragte Wilkauer vereinigt Feld einen tagebauweisen Abbau, woraufhin man freilich über dessen tatsächliche Ausführung nie wieder auch nur eine einzige Bemerkung in den Akten findet. Nur die heutigen Geländekonturen verraten uns noch, daß ein solcher wirklich erfolgt sein muß. Nun ähnelt der
oft nur erdige, braune Eisenstein tatsächlich oft sehr dem ,Raseneisenstein',
welcher Dieser Umstand betraf allerdings nur diese beiden Hämmer im Schwarzbachtal, auf deren Grund auch solche Brauneisensteinlager lagen; vielleicht auch noch den Erla'er Hammer, der ja auch direkt neben der Ausbißlinie des Crandorf'er Roteisenstein- Ganges angelegt worden ist. Gleichartige, leicht zu gewinnende Erzlager gab es im Mittweidatal in Raschau dagegen nicht und so mußte etwa der Elterlein'sche Hammer in Obermittweida das benötigte Eisenerz aus anderen Gruben beziehen (oder, wie wir noch erfahren werden, eigene Bergwerke ins Leben rufen). Es waren wohl auch derartige Unterschiede zwischen den Grubenbetrieben und deren Rechtsträgern, welche in den nachfolgenden Zeiten dazu führten, daß die Hammerwerksbesitzer oft nur wenig Zahlungsmoral hinsichtlich der zu entrichtenden Steuern und Gebühren zeigten. Offenbar infolge eines Berichts des damaligen Bergkommissionsrates und Berghauptmanns Carl Christian von Tettau (*1681, †1747, von 1730 bis 1733 Oberberghauptmann in Sachsen) vom 30. Oktober des vorangegangenen Jahres über seine „Expedition“ dorthin und die dabei von ihm vorgefundene „Unordnung“ in den Berechnungen erging am 12. August 1729 eine Verfügung aus Dresden an den Kreisamtmann und den Amtsverwalter in Schwarzenberg, in der es um die Verzehntung von Eisensteinen und Flößen ging (40010, Nr. 1398, Rückseite Blatt 32f). Darin hieß es in Bezug auf die „Uns von Eisensteinen und zu deren Verschmelzung brauchende Flöße gehörigen Zehnden und Ladegelder,“ daß das Fürstenhaus diese „zu erlaßen nicht geneyget (sei). Also begehren wir hiermit, ihr insgesamt wollet den Hammerwerksbesitzern deßen bescheiden“ und die ausstehenden Zahlungen „binnen Jahr und Tag“ einfordern. Außerdem liest man in dem zugehörigen Inserat, daß der Berghauptmann vorgeschlagen hatte, daß „im unverliehenen Felde zu bauen niemandem gestattet, sondern die Felder in Lehn genommen, und darüber Register, worinnen die gewonnenen Flöße zur Einnahme gebracht, und diejenigen, an welche sie verlaßen und vermeßen wurden, namhaft gemacht, eingeleget, von denen Eisensteinmaßen, welche der Flöße wegen sowohl itzo als künftig in Pflicht zu nehmen wären, die Maßverzeichnisse, wie zu den Ämtern, also auch zu den Bergämtern quartaliter richtig übergeben, von denen Amtsschreibern aber, die Hammerbesitzer über die von Eisensteinen und Flößen entrichteten Zehenden und Ladegelder, nicht mehr summarisch, sondern mit Specification derer Posten, worinnen sie eigentlich bestehen, quittiert werden“ sollten. Dem stimmte man auch in Dresden zu und erließ dazu folgende ausführliche Verfügung, welche das Oberbergamt an die einzelnen Bergämter weiterreichte, welche wiederum sie „mittels Anschlags nicht nur iedermann kund machen, sondern auch vor Nachtheil warnen“ sollten. Darin war festgelegt, was die Bergbauwilligen einzuhalten hatten, nämlich: „1. Alle Eisensteinflöße und Zuschlage Brüche bey iedes Orths Bergamte, wie andere Zechen zu muthen und deren Verleihung von daher zu gewartten. 2. Mit deren Belegung denen Bergordnungen und Gebräuchen gemäß sich zu verhalten, anderergestalt 3. die Contravenienten die Abtreibung und nach Befinden gefänglicher Einziehung ohne Ansehen der Person ingleichen die Contrabandirung des Gewonnenen sich selbst imputiren mögen. Weile auch 4. die Haltung und Einlegung der Register allergnädigst befohlen worden, also hat ieder Lehnträger und Schichtmeister bey denen in der 2ten und 3ten Woche ieden Quartals vorgeschriebenen Aufrechnungstagen bey ieder Woche mittwochs zu observiren, es mag Anschlag gehalten werden oder nicht, die ordentlichen Quartals Register bey dem Berg Amte mit denen darzu gehörigen Belegen nach gehaltenem Anschnitt, bey willkürlicher Straffe und Verlust des Lehns einzulegen, 5. die Register förmlich einzurichten, darinnen hauptsächlich durch wen, auch zu welcher Zeit vermeßen, ingleichen wohin es geliefert, und wie hoch taxiret worden? mit Belegen vom verpflichteten Eisenmeßer zu bestücken, sondern auch ein a part Vorraths Verzeichnis der noch nicht vermeßenen oder unabgefuhrten Zuschläge dem Register beyzufügen, 6. sich in der vom Eisenstein Meßer bey der Abfuhre einen Passir Zettel, ohne welches Producirung der Fuhrmann sowohl als andere der Anhaltung, Pfändung und Confiscation des Geladenen unterworffen bleibet, ausstellen zu laßen, und 7. sowohl die Lade Gelder und Zehenden Gebührniße gehörigen Orths, bey Vermeidung der Execution und angeführter Bestraffung, zu bezahlen, allermaßen 8. keinem Grundbesitzer dergleichen Zuschläge ohne solche Bedingung zu gewinnen und die Brüche zu belegen, vielweniger das Gewonnene an die Hammerwerksbesitzer oder sonsten zu verkaufen, freystehet und 9. danebst uns die Hammerinspektoren und Eisensteinmeßer darauf Achtung geben werden, iedermann auch die Hammerbesitzer mit Abführung der Zehenden und Ladegelder Gebührniße, darnach sich zu achten. Also haben wir hierdurch mit diesem öffentlichen Anschlage solches zu iedermanns Wissenschaft bringen wollen und vor Straffe und Confiscation des Gewonnenen und Ungelegenheit warnen wollen.“ Auch wenn es in dieser Verordnung vordergründig nur um die ,Flöße' und Zuschläge und nicht unmittelbar um das Eisenerz gegangen ist, illustrieren diese Vorgänge zum einen, welche Lücken und welches Desinteresse die Verwaltung oft aufwies; zum anderen aber, welche grundherrlichen Rechte die Hammerwerksbesitzer innehatten oder sich im Zweifelsfall auch einfach herausnahmen... Wo kein Kläger, da kein Richter.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Braunstein- Bergbau im 17. und 18. Jahrhundert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während der Verkauf des Eisensteins an die
Hammerwerke schon früher geregelt war und von Eisenstein- Zehntnern überwacht
wurde, rückte erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts auch der Braunstein in den
Blickpunkt des Fiskus. In älteren Dokumenten wird der Braunstein nie erwähnt ‒
vielleicht, weil es in der Nähe keine Glashütten gegeben hat, die ihn zum
Entfärben der Schmelze hätten verwenden können oder weil er als nur geringwertiges
Nebenprodukt galt. Herzog Johann Georg, der andere, (gemeint ist
Johann Georg der II., *1613, †1680, Kurfürst ab 1656), traf dazu nun die folgende
Verordnung an den Bergmeister zu Scheibenberg (40001, Nr. 229, Blatt 117):
An Unseren Bergmeister George Dietrich zu Scheibenberg. „Lieber getreuer, Wir haben vorlesen hören, wie ezliche ieden dem er anbefohlenen Bergrefier neben den Eisenstein mit brechen solle, den die berckleuthe denen Töpffern (?) verkaufen: Uns aber den von das gebührende zehende nicht entrichten wollen undt du dannehero für einen unterthänigsten fürschlag gethan. Wann Wir Uns dann in der Sache nicht eher resolviren können, bis fürhero Uns ezliche Pfunde oder ein halber Viertel Zentner solches Braunsteins davon zur bergk Canzley eingeschicket worden, so wie durch Unsern Münz Guardein auff die Probe sezen zu laßen braucht. Als befehlen Wir hiermit gnädigst, du wollest Uns dero was rein geschiedenes mit der ehesten beyfälligen gelegenheit oder Ambts Fuhre verwahrlich zuschicken, und darauf Unsere ferner Verordnung gehorsamst erwarten. Daran geschieht Unsere gefällige Meynung, Datum Dresden, den 17. Martii anno 1660.“ Dieser Aufforderung hat Bergmeister Georg Dietrich gewiß auch Genüge getan. Die fernere Verordnung ließ allerdings etwas auf sich warten und folgte einige Jahre später mit folgendem Schreiben (40001, Nr. 229, Rückseite Blatt 117f): An Unseren Bergmeister George Dietrich zu Scheibenberg „Lieber getreuer, Wir haben vorlesen hören, was Uns du unterm 8ten jüngstverwichenen Monats Septembris des braunsteins, daß unterschiedene arthen dergleichen anbrüche, sich anizo ereignen, und darnach frage gehalten werden wollte, auch wie von einer Zeche am Langenberg unlängst ezliche vierzig Centner, doch unverwogen, und ohne dein beysein und entrichtung (?) was zu Unserem zehenden abgeführet worden, unterthänigst berichtet undt darbey vorschlägest, um wie denn dergleichen abnahme des braunsteins frey und ohne Unser interesse zu (?) nicht gemeinet seyn, Als ist hiermit Unser befehl, du wollest auff solche bergk arth und wo selbige gebrochen wird, fleißige auffsicht haben, keinen, wer der auch sey, nicht eines Pfundes schwer, er habe denn von iedem Centner gleich von Hanßen Friedrichen, Einwohner zu Schneebergk, vorhin geschehen, drey gute Groschen zu unsern Zehenden, welche Uns du gebührend zu berechnen hast, entrichtet und richtigen Schein von dir darüber erhalten, auch sonsten gute anstellung machen, damit hierin kein Unterschliff oder Parthiererey Uns zu nachtheil verübet werde, inmaßen Wir dann an Unsere Ambtmänner zum Grünhayn, Wolckenstein und Schwartzenbergk hierbey gehörige befehliche, welche du behörige arth insinuiren lassen wirst, ertheilet, denen unter ihren anvertrauten ämbtern befindliche Geleits und Accis Einnehmern auch Zollbereithern anzudeuten, daß du einer braunstein fuhre und nicht einen Zettel über entrichteten zehenden von dir vorzulegen habe, sie selbigen darweil als vorfallen gut anhalten, mit dreyßig (?) straffe belegen, solche von ihm einbringen und es zu Unserer ferneren Verordnung unterthänigst berichten sollen, daran geschieht Unsere Meinung, Datum Dresden, am 24. Octobris anno 1669.“ Der hier genannte Hans Friedrich hatte zwischen 1660 und 1669 ein Handelsprivileg für den Verkauf von Braunstein in Sachsen erhalten (10036, Loc. 36092, Rep. 09, Nr. 1191). Die Nachfrage nach diesem Material ist damals offenbar gewachsen und der Zentner wurde etwa in Leipzig und Dresden zu Preisen von 3 Thalern und mehr gehandelt. Eine Abgabe von 3 Groschen pro Zentner entsprach folglich etwas mehr als 4% des Erlöses. Diese Regelung wurde 1696 auch gegenüber dem inzwischen amtierenden Bergmeister Enderlein noch einmal bekräftigt (40001, Nr. 229, Rückseite Blatt 120). Allerdings erfahren wir aus dem im Folgenden wiedergegebenen Schriftverkehr, daß Hans Friedrich um 1680 verstorben sein muß, woraufhin sein Privileg eingezogen und vorläufig keinem anderen erteilt worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Kurfürst Friedrich August, besser bekannt als August, der Starke und erster sächsischer König von Polen, bekanntlich immer Geldsorgen hatte, machten sich auch seine Bediensteten gezwungenermaßen Anfang des 18. Jahrhunderts viele Gedanken, wie man denn zu Einnahmen kommen könne und wo solche vielleicht auch verloren gingen. In einem Schreiben des damaligen Bergschreibers und Eisensteinvermessers in Lößnitz, Christoph Kändler, vom 9. September 1710 etwa wurde das Oberbergamt darauf aufmerksam gemacht, das wieder zuviel Braunstein „weggeschafft“ werde, ohne darauf Bergzehnten zu entrichten und derselbe schlug vor, man möge ihn doch gnädigst beauftragen, wie beim Eisensteinvermessen auch, beim Braunsteinverwiegen die Kontrolle auszuüben (40001, Nr. 2969, Blatt 17). Offenbar sahen die Grubenbetreiber den Braunstein, wie das Eisenerz ja eigentlich auch, als grundeigenen Rohstoff an und umgingen daher beim Verkauf das hier zuständige Bergamt in Scheibenberg. Auf die natürlich darauf folgende Frage der königlichen Kammer hin holte sich das Oberbergamt in Freiberg Auskunft von den Bergämtern ein, woraufhin Bergmeister Michael Enderlein aus Scheibenberg pflichtschuldigst am 31. Dezember 1712 nach Freiberg berichtete (40001, Nr. 2969, Blatt 1ff). Dieser Bericht vermittelt uns (auch mangels anderer Quellen aus dieser Zeit) so viele Fakten über den damals am Emmler auf Braunstein umgehenden Bergbau, daß wir ihn hier fast ungekürzt zitieren: „(...) wie auch hoch und wohledle Vater geruhen hochgel. zu vernehmen, was maßen zu Verkauffung des in Langenberg und Förstel gewonnenen Braunsteins bey hiesigem Bergamte Scheibenberg der Observanz nach iedesmahl ein freyzeddel gelöset, von iedem Centner deßen 3 Gr. entrichtet und hernach im königl und churfürstl. Oberzehenden Amt zu Schwartzenberg berechnet wird. Indem nun pro nunc sehr wenig angegeben und wie leicht zu erachten, heimlicher Weise viel verschleifft wird, so denn freylich in (?) und Trajudicium des hohen königl. Zehenden Interesse practicirt zu werden pfleget: Und eben dieses (?) Unternehmen, das doch gleichwohl keinen, wenn er ipso facto nicht ergriffen, so schlechterdings inculpiret werden kann, möglichst zu unterbrechen das summa necessitate ist, alß finden Eur. Hochherr. Excellenz wie auch hoch und wohledle Vater dieses nebst eigentlicher hiermit habender Bewandniß ohne ferneren Anstand zu berichten, und anbey die (?) so die schuldige Verzehendung vielleicht doch (...?) wie aus gehorsamster Pflichtschuldigkeit uns veranlaßet. Es ist nemlich ehedeßen außer obgedachten Langenberg und Förstel im hiesigen Ober Gebürge kein Braunstein bekannt geworden, welches dahero nebst diesem, daß der Centner vor einen Thaler und höher anzubringen gewesen, Hanß Friedrichen bewogen, daß er ieden Centner mit 3 Gr. zu verzehenden gegen erhaltenes Monopolium sich verbindlich gemacht. Ob ihm wohl diese Freyheit mit dem Ableben nur gedachten Friedrichs nunmehro vor 30 Jahren exsiriret, so ist iedoch ohngeachtet letzterer Jahre hier in denen Berg Aemtern Schneeberg, Eybenstock und Johanngeorgenstadt auff denen Eisenstein Zechen gleichfalls Braunstein erbrochen und dadurch der Preiß dieser Minera bis auf 15 Gr. und weniger reduciret worden, die Verzehendung beym ersten Herkommen verblieben, welches denn allerdings dem Bergmann, wenn er vom Centner statt des Zehenden den Vierten Theil entrichten soll, schwer und (?) vorkommt, welches in Erwägung, daß solche Abgabe sonst bey keinem als dem Schönburgischen Bergamt gewöhnlich, die Freyheit anderer lieber ad consequentiam appliciren wollte, zumahl da der Fuhrmann, wenn er auff ereignende Recontrirung des (Ausreiter ?) nur den Accis Zeddel produciren kann, er mag aus dem Bergamte den Freyzeddel haben oder nicht, so doch der Vorfallenheit wegen außer Sorgen und (?) ist. Denn wiewohl ich, der Bergmeister, etliche (Ausreiter ?) wegen so schlechter und regligeanter Auffsicht auff die Braunsteinfuhren zur Rede gesetzet haben doch dieselben sich excusiret, daß nach dem Bergamts Zeddel zu fragen, sie gantz keine Instruction hätten. Wenn denn die heimlichen Braunsteinhändler dadurch sicher gemacht und dermaßen verstärkt sind, daß nunmehro im Bergamte fast gar nichts mehr angemeldet und vergeben wird, alß wäre diesem Incommodo am füglichsten abzuhelffen und vorzubauen, wenn sonder Maßgebung an die Ämter Schwarzenberg, Grünhayn und Wolckenstein allergnädigster Befehl erginge, denen (Ausreitern ?) scharff und nachdrücklich anzudeuten, daß sie denienigen Braunsteinfuhren, so mit dem Frey Zeddel aus dem Bergamt behörig nicht versehen, alsbald contrabandiren möchten. Damit aber auch in der Abgabe eine Gleichheit (?) getroffen, einer auff den anderen sich zu referiren nicht voran hat und auch vornehmlich hieraus dem hohen herrschafftl. Interesse kein Nachtheil erfolge, könnte die Verzehendung nach dem gewöhnlichen Preiß eingerichtet und nicht sowohl vom Centner Braunstein, als auch der gleichfalls bey Eisenstein brechenden rothen Farbe hinkünfftig 1 Gr. 6 Pf. entrichtet, dieses aber nicht allein in Scheibenberg in Obacht genommen, sondern auch die Obergebürgischen Bergaemter durchgehends, wo nur solche beyde Mineralien zu brechen pflegen, dergleichen zu observiren, allergnädigst befehligt worden. Wie aber dieses bloß unseren gantz ohnmaßgebliche Meynung ist, welche nur beyläuffig wir eröffnen und die hierunter gebrauchte (?) in ergebenster Pflichtschuldigkeit gehorsamst depreciren, also geben zu Eu. hochherrschftl. Excellenz wie auch hoch und wohledle (...?) wir lediglich anheim, erwarten deroselben hochgel. Disposition und sind daher wie sonst in unausgesetzter Verharrung.“ Bergambt allda
Michael Enderlein, Bergmeister Vonseiten des Oberbergamtes gab man am 9. Januar 1713 diesen Bericht wie folgt nach Dresden weiter (40001, Nr. 2969, Blatt 5ff): „Als vor ungefähr etlich 30 Jahren der so genannde Braunstein, ein dem Töpffer und Glasmacher nöthige Minera, nur allein im Bergamt Scheibenberg zu Langenberg und Förstel bekannd und gewonnen ward, hat sich damahls Hannß Friedrich dahin verbündlich gemacht, gegen ein erhaltenes Monopolium von iedem Ctr. deßelben so zu selbigem Preis 1 Thl. und mehr gegolten, 3 Gr. zum landesherrlichen Zehnden zu bezahlen, welches auch alßo in Obergebürgischen Zehenden Amt verrechnet worden. Nachdem aber solche concession nach Ableben mehr gedachten Friedrich erloschen und einige Jahr her auch in den Bergämtern Schneeberg, Eybenstock und Johann Georgenstadt auff denen Eisenstein Gebäuden dergleichen Braunstein gleichfalls getroffen worden, nun in der festen Hand nicht zu erhalten, so ist nicht allein diese Minera im (?) und der (?) biß auf 15 und weniger Groschen herunter gefallen, sondern es wird auch nach des Bergamts zu Scheibenberg dißfalls beschehene Anzeige sehr wenig angegeben und verzehendet, welches denn guten Theils daher rührt, daß die Abgabe des Zehenden nemlich von 3 Gr. ietzigen Werth nach allzu hoch und nicht den zehnten, sondern den 5ten Theil und noch mehr beträgt, dahero solche Abgabe erübrigt zu seyn, das (?) deßelben angegeben wird, andern Theils, daß da die Fuhrleute und Häuer vormahls nebst dem Accis zettel auch einen freyzettel, wo solches geladen und verzehndet worden, haben müßen, anietzo die (?) nur nach dem Accis Zettel fragen und wenn solcher vorhanden, selbige ungehindert passiren laßen. Und wie nun dieses Eu. königl. Maj. hohes interesse gar sehr nachtheilig, alßo halten wir allerunterthänigst (?) dafür, daß solches dadurch abzuwenden, wenn zuvörderst die Abgabe des Zehenden durch alle Bergämter nach dem Werth des Einkauffs reguliret und nicht mehr, als nur würklich der (Preis?) betrüge, gleich wie auch bey der Koboldt minera geschieht, abgesondert, hiernechst aber auch in die Ämter Schwartzenberg Grünhayn und Wolckenstein allergnädigst anbefohlen würde, die (Ausreiterer ?) dahin zu instruiren, daß sie fernerhin keinen Braunstein, ingleichen Rothe Farbe, welche bey theils Eisenstein Gebäuden mit gefertigt wird, passiren laßen sollen, es habe denn ein solcher Fuhrmann nebst dem accis Zettel auch des Bergamts freyzettel, wo solche geladen, vorzuweisen. Denn ob man gleich die Aufsicht dißfalls von denen Geschwornen iedes Orts fordern wollte, so kann doch ein Geschworner in solchen Refier der vielen (?) halber nicht stets gegenwärtig seyn und also in geheim viel verparthieret worden, welches aber auf den Zoll- und Accisstädten gar leicht angetroffen werden kann. Überlaßen also Eu. Königl. Maj. was Sie hierauff so wohl in die Berg- als Zehnt Aemter anzuordnen auch uns zu befehligen allergnädigst vor gut befinden werden, und verharren übrigens zeit unseres Lebens, Freiberg, den 9. Januar 1713“ Was die Bergbeamten hier mit den ,Ausreitern' meinen, ist uns noch nicht klar ‒ vielleicht haben wir es auch nur falsch gelesen ‒ es muß sich bei diesen aber um eine Art Kontrolleur auf den Geleits- und Zollstellen gehandelt haben. Um 1680 (also 30 Jahre vor diesen Schreiben) war Braunstein offenbar ein seltenes Gut, das in Sachsen ausschließlich hier am Emmler in bauwürdigen Mengen gefunden und auch abgebaut worden ist. Deshalb also war dem oben benannten Johann (oder Hans) Friedrich bereits vor 1669 ein Handelsprivileg verliehen, welcher den Braunstein zu relativ hohen Preisen auf- und weiterverkaufte (10036, Loc. 36092, Rep. 09, Nr. 1191). Nachdem der Braunstein aber erst einmal als gut verkäufliche Ware erkannt war, achtete man auch auf anderen Gruben auf Vorkommen und wurde auch fündig, was zu einem Preisverfall (fast auf die Hälfte des früher erzielten Preises) führte. Bis dato hatte man darauf in der Bergbehörde nicht reagiert und die Höhe des Zehnten bei einem festen Betrag belassen, womit der Anteil dieser Abgabe am Verkaufserlös natürlich deutlich anstieg und der Gewinn in gleichem Maße sank. Dies nun zu ändern, schlug Herr Enderlein also vor. Seine Königliche Majestät und Kurfürst zu Sachsen jedenfalls stimmte den hier geäußerten Vorschlägen zu und ließ dies dem Oberbergamt am 4. März 1713 mitteilen (40001, Nr. 2969, Blatt 7), was wiederum das Oberbergamt den Bergämtern in Schneeberg. Schwarzenberg, Scheibenberg, Eibenstock und Johanngeorgenstadt sowie den Oberzehntnern des obergebirgischen Kreises und in Schneeberg am 19. April 1713 bekannt machte (40001, Nr. 2969, Blatt 9f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es dauerte
dann wieder einige Jahre, ehe eine neue Reaktion der königlichen Kammer
erfolgte. Dann aber forderte man von dort namens des Königs und Kurfürsten vom
Oberbergamt wieder Auskunft (40001, Nr. 2969, Blatt 16):
„Werte Räthe, liebe getreue, occasione
beygefügten von Christoph Kandlern vormahlen übergebenen Memorials wegen Wir zu
wißen verlangen, wo und wie mächtig der angegebene Braunstein breche, ob und was
Uns davon an Gebührnissen entrichtet werde, ingleichen ob nicht und auf was Arth,
ein Commercium damit zu machen und wem die Auffsicht mit dem Negotio hier
unterworfen (?) füglichsten auffgetragen werden könnte. Anbey begehren
(Wir), ihr wollet solches wohl erwogen ein und andern vor sich darmit
thun laßen und über dem Befinden neuen Bericht mit Anfügung eures
unmaßgeblichen Gutachtens allergehorsamst erstatten und von besagtem Braunstein
10 biß 12 Pfund (?) anhero einschicken, An dem geschieht Unser Wille und Meynung,
Man wollte wohl in Dresden wissen, ob die Maßnahmen Erfolg hatten. Daraufhin wandte sich das Oberbergamt in Freiberg am 18. Januar 1717 wieder an Bergmeister Michael Enderlein in Scheibenberg, welcher am 15. Februar 1717 Bericht erstatte. Auch diesen Bericht zitieren wir (soweit es uns gelingt, die Schrift zu lesen) vollständig (40001, Nr. 2969, Blatt 21ff). Er berichtete wieder recht ausführlich, daß... „nach der Beylage sub O. allhier in Schwartzenbergischen Bergrefier kein Braunstein gefunden wird, hingegen in Thennig und Förstel unterm Berg Ambt Scheibenberg Andreas Weißflugen, Andreas Merckeln und Johann Friedrich Weißflugen allerseits in Langenberg zusammen 19 Lehn bergrichtig verliehen sind. So sich nun den Braunstein selbst anlanget, wird solcher in besagter Gegend wenig und gar selten in frischen und ganzen Felde angetroffen, sondern meistens auff alten Eisensteingebäuden, wo vormahls ohne daßelbe zu observiren der Braun- mit unter dem Eisenstein gebrochen, endlich aber, als man wahrgenommen, daß diese Minera das Eisen verderbt und in der Grube auff Kästen geschlagen worden, aus dem alten Mann mit vieler Mühe vor ietzo wieder nachgesuchet und ausgekuttet. Inmaßen wenn er je einmahl in frischem Feld berührt wird, welches doch ganz extraordinair geschiehet, derselbe insgemein (Kwartz ?) liegt, sich bald wieder abschneidet und auskeilt. Auch ist der Braunstein, außer wenn sich derselbe, jedoch gar selten, in Nieren bis ¼ Elle anleget, über 1 bis 2 Zoll nicht mächtig, bricht auch vielmahls wie drusenweise auf aussetzenden Eisenstein Trümern bloß in schwebenden Mitteln, dahero sich er weder in die Teuffe setzt, noch ins Gebürge streicht, sondern nur gegen den Tag schwebet, darauff Fundgruben und Maaßen zu determiniren oder Stöllen anzulegen, so wenig recipiret, als nöthig ist, sondern der beybehaltenen observanz nach, nur Lehn auf gewisse Posten aufgenommen und verliehen worden. Was aber jährlich an Braunstein zu fördern und lieffern lassen kann, weil solcher nur nierenweise, also sehr ungleich bricht, auch bis anhero noch niemahls beständig gebauet, sondern bloß den Winter über und zwar (üblicherweise?) nach der Schicht bey der Weilarbeit, Sommerzeit aber gar nicht oder doch wenig gearbeitet worden, auch die Bergleuthe die Braunsteinförderung allein nach der Abnahme und Nachfrage iedesmahl eingerichtet, ein gewisses Quantum so genau gar unmöglich angegeben und nahmhaft gemacht werden. Und sind die letztern zehn Jahre über, nemlich de anno 1707 bis und mit a. 1716 zusammen zweyhundert ein und zwanzig Centner Braunstein von obgedachten Langenberger Bergleuthen angegeben und verzehndet, hierbey aber, an was für Oertern solcher verfuhret, so genau nicht nachgefraget, sondern wenn mir in dem von mir, dem Bergmeister, ertheilten passir Zettel des Bergmanns, der den Braunstein verkaufft und die Zehenden Gebührnis entrichtet, Nahmen gesaget, daßelbe genug zu seyn erachtet worden. Ob es wohl an dem, daß die meisten Fuhren theils nach Böhmen und Schlesien, theils auch bey den Messen nach Leipzig, in Thüringen und ferner ins Reich gehen mögen, da der Braunstein in Glashütten sowohl, als den Töpfern und Seifensiedern, wiewohl mit ziemlicher Menage und in geringer Quantität, nach dem es iede Officin und Profession erfordert, verbrauchet wird. Bey der Abnahme, da nur kleine Posten verkauffet wurden, und (weil) der Zehenden weniger als der Weg und Mühe eingetragen, bin ich zwar allemahl nicht zugegen gewesen, sondern habe der Bergleuthe Angeben Glauben zuteilen müßen, wenn aber 8 bis 10 Ctr. Braunstein mit einander abgenommen werden sollen, habe es dahin eingerichtet, daß solche en passant mit abgeben können: Wiewohl der Braunstein nicht gewogen, sondern nach einem uffn Centner visirten Faß gemessen und abgenommen wird. Gleich wie aber auf solchen Braunstein- Lehnen ein ordentlich bergmännischer Bau sich zur Zeit nicht etablirt, solches auch an ihm selbst nicht wohl practicable ist: So stehen solche Lehen nicht Gewerken, sondern Eigenlöhnern zu, die ohne sichere Rechnung für sich bauen. Und ob wohl diese, ihrer Aussage nach, den Centner Braunstein über 10, 12 und aufs höchste 14 Gr. nicht anzubringen wißen, davon iedoch 1 Gr. 6 Pf. Zehenden und 1 Gr. Geleit (?) so bey den Verkäuffen tragen müßen, wieder abgehet, so regulirt man doch den Zehenden nach der Berg Ambts Taxe, solche seit einigen Jahren her auff 15 Gr. gesetzt, wobey es bis dato verblieben, und obgedachte letztere zehen Jahr über fünffzehn Gulden, 6 Groschen Königl. Zehenden an den Hrn. Oberzehndner Bächler (oder Biehler ?) allhier berechnet worden. So viel endlich das Principale selbst angehet, sehe ich, daß da Langenberg, wo die Eigenlöhner wohnhafft, einzeln im Walde abgelegen und sonderlich quiete nocturna so genaue Auffsicht nicht gehabt werden mag, ohngeachtet der Zehenden, so vormahls vom Centner 3 Gr. war, nunmehro de Anno 1713 auff die Hälfte reducirt, auch von der was mehr als sonst eingekommen ist, daß dennoch aller Braunstein nicht angegeben, sondern auch Zehenden untergeschlagen sind, gleichwohl annoch in Sorgen. Denn wiewohl auff meinen an Eu. Hochwohlgeb. Excellenz (...) dem 31. December 1712 erstatteten pflichtschuldigsten Bericht und darbey ohnmaßgeblich gethanen etwaigen Vorschlag, daß nemlich, damit denen (Ausreitern ?) scharff und nachdrücklich angedeutet werde, diejenigen Braunstein- Fuhren, so mit dem Frey Zettel aus dem Bergambte nicht versehen, alsobald zu contrabandiren, an die obergebirgischen Ämbter allergnädigster Befehl ergehen möchte, diesfalls ein allergnädigstes Rescriptum (...) ergangen, ich hernachmahls hiervon gegen den (Ausreiter ?) zu Crotendorff gedacht, und derselbe fleißiger Auffsicht erinnert: hat sich derselbe doch nicht entblödet, frey zu sagen: daß, als ihm das Kreißambt allhier Andeutung gethan, auff die Braunstein- Fuhren, dem allergnädigsten Befehl zu Folge, ein offenes Auge zu haben, er geantwortet: daß weil der hohe Befehl nicht directo, sondern in Copia communicata an ihn, den Herrn Kreiß Ambtmann ergangen, sie der Abschrift und Zufügung also stricte nicht nachzugehen hätten. Wobey er, der (Ausreiter ?) hinzufügte, daß, wenn nur der Braunstein richtig vernotificiret, er umb den Bergambts Frey Zettel sich alsdann unbekümmert ließe. Im Übrigen sind hierbey die verlange 15 (?) Braunstein, womit zugleich etliche Stückgen von einer terra alba aparte (?) so gleichfalls bey Eisenstein auff den Raschauer Erb Güthern Scheibenbergischer Bergrefier liegt, aber dem Factor aufn Schindlerischen Blaufarbenwerke Hr. David Müllern gebauet, in ziemlicher Quantität gewonnen und auf alle Blaufarb Mühlen abgeführet wird. Und indem ich demselben diese weiße Erde als ein Minerale gebührende mit 1 Gr. vom Ctr. zu verzehenden ex officio metallico angesagt (?) gedachter Hr. Factor Müller aber, daß die Herren Schnorren zu Schneeberg ihre in derselbigen Refier fördernde Weiße Erde ebenfalls nicht verzehenden dürfften, dargegen vorgestellet, welches dahin gestellt seyn lasse. So gebe es Eu. Hochwohlbeg. Excell. (...) Erachten lediglich anheim, was dieselbe hierauff diesfalls zu verfügen gnädig und geruhen werden, ...“ Der Bericht wurde im Prinzip in Freiberg abgeschrieben und am 4. März 1717 nach Dresden weitergeleitet, wo sich der König und Kurfürst solchen Vorschlag allergnädigst gefallen ließ (40001, Nr. 2969, Blatt 28). Was die zuletzt angeführten Funde von ,weißer Erde' anbetrifft, wird es dazu demnächst einen speziellen Beitrag auf unserer Seite geben. Für uns ist hier von Interesse, daß nach wie vor in Sachsen ausschließlich am Emmler Bergbau auf Braunstein umging. Außerdem erfahren wir hier, daß er zu dieser Zeit hauptsächlich aus den Versatzkästen alter Eisensteinzechen gewonnen wurde, wo ihn die Alten, weil er als dem Eisenerz schädliche Beimengung galt, gleich untertage wieder eingebaut hatten. Das erklärt uns nun auch, warum auch in späterer Zeit noch im Freien liegende Zechen immer wieder neu aufgenommen wurden und dem alten Mann nachgefahren wurde. Wir schauen an dieser Stelle aber mal schnell in den Artikel zum Eisen in Meyer's Konversationslexikon von 1888 und lesen dort: „Auf die Eigenschaften des dabei entstehenden Roheisens influieren hauptsächlich die Temperaturverhältnisse und die Anwesenheit fremder Stoffe, welche Faktoren nicht nur die Qualität und Quantität des vom reduzierten Eisen aufgenommenen Kohlenstoffs beeinflussen, sondern auch in das gekohlte Metall fremdartige, bald schädlich, bald günstig wirkende Bestandteile einführen. Schon nach dem äußern Ansehen lassen sich weißes und graues Roheisen unterscheiden. Das Weißeisen entsteht im allgemeinen aus leicht reduzier- und kohlbaren und leichtschmelzigen Erzen, welche im heißesten Teil des Ofens, vor den Formen, keiner viel höhern Temperatur ausgesetzt werden, als die Schmelztemperatur des erzeugten und nach der Entfernung aus dem Ofen rasch abgekühlten Kohleneisens beträgt. Dasselbe enthält seinen Kohlenstoff im chemisch gebundenen Zustand. Wurden reine Eisensteine angewandt, erhielt die Schmelzmasse durch einen Mangangehalt den hinreichenden Grad der Leichtschmelzigkeit, und war die Temperatur in den Teilen über dem Schmelzraum so hoch, daß das Eisen sich vollständig kohlen konnte, so entsteht ein stark glänzendes, weißes, sehr hartes, sprödes, kristallinisch-blätteriges, in Kristallrudimenten auftretendes Produkt mit dem höchsten Kohlenstoffgehalt bis zu 6 Proz., das Spiegeleisen, wegen seiner Reinheit und seines Mangangehalts sehr zur Stahlfabrikation geeignet.“ Weiter unten im Text heißt es: „Die weißen Roheisensorten, deren Schmelzpunkt bei 1.050-1.200° liegt, und deren spezifisches Gewicht von 7,056-7,889 schwankt, eignen sich wegen ihrer Härte und Dickflüssigkeit nicht für die Gießerei, wohl aber in ihren reinern Varietäten zur Stahl- und Stabeisenfabrikation; die unreinern Sorten liefern ordinäre Stabeisensorten, während grelles Eisen oder Weißeisen vom Rohgang kaum verwendbar ist. Ein Mangangehalt in der Beschickung befördert die Aufnahme von Kohlenstoff, somit die Bildung von Weiß- und namentlich Spiegeleisen, trägt zur Entfernung von Schwefel bei und macht die Schlacke leichtschmelzig. Bei der Stahldarstellung wirkt das Mangan insofern günstig, als dasselbe die im Eisen vorhandenen Oxyde reduziert und ferner die Schweißbarkeit und Festigkeit eines Silicium enthaltenden Stahls erhöht.“ Ende des 19. Jahrhunderts waren die Qualitäten des Mangans als Stahlveredler natürlich bekannt und geschätzt. Bis zum 17. Jahrhundert wurde nun Gußeisen noch kaum hergestellt; die aus dem Rennfeuer gewonnene Luppe wurde vielmehr in den Hammerwerken noch ausgeschmiedet. Dabei könnte es hinderlich gewesen sein, wenn ein zu hoher Mangangehalt im Erz die Schmelzmasse zu ,leichtschmelzig' und umgekehrt das Schmiedeeisen zu hart machen würde. Das änderte sich erst, als auch im Erzgebirge die ersten Hohen Öfen errichtet wurden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Außerdem wurde 1717 Johann Christoph Flemming
aus Freiberg zum Faktor eines „Schwarzenberger Fossilienwerkes“ bestellt
(10036, Loc. 36179, Rep. 09, Nr. 2932a). Dieser erhielt ein neues Privileg zum
Handel mit Tripel (Kieselgur), Braunstein, schwarzer Kreide, Umbra, Ocker und
anderen Farberden sowie den Auftrag zur Errichtung von Niederlagen für diese
Mineralien in Mittweida oder in Elterlein (40010, Nr. 3361).
Darüber informierte das Oberbergamt am 7. August 1717 sämtliche Bergämter mit folgendem Schreiben (40001, Nr. 2969, Blatt 47): „Demnach Sr. Königl. Majestät in Pohlen (...) unser aller gnädigster Herr die von Johann Christoph Flemmingen angegebenen Fossilien an Trippel, Braunstein, Schwarzer Kreyde, Umbra und Ocker in feste Hand zu nehmen und eine Niederlage deßen, resp. in Mittweyde und Elterlein formiren zu laßen gesonnen und uns derselbe besage des copylich angefügten Extracts sub. dato dem 19. Juny c. a. allergnädigsten Befehl ertheilet, also wollen oberbergamtswegen wir an die sämtlichen nach (?) Bergämbter, von allen diesen Sorten und wenn dergleichen künftig noch mehrer gefunden werden sollten, etliche Centner zum Versuch, ob davon ein Vertrieb zu machen, gekommen, auch wo dergleichen auf sonst bauenden Zechen mit einbrechen, dieselben fleißig aushalten zu laßen, und alle quartale, wie viel das gesambte Quantum betrage, so wohl in die Zehend Ämbter, dahin die Gebäude gehörig, als an Flemmigen, damit (der) die Abhole und Gutmachung veranstalten könne, zu melden, hierdurch verordnet, zugleich aber auch denenselben mit angefüget haben, daß (...) Sr. Königl. Maj. allergnädigst gemeinet, deren Gewinn und Förder Kosten halber, gleich wie in puncto denen Edelgesteinen bereits unterm 10. Dec. abgewichnen Jahres anbefohlen (...) billigen Abtrag thun zu laßen...“ Es sollte aber nicht nur eine Aufkaufsanstalt für eventuell gewinnträchtige Nebenprodukte eingerichtet werden, es folgte sogleich auch ein „Verboth des unbefugten Verkauffs derer in Ober und Ertzgebürge befindlichen und auf denen Zechen und sonst mitunter brechenden Fossilien und Farben“ nach, worüber das Oberbergamt die Bergämter am 9. Februar 1718 in Kenntnis setzte (40001, Nr. 2969, Blatt 86). Herr Johann Christoph Flemming hatte mit seinem Privileg ‒ wie oben genannter Hans Friedrich dreißig Jahre zuvor ‒ quasi wieder ein Monopol für den Handel mit dergleichen Rohstoffen inne. Auch Braunstein durfte nun ohne Ladezettel und Verzehntung, entweder durch das zuständige Bergamt oder durch den ,Fossilien Factor' Flemming, nicht mehr frei verkauft werden. Offenbar ist aber noch nicht wirklich viel passiert und am 22. Januar 1718 hat Johann Mattey Laurentiy vom Schneeberg'er Zehntenamt nach Freiberg berichtet, daß Flemming „wenig oder nichts im Zehntenamt eingegeben (habe), weil er sich noch nicht hat einrichten können, weil er immerzu nothwendiger Angelegenheiten wegen, sich in Dresden oder Freyberg aufhalten müßen.“ (40001, Nr. 2969, Blatt 88) Herr Flemming selbst bat am 16. August dieses Jahres um Aufschub für die (üblicherweise jedes Quartal fällige) Abrechnung (40001, Nr. 2969, Blatt 103ff). Daraufhin genehmigte man in Dresden am 8. September 1718, daß
Schon am 20. Oktober 1718 forderte man aus Dresden dann das Oberbergamt dazu auf, daß es doch „ohne Zeitverlust expediren“ möchte, was diesfalls denn geschehen sei und Flemming zu Rechnungslegung auffordern solle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Zeitverlust mehrere Rückfragen bei den
Bergämtern, eigener Anträge Flemming's und so weiter wurde dann aber doch
ziemlich lang... Schließlich aber beschwerte sich Flemming am 25. Juni
1720, es habe (40001, Nr. 2969, Blatt 128ff)
„kein einziges Bergamt ihm die geringste Probe der einbrechenden Fossilien und anderen Berg Arthen eingesendet, und ob sie sich entschuldigen wollen, sie verstünden dergleichen nicht, noch weniger hätten die Arbeiter hiervon Kändnis, ohngeachtet doch auff allen Werken und Gebäuden dergleichen zu finden, und sollte es auch nur ein purer Letten und Berg Arth seyn, woraus man dann und wann, nachdem die sache ist, etwas gutes machen könnte, wie denn dieses der geringste Bergman von dem wilden Gestein und Felsen gar leicht unterscheiden kann; dahero habe ich alle Sorten, so bis anhero bey dem Werke seynd fabriciret worden, durch viele Mühe und Unkosten bekanndt machen müßen. Wie ich denn verblichenes Quartal Berggrün so No. 1 beygeleget in einem Steinbruche unweith Stolberg ausfindig gemachet und ieden Centner über 30 (?) gebracht und verkauffet habe. Nur ist zu beklagen, daß von dergleichen nicht eingesendet worden, noch weniger wird andern Leuten inhibiret, welche solche zubereiten und damit handeln. Und ob ich gleich zum öfteren verlanget, man mögte mir den weißen Erde (?) welcher sowohl auf unterschiedlichen Zechen in Schneeberg und Schwarzenbergischen Bergamtsrevier in Menge gebrochen wird, gleich andern Sorten gegen Bezahlung abfolgen laßen, indem ich dieses zum Zusatz anderer Sorten bey dem Werke unumgänglich nöthig habe, so habe ich es doch nicht erhalten können, sondern sie verkaufen es unverzehndet, wohin sie wollen, dergleichen mit andern mehr geschehen ist. Es haben dieserwegen Se. Exc. der Herr Geheimrath von Alemann in seinem Leben vor zwey Jahren in Marienberg sich in Person eingefunden, und unter anderem diese Fossilien Fabrique ganz genau untersucht, ob dieses Werck einen und den anderen sonderlich denen Gewercken zuwider seyn könnte, hingegen aber gefunden, daß es vielmehr denen Bauenden Gewercken zum höchsten Nutzen gereichet, sintemahl sie ihre Bezahlung davon erlanget, und bis hierher von demselben etliche 1.000 Centner abgenommen worden sind, daß auch dieserwegen nicht die geringste Klage eingelauffen ist. Noch dieses zu gedenken, da vorhero viele von dergleichen durch der Gewercken Kosten zu Tage gefördert worden, und von theils Arbeitern rohe und auch zubereitet verkauffet worden, wie denn nur eines zum Exempel anzuführen, als auf dem graul Eu. Königl. May. Vitriol Werck ich selbst vorher unterschiedne Mahle gelben (Sünd ?) fuderweise die Arbeiter verkauffet haben, ietzo aber schon vor etlichen 30 (?) dasigen Factor abgenommen und dieser selbige hoffentlich beym Wercke in Einnahme gebracht haben wird. Hieraus nun werden Eu. Königl. Maj. allergnädigst zu ersehen geruhen, wie alle Hinterniße hervorgebracht werden, das Werck übern Hauffen zu werffen, ich aber aus meinen eigenen Vermögen und Kräfften nicht capable bin, ein solches Werck in Stand zu richten, wenn Eu. Königl. Maj. mich nicht gewaldig schützten und die Verbrecher des Verbotes, doch sonder die geringste Verschreibung mit Nachdruck bestraffen laßen...“ Auch werde noch immer der Ankauf der ehemaligen Schmelzhütte durch die besagten Erben behindert, woraufhin Flemming bat, ihm doch die Annaberg’er Schmelzhütte zu verleihen, die gerade nicht gebraucht werde. Daraufhin forderte das Oberbergamt sämtliche Bergämter erneut schriftlich (und mit Empfangsbestätigung) auf, es möge doch „den Königl. Befehlen nachgelebet“ werden (40001, Nr. 2969, Blatt 134ff). Der Postbote scheint mit diesem Rundschreiben allerdings wieder recht lange unterwegs gewesen zu sein, denn erst im April 1721 wurde der Empfang auch in Scheibenberg durch Samuel Enderlein quittiert. Zumindest ist mit dieser Datierung eine Notiz auf dem Blatt versehen (40001, Nr. 2969, Rückseite Blatt 137), letztgenannter habe angegeben, daß „so viel den Braunstein anbetrifft, derselbe in der ganzen Refier an Hrn. Factor Flemming geliefert, von andern Farben aber allhier nichts vorkomme.“ Nun ‒ wenn dies zutrifft, so kann Herr Flemming eigentlich wenig Grund zu Beschwerden gehabt haben. Zumindest den Handel mit dem Braunstein aus dem Scheibenberg'er Revier hatte er demnach um 1720 komplett in der Hand, denn wie oben zu lesen stand, wurde ja 1717 im ganzen Schwarzenberg'ischen Bergrevier ausschließlich im Tännicht und am Förstelgut Braunstein gewonnen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Folgezeit muß auch die Farbenfabrikation
tatsächlich in Gang gekommen sein, wahrscheinlich aber weder in Elterlein, noch
in Annaberg, denn in allen weiteren Schreiben ist dann von einer ,Schwarzenbergischen
Königl. Fossilien Fabrique' die Rede.
Am 21. Februar 1726 berichtete Johann Christoph Flemming selbst an das Oberbergamt in Freiberg darüber (40001, Nr. 2969, Blatt 177ff):
Hoch Wohlgeborne, Hoch und Wohl Edle Veste Hoch und Wohlgelahrte sende hierbey in zwey Kästgen von allen denen Sorten deren Fossilien Proben, so viel aniezo bey der mir allergnädigst anvertrauten Fossilien Fabrique bekand, so wohl an Rohen, als auch denen zubereiteten, nach der Numero, nebst beygefügtem Inserat, worinnen zulängliche Nachricht enthalten, worin iedes her, von was für einer Grube und Berg Amts Refier, wie eines mit dem andern versetzet, was das Quantum, so wohl der Rohen an Centnern, den bauenden Gewerken bis Schluß des verwichenen 1725ten Jahres nach derer Herrn Berg Beambten über iede Post ausgestellte Liefer Scheine und Taxe gelieffert und davor bezahlt bekommen, auch wie viel bis dahin verkaufft und ins Commertion gebracht, was davor gelößet, betragen, dieses alles aus denen von mir an Oberzehendner Biehlern, allergnädigst anbefohlener maßen übergebene Rechnungen mit mehren besagen, auch aus der letztern 1724ten Jahres zu ersehen, daß über alle Kosten 1.743 Thl. 3 Gr. 4 Pf. Überschuß habe, welcher bestanden an Vorräthen, außenstehenden Schulden und Cassa Vorrath, wenn auch die iezo vorhandenen Rohen Vorräthe zu Kauffmanns Guth zubereitet, nach Abzug der Zubereitungs Kosten über 10.000 Thl. – Überschuß bleiben wird. Insonderheit, da nunmehro das ganze Werck regulair gebauet, und an hießigen Orte, so wohl der Zufuhr wegen, einen bequemen Platz gefunden, das Poch und Wasch Werck gebauet, darinnen vorgerichtet zwey Wällen und Räder, Sumpff, Poch Gezähe und Einschlag Werck, mit dem Wasch Wercke, Sumpffe Wasch Waßern, Waage und Bergk (Bley?) mit überbauenden Wohn Stube nebst diesen ein Brenn und (Treige?) Hauß, Waaren Niederlage (Treig?) Gerinne eingezäunte Bläze zum Rohen Vorräthen und dergl. auch ferner hin keinen Verlag mehr erstattet, es sehn viele Sachen unter denen Mineralien, so in den Bergk Wercken gefunden, und vormahls von wenigen erkand, noch dieselben zu Nuzen gewußt, sondern die meisten in die Halten gestürzet, auch wohl zum Theil mit denen scharffen (Sündern?), wenn die Stölln geschlämmt und gesäubert, denen Inwohnern die Wiesen verderbet, alle Rothen, schwarzen, braun und gelben Eisenschüßigen Hornsteine, allerhand farbige Schieffer, Letten, Mulmen, Bergartigen Schweiffe, (Sünden?) Braunstein und dergl. so die Eigenschafft haben, welche alle nach beygefügten Proben nunmehro bey dem Wercke gebraucht und in ziemlichen Vorrath, auch auf unendliche Jahre ohne Abgang und leichten Kosten mit Bestand in großer Quantitaet zu haben, wenn hiermit recht administriret wird. So ist kein Zweiffel, daß dieses Werck nicht nur jährlich einen erwähnten Überschuß geben, sondern auch zu Ihro Königl. Maj. Hohen Ruhm und Bergk Werck Interesse beförtert, zu mahl die Mineralien eben so gut als die Metalle weil man solche (davon?) bekommen kann und (?) den gemeinen Waßer, so wenig als jene zu entrathen, Es wurden insonderheit die Fossilien verbraucht, von denen Mahlern, Töpfern, Maurern, Leinewand und Tapeten Druckern, Weißgerbern, Leder Zurichter, allerhand Künstlern, zum Glaßmachen, Töpfern, Seiffen Sieden, die Chirurgus, Mediciner, Roß Ärzte zum Rauch Pulver, Waßern, Politur und dgl. mehr, es haben zeithero die Kauffleute vieles aus Holl- und England verschrieben und ins Land gebracht, nun mehro bleiben diese nicht nur allein meistens weg, sondern ich auch solche nach (Bayerland?) Königreich Böhmen, Brandenburg, Schleßingen und andern Orthen versendet habe, hiermit auch in Leipzig eine Niederlage, welche alles übergeben jährliche Rechnungen deutlicher besagen und ob ich schon von zeit des Anfangs bis hierher dieses Werck ein zu richten, ohne Ruhm nicht wenig Arbeit gehabt, bey wenigen Salario und vielen aufgewendeten Kosten kümmerlich leben müßen, so habe doch mein äußerstes gethan, um die Möglichkeit zu zeichnen, daß nicht von denen Ignoranten unter die geringen gezehlet werden kann, die ehemahls ohne Grund was angeben, und nicht vermocht, aus Zufuhren mit vieler Mühe und Wege, dabey manche ledige Schicht gefahren, ans Tage Licht gebracht, mit berühmten Kauffleuten communiciret, gelehrte Männer consultiret, wo zu ein iedes zu gebrauchen, und wie solches ins Commertium zu bringen. Insonderheit da ich bis anhero nicht geschüzet, daß Maß Ihro Königl. Maj. dieser wegen allergnädigst anbefohlen, auch Euer Excellenz und hochlöbl. Ober Berg Amt hochgeneigt verordnet, daß an denen Fossilien sich niemand vergreifen odder (Maschandirung?) treiben soll, sondern viel mehr von Leuten, die vormahls von den Sachen nichts gewußt, aniezo sehen und (?) es an vielen Orten (?) oder Handeln damit, das mit dergleichen Wercken ohne Privilegia sich nicht will thun laßen, könnte aus vielen Umständen erwiesen werden. Zeichens auch alle die jenigen Mineralien, so außen Bergwercken kommen, wie die verfaßet, daß außerdem kein Nutzen zu schaffen, die ganze Sache, die in einer wohl ein gerichteten regulairen Ordnung sein soll, stehet in der größten Confusion, inmaßen nur bis anhero nicht mehr gelaßen worden, als womit Niemand nicht gewußt zu machen, oder was ich selbst ausfündig gemacht, wenn noch dieses geschehen, das jenige Quantum so zur Fabrique gelieffert, ist alles richtig verzehndet worden, wovor ich auch gesorget, und nach denen Bergrechten gemäß die Berg Gebäude und Schürffe gemuthtet und bestätigt worden, von den übrigen aber, so viele 100 Centner vertrieben und (maschandiret?) haben, wird kein Pfennig ein kommen sehen, sondern alles meistens (?) verführet, ohne eines Beamten und Gewerken Wißen, Ich könnte ienen Leuten noch mehr als noch einmahl so hoch (?) bringen und ankauffen, auch viel ein höher Quantum, wenn solches unterbleiben, welches dann ander Gestalt nicht geschehen kann, halte auch wo unmöglich einen (?) zu thun, ohne gebührende Ordnung Mittels und Hülffe, mit diesen und allen dergleichen Wercken einige Nuzen zu schaffen, und ist auch allen denen, die mit dergl. Sachen umgehen und handeln, eigens Verderben, hülfft keinen bauenden Gewerken nichts, in der Zubereitung haben sie keinen Verstand von den Sachen, noch die Beschickung nach Arth der Sorten, die Waaren werden über häuffet, der Preiß geringert, gemein Guth in großer Menge ohne sondern Fleiß verferdiget, alles überführt, dahero den die Ausländer dadurch Gelegenheit haben, ihre Sachen, die sie in beßrer Ordnung halten, mehrern Fleiß verwenden, solche ins Land bringen und tragen das Geld davor naus, es wäre dann und wann das einer alleine hat und sonsten dieses aus fündig zu machen, nicht leicht möglich, so kann allenfals, wenn recht hiermit umgangen, einiger maßen Nuzen bringen, so bald aber noch einer und mehr mit dergl. zum Vorschein kommt, als bald ist das Verderben der Sache vorhanden, wie im Fall aus vielen Exempeln zu erweißen, dennoch wegen des Landesherrlichen Zehnden abzutragen und andern Umständen mehr, in beßre Ordnung zu bringen, wäre dieses in aller Kürze so viel möglich habe Euer Excellenz und hochlöbl. Ober Bergambte, wo nöthig erachtet gehorsamst zu berichten. Überlaßen alles in hoher Überlegung des ganzen Werckes sonder Maßgebung Hohen Schuz zu nehmen. In geziemender Referenz erwartte was dieselben dieses wegen (?) geneigt verordnen, denen gehorsamst nachzukommen, verbleibe
Euer Excellenz und hochlöbl. Oberbergamts unterthänigst gehorsamster So richtig schlecht kann sich´s also gar nicht angelassen haben, auch wenn man unterstellen darf, daß Herr Flemming sein Werk hier vielleicht etwas „über den grünen Klee“ hinaus gelobt haben wird...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
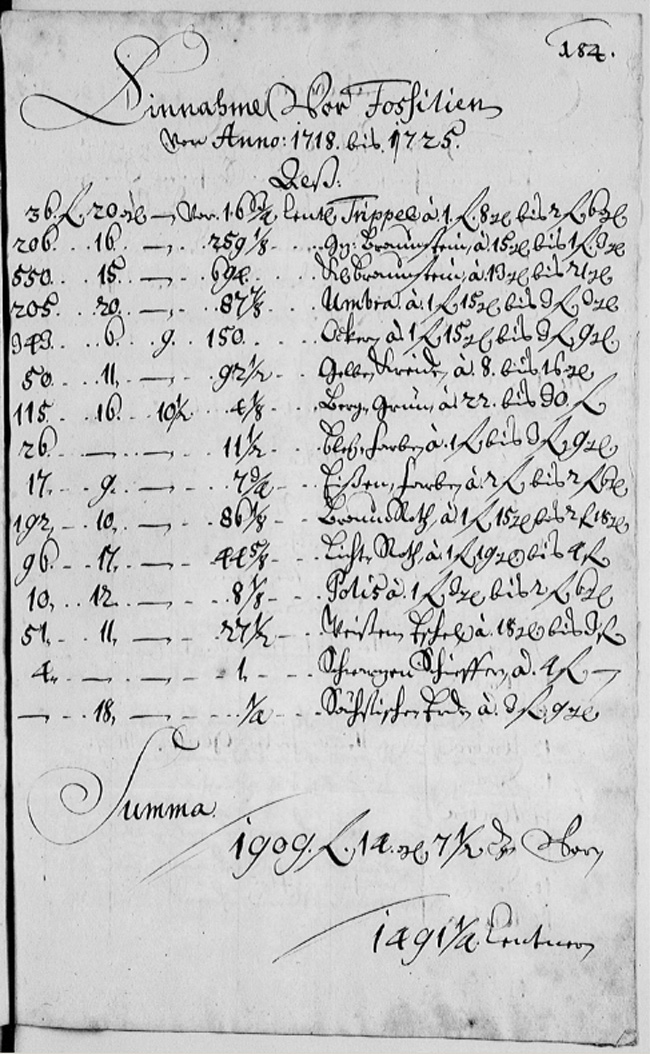 Diese Zusammenstellung der insgesamt von 1718 bis 1725 für das ,Fossilienwerk' angekauften Mengen verrät uns auch, daß es beim Braunstein zwei Qualitäten gab, deren erste von Flemming für 15 Groschen bis 1 Thaler, 3 Groschen, die andere aber für 13 bis 21 Groschen von den Gruben aufgekauft worden sind. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40001 (Oberbergamt Freiberg), Nr. 2969, Blatt 184, Gesamtansicht. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da nun vielleicht die Einnahmen aber doch nicht so
hoch anstiegen, wie Herr Flemming versprochen hatte und die Zehntenämter
in Schneeberg und Schwarzenberg keine weiteren Vorschüsse mehr geben wollten,
überlegte man wieder einige Jahre später in Dresden, ob es nicht besser wäre,
das Werk an Privatleute zu verkaufen. Daraufhin wurde
Berghauptmann Carl Christian von Tettau
wieder ausgesandt,
auch dieses Werk gründlich zu inspizieren. Seinen
Revisionsbericht sandte er am 28. August 1728 nach Freiberg (40001, Nr. 2969,
Blatt 195ff). Dieser vielseitige Bericht nennt uns folgende Fakten: Herr
Flemming hatte in dem nunmehr 10½ jährigen Zeitraum von Trinitatis 1718 bis
Reminiscere 1728 des Bestehens der ,Fossilien Fabrique'
Zugleich hatte er aber auch schon
erhalten. Irgendwie scheint uns diese Bilanz nicht so richtig aufzugehen. Auch sei Herrn Flemming's Sold, der auch noch einmal 456 Thaler pro Jahr, respektive 1.638 Thaler in diesem Zeitraum ausmache, in der Rechnung noch nicht enthalten. Berghauptmann von Tettau aber meinte dennoch, Seine Königl. Majestät müsse sich in Anbetracht der Entwicklung der Produktion keine Sorgen um die Erstattung des Verlages machen und führte langatmig dazu aus: „Wenn aber Se. Kön. Maj. erwägen, wie viele Salz, Vitriol, Alaun, Arsenic, Hammerwerke und dgl. in Eu. Königl. Landen mit viel mehren Kosten viele Jahre zu erbauen und zu erheben kosten, ehe sie sofort zu einem ergiebigen Überschuß gedeyhen, so wird wohl bey diesem Fossilienwerke 10 Jahre Zeit noch nicht viel heißen... Es würden jedenfalls an die 1.000 Thl. Geld ins Land kommen, was sonst Eu. Maj. Unterthanen vor die gleiche oder nicht beßre Waare außer Landes gehen laßen.“ Der Berghauptmann verwies sogar darauf, daß selbst „der Fuhrmann participiret.“ Auch sei aus der Tabelle zu ersehen, daß der Braunstein, Umbra, Ocker und die gelbe Kreide die gangbarsten Waren sind und daß bei diesen „unbefugtes Marchandiren vergangen“ sei, und empfahl daher das Werk der weiteren, hochherrschaftlichen Protektion. Die Fortstellung dieses Werkes wollte sich daraufhin auch König August gefallen lassen, forderte aber schon ein Jahr später ein neues Gutachten an (40001, Nr. 2969, Blatt 0216). Die Geschichte wiederholte sich nun über viele Aktenblätter. Johann Christoph Flemming hatte noch einige andere Ideen, fand zum Beispiel heraus, daß man aus alten Schmelztiegeln der Dresdner Münze noch Silber gewinnen könne und wollte auch ein „Wetz Stein Schleiff und Schmiede Werck“ errichten. 1729 beantragte er sogar die Ernennung zum Vize Berghauptmann, weil ihm dies bei den Grubenbesitzern mehr Autorität verschaffe. Dazu kam es aber nicht mehr. Am 17. September 1736 teilte der Oberzehntner des obergebirgischen Kreises, Johann Ludwig Valerian Fischer aus Schlettau mit, der Herr Flemming senior sei „ohnlängst mit Tode abgegangen.“ Er habe Verfügung getroffen, die Vorräte und das Inventar des Werks sicherzustellen, damit nichts abhanden komme (40001, Nr. 2969, Blatt 238f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danach folgt wieder eine kleine Lücke in der
Aktenüberlieferung. Offenbar aber hatten sich die früheren Angestellten
selbstständig machen wollen und die Königliche Kammer forderte am 3. Juni 1739
das Oberbergamt auf (40001, Nr. 2969, Blatt 240): „Unser Schwarzenbergisches
Fossilien Werck betreffend ist der von dem vorigen Farbenmeister Christian
Schmidt und Consorten übernommene Privat Fossilien Handel bei Strafe von 10
Thl. zu inhibiren.“
Na, so einfach geht´s aber auch nicht. Einige Zeit später hatte man dann Johann Christian Flemming's Sohn Johann Friedrich Flemming zum ,Fossilien Factor' bestellt. Dabei traf man in Dresden auch Verfügung, es solle alles in bisheriger Weise fortlaufen und bekräftigte seine diesbezüglichen Befehle. 1744 etwa erging die Verfügung, daß „jedesmal, wenn auf den Zechen solche Fossilien einbrechen, dem Factor Nachricht zu geben ist, sodann alle privat Marchanderie, besonders bey dem Braunstein, welcher bey Langenberg im Scheibenberger Bergamt gehörig bricht und noch unter allen Fossilien am meisten gehet, und gesucht wird, möchte bey einer (?) Strafe untersagt werden, wie denn auch dieserhalben (...) allergnädigster Befehl ergangen, welcher aber auf keine Weise mehr nachgelebet, sondern da die Eigenlehner der Langenbergischen Braunstein Zechen keinen Centner davon mehr anher zum Fossilien Wercke liefern, auf solche Weise dem Wercke die considerablste Einnahme entzogen wird...“ Die Bezahlung des Faktors wurde allerdings auch von wöchentlich 2 Thl. auf 1 Thaler, 18 Gr. herabgesetzt und nicht mehr von der Zehntenkasse gezahlt, sondern war dem Verkaufserlös zu entnehmen. Man hoffte, dadurch die Kosten zu reduzieren und den Verlag in einigen Jahren sukzessive vielleicht doch erstattet zu bekommen. Auch dem Sohn gelang es offenbar aber nicht, sein Handelsmonopol wirklich durchzusetzen. In einem Schreiben vom 28. Januar 1745 (40001, Nr. 2969, Blatt 258ff) etwa erbat er, man solle doch
Er zählte auch gleich noch einige ,Personen' auf, die unter anderem mit Braunstein und mineralischen Farben Handel trieben, nämlich:
Diese verkauften Braunstein auf der Leipziger Messe zu Preisen von 32 bis 36 Gr. pro Zentner, also bis zu anderthalb Thalern oder dem Doppelten, was Herr Flemming erzielte. Da kann man natürlich auch die Eigenlehner Merkel und Weißflog verstehen, daß sie kein Interesse mehr daran hatten, ihren Braunstein für ganze 10 Groschen den Zentner an das Königliche Werk zu verkaufen und lieber eine Bestrafung riskierten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach ihrer nächsten Revision des Werkes berichteten Johann Ludwig Valerian Fischer und Carl Ludwig Fischer am 12. Februar 1745 nach Freiberg (40001, Nr. 2969, Blatt 262ff), daß im ganzen Jahr 1744 nur 78 Thl. 23 Gr. 8 Pf. Einnahmen aus dem Verkauf erzielt worden seien. Anderthalb Jahre später berichtete auch Bergkommissionsrat Johann Moßdorff aus Freiberg nach seiner Anwesenheit dort über die schlechte Beschaffenheit des Fossilienwerks und daß der Faktor klage, das Werk sei seit seines Vaters Tode sehr verfallen, baufällig und stand kaum noch in Umgange, es seien Reparaturen erforderlich, aber die Rechnungen „ohne Abwurf.“ Auf die nachfolgende Aufforderung der Königlichen Kammer an das Oberbergamt zu einer neuerlichen Begutachtung hin schlug man in Freiberg vor, das Werk doch zu verpachten. Man hatte alsbald sogar einen Interessenten gefunden und am 18. Januar 1747 teilte auch die Kammer nach Freiberg mit, Seine Durchlaucht sei „nicht abgeneigt, das Werk den Schmirgel Gewerken des so genannten Grün belobten Tannenbaums zu Großwalthersdorff auf einige Zeit in Pacht zu geben.“ (40001, Nr. 2969, Blatt 276) Die Verpachtung muß auch irgendwann nach 1749 erfolgt sein, denn bis dahin wird Herr Flemming junior noch als Faktor genannt, in den nachfolgenden Aktenstücken ist dagegen immer von den Pachtinhabern die Rede. Die Oberaufsicht blieb aber auch nach der Verpachtung beim obergebirgischen Zehntenamt. Zu dieser Zeit fanden die Betreiber des Joseph & Marien Stollns bei Frankenberg in ihrer Grube Eisenocker, den sie zwar ordnungsgemäß dem Fossilienwerk zum Kauf anboten, jedoch aufgrund der großen Distanz zu dem stattlichen Preis von 4 Thalern für den Zentner. Darauf wollten natürlich die Pächter des Fossilienwerkes nicht eingehen, da diese Summe jegliche Einnahmen für die Produkte deutlich überstieg. Es kam zu einem längeren Streit vor dem Oberbergamt über die Angelegenheit, der letztendlich erst mit einem Entscheid der königlichen Kammer vom 15. August 1750 beendet wurde (40001, Nr. 2969, Film 0337ff). Demnach mußten die Pächter des Fossilienwerkes den Ocker „gegen billigen Preiß“ abnehmen; so sie sich aber über den Preis nicht einigen könnten, sollte den Gewerken der Vertrieb des Ockers freigestellt werden. Damit wurde das nie wirklich durchgesetzte Handelsmonopol des Fossilienwerkes weiter aufgeweicht... Wie wir gleich noch lesen können, wurde es 1755 gänzlich aufgehoben. Weil die Werksanlagen in Schwarzenberg wohl schon nicht mehr benutzt wurden, beantragte dann 1761 Georg Christoph Fischer, Drahtziehmeister aus Mittweida, die ,Vererbung' des Fossilienwerkes zwecks Umbaus zu einer Drahtziehmühle (40012, Nr. 33). Wieder ein Jahrzehnt später richtete die Landes Oeconomie-, Manufactur- und Commercien- Deputation am 11. Februar 1767 an die königliche Kammer ein Memorandum nachstehenden Inhalts (40001, Nr. 2973, Rückseite Blatt 7): „Hiernächst brechen auch im Lande, besonders in denen Ämtern Schwarzenberg und Scheibenberg sehr viel nuzbare Farben-, Polier- und andere Erden und Fossilien, von denen Gebrauch gemacht werden könnte, wenn das zu deren Aufbereitung ehemals vorgerichtete, zuletzt auf Rechnung des Churfürstl. Cammer- und Berg Collegio betriebene, nunmehro aber gänzlich eingegangene und an einen Privatim veräußerte Fossilien Werck zu Schwarzenberg entweder vorgerichtet oder an einen andern, bequemern Orte dergleichen Anstalt neuerlich gemacht würde. Da dergleichen Entrepise vielmehr dem Lande, deßen Producte dadurch ins Commercium gebracht werden, Vortheil in ganzen schafft, als daß ein damit sich abgebender Particulier sich daran einen beträchtlichen Überschuß (erreichen?) könnte, so ist vor uns billig, dem Cammer- und Berg Collegio, in deßen Händen die Sache ist, zu überlassen, was selbiges vor die Mittel am dienstsamsten finden dürfte: Die zu Anlegung und Umtrieb eines Fossilien Wercks sich darbietenden natürlichen Vortheile des Landes bekannt zu machen und Entrepenieurs darzu aufzumuntern.“ Das Fossilienwerk in Schwarzenberg war hiernach nun schon nicht mehr verpachtet, sondern ganz verkauft, ohne daß sich dessen wirtschaftliche Situation dadurch gebessert hätte. Beim Kammerkollegium griff man die Sache auf und sandte die folgende Aufforderung an das Oberbergamt (40001, Nr. 2973, Rückseite Blatt 6): Xaverius,
„Werte Räthe, liebe getreue, was bey uns die Landes Oeconomie-, Manufactur- und Commercien- Deputation wegen derer in hiesigen Landen und besonders in dem Amte Schwarzenberg und zu Scheibenberg brechenden, vielen (?) Farben-, Polier- und anderen Erden, auch Fossilien, von denen, wenn dergleichen Werke angelegt und in (?) Umtrieb gesezet würden, guter Gebrauch zu machen stünde, und durch die davon ins Commercium gebrachten Producte dem Lande großer Vortheil verschaffet werden könnte, vorstellig gemacht, solches ersehet ihr aus den hier angefügten Extracte mit mehrem und ist hiermit in Vormundschaft unseres Herrn Vetters des Churfürsten Unser Begehren, ihr wollet durch was vordienliche Mittel, diese sich darbietenden natürlichen Vortheile des Landes vors künftige beßrer Zubenuzung und in Aufnahme zu bringen, reiflich erwägen und darüber euren unterthänigsten Bericht, mit beygefügten ohnmaßgeblichen Gutachten gehorsamst erstatten. Daran geschiehet Unser Wille und Meynung. Datum Dresden, am 30. May ao. 1767“ Zu dieser Zeit (ab 1763) war Franz Xaver von Sachsen (*1730, †1806), vierter Sohn von Friedrich August, II. und nach dem Ableben seiner älteren Brüder an zweiter Stelle in der Thronfolge als König von Polen, in Vormundschaft für den noch minderjährigen Friedrich August, III. (*1750, †1827) Regent (Administrator) von Kursachsen (wikipedia.de). Die Aufforderung zur Berichtserstattung reichte das Oberbergamt am 17. Juni 1767 an sämtliche Bergämter (inklusive Groß Kamsdorf im Neustädtischen Kreis) weiter.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die einzelnen Bergämter erstatteten daraufhin auch mehr oder weniger aussagekräftige Berichte, unter denen aber der folgende ‒ obwohl er gar nicht aus einem solchen, sondern aus Chemnitz kam ‒ am interessantesten ist (40001, Nr. 2973, Blatt 17ff): „Hochwohlgebohrne, wohlgebohrne, gnädige, höchstgeehrte Herren! Ew. Hochwohlgeb. Gnaden und Ew. Wohlgebohren haben unterm 17ten Juny a. c. mir gemaßenst aufgetragen: Was vor Gebrauch von der, nach Aufhebung des ehemaligen Fossilien Werck zu Schartzenberg erfolgten Freygebung der Aufbereitung und Verkaufuung derer, auf den Berg Gebäuden und sonst brechenden Farben und anderer nutzbarer Erden, von Gewercken oder anderen Privatis gemachet? Auch ob und wie solche benutzet worden, sowohl durch was vor dienliche Mittel diese sich darbiethenden natürlichen Vortheile des Landes in Ansicht derer, in jedem Berg Amts Bezirk brechenden Fossilien vors künftige beßer zubenutzen, durch ohnmaßgebliches unterthäniges Gutachten der fördersamsten anzuzeigen. a.) Was nun das ehemalige Fossilien Werck zu Schwartzenberg anbelanget, so kann in Unterthänigkeit versichern, daß mir selbiges sowohl, als die daselbst zubereiteten Fossilien sehr wohl bekannt gewesen, mir auch besonders mit Untersuchung derselben sehr viel Mühe gegeben. Hierbey aber habe zugleich wahrgenommen, daß man bey Zubereitung derselben weder die erforderliche Wißenschaft angewendet, noch auch in der Wahl allzeit glücklich gewesen, zugeschweigen, daß man wohl gar öfters, um der und jener Gewerckschaft zu favorisieren, das unnützlichste Zeug von Weitem mit den größten Unkosten herbey gehohlet. Hieraus läßt sich also gantz natürlich folgen, warum diese Fabrique noch ehe sie recht emporgekommen, schon wiederum ihren Verfalle zugeeilet. Als wozu auch nicht wenig die entfernte und versteckte Lage des Ortes selbst vieles beygetragen, wodurch die Ab- und Zufuhren beträchtlich erschweret, also folglich der Preiß erhöher und der Abgang vermindert worden. Und da also schon die natürliche Lage einem sonst so nützlichen Wercke zuwider, so konnte um desto leichter durch üble Wirthschaft der gäntzliche Verfall deßelben bewirket werden. b.) Nach Einziehung aber derer, diesem Wercke ertheilten Privilegiorum prohibitiorum vermöge allergnädigsten Befehls vom 26ten Februar 1755 erfolgte Freygebung der Aufbereitung und Verkaufung derer auf den Berg Gebäuden und sonst brechenden Farben und anderer nutzbarer Erden, sind nach meiner Kenntniß weder vor Gewercken noch Privatis beträchtliche Vortheile erwachsen. So nachtheilig auch in gewißen Fällen Privilegia prohibitiva und Monopolia, nach der Meynung großer Staatsverständiger seyn können, so hat doch eine aufmerksame Erfahrung deutlich gezeiget, daß die Benutzung derer Fossilien, wenn selbige eintzelne Gewercken oder Privatis in freye Hände gegeben wird, von keinem beträchtlichen Anhalten gewesen. Das Schmirgel Werck zu Großhartmannsdorf und Sachsenfeld, die Ocker- Zeche zu Frankenberg und andere mehr, sind bey ihrem eifrigsten Umtriebe auf einmahl in Stocken gerathen. Die sorgfältige, mühsame und vielfache Zubereitung derer Fossilien, ehe sie zu einem bestimmten Gebrauch anzuwenden, ja die Vielfältigkeit derselben, um das Verlangen so vieler und vielfältiger Künstler und Handwerker zu befriedigen, erfordern zusammengesetzte Kräfte, und eine genaue Beobachtung gewißer genau bestimmter Gesetze, ohne welche der Käufer Gefahr läuft, der Verkäufer aber sein Product zu versilbern, und in Menge abzusetzen, verhindert wird. Dieses sind also, nach meiner wenigen Einsicht, diejenigen Ursachen, warum dergleichen Producte von weit anhaltendem Nutzen, wenn selbige in fester Hand verbleiben können. c.) Die sich darbiethenden natürlichen Vortheile des Landes aber, in Ansehung derer brechenden Fossilien, künftig besser zu nutzen, wäre mein unterthäniges ohnvorgreifliches Gutachten dahin gerichtet:
d.) Um aber einen zu einer dergleichen Fabrique schicklichen Ort in unterthänigen Vorschlag zu bringen, so scheint mir zur Zeit die Stadt Chemnitz vor vielen anderen sich vorzüglich aus folgenden Ursachen darzubieten.
Ew. hochwohlgebohr. Gnaden werden sich gnädigst zurück erinnern geruhen, wie in Chemnitz selbst kein bequemerer Platz anzutreffen, als die alte Tuchmacher Walckmühle vor dem Niclas Thor.
Weil aber diese gantz wüste liegende Tuchmacher Walckmühle dem Rathe zu Chemnitz zuständig, so habe bey selbigem Erkundigung eingezogen, ob dieses zur Zeit unbrauchbare werck käuflich könnte überlaßen werden, worauf beygelegte schriftliche Resolution sub B. erhalten. Da aber aus selbigen zugleich zu erfahren, was vor eine beträchtliche Menge herrschaftlicher und Gemeinde Abgaben auf diesem Grundstücke haften, so überlasse lediglich Ew. hochwohlgebohr. Gnaden hohen Einsicht, was hierunter vor dienliche Maaß Regeln zu nehmen, damit diese unerträgliche Laßten vermindert werden könnten. Übrigens aber wollte vor meiner Person auch wahrer patriotischer Gesinnung wünschen, daß eine, wegen vielerley Absichten, so gemeinnützliche Sache bald in gehörigen Umtrieb gebracht würde, wie mir es denn zum größten Vergnügen gereichen würde, wenn hierzu nach Maaß meiner Kräfte etwas beyzutragen im Stande wäre. Als der, in Erwartung Dero gnädigsten Befehle, mit aller unwandelbaren Treue lebenslang verharrend, Ew. hochwohlgebohr. gnad. und wohlgebohr. Herrsch. unterthänigst gehorsamster David Frentzel.“ Ob dieser Vorschlag den Beifall des Fürstenhauses gefunden hat und ob er umgesetzt worden ist, erfährt man nicht, denn leider springt der Akteninhalt an dieser Stelle auf das Jahr 1857 und das Auffinden von Farberden im Marbach'er Forstrevier vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses Kapitel zum
Vertrieb des Braunsteins im 18. Jahrhundert hier einzufügen, erschien uns
wichtig, denn während über die Abnehmer des geförderten Eisensteins immer wieder
Notizen, namentlich in den Fahrbögen der Berggeschworenen, die ihn zu vermessen
hatten, zu finden sind, haben wir erst Anfang des 19. Jahrhunderts wieder einen
Kaufmann
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Staatliche
Subventionen im 18. Jahrhundert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Offenbar auf Ansuchen des Bergamtes in Scheibenberg wurde
1733 auf hohe Anweisung ein Betrag von je 100 Thalern auf drei Jahre „zur
Erschürfung neuer Gänge im Bergambte Scheibenberg“ gnädigst gewidmet (40014,
Nr. 78, Blatt 3ff). Die Kosten sollten vom Obergebirgischen und Schneeberg'er
Zehntenamt zu gleichen Teilen getragen werden, legte die Königliche Kammer in
Dresden dazu am 20. Juni 1733 gegenüber dem Oberbergamt in Freiberg fest.
Bereits am 26. April 1733 wurde ein Johann Christian Mittelbach zum
Leiter dieser „Erkundungs- Mission“ bestimmt, als Steiger vereidigt und mit
besonderer Instruktion versehen.
Ein knappes Jahr später, am 11. November 1733 berichteten Samuel Enderlein, damals Bergmeister in Scheibenberg und Johann Paulus Bock, Geschworener, an das Oberbergamt dieserhalb, man habe „am sogenannten Schaaffberg, welcher von hiesigen Städtlein ungefähr ½ Stunde gegen Abend lieget, begeben und daselbst nach deren aufsetzenden Gängen unterschiedliche Schürffe, …werfen lassen, und auch auf George Ösers und Marien Trögerin (Name schwer leserlich ?) zur Unterscheibe Grundt und Boden einen schönen arthigen Gang, welcher sein Streichen nach deßen iezigen Einrichtung (…) 2 und 5/8 Uhr und das Fallen an 45 Gradt in occid. Hat, entblöset, wie denn hiernächst derselbe über ¾ Elle mächtig ist, und zur Zeit in einem silberarthigen Hornstein und Quarz nebst Fächerung eines Bleyschweifes und Glatten Harnisch bestehet, dabey aber der bergmännischen (schwer leserlich ?) nach man die Hoffnung hat, daß selbiger bey weiterem Abbaue und Erlängung fündig werden und sich zu Erz anhalten möchte, … im übrigen aber bis dato (?) 3 ⅜ Lachter von der Hängebank weg abgeteuffet und das Schächtlein mit nöthigem Gezimmer versehen worden, … wegen der im verwichenen Herbst 1733sten Jahres bey darmals entstandenen Regen Wetter sich darinnen gefundene vielen Wäßer, davon abgehen und dahingegen sich wiederum in Quartal Trinitatis a. c. auf die Waldt Refier mit den Schürffen wenden müßen, und darum nun also bis anhero in der Klein Mittweyda, am sogenannten Bären Acker, eine halbe Stunde über dem Ober Mittweydaer Hammerwerk gelegen, dasselbe beständig fortgesetzt, …(dort) aber nichts als bloße Klüfte getroffen...“ Die ganze Sache hatte in diesem ersten Jahr 95 Thaler, 2 Groschen gekostet. Aufgrund dieser Berichterstattung sandte am 14. Februar 1734 das Oberbergamt die königliche Anweisung zum Bergamt Scheibenberg, man wolle, daß der Schafberg „sobald es die Witterung zuläßt, durch die Ruthe untersucht und in Abriß gebracht werde.“ Wiederum ein Jahr später, am 5. Oktober 1735, sandte das Bergamt Scheibenberg, wieder vertreten durch Samuel Enderlein und Johann Paulus Bock, den vom Markscheider Ötterich aus Marienberg zum Schafberg angefertigten Riß an Herrn Berg Commissions Rath und Cammer Commisarium Johann Ludwig Valerian Fischern auf Schlettau, „nach welchem sothanes gebürge sehr viele Gänge und Klüfte (schlecht leserlich, aber sicherlich: in sich begreift ?).“ Das Gebirge solle nun durch einen Suchstolln aufgeschlossen werden. Das Oberbergamt hatte dazu vorgeschlagen, daß diesen Erkundungsstollen nicht weiter die Schürfgelderkassen finanzieren sollten, sondern die Besitzer „der anliegenden Kretzschmarschen Erbgerichte, Hammerwerksbesitzer, das Erbgericht in der Mittweyda, das in der Oberscheibe, wie auch Neudorff in Pöhla, das Tännich Guth, die beyden Hammerwerke zu Rittersgrün als das Schmertzingsche und Arnoldische und ingleichen das in Klein Pöhla“, welche „angehalten werden (sollen), solchen Stollen zusammen zu treiben“ und im Gegenzug auf ihren Fluren die halbe Tranksteuer erlassen bekommen. Dazu merkte das Bergamt in Scheibenberg aber an, daß dabei oft unbergmännisch vorgegangen werde und binnen eines Jahres kaum zwei Lachter Vortrieb erreicht würden. Offenbar wurde über die weitere Finanzierung dieses Vorhabens keine Einigung erzielt und so blieb es liegen, denn außer einer Instruktion für den bestellten Schichtmeister Mittelbach für das Folgejahr enthält die Akte sonst nichts mehr (40014, Nr. 78).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als eine Folge der Ereignisse des Siebenjährigen Krieges und des für einen wirtschaftlichen Wiederaufschwung nötigen Rohstoffbedarfs ist dann nicht nur die Gründung der Bergakademie in Freiberg und schließlich die Aufnahme einer systematischen geologischen Erkundung durch die Geognostische Landesuntersuchungskommission zu sehen. Das Fürstenhaus sah sich auch genötigt, an ganz konkreten Punkten in die Arbeit der Behörden einzugreifen und forderte etwa 1782 das Oberbergamt auf, sich um das Aufsuchen neuer Eisenerzlagerstätten zu bemühen (40014, Nr. 169, Rückseite Blatt 2ff): „Werte Räthe, liebe Getreue! Uns ist geziemend vorgetragen worden, wohin Uns ihr bey Gelegenheit des von dem Besitzer des Schlößler*) Hammerwerks, Hänel, gegen die von dem Besitzer des Rothen Hammers zu Wildenthal, Irmischen, intendirte Errichtung einer 2ten Stabhütte, beschehenen Anführens, daß durch Erhebung einer neuen dergl. Hütte, die böhmische an der Grenze liegenden Hammerwerks Besitzer aufmerksam gemacht, und wohl gar zum Nachtheil hiesiger Hammerwerke, wieder keine Eisensteine aus Böhmen verabfolget werden möchten, in dem mit Beyfügung der hierbey zurückgehenden 2 Faszikel Acten den 3. Junii 1780 zu Unserem Cammer Collegio erstatteten gehorsamsten Berichte, sowohl wegen der Unentbehrlichkeit der böhmischen Eisensteine zum Umtriebe der hiesigen Hammerwerke, als auch über den Passum, ob die Eisensteine nicht innerhalb des Landes in hinlänglicher Quantität gewonnen, und ersterer dadurch ganz entbehrlich gemacht werden könnte? Euer ohnmaßgebliches Gutachten eröffnet habt. Nachdem nun in diesem sowohl, als in dem 1740 deshalb vom damaligen Oberberg Amte erstatteten Berichte behauptet worden, daß der böhmische Eisenstein, besonders bey einigen Fabricatis, so lange unentbehrlilch sei, bis in hiesigen Landen gleich gute und schmeltzwürdige Eisensteine in hinlänglicher Quantität gefunden worden, mithin sowohl überhaupt, als zum Besten derjenigen Hämmer, welche von der böhmischen Grenze entfernt sind, die Ausfündigmachung dergl. guter Eisensteine in hiesigen Landen um so nothwendiger wird, da zu Folge eingegangener zuverlässiger Nachricht in den Königl. Preuß. Landen neuerlich zu Verbeßerung dieses Artikels, viele Bemühungen mit gutem Erfolg angewendet worden seyn sollen, diese im Brandenburgischen getroffenen Veranstaltungen aber dem Debit des innländischen Eisens in der Folge leicht nachtheilig werden dürfte. Also ist hiermit Unser Begehren gnädigst befehlend, ihr wollet einer oder mehrern der Sache kündigen Personen, zu Aufsuchung beßrer Eisensteine, besonders in der Nachbarschafft der an solchen Mangel leidenden Eisenhämmer Auftrag ertheilen, hienächst von sämmtl. innländischen Hammerwerks Besitzern darüber, ob, und in welchem Verhältniß mit innländischen Eisenstein, auch zu welchem Fabricatis sie den böhmischen Eisenstein verschmeltzen, und ob sie selbigen aus Noth, weil ein gleich guter ihnen im Lande nicht verschaffet werden kann, oder blos, weil er näher zu haben ist, gebrauchen, ferner, ob derselbe ganz oder doch zum Theil auf solchen gruben, wo sie, oder andere Sächsische Gewerken mit baun, von ihnen gezogen werde, Anzeige erfordern und nach deren Eingang darüber euren gehorsamsten Bericht mit ausführlichem Gutachten, zugleich auch, was ihr wegen des ersten Puncts zu Aufsuchung beßrer Eisensteine veranstaltet habt, mit anzeigen, endlich auch eine oder andre geschickte Person, welche durch Besichtigung guter ausländischer Hammerwerke sich die etwa in hiesigen Landes Fabriken noch seltene Kenntniß, erwerben, und solche demnächst den Hammer Besitzern im Ober Gebürge und Voigtlande mittheilen, auch bey dieser Gelegenheit nähere Erkundigung über obgedachte in Brandenburgischen (?) Verbeßerungs Anstalten einziehen könnte, in Vorschlag bringen, übrigens aber Uns annoch in dem per Inferatum vom 16. Febr. von euch erforderten Berichte, eure gutachterliche Meynung darüber, ob nicht vielleicht die Aufsuchung und der Gebrauch durch Aussetzung gewißer Aufmunterungs Praemien zu bewürken seyn dürfte, mit eröffnen.
Friedrich August, Churfürst,
*) Mit dem Schlößel ist hier der gleichnamige Ortsteil von Hammerunterwiesenthal gemeint.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der daraufhin ergangenen Aufforderung des Oberbergamtes zu Freiberg folgend, berichtete das Bergamt Scheibenberg am 27. November 1782 (40014, Nr. 169, Blatt 14f): „(…) Endlich haben auch IV. in dem Dorfe Raschau die Hammerwerks Besitzer zu Groß und Klein Pöhla, ingleichen aufn Ober Mittweyder Hammer, einen alten Eisenstein Zug gegen den Münzerberg, der Junge Johannis genannt, mit einem Schacht anschlagen (?) laßen, mit welchem in 7 Lachter vom Tage nieder, ein Flötz, eine Elle mächtig, angebrochen, schwartzen Eisenstein erlanget, auch bereits an die 30 Fuder vermeßen worden. Ob nun dieser Eisenstein etwas Kupfer mit sich führet und also nicht ganz tüchtig seyn solle, so suchen doch die Herrn Gebrüder Nietzsche aufn Ober Mittweyder Hammerwerke, diesen Zug mit einem tiefern Stolln zu lösen und die Eisensteine zu erbrechen. So wie wir schon (?) nach unserm ohnmaßgeblichen Gutachten dafür halten, daß zwar vor allem vorbemerktes Gebürgs Gegenden, das ad III. bemerkte Globensteiner Gebürge mittelst Aufgewältigung des alten Stollns und deßen Forttriebs, so sind auch V. das Eisen Aemler Gebürge hinter Raschau Vielen noch darinnen befindlichen Pingen, ein starker Aushieb an Eisenstein vorgewesen seyn muß, noch mehr zu untersuchen seyn dürffte, so verdient jedoch am aller vorzüglichsten, daß VI. das Engelsburger Berggebäude* bey Pöhla zum schwunghaften Umtrieb hinwiederum gebracht würde. Dieses Berggebäude befindet sich nun im dasigen Gneuß Gebürge, auf einem mächtigen schwebenden Gang, deßen Eisenstein an Güte, Gehalt und Schmeltzbarkeit seinesgleichen im gantzen Gebürge, maaßen dieser Eisenstein im Frisch Feuer ohne allen Zusatz zum besten Eisen geschmeltzet wird. Die Herstellung dieser Eisenstein Grube beruht auf Vorrichtung eines tüchtigen Kunstgezeuges, wozu die beste Gelegenheit vorhanden, und der Hammerwerks Besitzer zu Pöhla, Herr von Elterlein, ist erböthig, dieses Werk, insoferne ihm ein Vorschuß von 400 bis 500 Th. gnädigst zugesichert würde, hinwiederum anzurichten, und in behörigen Umtrieb zu setzen. (…)“ *) Eine gleichnamige Grube gab es auch
bei Grünstädtel am Nordhang des Mittweida- Tales. Hier ist aber diejenige
bei Pöhla, nördlich des Kalkwerks
und der Grube
In den alten Zeiten muß der Name „Silber Emmler“, der bis heute gern kolportiert wird, ja irgendeinen Ursprung besessen haben ‒ hier nun ist jetzt vom „Eisen Aemler“ die Rede, was zumindest die letzten Bergbauphasen unseres Erachtens wesentlich besser trifft...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie zur gleichen Zeit auch am Fürstenberg bei Waschleithe folgte nun eine „Gründerzeit“ mit einer ganzen Reihe von Neugründungen, die ‒ den geologischen Umständen und dem schon vorangegangenen Bergbau der Altvorderen geschuldet ‒ aber eher selten längeren Bestand hatten. Nur beispielhaft und dem weiteren Text vorgreifend seien an dieser Stelle genannt:
Die Lage der auf denselben Lagern bauenden Gruben dicht beieinander führte schon immer fast unweigerlich zu Streitigkeiten, sowohl untereinander wegen „Raubbaus“ im jeweils angrenzenden Grubenfeld, als auch mit den Mühlen- und Hammerwerksbesitzern um die Nutzung des Schwarzbachwassers (vgl. z. B. 10036, Loc. 36070). Auch wegen der bergrechtlichen Vorrangstellung der Flächennutzung und einer Enteignung von Flächen des Gutes kam es zu Streitigkeiten, etwa zwischen der Königin Marien- Hütte als Bergwerkseigentümer von Wilkauer Vereinigt Feld und dem damaligen Grundeigentümer des Tännichtgutes, Carl Louis Stengel (vgl. 40169, Nr. 143).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
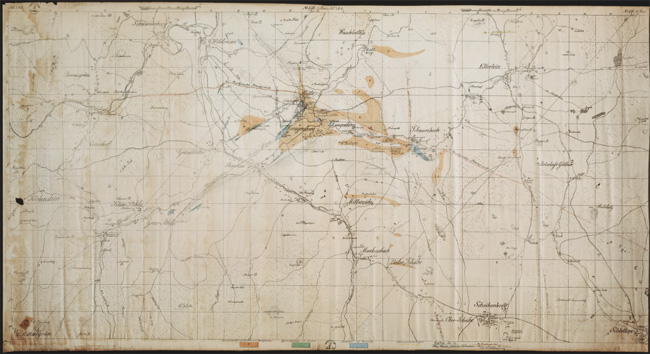 Mangan- und Eisenerz führende Quarzbrockenfelsbildungen bei Langenberg und Schwarzbach, Waschleithe, Elterlein und Unterscheibe, zusammengestellt von C. H. Müller 1866. Am oberen Bildrand liegt Schwarzenberg, rechts unten Scheibenberg. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044-1 (Generalrisse), Nr. k18595, Gesamtansicht, Norden ist rechts oben. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemerkungen
zur Bergverwaltung und zu den Bergbeamten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinsichtlich der Bergbauverwaltung liegt die uns hier interessierende Region am Emmler im Grenzbereich mehrerer Bergreviere und wechselte auch in seiner Zugehörigkeit zu diesen. Die östliche Grenze des Schwarzenberg'er Reviers verlief ursprünglich an den Grenzen zur Grafschaft Hartenstein unmittelbar westlich des Knochens. An dessen Nordgrenze grenzte das Schneeberg'er Bergrevier an. Die Gegend der Ämter Crottendorf und Grünhain mit Elterlein und Schwarzbach gehörte dagegen der schönburgischen oberen Grafschaft Hartenstein und damit dem Bergamtsrevier Scheibenberg an. Scheibenberg lag also nicht auf kursächsischem Territorium, sondern war innerhalb der seit 1406 den Schönburgern gehörenden oberen Grafschaft Hartenstein bzw. des schönburgischen Amtes Crottendorf Bestandteil der Besitzungen der Herren von Schönburg. Die Schönburger hatten in Scheibenberg ein eigenes Bergamt eingerichtet. Dort hatte 1515 der Elterlein'er Bergbauunternehmer Caspar Klinger Silbervorkommen entdeckt. Die eintreffenden Bergleute wohnten zunächst in dem seit dem 15. Jahrhundert nachweisbaren Dorf Oberscheibe (heute ein Ortsteil von Scheibenberg). Die Gründung der Stadt Scheibenberg geht auf die Brüder Ernst und Wolff von Schönburg zurück, die 1522 das Terrain im Wald abmessen und eine Planstadt im Stile des zuvor von ihnen gegründeten Oberwiesenthal anlegen ließen. Die Stadt Scheibenberg und der hiesige Bergbau entwickelten sich somit vor dem Hintergrund der für die Herrschaftsverhältnisse in der frühen Neuzeit typischen territorialen Gemengelage mit einem sich daraus ergebenden vielfältigen Konfliktpotential. Zu nennen ist dabei besonders die Nachbarschaft zu Kursachsen, das natürlich bestrebt war, sein Gebiet durch eine systematische Politik der Arrondierung und Vereinheitlichung auf Kosten der um und in seinem Gebiet liegenden Kleinterritorien zu festigen und auszubauen. So versuchten die ernestinischen Kurfürsten 1522 in unmittelbarer Nähe von Scheibenberg eine neue Bergstadt unter dem Namen „Neustadt am Scheibenberge“ zu gründen, was jedoch an den Widerständen des Klosters Grünhain und den geringen Silberfunden auf ernestinischem Boden scheiterte. 1559 kam der oberwäldische Teil der Herrschaft Hartenstein, zu dem neben Elterlein und Oberwiesenthal auch Scheibenberg gehörte, dann durch Kauf an die albertinischen Wettiner (40014).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In
seinen Acta privata hielt Bergrat Johann Georg von
Wichmannshausen in Freiberg die folgende Beschreibung der Umgrenzung des
Scheibenberg'er Bergreviers fest (40001, Nr. 2864, Vol.
II, Blatt 11ff, Punkt 50):
„Das Berg Amts Refier ist folgende: 1. Von Hause aus gegen OR. reinet es mit dem Berg Amte zu Annaberg so weit das Amt Schlettau seine Reinung hat, außerhalb der Dörfer und Güther so Schönburgisch gewesen, als von den Hermannsdorfer, Schlettauer und Walthersdorfer Güthern an und auf den Herrnschacht (?) bis hinaus an Crotendorf und hierüber nach Neuendorf, wo sich die Scheubenbergische Reinung anführet und von der Weißen Sehma über Neudorf bis ans Mutze (?) Reinung, da die Schönburgische Refier wendet (?) und gehören unter diesen Bezirk Unter Wiesenthal, Neudorf, Crottendorf, Oberscheibe, Mittweyde und die Hälfte der Dörfer Pöhla und Rittersgrün. 2. Zwischen OR. und ME. gehet die Reinung an die Böhmische Grenze mit dem Berg Amte zu Preßnitz und bis hinauf in Unter und Ober Wiesenthal, am Fichtelberg da das Waßer hinauf zwischen der (?) Böhmen, den Heerzug zu Schlackenwerda, und dem Sachsen reinet. 3. Von dannen seithalb von ME. gegen OCC. reinet es auf der Platten mit dem Wiesenthaler und halb die Gottesgaber Reinung, hinter dem Fichtelberg an der Grenze hinein, wo die Dritte Reinung überlauft ? bis jenseits des gebürges nach dem (?) zu, hinunter nach dem Pöhlwasser. 4. Hält das Pöhlwasser, so überder Burckhartsleithen entspringt, zwischen dem Berg Amte Schwarzenberg und den Rein gegen OCC zu von der Rittersgrün an, durch die Pöhla, Grünstädtel und im Wasser hinauf bis Raschau an Mönnigs Steig mit den Bergämtern Schnee- und Annaberg. 5. Gegen SE. rainet es mit dem Geyerschen Bergamte, (?) an der alten (?) Reinung von Greogor Meyern über die Zwönitz und hinauf bis an die 3. (Zechen?) seitwärts zwischen Morgen bis wieder nach dem Dörffel zu. 6. zwischen denen Berg Ämtern Schnee- Annaberg und Scheibenberg hält die Landstraße von dem Städtlein Zwönitz und selbiger (?) hinauf an Fürstenberg bis oben an Mönnigs Steig und von da in die Raschau, hernach über selbige Güter und den Münzerberg hinüber bis an die gewesene Schönburgische Reinung mit dem Berg Amt Annaberg den Rein. Würde also im Berg Amt Scheibenberg im ganzen Amte Crottendorf ingleichen in der alten (Leinischen?) Refier auf alle Metalle und Mineralien, dergleichen wie im Berg Amte Annaberg erblich Lehn allein auf Eisenstein und was sonst für gemein und alleine zum Eisenstein bemerklichen Lehn seyn, als Zechen Häusern, Waßer, Pochwercke und Sturzplätze verleyen. Ob auch wohl Dörfel vor diesen zum Amte Crotendorf gehörig gewesen, nach dem aber das Berg Amt zu Annaberg dargethan, daß es daselbst seit dem Vorherigen über recht verwahrte Zeit in (?), so soll es auch hinführo bey selbigem Amte, wohin dessen Refier enthalten, ferner bleiben. Mehr gehört zu diesem Berg Amte Hohnstein, woselbst das Schwarzwasser und Mulde zwischen der Aue, Zell und Clösterlein den Rein mit dem Bergamte Schneeberg allenthalben hinunter, auch über der Mulde, so weit der Herr von Schönburg Güther begriffen und sich ihre Herrschaften erstrecken, als Stein, Hartenstein, Tiefenstein, Glauchau, Waldenburg und Penig, in welcher ganzen Schönburgischen Refier der Bergmeister zu Schneeberg vermöge des de ao. 1529 aufgerichteten Vertrages zwischen dem Hause Sachsen und denen Schönburgschen Herren auf alle Metalle und Mineralien zu verleyen hat.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Wahrnehmung der Bergbaurechte in dieser Region gestaltete sich freilich auch danach immer schwierig, da sowohl der sächsische Herzog und spätere Kurfürst in seiner Eigenschaft als Lehnsherr und Inhaber des Bergregals auf edle Metalle, als auch die Schönburger als Landesherren und Inhaber der Bergbaurechte an den unedlen Metalle Rechte innehatten, deren Art und Umfang freilich von jeder Seite unterschiedlich ausgelegt werden konnten. Deutlich wird diese Gemengelage auch an der Entwicklung der Bergämter. Nach dem Auffinden von Silber bei Elterlein um 1460 statteten die Schönburgischen Landesherren die Siedlung 1489 mit Stadtrechten aus und richteten wenig später ein eigenständiges Bergamt in Elterlein ein, dem weitere Bergämter in Hohenstein (vermutlich um 1529), in Oberwiesenthal (kurz vor 1530) und eben in Scheibenberg (1530) folgten, wohin das Bergamt Elterlein dann verlegt wurde. Die Bedeutung Scheibenbergs nahm in dieser Zeit zunächst schnell zu, was auch darin Ausdruck fand, daß das von den Wettinern und den Schönburgern gemeinsam betriebene Bergamt Hohenstein (Hohenstein- Ernstthal) sowie das ursprünglich eigenständig von den Schönburgern gegründete und betriebene Bergamt Lößnitz auf Anordnung von Kurfürst Johann Georg, des I. ab 1617 dem Bergamt Scheibenberg unterstellt wurden, in das man nur zwei Jahre später auch noch Oberwiesenthal als Unterbergamt integrierte. Zeitweise verwaltete der Bergmeister in Scheibenberg sogar die entsprechende Stelle in Schwarzenberg (40014). Infolge der mehrfachen Umstrukturierungen gab es schon immer auch Revierstreitigkeiten zwischen den Bergmeistern in Scheibenberg, Schneeberg und Schwarzenberg, namentlich wegen Eisensteinverleihungen. In der Gegend der Oswaldkirche und am Emmler sind solche Streitfälle zum Beispiel aus dem Jahr 1650 und erneut 1698 dokumentiert (40012, Nr. 1156). Tatsächlich ist bis zum Hauptrezeß zwischen dem wettinischen Fürstenhaus in Dresden und den Fürsten von Schönburg- Glauchau- Waldenburg im Jahr 1740 das in der schönburgischen Grafschaft Hartenstein gelegene Scheibenberg noch unter schönburgischer Bergverwaltung geblieben, obwohl der oberwäldische Teil der Grafschaft ja bereits 1559 durch Kauf in den Besitz der Wettiner übergegangen war. Die Eigenständigkeit der schönburgischen Bergämter als Verwaltungseinheiten blieb darüber hinaus sogar noch weiter bestehen. Auch die Bergmeister im Bergamt Scheibenberg mit dessen Unterbergämtern Hohenstein und Oberwiesenthal wurden noch eine Zeitlang vom Gesamthaus Glauchau besoldet (30572, Nr. 5341).Bergrat von Wichmannshausen notierte in seinen Acta privata dazu unter Punkt 44. (40001, Nr. 2864, Vol. II, Blatt 8): „Die Hrn. von Schönburg bekommen in dasigem Bergamte den 3ten Pfennig von den Zehenden Gebühren, so von dem allda brechenden (Symbole) Silber und Kupfer abgestattet wird, von Eisen aber bekommen sie nichts, darvor müßen sie auch zu des Bergmeisters Besoldung den 3ten Pfennig geben.“ Bergrat von Wichmannshausen fügte dem noch hinzu: „Und zwar bekommen sie ⅓ derer Zehenden Gebühren aus Scheubenberger u. Wiesenthaler Berg Amts Refier vermöge Recesses, so gedachte (?) mit dem Churhause Sachsen anno 1529 errichtet fol. 17, dere sub no. 48 cit. OBAmt Acten de anno 1718“ Im Hauptrezeß von 1740 war auch schon festgelegt, daß „die Scheibenberg. Bergbeamten (...) von dem Ober Zehndner im Obergebürge als zugleich gemeinschftl. Berg Beamten derer (?) von Schönburg laut Receß vom 19. Mai 1740 in Pflicht genommen (werden).“ (40001, Nr. 2864, Vol. II, Rückseite Blatt 8, Punkt 53.) Die Bergamtsstube befand sich ursprünglich im Rathaus in Scheibenberg. Ab 1764 erhielt der Bergmeister Michael Hermann Enderlein aus der obergebirgischen Quatemberkasse „vor Haldung der Berg Amtsstube und des Archivs in seinem Hause zu Scheubenberg“ von diesem Jahr an 6 Thaler Zuschuß (40001, Nr. 2864, Vol. II, Rückseite Blatt 8, Punkt 45.). Nachdem sich der Schwerpunkt des Bergbaus im weiteren Verlauf verlagert hatte, wurde ab 1767 das bis dahin noch eigenständige Revier Scheibenberg mit seinen Unterrevieren Oberwiesenthal und Hohenstein mit dem Bergamt Annaberg „kombiniert“ und damit dem kursächsischen Bergmeister in Annaberg die Oberaufsicht über das (vormals schönburgische) Bergamt Scheibenberg übertragen. 1787 hatten die noch bestehenden drei Unterreviere Scheibenberg, Hohenstein und Oberwiesenthal immerhin noch insgesamt 220 Mann in Arbeit, von denen 95 im Scheibenberg'er Revier anfuhren (40014). Im Jahr 1772 wurde das alte Revier Schwarzenberg aufgelöst und der südliche Teil mit dem Revier Johanngeorgenstadt, der nördliche und westliche Teil mit dem Bergamt Schneeberg vereinigt. Ab diesem Zeitpunkt grenzten unterhalb von Langenberg folglich drei Reviere, nämlich Johanngeorgenstadt mit Schwarzenberg, Schneeberg mit Eibenstock und Voigtsberg und Annaberg mit Scheibenberg, Oberwiesenthal und Hohenstein aneinander. Erst 1856 wurde die Bergverwaltung für das Westerzgebirge dann erneut in Schwarzenberg zusammengefaßt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Bergbauverwaltung der Region um Schwarzenberg können wir im 10. Band des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ lesen: „Das Schneeberger Revier wurde gleich anfangs sehr bestimmt abgegrenzt, und auf den Radius einer großen Bannmeile gesetzt, so daß es noch Vielau, Zwönitz, Grünhain, Eibenstock, Kirchberg u. s. w. einschloß. Aus diesem Cirkel fielen zwar in Folge des grimmaischen Machtspruches 1531 alle schönburgschen Orte hinweg; dagegen erweiterte dasselbe der Ankauf von Schwarzenberg 1553, von Ober- Hartenstein 1559 und von den Planitzer Gütern 1563. Nach einigem Zwist mit den Bergämtern Schwarzenberg und Eibenstock machte Kurfürst August das Schwarzwasser und die Griese bei Lauter, so wie die Straße von Sosa über Bockau nach Schwarzenberg zur Grenze. 1591 vereinigte man mit hiesigem Revier den neustädter und voigtländischen Kreis, bis letzterer 1676 wieder davon getrennt wurde. 1673 wurde der Mönchssteig bei Grünhayn und Raschau zur Grenze gegen die Bergämter Annaberg und Scheibenberg gewählt, wodurch Schneeberg bei Raschau treffliche Gebäude erwarb. 1819 wurden die beiden voigtländischen Bergamtsreviere Voigtsberg und Falkenstein mit dem Schneebergischen vereinigt, wodurch letzteres eines der weitläufigsten in Sachsen ward.“ Große Teile des Graul mit den Gruben Gottes Geschick und Catharina sowie der Knochen mit den Kieszechen auf dem Allerheiligen Zug und selbst das Kalkwerk auf dem Emmler fielen damit dem Bergamt in Schneeberg zu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damit war aber längst
noch keine Klarheit zwischen den Behörden geschaffen: Die Streitereien um die
Ausübung der Berggerichtsbarkeit zogen sich noch bis 1806 hin und füllen
weitere Akten (40014, Nr. 214). So beschwerte sich etwa Christian Gottlob
Schubert, Schichtmeister in Raschau, am 20. April 1805 beim Bergamt in
Scheibenberg, daß bei der Eisensteingrube Grüner Zweig am Graul ein neuer
Schacht geteuft werden solle, dies aber von dem Besitzer der Vitriolwerke in
Beierfeld und am Graul, auch Eigentümer der Grube Stamm Asser am Graul,
Christian Friedrich Köhler, behindert werde (40014, Nr. 214, Blatt 1).
Eine andere Anzeige des Schichtmeisters Christian Andreas Richter der
Grube Vertrau auf Gott am Graul vom 12. November desselben Jahres besagt,
daß der Schichtmeister von Stamm Asser ihn am Vermessen des dort
ausgebrachten Eisensteins gehindert und ihn sogar unter Androhung der
Inhaftnahme des Platzes verwiesen habe (40014, Nr. 214, Blatt 42). Das Bergamt
zu Schneeberg sah sich daraufhin genötigt, am 5. Mai 1806 festzulegen, daß,
bevor höchste Resolution hierzu eingehe, zunächst alles beim status quo bleiben
solle und kein Eisenstein zu vermessen sei. Auch Herr Köhler erhielt
Anweisung, er solle sich
„der Demolirung der bey diesen Eisensteinzechen (...) vorhandenen
Einrichtungen und Baue“ und des Anmaßens des ausgeförderten Eisensteins oder
anderer Exzesse enthalten. Inzwischen wurde auch Bericht an das Oberbergamt
erstattet und
da man das offenbar in Freiberg nicht wußte, fragte man am 27. November 1805 in
Scheibenberg nach, wohin denn eigentlich der Zehnte der Eisensteingruben in dem
Stück Graul’er Gebirge, welches ,ehedem zur Abtey Grünhayn gehört hat',
entrichtet werde
(40014, Nr. 214, Blatt 66).
In dem daraufhin folgenden Schriftverkehr zwischen den Bergämtern Schneeberg, Annaberg mit Scheibenberg und dem Oberbergamt zu Freiberg haben wir verschiedene, schon ältere Weisungen gefunden, die den Streitparteien jeweils als Beilagen dienten. Weil sie am ältesten ist, zitieren wir zunächst die Anlage (40014, Nr. 214, Blatt 61): „sub. O.“ „Demnach der Chursächs. Bergmeister zu St. Annabergk, Hr. Gottfried Leonhardt, dato erinnert, wie Ihme zwar wissend, daß der Scheibenbergische Bergmeister auf seiner Refier, und zwar nur was Grünhaynisch und Aebtisch Lehn, alleine auf Eisenstein zu verleihen berechtiget sey, dieser aber sich unternehme, solche Verleihung auf Zechenhäuser, Waßer und Pochwerke zu extendiren, darbey gebothen, hierinnen befürderen Dingen nach Ober Bergamts wegen gebührende Weisung zu thun, als wird uf eingezogene Erkundigung, vergangener gnüglicher Verhör des Bergmeisters zu Scheibenberg und producirte Scheibenbergische Refier de dato den 8ten October 1619 hiermit zum Bescheidt: Daß wir aus nur allegirter Berg Amts Refier mit klaren, ausdrücklichen Worten zu befinden: An denen Ende, so Grünhaynisch und Aebtisch Lehn in solchem Bezirk mit begriffen ist, verleiht er, außer die Huthhäuser, Waßer, Pochwerke, Hütten, Sturz Plätze und was sonsten für gemeine Berg Lehn seyn mögen, auff keine andern Metalle, als auff Eisen. Der Bergmeister zu Scheibenberg in der Annabergischen Refier, anderen Orthen, so Grünhaynisch oder Aebtisch Lehn, item am Fürstenberg, nicht allein auf Eisenstein, sondern auch die Zechenhäuser, Wasser, Pochwerke, Stürz Plätze und was sonsten für gemeine Lehn seyn, zu verleihen, keineswegs aber auf andere Metalle oder die Verleihung in die übrige dem Berg Amte zu Annaberg eingegebene Refier zu extendiren, befugt. Publiciret zu St. Annaberg, ao. 1613“
Churfürstl. Sächs. befohlener Rath und Vice Berg Hauptmann
Mit dieser Anweisung wurde zunächst einmal das dazumal noch schönburgische Bergamt gestärkt; wurde doch ausdrücklich erklärt, daß der Bergmeister zu Scheibenberg alles, ,was sonsten für gemeine Berg Lehn seyn mögen' verleihen dürfe, mit der einen wesentlichen Ausnahme: Dies galt nur im Amt Grünhain und ausschließlich für Eisensteinzechen. Wie man dann dem folgenden Aktenauszug entnehmen kann, war die Grenze zwischen den Bergrevieren Schneeberg und Scheibenberg schon 1649 nach Osten verlegt worden, so daß die Gruben am Graul bereits damals unter die Jurisdikation des ersteren gefallen sind (40014, Nr. 214, Blatt 34f): „sub C.“ „Zu wißen sey hiermit, denen es nöthig, daß heute dato vor dem Churfürstl. Ober Bergamt, die zwischen dem jetzigen Bergmeister zu Schneeberg, Andreas Gönnern, und Bergmeister zum Scheibenberg, Christoph Dittrichen, seither wegen des Eisenstein Verleihens sich enthaltenden Differentien nach genugsamen Verhör beyder Theilen, folgender Gestalt abgehandelt und (versichert?) worden; Es verbleibet nemlich bey dem am 30. April ao. 1649 hierinnen ergangenen Churfürstl. gnädigsten Befehl, daß ein jedweder Bergmeister, vermöge Churfürstl. Begnadigung in seiner eingeräumten Refier, alle Metalle und also der Bergmeister zum Schneeberg gleichfalls darinnen, bis an den Fahrweg nach St. Oßwald und dem Emler auf Eisenstein bergüblich zu verleihen Macht haben soll. Derweil aber obgedachter Bergmeister zu Scheibenberg dargethan, daß ihme hierdurch ein Guttheil an der Grünhaynischen und Schönburgischen Refier, vor welchen er alten Brauch nach, dem Oberförster zum Grünhayn jährl. 20 (floren?) entrichten müßte, abgingen, dahero der Bergmeister zu Schneeberg auch nicht unbillig ein Theil von solchen jährlichen 20 (floren?) auf sich nähme, wiewohl jetziger Zeit bey gar geringer Einnahme es sehr schwer fiele. Als soll hinführ gedachter Bergmeister zu Schneeberg dem Grünhaynischen Oberförster, bis etwa deshalben eine Erleichterung zu erlangen, den halben Theil als 10 (floren?) zahlen, darzu denn die von solchen Eisenstein Zechen einkommende Muth-, Bestätigungs-, Verschreibe-, Receß- und Vermeß- Gelder mit brauchen mag, mit welchen auch andere dergl. es (ewigem?) Gebrauch nach, wie es der Bergmeister zu Scheibenberg gehalten, verbleiben soll. Wenn dann beyde Theile also zufrieden gewesen, als sind alle diesfalls entstandene Irrungen gänzlich beygeleget, diese Abhandlung in gegenwärtigen Receß verfaßt und unter unserer eigenhändigen Subscription jeder der Theile zu laßener Nachricht zugestellet, auch sich beyderseits hinführe dem Gebühr nach, schied- und friedlich allenthalben zu vergleichen, oberbergamtswegen anbefohlen worden. Actum Schneeberg, den 15. Juliy ao. 1650“ Für das Oberbergamt zeichneten dieses Schreiben Abraham von Schönberg und Theodor Siegel. Der ,Fahrweg nach St. Oßwald' war schon nicht mehr der Mönchssteig, sondern die alte Grünhainer Straße... Damit war der gesamte Graul und Teile der Heyde unter Schneeberg'ische Bergverwaltung gekommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem ungeachtet verlieh der Bergmeister in Scheibenberg, anfangs des 19. Jahrhunderts Johann Karl Schütz, aber offenbar weiter Eisensteinzechen am Graul und das paßte natürlich dem Bergmeister zu Schneeberg, zu dieser Zeit Ludwig Heinrich Kabisch, natürlich überhaupt nicht, zumal sich daraus oben erwähnte Feldstreitigkeiten mit den Silber- und Kieszechen am Graul, namentlich Stamm Asser, ergaben. Schließlich erging hierzu ein Entscheid der kurfürstlichen Kammer, den das Oberbergamt am 11. Juni 1806 nach Schneeberg und nach Scheibenberg mitteilte: Man überwies das gesamte Graul'er Gebirge nunmehr endgültig an das Bergamt Schneeberg. Nebenbei ist von Interesse, daß dieser Entscheid ausdrücklich auch ,Eisensteinflöße' mit einschloß, auf die ja am Fürstenberg bei Waschleithe ‒ auch auf vormals Grünhain'er Klosterland ‒ mehrere Gruben bauten. Jedenfalls wurde nun dem Bergamt in Scheibenberg verordnet (40014, Nr. 214, Blatt 74ff): „1.) sich fürs künftige in dem durch das höchste Rescript vom 24. Febr. 1786 an das Bergamt Schneeberg überwiesene Stück des Grauler Gebürges allen Verleihens auf Eisenstein, sowohl aller Aufsicht über den dortigen Eisenstein Bergbau und der Ausübung der Berggerichtsbarkeit allda gänzlich zu enthalten und solche dem Bergamte Schneeberg zu überlaßen. 2.) an Letzeres sämtliche, den besagten Eisensteinbergbau betreffende Acten, (...) im Originale, ingleichen die concernirenden Risse und Register (...) auszuantworten (...), nicht weniger 3.) letztgenannte Eigenlehner hiervon allenthalben das Nöthige zu eröffnen und solche ebenfalls an das Bergamt Schneeberg zu verweisen...“ Das wurde natürlich auch den Eigenlehnern der Eisenstein- Gruben mitgeteilt und aus dieser Liste erfahren wir noch, daß die Überweisung nach Schneeberg zu diesem Zeitpunkt die folgenden Eisenstein- Gruben am Graul und auf der Heyde betroffen hat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1847 wurden dann die Bergamtsreviere Marienberg und Annaberg vereinigt; Sitz des Bergamts wurde zunächst Annaberg (40007). Bei der Neuordnung der westsächsischen Bergamtsbezirke im Jahre 1856 wurden die Bergämter Johanngeorgenstadt und Schneeberg aufgelöst. 1856 wurde auch der Sitz des vereinigten Annaberg'er (dessen östlicher Teil) und Marienberg'er Bergreviers wieder nach Marienberg verlegt. Die westliche Hälfte des Annaberg'er Reviers mit seinen Unterrevieren Oberwiesenthal, Scheibenberg und Hohenstein wurde dagegen dem wiedererrichteten Bergamt Schwarzenberg zugeteilt. Das Schwarzenberg'er Revier umfaßte nun das vereinigte Revier Johanngeorgenstadt- Schwarzenberg- Eibenstock, das Schneeberg'er Revier mit der Voigtsberg'er Abteilung sowie vom ehemaligen Bergamt Annaberg die Revierabteilungen Scheibenberg, Hohenstein- Ernstthal und Oberwiesenthal. Diese Gliederung hatte noch bis zur Auflösung der Bergämter infolge der Inkraftsetzung des 1. Allgemeinen Berggesetzes im Königreich Sachsen 1869 Bestand (40052, 40014).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die uns aus den Akten dieser Zeit bekannt gewordenen Bergmeister im Bergamt zu Scheibenberg waren:
Bei einer Revision der Bergämter Annaberg und Scheibenberg durch den Berghauptmann von Heynitz im Jahr 1780 fand dieser allerdings, daß unter den Bergmeistern Enderlein und Fischer die „gute Ordnung“ verloren gegangen sei (40001, Nr. 120). Die Bergamtsstube befand sich noch im Wohnhaus des inzwischen pensionierten Bergmeisters Enderlein, sei aber in einem „dem Einfall drohenden“ Zustand. Auch für das Aktenrepertorium des Bergamtes fand Berghauptmann von Heynitz nur Kritik. Über die belegten Bergwerke im Bergamtsbezirk Scheibenberg steht in seinem Revisionsbericht, daß sie sich „zum Theil in sehr schlechtem Umtrieb befinden, auch zum Theil von weniger Hoffnung sind (wie denn einige derselben bishero blos, um denen Schichtmeistern Lohn zu verschaffen, und denen Beamten die Gebühren anzuziehen, betrieben zu seyn scheinen).“ Das ist ein hartes Urteil... Ab Luciae 1767 ist Scheibenberg mit Annaberg kombiniert gewesen (40001, Nr. 2864, Rückseite Blatt 36) und die im Folgenden genannten Personen waren zum Teil, spätestens aber ab 1820, in Personalunion für beide Bergämter zuständig.
Als Geschworene fungierten in dieser Zeit im Bergamt (später im Unterrevier bzw. der Revierabteilung) Scheibenberg:
Sowohl die Enderlein’s, als auch die Familie Bock waren auch selbst im Bergbau als Lehnträger oder Miteigentümer von Gruben aktiv. Während der Zugehörigkeit des früheren Bergamtsreviers Scheibenberg zum Bergamtsbezirk Schwarzenberg ab dessen Neugründung 1856 war hier als Geschworener tätig:
Bekanntlich wurden infolge der Inkraftsetzung des Allgemeinen Berggesetzes für das Königreich Sachsen ab 1869 die Bergämter aufgehoben. Aus dem Oberbergamt in Freiberg wurde das Landesbergamt gebildet und für die Beaufsichtigung der Betriebe in den einzelnen Revieren wurden mehrere Berginspektionen geschaffen ‒ die für den Berginspektionsbezirk Schneeberg regional zuständige hatte ihren Sitz in Zwickau. In dieser Zeit waren hier u. a. tätig:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Geschichte einzelner Grubengebäude
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vater Abraham
bei Oberscheibe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir verlassen nun zunächst den Höhenzug
des Emmler, um auf diejenige Eisensteingrube einzugehen, die von allen im
Weiteren noch angeführten Bergwerken in dieser Region wohl am längsten
durchgehend in Betrieb gestanden hat: Die Grube Vater Abraham,
südwestlich von Oberscheibe gelegen und dem Emmlerrücken quasi gegenüber.
Hier baute man nie Manganerz, sondern ausschließlich Eisenerz ab.
In den Erzlieferungsextrakten des kombinierten Annaberg'er Bergreviers (40166, Nr. 1, 22 und 26) wird sie schon ab 1677 aufgeführt und sie stand noch bis 1862 ‒ also für 185 Jahre !! ‒ mehr oder weniger kontinuierlich in Ausbringen. Da sie von Beginn an im Besitz von Hammerherren gewesen ist, ist die Grube auch in den Zehntenabrechnungen des Bergamtes für die ab 1770 bestehende Hammerwerksinspektion in Schneeberg regelmäßig aufgeführt (40022, Nr. 346, 459 und Nr. 460). Wenn auch die Überlieferungen zu anderen Gruben oft größere Lücken aufweisen, so hat doch keine einzige Eisenerzgrube am Emmler nachweisbar eine längere, durchgehende Betriebszeit vorzuweisen. Wohl wissend, daß unser Bericht selbst in der Beschränkung auf den Eisen- und Manganerzbergbau des Schwarzbachtals keineswegs allumfassend sein kann, gehört diese bedeutende Grube doch zum hiesigen Eisensteinbergbau unbedingt dazu und soll aus eben diesem Grund auch vorangestellt sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine in einer Auflistung alter Verleihungen im Zuständigkeitsbereich des Bergamtes zu Scheibenberg enthaltene Eintragung sagt uns dann, daß wenigstens ab 1673 die Familie von Elterlein auch hier in Oberscheibe im Bergbau engagiert gewesen ist. Darin heißt es (40014, Nr. 15, Film 0032 des Digitalisats, letzte Eintragung auf der linken Seite): „Wolff Samsohn von Elterlein verliehen den 23. Nov (?) 2 lehn auf 1 posten auf des Richters Christoff Schuffenhauser zu oberscheibe, wo vor dies Kalchstein gebrochen, solchen zu Eisenflößen zu gebrauchen, auch sonst alle Metalle und Minerale, wo frey felt ist, best. den 6. Dec (ohne Jahreszahl, aber Eintragungen aus dem Jahr 1673)“ Tatsächlich liegt die Grube Vater Abraham ja westlich unterhalb des Kalksteinbruchs in Oberscheibe und wie hier zu lesen steht, war Herr Wolf Samson von Elterlein natürlich auch an den „Flößen“ nur allzu sehr interessiert. Leider werden in dieser Liste die Namen, unter denen die Gruben verliehen worden sind, nicht genannt. Wie wir aus einer späteren Eintragung in derselben Akte noch erfahren haben, hatte damals das Amt des Richters in Oberscheibe eigentlich Georg Valentin Schuffenhauer inne. Vielleicht bestand einer der Gründe dafür, daß sich die Familie von Elterlein neu orientierte und sich nun auch in Oberscheibe im Eisenerzbergbau engagierte, ja darin, daß das Hammerwerk Obermittweida mehrfach durch Hochwasser (u. a. auch 1661) und durch Brände (u. a. 1613, 1667, 1673 und 1724) schwer beschädigt worden ist. Das führte offenbar sogar dazu, daß das Bergamt zu Scheibenberg bereits verliehene Baufelder (nach Einholung der Erlaubnis von höherer Stelle) wieder an Dritte vergab, wie folgende Notiz des Bergmeisters aus dem Jahr 1660 zeigt (40014, Nr. 15, Film 0013, linke Seite): „weil die Eisenstein Lehne zum (?) Hammerwergk gehörig nicht erblich, nur lehne (sind), solchen Hammer vorbehalten worden sind, weil der doch in grund abgewüstet, auch in viel langen iahren (?) eisen allda gemachet worden ist, darneben (?) wegen holz mangel es (nicht?) iede gangbar gemachet werden könne, also ist (?) unterthänigster bericht an Ihre Churf. Durchl. de dato 25. Jan. ergangen, worauf am 28. Febr. ein gnäd. Befehl eröffnet dahin, (daß) solche lehne iedem andern für frey verliehen und bestätigt (werden können) was den 2. und 9. April zu Schwarzenberg und Scheibenberg mäniglich subliciert worden,“ Georg Dietrich, B. M. Neben Verwüstungen (durch Feuer und Naturereignisse) wird hier vom Scheibenberg'er Bergmeister Georg Dietrich aber auch der Mangel an Brennholz als ein Grund dafür angeführt, daß die Eisenhämmer gar nicht mehr so viel Eisenerz verarbeiten konnten und die Besitzer deshalb die ihnen verliehenen Baufelder unangegriffen liegenließen. Aus dem Jahr 1676 stammt dann die folgende Eintragung in derselben Akte (40014, Nr. 15, Film 0035 des Digitalisats, 4. Eintragung auf der rechten Seite): „Wolff Samsohn von Elterlein verliehen den 5. Octb: Nehmlich eine Kunst und Zeuggefälle, Radstube Rösche, sambt des waßerlaufs, auch alles einfallende quelle und gesprenges (schwer leserlich ?) und der Ober Scheibner Gemeinde und selbiger (?) Erbgüter und wiese, zu seiner Eisenstein Zeche allda, wie er solches alles seinem besten nach nutze und brauche und die Churf. intraden fördern kann, best. den 19 dito.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während in der Eintragung aus dem Jahr 1673 ausdrücklich die Rede von den „zu gebrauchenden Flößen“ ist, besaß derselbe Muter vier Jahre später dagegen in Oberscheibe eine eigene Eisensteinzeche. Ob es vielleicht dieselbe Grube gewesen ist, die zuvor auf Kalkstein verliehen gewesen, aber auf Eisenstein fündig geworden ist, geht hieraus nicht hervor. Die Anlage eines ersten Stollns bei Vater Abraham sowie der ersten Radkunst, um unter dieser Stollnsohle abbauen zu können, geht demnach aber schon auf den hier erneut als Lehnsnehmer genannten Wolf Samson von Elterlein zurück. Der Abbau muß sich offenbar rentiert haben, denn bereits im Folgejahr 1677 erweiterte Herr von Elterlein noch einmal sein Abbaufeld, und diesmal gleich um 8 Lehne (40014, Nr. 15, Film 0036 des Digitalisats, 3. Eintragung auf der linken Seite): „Wolff Samsohn von Elterlein verliehen den 16. Januar 1677 8 lehn auf 3 posten auf oberscheibner, seinem vorigen felt allda zum besten, wo frey felt ist, best. den 30. dito.“ Und auch im Folgejahr 1678 wurde das Baufeld der Eisensteinzeche noch einmal vergrößert (40014, Nr. 15, Film 0037 des Digitalisats, 1. Eintragung auf der linken Seite): „Wolff Samsohn von Elterlein verliehen den 31. Marty 11 Lehn auf 4 posten auf Michel Müllers und Meyers zur Ober Scheibe, die solches vorhin in lehn gehabt und also seines itzigen felt zum besten, best. den 14. April.“ Zählen wir kurz zusammen, dann waren das bis hierhin 21 Lehn auf 8 Posten. Der finanziell ja nicht schlecht situierte Hammerherr (zu dieser Zeit u. a. noch im Besitz des späteren Nietzschhammers in Obermittweida) nahm nun also auch anderen Bergbautreibenden deren dort zuvor schon innegehabten Felder ab... Dies wiederholte sich erneut im Folgejahr 1679 (40014, Nr. 15, Film 0038 des Digitalisats, 1. Eintragung auf der linken Seite): „Wolff Samsohn von Elterlein verliehen den 30. Marty ein Fundgrub auf ein streichenden Eisenstein gang, auf Abraham Schumanns und Hans Dörffers (?) zu (Ober... im Falz verdeckt) Scheibe erbgute, seinem alten felt zum besten, auf Eisenstein und alle metalle, best. den 13. April.“ Die zweite der folgenden Eintragungen aus dem Jahr 1686 weist dann auf den Baubeginn des tiefen Stollens bei der Grube Vater Abraham hin (40014, Nr. 15, Film 0045 des Digitalisats, 4. Eintragung auf der rechten Seite): „Rosine von Elterlein verliehen den 8. Aug. 1 fundgrub und obere 2 maße auf Eisenstein und alle metalle und min. auf dem Pfarrgut und andern angelegenen Gütern in Markersbach, in freyem felt, best. den 22. dito. Ingleichen ihr verliehen den 4. Sept. einen Erbstolln auf der ober Scheibner Gemeinde anzusetzen im Dorff und hinauf gegen ihre allda habende Zeche zu treiben, auf Eisenstein und alle metalle und minerale, so damitt überfahren werden möchten, best. in freyem felt den 18. eig.“ Schau an: Auch die Gattin Rosine von Elterlein mußte nun für die Verleihungen herhalten... Dies war aber durchaus gängiges Vorgehen der Lehnsträger, um bei einem eventuell vorzeitigen Ableben die Witwe durch eigene Belehnungen an ertragreichen Gruben dann versorgt zu wissen. Neben den 21 Lehn besaßen die von Elterlein's nun also auch zwei Fundgruben nebst zwei oberen Maßen und das Erbstollnrecht für ihre Grube.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir haben die Grube
Vater Abraham auch in einer Auflistung alter Grubenaufstände aus
den Jahren ab 1680 gefunden (40014, Nr. 12, Film 0005, zweite
Eintragung rechts oben), wo sie unter der Rubrik
Eisensteinzechen und Berggebäude im Quartal Reminiscere 1681 (und
danach fast durchgehend fortlaufend) aufgeführt ist.
Hier heißt es über die Grube:
„Vater Abraham uf d ober Scheibner hat d Steiger diß quartal weg manglung der Waßer mehr nicht als 10 fud Eisenstein gefördert, ist aufgange 22 th. 16 gr. 10 pf. und vorhin Receß 737 th 8 gr 2 pf thut izo nach abzug des Eisensteins 20 th – gr – pf 752 th.10 gr. – pf.“ Die Register führte damals ein Schichtmeister Andreas Kriniz (Name aber schlecht leserlich). Steiger war ein Hans Weigel. Daß sie ‒ wie man hier liest ‒ wegen Mangels an Wasser nicht soviel, wie sonst fördern konnten, kann nur bedeuten, daß es bereits damals ein Kunstgezeug zur Wasserhaltung auf dieser Grube gegeben hat, für das es offenbar im Winter nicht genug Aufschlagwasser gab. Identische Abschriften dieser Aufstände sind auch in den Oberbergamtsakten hinterlegt (40001, Nr. 160, Blatt 18ff), allerdings fehlen in diesen Kopien einige Quartale.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wahrscheinlich war die Grube Vater
Abraham in dieser Zeit tatsächlich nur mit dem Steiger und zeitweise
mit noch einem zweiten Bergarbeiter belegt. Im folgenden Quartal
Trinitatis 1681 nämlich steht in dieser Liste geschrieben (40014, Nr. 12, Film 0007, zweite Eintragung links oben sowie 40001, Nr. 160, Film 0039):
„Vater Abraham uf d ober Scheibner ist diß quartal ½ lachter in Kunstschacht abgeteufet und mit dem Steiger und 1 arbeiter 10 fud Eisenstein gewonnen worden...“ Die beiden wurden nach Gedinge bezahlt, wie man der Eintragung aus dem Quartal Crucis 1681 entnehmen kann (40014, Nr. 12, Film 0009, zweite Eintragung links unten sowie 40001, Nr. 160, Film 0043): „ist diß quartal von Steiger u. arbeiter 25 fud Eisenstein in geding á 1 th – gefördert worden...“ Zusammen mit Holz und Schmiedekosten ergaben sich daraus Betriebskosten im Quartal von 30 Thalern, 9 Groschen und 10 Pfennigen, welche „nach abzug des Eisensteins auch Quat. Zehnten und Lade gelt“ dem Gruben- Rezeß aufgeschlagen wurden. Luciae 1681 betrug das Ausbringen noch einmal 20 Fuder, die Gesamtförderung im Jahr 1681 summierte sich also auf 65 Fuder Eisenstein. Diese Zahl ist allerdings um 22 Fuder größer, als die in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22) für dieses Jahr genannte Zahl. Möglicherweise ist in den Extrakten also nicht die abgebaute und geförderte, sondern nur die verkaufte und abgelieferte Menge angegeben. Reminiscere 1682 wurden ebenfalls 20 Fuder ausgebracht, Trinitatis 1682 waren es 15 Fuder, und Crucis 1682 wurden 25 Fuder Eisenstein gefördert. Ein klein wenig ausführlicher ist dann die Eintragung aus dem Quartal Luciae 1682 (40014, Nr. 12, Film 0017, vierte Eintragung links oben): „Vater Abraham zur Ober Scheibe hat der Steiger und 1 arbeiter in disen 4tel mehr nicht, als 10 fud Eisenstein in sehr festem gestein mit hauen gewonnen, schiebet die Kunst an Tag 70 Lachter in felte und ist der schacht 12 lachter tief, und viel grundwaßer vorhanden, ist ufgegangen 14 th 14 gr 10 pf hierzu voriger Receß 848 th 5 gr – pf zusammen verbleibet nach abzug des Quart. Zehnden Receß 853 th. 19 gr.” Als Schichtmeister und Steiger waren dieselben auch weiter tätig. Zählen wir die hier genannten Zahlen wieder zusammen, kommen wir auf 70 Fuder Förderung in diesem Jahr. Diese Zahl überschreitet nun doch ziemlich deutlich die in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22) für das Jahr 1682 genannte Menge von 33½ Fudern Ausbringen. Nach der obigen Beschreibung stand das Antriebsrad der Wasserkunst damals noch ,an Tag' ‒ also übertage ‒ und trieb das Pumpengestänge in dem 12 Lachter tiefen Kunst- und Förderschacht über ein 70 Lachter langes Feldgestänge an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1683 wurden in gleicher
Weise 25 Fuder gefördert. Trinitatis 1683 ist keine Förderung angegeben,
stattdessen heißt es (40014, Nr. 12, Film 0021, erste Eintragung links oben):
„hat der Steiger den alten Schacht ausgewechseld und mitt 1 arbeiter 3
lachter abgeteuffet in festen gestein.“
Der Tageschacht war damit nun 15 Lachter (zirka 30 m) tief geworden. Als Steiger wird jetzt ein Hans Georg Baumann genannt, der Schichtmeister blieb derselbe. Crucis 1683 wurden dann wieder 15 Fuder und Luciae 1683 wurden noch einmal 20 Fuder Eisenstein zutage gefördert, womit nach dieser Quelle das Ausbringen im ganzen Jahr 1683 bei 60 Fudern gelegen hat. Auch diese Menge weicht von der in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22) genannten Zahl von gerade einmal 15 Fudern sehr deutlich ab. Wie auch zuvor, reichte der erzielte Verkaufspreis für das ausgebrachte Erz aber nicht aus, um sämtliche Betriebskosten zu decken, so daß der Grubenrezeß weiter auf nun 916 Thaler, 13 Groschen und 10 Pfennige am Schluß des Jahres 1683 angewachsen war. Diese Kosten trugen der Lehnträger und seine Gesellenschaft. So ging es auch im folgenden Jahr 1684 weiter: Reminiscere und Trinitatis wurden je 20 Fuder, Crucis dann 25 Fuder Eisenstein durch den Steiger und einen Bergarbeiter gefördert. Ab Crucis 1684 wird als Steiger ein Herr Christoff Hendel (Name aber schwer leserlich) anstelle des vorherigen genannt. Im letzten Quartal dieses Jahres heißt es dann (40014, Nr. 12, Film 0033, zweite Eintragung links oben): „Vater Abraham zur Ober Scheibe ist diß 4tel uf d Zeche nicht gearbeitet, eine ganz neue große Kunst gebauet, die (...?), ist ufgangen 100 th – gr – pf hierzu voriger receß… 1.041 th...“ Die Groschen und Pfennig- Beträge des aufgelaufenen Rezesses sind im Heftfalz verdeckt. Eine neue Wasserkunst ‒ das macht die fast vervierfachten Betriebskosten bei fehlendem Ausbringen verständlich... Und dann reichte auch die neue Kunst nicht einmal aus, wie man im Quartal Reminiscere 1685 liest (40014, Nr. 12, Film 0034, zweite Eintragung rechts oben): „Vater Abraham zur Ober Scheiben hat die Kunst die waßer zu sumpf nicht zwingen können, ist aber in frist und baulichen wesen erhalten und diß quarthal aufgangen 8 th 14 gr 6 pf hierzu voriger receß 1041 th 9 gr 6 pf thut zusammen 1.050 th 3 gr – pf Andreas Kriniz S. M. Christoff Hendel (?) St.“ Das Jahr 1685 wurde auch weiterhin kein gutes Jahr für diese Grube. Auf Trinitatis trug der Bergschreiber ein (40014, Nr. 12, Film 0036, erste Eintragung links oben): „Vater Abraham zur Ober Scheiben ist diß 4tel der Kunstschacht durch Steiger und arbeiter ausgewechselt, die örter gesäubert, aber kein Eisenstein gefördert worden, ...“ Und auch im Quartal Crucis liest man (40014, Nr. 12, Film 0037, dritte Eintragung links oben): „Vater Abraham zur Ober Scheiben ist diß 4tel durch Steiger und arbeiter in selbigen Kunstschacht 3 lachter abgeteufet, auch etwas Eisenstein gewonnen worden, so noch unvermeßen in Stein bett (?) lieget, ...“ Luciae 1685 heißt es (40014, Nr. 12, Film 0038, fünfte Eintragung links von unten): „ist durch 2 arbeiter das verbrochene orth gewältiget und gezimmert, auch in Schacht ausgewechselt worden, ...“ Auch die Steigerstelle wurde neu besetzt: Hier ist jetzt ein Herr Oßwalt Fridrich als solcher angeführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Jahr 1686 begann dann wieder mit
einer hier ausgewiesenen, vergleichsweise beachtlichen Förderung von 50
Fudern Eisenstein im Quartal Reminiscere. Für den Abbau und die Förderung
zu Tage erhielten der Steiger und ein Bergarbeiter jetzt einen etwas
angestiegenen Gedingelohn von 1 Thl., 3 Groschen pro Fuder
(40014, Nr. 12, Film 0040,
vierte Eintragung links oben).
Als Grubensteiger wird schon wieder ein neuer Name genannt: Diese Stellung
hatte nun ein Herr Michael Lang inne. Schichtmeister blieb
Andreas Krinitz.
Den offenkundigen Problemen, den Grubenwässern beizukommen, war dann eine grundsätzliche Entscheidung der Gewerken zum Weiterbetrieb der Grube geschuldet, die in diesem Jahr gefallen ist. Trinitatis 1686 liest man im Grubenaufstand (40014, Nr. 12, Film 0042, erste Eintragung links oben): „Vater Abraham zur Ober Scheiben hat der Steiger und 2 arbeiter eine Rösche zur waßersseige (?) aufgefahren in geding 18 (?) lachter und ein schächtel gesunken...“ Und im folgenden Quartal ist über die Arbeiten auf der Grube Vater Abraham festgehalten (40014, Nr. 12, Film 0043, erste Eintragung rechts oben), weil „die (?) grundwaßer durch die Kunst nicht mehr können gezwungen werden, so ist ein Stolln angefangen dahin zu treiben und an seine anbrüche...“ Der Bau des Wasserlösestollns hatte also begonnen. Auch Luciae 1686 heißt es dazu (40014, Nr. 12, Film 0044, vierte Eintragung rechts von unten), daß man hier „hat waßer nötigkeit wegen nicht gebauet werden können. Daher von Steiger neuer Stolln diß orths 14 lachter in geding á 1 th – gr ufgefahren worden, ...“ Ob es nur ein Schreibfehler war, daß als Steiger nun ein Herr Hans Lang angeführt wurde, können wir nicht wissen. Auch Reminiscere 1687 ist im Aufstand nur vermerkt, es werde nun ein Stolln heran getrieben und die Grube in Rezeß erhalten. Der war inzwischen auf 1.230 Thaler, 1 Groschen und 8 Pfennige angewachsen, zumal ja auch kein Erzverkauf mehr gegengerechnet werden konnte. Trinitatis 1687 heißt es noch einmal (40014, Nr. 12, Film 0052, fünfte Eintragung links von unten): „Vater Abraham hatt der Steiger und Karrn läufer in geding 5 lachter ufn Stolln aufgefahren und die stroß söhlig nachgehauen, ist ufgangen 50 th 15 gr ...“ Da waren es schon 1.280 Thaler und 16 Groschen Rezeß geworden. Crucis 1687 ist vermerkt, daß die Grube keine Register mehr einlege. Man sparte sich wohl die Bürokratie und das teure Papier.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Eintragung eines Aufstands
zur Grube Vater Abraham folgt in dieser Auflistung dann tatsächlich
erst Trinitatis 1688. Dann heißt
es (40014, Nr. 12, Film 0060, zweite Eintragung rechts oben): „Vater
Abraham zur Ober Scheiben hat der Steiger und 3 arbeiter 38 lachter diß
4tel ufn Stolln gesäubert, ist aufgangen 75 th 20 gr 6 pf ...“
Die Belegschaft hatte sich also gegenüber früheren Zeiten glatt verdoppelt und auch als Steiger wird mit einem Herrn Hans Fridrich jetzt schon wieder ein neuer Name genannt. Das Ziel war aber noch lange nicht erreicht. Crucis 1688 „hat der steiger diß 4tel mitt 3 arbeitern ufn Stolln gesäubert, auch ein Tag Schacht von 11 lachtern gewältiget, ...“ (40014, Nr. 12, Film 0062, dritte Eintragung links von unten) und auch über das letzte Quartal 1687 liest man hier (40014, Nr. 12, Film 0063, dritte Eintragung rechts oben): „ist der Stolln mitt 3 arbeitern 15 lachter in diesem 4tel gewältiget, aber noch nicht für orthe kommen.“ In Anbetracht der hohen Betriebskosten von über 75 Thalern pro Quartal und fehlenden Ausbringens war aber auch der Grubenrezeß weiter auf inzwischen 1.801 Thaler, 9 Groschen, 5 Pfennige angewachsen... Reminiscere 1689 hatte man weitere 13 Lachter „in alter weiß gesäubert“ (40014, Nr. 12, Film 0066, links oben). Trinitatis fehlt eine Eintragung in der Liste der Aufstände und Crucis 1689 heißt es nur knapp, man habe weiter auf dem Stolln gebaut (40014, Nr. 12, Film 0068, links unten). Im letzten Quartal dieses Jahres wurde notiert: „Vater Abraham zur Ober Scheiben hat der Steiger und 3 arbeiter zeither ufn Stolln in frischem gearbeitet und 7 Lachter aufgefahren und durch Gottes Hülff feine anbrüche an Eisenstein überfahren, woraus künftig der hohen Ambts (...?) berg quartals Intraden können gefördert werden...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächsten Eintragungen stammen dann
aus dem Quartal Reminiscere
1690. Jetzt heißt es über diese Grube: „Vater Abraham zur Ober Scheiben
hat der Steiger und 3 arbeiter aufn Stolln 30 fud Eisenstein gefördert in
geding uf 1 Th 4 gr darüber 8 Lachter ufn Stolln gesäubert...“
(40014, Nr. 12, Film 0071, Mitte rechts)
Und natürlich stieg durch diese
bedeutende Investition in den zukünftigen Grubenbetrieb ‒ obwohl es jetzt
auch wieder ein Eisenerz- Ausbringen gab ‒ auch der Grubenrezeß stetig
weiter an.
Im folgenden Quartal wird die insgesamt aufgefahrene Stollnlänge erstmals und zwar mit 193 Lachtern (rund 386 m) beziffert (40014, Nr. 12, Film 0072, links oben). Auch Crucis 1690 „hat der steiger und 3 arbeiter in disen quartal ufn Stolln 15 fud Eisenstein in geding á 1 Thl. – Gr. gewonnen und sonst für Stollnort ist weiter aufgefahren...“ (40014, Nr. 12, Film 0074, Mitte rechts) Die „Berg Kost“ erreichte jetzt mit 2.357 Thalern, 15 Groschen und 8 Pfennigen einen ersten Höchststand. Luciae 1690 wurden durch den Steiger mit vier Mann Belegschaft noch einmal 30 Fuder Eisenstein gefördert. Außerdem wurde auch noch ein neuer Schacht „in hangenden uf 8 Lachter gesunken.“ (40014, Nr. 12, Film 0074, Mitte rechts) Addieren wir diese Angaben zum Ausbringen, so kommen wir mit 75 Fudern im Jahr 1690 erneut auf eine wesentliche größere Menge, als in den Erzlieferungsextrakten für diese Grube in diesem Jahr angegeben ist (27 Fuder, vgl. 40166, Nr. 22). Reminiscere 1691 wird die aufgefahrene Stollnlänge mit 200 Lachtern (zirka 400 m) angegeben (40014, Nr. 12, Film 0077, links unten). Außerdem wurden in diesem Quartal auch 70 Fuder Eisenstein zutage gefördert. Die Gedingekosten sind auf 1 Thaler, 3 Groschen wieder leicht gesunken. Andreas Krinitz war nach wie vor der Schichtmeister und Hanns Fridrich Steiger. Vielleicht aufgrund des jetzt wieder regelmäßigen Ausbringens wird der Receß „nach abzug der Churf. Intraden“ in diesem Quartal nur noch mit 1.480 Thalern, 4 Groschen und 2 Pfennigen beziffert. Trinitatis 1691 heißt es wieder knapp, der Steiger habe mit 2 Arbeitern das Stollnort 7 Lachter fortgestellt, „aber dis 4tel nichts von Eisenstein gefördert.“ (40014, Nr. 12, Film 0078, Mitte rechts) Vor den gleichartigen Notizen zum folgenden Quartal sind in der Akte noch etwas ausführlichere Berichte eingeheftet, die offenbar anläßlich der Anwesenheit von Vertretern des Oberbergamtes in Schwarzenberg zusammengestellt worden sind (40014, Nr. 12, Film 0079ff):
Aufstände und berichte bey der Churf. Sächs.
Hohen bergk Commission Wie üblich, wurde wieder zuerst über die auf Silber und Kupfer bauenden Zechen berichtet. Dann heißt es weiter: „Anlangend die Eisenstein Zechen, welche zum theil wirklich gebauet werden von denen Hrn. Hammermeistern, die ebenfalls bei der heutigen Hochwohllöbl. Bergk Commission zu erscheinen bergamtswegen beschieden sind, belegt, auch theils in receß gehalten werden, ist folgend ufstand (?) zu nehmen.“ Offenbar hatten also die Besitzer und Lehnträger der Gruben persönlich in Schwarzenberg zu erscheinen. Über die Grube Vater Abraham ist hierin festgehalten (40014, Nr. 12, Film 0081, links oben): „Vater Abraham zur Ober Scheiben sind feine anbrüche von gemeinem Eisenstein vorhanden und (?) anbrüchig, hat auch izo (...?) die Fr. von Elterlein wittichen obermittweyde hammer, hat baut (?) diß wergks einen kostbaren tiefen Erbstolln, uf etzlich hundt lachter gewältigen und hinan treiben laßen, aber in die Zeche noch nicht durchschlägig, ist receß Trin. 91: 2534 th 17 gr 1 pf Andreas Kriniz S. M.“ Obwohl die Gesamtlänge des Stollns inzwischen 207 Lachter betrug, war er demnach noch immer nicht in die eigentliche Grube eingekommen ! Die beträchtlichen Kosten für den Stollnvortrieb trug der Lehnträger, als welcher hier die inzwischen die verwitwete Frau von Elterlein benannt wird, dazumal noch auf dem Obermittweida'er Hammerwerk ansässig. In der nachfolgenden Auflistung für das Quartal Crucis 1691 heißt es (40014, Nr. 12, Film 0082, links oben): „ist der Stolln vom mundloch 213 lachter izo sind 3 lichtlöcher gesunken uf 12 lachter tief, hoffen für ort (?) Eisenstein anbrüche zu haben...“ Die Anbrüche hat man offenbar beim Stollnvortrieb gefunden, den man schon im Streichen des damals bekannten Lagers vom Tal her angesetzt hatte. Denn Luciae 1691 heißt es im Grubenaufstand (40014, Nr. 12, Film 0083, rechts oben): „Vater Abraham zur Ober Scheiben hat der Steiger und 1 arbeiter 55 fud Eisenstein diß 4tel in geding á 1 th 3 gr gewonnen ufn berg ort diß Stollns...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im ersten Quartal 1692 waren es dann aber wieder nur
noch 15 Fuder Förderung
(40014, Nr. 12, Film 0085, Mitte links sowie 40001,
Nr. 160, Film 0056).
Auch liest man, es seien „die
Anbrüche schlecht.“ Selbst die Bezahlung des Gedinges pro
ausgefördertes Fuder Eisenerz wurde wieder um 3 Groschen geringer.
Trinitatis 1692 hat man noch einmal 25 Fuder Erz gefördert
(40014, Nr. 12, Film 0086, Mitte rechts
sowie 40001, Nr. 160, Film 0061), ab Crucis 1692 wurde die Grube dann aber mit 20 Groschen
Gebühren in Rezeß
gehalten (40014, Nr. 12, Film 0088, Mitte rechts
sowie 40001, Nr. 160, Film 0067).
Luciae 1692 heißt es im Grubenaufstand (40014, Nr. 12, Film 0092, Mitte rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0073): Vater Abraham zur Ober Scheibner. „Hat theils aus Mangelung Holtzes, theils und fürnehmlich aber weilen bey diesen finstren Zeiten die Arbeiter Belohnung nicht zureichen wollen, nicht belegt noch dieses Quartal gebauet werden können, ist aber in Receß erhalten worden mit 4 th 4 gr – pf. und vorhin Receß... gibt Summa 2.657 th 10 gr 3 pf. Andreas Kriniz Schichtmstr.” Anfang der 1690er Jahre hat offenbar auch der Bergschreiber, der diese Zusammenstellung führte, gewechselt, denn das Schriftbild änderte sich deutlich, wie folgender Ausriß aus einer der Textseiten zeigt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere und Trinitatis 1693 wird
die Grube Vater Abraham zu Oberscheibe in der Liste von Aufständen
nicht aufgeführt; offenbar sind keine Register eingelegt worden. Die
nächste Eintragung entstammt dem Quartal Crucis 1693
(40014, Nr. 12, Film 0104, oben rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0079).
Die Grube war wieder mit dem Steiger Johann Friedrich und drei
Arbeitern belegt, durch welche 55 Fuder Eisenstein, namentlich von
zwei
neu abgesunkenen Schächtlein, ausgebracht worden
sind. Als Schichtmeister zeichnete ab jetzt Herr Salomon Escher.
Luciae 1693 wurden 40 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen (40014, Nr. 12, Film 0108, oben rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0084). Das im vorigen Quartal begonnene Schächtchen wurde um 3½ Lachter verteuft und auch der Stolln wurde um 12 Lachter fortgestellt, er war aber „geradefort noch 55 Lachter ins Feldt zu treiben.“ Reminiscere 1694 heißt es im Grubenaufstand, man habe den tiefen Wasserlösestolln um weitere 2 Lachter erlängt, außerdem hatte man wieder 65 Fuder Eisenstein gefördert (40014, Nr. 12, Film 0113, oben links sowie 40001, Nr. 160, Film 0089f). Allerdings liest man auch: „Der Stolln ist nun 233 Lachter ins feldt getrieben und noch ungefähr 54 Lachter bis in das Kunst Gebäude aufzufahren. Sonsten sind vorn Stollnort starcke Wasser erschrothen, so daß fast unmöglich weiter fortzufahren, dahero anstalt zu einem neuen Lichtloch gemacht ist.“ Die Auffahrung des Stollns erwies sich also als sehr kostenintensiv, wodurch auch der Rezeß weiter auf nun 2.882 Thaler, 6 Groschen und 9 Pfennige angestiegen war. Besonders das neue Lichtloch beschäftigte die Belegschaft in der Folgezeit noch lange, denn sie konnten auch Trinitatis 1694 darin „Wassers halber nicht fortarbeiten.“ (40014, Nr. 12, Film 0116, oben rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0094) Crucis 1694 stockte man die Belegschaft um 2 Häuer auf, „welche anfänglich, weil die alzustarcken Wäßer sie zurück getrieben, einen aushieb gethan undt 6 Lachter aufn Stolln aufgefahren als man nun vermeinte, die Wäßer würdten nunmehro auf den neuen Lichtloch eher wegfallen, haben sie wieder abzuteufen angefangen, sindt aber dennoch wieder abgetrieben worden. Haben dahero 4 lachter vorgeschlagen und ein ander neu Lichtloch angefangen, die Wässer (?) zu halten, haben (...?) Das neue Lichtloch ist auf Abraham Schumanns Erbguth angefangen undt ist bey dem letzten abziehen befunden worden, daß von demselben bis an den alten Kunstschacht noch 60 Lachter aufzufahren. Man versucht aber, unterwegs an die Anbrüche zu kommen. Im übrigen sindt dieses Quartal 80 Fuder Eisenstein vermessen wordten.“ (40014, Nr. 12, Film 0119, oben rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0098) Auch Luciae 1694 gelang es nicht, eines der begonnenen Lichtlöcher bis auf den Stolln niederzubringen (40014, Nr. 12, Film 0123, oben links sowie 40001, Nr. 160, Film 0102). Die sechs Mann Belegschaft haben wieder auf den „vormahls gemeldten zwei Lichtlöchern gearbeitet, der Meinung, eines davon niederzubringen, als es aber der starcken Wässer halber unmöglich gewesen, haben sie das Stollnort wieder aufzufahren angefangen. Gott hat auch diese Arbeit gesegnet undt sindt numehro zum ersten Mahl Eisensteine auf diesem Stolln beschert, sindt dermahlen (?) vor Orth von der Fürste nieder die Anbrüche 1½ Elle hoch gehabt, welche sie auch über sich undt zur Rechten in Hangenden stehen lassen. Diese Anbrüche sindt etzliche Lachter fortkommen, haben sich aber doch vor Orth wieder verlohren, ohne (?) weil die Bergleuthe zu weit ins Liegende strecken. Sonsten sind vom Stollnort bis zu dem alten Kunstschacht noch 55 Lachter aufzufahren. Auch sindt dieses Quartal 110 Fuder Eisenstein mit vermessen worden.“ Diese Bemühungen kosteten in diesem Quartal über 208 Thaler, so daß ‒ obwohl es ja auch Einnahmen aus dem Eisensteinverkauf gegeben hat ‒ der Grubenrezeß weiter auf nun über 3.081 Thaler angestiegen ist. Daß allerdings das erste Mal Eisenstein auf der Stollnsohle gebrochen worden sei, kann nicht stimmen: Bereits 1689 hatte man mit dem Stolln Eisensteinanbrüche überfahren und 1691 heißt es ausdrücklich, der Eisenstein sei „ufn berg ort diß Stollns“ gewonnen worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bis Ende des ersten Quartals des Folgejahres 1695 trieb man den Stolln um weitere 4 Lachter vor (40014, Nr. 12, Film 0126f, unten rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0106). „Weil aber die geding und unkosten zu hoch kommen, hat man vermeint, bey diesen trocknen Winter Wettern das Lichtloch nieder zu bringen, welches aber der allzu starcken Grundtwäßer und harten Kälte halber unmöglich gewesen, hierauf haben sie aus dem neuen Förderschacht Eisenstein gefördert und davon 55 Fuder vermessen. Sonsten sind vorn Stollnort und von neuem Lichtloch noch 51 Lachter bis zum alten Kunstschacht aufzufahren.“ Trinitatis 1695 unterzeichnete nicht nur mit Johann Friedrich jun. ein neuer Schichtmeister (der Steiger wird nun als Johann Friedrich sen. benannt), man faßte auch einen neuen Plan (40014, Nr. 12, Film 0131, oben links sowie 40001, Nr. 160, Film 0110): Die Belegschaft hat „anfänglich etwas Eisenstein gefördert, (...) seither aber haben sie an dem Stolln nach dem Wochenlohn gearbeitet, welche Arbeit vor itzo nicht zu Register gebracht, weil die Bergleuthe noch nicht darauf abgerechnet, muß daher künftiges Quartal mit eingerechnet werden. Die Arbeith aber ist umb deswillen angefangen worden, weil man vermeinet, die Klüfte besser zu eröffnen undt die Wässer zufallen, damit das neue Lichtloch, welches anitzo am weiten gelegen, vollend möchte (?) niedergesunken werden. Dahero haben sie im Stolln zu beyden Seiten aufgehauen undt den Eisenstein nachgefahren, welchen sie (?) aufn Stolln getroffen haben. Obgleich sich nun gleich Wässer bey dieser Arbeith gefunden, dennoch haben solche nicht gantz und gar können gefället werden, dass man also nicht weiß, wie dieses Lichtloch anzugreifen, weil man es schon auf viele Weiße versucht und die Unkosten darauf (verursacht?) hat. Sonsten sind dieses Quartal 40 Fuder Eisenstein mit gefördert und vermessen worden.“ Man wollte also durch die Unterfahrung des Lichtlochs und den Abbau auf dem Lager das Gebirge auflockern, vielleicht auch wasserführende Klüfte antreffen, über die das Grundwasser dem Stolln zufallen und damit das Abteufen des Lichtlochs erleichtert werden sollte. Neu ist auch, daß die Arbeiter (zumindest für diese Tätigkeit) statt dem Gedinge- einen Wochenlohn erhielten. Dem Grubenaufstand auf Crucis 1695 zufolge hatte man dann den Plan, das Lichtloch auf den Stolln abzusinken, scheinbar fast schon ganz aufgegeben (40014, Nr. 12, Film 0136f, unten rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0115f), denn: „In dieser Stollnarbeit haben sie auf den Anbrüchen zu beyden Seiten aufgehauen, auch über sich gebrochen und sogleich etwas Eisenstein gewonnen, welcher das künftige Quartal vermessen und verrechnet werden soll. Weil man aber mit dieser Arbeit dem neuen Lichtloch nichts helfen können, indem die Wässer nicht niederzubringen gewesen, so hat man davon abgelassen, daß also das Lichtloch vergeblich angefangen undt die hiervon Unkosten umbsonst aufgebracht (?) worden.“ Aber dem Tüchtigen gehört bekanntlich das Glück. Man liest an dieser Stelle weiter: „Nach diesem hat man den alten Kunstschacht aufgemacht und gesäubert, dafür befunden, daß in dem obern Gebäude (?) die Grundtwaßer auff 55 Lachter (so weit ist der Stolln in (?) feldt noch zu treiben) in Klüften weggefallen. Nun hatte man also bald auf den alten Stroßen und Anbrüchen arbeiten und Eisenstein gewinnen können. Weil aber die Bergleuthe kein Wetter gehabt, haben sie einen neuen Förderschacht niedergesunken undt den alten Kunstschacht zum Wetterschacht erhalten müssen. Nachdem nun nemlich diese beyden Schächte gewältiget und verwahret, so sindt die Arbeiter vor itzo auf die Anbrüche geleget worden. Es stehet aber der Eisenstein so fest, daß man (ihm) allein mit Schlägel und Eisen nichts anhaben kann.“ Dieser Aufwand bewirkte aber auch wieder hohe Quartalskosten von über 186 Thalern und der Rezeß erreichte die Summe von 3.347 Tahlern und 17 Groschen. Im letzten Quartal dieses Jahres wurde die Mannschaft daher auf die Anbrüche im ,oberen Gebäude' (also am alten Kunstschacht) gelegt und wieder 90 Fuder Eisenstein gefördert und vermessen. Das Ausbringen half wirtschaften und der Rezeß stieg daher in diesem Quartal nur noch um 14 Thaler an (40014, Nr. 12, Film 0142 sowie 40001, Nr. 160, Film 0122). Dagegen blieb die weitere Ausrichtung erstmal liegen: „Mit dem Stolln und unterm neuen Lichtloch bleibet es in vorgen Standt.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber der Plan war nicht ad acta gelegt
und im nächsten Winter versuchte man es erneut. Reminiscere 1696 heißt es
zunächst im Aufstand
(40014, Nr. 12, Film 0145, unten rechts), die
Belegschaft habe „in
obern Gebäude auf den Anbrüchen gearbeitet, welches bey dem trockenen
Winter ganz ohne Wasser gewesen, dahero sie auch immer in die Teufe
getrachtet haben und sind etzliche Lachter tiefer, als die Alten gebauet,
gekommen. Die Anbrüche bleiben beständig und mächtig, aber dabey sehr
fest. (...) Sonsten sind dieses Quartal 115 Fuder Eisenstein mit
vermessen worden...“
Weiter liest man dann: „Inmittel hat man sich bemüht, die Wässer zu zwingen und das angefangene Lichtloch, welches schon sehr viel gekostet hat, herniederzubringen. Dahero sind 14 Bergleuthe angelegt worden, welche Tag und Nacht gearbeitet und die Wässer gehalten haben. Sie haben aber länger nicht als 2 Schichten arbeiten können. Denn als sie noch einige Lachter gesunken gehabt, ist das Wasser von neuem angestiegen und hat sie abgetrieben.“ Die hatten wirklich ein Problem: Wenn 14 Mann in drei Schichten (wahrscheinlich mit den dazumal üblichen Handpumpen) das Grundwasser nicht niederhalten konnten, dann kam schon richtig viel davon gelaufen... Freilich bildet der Westabhang des Scheibenberges unterhalb der Straße nach Crottendorf, wo die Grube baute, auch eine Quellmulde, in welcher nicht nur der Abrahamsbach entspringt und oberirdisch abläuft. Bis in die jüngste Zeit sorgten hier Fassungen und Brunnen noch für die Trinkwasserversorgung der unterhalb liegenden Orte. Wie so oft, erwies sich das Wasser auch hier gleichermaßen als „der Freund und der Feind des Bergmanns.“ Trinitatis 1696 konzentrierte man sich erstmal wieder auf die Erzförderung, brachte auch 100 Fuder zutage aus, wodurch der Gesamtrezeß in diesem Quartal nur noch um ganze 2 Thaler gegenüber dem vorigen aufwuchs (40014, Nr. 12, Film 0152, links oben). Er hatte mit über 3.386 Thalern aber auch seinen bisherigen Höchststand erreicht. Dennoch blieb man „förderhin aber (...) gesonnen, den Stolln undt das neue Lichtloch wieder zu belegen.“ Crucis 1696 wurden erneut 95 Fuder ausgebracht, wodurch trotz Quartalskosten von 113 Thalern erstmals seit langer Zeit der Gesamtrezeß um 15 Thaler sank (40014, Nr. 12, Film 0156, links oben). Dabei hatte man auch die Belegschaft wieder auf drei Häuer nebst dem Steiger reduziert. Auch im folgenden Quartal wurden aus dem „obern Gebäude, wo die Anbrüche, so Gott Lob, immer schön und beständig bleiben, 160 Fuder gefördert und vermessen.“ (40014, Nr. 12, Film 0160, Mitte links) Man war sich aber der Bedeutung des Stollens für den weiteren Grubenbetrieb bewußt und dachte daher auch weiter über eine Lösung für das Wasserproblem im zukünftigen Stollnlichtloch nach: „Ins künftige, geliebts Gott, soll zugleich aufm Stolln (wieder?) angelegt werden (...?) das Lichtloch mit über sich brechen wieder angefangen werden, damit man aufm Stolln wieder auffahren und arbeiten könne.“ Wenn man ,mit über sich brechen' fortfahren wollte, was ja ,von unten aufwärts' bedeutet, scheint man also das bisherige Tiefste des Lichtlochs nun vom Stolln aus anfahren zu wollen. Über Kopf gegen Wasser ‒ das könnte ein verdammt gefährlicher Plan sein...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Überhauen ist im ersten Quartal
1697 auch begonnen worden. Parallel wurden 80 Fuder Eisenstein gefördert
(40014, Nr. 12, Film 0164, rechts oben
sowie 40001, Nr. 160, Film 0127).
Der Rezeß ist seit Trinitatis 1696 auf nun noch 3.355 Thaler, 6 Groschen
und 7 Pfennige stetig etwas abgesunken.
Trinitatis 1697 startete man dann einen neuen Versuch (40014, Nr. 12, Film 0169, rechts oben sowie 40001, Nr. 160, Film 0131): Die Erzförderung wurde zwar fortgesetzt, aber man befaßte sich „daneben 3 Wochen mit auswechseln und über sich brechen (...). Weil man aber gerne das angefangene Lichtloch durchschlägig machen, und zu Stande bringen wollte, so hat man die Rothenberger Bergleuthe genommen und allhier angelegt, welche auch etzliche Schichten auf 3 3tel Tag und Nacht nebst denen Scheibner Bergleuthen gearbeitet, alleine, es ist unmöglich zu zwingen gewesen, sind dermahlen die Wässer stärcker worden und nicht zu halten gewesen, sind dahero diese Arbeiter abermahls abgetrieben worden, und weiß man fast nicht, wie dieses Lichtloch ferner zu rathen und zu helfen.“ Da diese Grube im gleichen Revier lag und zu dieser Zeit in Umgang stand, waren es vermutlich Kollegen von Arnold's Rothenberg bei Rittersgrün, die hier mit angepackt haben. Natürlich drückte der Aufwand an ,Man Power' auch die wirtschaftliche Bilanz und trotz eines Ausbringens von 105 Fudern überstiegen die Ausgaben in diesem Quartal wieder die Einnahmen, so daß der Rezeß wieder anstieg. Crucis 1697 setzte man das Übersichbrechen wieder fort, aber ohne Erfolg (40014, Nr. 12, Film 0174, Mitte links sowie 40001, Nr. 160, Film 0136): „Nun sind zwar durch solche Arbeit starcke Wasser erschrothen worden, dass auch die Arbeiter deswegen nicht weiter (?) können, sondern davon ablassen müssen. Es wollen aber doch die Wässer gänzlich nicht wegfallen...“ Luciae 1697 hielt dann auch noch ein Bruch ,am mittleren Lichtloch', der erst gewältigt werden mußte, die Arbeiten auf. Man hatte zwar auch wieder 60 Fuder Eisenstein gefördert; der blieb aber noch unvermessen in Vorrat liegen (40014, Nr. 12, Film 0178, Mitte links sowie 40001, Nr. 160, Film 0141). Reminiscere 1698 ist die Grube Vater Abraham in den Grubenaufständen des Bergamtes Scheibenberg nicht aufgeführt. Leider endet damit der Inhalt dieser Akte... Die Fortsetzung haben wir in den Akten des Oberbergamtes gefunden, wo die Abschrift des Aufstandes auf Reminiscere 1698 erhalten geblieben ist (40001, Nr. 160, Film 0146). Der Steiger und 3 Mann hatten „auf den Anbrüchen gearbeitet undt Eisenstein gefördert, auch deßen 125 Fuder mit vermeßen...“ Trinitatis 1698 liest man, mit gleicher Belegung habe man weiter auf den Anbrüchen gearbeitet und „endlich auf dem Stolln, so wandelbar geworden, auszuwechseln angefangen.“ (40001, Nr. 160, Film 0151f) Dasselbe ging auch noch Crucis 1698 vonstatten (40001, Nr. 160, Film 0157f). Vom Ausbringen hatte man 90 Fuder vermessen und weitere 40 Fuder im Vorrat behalten. Dank des stetigen Ausbringens stieg der Rezeß trotz der Ausbauerneuerung nicht wesentlich und blieb bei etwa 3.425 Thalern. Luciae 1698 schließlich liest man im Aufstand (40001, Nr. 160, Film 0163), man habe zwar weiter auf den Anbrüchen gearbeitet, doch seien diese „schmal, weile man der Nässe halber nicht tieffer bauen kann, dahero nun auff alle Weise dahin zu trachten ist, daß der Stolln undt das angefangne Lichtloch zum Standte gebracht werde, damit man die Wasser abführen und grundhafftig bauen könne.“ Trotzdem hatte man erneut auch 95 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen. Der Rezeß lag mit Schluß Luciae bei 3.409 Thalern, 7 Groschen und 8 Pfennigen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Jahr 1699 fehlen auch in der
Oberbergamtskopie sämtliche Grubenaufstände.
Reminiscere 1700 ist Vater Abraham aber wieder aufgeführt (40001, Nr. 160, Film 0169), allerdings heißt es nun: „Zu Anfang dieses Quartals hat es über den andern Lichtloch auffn Stolln einen gefährlichen Bruch gemacht, auch hernach gemeltes Lichtloch (?) übern Hauffen geworffen, daß mann einen neuen Schacht zu sinken anfangen müßen. Weil aber biß dato noch nichts wieder gewältiget noch (?), so kann vor ietzo weiter nichts biß zukünfftiges Quartals Rechnung davon gemeldet werden...“ Aua. Trotzdem hatte man zuvor noch 40 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen lassen. Als Steiger unterzeichnete nun ein Hanß Friedrich Friedrich und den Schichtmeister Salomon Escher zu bezahlen, scheint den Gewerken bei fehlendem Ausbringen zu teuer geworden zu sein, denn „werden die Register von der Gewerckschafft selbsten gehalten.“ Mit der Auswechslung der Zimmerung auf dem Stolln und der Gewältigung des Bruchs war man das ganze Quartal Trinitatis 1700 beschäftigt, doch es „hat aber doch nicht können gezwungen werden, ob es schon Tag undt Nacht getrieben werden.“ (40001, Nr. 160, Film 0175) Natürlich wuchs durch diesen Aufwand bei fehlenden Einnahmen aus dem Erzverkauf nun auch der Rezeß wieder an und hatte mit Schluß Trinitatis 1700 den Betrag von 3.769 Thalern, 4 Groschen und 10 Pfennigen erreicht. Auch Crucis 1700 war die Gewältigung noch immer nicht vollbracht, im Gegenteil heißt es im Aufstand (40001, Nr. 160, Film 0181): „Dieses Quartal ist die Grube mit 1 Steiger und 4 Häuern belegt geweßen, welche continuirlich mit den Bruch umbgangen. Ob man nun gleich mit dieser Arbeit dahin gebracht, daß man in undt übern Bruch den Durchschlag hätte machen undt die Wäßer durchführen können, so hat man doch wegen des lohsen Gebürges nicht trauen dürffen, weil es den Stolln hätte vollschieben undt den Bruch vergrößern mögen, welches man wahrgenommen, alß die Wäßer etzliche mahl mit Gewalt durchgerißen undt alles verschlämmt, sich aber auffs neue dabey allzeit wieder verbrochen und versetzet; dahero hat man müßen anfangen, die Wäßer von Tage nieder zu fällen und solche sachte abzuzäpfen, deßwegen haben die Bergkleuthe in neuen Schacht auffgehauen undt treiben biß dato ein Ort unter den andern gegen den Bruch.“ Die ganze Mühe kostete allein in diesem Quartal 104 Thaler, die dem Rezeß zugeschlagen wurden. Aufstände auf Luciae 1700 fehlen wieder auch in der Oberbergamtskopie. Die nächsten überlieferten Grubenaufstände entstammen dann dem Quartal Reminiscere 1701. Über Vater Abraham heißt es nun (40001, Nr. 160, Film 0189), man habe nebst dem Steiger jetzt 8 Bergarbeiter angelegt, von der 11. bis 13. Woche sogar 10 Bergleute. Mit dieser Belegung scheint man es nun endlich geschafft zu haben: Es wurden 19 Lachter gewältigt und ein Gesenk auf den Stolln durchgeschlagen, bis man die Wässer endlich „vollends abgeführt“ hatte; auch hatte man inzwischen 3 Lachter Schachtzimmerung im Oberen Schacht ausgewechselt. Und außerdem hatte man noch 20 Fuder Eisenstein zu Tage gefördert... Die Kosten dafür betrugen allerdings auch mehr als 193 Thaler, so daß der Rezeß nun wieder einen Betrag von 4.123 Thalern überschritt. Bis Ende Trinitatis 1701 sind 50 Lachter Stollnlänge gesäubert und die Zimmerung ausgewechselt, zugleich die Brüche auf dem Stolln durchfahren worden. Davon betroffen war also ungefähr ein Drittel der Gesamtlänge des Stollns (40001, Nr. 160, Film 0195). Zwei Arbeiter haben parallel am Förderschacht auch wieder 35 Fuder Eisenstein ausgehauen. Weil sich diese Anbrüche aber „nicht erstrecken wollen“ und man in die Tiefe noch nicht gelangen konnte, mußte man den Abbau dort vorerst wieder einstellen. Diesen Aufstand unterschrieb übrigens neben dem Steiger auch wieder Schichtmeister S. Escher.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Quartal Crucis 1701 berichtet
uns der Grubenaufstand über Vater Abraham (40001,
Nr. 160, Film 0200):
„Dieses Quartal ist diese Grube mit 1 Steiger und 6 Arbeiter belegt gewesen, welche theils aufm Stolln gesäubert, theils aber auf den Anbrüchen gearbeitet haben. Und nachdem nun der Bruch wieder gewältiget und die Wässer wieder abgeführet worden, laßen sich die Anbrüche so wohl für den Stolln Orth alß auch im Felde, Gott lob ! schön ansehen, nur daß der Stolln noch nicht völlig ausgewechselt ist… weilen man die Arbeiter wegen Mangelung des Eisensteins auf die Anbrüche legen müßen...“ Es waren immer noch 60 Lachter Stollnlänge bis zum oberen Förderschacht in Ordnung zu bringen, aber man hatte auch wieder 60 bis 70 Fuder Eisenstein im Vorrat. Der Rezeß ist auf 4.312 Thaler angestiegen. Aus dem letzten Quartal dieses Jahres existieren seltsamerweise zwei Fassungen mit unterschiedlichem Schriftbild (40001, Nr. 160, Film 0205 und 0210), von denen uns die zweite allerdings logischer erscheint. In dieser heißt es, mit derselben Belegung wie zuvor hatte man „6 Wochen in Wochenlohn aufm Stolln und 7 Wochen in Gedinge auffn Anbrüchen gearbeitet, den Stolln bis oberer Förderschacht wieder hergestellt und von dort 14 Lachter in frischen Feld getrieben.“ Dort stand das Lager 1½ Lachter, auch 2 Ellen mächtig auf der Sohle und an der Fürste an. Man hatte 140 bis 150 Fuder gewonnen, wovon 100 Fuder vermessen worden. Immerhin scheint der Stolln nun bis an den Förderschacht herangebracht worden zu sein. Danach besteht wieder einmal eine zeitliche Lücke in den Überlieferungen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der damalige Vize- Berggeschworene Johann Paulus Bock notierte dann Ende des Jahres 1711 über seine Befahrung der Grube ‒ allerdings reichlich knapp (40014, Nr. 53):
Fahrbogen „(...) Weiter gefahren aufm Vater Abraham auf der Ober Scheibe Arbeit in Geding auf Eisenstein ist Johann Friedrich mit geschoßnen Bauen 18 Lachter dief der Stolln von Mundloch biß vor Ort 300 Lachter aufgefahren der Gang ist ½ Elle, auch 3 Ellen mächtig.“ Der Geschworene befuhr diese Grube regelmäßig jeden Monat, seine Notizen dazu sind Anfang 1712 (Quartal Reminiscere) jedoch nahezu wortgleich. Anfangs des zweiten Quartals liest man dann einmal: „(...) weiter gefahren Vatter Abraham auf der Ober Scheibe, aber niemandt.“ Er hatte niemanden angetroffen, das heißt also, die Grube war zu dieser Zeit nicht belegt. Im Jahr 1727 wurde Erhardt Haustein im Oberbergamt Freiberg zum Vize- Obereinfahrer für den obergebirgischen Kreis bestellt. In seinen Fahrbögen haben wir noch zwei Erwähnungen der Vater Abraham Fundgrube zu Oberscheibe aus dem nachfolgenden Zeitraum gefunden. Er besuchte die Grube im Quartal Reminscere 1734 und berichtete darüber (40001, Nr. 2527, Blatt 62): „Vater Abraham Fundgrub in der Oberscheib. Dieses Gebäude ist vom Tage auf 20 Lachter abgebaut, kundte nicht biß auf die Sohle fahren, indem die Waßer 3 Lachter waren aufgegangen. Wurde der Bau itzo (?) flötz weiß fort geführet welche flötz von (?) eisen Stein. Hier wird ein tiefer Stollen auf 283 Lachter getrieben, welcher 30 Lachter Teufe ein bringt, noch 18 Lachter aufzufahren haben, ehe sie die fundgrube berühren, dieser Stolln ist mit 2 licht löchern versehen, dieses Gruben Gebäude muß mit vielen Holtz versehen werden, weil (guhriger?) Sand Stein sich allda befindet, die Arbeiter haben das geding und bekommen vor der Fuder eisen Stein 1 Thl. 2 Gr. hingegen müßen Eu. Wohllöbl. Gewerkschaft Pulver und Holtz darzu anschaffen, die Schmiedekosten, Berg Seil und gelichter tragen die Arbeiter, hier arbeiten 1 Steiger 8 häuer 3 Jungen.“ Auch ein Jahr später hatte der Vize- Obereinfahrer den falschen Zeitpunkt für seine Befahrung erwischt (40001, Nr. 2527, Rückseite Blatt 91): „Vater Abraham in der Ober Scheibe, in Scheibenberger berg Amts Revier. Hier ist der tag schacht auf 26 lachter biß auf die Stollnsohle abgesunken, stundten aber bey meiner befahrung die Waßer 3 Lachter hoch muß alßo sich ein (?) und brecht der eisen stein Flötz weiß…“ Der tiefe Stolln war nun 285 Lachter getrieben; noch immer war der Durchschlag aber nicht erreicht. Sonst ist der weitere Bericht praktisch gleichlautend zu dem vom Vorjahr. Vielleicht hätte Herr Haustein einfach mal in einem Sommerquartal vorbeikommen müssen ‒ weitere Fahrberichte über Vater Abraham finden sich in dieser Akte jedenfalls nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die in obiger Karte vermerkte Andreas
Fundgrube in Unterscheibe, welche möglicherweise auf einem Gegentrum dieser
Eisensteinlager nördlich des Tales baute, war inhalts der Akten des
Bergamtes Scheibenberg von 1739 an und noch im Jahr 1748 an den jetzigen Besitzer
des Obermittweida'er Hammers, Dr. Andreas Nitzsche, verliehen
(40014, Nr. 330 und 40014, Nr. 43, Blatt 19b).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Quartal Luciae 1741 stammt dann die
folgende Eintragung im Belehnungsbuch des Bergamts Scheibenberg (40014,
Nr. 43, Blatt 23b):
„Den 22. November ist Hrn. Christian Heinrich Richtern, Schichtmeister aufn Vater Abraham Eißenstein gebäude zu Oberscheibe, diesem gebäude und deßen beyden Herrn Gewercken zum Besten noch mehrer Feld zu den am 2ten Lujus (?) gelegten und auf recht und erblich vermeßnen Feld, an 14 neuen Lehnen, verliehen worden, dergestalt, daß da bey dem Vermeßen schon 3 Lehne mitgelegt sind, die übrigen 11 Lehne künftig vollends von der Viehtrift und dem daselbst befindlichen Pfahl an des Ganges Streichen nach 2 Lehne hoch sollen geleget werden.“ Erinnern wir uns kurz: Das Grubenfeld umfaßte 1678 eine Fläche von 21 Lehnen auf 8 Posten und wurde 1686 um zwei Fundgruben und zwei obere Maße vergrößert. Jetzt kamen noch einmal weitere 14 Lehne hinzu, womit wir bei 35 Lehn Grubenfeld wären ‒ zuzüglich der beiden Fundgruben und zweier oberer Maße. Gehen wir davon aus, daß man noch glaubte, auf einem zwar sehr flach fallenden, aber eben auf einem Gang zu bauen, so dürften die Fundgruben 1686 je 7 Lehne und die Maßen derer 4 umfaßt haben. Von beiden zwei waren damals bereits verliehen worden, so daß deren Fläche dann insgesamt 22 Lehnen entsprochen hat. Die Summe betrüge dann aber jetzt nur 57 Lehn. Nehmen wir umgekehrt an, daß 1686 Wolf Samson von Elterlein und seiner Gattin bereits gevierte Fundgruben und Maßen verliehen worden wären, dann wären dies zweimal 49 Lehn für die beiden Fundgruben zuzüglich weiterer 32 Lehn für die zwei oberen Maße gewesen ‒ wie man leicht sieht, überstiege die Summe deren Anzahl die im folgenden Bericht genannte Zahl von 86 alten Lehn deutlich. Irgendwo dazwischen wird die tatsächliche Verleihung also zu suchen sein... Ferner ist hier nun von zwei Gewerken die Rede. Dabei handelte es sich einerseits nach wie vor um die Familie von Elterlein, andererseits um oben schon erwähnten Andreas Nietzsche, welcher den Obermittweida'er Hammer inzwischen erworben und damit wohl auch einen Teil der Grubenanteile übernommen hat. Auch, wenn sie hier als ,Gewerken' bezeichnet werden, ist uns doch bislang kein Schriftstück bekannt geworden, aus dem hervorgeht, daß die früheren Alleinbesitzer aus der Familie von Elterlein die Grube vergewerkt hätten. Ganz sichere Quellenangaben gibt es zu diesem Thema zwar nicht, doch konnte tatsächlich auch ein Eigenlehner Anteile bzw. Kuxe an Dritte vergeben. Entscheidend war dabei, ob die Grube fündig ist oder nicht. Genauso kann von Anfang an eine Gewerkschaft den Bergbau betreiben und nie Erz finden. Der Unterschied besteht im Eintrag ins Lehnbuch: Wird eine Grube von vornherein gewerkschaftlich betrieben, müssen auch alle Mitglieder der Gewerkschaft als Anteilseigner mit der Anzahl ihrer Kuxe im Lehnbuch eingetragen werden. Fallen die Kuxe ins Retardat, entscheidet der Bergmeister, wie damit verfahren wird. Beim Eigenlehner lief das anders, denn er vergab die Kuxe gewissermaßen ,privat', es war ja keine Gewerkschaft. Damit hatte auch der Bergmeister kein Mitspracherecht. Es war eine fiktive Aufteilung unter Privatleuten. Man konnte dann, wenn es schiefgeht, auch nicht über das Bergamt seine Rechte einklagen, sondern nur privatrechtlich vom Eigenlehner Schadenersatz fordern (Informationen von Herrn U. Jaschik). Von nun an gingen die Erzlieferungen jedenfalls zu unterschiedlichen Anteilen an den Obermittweida’er Hammer und an die Hammerwerke in Rittersgrün und Pöhla, wo die Familie von Elterlein nun ansässig war. Über die Verteilung der hier genannten, nachgemuteten Abbauflächen und über den Ablauf des Vermessens belehrt uns der folgende Bericht, den wir ebenfalls in dieser Quelle gefunden haben und den wir hier gern vollständig zitieren wollen (40014, Nr. 43, Blatt 40ff): Reg. den 11. Oct. 1752 „Alß heutigen Tag anberaumt gewesen, auf der Vater Abraham Eißensteinzeche zu Oberscheibe wegen des an 86 alten und 3 neu gemutheten Lehnen am 2. Nov. 1741 mit verlohrener Schnur, iedoch erb- und eigenthümlich vermeßenen Feldes, die Lochsteine zu füllen, so haben sich an Seiten des Bergambtes zu Scheibenberg
Herr Bergmeister
Samuel Enderlein, an Seiten derer Gewercken, nehmlich
Herrn Christoph
Nietzschens und als zugleich hierzu Bevollmächtigte
Hr. Christian
Heinrich Richter, Schichtmeister und vormittags umb 8 Uhr auf diesen Lehnen eingefunden. Wie aber die Expedition vorgenommen und der 1te Lochstein unten bey der großen Halde auf Gotthelf Richters Acker gesezet werden sollte, wurde man gewahr, daß die ehemals eingeschlagenen Pfähle nicht mehr vorhanden, sondern herausgerissen waren, dahero das Vermeßen mit verlohrener Schnur nochmals mußte vor die Hand genommen und wieder viel Mühe und Accuratesse angewendet werden, daß die Lehne nach derjenigen Stunde und Lage, nach welcher sie nach der vorigen Registratur auf den gemachten Riß waren aufgetragen worden, wieder richtig gefunden und geleget werden konnten. Wie man nun auch damit wieder zur Richtigkeit gekommen, so wurde zur Füllung derer Lochsteine geschritten, und also in Gottes Nahmen Stunde 10 der 1te Lochstein, nach dem zuvörderst Kohlen und Glaß und also auch bey allen übrigfolgenden Lochsteinen waren hineingeleget worden, wobey der großen Hald auf Gotthilf Richters Feld vom Herrn bergmeister Samuel Enderlein mit beygefügten 2 Zeugen bedeutenden Nebensteinen, welcher gedachten 1ten Lochstein Gotthülff Krauße, Bergjunge auf diesem Eisensteingebäude, aus Crandorff gebürtig, mit befestigten Zapfen, und sodann von wohlgedachten Herrn Bergmeister Enderlein 2 Ohrfeigen zum Andencken bekam mit Bedeutung, daß er sich dieses Actus und dieses Lochsteins erinnere und künftig da es nöthig, gewissenhaftes Zeugniß darüber ablegen könnte, worauf er im Nahmen derer obbenannten Herren Gewercken vom Hrn. Schichtmeister Richter 2 sächs. Groschen zum Schmerzensgeld erhalte. Sodann wurden von diesem Lochstein lincker Hand querüber 7 Lachter, Stundt 4 gemeßen und auf der itzo eben gemachten kleinen Halde auf Richters Feld der 2te Lochstein gesezet. Von diesem Lochstein wurden 4 Lehne oder 28 Lachter scharf hinauf, noch auf Richters Feld, mit dem Feldweg rechter Hand, wo des Richters Feld und zugleich das 4te Lehen ausgehet, der 3te Lochstein gefüllet. Und von solchem über den Feldweg hinüber auf Schumanns Feld und auf einer alda befindlichen großen Halde 7 Lachter lincker Hand quer gezogen, allhiero auch ein Lochstein hätte sollen gesezet werden. Weil aber solcher Lochstein gleich auf dem Rand einer alten Binge gekommen wäre, wo nichts als lockere Berge befindlich, welche durch den Regen weggewaschen würden und der Lochstein in die Binge fiele, so ist allhier kein Lochstein gesezet worden. Hierauf wurden von dieser Halde noch 4 Lehn lincker Hand etwas scharf hinüber auf dem Schuhmannschen Feld nach Stunde 4 geleget und lada der 4te Lochstein gesezet. Von da wurden nach Stunde 10 hinaufwärts 8 Lehn an 56 Lachter vermeßenn und geleget, und der 5te Lochstein gesezet, von solchem wieder aus Schumanns Feld und über die Viehtrift hinüber und ferner auf Christian Frentzels Grund und Boden 7 Lehn á 49 Lachter gezogen und der 6te Lochstein auf etwas naßen Boden gesezet. Von solchem wurde lincker Hand etwas scharf Stundt 4 über die Viehtrift hinüber wiederumb alsdann auf Christian Schuhmanns Feld zusammen 5 Lehn hoch an 35 Lachter gemeßen und der 7te Lochstein gesezet. Sodann wurden nach Stunde 10 den Berg oder Acker herunter 7 Lehn an 49 Lachter gezogen und geleget und der 8te Lochstein gesezet, von welchem hernach 1 Lehn oder 7 Lachter nach Stund 4 lincker Hand querüber geleget und vermeßen und der 9te Lochstein und endlich die 8 Lehne an 56 Lachter nach Stunde 10 vollends herüber vermeßen, welche sich auf Gotthelf Richters Feld endigten allhiero der 10te Lochstein gefüllet wurde. Wobey zu gedenken, daß diese Lochsteine alle von schwartzer Wacken und oben ein + (ein Kreuz) in solche eingehauen gewesen, welches mit Röthel ausgestrichen worden und verpflichtete sich (unleserliche Passage ?) der Hr. Schichtmeister, solche auch nummeriren zu laßen. Daß also in allem 89 Lehne, als
6 einfache
Lehne unten herauf zwischen der großen und der itzo 48 Lehn an 8 Lehn hoch und 6 Lehn breit und 35 Lehn an 7 Lehn hoch und 5 Lehn breit Summa 89 Lehn. Wie beygeführter Riß ausweißet, vermeßen und verlochsteinet worden, wobey zu gedencken, daß unter diesen 89 Lehnen drey Lehne von denen jenigen 14 neuen Lehnen, welche nach der in denen dießfalls gehaltenen Acten befindlicher Registratur fol. 4 gemuthet und bestätigt wurden, mit darin begriffen, welche die damahligen, in der Registratur benannten Bevollmächtigten oben auf und von Frentzels Feld an von den aufn Riß zu sehenden 3ten Lehn und über die Viehtrift hinüber auf Christian Schuhmanns Feld, biß zum 7ten Lochstein geleget. Da aber nun noch 11 Lehn von denen neu gemutheten 14 Lehnen übrig und auch zu legen, zu vermeßen und zu verlochsteinen waren, und solches heute auch geschehen sollen, so meldeten der verpflichtete Schichtmeiser Richter und Steiger Rücker wie sie dieserhalb allerweit mit deren Herrn Gewercken ihre Meynung darüber vernehmen und sich sodann heute über 8 Lehne an Bergamts Stelle dieserhalb zuverläßig erklähren wollten, wie denn auch diese beyden versicherten, daß sie von ihren Herrn Gewercken mündlich wären bestellet worden, in ihrem Nahmen der heutigen Expedition beyzuwohnen und zu thun, was sie thun sollten und würden, welches alles, wie es würcklich obbeschriebenermaßen erfolget, fideliter anhero registriret worden von Johann Sigismund Abendroth, N. C. matr. jur. und Bergschreiber.“ Die Lage der hier noch unvermessen übrigen 11 Lehne wurde dann am 8. November 1752 festgelegt und im Bergamt registriert (40014, Nr. 43, Blatt 42). Besonders über die zwei Groschen ,Schmerzensgeld' haben wir uns beim Lesen amüsiert... Neu war uns dagegen der Brauch, die Lochsteine nach dem Setzen zu ,füllen' . Vielleicht hatte dies ja denselben Grund, wie der Brauch, daß Vermesser späterer Tage oft unter Grenzsteine einen Pfennig legten, um sicher zu gehen, daß sie niemand später ausgegraben und versetzt (und dabei gewiß den Pfennig nicht übersehen) habe. Freilich hätte man die offenliegende Füllung einfach wieder ins Loch hineinstecken können... Bei dem oben als Gewerke genannten Christoph Nietzsche handelte es bereits um einen der Söhne des Dr. Andreas Nietzsche, und zwar genau genommen, um Christoph Andreas Nietzsche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemerkungen zu
den Grubenfeldgrößen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offenbar war es im Bergamt Scheibenberg
auch noch immer Usus (zumindest im Flöß- und Eisenstein- Bergbau),
anstelle von Fundgruben und Maßen die althergebrachten Flächengrößen ,Lehen'
und ,Wehre' zu verwenden, was eigentlich bei den dieser recht
bedeutenden Grube insgesamt vergebenen Flächengrößen doch eher wenig Sinn
machte ‒ es sei denn, man wollte die Kontur der bestätigten Abbaufläche
vielleicht besonders gut an die erkundete Form der Lagerstätte anpassen
und wählte deshalb diese große Anzahl der recht kleinen Flächeneinheiten.
Da in obigem Text Zahlenangaben dazu aufgeführt sind und da sie uns noch
öfter begegnen werden, soll an dieser Stelle folgende kleine Tabelle diese
Begriffe erläutern.
*) Die in den einzelnen Bergamtsrevieren verwendeten Lachtermaße lagen gewöhnlich zwischen 1,7 m und etwas über 2,0 m, waren jedoch sämtlich verschieden und wurden erst ab 1830 auf das metrische Maß von 2,0 m normiert. Für diese Rechnung gehen wir vereinfachend von dem metrischen Maß aus. **) Die Breite der Grubenfelder auf streichenden Gängen war mit 3,5 Lachtern beiderseits des erschürften Ganges = insgesamt 7 Lachter in den meisten Revieren einheitlich, doch die Angaben zur Länge eines Fundgrub’ner Feldes schwanken selbst unter den sächsischen Bergrevieren zwischen 6 und rund 8,5 Lehn zu 7 Lachter Länge = 42 bis 60 Lachter Gesamtlänge. Auch die Länge der Maße auf einem streichenden Gang war nicht in allen Regionen einheitlich festgelegt.
Aus dem Verleihbuch des Bergamts Scheibenberg ist uns ferner in Zusammenhang mit der Kalkgewinnung in Crottendorf eine „ordinaire gevierdte Fundgrube, so 28 Lachter lang und 28 Lachter breit,“ bekannt geworden, welche also die Größe einer gevierten Maß besaß (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 31). Die identische Seitenlänge und quadratische Form kam wohl der Aneinanderreihung von Fundgruben und Maßen entgegen, denn in Akten aus dem 19. Jahrhundert haben wir auch von einer „Streckung“ der Fundgruben nach dem Streichen des aufgeschlossenen Lagers gelesen (40014, Nr. 191). Beschrieben wird, daß die eine Achse der Fundgrubenfläche 42 Lachter, die andere 28 Lachter umfaßte. Eine solche rechteckige Fundgrube hätte damit eine Grubenfeldfläche von 1.176 Quadratlachtern oder 4.704 m² beinhaltet, jedoch konnte es leichter zu Überscharflächen und Überschneidungen kommen, welche man dann wieder mit Lehnen und Wehren oder Überscharen auszugleichen suchte. Die im Bericht oben genannten 89 Lehn (am Ende ihrer Betriebszeit hatte die Grube Vater Abraham sogar glatt 100 Stück davon) entsprachen folglich einem verliehenen Grubenfeld von 17.444 m². Ungefähr dieselbe Fläche hätte man genauso gut auch mit einer einfachen Fundgrube und 21 Maßen oder mit einer gevierten Fundgrube und 2½ gevierten Maßen abdecken können. Insbesondere das noch lange vergebene ,Lehn' war doch eigentlich nur eine winzige Fläche, auf welcher der Lehnsträger gerade einmal einen Schacht absenken und ein wenig taube Berge aufhalden konnte. Unter heutigen Gesichtspunkten wäre das völlig unwirtschaftlich; aber da die meisten der weiter unten noch näher beschriebenen Zechen reine Eigenlehner- Gebäude gewesen sind, in denen zumeist anderswo angestellte Bergleute in Weilarbeit (quasi in Heimarbeit nach Feierabend) ihr Glück versuchten, machte dies offenbar Sinn. Vielleicht ist in der kleinen Flächeneinheit des
Lehns ja sogar der sprachliche Ursprung des Begriffs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein weiterer,
ausführlicher Fahrbericht entstammt den Generalbefahrungsregistraturen des
Oberbergamtes und datiert auf den 6. August 1750 (40001, Nr. 160,
Film 0219f). Darin heißt es über:
Vater Abraham Stolln in Oberscheibe. „Bey diesem Gebäude wird auf einem Flötz, so in Hauptstreichen hora 10 und 11 hat, gebauet, und hat selbiges iederzeit nur Nester oder Nieren weiße gut gethan, da denn von einem derer mächtigen Nieren viele Fuder Eisenstein gewonnen werden. Dieses Flötz ist mit einem Stolln, so (die Zahlenangabe fehlt) Ltr hergeholet, und durchgängig in gutem Holtz steht, gelöset und bringt selbiger aufn alten Tageschacht 22 Ltr. saiger, weiter ins Gebürge aber mehrere Teuffe ein. Gegenwärtig wird der Hauptbau 40 Ltr. vom tageschacht weg gegen Merid. Verführet, allwo das Flötz bey 2 Ltr. mächtig mit derben Eisen Stein unterm Stolln niederkömmt, so daß man im Gesencke von 2½ Ltr. lang anlegen, iedoch nicht mehr als 3 Ellen saiger absinken können, ehe die Waßer sich so häuffig gefunden, daß 2 Pumpen hinein gerichtet werden müßen, zu dem ist der Eisen Stein ferne hinter erstaunlich feste und in hintern Stoß hat er schon seine Endschafft erreicht, folglich ist auf diesen Bau keine sonderliche Reflexion zu machen. Von diesem Gesencke weg hat das Flötz übern Stolln dem angenommenen Streichen nach in hora 1 noch gegen 12 Ltr. gut gethan, wo sich dann der Stein ausgekeilet und daß Flöß dermaßen verschoben hat, daß man gegenwärtig noch nicht recht klug werden können, ob es durch Fäulen in die Höhe gezogen worden, und also über der Stollnförste stecke, oder sich wieder nach hora 9 oder 10 wieder in das Liegende gezogen haben möchte. Das letztere wurde von denen Berg Beamten sowohl als Schichtmeister und Steiger der Grube vor wahrscheinlich vermuthet und dahero auch nach solchen Flötz linker Hand in hora 6,4 OR. aufgefahren worden, ohne solches biß dato wieder auszurichten. Der andere Versuchsbau bestehet in einem unter dem ehemaligen Kunstschacht gesunkenen Lichtloch, so 8 Ltr. tieff, aus welchen man mit verschiedenen Versuchs Örtern nach dem Liegenden dieses Flötzes zwar fortgefahren, iedoch von Stein nichts sonderliches ausgerichtet, endlich auch mit dem einen Ort in alten Mann, so von dem Bau derer Alten aus dem alten Kunstschacht herüber war geschlagen. Bey diesen Umständen nun käme es darauf an, wie nehmlich diesem Wercke, da es ein erstaunlicher Holtzfreßer sey, mit Ausrichtung guten Eisensteins, damit sowohl Ihro Maj. ratione des Holtzaufwandes sowohl als auch bauende Gewerken Nutzen davon hätten, zu schaffen wäre? Zu diesem Ende denn Schichtmeister und Steiger zuvörderst ihre Meynung darüber entdecken sollen, da sie denn dafür hielten, daß es wegen des letztern Baus beßer gethan sey, wenn man diesen sogenannten Flötz über den alten Kunstschacht mit einem Schacht vorschlüge, indem es allem ansehen nach sehr langweilig werden möchte, durch den alten Mann durch an frische Stöße und ganzes Feld zu kommen. Wegen des Stolln Triebs hingegen hielten beyde darvor, wo möchte mit selbigem in ietziger Stunde 6,4 noch etliche biß 6 Ltr. fortgefahren werden, da sich dann zeigen müßte, ob das Flötz vor oder über dem Stolln Ort stehe. Bergamtswegen wurden obige beyde Meynungen nicht improbirt und es würden die Herren Gewercken nicht unrecht gethan haben, wenn sie das Bergamt vor Absinken dieses letzten Lichtlochs consultiert hätten, da man ihnen gleich zu dem Schacht übern alten Kunstschacht gerathen haben würde. Weil nun dieser letztre Bau eine pure Krüpeley, so wäre nach gepflogener reifflicher Überlegung, dem Steiger untersagt worden, in alten Mann weiter fortzufahren, doch dabey die sogenannde miserable Strecke von neuen biß zum alten alten Tageschacht, dem Wetter halber, in baulichen Wesen zu erhalten. Die Arbeiter wären also von ihm vor dem Stolln Ort und in den Eisensteinbau behörig einzutheilen und dahin zu sehen, daß etwas Stein aus letztern Bau gefördert werden könnte, es möchte nun dauern, so lange als es wolle, inmaßen gegenwärthig weiter kein Eisenstein anzugeben wäre. Nach Auffahrung 6 Ltr. vor dem Stollnort soll der Steiger melden, ob sich das Flötz spüren laße. Sollte nun hernach und durch Üvbersichbrechen vor dem Stollnort sowohl als auch durch einen der letztern Versuche, nehmlich der Hereinschlagung eines Schachtes über den alten Kunstschacht, nicht (einiges?) von Stein mehr heraus kommen, so würde man, nach vorheriger allerunterthänigster Berichterstattung und des Bergamts Exculpation, dieses Werck caduc zu schreiben, genöthigt werden, weile der königl. Eisenstein Zehende kaum den Holtzaufwand bezahlte...“ Am Blattrand notierte der Bergmeister noch dazu: Nota. „Wegen der Eisenstein Nieren, so öfters gantz eben liegen, ist es von mir als Flötz angenommen und von (den) alten darauf auch Lehne verliehen worden. Nach dem Fallen aber und da dieser Eisenstein sich doch 22 Lachter tief niederzieht, auch unter der Stolln Sohle wieder einschießt, wäre es eigentlich für einen Gang anzusehen. M. E.“ Wenn wir diese Notiz richtig deuten, dann hat die Verleihung von Lehn anstatt einer Fundgrube also damit zu tun, daß man hier ‒ zumindest zu dieser Zeit ‒ von einem flächenhaften Lager und nicht von einem linearen Gang ausgegangen ist. Eine weitere Registratur über eine gehaltene Generalbefahrung durch Bergmeister Enderlein, diesmal begleitet vom Geschworenen Johann Friedrich Mittelbach, datiert auf den 26. Juli 1751 (40001 Nr. 160, Film 0226ff). Danach waren die 6 Lachter Ort nun ausgelängt, doch das Flöz dabei nicht wieder ausgerichtet worden. Der Geschworene hatte an diesem Punkt ein Überhauen aufhauen lassen, aber auch damit wurde das Eisensteinlager nicht erreicht. Nach neuerlicher Überlegung hat man nun den Steiger angewiesen, 3 oder 4 Lachter nach Westen hinauszubrechen. Da der neue Tageschacht an der Viehtrift nahe der Markscheide zu liegen käme, wurde der Gewerkschaft ein Markscheidezug empfohlen. In dem Eisensteinbau gegen Norden vom Förderschacht war der Stein „zwar nicht sehr mächtig, doch von ziemlicher Güte.“ Der Geschworene befuhr außerdem noch den „aufgewältigten, alten Schacht von 11 Ltr.“, aus dem man einen Durchschlag in den vorgedachten Eisensteinbau fahren wollte, doch war dabei „nichts zu defileriren befunden.“ Die nächste Befahrung durch den Bergmeister und den Geschworenen Mittelbach erfolgte am 26. September 1753 (40001 Nr. 160, Film 0236ff). Diesmal ist man auf dem 22 Ltr. tiefen Hauptförderschacht eingefahren, welcher bis auf den tiefen Stolln niederging und auf dem Stolln gegen Süden gefahren. Man hatte auf der Stollnsohle noch immer nicht das Flöz angefahren, doch man konnte „die Arbeiter, so über der Stollnfirste aufm Eisen Stein arbeiteten, vernehmlich mit der Arbeit hören.“ Danach wurde der gesamte Stolln durchfahren und inspiziert. Das Tragwerk war zum Teil wandelbar und mußte ausgewechselt werden. Schließlich ist man noch in ein „anderes ohngefähr 6 Lachter tiefes Tagschächtgen und von dort biß auf den Stein, wo die Leuthe arbeiteten, die man aufm Stolln mit ihrer Arbeit hören konnte,“ gefahren. Daselbst war „sehr fürtrefflicher Eisenstein im Anbruch.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einige weitere ‒ dagegen recht
knappe ‒ Fahrberichte zur Grube entstammen wieder den Akten des Bergamts
Scheibenberg und dem Jahr 1754 (40014, Nr. 109, Blatt 21ff):
„28. März 1754 Hoffnung Gottes in Unterscheibe und Vater Abraham in Oberscheibe. Bei ersterer Grube habe ich nur den neuen Schacht (unleserlich ?) a. b. L. befahren und befunden, wie etl. (?) von der Hängbanck weg nicht recht nach dem (?) lagen, so der Steiger auch beßern wollte. Bey letzterer kommt es auf dem neuen Schacht an, ob dieser Stein bringt, sonst sieht es zur Zeit schlecht um diesen Vater Abraham aus und wird, wenn dieser sich nicht löst, viele deliberation erfordern, wo fernerweit Eisenstein zu finden sey, jedoch die Hoffnung und Geld wird uns darauf vielleicht noch schützen. (...) Vater Abraham, den 1ten April 1754 Weilen von Gewerken Klagen kamen, als ob der alte Steiger den Bau nicht recht verführte, besonders mit dem jetzigen neuen Schacht, so ist heute über Tag solches nach Beschaffenheit dasigen Zugs in Augenschein genommen und besondere Acte darüber zu halten, absolviret worden, wie denn auch denen sämtliche Herrn Gewerken schon wieder remonstratio geschehen, wieder für den alten Steiger gleich dimittries zu halten. Michael Herrmann Enderlein, Vice Bergmeister.“ Offenbar stand es dazumal schon nicht mehr gut um die aufgeschlossenen Eisenerzvorräte. Ein weiterer Fahrbericht findet man auf der Rückseite von Blatt 39 derselben Akte: „Befahrung Vater Abraham, den 14ten April 1754 Allhier fuhr ich erstens in den alten 22 Ltr. saiger tiefen Förderschacht und visitirte solchen bey wegen der Zimmerung sowohl, als auch den Stolln, wo der weg biß unter den jetzigen neuen Schacht, welcher ohnweit des Stollnortes hinein geschlagen, und das Eisenstein Flötz mit Stein wieder getroffen worden, doch noch 6 Ltr. über dem Stolln. Dieser neue Eisenstein Anbruch war über 4 Ellen hoch, jedoch das Hangende oder das Dach noch nicht völlig frei geschoßen. Gut war der Stein auch, nur geben der Himmel, daß sich solcher Anbruch extendire und (?) Steine, wie es darauf die Art hat, seyn mögen. Veranstaltet habe (ich), daß der Steiger das Flötz mit etl. Stempeln fange, und nicht trauen sollte, weil das Hangende ein faules Gestein wäre, wie ich denn außer Schuld seyn wollte, wenn ein Unglück durch seine Wage entstehen sollte. Ferner habe ihm auch anbefohlen, den neuen Fahrschacht vollends allenthalben zu verschlagen. Es war hier Zeit, daß der neue Schacht mit dem schönen Anbruch den Ausschlag gab, maßen sonst dieser Vater Abraham gewiß entschlafen wäre. Die Herren Gewerken, denen diese Grube eine erstaunliche Menge Fuder Eisenstein hergeben, waren, da der Stein etwa 3 Quartale ausgesetzt, sehr zaghaft und wollten auch sogar den alten Steiger absetzen, allein, laut der dieserhalb fabricirten Acten, konnten wir ihn nicht deferiren, sondern mußten ihren Zuschlag unterbrechen. Michael Herrmann Enderlein, Bergmeister.“ Michael Herrmann Enderlein hatte im April diesen Jahres Samuel Enderlein als Bergmeister in Scheibenberg abgelöst. Ende des Jahres 1754 war man dann offenbar mit dem Abteufen des neuen Schachtes und dem Durchschlag auf das Erzlager erfolgreich, wie folgender Fahrbogen vermeldet (40014, Nr. 109, Blatt 59ff):
Fahrbogen von dem
Scheibenberger Bergamts Refier, „(...) Auf dem alt Vater Abraham, in Ober Scheibe gelegen, ist ebenfalls Generalbefahrung gehalten, die Belegung mit 1 Steiger, 8 Häuer, 3 Lehr Häuer, 1 Knecht und 1 Karrenläuffer befunden, mit diesen Arbeitern wird 4 Lachter über dem Stolln auf einem Flötz die Arbeit auf ⅔ getrieben, welches Flötz ein Lachter mächtig anbrüchig von Eisenstein. (...) Auf dem Andreas Stolln, in Nieder Scheibe gelegen, gefahren, die Belegung mit 1 Steiger, 1 Karrenläuffer befunden, mit diesen Arbeitern wird das Ort in Quergestein gegen Meridies auf ⅓ getrieben, sind 3 ½ Lachter aufgefahren.“ Hiernach waren zu dieser Zeit auf Vater Abraham 13 Mann und ein Steiger angelegt, die in zwei Schichten („Dritteln“) anfuhren. Auch auf der Nordseite, bei St. Andreas, war wieder Bergbau in Umgang.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Erzführung des Lagers zeigte sich zu dieser Zeit offenbar absetzig, denn Herr Enderlein notierte am 23. Juli 1755 über seine Befahrung auf Vater Abraham (40014, Nr. 110, Blatt 9f): „Auf dieser Grube suchte der Schichtmeister, Hr. Richter, um eine Befahrung und Besichtigung des jetzigen Baues an, indem sie wegen des Flötzes zweifelhaft wären, wohin sie ihm, da es sich bald auf und nieder zög, und jetzo taub wäre, mit der Arbeit nachfahren und solches wieder mit Eisenstein suchen und edel finden mögten. Und ob ich wohl eine General Befahrung darauf halten wollte, so war es aber nicht möglich seit vergangenem Montag, als da eben die Ansuchung um diese Expedition geschah, da Herr Geschworener, der eine Schwartzenberger Verrichtung zu unternehmen, destinirt war, darzu holen zu laßen, mithin nahm ich den Einfahrer, Herrn Mittelbacher, zu mir und befuhr die Grube mit ihm alleine, da fand ich aber, daß die Vorsteher in ihrer Meynung mit Aufsteigung des Flötzes (…?) waren. Ich wieß sie dahero an, wo sie in tauben Mittel fort bauen sollten und nach 14 Tagen wollte ich wieder fahren und weitere Anweisung thun.“ Michael Herrmann Enderlein. Ob die weiteren Anweisungen des Bergmeisters den Erfolg brachten, weiß man nicht genau. Aber der nun in Scheibenberg amtierende Berggeschworene, Christian Heinrich Hildebrandt, fand bei seiner Befahrung der Grube im Quartal Trinitatis 1755 den Abbau wieder in Umgang vor (40014, Nr. 110, Film 0027): „No. 5. Woche montags bin ich aufn Vater Abraham in Oberscheibe gelegen, gefahren und war das Gebäude mit 1 Stgr., 6 Häuern, 6 Lehrhäuern und 1 Karrnläuffer beleget. Allda wurde die Arbeit auf 3/3tel getrieben und das Eisenstein Flötz ist 1 Lachter ab und zu fallend mächtig.“ Und auch über seine Befahrung im folgenden Quartal Crucis 1755 notierte der Berggeschworene (40014, Nr. 110, Film 0036): „Dienstags fuhr ich auf der Beständigen Einigkeit, Commun Zeche zu Scheibenberg, (...) Sodann verfügte ich mich auf den Vater Abraham, befunde das Gebäude mit 1 Stgr., 7 Häuern, 5 Lehrhäuern und 1 Jungen beleget und wird mit diesen Arbeitern auf dem Flötz die Arbeit auf 3/3tel continuirt.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus der nun wieder
anschließenden zeitlichen Lücke in der einen Akte haben wir Fahrberichte
in den Oberbergamtsakten gefunden: Johann Christian Mittelbach ist
inzwischen Einfahrer geworden und wurde von dem Vice- Einfahrer Johann
Christian Schubert und dem Geschworenen Hildebrandt begleitet.
Außerdem waren Schichtmeister Richter und Steiger Rücke bei
dieser Befahrung zugegen. Die Registratur hierzu stammt vom 18. Juli 1759
und ist recht kurz (40001 Nr. 160, Film 0265): „Auf welchem
Eisenstein Gebäude bey Gott Lob ! noch guten Anbrüchen nichts
veränderliches vorgefallen.“ Der Stolln wurde in gutem Stand befunden
und „Stroßenarbeit auf den Anbrüchen“ wurde in 2 Ltr. Teufe (unter
dem Stolln) verführt. Die Vorsteher beklagten allerdings Holzmangel.
Die nächste Befahrungsregistratur datiert auf den 15. November 1759 (40001 Nr. 160, Film 0241). Offenbar war auch jetzt auf der Grube Vater Abraham alles in bestem Stand: „Auf dem Eisensteinbau, welcher itzo 13 Lachter saiger tief steht, fande man nichts zu defideriren, sondern bey denen Vorstehern wiederhohlte man nur die ihnen gegebene Erinnerung, daß sie bey denen iezigen schönen Anbrüchen auch in Zeiten Versuchs Baue unternehmen und die Flötze aufsuchen sollten, als welches auch, daß sie damit schon angefangen, in dieser vorherigen Teufe sowohl, als auch noch 6 Lachter tiefer auf der Stollnsohle gezeiget wurde. Endlich durchfuhren sämtliche fahrenden Beamte den 300 Lachter weit getriebenen und bis auf etliche wenige Lachter in purem Holtz stehenden Stolln, visitirten ihn fleißig und befanden, daß er, bis auf etliche wenige thürstöcke, wobey der Steiger aber gleich an der Auswechslung begriffen war, in tüchtigen guten Stand, wobey der Hr. Schichtmeister und Steiger bedeutet wurden, fernerweit darauf gute Aufsicht zu haben.“ Auch von der Befahrung am 1. Juli 1760 heißt es in der Oberbergamtsregistratur (40001 Nr. 160, Film 0268), diese Zeche wurde „Gott Lob in guten Anbrüchen und Umständen befunden, daß nichts zu erinnern war. Sonsten ist aber noch bergamtswegen angeordnet worden, daß (...) ieder Bergarbeiter vom obersten bis zum untersten wöchentlich – 1 gr. – mehr Lohn verschrieben und, wenn die Gewerkschafft nicht wollte, keine Eisensteine vermessen werden sollten.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder etwas später und im zweiten Absatz der o. a. Bergamtsprotokolle findet auch der Bergbau auf dem nördlichen Gegentrum des Abraham'er Gangzuges auf der Andreas Fdgr. in Unterscheibe einmal Erwähnung. Dort scheint man aber schon zu dieser Zeit nur Spuren der Alten gefolgt zu sein, ohne dabei neue, lohnenswerte Anbrüche vorzufinden, wie auch folgende Generalbefahrungsregistratur aus dem Jahr 1764 (40014, Nr. 124, Blatt 2) zeigt:
Reg. Auf dem
Unterscheibner Gebürge, „Zur heutigen Expedition wurde auf dem St. Andreas, einer (unleserlich ?) wieder aufgenommenen kleinen Grube, der Anfang mit der Befahrung gemacht und also befunden. Diese besteht eigentl. nur aus einem 5 Lachter tiefen Schächtgen, woraus ein horiz. streichender Gang sich befindet und von (?) lange Jahre her ein Bergmännisches Geschrey gewesen, als wenn Erz anstehend darinnen verlaßen worden, aber, weil Wäßer Zugänge vorhanden (?), nachdem nun der Hr. Msch. Richter und die Eisenstein- Bergleute vom Vater Abraham sich daran gewagt, so haben sie solches in Lucia a. p. aufgenommen, den 5 Lachter tiefen Schacht gewältiget und zwei zu drey Drittel Arbeit, auch eine Rösche zu Abfangung der Tagewäßer von 8 Lachter hinan getrieben, etwas Kieße, Schwärze und Glänze getroffen, wovon sie Proben von 2 bis sechs Loth Silber erhalten; hiernach ist auch eben aufm Gang gegen Sept. (diese Abkürzung steht hier für septentriones = Mitternacht) ein altes Ort von 8 Lachtern noch gewältigt und (?) denn etl. Lachter abgesunken worden, weil aber keine Erzfälle und Anweisungen zu solchen sich gezeigt und die Waßer Zugänge gar zu stark gewesen, so ist es wieder liegen geblieben, wobey Fuder (?) sich auch bergmännisch bezeigt und mit gebaut, allein, ebenso nicht glücklich gewesen, welches anhero bemerkt. Michael Herrmann Enderlein, Bergmeister.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf dem folgenden Blatt der o. g. Akte
(40014, Nr. 124) liest man dann wieder über die Grube Vater Abraham:
„Ferner eodem die (am gleichen Tage) begab man sich auf das Oberscheibner Gebürge, woselbst die Vater Abraham, ein sehr altes Eisenstein Berggebäude befahren wurde. (?) ist die ietzige Arbeit des Eisensteins in der 13ten und 16ten Lachter saigerer Teufe besichtiget worden, wo die Anbrüche nur Nieren und Fälleweise sich befanden und gegen sonsten eine sehr merklicher Abfall derselben sich zeigte, doch hoffen die Vorsteher, an die 60 Fuder zum Vermeßen zu fördern, wobey also nichts zu veranstalten war. Zweitens befand sich das Such Ort in der 16ten Lachter saiger Teufe hor. 8 OR. 40 Lachter ins Feld getrieben, um damit Eisenstein Flötze aufzusuchen. Drittens fuhr man noch 6 Lachter biß auf der tiefen Stolln nieder, um solchen zu durchfahren. Hierbey nahm man nach genauer visitaton wahr, daß er allenfalls in tüchtiger Zimmerung gehalten und weshalber die Vorsteher auch beschieden worden, den Stolln jedero Zeit wohl in Zucht nehmen und zu keinem Bruch kommen zu laßen, außerdem denn sie sich einer großen Verantwortung zu ersehen, welches anhero notirt. Michael Herrmann Enderlein, Bergmeister.“ Derselbe Bergmeister faßte im September 1766 auch einen langen ,Conspect' über die in seinem Zuständigkeitsbereich umgängigen Bergwerke für das Oberbergamt in Freiberg ab und fügte diesem mehrere tabellarische Aufstellungen bei (40001, Nr. 122, Blatt 27ff). In diesen Tabellen ist die Grube Vater Abraham natürlich aufgeführt und angegeben, sie verfüge über „500 Lachter Stollnvortrieb, 6 Schächte in allem, die Teufe im jetzigen Bau (betrage) 8 Lachter, bis Stolln aber 22 Lachter saiger.“ In der Spalte ,ob die Grube bauwürdig oder nicht' heißt es hier: „Dieß uhralte Eisenstein Gebäudte hat vieles hergegeben, dahero im Alter noch bauwürdig und zu erhalten.“ Da es 1677 verliehen und aufgenommen worden ist, stand das ,sehr alte Berggebäude‘ zu diesem Zeitpunkt eigentlich aber noch nicht einmal 100 Jahre in Umgang. Interessanterweise ist in dieser Zusammenstellung keine einzige Eisensteingrube in Langenberg aufgeführt. Von Interesse ist aber auch die hier enthaltene Aufrechnung, wieviel Eisenerz denn in den einzelnen Revierabteilungen Schwarzenberg, Scheibenberg und Oberwiesenthal ausgebracht worden ist. Herr Enderlein hat für den Zeitraum von 1757 bis 1766 zusammengerechnet und festgestellt, daß:
Von den 8.357 Fudern Eisenerz im Scheibenberg'er Revier kamen allein 3.124 Fuder aus der Grube Vater Abraham, also mehr als ein Drittel des Gesamtausbringens. Natürlich sind die bedeutenden Eisensteingruben auf dem Crandorf'er Gang bei Erla noch einmal wesentlich ergiebiger gewesen. Aber auch, wenn man das Ausbringen der drei Regionen summiert, kamen damals immer noch mehr als 8% der Gesamtförderung der drei Revierabteilungen an Eisenstein aus Oberscheibe. Das ist schon eine ziemlich beachtliche Größenordnung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine sehr ausführlichere Beschreibung
gibt es dann wieder in den Generalbefahrungs- Registraturen (40014, Nr. 124, eine
unwesentlich veränderte Kopie auch in 40001,
Nr. 160, Blatt 0287ff) aus dem Jahr 1768. Außerdem hatte man hatte man vonseiten des Oberbergamtes
neue Richtlinien erlassen, wie die Protokolle abzufassen und zu gliedern
seien.
General Befahrungs Registratura den 5. May 1768 In Praesenta Herr Bergmeister Fischer und Herr Geschworener Hildebrandt. Aufn Vater Abraham in der Oberscheibe. „Zugegen war der Herr Schichtmeister Richter und der Steiger Johann Georg Schuberth. Belegt ist dieses Gebäude mit gedachtem Steiger, 6 Häuern und 1 Jungen. Dieses Gebäude bauen ganz allein mit ¾ Schichten Herr Nitzsche und mit ¼ Schicht der Herr von Elterlein zu Pöhla. A. Der tiefe Stolln deßelben bringt unter denen gegenwärtigen zwey saiger Tage Schächten etl. 20 Lachter saiger Teufe ein und er ist von letzten Tage Schacht weg, wenige Lachter gegen ME. aufgefahren. B. In etl. 100 Lachter von Mundloch hinauf geht der erste Tage und Förder Schacht gegen 20 Lachter saiger bis aufn Stolln nieder, und nahe bey solchem haben sie bishero nach dem Ausstreichen gegen OR. (oriente = Osten) auf dem Flötz oder vielmehr sehr flach fallenden Gang meistentheils in alten Mann in die Höhe gebaut, jedoch darbey einestheils noch hangende Flötze so die Alten anstehen gelaßen, anderntheils in Stößen auf dem Haupt Flötz selbsten noch hin und wieder den im ganzen Mittel nutzbarn Eisenstein gewonnen, wie sie denn auch noch gegenwärtig ganz allein in dieser Distanz für ietzt habende Anbrüche haben, und gewinnen, und hoffen sie Vorsteher in diesem Mittel wenn anders der Bau nicht stärker forciret werden sollte, noch etliche Quartale mit göttl. Hülfe nutzbarn Eisenstein gewinnen zu können, dahero C. war zuvörderst sich zu erinnern und anzumerken, daß von vorbeschriebenen Bau das meiste Feld gegen SE. (septentriones = Mitternacht, Norden) wohin das Gebürge abfällt, ingl. ziemliche Distanz gegen ME. wohin das Gebürge aufsteiget, in und über dem Stolln fast ganz groß abgebaut, hingegen unterm Stolln ist noch lauter ganzes und frisches Feld, und in diesem District die ergiebensten Eisensteine über dem Stolln gebrochen, so ist umso mehr zu vermuthen, daß die Flötze in der Teuffe nebst göttl. Seegen noch viel beßere Veredlung faßen dürften; allein obschon auf der Stollnsohle an zwey verschiedenen Orten mit 2 und 3 Pumpen abgeteuffet, auf denen ergiebige Eisensteine (gefördert) werden wollen, so ist doch diese Versuchsarbeit nicht tiefer als 2 Lachter flach, mithin nur 1 Lachter saiger fortzusetzen gewesen, inmaßen lediglich die allzu starken Waßer Zugänge die diesfallsige Hinderniß nicht tiefer abbauen zu können, verursachet. D. Der andere Tage und Förderschacht, welcher von vorbesagten gegen 100 und 20 Lachter entfernt ist, gehet bis auf ein übern Stolln befindlichen Feld Ort 14 Lachter tief nieder. Aus solchem Schacht und zwar in mehrer Höhe über ietzt besagten Ort sind auf denen gehabten Flötzen bey dem Bau nach ihrem Austrichen gegen OR. viele Eisensteine gewonnen worden. Hingegen bey Treibung des Feld Orts in 14 L. Teuffe haben die Flötze gegen ME. ihre sonst habende edle Beschaffenheit nicht gehabt, obschon ab und zu Eisenstein mit eingebrochen, dahero ist die wahrscheinliche Vermuthung gefaßt worden, daß nach Absinkung besagten Schachts das Haupt Flötz sich mehr in das Hangende gegen OCC. (occidente = Westen) geschlagen haben dürfte. In solchen Betracht ist das vorhero 8 Lachter gegen ME. (meridies = Mittag, Süden) getriebene Ort auf die Stund 12 gewendet, und bishero zu Einholung des Haupt Flötzes 12 Lachter getrieben worden, hingegen in Ansehung solchen Orts wurde resolvirt, es nun mehro noch auf Stund 1 und 2 zu wenden, damit nicht nur denen Flötzen näher gekommen, sondern auch gute Wetter Wechslung zu erhalten würde. Im Übrigen und E. wurde bey gehaltener Deliberation in Betrachtung der sub lit. C. gemachten Anmerkung für am nöthigsten gefunden, daß das wichtigste Augenmerk bey diesem Gebäude auf (?) und Verführung eines Baues unterm Stolln in Zeiten zu richten wäre, in solcher Absicht aber wurde erwogen, daß durch Treibung des tiefen Stollns und des oberen Baus aufm Flötze die meisten Tage Waßer die Brünnen der dasigen benachbarten Güther wären gezäpfet worden, mithin stünde umso mehr nach obenstehenden zu befürchten, daß beyn Abteuffen unterm Stolln die habenden vielen Waßer aus dem mächtigen und sehr offenen Flötz wegfallen, und dem tiefern Bau die obgedachte Hinderniß machten, daher wäre vor allen Dingen auf alle Fälle es mögten die Waßer Zugänge mit Menschen Händen mittelst Waßer Ziehen oder Pumpen, oder auch sogar mit einer Kunst gehalten werden wollen, und unumgänglich nöthig, daß der Stolln verfludert würde, jedoch würden alle solche Fluder über 70 bis 80 Stämme Holtz nicht erfordern. Wenn nun die Verfluderung bewürkt seyn wird, so stünde zuförderst abzuwarten, ob nicht sodann in gewißer Teuffe die Waßer mit Menschen Händen zu halten seyn dürften, wenn aber auch solche Hoffnung nicht von so einem glücklichen Erfolg wäre, so wäre wegen des starken Anlaufen des Stollns die Hoffnung noch übrig, eine Kunst zu hängen, und zu deren Aufschlag Waßer die Stolln Waßer gebrauchen zu können, nehmlich wäre der Stolln gewiße Distanz abzuwägen 3 von 20 L. zu 20 L. das Anlaufen zu bemerken, und dadurch zu untersuchen, ob man nicht an einem gewißen Ort, wo ein Gefälle auf das Rad herausbringen könnte, welchenfalls allerdings die Treibung eines Waßerlaufs zu veranstalten wäre; bey beschehener Vorlesung wurde nichts darbey erinnert, und habe solches anhero bemerket, Erasmus Christian Friedrich Schindler, Bergschreiber.“ Die Anteile der Eigner der Grube, der Hammerherren in Pöhla und Obermittweida, werden hier mit ,Schichten' benannt. Deren drei Viertel wurden vom Obermittweida'er Hammer, das vierte Viertel von den Besitzern des Pfeilhammer in Pöhla verbaut. Die ,Schicht' bezeichnet eine Unterteilung der Grubenanteile analog der später üblichen Kuxe; statt 128 Kuxen gab es aber üblicherweise nur 32 Schichten. Wie man ferner liest, baute man bereits nur noch verbliebene Gangmittel oberhalb des am Hauptschacht rund 40 m tief einkommenden Stollns ab, während eine Verteufung der Baue auf dem Lager unter die Stollnsohle noch an der Menge des zusitzenden Wassers scheiterte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Jahr 1769
ist eine Inspektion des Bergamtes Annaberg mit Scheibenberg durch den
Berghauptmann Carl Eugen Pabst von Ohain dokumentiert
(40001, Nr. 109, Film 0048ff). Er hatte zunächst im
Bergamtsbezirk Annaberg viel zu tun und am 1. August 1769 registrierte man
schließlich in Annaberg, was
das Bergamt Scheibenberg anbetrifft, nur über die wichtigsten Berggebäude.
Gleich als zweites wird unter der Nummer b.) die
Grube Vater Abraham in Oberscheibe angeführt. Hier heißt es, daß „durch
die vom Bergamte angeordnete Verfluderung des Stollns der Vortheil
erlanget worden (ist), daß man die sonst ungemein starken Waßer
dergestalt abgeführet hat, daß mittels einer Drückelpumpe gegen 9 Ellen
ungehindert abgeteufft werden können, welches bey diesem so schwebend
fallenden Gange ein ansehnliches beträgt.“
Den im Vorjahr gefaßten Plan hatte man also umgesetzt und statt bisher 1 Lachter saiger unter dem Stolln konnte man nun die Wasser bis auf 9 Ellen (rund 4,8 m) unter dessen Sohle niederhalten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Generalbefahrung erfolgt im
Jahr 1770 und auch dieser Bericht ist überliefert (40014, Nr. 124):
General Befahrungs
Registratur, „in Praesentis Herr Bergmeister Fischer und Herrn Geschworener Hildebrandt, zugegen war der Herr Schichtmeister Richter und der Steiger Schuberth. Belegt ist diese Grube mit gedachtem Steiger, 6 Häuern und 1 Jungen. Nachdem zu Befolgung der bey der am 5. May 1768 gehaltenen General Befahrung getroffenen Veranstaltung der Stolln verfludert worden, so hat, jedoch mit schweren Waßerhaltens Kosten, gegen 12 Ellen saiger unterm Stolln abgeteuffet, und innerhalb solcher Teuffe auf dem Flötz oder dem sehr flach fallenden Gange bey Gottlob! gehabten schönen und mächtigen Eisenstein neu gebauet werden können, wiewohl bey gehabten vielen Waßern, besonders zu Waßerfluth Zeiten, der Bau unterm Stolln ersauffe und wiederum gewältigt werden müßte, daß dahero bey der schwachen Belegung die Arbeiter binnen 24 Stunden gar öfters 16 Stunden anfahren müßen. Dahero und weile man durch bisherigen Bau unterm Stolln überzeugt worden, daß der edle flache Gang mit schönen und mächtigen Eisensteinen in die Teuffe setze, so ist, weile die Mitteln übern Stolln abgebaut sind, der Bedacht auf Erbauung eines Kunstgezeugs genommen, und in solcher Absicht ein Markscheider Zug gethan worden. Nach Ausweisung sothanen Zuges hat der Stolln von dem ietzigen ersten Tag und Förder Schacht, welcher in etl. Hundert Lachtern vom Stolln Mundloch hinauf hinein kömmt, in ersten 50 L. Distanz gegen ME. 2 L. ¾ Ellen und 2 Zoll Anlauffen und daselbst befinden sich zu allen Zeiten Kunst aufschlage Waßer, es wäre denn, daß wie man jedoch nicht besorget, bey künftigem Bau unterm Stolln gegen ME. die Stolln Waßer auf dem offenen Flötze weg und dem Tieffsten zufielen, zu Vermeidung deßen aber, wäre allenfalls auf andre dienliche Mittel in Zeiten Bedacht zu nehmen, mithin hat sich durch den Markscheidezug am Tage geleget, daß aus dem vorbesagten Tage Schacht ein Kunst Waßer Lauf gegen ME. von etwa 50 Lachtern bis dahin, wo die Waßer auf dem Stolln zum Aufschlag auf die Kunst gefaßt werden sollen, getrieben werden dürfte, auch zwischen diesem und dem tiefen Stolln ein Rad von 9 Ellen eingebracht werden könne. Bey heutiger Befahrung wurde nun auch befunden, daß besagter Kunst Waßer Lauf bereits gegen 20 L. getrieben sey, welche 30 Lachter wegen des sehr gebrächen Gesteins mit ⅔ Arbeit binnen des Quartals aufzufahren seyn dürfte. Zweitens war die Radstube bey vorbesagtem Tage Schacht auch bereits über die Hälfte zu Standt; drittens konnte bey gegenwärtigen vielen Waßern nicht gebauet werden, dahero wurden die Vorsteher angewiesen, vor allen Dingen und wenn unterm Stolln nicht gebauet werden könne, die sämtl. Mannschaft zu Forcirung der bey der Rad Stube anzuwendenden Arbeit zu gebrauchen, und wenn solche zu Standt, sodann den Waßer Lauf umsomehr schwunghaft zu treiben; Nach beschehener Wiedervorlesung wurde weiter nichts darbey erinnert und habe solches anhero art. Erasmus Christian Friedrich Schindler, Bergschreiber.“ Offensichtlich gingen die Eigner das Problem der Wasserhebung nun energisch an, zumal die Mittel oberhalb des Stollns schon fast gänzlich abgebaut waren. Man sparte auch nicht an der Vermessung, um den unterirdischen Wasserlauf in der richtigen Höhe anzusetzen und die Ausbeute an Aufschlagwasser damit zu maximieren. Daß diese Grube ja den Hammerherren selbst gehörte, die auch die nötige Kapitalkraft dafür besaßen, und daß diese wohl auf das qualitativ hochwertige, eigene Eisenerz nicht verzichten wollten ‒ man hätte es ja sonst, nicht weniger teuer, anderswo einkaufen müssen ‒ machte die technische Modernisierung und letztlich auch den langen, kontinuierlichen Betrieb dieser Grube erst möglich. Und immerhin lohnte dieser Aufwand hier auch, denn man hatte ja Gottlob ! auch neue Anbrüche erschlossen... Aus der Generalbefahrung im November des Folgejahrs 1771 (allerdings war wohl der Bergschreiber gerade unpäßlich und ein anderer hat das Protokoll ‒ und dies leider in einer schwer lesbaren Handschrift ‒ zu Papier gebracht) erfährt man, daß Vater Abraham jetzt mit 4 bis 5 Arbeitern nebst dem Steiger belegt war und die Hammerherren von Elterlein und Nietzsche nach wie vor die Eigner gewesen sind. Die Radstube und die Wasserrösche waren fertig geworden, die Radstube ausgezimmert und die Wasserkunst „zum Umgang gebracht“. Gehangen ist ein Satz von 4 Lachtern Tiefe, mit dem man die Wasser derzeit niederhalten könne. Nur der Schacht müsse noch „verflächt“ werden, damit die Korbstangen geradlinig laufen können. „Veranstaltet“ wurde, den Stolln weiter zu verflutern, damit die Stollnwasser dem Unterbau nicht wieder zufallen. Die Mittel über der Stollnsohle waren gänzlich abgebaut und das Gebäude wäre ohne die Kunst „in Wegfall geraten“.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere zehn Jahre später gab es wieder
einen sehr umfangreichen Bericht (40014,
Nr. 124, Blatt 35; offenbar hat man in dieser Akte mehrere ältere Akten
zusammengeheftet und in diesem Teil sind auch die Blätter wieder
nummeriert, Abschriften dieser Registratur finden
sich auch in den Oberbergamtsakten: 40001, Nr. 125, Film 0156ff, sowie in
der Grubenakte: 40169, Nr. 221, Blatt 1ff):
General Befahrungs
Registratur, „Dieses Eisenstein Gebäude befindet sich auf einem hor. 10, 4 streichenden und bey etlichen 20 Grad in Abend fallenden schwebenden Gange. A. Die Befahrung geschah zu dem 20 Lachter saiger tiefen Hülfs Tage und Förderschacht bis Stolln, deßen Mundloch an 150 Lachter gegen SE. vorstehet, der Stolln aber noch weit gegen ME. gehet und in allem 405 Lachter Länge hat, in welcher derselbe in schwerer Zimmerung gehalten werden muß. Wobey zu bemerken, daß von letztern obern Tage Schacht der Stolln noch 50 Lachter in der Absicht, andere Eisenstein Gänge, die hor. 12 aufsetzen sollen, zu überfahren, darbey aber der in diesem Gebürge Kalckstein Strich angefahren und dahero das Stolln Ort bisher nicht weiter erlängt worden. Nachdem nun bey diesem Gebäude an 200 Lachter Länge übern Stolln alles (gewonnen?) hat man de ao. 1771 B. aufn Stolln, 4 Lachter von dem gedachten Tageschacht, sich mit einer Kunst gelagert und eine Rad Stube ganz in Holtz erbauet, die Aufschlagewaßer aber, da der Stolln in 100 Lachtern Länge 8 Ellen anläuft, durch eine in solcher Länge getriebene söhlige Rösche herbey geführet, deßgleichen ein 8 Ellen hohes Rad gehänget und damit den Kunstschacht 4 Lachter saiger abgesunken, und dadurch die Gelegenheit hergestellt worden, daß man seit deme, an 60 Lachter Länge unter dem Stolln Bau verführen könne, wobey man den Gang zu ½ bis ¾ Lachter mächtig befunden. Von da fuhr man bis Stolln hinaus, wo C. in vorgedachten Tageschacht sub. A. in 2 Ellen Höhe ein Röschen Ort gegen Mittag, 6 Lachter lang abgehet, und des nächsten in ein Gegenort durchschlägig wird, maaßen vorgedachte untere Rösche sub. B. zu Bruche zu gehen, eilet, und eine neue 2 Ellen höhere zeithero betrieben worden, daß also künftig anstatt 8 bis 10 Ellen hohes Rad gehänget werden kann. Wobey die Vorsteher vorstelleten, welchergestalt D. es nicht möglich seyn wolle, den zwar nur 4 Lachter tiefen Kunstschacht tiefer niederzubringen, maaßen damit nunmehro das Eisenstein Flötz Liegende, und mit solchem außerordentliche Waßer Zugänge erlanget werden. Da nun Radstube und Kunstrad wandelbar, und ehedem in neue Zimmerung gesetzt werden müßte, auch da man um 2 Ellen mehr Gefälle in die Radstube und zum neuen Rad einbrächte, so sey der Vorschlag, daß man einen neuen Kunstschacht ins Flötz Hangende also absetze, damit man mittelst 8 Lachter Teuffe unter dem Stolln das Flötz ohne deßen Waßerreiches Liegendes zu erreichen, zu erlangen suche, wobey sodann auf dem Flötz selbst wiederum 6 bis 8 Lachter flacher Teuffe abbauen zu können, die Gelegenheit hergestellt werde. Und der Steiger des Gebäudes, welcher sich die ietzige Radstube bey vorhabender neuen Auszimmerung dahin einzurichten, abzuändern und an 3 Stunden andere Richtung gegen das Hangende vorzurichten und herzustellen. Übrigens ist das Gebäude mit 14 Mann beleget, und wobey quartaliter 60 bis 70 Fuder Eisenstein á 1 Thaler 16 Gr. – Pf. gefördert werden. Veranstaltung. 1.) Zuvörderst wurde dem Steiger anbefohlen, den Tageschacht lit. A. weile er sehr wandelbar, des allernächsten in neuen Schrot zu setzen, und bey der so höchst gefährlichen Grube, seiner zeithero bewiesene Geschicklichkeit und Eyfer, bey der nöthigen Stollen-, Schacht- und übrigen Zimmerung ferner anzuwenden. 2.) Und anlangend des Antrages sub lit. D. wegen Absinkung einen Kunstschachtes ins Flötz Hangende, ohne dabey deßen waßerreiches Liegendes zu berühren, fande solcher Vorschlag allerdings den gebührenden Beyfall, nur aber scheint es gefährlich, solche ietzige Radstube, in bemerkte andere Richtung zu setzen, welches aber bey dem anhaltenden Ansuchen des in der Zimmerung dieses Gebäudes erfahrenen und geschicklichen Steigers demselben nach seiner gethanen Proposition gestattet wurde. 3.) Dahingegen, als zu einer langen Dauer dieses Gebäudes nichts, als die Herbeytreibung eines tiefen Stollns vorzüglich übrig, die aber nach Situation der Gegend nicht so leicht zu bestimmen, so soll daherwegen anderweit deliberation werden, und die Vorsteher Vorschläge dahin thun und einreichen. Welches nachrichtlich anhero zu bemerken sollen, Erasmus Christian Friedrich Schindler, Bergschreiber.“ Hier ist auch einmal der Verkaufspreis angeführt, nach welchem das ausgebrachte Erz zwischen der Grube und den Hammerwerken verrechnet worden ist: 1 Thaler, 16 Groschen für das Fuder war ein durchaus guter Preis im Vergleich mit anderen Gruben der Umgegend, was für die Qualität des Erzes spricht. Nicht uninteressant ist auch die
Bemerkung, man habe mit dem Suchort einen „Kalckstein
Strich angefahren“, denn weiter
südöstlich baute ja zeitgleich schon das Kalkwerk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wohl des gewagten Planes wegen, bei dem
nicht sonderlich standfesten Gebirge die Radstube um 90° verdreht ‒ und
mit größerer Höhe ‒ neu auszuhauen, fand schon im Folgejahr (am 16. April
1782) eine erneute Revision durch das Bergamt statt.
Zu deren Vorbereitung erstellte der Schichtmeister Richter eine
Anzeige zum Grubenbetrieb (40169, Nr. 221, Blatt 6ff).
Diese enthält auch verschiedene Übersichten für den Zeitraum 1778 bis 1781
und diese wiederum sind dahingehend von Interesse, daß es spätestens seit
1778 keine Unterteilung in Schichten mehr, sondern in 128 Kuxe gegeben
hat. Über die Grubenrevision wurde notiert
(40014, Nr. 157, Blatt 8f, Abschrift auch in
der Oberbergamtsakte: 40001, Nr. 120, Blatt 67f):
7. Vater Abraham Eisenstein Berggebäude zu Oberscheibe. „Befindet sich auf einem hor. 10 und bey 20 Grad in Abend fallenden Eisenstein Gang, worauf zu ½ bis 1 Lr. mächtig Eisenstein einbricht und ist mit einem über 400 Lr. langen Stolln, der beym Tage Schacht 20 Lr. Teufe einbringet, gelöset, wobey in 200 Lr. Länge vom Tag bis Stolln, preßgebauet ist. 4 Lr. vom Tage Schacht ist mit einem 8 Ellen hohen Kunstrad 4 Lr. saiger tief und in 80 Lr. Länge ebenfalls abgebauet. Das Flötz und Gebürge ist überaus Waßer reich, und dahero dann der gegenwärtige Kunst Schacht nicht ferner continuirt werden darf, weil solcher in fernerem Absinken in das Flötz Liegende gelangen würde. Nach dem nun mit Betrieb eines höheren Röschen Orts nunmehr ein 10 Elliges Kunst Rad einzuhängen ist, so wird die Radstube gegenwärtig bey schwerer und gefährlicher Holtz Zimmerung verwendet und nach des Ganges Streichen über Kreutz gesetzet, so dann ein neuer Kunstschacht in des Flötzes Hangende also abgesunken werden soll, daß man hiermit erst in 10 Lr. Teufe das Flötz ersinket, und 5 Lr. hohe neue Stroßen hergestellt werden. Das Gebäude ist mit 14 Mann beleget und fördert quartaliter 70 bis 80 Fuder Eisenstein. Man wird künftig in Betrachtung ziehen, ob mit einem tiefern Stolln bey zu kommen seyn dürfte, jemehr zu Aufschlag Waßern und höhern Gefälle keine Möglichkeit vorhanden.“ In der Akte des Bergamts Scheibenberg sind auch Tabellen über das Ausbringen der Gruben enthalten, nach denen Vater Abraham in den Jahren 1778 und 1779 jeweils deutlich über 400 Fuder Eisenstein gefördert hat. Bedingt durch den aufwendigen Umbau der Wasserhaltung ging die Förderung im Jahr 1782 auf nur noch 312 Fuder zurück (nach der oben erwähnten Anzeige des Schichtmeisters Richter waren es 348 Fuder 1780 und 368 Fuder im Jahr 1781), war aber bereits im Jahr 1785 wieder auf 512 Fuder angestiegen. Dabei „verbaute sich“ die Grube, d. h. die Eigner zahlten keine Zubußen, erhielten jedoch auch keine Ausbeute. Stattdessen trugen sie jedoch die Betriebskosten, die vonseiten der Grube mit dem gelieferten Erz verrechnet worden sind. Auch im Jahr 1781, und zwar festgehalten im Sitzungsprotokoll des Bergamtes vom 7. Juli 1781, wurde ein Vergleich mit dem Grundbesitzer namens Schubert (in späteren Akten liest man wieder Abraham Schumann) über den Grundzins für die angewachsene Haldensturzfläche vereinbart. Als Gegenleistung erhielt dieser von nun an jährlich von den Gewerken einen Ausgleich in Form von „5 Waag Eisen.“ (40169, Nr. 221, Blatt 13) Der Besitzer des Bodens wechselte zwar in der Folgezeit, doch der hier vereinbarte Zins blieb lange Zeit bestehen. Außerdem liest man in diesem Protokoll, daß der Steiger Schubert, „welcher sich bei dieser gefährlichen Grube so fleißig als geschickt bezeiget,“ von nun an 4 Groschen mehr Wochenlohn und zwar nun 1 Thaler, 10 Groschen erhalten solle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch vonseiten des Königlichen Oberbergamtes schaute man sich gelegentlich einer Rundreise durch das Westerzgebirge die neue Anlage wieder an (40014, Nr. 157, Blatt 49f, Abschrift auch in der Grubenakte: 40169, Nr. 221, Blatt 9ff und Registratur hierzu auch in 40001, Nr. 128, Blatt 16ff): Protocollum, Scheibenberg den 9ten Aug. 1782 Praesentes: Se. Wohlgeboren, der Herr Berg Commissions Rath Charpentier, Bergmeister Sommer, Markscheider Schnick, Geschworener Hildebrandt, Bergschreiber Schindler „Als Dominus Commissarius sich gestern von Wiesenthal hierher nach Scheibenberg begeben und heutigen Tag zu Befahrung einiger in Scheibenberger Refier gelegener Gruben Gebäude ausgesetzet hat, so wurde I. Aufn Vater Abraham Berggebäude zu Oberscheibe, der Anfang gemacht. Es fuhren dannenhero Praesentes allhier den Tageschacht 22 Ltr. saiger hinein bis aufn Stolln, und auf diesen 3 Ltr. gegen SE. bis in die Rad Stube, welche in gantz neue Zimmerung gesetzet, auch ein neues 11 Ellen hohes Rad gehangen worden. Von der Radstube 6 Ltr. zurück in der Stunde 3 gegen OC. ist der neue Kunst Schacht angefangen, mit selbigem in 5ten Ltr. das Flötz ersunken, auch bereits 2 Ltr. unter selbiges abgeteufet worden. In 200 Ltr. Länge, nach seinem Streichen zwischen Stundt 10 und 11 ist das Flötz sowohl übern Stolln, als in der Stollnteufe, ingleichen 4 Ltr. unter der Stollnsohle saiger abgebauet, dahero die Absicht dahin gerichtet ist, durch ferneres Absinken mit dem neuen Kunstschacht das Flötz wieder auszurichten, zu trocknen und in mehrer Teufe zu bebauen. Nach Beaugenscheinigung alles deßen fuhr man durch obbesagten Schacht wieder zu Tage aus, ... Leberecht Ehregott Taube, Protocollist.“ Bei dem hier genannten Berg Commissions Rath handelte es sich um keinen Geringeren, als Johann Friedrich Wilhelm von Charpentier (*1738, †1805), damals als solcher bereits Mitglied des Oberbergamtes und ab 1801 selbst Berghauptmann in Sachsen. Über die bergamtliche Befahrung wurde nur kurz notiert (40014, Nr. 160, Blatt 6f): B. Auf dem Gebürge zu Scheiba, Markersbach und Gründen. No. VI. Vater Abraham Eisenstein Gebäude zu Oberscheibe „Allhier wurde statt der vorigen 8 Ellen hohen Radstube eine neue, 12 Ellen hohe Radstube in sehr kostbarer Zimmerung ausgezimmert und hergestellet, auch ein 11 Ellen hohes Rad und neues Kunstgezeug gehangen, ingleichen der Kunstschacht 2 Lr. saiger tief, bis zu 7 Lr. saiger vor Teufe abgesunken, in welcher Teufe das Eisenstein Flötz mit 2 Lr. mächtigen Eisenstein erlanget wurde. Das Gebäude ist mit 13 Mann belegt, wobey wegen vorgewesener Kunstarbeit nur 312 Fuder Eisenstein gefördert werden konnten.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Jahr später hielt man im gleichen Kapitel für bemerkenswert (40014, Nr. 161, Blatt 6f): No. VI. Vater Abraham Eisenstein Gebäude zu Oberscheibe „Ist mit 13 Mann Arbeitern belegt. Und gleichwie in vorigem Jahre 1782 schon untern Stolln ein neuer Kunstschacht 7 Lr. tief abgesunken, und bey diesen an etl. 20 Grad fallenden und an 2 Lr. mächtigen Gange hierdurch Gelegenheit zu Abbauung verschaffet worden; als wurden in oberwähnten Jahre bey verführten Stroßen Bau 480 Fuder Eisenstein an Betrag von 800 Thl. gefördert. Auch wurde der 3te Tageschacht ausgewechselt, der 4te Tageschacht 22 Ltr. tiefer neu ausgewältiget, und der 400 Lr. lange schwerköstige Stolln in Zimmerung erhalten.“ Dieselben Angaben findet man auch in der Anzeige zum Behuf der 1784 zu haltenden Revision für das abgelaufene Jahr aus der Hand von Schichtmeister Richter (40169, Nr. 221, Blatt 14). Über diese Befahrung im Jahr 1784 hielt man in der Bergamtsakte fest: No. VI. Vater Abraham, Eisenstein Gebäude zu Oberscheibe „Ist mit 1 Steiger und 14 Mann Arbeiter belegt. Wobey in dem zur Zeit untern Stolln nur 8 Lr. tief weiter gesunken Kunstschacht auf dem flach streichenden und 20 Grade in Abend fallenden schwebenden Eisenstein Gang auf dem mit 75 Lr. Länge in Mitternacht vorgerichteten Eisenstein Bau 520 Fuder Eisenstein bey 1½ Lr. mächtigem Gang producirt worden sind. Wegen Mangel der Aufschlage Waßer konnte der Kunstschacht nicht abgesunken werden; dahero aus der Radstuben Strecke ein Ort 15 Lr. gegen Abend zu Erlangung mehrer Aufschlagewaßer betrieben worden ist. Übrigens wurde dieses beschwerliche und gefährliche Gebäude in gehöriger Holtz Zimmerung erhalten. Die Gewerken ersuchen uns, daß ein gnädigst (Befehl ?) erlaßen und dieshalb unterthänigster Bericht erstattet werden soll.“ Worum es in letzterer Bemerkung innerhalb des kurzen Textes geht, ist nicht gleich klar, abgesehen davon, daß Holz ja nicht nur zum Grubenausbau benötigt und schon lange ein knappes Gut war. Aufklärung brachte der Inhalt der Grubenakte (40169, Nr. 221, Blatt 17ff): Die Gewerken (an dieser Stelle haben sie alle eigenhändig unterschrieben, so daß wir sie namentlich anführen können)
beantragten nämlich mit Schreiben vom 12. Oktober 1784 den Erlaß des Zehnten und des Ladegeldes auf sechs Jahre, um mit dem ersparten Geld das oben in dem Befahrungsbericht erwähnte Wasserort, welches sehr schwerköstige Zimmerung erforderte, fortstellen zu können. Auf das Jahr 1782 etwa fielen auf die ausgebrachten 312 Fuder Eisenstein im Wert von 520 Thalern 52 Thaler Zehnter und weitere 13 Thaler Ladegeld an (40169, Nr. 221, Blatt 12). Diesen Betrag wollten die Gewerken für ebendiesen Bau verwenden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch in der von Schichtmeister Richter erstellten Anzeige zum Grubenbetrieb 1784 wird wiederholt, daß der Zehntenerlaß für den Forttrieb des Wasserorts erwünscht sei (40169, Nr. 221, Blatt 20ff). Für die Zwischenzeit hatte man sich damit beholfen, Übertagewasser in Röhren zu fassen und es über den südlichsten Tageschacht auf dieses ,Wasserlaufsort' zu leiten, womit man zwar den Gang der Kunst befördern konnte, aber einen für ein tieferes Absinken des Kunstschachtes hinreichenden Umgang der Kunst noch nicht erzielt hatte. Nach der Notiz zur Befahrung ,auf das 1785te Jahr' ist diesem Antrag bis dahin noch nicht stattgegeben worden (40014, Nr. 161, Blatt 38, wobei in dieser Akte wieder einige ältere Akten zusammengeheftet worden sind und die Blattnummerierung immer mal aussetzt und von vorn beginnt): No. VI. Vater Abraham, Eisenstein Gebäude zu Oberscheibe „Ist mit 1 Steiger und 14 Mann Arbeiter belegt. Wobey in dem zur Zeit untern Stolln nur 8 Lr. tief weiter gesunken Kunstschacht auf dem flach streichenden und 20 Grade in Abend fallenden schwebenden Eisenstein Gang auf dem mit 75 Lr. Länge in Mitternacht vorgerichteten Eisenstein Bau 512 Fuder Eisenstein, an Betrag 853 Thl. 8 Gr. bey 1 ½ Lr. mächtigem gang producirt worden sind. Auch wurde das Waßer Röschenort über der Förste der Radstube in der Stundt 4 – 5 ferner 12 Lr. in Abend nun in allem 28 Lr. Länge fortgestellet. Womit denn die Waßer das hangenden Gebürges ab- und dem Kunstgezeug zugefördert werden. Übrigens wurde dieses beschwerliche und gefährliche Gebäude nebst Stolln, Schächten und Kunstgezeug in erforderlicher Reparatur unterhalten.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allerdings war den teils ja selbst adeligen
Hammerherren die Bitte um einen gnädigsten Befehl bergamtswegen
natürlich nicht abzuschlagen, und die folgende ausführliche
Generalbefahrungs- Registratur befürwortet dann den Antrag auf Steuererlaß (40014, Nr. 124,
Blatt 47ff, Abschrift in der Grubenakte: 40169,
Nr. 221, Blatt 24ff):
General Befahrung Registratura,
den 8. Ju. 1785 Praesentes: Herr Bergmeister Christian Hieronymus Sommer, Herr Berggeschworener Christian Friedrich Rau, ingl. Herr Schichtmeister Christian Gottlob Richter und Steiger Johann George Schuberth. „Dieses Gebäude befindet sich zunächst Ober Scheibe, auf einem zwischen den Stunden 10 – 11 streichenden und bey etl. 20 Graden in Abend fallenden schwebenden Gange, gelegen, und welches Gebäude sowohl als sein ansehnliches Alter enthält, als auch neuerlich und zwar im Jahr 1766*) 5.424 Fuder Eisenstein á 1 Th. 16 Gr. – Pf. gefördert worden, dahingegen aber auch wegen der vielen kostbaren Ausführungen und schwerhältigen Bauen von denen Herren Gewerken inhalts des Registers bis daher 21.062 Th. 8 Gr. – Pf. zugebüßet oder als Receß hineingebauet werden müßen.“ *) Hier stimmt etwas im Text dieser Registratur nicht: Es sind keinesfalls „im Jahr 1766“ fast fünfeinhalbtausend Fuder gefördert worden. Da uns die Erzlieferungsextrakte (40166, Nr. 1, 22 und 26) zur Verfügung stehen, kommen wir dahinter, daß es „seit 1766“ heißen muß. In den neun Jahren von 1766 bis 1784 sind (nach diesen Aufzeichnungen) 5.247 Fuder, also ungefähr die hier genannte Menge Eisenstein, ausgebracht worden. Nachdem dies geklärt ist, zurück zum Text: „Die Befahrung geschah A.) zu dem durch Quergestein abgesunkenen 2ten Tage und Förderschacht 20 Lr. saiger tief bis Stolln Sohle hinein und dann 2 Lr. durch Quergestein bis wiederum an ein ferner 4 Lr. saiger tief niedergehendes Gesenk und dann in solcher Teufe 6 Lr. in Abend bis an das Flötz. In dieser Teufe gehet das Ort 30 Lr. in Mittag ab, wobey das Flötz mit ½ bis ¾ Lr. mächtigem Eisenstein verfahren worden, und in solcher Beschaffenheit auf der Sohle noch anstehet. B.) Auf gleiche Weise wurde von vorgedachten Punct und Förder Schächtgen bey einschießender Sohle oder Stroßen 20 Lr. lang und 4 Lr. saiger Tiefe gegen Mitternacht bis Kunstschacht und deßen gegenwärtige Sohle gefahren, wobey denn das Eisenstein Flötz sich in voriger Beschaffenheit mit ½ und ¾ Lr. mächtigem Eisenstein verhielte, und der Stroßenbau ohnweit des Förder Schachts, mit 6 Mann zu 3/3 belegt, befunden wurde. C.) Anlangend nun, den Kunstschacht und Kunstgezeug, wurde befunden, wie seit letztren Quartals Befahrung die in völlig gurigem Gestein gestandene Radstube nicht nur 3 Stunden in ihrer Richtung verwendet, als auch in haltbare Zimmerung versetzet, eine Gestängestrecke 7 Lr. in Abend getrieben und zu Ende derselben ein neuer Kunstschacht in Quergestein 3½ Lr. saiger bis Flötz, 1½ Lr. durch solches und dann bey 8 Lr. saigerer Teufe mittelst ferneren Querschlags 6 Lr. in Abend, das Flötz angefahren worden. Ob man schon die Kunst bey ietziger sehr naßen Witterung vielen Effect bewürkte, maaßen die Zugänge Waßer beträchtlich stark befunden wurden, so befindet sich jedoch dieser tiefe Bau bey geringster Dürre in Ermanglung der Aufschlage Waßer sehr öfters zurückgesetzet, dergestalt, daß solcherwegen der Kunstschacht nicht ferner abgesunken werden kann. D.) Dahero dann zur Zuführung mehrer Aufschlage Waßer, 4 Lr. überm Stolln und in der Röschen Teufe, ein Querschlag gegen Abend aufgehauen, bereits 20 Lr. in den Stunden 5 – 4 fortgestellet, und hiermit schon ein ziemlicher Theil Waßer erlanget worden, und ferner zu ⅓ und ⅔ Belegung betrieben wird. Das Gebäude ist belegt mit 1 Steiger, 1 Zimmerling, 6 Häuern, 5 Knechten und 1 Jungen, wobey quartaliter 128 Fuder Eisenstein, an Betrag 213 Th. 16 Gr. – Pf. zwar gefördert, von denen Herren Gewerken aber 280 Th. – Gr. – Pf. Kosten bestritten werden müssen. Anlangend die Veranstaltung, wurde a.) denen Vorstehern und besonders dem Obersteiger die fernere Sicherstellung des Stollns und der Grube in fleißiger Holtz Zimmerung besonders empfohlen, b.) sowie, daß das Eisenstein Bedürfniß sich solange als möglich in der 4. bis 8. Lr. Teufe (unleserlich ?) erholet, und die 4. Lr. höhere Teufe zur Retirade geschonet werden sollen. Da nun aber bey dem großen Mangel der Aufschlage Waßer und waßerreichen Tiefsten ein fernerer Bau in mehrer Teufe ohnmöglich und folglich ohne baldige Haupt Anstalten in die Zukunft, die Baue des Gebäudes sehr bedenklig und solcherhalb verschiedene Deliberationes gehalten worden, (?) eröffneten die Vorsteher des Gebäudes ihr Gutachten vorzüglich dahin, daß vorgedachter Querschlag in der Röschen Teufe lit. D. sowohl in Abend zu fernerer Erschrotung mehrer Aufschlage Waßer, als auch in gleicher Absicht ein Querschlag in Morgen betrieben werrden möchte, mit der Angabe, wie mit letztren bey 70 oder 80 Lr. Länge ein fernerer Eisenstein Zug gelöset werden müsse, als auf welchem schon in älteren Zeiten Baue am Tage nieder verführet worden. Dahingegen, gleichwie die Gewerken schon gegenwärtig viele Kosten verwenden müssen, solche Ausführungen ohne eine höchste Unterstützung ganz ohnmöglich seyn würden, und solcheswegen auf das wegen gesuchtem Zehenden Erlaß übergebene Schreiben, sich nochmals bezogen. (...)“ Erasmus Christian Friedrich Schindler, Bergschreiber.“ Die Investitionskosten für den aufwendigen Umbau und den noch nicht beendeten Vortrieb der Wasserstrecken (mit denen in diesem Fall, gewissermaßen wie ein Flachbrunnen, mehr Aufschlagwasser erschroten werden sollte) lagen auch den nicht gerade armen Hammerherren natürlich auf der Tasche und drückten den Gewinn. Wie nun einige Jahre zuvor schon in den Akten festgehalten worden ist, wäre aber ohne diese Aufwendungen die Eisensteinzeche längst „in Wegfall geraten“. Schon der eigenen Reputation wegen (die Zahl der noch zu beaufsichtigenden Erzbergwerke wurde ja gerade eher kleiner) verwendete sich das Bergamt deshalb gern für den erbetenen, zeitweiligen Erlaß des Zehnten, wollte den Antrag unterstützen und anderweits Bericht erstatten, zumal „dieses Gebäude noch niemahls höchste Begnadigung erhalten“ hat. Außerdem argumentierte man seitens des Bergamtes, daß durch den Abbau im eigenen Lande sonst erforderliche Importe aus Böhmen vermindert würden und daß der hiesige Stein „als ein vorzüglicher Fluß beim Eisenschmelzen zugesetzet und eben solches zu großen Vortheil der wenigeren Holz Consumption“ gereiche.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Erlaß des Zehnten wurde am
20. Juli 1785 vom Bergamt gegenüber dem Oberbergamt in Freiberg
befürwortet und nach Weitergabe dorthin auch von der Kurfürstlichen Kammer
am 2. November 1785 zunächst auf 3 Jahre genehmigt (40169, Nr. 221,
Blatt 30ff). Diese für die Gewerken sehr positive
Entscheidung teilte das Oberbergamt am 2. November nach Annaberg und das
Bergamt den Gewerken am 16. November 1785 mit. Auch in der
Registratur zur Befahrung im Jahr 1787 ist es (unter Punkt 6.b) vermerkt (40014, Nr. 124, Abschrift in 40169, Nr. 221, Blatt 41ff):
General Befahrungs Registratura Abgefaßt in No. 4te Woche des Quartals Trinitatis, am 7. Juny 1787. „1.) Diese schon sehr alte Eisenstein Zeche, welche mit 100 Lehnen und 30 Posten beliehen, mit 1 Steiger, 1 Zimmerling, 7 Häuern, 5 Knechten und 1 Jungen belegt ist, á Kux 2 Thlr., 4 Gr., – Pf. Zubuße giebt, im abgewichenen Quartal Remin. d. J. 282 Th. 4 Gr. 3 Pf. an Zubuße und 220 Th. – Gr. – Pf. für 120 Fuder Eisenstein Einnahme á 1 Th. 16 Gr. – Pf. überhaupt, also 502 Th. 4 Gr. 3 Pf. Einnahme und ebensoviel Ausgabe, zur Zeit keine Grubenschuld, wohl aber 21.678 Th. 13 Gr. 6 3/5 Pf. Receß gehabt hat, liegt in einer von dem Dorfe Oberscheibe gegen Mitternacht sanft ansteigenden Schlucht. 2.) Es ist dieselbe mit einem an dem Scheibner Bächel angesetzten 290 Lr. zum Theil querschlagsweise gegen O. größtentheils aber gangweise gegen Mitternacht bis an den zweyten 20 Lr. saiger tiefen Tageschacht und von selbigem noch 120 Lr. gangweise gegen Mitternacht, jedoch mit sehr vielem Ansteigen getriebenen Stolln gelöset. 3.) Der Bau wird auf einem zwischen den Stunden 10 – 11 streichenden, unter 20 Grad gegen Abend fallenden Flachen Gange, oder einem flachgangweise streichenden Eisenstein Lager verführet, welches ½, ¾ bis 1¼ Lr. mächtig ist und rothen und schwarzen Glaskopf mit Quarz führet. 4.) Da dieser Gang oder dieses Lager über dem Stolln größtentheils wenigstens auf eine Länge von 200 Lr. von Vorfahren bereits völlig abgebauet ist, so hat in neuern Zeiten, um sothanen Gang auch unter dem Stolln verfolgen zu können, auf die Erbauung eines Kunstgezeugs werkthätiger Bedacht genommen werden müßen. Weil aber hierzu von außen keine Aufschlage Waßer vorhanden gewesen, so ist deßen Erbauung und in Betriebsetzung lediglich dadurch möglich geworden, daß man, weil mit demselben gegen Mitternacht viele Waßer erschroten sind, und derselbe wie unter sub Numm. 2 gedacht, von dem 2ten Tageschacht von welchem in wenig Entfernung gegen Abend das Kunstgezeug hänget, auf eine Länge von ohngefähr 109 Lr. mit bey nahe 10 Lr. Ansteigen getrieben ist, besagte Stolln Waßer mittelst einer in dem 2ten Tageschacht 11 Ellen über dem Stolln angesetzten, gegen Mitternacht söhlig bis auf die ansteigende Stollnsohle getriebene Rösche, auf ein 10½ Ellen hohes Kunstrad zum Aufschlage Waßer hat brauchen können. 5.) Mit diesem Kunstgezeuge nun, welches wie schon erwähnt, ohnweit des 2ten Schachts im Hangenden des Eisenstein Lagers gegen Abend hängt, ist erstlich 4½ Lr. bis auf das Eisenstein Lagers Liegende, und unter solches noch 4 Lr. saiger, überhaupt 8½ Lr. saiger abgeteuft und dadurch über 16 Lr. flache Höhe von vorerwähntem Eisenstein Lager getrocknet worden. Hiervon ist zur Zeit noch nicht mehr als eine Länge von 20 bis 24 Lr. von Stolln bis Kunstschacht Tiefstes abgebaut, auf die übrige Länge, sowohl vom Kunstschacht gegen Mitternacht, als Mittag, hingegen, sind nur erst wenige Stroßen ausgehauen, alles übrige aber stehet noch im Ganzen bey ½ bis 1½ Lr. mächtigen, guten Eisenstein an. Es hat dieses Gebäude also, wenn nicht unvorherzusehende Unglücksfälle eintreten, ohngeachtet der vielen Grundwaßer halber, bevor nicht mehre als die ietzigen Aufschlage Waßer erlanget werden, und ohngeachtet, daß das Stolln Ort gegen Mitternacht durch ein Kalck Lager abgeschnitten und vom Kunstschachte gegen Mittag etwas schmaler und geringer, als gegen Mitternacht ist, dennoch auf eine lange Reihe von Jahren zu einer beträchtlichen Eisenstein Förderung sichere Aussichten. 6.) Die gegenwärtig gangbaren und Versuchs- Baue bestehen in folgenden: a.) bey 12 bis 14 Lr. flacher Teufe werden abwechselnd mit 5 bis 8 Mann auf ¾ bis 1 Lr. mächtigen schwarzen und rothen Glaskopf und inneliegenden Quarz führenden Gängen, vom Kunstschacht sowohl gegen Mitternacht, als gegen Mittag einige Fürsten und Stroßen ausgehauen. b.) wird bey 119 Lr. vom 2ten Schachte gegen Mitternacht in der Stolln Sohle nahe am 3ten Schacht ein Querschlag in der Absicht gegen O. getrieben, theils um ein anderes in der Seite liegendes, ohngefähr 50 bis 60 Lr. entferntes Eisenstein Lager zu überfahren, theils um mehre Aufschlage Waßer dadurch zu erschroten, mit 4 Mann betrieben, und ist dermalen 20 Lr. vom Haupt Flügel erlängt. Wobey zu bemerken, daß die Gewerkschafft wegen dieses Querschlagsbetriebes auf beschehenes unterthänigstes ansuchen vermöge gnädigsten Befehles vom 25. October 1785 auf drey Jahre Zehenden Erlaß erhalten hat. 7.) Die Grundwaßer sind, wie schon Numm. 6 bemerklich gemacht, sehr starck, dringen mehrentlich aus dem Liegenden hervor, und werden mittelst 4 Kunst Sätze von 12 Zoll Weite gehalten. Die Unterhaltung der Kunst in Ansehung der Lederung so wie deren Wartung ist dem Steiger verdingt und erhält derselbe für erstere auf 4 Sätze á 21 (Gr.?) auf eine Woche quartaliter 3 Th. 19 Gr. – Pf. und für letztere wöchentlich 4 Gr. 8.) Die Förderung wird durch den Haspel bewerkstelligt, würde aber durch einen leichten Pferde Göpel, wenn in Zeiten hierauf der Bedarf genommen worden wäre, viel vortheilhafter geschehen können. 9.) Die Zimmerung ist äußerst schwerköstig, und erfordert jährlich gegen 120 Stämme 16 bis 20 Zoll starcke 40 bis 45 Ellen lange Schachthölzer. 10.) Nach reiflicher Überlegung, wie künftighin der Grubenbau bey dieser Zeche fortzustellen und was sonst etwa zu verfügen seyn möchte, wurde folgendes veranstaltet: a.) Daß, solange als es die Aufschlage Waßer gestatteten, lediglich auf den tiefsten Puncten der Eisenstein Bau verführet, die oberen Puncte hingegen als Reserve Baue anstehen gelaßen werden sollten. b.) Daß man zu Einschränkung der so beträchtlichen Holtz Consumtion an schicklichen Puncten Bergfesten stehen zu laßen habe. c.) Daß der sub. Numm. 6 lit. B. erwähnte Querschlag mit möglichster Geschäftigkeit (?) fortzustellen sey, und wenn mit selbigem die vorhabende Absicht erreicht worden, d.) auf die Anlegung eines anderweiten bey dem 2ten Tageschacht 11 Ellen über dem Stolln anzusetzenden ebenfalls gegen O. zu betreibenden Querschlags werkthätigen Bedacht zu nehmen sey, indem man hierdurch nicht allein das obbemerkte in der Seite gegen O. stehende Eisenstein Lager an einem schicklichen Puncte überfahren, sondern auch die Aufschlage Waßer vermehre und hierdurch, da besonders der größte Theil der Grund Waßer in der Nähe des Kunstschachtes aus dem Liegenden hervordringen, nämlich die Grund Waßer verminderen und die Aufschlage Waßer vermehren könnte, welches denn von soviel größeren Nutzen seyn würde, wie man sich dadurch in den Stande setze, weiter abteufen, tiefe Strecken treiben und über solche tüchtige Bergfesten stehen laßen, auch da sich der Eisenstein nach der Teufe augenscheinlich verbeßert, austräglich Eisenstein fördern zu können. Und endlich d.) wie bey der Berechnung sämtlicher seit der Erhebung des Gebäudes geförderter Eisensteine, der seit 2tem 1786 geförderte Eisenstein angemerkt ist, soweit als es möglich ist, in den vorherigen Registern zurück zu gehen, sämtliche geförderte Eisensteine zu summieren und in künftigem Register aufs ietzige Quartal Trinitatis mit Bemerkung der Zeit, von welcher das Anhalten genommen, aufzuführen. Welches nachrichtlich anhero bemerket, Erasmus Christian Friedrich Schindler, Bergschreiber.“ Der zuvor wieder von Schichtmeister Richter abgefaßten Anzeige auf das vorangegangene Jahr zufolge, sind 1786 mit 15 Mann Belegung 496 Fuder Eisenstein im Wert von 826 Thalern, 16 Groschen ausgebracht worden (40169, Nr. 221, Blatt 40Aff). Derselben Zusammenstellung in Vorbereitung der nächsten Generalbefahrung, deren Protokoll wir oben gerade wiedergegeben haben, kann man dann entnehmen, daß im gesamten Jahr 1787 ein Ausbringen von 512 Fudern zu verzeichnen war, mithin die Förderung noch einmal gesteigert werden konnte (40169, Nr. 221, Blatt 49ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Angaben über den Fortgang der Arbeiten liefern
uns dann die Fahrbögen des im Bergamt Scheibenberg zu dieser Zeit tätigen
Berggeschworenen Johann Samuel Körbach aus dem Jahr 1788 (40014,
Nr. 175, Film 0030f):
26ten Apr. 1788 Fahrbogen von Vater Abraham zu
Oberscheibe gelegen, Belegung. „Dieses Grubengebäude war da mit
Befahrung. „1.) Die Befahrung geschah zu dem Oberen und letzten Tageschacht 22 Lachter hinein bis Stollnsohle, auf dieser gegen Morgen, halb Mitternacht 33 Lachter bis für anstehendes Ort. Allhier bemerkte man, daß in 25 Ltr. Distanz ein Eisensteinlager angefahren worden, welches nun hehrdennn gegen 3 Lachter mächtig und bestehend aus grauem und Glasköpfigen Eisenstein; deßen streichen 7 und sein Fallen gegen 20 Grad in Mittag. Da nun dieses neue angefahrene Eisensteinlager sowohl im Streichen als auch im Fallen ausgerichtet worden, so haben dieses Ort fernere Arbeit, in Qurgestein getrieben, eingestellt, und dem Steiger dahin zugewiesen, einen Bau auf dem neu ausgerichteten Eisensteinlager vorzurichten. 2.) geschah die Befahrung von oben gedachten Tageschacht auf der Stollnsohle, auf dieser gegen Occ. Sept. (NW) ohngefähr 110 Ltr. (?) flachgangweiß bis an den Kunstschacht, demselben 8½ Lachter saiger in Liegenden hinein bis auf eine in Abend betriebene Strecke, auf die for bis Stroßenbau. Allhier bemerkte man ein Eisenstein Flötzlager, von ½ bis 1 Ltr. mächtig, bestunde in grauen glasköpfigen Eisenstein, mit weißem Quarz vermenget, deßen Streichen oc. 4 und sein Fallen gegen Abend bei 20 Grad. Auf nur gedachten Flötzlager wurde sowohl das Ort in Mittag, wie auch der Stroßenbau verführet. Anmerkung. Der Querschlag, welcher vom 3ten oder obern Schacht in OR. zu betrieben, theils um ein anderes, in der Seite liegendes Eisensteinlager zu überfahren und mehrer Aufschlag Waßer zu erschroten. So bis der letzten gehaldenen General Befahrung in ao. Trinitatis 1787 bey 20 Ltr. Erlängung, in Morgen angestanden, wozu die Gewerkschaft wegen dieses Querschlagsbetriebes auf beschehenes unterthänigstes Ansuchen auf 3 Jahre den Zehenden Erlaß zu erhalden hat, ist nun mehro bey fernerem Fortbetrieb in Morgen & Mitternacht bei 13 Ltr. Erlängung, in Summa 33 Ltr. ein Eisensteinlager angefahren, deßen Streichen 7 und Fallen in Mittag, bestehend aus 3 Ltr. mächtigen, grauen und glasköpfigen Eisenstein, mit vermengtem weißen Quarz.“ Herr Körbach wird uns nun auf einige Jahre bei unseren Recherchen begleiten... Über das Anfahren eines anderen Eisensteinlagers am 3. Tageschacht hat Herr Körbach auch im Bergamt Annaberg gesonderte Anzeige erstattet (40169, Nr. 221, Blatt 52f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In seinen Befahrungsbericht vom November 1788 gibt uns der Berggeschworene Johann Samuel Körbach genauere Angaben darüber, wie der Abbau eigentlich ausgeführt worden ist (40014, Nr. 175, Film 0051f): 8ten Nov. 1788 Fahrbogen über das Berg- und Grubengebäude Vater Abraham zu Oberscheibe gelegen, in Scheibenberger Bergamts Refier im Quartal Luciae 1788 No. 4te Woche. „a) Bey diesem Grubengebäude wird der Bau 8 Ltr. unter der Stollnsohle durch den Steiger und 14 Bergarbeiter auf einem Std. 10 streichenden und in Abend gegen 20 Grad fallenden, 1 bis 1½ Ltr. mächtigen, grauen Eisensteinlager zu 2 und 3/3tel Belegung getrieben, als ad 1.) wird auf der tiefsten Sohle vom Kunstschacht aus ein Ort durch 3 Mann zu 3/3teln Belegung fortgestellet, mit 1 Ltr. Höhe. Ist nun gedachtes Ort 2 bis 3 Ltr. erlänget, so werden die Förstenstöße mit 1 und 2 Ltr. Höhe nachgeschlagen und also eine Höhe gegen 4 Lachter von der tiefsten Sohle bis an die zu stehen bleibende 3 bis 4 Lachter starke Bergfeste und werden quartaliter 136 Fuder Eisenstein gefördert, ad 2.) wird auf der alden Stolln 2 Ltr. von dem Hereinkommen des untern Tageschachtes in Mittag ein Ort in Quärgestein in der Stunde 5,4 in Morgen betrieben, welches nun mehro von dem alden Stolln bis für anstehendes Ort 7 ⅛ war, wird durch 2 Mann zu 2/3tel Belegung fortgestellet. Die Absicht mit Betrieb diesen Orts ist 1.) mehre Aufschlagwaßer zu erschrothen. Weil in tiefsten auf dem Liegenden sich immer starcke Waßerzugänge fünden, und 2.) das bereits schon in Mittag angefahrene Eisensteinflötzlager mit diesem Ort weiter in Morgen zu überfahren und mit hoffnungsfollen Anbrüchen wieder auszurichten.“ Obwohl in den Texten eigentlich immer von einem ,Strossenbau´ die Rede ist, wurde nach dieser Beschreibung doch von einer zuerst vorgetriebenen Grundstrecke aus in die Firste eingeschlagen, so daß man also von einem Firstenbau sprechen müßte. Der Begriff Strossenbau wurde sicherlich deshalb hier verwendet, weil man ja zu dieser Zeit längst schon unterhalb der Stollnsohle abbaute. Da die drei Jahre mit Ende 1788 abgelaufen waren, erbaten die Gewerken der Grube am 5. Dezember dieses Jahres noch einmal um Verlängerung des Zehntenerlasses (40169, Nr. 221, Blatt 54ff). Zur Prüfung der Angelegenheit erfolgte am 19. Januar 1789 eine erneute bergamtliche Grubenbefahrung. Gegenüber der letzten Generalbefahrungs- Registratur vom Jahr 1787 fällt uns in dieser auf, daß hierin hinsichtlich der Beleihung nicht von Lehnen und Posten die Rede ist, sondern von einer Fundgrube nebst einem weiteren Maß (40169, Nr. 221, Blatt 57ff). Wie man dann aber in der Anzeige des Schichtmeisters Richter behufs der Revision im Jahr 1789 herausfindet (40169, Nr. 221, Blatt 72ff), bezog sich diese Angabe gar nicht auf die eigentliche Grube Vater Abraham, wo alles beim alten geblieben ist, sondern auf das beredte neue Lager am 3. Tageschacht. Die Gewerken hatten unter dem Namen Neues Glück Fundgrube dort am 28. Juli 1787 eine separate Grube gemutet. Sie wurde „auf vorstehende Muthung an den Muther Hrn. Schichtmeister Christian Gottlob Richter dem Berggebäude Vater Abraham zu Oberscheibe zum besten nach vorhergegangener Besichtigung des Hrn. Obereinfahrers und Geschworenen Odontius bestätigt und verliehen unter dem Namen Neues Glück eine Fundgrube nebst der ersten oberen Maaß auf einem flachstreichenden und gegen Abend fallenden Gange, welcher mit dem Stollnort in 27 Lr. Länge von dem letzten Tageschacht überfahren worden ist.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 107) Auf Mutung vom 4. Februar des Folgejahres hin erhielt die Gewerkschaft am 18. Februar 1789 auch das 1. und 2. untere Maß zu dieser Grube bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 123). Nach der Befürwortung durch das Bergamt wurde jedenfalls am 12. März 1789 auch in Dresden genehmigt, den Zehnten noch weitere zwei Jahre bis Ende 1790 zu erlassen, was das Bergamt den Gewerken am 16. April 1789 mitteilen konnte (40169, Nr. 221, Blatt 65ff). Der Anzeige des Schichtmeisters zum Grubenbetrieb zufolge wurde übrigens im ganzen Jahr 1788 ein Quantum von 544 Fuder Eisenstein ausgebracht (40169, Nr. 221, Blatt 72ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die quartalsweisen Befahrungsberichte der
Berggeschworenen des Scheibenberger Reviers sind in den Akten des
Bergarchives ziemlich vollständig bewahrt. So können wir über den Fortgang
des Abbaus Johann Samuel Körbach weiter zitieren (40014, Nr. 175,
Film 0072f):
8ten Apr. 1789 Fahrbogen über das Berg- und Grubengebäude Vater Abraham zu Oberscheibe gelegen, im Quartal Reminiscere 1789 No. 13te Woche in Scheibenberger Bergamts Refier. „Dieses Grubengebäude war mit
1.) der tiefste Bau, 8 Ltr. unterm Stolln, mit 12 Mann, auf dem Eisenstein Lager, theils mit Ortsbetrieb, wie auch sowohl fürstenweiß in Mittag verführet. Das Eisenstein Lager bestunde aus 1 bis 1½ Ltr. grauem Eisenstein mit vermengtem Quarz und Glimmerschiefer. 2.) würd bey dem untern Tageschacht 11 Ellen über der Stollnsohle das Ort in halb Mitternacht und Morgen, so in Quärgestein, in Stunde 5,4, mit 4 Mann Belegung fortgestellet, war nunmehro 14¾ Ltr. bis für Ort fortgebracht. Ferner 3.) der Quärschlag, mit nur gedachter Sohle und gegen 6 Ltr. Entfernung vom Schacht in Mitternacht, würd gedachter Quärschlag in Stunde 3,4 in halb Abend und Mittag mit 2 Mann betrieben, war nunmehro 30 Lachter bis für anstehendes Ort erlänget. Vor gedachtem Ort zog sich förstenweiß ein blauer Schiefer herein und es fanden sich in Stunde 3 streichende Klüffte mit führenden Schwefelkieß hierin.“ Wie wir schon aus den Angaben zum Ausbringen in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wissen, stand Vater Abraham tatsächlich kontinuierlich durchgehend in Betrieb. Auch hinsichtlich der anfahrenden Mannschaft änderte sich zwar je nach Bedarf die Zusammensetzung etwas, die Anzahl der hier angelegten Bergarbeiter blieb aber von nun an ebenfalls über lange Zeit stabil. Über das Anfahren der Schwefelkies- führenden Trümer berichtete der Geschworene am 4. Juli 1789 auch in Annaberg (40169, Nr. 221, Blatt 77). Wieder ein halbes Jahr später berichtete Johann Samuel Körbach über seine Befahrung an das Bergamt in Scheibenberg (40014, Nr. 175, Film 0106f), daß mit gleichgebliebener Belegung folgende Arbeiten ausgeführt worden sind: „1.) Der Bau 8 Ltr. unter der Stollnsohle auf dem Eisenstein Lager mit 4 Mann betrieben werde, dieses Eisensteinlager hat sich ganz aus seinem Streichen gewendet, da es sonst immer 10,4 hatte, so hat es inzwischen 5 und fällt in Mitternacht, die Mächtigkeit ist gegen 1 bis 1½ Ltr., bestehet noch aus schwarzem Glaskopf mit braunem Lehm und glimmerischen Eisenstein, wird der Bau mit Betreibung eines Orts in Abend auf dem Liegenden des Flözes auf der tiefen Sohle fortgestellet, förstenweiß auf dem Liegenden ausgeschramt, das Flöz nachgeschossen, ad 2.) würd das Ort 11 Ellen über der Stollnsohle, ohnweit des hereinkommenden Tageschachtes in Morgen das schon weiter in Mittag angefahrene Eisenstein Lager mit gedachten Ortbetrieb, allhier anzufahrenden 3 Mann fortgestellet in Quärgestein, wurde 20 Ltr. erlänget, ferner 3.) auf oben gedachter Sohle der Quärschlag in Abend war 46 Ltr. fortgebracht, da aber die Mannschaft ietzo nicht zureicht, so wird gedachter Quärschlag anietzo nicht betrieben. Es ist von diesem Grubengebäude 128 Fuder Eisenstein in diesem Quartal vermeßen worden.“ Scheibenberg, den 27. Dec. 1789 Johann Samuel Körbach, Berggeschworener. Auch von den Anzeigen des Schichtmeisters Richter zum Grubenbetrieb haben wir in den Grubenakten noch weitere finden können. Im ganzen Jahr 1789 wurde der nächsten zufolge eine Förderung von 536 Fudern Eisenstein erreicht, also fast dieselbe Menge, wie im Vorjahr (40169, Nr. 221, Blatt 75ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner Befahrung im Quartal Reminiscere 1790 fand Herr Körbach zu berichten, daß mit gleicher Belegung (40014, Nr. 175, Film 0119f): „2.) der Bau bey 8 Ltr. Saigerteufe unterm Stolln mit 12 Mann zu 3/3tel auf dem Eisenstein Lager, welches Stunde 5 streicht und gegen 40 Grad in Mittag fällt, aus 2 Ltr. mächtigen grauen Eisenstein mit Quarz bestehet, verführt. 3.) wird bey dem untern Tageschacht 11 Ellen über der Stollnsohle das Ort im Quärgestein in Stunde 5,4 in Morgen mit 1 Mann fortgebracht, war 41¾ Lachter ins Feld gebracht, wird fernerweit mit 1 Mann, in der Hoffnung, das schon weiter in Mittag überfahrene Eisenstein Lager mit gedachtem Ortsbetrieb wieder anzufahren, betrieben. Mann hat auch schon bey 30 Lachter Distanz vom Stolln aus anietzo ein Trum von 3 Zoll Gneus mit etwas grauem Eisenstein überfahren, deßen Streichen 11,1 und Fallen in Abend hat.“ Die Mächtigkeit des Eisensteinlagers hatte offenbar im jetzt angefahrenen Abschnitt wieder zugenommen und wird hier mit zwei Lachtern (≈ 4 m) angegeben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Winterhalbjahr (Befahrung im Quartal Luciae 1790)
hatte man zur Unterstützung des Steigers einen Untersteiger angestellt.
Ansonsten blieb die Belegung der Grube bei 14 Mann (40014, Nr. 175, Film
0139f), „durch welche
ad 2.) der Bau, 8 Ltr. saigrer Teufe unterm Stolln auf dem Stunde 3 streichenden und in Abend fallenden 1½ Ltr. mächtigen, aus grauen Eisenstein mit vermengter brauner Eisenerde und Quarz bestehenden Lager verführet, vermittelst Ortsbetriebs und Förstenarbeit bis an die stehen bleibende Bergfeste; von der tiefsten Sohle bis gedachter Bergfeste 3 Lachter hoch und in Mittag ausgehauen; ist von gedachten Bau in diesem Quartal 128 Fuder Eisenstein vermeßen worden. 3.) Befande, daß in Kunstschacht Tiefsten gegen 2 Lachter Waßer aufgegangen waren; die Ursache hiervon war der Mangel an Aufschlagewaßer. Man würde noch mehr nothleiden, wenn nicht mit dem Quärschlag, so 11 Ellen über der Stollnsohle in Morgen betrieben würde; ist in allem von Ober Stolln 47½ Lachter bis in Morgen anstehendes Ort fortgebracht; Mann hat mit solchem drey flach streichende Lager angehauen, welche (…?) aus Gneuß und Letten mit wenig einbrechenden Eisenstein, von 1, 2 bis 3 Ltr. Mächtigkeit überfahren; auf solchen nun haben sich immer etwas Waßer gefunden, welche die Aufschlage Waßer vermehret haben. Ad 4) Ob das Eisenstein Lager, welches von gedachten Quärschlag gegen 136 Ltr. Länge in Mittag, von gedachten oberen Stolln, mit einem 25 Ltr. in Morgen betriebenen Quärschlag ist überfahren worden, mit erstgedachten 47½ Ltr. in Morgen betriebenen Quärschlag, noch zu überfahren sein dürfte, ist bald zu zweifeln, würde sich am besten beweisen, wenn, von dem Herrn Markscheider der schon längst anbefohlene Zug verrichtet würde.“ Oh ‒ ein uns von anderen Gruben schon wohlbekanntes Problem: Die Markscheider nahmen aber auch viel zu hohe Gebühren, die sich die Gewerken gerne so lange wie möglich ersparen wollten... Auch der Mangel an Aufschlagwasser ist leicht erklärlich; liegt doch die Grube ziemlich weit oben am Westhang des Scheibenberges. Von übertage bringt man dort nur schwer einen Aufschlaggraben heran, zumal man sich über die Wasserrechte an dem kleinen Bachlauf ja auch noch mit den Mühlenbetreibern in Unterscheibe und Markersbach hätte einigen müssen. Aufgrund der Behinderung des Betriebes durch den Wasseraufgang gab es hierzu gleich am 7. Januar 1791 auch wieder einen Fahrbogenvortrag des Geschworenen im Bergamt in Annaberg (40169, Nr. 221, Blatt 79). Trinitatis 1791 fanden wir keine Befahrungsnotizen des Berggeschworenen in den Akten. Der nächste Bericht datiert auf Crucis 1791, worin Herr Körbach vermerkte: „befande das Kunstgezeug abgeschitzet, da das Kunstrad (...?) wandelbar geworden war und solchen nicht mehr zu helfen, so wird dieses abgetragen, welches 10½ Ellen hoch war und dafür ein neues von 11 Ellen eingebaut, welches auch bald färtig ist und der Ober Kunst Steiger Grund beaugenscheiniget hat, ist auch geschehen und hat befunden, daß man stadt der ganzen Bruchschwinge nur eine halbe zu hengen hat, ist die Radstube, so in Holz stehet, an verschiedenen Punckten wandelbar (unleserliche Passage ...?) derselben bis in Gang herzustellendes Kunstgezeug immer gegen drey Wochen Dürre.“ Und im letzten Quartal 1791 hielt der Berggeschworene fest (40014, Nr. 175, Film 0177): „ad 1) befande das neue 11 Ellen hohe Kunstrad nebst einer neuen halben Bruchschwinge eingebaut war, die Radstube an verschiedenen Punckten repariret. 2) fernern die Waßerm, so bis Stollnsohle aufgegangen, waren 4 Ltr. gewältiget, ist weiter nichts vorgefallen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Bericht des Geschworenen vom 2. April 1792
liest man dann davon, daß die Mächtigkeit des Lagers vor dem Ort wieder
deutlich abgenommen habe (40014, Nr. 185, Film 0016):
Über Vater Abraham Eisensteinzeche zu Oberscheibe gelegen, „ad 1.) Belegung Befande das Grubengebäude mit 1 Ober, 1 Untersteiger, 5 Häuern, 1 Lehrhauer, 3 Knechten und 2 Jungen beleget, in summa 13 Mann, durch welche 2.) der Bau bey 8 Ltr. Teufe unterm Stolln auf dem in West halb Nord fallenden Eisenstein Lager verführet vermittelst Ortsbetriebs in Süd und förstenweiß. Vor dem Ort befande das Lager noch gegen 1 Elle mächtig bestehend aus grauem Eisenstein mitführendem Glimmer und scheinet, als wenn es das Lager wolle zerschlagen. In der Förste bey 2 Ltr. Höhe erreicht, ist das Lager noch gegen ein Lachter mächtig, bestehet aus grauem Eisenstein, braunem Horn und etwas führenden Glimmer.“ Eine Elle Mächtigkeit (die Dresdener hatte rund 0,53 m Länge) ist gegenüber den zuvor gemachten Angaben von bis zu 4 m Mächtigkeit nicht mehr viel... Im folgenden Sommer reichte dann erneut das Aufschlagwasser nicht für den Betrieb des Kunstgezeuges (40014, Nr. 185, Film 0022): Vater Abraham „Allhier wird bey 8 Ltr. Teufe unterm Stolln 7 Ltr. vom Kunstschacht in West beym Quärschlag auf dem Stunde 10 streichenden und in West fallenden Eisenstein Lager durch Menschenhände die Waßer vermittelst Pumpen gehalden, und auf sothanen Flöz abgeteufet. Dieses Flöz war 1 Ltr. mächtig, bestand aus grauem Eisenstein und Horn mitführendem Quarz. War das Abteufen in allem ½ Lachter unter erstgehaldner tiefsten Sohle niedergebracht. Habe die Vorsteher des Grubengebäudes angewiesen, eine leichtere und (?) Förderung herzustellen. Die Möglichkeit mehr Förderung ist vorhanden (unleserliche Passage ?) jeden Kübel gegen 3 gr Ersparniß kann gemacht werden, wenn nur die Herren Hammer Herren als dasige Gewerken, wollen 30 bis 40 Thaler Kosten aufwenden werden.“ 25ten Juny 1792 Von seiner Befahrung im September 1792 fand Johann Samuel Körbach nur kurz zu notieren (40014, Nr. 185, Film 0029): „Befande das Grubengebäude mit 1 Ober, 1 Untersteiger, 4 Häuern, 2 Lehrhauer, 2 Knechten und 3 Jungen beleget, in summa 13 Mann, durch solche wird durch den Untersteiger und 3 Mann auf dem Stolln Thürstöcke eingewechselt, auf dem untern Stolln bey 7 Ltr. Teufe stehengebliebene Mittel oder Bergförste des Eisensteins Lager mit 4 Mann gearbeitet und sind von solchen 80 Fuder Eisenstein gewonnen worden.“ 25ten Sept. 1792 Um das Ausbringen trotz abnehmender Lagermächtigkeit aufrecht zu erhalten, ging man nun offenbar daran, die Bergefesten zu schwächen. Mit einer etwas geringer gewordenen Belegung von nunmehr 12 Mann (40014, Nr. 185, Film 0038): „wird der Bau mit 6 bis 7 Mann auf dem untern Stolln stehengebliebene Bergförste, so aus Eisenstein bestehet, abgebauet und ist von solchem in diesem Quartal 120 Fuder gefördert und vermeßen worden. 3. wird mit 2 Mann dem Stolln in Thürstockzimmerung ausgewechselt und 4. ist ein Überhauen angeleget auf einem von Alten Vorfahren verlaßnen Eisenstein Lager, ist 2¼ Lachter mächtig, soll auf dem Stolln vom hangenden ersten abgebauten Flöz Durchschlag gemacht werden, welcher von dem 20 Ltr. tiefen Tageschacht in ohngefährner Länge 19 bis 20 Lachter in Süd auf dem Stolln wird heraus kommen, welches zum frischen Wetterzug und zum Fördern mit benutzet werden soll, und ist bey der stehengebliebenen Bergförste südlicherseite angeleget.“ 19ten Dec. 1792 Auch Baue der Vorfahren wurden noch einmal angegriffen, bei denen der Eisenstein innerhalb der Gangmasse nur noch „mitgeführt“ ist. Die Alten haben lieber das „Gute“ und einfach auszuklaubende Erz abgebaut und alles andere stehengelassen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch 1793 baute man die eigentlich doch
sicherheitshalber stehengelassene Schwebe unter der Stollnsohle weiter ab,
wie man in den Notizen Köbach´s lesen kann (40014, Nr. 185, Film
0053):
„Durch solche wird der Bau auf dem (?) 7 Lachter unterm Stolln und von dem Kunstschacht in Nord stehengebliebene Bergförste des Eisensteinlagers abgebauet, ist ½ bis 1 Ltr. mächtig, führt Hornstein und grauen Eisenstein.“ 23.April 1793 Und im folgenden Quartal heißt es (40014, Nr. 185, Film 0061): „b) gangbare Baue betr. Würd mit 9 Mann zu 3/3tel Belegung der neue Kunst und Förderschacht mit 5 Ellen Länge und 1½ Ellen Weite dem Eisenstein Flöz ins Liegende oder Morgenseite abgesunken, war 2¾ Ltr. unter der Stollnsohle niedergebracht, befindet sich vom alden Kunstschacht in 6 Ltr. Länge in Süd. Würd mit 5 Mann auf dem bey 6 Ltr. unterm Stolln stehengebliebene Bergfeste der Eisenstein ausgebaut, ist 1 bis 1½ Ltr. mächtig und bestehet aus braunem Hornstein mitführendem Eisenstein.“ Ende des Jahres 1793 war dann das ja ,wandelbar´ gewordene Kunstrad erneuert, worüber Herr Körbach notierte (40014, Nr. 185, Film 0075): „Befande, daß nun mehro das Kunstgezeug in dem 8 Ltr. saiger tief unterm Stolln in Quärgestein abgesunkenen Kunst und Förderschacht eingebauet war, wird nunmehr Stroßen Bau auf dem flach streichenden und unter einem Winkel gegen 25 Grad in West fallenden Lager in Nord vorgerichtet.“ 15ten Nov. 1793 Ein Jahr später war der neu vorgerichtete Strossenbau schon auf 12 Lachter (rund 24 m) Länge ausgehauen (40014, Nr. 185, Film 0116): „Der Bau wird bei 6 Ltr. saiger Teufe unterm Stolln auf dem vom Kunstschacht 12 Ltr. langen und in Nord auftragenden (?) Strossen Bau auf dem Stunde 12 streichenden und unter einem Winkel gegen 20 Grad fallen in Abend verführet, sothanes Lager ist gegen 3 Ellen mächtig, führt Quarz, braunen Hornstein und schwarzgrauen Eisenstein.“ 15. Nov. 1794 So ging auch im Folgejahr der Betrieb weiter (vgl. 40014, Nr. 193, Film 0006: Fahrbogen vom 30. Januar 1795 und Film 0016: Fahrbogen vom 19. Juni 1795). Im letztgenannten Fahrbogen vom Quartal Trinitatis 1795 ist noch folgende Anmerkung enthalten: „Man hat bey diesem Grubengebäude in diesem Quartal Trinitatis a. c. gegen 112 Fuder Eisenstein gewonnen, waren an die Herren von Elterlein Erben zu Großpöhla 84 Fuder vermeßen und Herrn Carl Heinrich von Elterlein zum Pfeilhammer waren 14 Fuder auf ihren Antheil Kuxe und die Herren Gebrüder Nützsche haben sich keinen vermeßen laßen, wenn auf ihren Antheil 84 Fuder zustände. Die Ursache, warum sich solche keinen anietzo vermeßen wollen laßen, währe diese, weil sie bey ihrem Hammerwerk mit dergleichen Eisenstein Vorräthen überhäufet wären. Sollte ihr Antheil Eisenstein bey dem Register in Vorrath aufgeführet werden, bis sie solchen brauchten. Ob nun solches geschehen könne, bitte ich mir von deren Churfürstl. Bergamt als Eisenstein Meßer gütigste Resolution aus, wie ich mich dabey verhalten soll.“ Hier werden wieder einmal die Gewerken und Abnehmer des Erzes angeführt und aus den ihnen zustehenden Erzmengen kann man auf die Verteilung der Kuxe schließen. Eine bergamtliche Entscheidung hierzu zu erwirken, erfolgte am 20. Juni 1795 auch wieder ein Fahrbogenvortrag des Geschworenen im Bergamt in Annaberg (40169, Nr. 221, Blatt 82). Der Fahrbogen des nächsten Quartals berichtet erneut, daß die Nietzsche's auf dem Hammerwerk in Obermittweida den Eisenstein noch nicht abgenommen haben (40014, Nr. 193, Film 0024). Mit dem Steiger und 12 Arbeitern „wird der Strossenbau vom Kunstschacht in Nord verführet, ist gegen 16 Lachter erlengt. 2tens Ist in diesem Quartal Crucis a. c. gegen 104 Fuder Eisenstein gewonnen und zutage ausgefördert worden, wovon an das Pfeilhammerwerk 13 Fuder, und zum Großpöhlaer Hammerwerk 13 Fuder vermeßen worden; hingegen haben die Herren Gebüder Nitzsche ihren zustehenden Antheil von 78 Fuder nicht vermeßen laßen; befindet sich nunmehro mit dem im Quartal Trinitatis nicht vermeßnen Eisenstein 162 Fuder auf der Halde bey der Grube; habe also auch weder Zehnden noch Ladegeld in das Rentamt Schwarzenberg einreichen können. Bitte Eu. Churfürstl. Bergamt, die Herrn Nitzsche zu bedeuten nebst ihren Steiger und Arbeitern zum vermeßen stellen zu laßen, ihre zurückgebliebene Eisensteine, es möchte sonst Unordnung bey dem Amtsherrlichen Zehndnern, wie auch bey der Grube selbst entstehen.“ 26. Sept. 1795 Erst Ende dieses Jahres scheinen beim Obermittweida'er Hammer Absatz und Bedarf an Erz wieder aufgekommen zu sein, denn Herr Körbach hielt am 30. Dezember 1795 dann fest (40014, Nr. 193, Film 0030), man habe „in diesem Qu. Luciae 96 Fuder gewonnen und sowohl diesen, als die zurückstehenden 162 Fuder vermeßen lassen.“ Damit waren nun auch die Bergamtsgebühren, die Ladegelder und der Zehnte wieder auflaufend und die befürchtete „Unordnung“ war damit vermieden. Warum der Bedarf an Eisenerz 1795 in Obermittweida stockte, haben wir noch nicht näher untersucht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Sommer des Folgejahres (am 30. Juni 1796) hat Herr Körbach über die Grube Vater Abraham „nichts veränderliches befunden.“ (40014, Nr. 193, Film 0048) Am 19. November 1796 erfolgte aber wieder eine amtliche Grubenbefahrung durch Bergmeister Schütz aus Annaberg (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 83ff). Den noch gewinnbaren Vorrat schätze dieser auf nur noch 90 Quadratlachter Lagerfläche nördlich vom Kunstschacht, südlich davon aber auf wenigstens 500 Quadratlachter. Hinzu käme aber ja außerdem noch das am 3. Tageschacht angefahrene, neue Lager. Außerdem wies der Bergmeister an, man solle zur Minderung des Bedarfes an Ausbauholz in den Abbauen Pfeiler stehen lassen und die Krümmung des Stollnverlaufs bei 75 Lachter vom 1. Lichtloch durch einen geraden Umbruch beseitigen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1797 berichtete der Geschworene dann, mit einer Belegung von derzeit 11 Mann werde das 3 Ellen mächtige Lager nun schon 19 Lachter vom Kunstschacht entfernt abgebaut (40014, Nr. 196, Film 0008). Crucis 1797 war die Belegung wieder auf 13 Mann angestiegen und man baute bei 19½ Ltr. Länge ab Kunstschacht im Strossenbau das hier nun ½ bis ¾ Ltr. mächtige Lager ab, welches Hornstein, Quarz und grauen Eisenstein führe (40014, Nr. 196, Film 0048). Nahezu gleichlautend ist auch Körbach´s Eintragung aus dem Quartal Luciae 1797 (40014, Nr. 196, Film 0067) und auch im Fahrbogen vom 25. August 1798 gab es über den Abbau nichts wesentlich Neues zu berichten (40014, Nr. 196, Film 0132). Man baute weiterhin unter dem Stolln ab, wobei man „sowohl Stroßen als Förstenaushieb“ anwandte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grubenbetrieb
bei Vater Abraham im 19. Jahrhundert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So ging es auch in den Folgejahren weiter: Im Bereich
westlich des Kunstschachts unterhalb der Stollnsohle war das
Eisensteinlager offenbar sehr ergiebig. Reminiscere 1799 fand der
Geschworene Körbach den Strossenbau noch auf 19 Lachter Länge nach
Norden vorgerichtet (40014, Nr. 199, Film 0013), Trinitatis 1799 gab er
bereits 27 Lachter Länge an. Luciae 1799 notierte er, das 2 bis 3 Ellen
(rund 1,7 m) mächtige Lager im Strossenbau werde mit 8 Mann Belegung
weiter „stroßenweiß“ gegen Nord ausgehauen (ebenda, Film 0077f).
Außerdem hielt er fest: „Es wird der Umbruch auf dem Stolln von dem
1ten Lichtloch bei 83 Ltr. südl. Länge mit 2 Mann betrieben, in Stunde 7
gegen Ost, war vom Hauptstolln in Quergestein 6¼ Lachter erlengt, wird
noch gegen 12 Lachter in der Richtung zu treiben sein, durch solchen wird
gegen 20 Lachter Stolln abgeworfen, welche schwerköstig in Holz in
Reparatur zu unterhalten war.“
Von seiner Befahrung im Quartal Luciae 1800 (40014, Nr. 200, Film 0060) gab es zu berichten: „Befande das nunmehro der Umbruch auf dem Stolln, welcher bey 83 Ltr. südl. Länge von dem 1sten 11⅛ Ltr. saiger tiefen Lichtloch angefangen worden, und in Quergestein gegen Ost aufzufahren in Stunde 7 ist der Durchschlag mit 19 Ltr. auffahren wieder im Stolln gemacht und ist 1 Elle tiefer unter der Stollnsohle eingekommen. Ist also die (?) des Stollns und schwerköstige Zimmerung abgeworfen worden und beßrer Abzug in der Wassersaige verschafft worden. Ad 2. Wird der Stroßenbau ... in Nord mit 11 Mann ausgehauen, das Lager ist 2 Ellen mächtig...“ 25. Oct. 1800 Zu dem erfolgreichen Durchhieb des Umbruchs gab es am 1. November 1800 einen Fahrbogenvortrag in Annaberg (40169, Nr. 221, Blatt 87). Auch Trinitatis 1801 fand der Berggeschworene nichts wesentlich neues vor (40014, Nr. 202, Film 0027f). Der Strossenbau stand weiter gegen Nord mit 12 Mann in Abbau, das Lager war im derzeit angegriffenen Abschnitt 1½ bis 2 Ellen mächtig. Luciae 1801 war die Mächtigkeit wieder auf bis zu 3 Ellen angewachsen und auch Reminiscere 1802 ging der Abbau im Strossenbau mit 9 Mann Belegung weiter (40014, Nr. 202, Film 0076). Die übrige Mannschaft war auf einem Flügelort des Stollns angelegt, das man vom Hauptstolln an dessen Nordseite gegen Morgen in Quergestein betrieb, „um mehr Teufe unter die Radstube einzubringen.“ (40014, Nr. 202, Film 0099f) Eine weitere amtliche Grubenbefahrung führten Bergmeister Schütz und Geschworener Körbach im November 1802 durch, worüber im Sitzungsprotokoll des Bergamtes in Annaberg vom 13. November festgehalten ist, man habe das Kunstgezeug in wandelbarem Zustand gefunden, ferner herrsche Mangel an Aufschlagwasser (40169, Nr. 221, Blatt 88f). Aus diesem Grund waren wieder einmal die Wasser im Tiefbau unter der Stollnsohle um 3 Lachter aufgegangen. Man wollte den Abbau oberhalb des Wasserspiegels zwar fortsetzen, aber dort kam Wettermangel hinzu. Um dem Mißstand abzuhelfen, verlängerte man nun das Wasserort und beabsichtigte, ein größeres Kunstrad einzuhängen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1803 berichtete Herr Körbach (40014, Nr. 209, Film 0017), man baue jetzt „bey 5 Ltr. Teufe unterm Stolln und 17 Ltr. westl. Entfernung vom Kunstschacht im Stroßen- und Förstenbau mit 9 Mann Belegung in 3/3teln“ und es „wurden 2 Stroßen und ein Förstenstoß... in Nord ausgehauen.“ Daß man noch nicht wieder in 8 Lachtern Teufe unter der Stollnsohle bauen konnte, lag noch immer daran, daß es noch an Aufschlagwasser mangelte und die Grundwasser demzufolge noch nicht abgesenkt werden konnten. Die Lagermächtigkeit gab er mit 2½ Ellen an. Das Wasserort in Quergestein war nun schon 54 Ltr. lang und es fehlten noch gegen 4 Ltr. bis zum Einkommen in Radstube. Einen längeren Bericht an das Bergamt in Scheibenberg faßte der Geschworene Körbach wieder auf das Quartal Trinitatis 1803 ab (40014, Nr. 209, Film 0025f). Darin heißt es: „Befande, daß wegen Fäulniß das Kunstrath zusammengebrochen war und also die Grundwaßer bis Stolln Sohle hoch aufgegangen waren. 2tens wurde wurde die Radstube mit dem Steiger und 5 Mann zu 2/3teln mit wünkliger ganzer Schrothzimmerung, weil solche von allen vier Seiten nicht haltbares Gestein ist und vielen Druck hat, von der Radstuben Sohle auf starke Grundlage die Jöcher von 12 bis 14 Zoll Stärke auf geschrothen, wird nunmehro 14 Ellen lang und 13½ Ellen hoch mit Holz Schroth vorgerichtet, wird anstatt ersteren Kunstrath, so 11 Ellen hoch war, nunmehro eines von 12 Ellen Höhe, alsdann wenn die Rathstube färtig sein wird, eingebaut. 3tens war das Umbruchsort, so auf dem Stolln in der Nord Seite, bis in die Rathstube mit 58 Ltr. Länge durchschlägig gemacht und durch solchen Ortsbetrieb 1½ Ellen mehr Gefälle anhergebracht, 4tens wird mit 2 Mann auf der Stolln Sohle von dem 20 Ltr. saigeren hintern Tageschacht in Süd auf allda Stunde 6 streichenden und Nord fallenden Eisenstein Lager, welches 2 Ltr. mächtig ist, überhauen, solches Lager führt Hornstein, Quarz und grauen Eisenstein, 5tens wird das sogenannte Wetter Ort vom Stolln nach dem Kunstschacht mit 2 Mann betrieben, den ansehnlichen Theil Waßer, welcher zeithero sich im Kunstschacht hangenden oder Abendseite hereingezogen hat und mit dem Kunstgezeug hat müßen herausgehoben werden, wird sodann, wenn das Ort bis dahin gebracht ist, solches auf der Stollnsohle abgeführt.“ Na ja ‒ der Kunstradbruch wäre auch heute ein meldepflichtiges Ereignis gewesen... Am 30. April 1803 gab es deshalb wieder einen Fahrbogenvortrag hierzu im Bergamt in Annaberg (40169, Nr. 221, Blatt 90f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber die Betriebsleitung und die Belegschaft waren
fleißig und die Gewerken zahlungskräftig und so konnte der Geschworene
Körbach von seiner Befahrung im folgenden Quartal Crucis 1803 bereits
berichten (40014, Nr. 209, Film 0038):
„Befande, daß nunmehro die Radstube 16 Ellen lang mit 13 Ellen Höhe durchaus mit Sparrn und aufgeführter ganzer Schrothzimmerung hergestellt war, und 2tens war nunmehro das verförtigte Kunstrad von 12 Ellen Höhe und 15 Zoll im Lichten Weithe geschaufelt, von Tag herein geschafft und eingebaut. 3tens wurde der Förstenbau von dem 2ten Tageschacht übern Stolln in 11 Ltr. südl. Endfernung, mit 3 Mann auf dem Stunde 11 streichenden und westl. fallenden Lager betrieben, ist solches gegen 2 Ltr. mächtig und führt Hornstein und grauen Eisenstein.“ Wie in den Fahrbögen des Berggeschworenen zu lesen ist, ging es danach wieder normal weiter: Reminiscere 1804 berichtete er, daß wieder in 7 Lachter Teufe unterm Stolln und 20 Lachter vom Kunstschacht in Mitternacht abgebaut wurde (40014, Nr. 213, Film 0009). Auch Trinitatis und Crucis 1804 waren 15 Mann in Dritteln mit dem Ausschlagen von Strossen 4 bis 6 Lachter unter der Stollnsohle und nun 24 Lachter vom Schacht aus befaßt (40014, Nr. 213, Film 0018f und 0033). Luciae 1804 wurde der Strossenbau bei 6 Lachter Teufe unter der Stollnsohle weiter in Nordrichtung betrieben und eine neue Strosse bei 8 Lachter Teufe vom Kunstschacht aus angehauen. Das Lager war hier aber nur 3½ Ellen mächtig (zirka 1,9 m, 40014, Nr. 213, Film 0046). Außerdem wurden im Beisein des Geschworenen Luciae 1804 noch 80 Fuder Eisenstein vermessen, wovon 60 Fuder nach Obermittweida, 10 Fuder zum Pfeilhammer und weitere 10 an den Großpöhla'er Hammer (den Siegelhof) gegangen sind (40014, Nr. 213, Film 0057). Vom Quartal Reminiscere 1805 berichtete Herr Körbach, es seien 9 Mann in 3/3 Belegung auf dem Abbau in Richtung Mitternacht 6 Lachter unterm Stolln angelegt und dort sei das Lager noch 2½ Ellen (zirka 1,3 m) mächtig, weitere 6 Mann seien mit Ortsbetrieb und Förstenaushieb in 8 Lachter Teufe unterm Stolln in Mittag beschäftigt (40014, Nr. 232, Film 0003). Praktisch gleichlautend sind die Notizen des Geschworenen aus den Quartalen Trinitatis bis Luciae 1805 (40014, Nr. 232, Film 0013 und 0030). Luciae 1805 gingen von Vater Abraham 60 Fuder Eisenstein nach Obermittweida und 70 Fuder an den Pfeilhammer (40014, Nr. 232, Film 0039f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ende 1805 schied Herr Körbach aus seinem Dienst
aus. Weil man die Stelle nicht sofort neu besetzen konnte, hat der damalige Bergamts- Protokollist Friedrich August Schmid „In gehorsamster Befolgung
der unterm 18ten Januar a. c. an das hiesige Bergamt erlaßnen
hochwohlen Ober Bergamts Verordnung (...) Unterzeichneter mit
besondrer Beziehung auf die zu §75 des diesjährigen Haushalts Protocolls
von Seiten des Bergamtl. Directorii getroffnen Verfügungen am 6ten
und 7ten Februar a. c. folgende Grubengebäude befahren...“
(40014, Nr. 233)
In der nachfolgenden Liste findet man unter der Nummer 3 (40014, Nr. 233, Film 0005ff): 3. Vater Abraham zu Oberscheibe „Rubricirtes Grubengebäude ist gegenwärtig mit 19 Mann, als
belegt, durch solche Mannschaft folgende Baue verführt werden: a) ein Stroßenbau bei 4 Lachter Teufe unterm Stolln und 15 Lachter nördlicher Entfernung vom Kunstschacht. Das Vater Abrahamer Eisensteinlager ist hier 12 bis 24 Zoll mächtig, besteht aus dichtem Brauneisenstein, Hornstein und Quarz und verflächt sich 20° gegen Abend. Belegt ist dieser Bau gegenwärtig mit 2 Mann. b) Ein Ort bei 8 Lachter Saiger Teufe unterm Stolln und 6 Lachter nördlicher Länge vom Kunstschachte. Hier wird auf einem 1 Lachter mächtigen, aus dichtem Brauneisenstein mit Hornstein, Quarz und Glimmerschiefer bestehenden zweiten Eisensteinlager gebaut, welches Stunde 5,6 in SW streicht und 15° südliche Verflächung hat. Dieser Bau ist mit 2 Mann zu 2/3 belegt. c) In derselben Sohle ein Ort bei 8 Lachter südlicher Länge vom Kunstschachte auf demselben Lager. Letzteres ist hier ½ bis 1 Lachter mächtig und mit 2 Mann belegt. d) Ein Ort gegen Ost auf dem sub a) beschriebenen Eisensteinlager. Das oben erwähnte Eisenstein constituirt hier neben dem Hornstein und Quarze eine Mächtigkeit von ¾ Lachter und das Ort war ebenfalls mit zwei Mann belegt. e) Ein Ort in derselben Sohle gegenwärtig in Gewältigung. Bei Aufgewältigung dieses Ortes, welches des frischen Gebirges wegen während des letzten Radstubenbaus im Jahr 1803 (…) zu Bruche ging, hat man die Absicht, die ehemalige Communication derselben mit dem Pkt. a. beschriebenen Stroßenbau gegen Nord wiederherzustellen, um dadurch gegen den gegenwärtigen Förderungsweg, welcher aus dem Tiefsten durch Tröge (?) bis Kunstschacht geschieht, eine bequemere Förderung zu erhalten. Die Gewältigung dieses Orts gegen Nord geschieht durch zwei Mann.“ Veranstaltung „Da bei dem sub a. erwähnten Stroßenbau die Förderung gegenwärtig mittels eines ein Lachter weiter in N. angebrachten Rollochs bis auf einen zwei Lachter tiefer befindlichen Stroßenbau und von da aus bis Stolln geschieht, so ist, um diesen weitläufigen Förderungsweg in einen kürzeren zu verwandeln, der Steiger angewiesen worden, eine ½ Lachter Hohe und sechs Lachter in S. zurückgehende Stroße nachzureißen und dadurch, mit besonderer Beziehung auf den sub. e. bemerkten Plan, eine zur Förderung mit gehöriger Höhe und Weite versehene Strecke herzustellen.“ Der vom Geschworenendienst- Versorger getroffenen Festlegung halber, gab es hierzu am 22. Februar 1806 wieder einen Fahrbogenvortrag im Bergamt Annaberg, wobei man seitens des Amtes die Festlegungen genehmigte (40169, Nr. 221, Blatt 91). In der 6. Woche des Quartals Trinitatis 1806 befuhr Herr Schmid die Grube erneut und berichtete darüber (40014, Nr. 233, Film 0022f): Vater Abraham zu Oberscheibe. „Bei der heutigen Befahrung dieses Gebäudes wurden sämtliche in No. 6te Woche des vorigen Quartals beschriebenen Baue annoch belegt befunden und ist bei selbigen gegen das vorige Quartal etwas Veränderliches nicht vorgefallen... Die Veranstaltung anlangend, ...so ist diese bewerkstelligt worden... Bei Befahrung des dasigen, in sehr schwerköstiger Zimmerung stehenden Stollns ist letzterer in gutem Standt, jedoch der auf den Stolln niedergehende erste Tageschacht oder Lichtloch sehr wandelbar befunden worden, weshalb dem Steiger die Auswechslung der preßhaften Punkte in selbigem sofort aufgegeben worden ist.“ In der folgenden Woche hatte Herr Schmid dann die Aufgabe (40014, Nr. 233, Film 0022f): „bei Vater Abraham zu Oberscheibe 155 Fuder Eisenstein, als
Eine der letzten Eintragungen in dieser Akte betrifft erneut die Grube Vater Abraham und entstammt dem Quartal Reminiscere 1807 (40014, Nr. 233, Film 0044). Herr Schmid berichtete, daß alles wie vorbeschrieben fortgestellt werde und: „Hierüber ist annoch zu bemerken, daß die getroffne Veranstaltung völlig ausgeführt befunden“ wurde, worüber der Beamte sicherlich zufrieden gewesen ist. Dies wurde am 28. Februar 1807 auch auf der Bergamtssitzung in Annaberg zur Kenntnis genommen (40169, Nr. 221, Blatt 92). Ferner fand er aber noch bemerkenswert, es „wurde annoch wahrgenommen, daß das dasige Eisensteinlager aus seiner Hauptstreichungslinie, der Std. 10 sich in Std. 6 gewendet habe, woraus zu vermuthen ist, daß dieser Punct vielleicht der Durchfaltungs Winkel der in diesem Stücke Gebirge aufsetzenden zwei Haupteisensteinlager sei, von welchen das eine bekanntlich Std. 10,4 bei 20° westlicher Verflächung, das andere Std. 5,6 bei 15° südlicher Neigung gegen den Horizont streicht.“ Ab Mitte 1807 hat dann Christian Friedrich Schmiedel die Funktion des Berggeschworenen in Scheibenberg wahrgenommen (40014, Nr. 235).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einer durch das Oberbergamt gehaltenen Generalbefahrung halber wurde dann im Jahr 1807 der folgende Aufstand
aufgesetzt (40001, Nr. 115, Blatt 129ff,
Abschrift in 40169, Nr. 221, Blatt 93ff):
praes. 9ten Juny 1807
Aufstand und Grubenbericht 1.) (?) und bergmännische Lage der Grube. „Dieses uralte Eisenstein Berggebäude liegt am oberen Ende des Dorfes Oberscheibe, in einer daselbst gegen Mittag Morgen sanft aufsteigenden Schlucht, wo in alten Zeiten weiter in Morgen verschiedene Teiche angeleget, aus welchen die Waßer auf eine in gedachtem Dorfe befindliche Mühle geleitet gewesen, so aber in neuern Zeiten gänzlich eingegangen und durch den dasigen Bergbau, besonders durch den dahin einschlagenden Stollen (jetzt Waßerreichen Orte) beynahe völlig getrocknet (sind?).“ 2.) Innere Beschaffenheit des Gebürges. „Das Gebürge, in welchem gedachte Grube lieget, hat gleiches Fallen und Aufsteigen mit dem dasigen Eisensteinlager, und bestehet aus einem viel aufgelösten Glimmerschiefer, das Liegende des Eisensteinlagers gleicht oft mehr einen grauen sandigen Letten und ist sehr guhrig, das Hangende ist etwas wenig fester und ist, wenngleich auch Örter durch das Quergestein getrieben wurden, dennoch eine sehr schwerköstigen Zimmerung unterworfen.“ 3.) Beschreibung des dasigen Eisensteinlagers. „Das 1te und mächtigste Eisensteinlager dieser Grube ist dasjenige, so anjetzt bebauet wird, sein Streichen ist hora 10 – 11 und fällt unter einem Winkel von ca. 20 Grad in Abend, die Mächtigkeit desselben ist ¼, ½, auch bisweilen 1 und 1¼ Lachter, und besteht aus dichtem und fasrigem Brauneisenstein, braunem Eisenocker, auch aus eisenschüssigem Glimmerschiefer, und bisweilen schwarzem Glaskopf, nebst Quarz und Hornstein, seine größte Mächtigkeit ist anjetzt bey 8 bis 10 Lachter Entfernung vom Kunstschacht gegen Mittag, als woselbst man zur Zeit weder das (?) Hangende, noch Liegende, so wie selbst das Streichen des Lagers richtig bemerket, und es mehr den Anschein giebt, als sei es daselbst von einem andern übersetzenden Lager aus seiner sonstige Richtung verrückt worden, welches dann nur erst bei mehrer Ausbringung noch genauer zu bestimmen sein dürfte. Ein zweytes Eisensteinlager findet sich in ca. 90 Lachter Entfernung vom 2ten Tage- und Förderschacht gegen Mittag, oder 20 Lachter von dem 3ten Tage- und Waßerröschen Schacht gegen Mitternacht, deßen Streichen Stunde 5,6 und das Fallen 15° in Mitternacht ist, welches auch von den Vorfahren bis auf die jetzige Wasserröschen Sohle ziemlich abgebauet worden. Ein drittes Eisensteinlager ist dann bey ca. 20 Lachter von diesem 3ten Tageschacht weiter in Morgen auf der Wasserröschensohle angefahren, deßen Streichen hora 7 und das Fallen gegen Mittag ist.“ Einfügung des Verfassers: „Sie haben mit den obigen im Ganzen gleiche Bestandtheile.“ „Die Beschaffenheit und Ausdehnung dieser beiden letzten Eisensteinlager läßt sich anjetzt nicht so ganz genau bestimmen, indem in neuern Zeiten selbige nicht bebaut werden, und solche für der Hand unter der dortigen Wasserröschen Sohle anzugreifen, würde, weil ein Theil der jetzigen Aufschlagwaßer darin hergeleitet werden, nicht ohne Nachtheil des Kunstgezeugs, anzustellen sein.“ 4.) Aussichten der Grube nach ihrem Aufkommen, Betriebsplänen, Ausführungen und Metallausbringen. „Das Aufkommen dieser sehr alten Eisenstein Berggebäudes ist nirgends ausfindig zu machen und muß selbiges allem Anschein nach einer langen Reihe von Jahren in Umtrieb gewesen sein;“
Einfügung des Verfassers: „In den Ausbeutbögen erscheint diese Grube
„der dasige Stolln, welcher bey 300 Lachter nördlicher Entfernung in dem Dorfe Oberscheibe bey dem dasigen Bache langeleget, und von denen Vorfahren gegen Morgen in das Gebäude eingebracht worden, …“ Einfügung des Verfassers: „theils gang-, theils querschlagsweise und zwar 290 Lachter vom Mundloche bis 2ten, 20 Lachter saiger tiefen Tageschacht und von da nach 120 Lachter gangweise gegen Süd – jedoch mit sehr vielen Ansteigen,“ „…ist der erste Betriebsplan der Alten gewesen, denn in neuern Zeiten die Herstellung eines Kunstgezeuges nämlich erst in Stande gesetzt ist, die Eisensteine anjetzt bis 8 Lachter saiger unterm Stolln abzubauen. Ferner sind bey diesem Gebäude seit dem Quartal Crucis 1737 bis mit Schluß des vorigen Qu. Reminsc. 1807 23.729 Fuder Eisenstein, an Betrag für 30.020 Thl. 18 Gr. – Pf. ausgefördert worden.“ 5.) Dermahliger Zustand der Grube.
a.) Das Haupt
Eisensteinlager dieses Gebäudes in der Nähe des 19 Lachter tiefen 2ten
Tage-, Übrigens ist dieses Eisensteinlager von jetzigem Kunstschacht gegen Mittag bis in die 7 Lachter Teufe und gegen 30 Lachter Länge, einige zur Sicherstellung des Baues stehen gelaßne Bergfesten ausgenommen, dann in Mitternacht bis in die 8 Lachter Teufe und ca. 20 Lachter Länge größtentheils abgebaut, und in den mit diesem Abbau erlangten Stößen stehet der Eisenstein theils ¼ bis ¾ Lachter mächtig an; die 8te Lachter Teufe des Kunstschachtes, welche mittelst Verbeßrung des Kunstgezeuges erst ganz in neuern Zeiten hergestellt worden, ist gegen Mittag nur erst bis in die 8 und 10 Lachter Länge abgebaut, als woselbst der Eisenstein von sehr guter Beschaffenheit und über ¾ Lachter mächtig ansteht. b) Die Zimmerung bey diesem Eisensteinbau sowohl, als auch denen Stolln- und Waßerröschenstrecken, ist, wegen des sehr guhrigen Gesteins, schwerköstig, und ist deshalb durchaus sowohl in denen Schächten, als Strecken, in ganze Schrotzimmerung gesetzet; der Eisensteinbau hingegen wird durch Schlagung der Kästen verwahret, wozu deren sämtliche Unterhaltung jährlich 110 Stämme Schachtholtz von 10 bis 16 Zoll Stärke erforderlich sind. c) Mauerung hieselbst anzulegen ist wegen der fehlenden festen Seitenlagen, wenigstens ohne sehr großen Kostenaufwand, beynahe ganz unmöglich. d) die Waßer- und Wetterhaltung ist durch den bereits erwähnten, 290 Lachter langen Stollen, welcher beim Kunstschacht 19 Lachter saigerer Teufe einbringt, so wohl, als durch die Herstellung eines Kunstgezeugs bewirket; auf dem Stolln selbst befinden sich 2 Tageschächte, der 1te bey 90 Lachter Länge vom Mundloch, so 11 Lachter tief, damit anjetzt blos zur Bequemlichkeit der Stolln (Unterhaltung?) und der 2te 19 Lachter saiger tiefe Tageschacht, zugleich zur Ausförderung der Eisensteine und zum Wetterzug.“ Einfügung des Verfassers: „In den Bergamtsacten Fol. 41b, wird eine Länge von 410 Lachter angegeben. Damals wurde die jetzige Waßerröschen Länge von 120 Lachter mit zur Stolln Länge gerechnet, und hatte diese Länge sehr viel Ansteigens, daher solche in neuern Zeiten söhlig und zwar übern Stolln bey 12 Ellen Höhe fortgestellet und zu einen Wasserröschenort gebildet worden; welche Länge von 120 Lachtern nun dem Stolln abgehet.“ „Das Kunstgezeug so die Waßer 8 Ltr. saiger tief bis auf den Stolln mittelst 4 eingebauter Kunstsätze von 9 bis 11 Zoll Weite aushebet, erhält die Aufschlagewaßer durch die bey 13 Ellen Höhe übern Stolln gegen Mittag Morgen abgehenden Röschen Örter, und der größte Theil derselben entspringt bey dem auf 120 Lachter weiter in Morgen entfernten 3ten Tageschacht, welcher auf das dasige Waßerröschenort durchschlägig ist. Das Kunstrad selbst ist 12 Ellen hoch und bey Ende der 6 Ellen langen Korbstange mit einer Bruchschwinge versehen, vor welchem noch 12 Ltr. Streckengestänge bis Kreutz eingeschloßen, sich befindet. e) Die Förderung der Eisensteine wird auf denen nicht beträchtlich langen Förderstrecken mittelst Karrnhunten (?) und durch den untern Stolln 7 Ltr. tiefen Förder- sowie den dasigen 19 Ltr. tiefen Tageschacht mittelst Haspel Förderung bewürket, wo in einer Schicht aus dem Füllorte des ersteren, durch 5 Mann Arbeiter 5 Fuder oder 100 Kübel Eisenstein, zu Tage gefördert werden. f) Die Belehnung dieses Gebäudes bestehet aus
g) belegt ist das Gebäude mit
Übrigens werden denen Eigenlöhnern dieses Gebäudes, wovon zum
gehörig, die Zubußen nach den aufgewendten Kosten angeschlagen, welche im vorigen Quartal Reminiscere 356 Thl. 23 Gr. 9 Pf. betrugen; dagegen gedachte Eigenlöhner den geförderten Eisenstein in natura erhalten, und in eben diesem Quartal 112 Fuder á 1 Thl. 16 Gr. – Pf. folglich an Geldbetrag 186 Thl. 16 Gr. – Pf. empfangen haben, womit folglich der Receß um 170 Thl. 7 Gr. 9 Pf. oder bis auf 32.504 Thl. 22 Gr.- 5 11/40 Pf. gestiegen, dagegen aber zur Zeit noch keine Gruben Schulden angeschwollen, sowie bis jetzt auch noch keine Ausbeuthe gefallen.“ Letzteres ist ein recht interessanter Vermerk: So ähnlich nämlich wird es sicher bei sehr vielen Eisenerzgruben auch gelaufen sein. Zunächst einmal setzten sich die Gewerken hiernach aus den Hammerwerksbesitzern der Umgegend zusammen. Diese trugen zwar sämtliche Betriebskosten in Form von Zubußen selbst, erhielten im Gegenzug aber das gesamte geförderte Roherz „in natura“ zu einem festen Preis. Bei der Festlegung des Verkaufspreises mischte nun auch das Bergamt mit, denn das Erz wurde von diesem nach Gehalt und Verwertbarkeit taxiert. Wenn man den Preis für das Erz allein nach den Gestehungskosten gebildet hätte und nach anstehenden Kosten und Aufwendungen die Abnahme an Erz erhöhen oder senken würde, könnte die Rechnung dann glatt aufgehen. Damit hätte die Grube sogar im Freiverbau stehen können, denn sie hätte sich ja selbst getragen und eigentlich gar keine Zubußen benötigt. Tatsächlich überstiegen die Betriebskosten aber den Wert des ausgebrachten Erzes (zumindest in diesem Quartal um rund 170 Thaler), welche die Gewerken mittragen mußten. Dies taten sie auch vollständig. Dieser Verlag ging schließlich ja in den Rezeß ein, welcher bei einer Aufgabe des Bergbaus von den Gewerken vom Grubenbetrieb hätte zurückgefordert werden können. Mal abgesehen davon, daß dies mangels Masse in den wenigsten Fällen gelungen wäre, war es für die Kuxinhaber aber dennoch eine Art Geldanlage und die war es ihnen offenbar ‒ auch, wenn die Chance, es eines Tages tatsächlich zurückzuerhalten, höchst gering war ‒ wert. Die stetig gesicherte Rohstoff- Lieferkette für die eigenen Hüttenbetriebe aber war von weit größerer Bedeutung, zumal gerade wieder einmal kriegerische Zeiten herrschten und Napoleon's Heere durch Europa zogen. Letztendlich betrieben die Gewerken die Grube also nicht eines Gewinns aus dem Erzverkauf halber, sondern ausschließlich für ihren eigenen Rohstoffbedarf. Dann fällt uns hier noch auf, daß der Begriff „Posten“ hier neben die „Lehen“ gestellt wird, als ob es etwas gleichartiges wäre. Dies würde ja darauf verweisen, daß es sich dabei auch um ein Flächenmaß gehandelt haben könnte. Und noch eins: Es gab außerdem ja noch die Fundgrube „Neuglück“ nebst Maßen, die den Gewerken 1788 (damals „Neues Glück“ genannt) bestätigt worden ist. Diese umfaßte das andere Lager am 3. Tageschacht. Den Abbau dort nahm man vor der Hand aber deshalb noch nicht in Angriff, weil das Wasserlaufsort aus dieser Richtung die Aufschlagwasser zum Kunstschacht führte und man befürchtete, diese Wasser dem Kunstrad zu entziehen und dem Stolln zuzuschlagen, wenn man dort den Abbau aufnähme. Nach diesen Anmerkungen kommen wir wieder zurück zum Text des Grubenaufstands.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Vorhandene Aussichten und Pläne der fernerweit festzustellenden Betriebspläne. „Der hauptsächlichste Plan bey diesem Gebäude dürfte dahin gerichtet sein, um in der Folge der Zeit mehre Teufe herzustellen, besonders, da die Eisenstein Anbrüche auf der jetzigen tiefsten Sohle fast ununterbrochen von guter und auch bereits angezeigter Mächtigkeit anstehen bleiben, damit, wenn die jetzige Teufe ihrer Länge nach völlig abgebaut sein sollte, man in Standte gesetzt wäre, einen tieferen Bau und ununterbrochene Eisenstein Förderung herzustellen.“ Einfügung des Verfassers: „Es scheint überhaupt, als würde dieses Eisensteinlager in mehrer Teufe an Mächtigkeit zunehmen.“ „Ob nun schon jetzt dieser Plan in eben dieser Hinsicht noch auf verschiedene Jahre hinaus zu setzen wäre, weil man für jetzt noch ansehnliche Baue über dieser Sohle vor Handen hat, so dürfet doch man nach und nach zu einer allmählichen Vorrichtung zu schreiten sein, und besonders die noch von dem Kunstschachte zurück stehende, 2 Ellen hohe Stroße mittelst eines Querschlages von 18 Ltr. Länge vom Stolln aus herein zu holen, um dann diese Höhe dem Kunstschachte abzunehmen, dann endlich wenn das jetzige Kunstrad wiederum einmal wandelbar werden sollte, selbiges nach der jetzigen Radstube um ½ bis ¾ Ellen zu erhöhen, wo man hoffentlich in Standte gesetzt werden könnte, noch einige Lachter mehre Saiger Teufe den Kunstschacht herzustellen, und solchen dann nach (?) Teufe oder nach dem Fallen des Eisenstein Lagers berechnet, würde diesem Gebäude noch eine ansehnliche Dauer, in Rücksicht der Eisenstein Förderung, versprechen, da ein Lachter saigerer Teufe doch gegen 3 Lachter Abbau des Eisensteinlagers gewährete. Schlüßlich sind jene weiter in Morgen befindlichen beyden Eisensteinlager ebenfalls noch eine vortheilhafte Aussicht in die Zukunft, welche jedoch, da die Aufschlagewaßer zum Kunstgezeug von selbigem zum Theil weit hergeleitet sind, nicht eher in Angriff genommen werden können, als bis man einen tieferen Abbau des jetzt bebaut werdenden Eisensteinlagers für ganz unmöglich findet.“
Annaberg, Monat Juni 1807.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem die Generalbefahrung ‒ übrigens
durch keinen Geringeren. als den späteren (ab 1826) sächsischen
Oberberghauptmann Sigismund August Wolfgang Freiherr von Herder ‒
erfolgt war, hielt man im Bergamt noch Folgendes darüber fest (40001,
Nr. 115, Blatt 135ff, Abschrift in 40169,
Nr. 221, Blatt 99ff):
Registratur Praesentes Sn.
Hochwohlgeboren, der Herr Bergcommissionsrath von Herder als hoher
Revisions Commissarius, Herr Bergmeister Schütz, Herr Geschworener
Schmiedel, Herr Bergamts actuarius Schmidt, hierüber „Über die heutigen Tages von Do. Commiss. Sr. Hochwohlgeboren, der Herr Bergcommissionsrath von Herder, mit Zuziehung der in margine angegebenen Personen, und Subscriptio, auf der Eisensteingrube Vater Abraham zu Oberscheibe ohnweit Scheibenberg abgehaltene Befahrung und hierauf erfolgte Delibiration über den bei dem Gebäude fernerweit zu verfolgenden Betriebsplan war nachstehendes zu registrieren. Die Befahrung geschah zum 2ten Tage- oder Förderschacht hinein bis auf den Vater Abraham Stolln, von selbigem nach dem Kunstschacht, hiernach in die nach dem vorstehenden Aufstande dermalen gangbaren Baue, zurück bis in die Radstube, und von da wieder zu Tage aus. Der dasige Hauptbau befand sich zur Zeit, nach (?) Inhalt des schon gedachten Aufstandes, 8 Lachter unter dem Stolln, woselbst bei 9 Lachter südlicher Entfernung vom Kunstschachte ein Ort gegen Mittag durch 2 Mann fortgebracht wird, um den hinter dem Orte ansteigenden, mit 10 und zuweilen 12 Mann belegten Hauptförstenbau, welcher sich bis zum Kunstschachte fortzog, mehre Erlösung (?) zu geben. Das Ort wurde auf dem Lager selbst, und zwar in deßen Lilegenden getrieben, das Lager strich hier, wie es schien, Std. 12, fiel gegen 60 Grad in Abend, statt daß es sich sonst immer auf 70 (?) Grad gegen eben diese Weltgegend verflächte und war bei einer Mächtigkeit von 1 ½ Lachter sehr reich an derbem Brauneisenstein und braunem Glaskopf. Überhaupt bemerkte der Schichtmeister, Hr. Richter, hierbei, daß man wegen der Qualität des Eisensteins wohl auf viele Jahre hinaus geborgen sei, nur die Abnahme fehle immer in dem erforderlichen Maaße, da der Vater Abrahamer Eisenstein leicht Kaltbruch verursache, und auf 44 Kübel Rothenberger kaum 16 Kübel hiesiger Eisenstein gesetzt werden könnten, es hätte daher auch die anfahrende Mannschaft selbst während des verfloßnen Sommers ein Zeit lang wieder ausfeiern müßen. Hiernächst war auch 12 Lr. nördlich von dem obbemerkten Orte, in derselben Sohle noch ein Bau mit 2 Mann belegt, wo das Lager einen Bauch zu werfen und mehr gegen Abend sich zu ziehen schien.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Bemerkung ist uns eine weitere
Einfügung wert, da wir auch erst nachschauen mußten, was denn damit
eigentlich gemeint ist: In Meyers Konversationslexikon (Ausgabe 1888)
haben wir folgenden Eintrag hierzu gefunden:
„Kaltbruch, die Eigenschaft mancher Metalle, bei der mechanischen Bearbeitung (Hämmern, Walzen etc.) in gewöhnlicher Temperatur rissig zu werden, eine Folge von fremden Beimengungen (z. B. von Phosphorgehalt bei Schmiedeeisen, von Kupferoxydul bei Kupfer) oder veranlaßt durch kristallinische Struktur, welche durch Guß bei nicht gehöriger Temperatur entstanden ist.“ (peterhug.ch) Diese Eigenschaft steht übrigens im Gegensatz zum sogenannten Rotbruch, was die Brüchigkeit des Eisens bei höherer Temperatur (etwa beim Schmieden) bezeichnet. Dafür sind dann in erster Linie Beimengungen von Arsen, Antimon oder Kupfer im Eisenerz und damit auch im Roheisen verantwortlich. Etwas ausführlicher als der kurze Vermerk im Lexikon ist die nachfolgende Beschreibung aus einer österreichischen Enzyklopädie des Eisenbahnwesens (Freiherr von Röll, 1913): Eisen und Stahl „Das Eisen, wie es die Technik für ihre mannigfaltigen Zwecke verwendet (über die Verwendung im Eisenbahnwesen, s. Art. Baustoffe, Bd. II, S. 32), ist durchaus nicht der reine Grundstoff, den die Chemie der Metalle als solchen kennt, sondern stellt stets eine Verbindung oder Legierung des reinen E. mit anderen metallischen und nichtmetallischen Elementen dar. Teils unvermeidlich, teils beabsichtigt, treten bei der hüttenmännischen Erzeugung die fremden Beimengungen aus den verwendeten Roh- und Hilfsstoffen in das E. ein. Dem Einflusse dieser Körper, die das E. in seinen verschiedenen Arten begleiten und im Wege der metallurgischen Prozesse auf das erwünschte Maß gebracht werden, verdankt es seine Eigenschaften, die es für die Praxis verwendbar und schätzenswert machen. Das chemisch reine E. hat keine technische Bedeutung, da es ein Metall von geringerer Zähigkeit und Härte ist. Unter den, das E. begleitenden nichtmetallischen Körpern, spielt vor allem der Kohlenstoff die wichtigste Rolle, neben ihm das Silizium, der Schwefel und der Phosphor. Von den Metallen fehlt fast nie das Mangan, und ist sehr häufig das Kupfer, wenn auch oft nur in sehr geringen Mengen, im E. enthalten. In vielen Fällen läßt der Verwendungszweck des Eisens die Gegenwart von Nickel, Chrom, Wolfram, Titan und Vanadium wünschenswert erscheinen. Vereinzelt werden Arsen, Antimon und Wismut als unerwünschte Begleiter des E. angetroffen. Die Anwesenheit von nur wenigen 100stel eines Prozentes jener angeführten Körper übt meistenteils auf die Eigenschaften des E. einen ganz erheblichen Einfluß aus. Die Kenntnis der Art und Weise des Einflusses, den die Fremdkörper für sich und in ihrer Wechselwirkung besitzen, ist demnach von der größten Bedeutung für die Erzeugung und Verwendung des E. Die Erforschung der verschiedenen Eisengattungen nach dieser Hinsicht ist heute ein besonderer Zweig der metallurgischen Wissenschaft geworden, der sich auf die mikroskopische Untersuchung des Gefüges stützt. (...) Am stärksten beeinflußt der Kohlenstoff die Eigenschaften des E. Er ist der wichtigste der fremden Bestandteile, da er ausnahmslos in allen im großen hergestellten und verwendeten Eisensorten vorhanden ist. Er wird vom E. leicht, aber nur in beschränktem Maße aufgenommen. Reines E. vermag wenig mehr wie 4% an Kohlenstoff aufzunehmen. Anwesenheit von Mangan oder Chrom steigern das Sättigungsvermögen des E. für Kohlenstoff derart, daß eine Eisenmanganlegierung (genannt »Ferromangan«) mit etwa 90% Mangangehalt ungefähr 71/2% Kohlenstoff enthält, während eine 50% Eisenchromlegierung (»Ferrochrom«) sogar einen solchen von 8% aufweisen kann. (...) Der Kohlenstoff drückt mehr als andere Körper den Schmelzpunkt des E. herab. Kohlenstoffarmes E. schmilzt bei etwa 1500° C, während der Schmelzpunkt bei einem Kohlenstoffgehalt von ungefähr 4% auf 1100° C. sinkt. Sein wichtigster Einfluß besteht in der Steigerung der Härte und Festigkeit, allerdings auch der Sprödigkeit des E., wogegen die Dehnbarkeit und Schmiedbarkeit mit zunehmendem Kohlenstoffgehalte vermindert wird. Das Silizium verbindet sich leicht und in jedem Verhältnisse mit dem E. Es macht das geschmolzene E. dünnflüssig und erhöht das Lösungsvermögen des E. für Gase, ein für Flußeisenerzeugung wichtiger Umstand. Die Aufnahmefähigkeit des E. für Kohlenstoff wird durch Silizium gemindert. Neuestens hat auch der Einfluß des Siliziums auf die magnetischen Eigenschaften des kohlenstoffarmen Flußeisens für die elektrische Industrie große Bedeutung erlangt. Auch der Phosphor wird vom E. in jedem Ausmaße aufgenommen. Er steigert die Härte des E., doch ist sein diesbezüglicher Einfluß weit unerheblicher als der des Kohlenstoffes. Da ein höherer Phosphorgehalt das Gefüge grobkristallinisch macht, wird solches E. spröde und läßt sich bei gewöhnlicher oder ganz besonders bei sehr niedriger Temperatur durch leichte Hammerschläge brechen, welche Erscheinung man den »Kaltbruch« des E. nennt. Die Höhe des Phosphorgehaltes, der den geschilderten ungünstigen Einfluß auf das E. auszuüben vermag, hängt von dem gleichzeitig vorhandenen Gehalte an Kohlenstoff derart ab, daß kohlenstoffarmes E. weit weniger empfindlich gegen den Einfluß des Phosphorgehaltes ist, als hochkohlenstoffhaltiger Stahl. Der Schwefel, der das E. im kalten Zustande so gut wie gar nicht beeinflußt, vermindert in Rot- und Weißglut jedoch seine Festigkeit derart, daß es bei der Bearbeitung durch Walzen, Schmieden u.s.w. bricht. Man bezeichnet diese Erscheinung als den »Rotbruch« des E. Das Ausmaß des derart üblen Einflusses des Schwefelgehaltes hängt ganz besonders von der Höhe des gleichzeitig vorhandenen Kohlenstoff- und Mangangehaltes ab, der dem Einflusse des Schwefels entgegenwirkt. (...) Das Mangan ist nahezu stets im E. vorhanden, ganz besonders im schmiedbaren E., dem es meistens absichtlich zugefügt wird. Es wird vom Eisenhüttenmanne wegen seines günstigen Einflusses auf die Festigkeitseigenschaften und die Schmiedbarkeit des E. als nahezu unentbehrlicher Begleiter sehr geschätzt. Als sehr häufiger Begleiter des E. in seinen Erzen gelangt das Kupfer in das E., das es bei seinem gewöhnlich nur niedrigen Gehalte kaum beeinflußt. Erst ein Kupfergehalt von ungefähr 1/2% beeinträchtigt merklich die Schmiedbarkeit und Schweißbarkeit des E. Nickel, Chrom, Wolfram und Titan, die als dem E. absichtlich zugefügte Bestandteile auftreten, verleihen ihm größere Härte, Härtbarkeit und in gewissen Fällen auch vermehrte Zähigkeit. Von diesen Einflüssen der genannten Körper macht die Eisenhüttentechnik auf dem Gebiete der Erzeugung der Spezialstähle, besonders des Werkzeugstahles ausgiebigen Gebrauch.“ Nun baute man auf Vater Abraham schon Ende des 18. Jahrhunderts in rund 40 m Tiefe Erz ab. Woher der Phosphor, der ja meistens oberflächennah vorkommt und organischen Ursprungs ist, hier in den Erzen stammte, ist unklar. Auch der Umstand, daß die Alten ja über dem Stolln schon lange vorher gebaut und damit Wasserwegsamkeiten im Gebirge geschaffen haben, die vielleicht einen Eintrag von Phosphaten in tieferliegende Schichten ermöglichen könnten, ist kaum als Argument zu nehmen, da eine Überdüngung der Felder damals noch kaum stattgefunden haben dürfte. In diesem Zusammenhang fällt uns aber ein, daß die Geschworenen gelegentlich auch Vorkommen von Eisenpecherz erwähnt haben. Sofern damit wirklich das Mineral Triplit – ein Eisenphosphat – und nicht ein Synonym für Stilpnosiderit gemeint war, könnte dessen Vorkommen natürlich die Kaltbruchneigung des aus diesem Erz erschmolzenen Eisens erklären.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doch wieder zurück zu Befahrung im Jahr 1807 (40001, Nr. 115, Blatt 135-140): „Die Radstube stand in ganzem Schrot, wie denn überhaupt in den Schächten ebenfalls lauter ganzer Schrot, und auf den Stollen und Strecken durchgehends ganze Thürstockzimmerung zu finden war. Ds. Commiss. fiel hierbey auf, daß man nicht lieber auf den Strecken, statt geschnittenen stärkeren Holzes, schmäleres rundes Holz gebrauche, wenn man auch würklich, nach des Schichtmeisters anführen, wegen Feigheit des Gebirges mit festen Widerlagern nicht ankömmen, und derhalb sowohl, als aus andern zur Genüge bekannten Gründen, die Zimmerung mit Mauerung vertauschen möchte, allein Herr Schichtmeister Richter entgegnete, daß, ob ihm wohl die vorzüglichste Wirksamkeit des ungeschnittenen Holzes gegen das Geschnittene nicht unbekannt sei, er dennoch ersteres dem letzteren, an minder perfekten Puncten besonders, vorziehen müßte, weil man dabei, wenn man das Holz mit der geschnittenen Fläche an das Gestein, und einen Stempel scharf an den anderen setze, das Verschieben hinter letzteren erspare. Besonders (?) aber fanden Ds. Commiss., daß die Zapfen des Kunstrades auf Lagern von Basalt gingen, und beide Zapfen sowohl, als Zapfenlager bereits 30 Jahre ohne ausgewechselt zu werden, gegangen sein sollten. Nach abgehaltener Befahrung gingen Ds. Commiss. mit den anwesenden Herren Bergbeamten und resp. Grubenvorstehern über den Zustand und ferneren Betrieb des Gebäudes zu Rathe, und erklärten zuvörderst, daß über den bisherigen Betrieb und deßen Fortstellung um so weniger etwas einzuwenden sei, da man bereits das Eisensteinlager so weit aufgeschloßen habe, um, vernehmlich bei dem leider geringen Absatzquanto, auf 20 und mehr Jahre gnügliche Anbrüche zu haben, überdieß könne man sich schon durch Forttrieb der obern Örter gewiß noch mehre Anbrüche verschaffen, und wenn je ein vergrößerter Absatz an Eisenstein noch stärkere Vorräthe davon nöthig machte, so dürfte ja nur die in der 15 Lachter- Strecke unter Tage gegen Morgen vom Kunstschachte ausgerichteten zwei Eisensteinlager, welche ebenfalls sehr reich an Eisenstein und nur wenig bebaut wären, mit in Angriff genommen werden. Allerdings billigten Ds. Commiss. die Absicht des Schichtmeisters, jene vorerwähnten zwei Lager dermalen noch nicht und nur im Nothfall anzugreifen, indem nach dem Anführen des Schichtmeisters der Mangel an Aufschlagwaßer für das Gebäude oft sehr drückend wäre, und gerade von den besagten Eisensteinlagern dermalen noch ein großer Theil Aufschlagwaßer herkäme, welche bei dem Abbaue der ersteren in die Teufe dem Kunstgezeuge entgehen, ja sogar durch selbiges gehalten werden müßten. Dieser Umstand gab zugleich Veranlaßung, über die dem hiesigen Kunstgezeuge zu verschaffende größere Wirksamkeit zu sprechen. Zu dieser Hinsicht waren Ds. Commiss. erstlich mit den Herrn Schichtmeister darin vollkommen einverstanden, daß als ein nächster auszuführender Plan, um die Waßerhaltung bei Vater Abraham zu erleichtern, die Nachreißung der nach dem tiefen Stolln vom Kunstschachte noch zurückstehenden 2 Ellen hohen Stroße anzusehen sei, um sodann die saigere Höhe des Kunstschachtes eben so weit vermindern, und das Lager ohne die jetzigen Aufschlagwaßer zu vermehren, noch 6 Ellen mehre flache Teufe abbauen zu können. Zweitens bemerkten Ds. Commiss., daß auch die vom Herrn Schichtmeister nach erfolgter Stroßennachziehung vorgeschlagene Erhöhung des jetzigen, 12 Ellen hohen Kunstrades auf 12 ½ bis 12 ¾ Ellen einigen Nutzen für die künftige Waßerhaltung verschaffen werde, vorzüglich aber wäre drittens doch nachgerade auch auf Vermehrung der jetzigen sehr schwachen Aufschlagewaßer bedacht genommen werden müsse. Sie befragten zu dem Ende das anwesende Bergamt und die Grubenvorsteher, ob es ihnen nicht rathsam scheine, ein Röschenort nach Scheibenberg zu zu treiben und damit die Waßer vom (?) und St. Laurentiusstolln aufzufangen. Da jedoch dieser Plan hochdenenselben selbst etwas weit anstehend dünkte, und der Herr Schichtmeister Richter stattdeßen die Benutzung eines Schützteiches in Oberscheibe oder den Betrieb einer höchstens 70 bis 80 Lachter langen Röschenortes nach eben jenem Dorfe, oder endlich die Heranbringung des in Niederscheibe angesetzten, alten Wunderlich Fürstenglücker Stollns unmaaßgeblich vorschlug, inmaßen letzterem höchstens eine starke Viertelstunde im frischen Gestein herauf zu treiben sei und wohl auf 30 Lachter Teufe unter dem jetzigen Vater Abrahamer Stolln einbringen würde, so schenkten hochdieselben besonders dem letztgedachten Vorschlage ihren geneigten Beifall und verordneten, daß dessen Ausführung nach Kräften der Grube baldthunlichst vor die Hand genommen werden solle. Endlich gaben Ds. Commmiss. dem Schichtmeister Herrn Richter Ihre Zufriedenheit über deßen Betriebsamkeit und Ordnung bei Verwaltung der seiner Administration angetrauten Gruben überhaupt zu erkennen, und munterten denselben auf, fernerweit darin zu beharren. In Verfolgung alles deßen ist gegenwärtige Registratur aufgenommen, vorgelesen, ohne einige Erinnerungen dagegen genehmigt, unterschrieben, solches alles aber nachrichtlich anhero bemerkt worden von Carl Friedrich Scheuchler. Bergamt Scheibenberg den 7. April 1808.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Generalbefahrung hatte noch einen
anderen Hintergrund: Freiherr Sigismund August Wolfgang von Herder
berichtete auch im Oberbergamt zu Freiberg über seine Revisionsreise und
dort steht zu lesen (40001, Nr. 110, Blatt 68ff):
An das Königl. Ober Berg Amt Commissarischer Vortrag „E. Königl. Oberbergamt hatte in neueren Zeiten schon oft bey dem Bergamt Annaberg und den damit combinirten Refieren Mängel und Gebrechen in den Grubenbauveranstaltungen, grubenhaushalt und dem bergamtlichen Geschäftsgang wahrgenommen und beym Vortrag des allerhöchsten Befehles vom 6ten März 1807 (…) kam in Erinnerung, daß in den gedachten Bergamtsrefieren eine Hauptrevision seit sehr langer Zeit nicht gehalten, nun aber nothwendig geworden sey.“ Nun, das können wir so ganz pauschal
nicht bestätigen. Revisionen der Bergämter fanden schon mit gewisser
Regelmäßigkeit statt und wie wir schon wissen, ist zum Beispiel 25 Jahre
zuvor Bergkommissionsrat Charpentier nach Annaberg entsandt worden,
um das Bergamt zu kontrollieren und der hat auch einige der in Umgang
stehenden Gruben befahren, darunter auch das
Während aber Herr von Herder dem Betrieb bei Vater Abraham seinen Beifall schenkte, äußerte er sich über den Eigenlehnerbergbau im Schwarzbachtal in seinem Bericht an das Oberbergamt vom Juli 1808 vollkommen anders (40001, Nr. 110, Blatt 120f): „In Ansehung des im Tännichtwalde bey Schwarzbach und Langenberg (auf) einem nur einige Lachter tief liegenden Eisensteinlager verführten und jetzt durch die gevierten Fundgruben
in Umtrieb stehenden, sehr unregelmäßig, theils mit Holzverwüstung, theils nicht einmal mit sonderlichem Vortheil für die Eigenlöhner betriebenen Bergbaus, so ist zwar über den abendlichen Theil des ziemlich weit verbreiteten und durch die gevierten Fundgruben Christian, Gnade Gottes und Kraus bebauten Eisensteinlagers der Plan zu einem regelmäßigeren Eisenstein Abbau in Heranbringung eines dieser Gebäude lösenden und das dasige Eisenstein Lager aufschließenden, mit gehörigen Lichtlöchern zu versehenden, tiefen Stollns und in von diesem aus zu betreibenden regelmäßigen Flötzbau, wobey jedoch der Wahl des Punktes zum Ansitzen und dem Herantriebe dieses Stollns ein genauer Markscheider- Riß vorangehen müsse, gesetzt worden. Allein in Ansehung der den morgendlichen Theil des gedachten Eisenstein Lagers abbauenden Gruben
so ist nur bey letzterer ein regelmäßiger Abbau möglich, dahingegen bey ersteren, wo in altem Mann noch stehengebliebene Eisenstein Mitteln der Vorfahren ohne alles Anhalten und nur auf gut Glück gesucht wird, ein sicherer Plan nicht festgesetzt werden konnte, und bleibt nur der Wunsch übrig, daß dieser holzfressende, über dem nicht sehr lohnende Bergbau gänzlich gesperrt werden möchte.“ Sign. Freyberg,
den 18ten July 1808 Wir behalten dies in Erinnerung und kommen später noch auf die hier genannten Gruben im einzelnen zurück.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie oben schon zu lesen stand, war
bereits ab 1807 Herr Christian Friedrich Schmiedel Geschworener im
Bergamt Scheibenberg (40014, Nr. 235). Da zwischendurch aber der
Bergamtsprotokollist Friedrich August Schmid die Befahrungen
einiger der im Revier umgängigen Gruben ausführte, findet sich die nächste
Eintragung zu Vater Abraham aus der Hand des neuen Geschworenen
erst wieder aus der dritten Woche des Quartals Trinitatis 1807 (40014,
Nr. 235, Rückseite Blatt 97 und Blatt 98). Er notierte über seine
Befahrung:
„Auf Vater Abraham bei Oberscheibe gefahren.“ Belegung. „Dieses Eisensteingebäude ist belegt mit 1 Steiger, 1 Zimmerling, 9 Doppelhäuern und 8 Knechten, summa 19 Mann.“ Abbau eines Eisensteinlagers. „Durch 2 Mann wird 1.) bei 4 Lachter Teufe des Kunstschachtes auf den daselbst ersunkenen ¼, ½, bisweilen auch 1¼ Lachter mächtigen Eisensteinlager ein Ort Stunde 11,4 nach dem Streichen desselben gegen Mitternacht betrieben und ist nunmehro 20 Lachter von dem Kunstschachte fortgelengt. Sodann werden auf eben diesem Lager 2.) bei 4 Lachter mehrer Teufe und 9 Lachter von dem Kunstschachte gegen Mittag durch 6 Mann 3 Förstensttöße, jeder von ¼ Lachter Höhe verhauen und 3.) ebendaselbst 1 Stroßenstoß von ⅜ Lachtern Höhe mit 2 Mann nachgerißen. Gedachtes Eisensteinlager fällt 15 bis 20 Grad gegen Abend und besteht aus Hornstein, Quarz und braunem Eisenstein. Übrigens wird durch 4 Mann die Zimmerung sowie durch 4 Mann die sämtliche Förderung und durch 1 Mann, nämlich den Steiger, die Aufsicht geführt und die Wartung des Kunstgezeuges bewirket.“ Auch Herr Schmiedel hatte diese Funktion wieder über einige Jahre inne, so daß wir wieder auf zahlreiche seiner Fahrbögen zurückgreifen können. Insbesondere seine schöne, saubere Handschrift macht uns dabei die Arbeit leichter...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner Befahrung im Quartal Crucis 1807 fand Herr Schmiedel dagegen nur zu bemerken, es sei gegenüber letztem Bericht keine Veränderung vorgefallen (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 117). Etwa gleichlautend ist dann wieder Schmiedel's Fahrbericht vom 16. Dezember 1807 (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 141): „Auf Vater Abraham Fundgrube zu Oberscheibe gefahren.“ Belegung. „Dieses Gebäude ist mit 1 Steiger, 1 Zimmerling, 8 Doppelhäuern und 8 Knechten, in Summa 18 Mann belegt.“ Gangbare Baue. „Durch 2 Mann wird 1.) in 4 Lachter Teufe des Kunstschachtes ein Ort Stunde 11,6 gegen Mitternacht betrieben, welches auch nunmehro 23½ Lachter von dem Kunstschacht erlängt ist. Nächst diesem wird 2.) durch 9 Mann bei 8 Lachter Teufe mehrgedachten Kunstschachtes 11 Lachter gegen Mittag 3 Förstenstöße zu 3/3 nachgerißen. Gedachtes Lager ist ½ bis 1½ Lachter mächtig, streicht Stunde 11,3 hat 30 Grad westl. Fallen und besteht aus Quarz, Hornstein und braunem Eisenstein. Sodann wird durch 3 Mann die allhier ziemlich schwerköstige Zimmerung, durch 3 Mann die Förderung und endlich durch 1 Mann, nämlich den Steiger, die Wartung des Kunstgezeuges bewirkt und die Aufsicht geführet.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste Fahrbogen datiert dann auf
den 15. Februar 1808 (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 14). Hierüber
berichtete Herr Schmiedel, die Grube sei mit 17 Mann belegt und das
Ort in 8 Lachtern teufe unterm Stolln nach Süden sei nun „bei 1 Lachter
Weitung 11½ Lachter erlängt.“ Auf dem ziemlich flach (eher konkordant)
einfallenden Lager war man natürlich gezwungen, auch in die Breite zu
gehen, um es vollständig zu gewinnen. Außerdem wurden „hinter diesem
Orte zwei Förstenstöße ausgehauen.“ Man fuhr also oberhalb der
Grundstrecke im Firstenstoßbau dem Lager nach.
Zwar war dies den zahlungskräftigen Gewerken zu danken, jedoch nicht minder lobenswert im Grubenbetrieb, und so hielt der Geschworene auch fest: „Nicht minder habe ich bei dieser Grube die durchgängig in doppelter Thürstockzimmerung stehende Aufschlagerösche, so wie auch den tiefen Stollen befahren, wobei aber etwas zu bemerken nicht vorgefallen ist.“ Trinitatis 1808 berichtete Herr Schmiedel, es seien 18 Mann angelegt und im Abbau nach Süden nun „4 Förstenstöße, jedes von ¼ Lachter Höhe“ in Betrieb (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 28). Seine nächste Grubenbefahrung erfolgte am 6. Juli 1808. Beachtenswert ist die Angabe in seinem Fahrbericht, es werde nun „10 Lachter vom Kunstschacht nach Süden das Lager sowohl Ort-, als Förstweise bei 6 Lachter Weitung“ abgebaut (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 56 und Blatt 57). Sechs Lachter Breite !! Das waren ja rund 12 m ‒ das ist schon eine sehr bedeutende Spannweite. In dem bekanntlich mit zwischen 20° und 45° nur flach geneigten Eisensteinlager waren solche Weitungsbaue wahrscheinlich auch unumgänglich, wollte man das Lager denn möglichst vollständig abbauen. Auch ist in den Fahrbögen nie von stehengelassenen Sicherheitspfeilern die Rede, was den immensen Ausbauholz- Bedarf dieser Grube nur zu gut erklärt. Allein für das Quartal Trinitatis 1807 wurden der Eisensteinzeche Vater Abraham 120 Stämme Holz zugewiesen (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 112). Auch der Fahrbogen aus dem Quartal Luciae 1808 sagt aus, daß man vor Ort bei 5 Lachtern Weitung abbaute (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 90) und Reminiscere 1809 heißt es erneut, man baue mit „4½ Lachter Weitung“ (auch das sind noch rund 9 m Breite) das Lager ab (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 102). Die Belegung war zu diesem Zeitpunkt wieder auf 15 Mann etwas zurückgegangen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von der Befahrung im März 1809 (40014, Nr. 236, Blatt 126) war nichts wesentlich anderes zu berichten. Hervorhebenswert war lediglich die: „Anmerkung: Allhier ist noch zu bemerken, daß das in meinem letzteingereichten Fahrbogen bemerkte, bei 14 Lachtern nordwestlicher Länge von der Radstube auf dem tiefen Stolln angelegte, Std. 12 gegen Mittag betriebene Stollnflügelort bis an den Kunstschacht auf eine Länge von 19 Lachtern fortgebracht und mit deßen söhligen Betrieb ½ Lachter mehrer Teufe als mit dem Hauptstolln erlangt und eingebracht worden ist.“ Da die Grube am Hang der Hochfläche unterhalb des Scheibenbergs eigentlich immer unter Aufschlagwassermangel zu leiden hatte, war jeder Meter mehr Gefälle für das Kunstrad von Bedeutung... Das war natürlich auch ein Grund für einen Vortrag aus dem Fahrbogen im Bergamt Annaberg am 1. April 1809 (40169, Nr. 221, Blatt 103). Crucis 1809 befand der Geschworene wieder nichts wesentlich neues zu berichten: Mit 15 Mann Belegung wurde weiter unterhalb des Stollns in Richtung Süden abgebaut (40014, Nr. 236, Blatt 160f). Erneut wurden auch die Aufschlag- und Abflusswege überprüft, worüber Herr Schmiedel diesmal notierte: „Sodann wurde der zu diesem Gebäude gehörende obere, als auch der tiefe Stolln, welche beide größtentheils in doppelter Thürstock- Zimmerung stehen, befahren, wobei zwar nichts zu erinnern war, jedoch aber wurde dem neu angestellten Steiger (dienst-) Versorger empfohlen, nur gedachte Stölln bestmöglichste Aufsicht zu führen.“ Diese beiden Baue waren schließlich auch überlebenswichtig für den Fortbetrieb des Abbaus. Am 27. Juli 1809 notierte Herr Schmiedel, er habe „Bei Vater Abraham das Zechen Inventarium revidirt und in allen Stücken richtig befunden, dem neuangestellten Steiger (dienst-) Versorger Schubert in Verantwortung übergeben.“ (40014, Nr. 236, Blatt 168) Am 28. Juli 1809 erfolgte eine Generalbefahrung im Revier zusammen mit dem Bergmeister Schütz und hierzu gab es auch den Vermerk im Sitzungsprotokoll des Bergamtes vom 19. August 1809, daß man dabei angewiesen habe, die Abbaue mit Bergen auszustürzen. Auch dies sollte der Reduzierung des immensen Holzbedarfs bei dieser Grube dienen (40169, Nr. 221, Blatt 104). Am 28. September heißt es nur knapp im Fahrbogen, es gäbe seitdem bei Vater Abraham keine bedeutsamen Veränderungen. Wieder ausführlicher wird der Geschworene in seinem Fahrbogen auf Luciae 1809 (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 201 und Blatt 202), worin er berichtete, die Grube Vater Abraham sei weiterhin mit 15 Mann belegt, durch die erstens bei 7½ Lachtern unterm Stolln ein Ort Stunde 5,2 gegen Südwest zu 2/3 „im Quergestein nach dem vorliegenden Eisensteinlager, um von selbigem nicht nur die Waßer ab- und dem Kunstschachte zuzuführen, sondern auch zugleich mit zu erfahren, wie weit die Eisenstein Anbrüche nach dieser Weltgegend sich noch fortziehen möchten,“ getrieben werde. Dieses war nunmehr 16¼ La erlängt. Zweitens wurde der Abbau des Lagers in 7 Lachtern Teufe des Kunstschachtes und 12 Lachter von diesem nach Süden „bei 4 Lachtern Weitung ort- und förstenweiß“ fortgesetzt. Schließlich seien zwei Mann ständig damit beschäftigt, die vorfallende Zimmerung auszuführen. In seinen Angaben zur Zusammensetzung
des Eisensteinlagers liest man hier erstmals (und später auch bei anderen
Gruben) die Bezeichnung „Eisenpecherz“, ohne daß wir heute sicher
einordnen könnten, was er damit gemeint haben könnte. Der Name wird heute als Synonym für das Mineral
Vorgenanntes Untersuchungs- und Wasserort hatte man bis Ende 1809 noch auf eine Länge von 21 Lachtern fortgestellt (40014, Nr. 236, Blatt 220).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Februar 1810 hatten die Gruben der
Umgegend zunächst einmal ganz andere Sorgen, über die Herr Schmiedel
notierte (40014, Nr. 245, Film 0024), er sei auf Vater Abraham und
Beständige Einigkeit (eine Kommunzeche in Elterlein) gewesen und habe
„wegen Ableitung der durch das anhaltende Thau- und Regenwetter
entstandenen, vielen Tagewäßer das Nöthige veranstaltet.“ Bei Vater Abraham scheint das Hochwasser glücklicherweise aber keine Schäden verursacht zu haben und so ging der Abbau wieder normal weiter. Mit 15 Mann anfahrender Mannschaft baute man weiter vom Kunstschacht aus nach Süden „ort- und förstenweise bei 2 Lachter Weitung“ das Lager ab und 3 Lachter hinter dem Hauptorte wurde die Förste ausgehauen (40014, Nr. 245, Film 0027). Auch Trinitatis 1810 gab es demgegenüber nichts bemerkenswertes neues zu berichten (40014, Nr. 245, Film 0042 und 0054). Seltsamerweise besteht danach eine etwas längere Lücke in den Befahrungen durch den Geschworenen auf dieser Grube. Erst am 7. Januar 1811 war er wieder hier – zumindest gibt es keine Eintragungen in seinen Fahrbögen aus der dazwischenliegenden Zeit. Mit der Grundstrecke bei 7½ Lachtern Teufe des Kunstschachtes im südlichen Abbau stand man nun nur noch 8 Lachter vom Kunstschacht entfernt. 14 Lachter vom Kunstschacht nach Süden entfernt betrieb man die Firstenbaue oberhalb dieser Strecke (40014, Nr. 245, Film 0138). Die nächste Befahrung erfolgte dann schon am 21. Februar 1811 und über diese berichtete Herr Schmiedel, es habe sich zwar nichts verändert, man habe „jedoch aber wahrgenommen, daß das Hangende des allhier bebaut werdenden Eisensteinlagers außerordentlich starken Druck äußerte, daher denn auch dem Steiger die größtmöglichste Wachsamkeit wegen der daselbst anzubringenden Zimmerung und sonstiger Verwahrung anempfohlen wurde.“ (40014, Nr. 245, Film 0161) Der Fahrbogen zu seiner Befahrung im Quartal Crucis, am 30. Juli 1811, sagt, daß dazumal 16 Mann hier anfuhren und daß das Streckenort der Grundstrecke inzwischen nur noch 7 Lachter vom Kunstschacht entfernt stand, jetzt noch 3 Lachter Weitung besaß und 12 Lachter vom Kunstschacht entfernt die Firsten nachgerissen werden. Nur ein Lachter Vortrieb in anderthalb Quartalen klingt zwar auf den ersten Blick wenig ‒ aber das Ort hatte ja auch immer noch rund 6 m Breite ! (40014, Nr. 245, Film 0224)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Genauso ging man auch 1812 weiter vor. Am
7. Januar dieses Jahres war die Weitung der Grundstrecke auf 2½ Lachter
zurückgegangen und die Firstenbaue waren bis auf 10 Lachter an den
Kunstschacht herangerückt (40014, Nr. 250, Film 0005).
Bei seinen Befahrungen am 26. März und 6. Juli 1812 fand Herr Schmiedel keine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem letzten Stand vor (40014, Nr. 250, Film 0036 und 0070). Auch Bergmeister Schütz fand nach seiner Befahrung bei Vater Abraham am 5. Mai 1812 nichts wesentliches zu bemerken (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 107). Zu dieser Zeit war übrigens Carl Amandus Kühn im Bergamt Annaberg tätig. Von seiner nächsten Befahrung am 28. August berichtete Herr Schmiedel, daß man nun das Streckenort der Grundstrecke wieder vom Kunstschacht südwärts vortrieb und sich damit wieder bis auf 13 Lachter südwärts von diesem entfernt habe. Acht Lachter dahinter werden wieder die Firsten nachgenommen. So blieb es auch bis zur Befahrung am 9. November 1812 (40014, Nr. 250, Film 0094 und 0118). Bis zum 14. Dezember dieses Jahres hatte man mit 16 Mann Belegung in drei Dritteln die Grundstrecke wieder auf 14 Lachter vom Kunstschacht weg erlängt, dies mit 2½ Lachter Weitung, und 9 Lachter zurück erfolgte der Förstenaushieb (40014, Nr. 250, Film 0132). Bis zur Befahrung am 7. April 1813 war die Grundstrecke bei 2 Lachtern Weitung dann auf 16 Lachter Länge fortgestellt und über ihr erfolgte Firstenaushieb (40014, Nr. 251, Film 0034). Im nächsten Quartal war der Vortrieb der Grundstrecke besonders beachtlich, denn am 13. Juli 1813 stand das Ort bei 3 Lachtern Weitung bereits 22 Lachter südlich des Kunstschachts (40014, Nr. 251, Film 0071). Diese Vortriebsleistung nahm aber wieder ab, denn bis zur nächsten Befahrung durch den Geschworenen am 15. Oktober 1813 hatte man (wobei allerdings auch die Weitung auf wieder 3½ Lachter nochmals zugenommen hatte) nur 2 Lachter geschafft und bis Weihnachten des Jahres fand Herr Schmiedel dann gar keine Längenzunahme mehr vor (40014, Nr. 251, Film 0101f und 0124). Bei seiner Befahrung Trinitatis 1814 nur kurz darauf, nämlich schon am 25. Januar 1814, konnte es demgegenüber natürlich noch keine bemerkenswerten Fortschritte geben und auch am 7. März 1814 gab Herr Schmiedel die Länge der tiefen Abbaugrundstrecke immer noch mit 24 Lachtern südwärts vom Kunstschacht (bei 3¼ Lachter Weitung) an (40014, Nr. 252, Film 0012 und 0024). Allerdings hatte auch die Belegung ‒ vielleicht auch infolge der Kriegsereignisse des Vorjahres ‒ auf 13 Mann abgenommen. Am 24. Mai 1814 waren sogar nur noch 11 Mann hier angelegt, nämlich
Das tiefe Ort in 7½ Lachter Teufe des Kunstschachtes (also unter dem Stolln) stand mit 3 Lachter Weitung nun bei 27 Lachter vom Schacht nach Süden (40014, Nr. 252, Film 0049f). Außerdem machte Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen die folgende Anmerkung. „Da die Vorsteher dieses Berggebäudes in nächstvergangener Woche angezeigt haben, daß das Kunstrad sehr wandelbar sey und die Erbauung eines neuen sich nöthig mache, so habe ich selbiges bei heutiger Befahrung mit in Augenschein genommen und das Anbringen gedachter Vorsteher gegründet befunden. Weil nun die nöthigen Materialien zu einem dergleichen Rade meistentheils schön vorräthig sind, also habe ich den Steiger aufgegeben, das noch fehlende sofort anzuschaffen und sodann zur Erbauung des neuen Rades zu verschreiten.“ Vielleicht, um die Umsetzung dieser Anweisung zu prüfen, war der Geschworene schon am 2. Juni 1814 wieder hier, fand aber diesbezüglich noch keinen neuen Stand vor (40014, Nr. 252, Film 0056). Am 12. August des Jahres war zu berichten, daß das tiefe Ort mit wieder 12 Mann Belegung nunmehr auf 28 Lachter vom Kunstschacht südwärts ausgelängt war und bei 3 Lachter Weitung das Eisensteinlager „sowohl ort- als förstweise abgebaut“ werde (40014, Nr. 252, Film 0065). Vielleicht war damit aber auch das Auskeilende des Lagers in dieser Richtung und Teufe erreicht, denn als Herr Schmiedel am 20. Oktober 1814 wieder auf der Grube anfuhr, war zu berichten, daß man nun einen halben Lachter tiefer, bei 8 Lachter Teufe des Kunstschachts und 2 Lachter von diesem entfernt, ein neues Streckenort nach Süden anschlug und dies auch gleich wieder mit 2¼ Lachter Weitung (40014, Nr. 252, Film 0086). Bis zu seiner letzten Befahrung am 28. November im Jahr 1814 hatte man mit inzwischen wieder 15 Mann Belegschaft das neue tiefe Streckenort „bei 8¾ Lachter Teufe des Kunstschachtes“ zwar nur auf 2½ Lachter Länge südwärts fortgebracht, dabei aber die Weitung wieder auf 3 Lachter verbreitert (40014, Nr. 252, Film 0097f). Vom neuen Kunstrad war noch nichts wieder zu hören... Das noch fehlende Material war wohl gerade schwer zu bekommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So schritt man weiter fort und hatte das
tiefe Streckenort bei gleichgebliebener Weitung bis zum 7. März 1815 auf
3½ Lachter Länge ausgelängt (40014, Nr. 254, Film 0021) und am 10. Juli
1815 war es bei nun schon wieder
5 Lachter Weitung ( !! ) bis
4½ Lachter vom Kunstschacht fortgestellt
(40014, Nr. 254, Film 0058). Am 27. März 1815 gab es auch wieder einen
Fahrbogenvortrag im Bergamt Annaberg.
Dabei wurde über die zunehmende Verflachung des Lagers disputiert und von
C. A. Kühn empfohlen, das Ort weiter auszulängen, um besseren
Aufschluß über dessen Streichen und Fallen zu bekommen, was den Beifall
des Bergamtes fand (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 109).
Ähnlich lautete auch der Bericht im Fahrbogen auf Crucis 1815: Das tiefe Ort nach Süden stand am 20. September bei 5¼ Lachter vom Kunstschacht und besaß 4½ Lachter Weitung (40014, Nr. 254, Film 0080). Am 30. Oktober 1815 stand man bei 4 Lachtern Weitung 6 Lachter südwärts vom Kunstschacht (40014, Nr. 254, Film 0091). Bis zum 13. Januar 1816 hatte man bei noch 3 Lachtern Weitung einen Stand von 7 Lachtern Länge erreicht und als Herr Schmiedel am 20.1.1816 die Grube erneut befuhr, maß er bei 3¼ Lachter Weitung eine Streckenlänge von 7½ Lachtern (40014, Nr. 257, Film 0006 und 0014). Bis 10. Mai 1815 hatte die Weitung wieder auf 4 Lachter zugenommen und das Ort stand 9 Lachter vom Kunstschacht entfernt (40014, Nr. 257, Film 0042). Nimmt man die hier angegebenen Maße und eine durchschnittliche Höhe von 2 Lachtern einmal zur Grundlage eines kleinen Überschlags, so wurden zu dieser Zeit pro Quartal zwischen 13 m³ und 48 m³ aus der Lagerfläche ausgehauen. Nachdem man bis zum 16. Juli 1816 das Streckenort auf 14 Lachter ausgelängt hatte, setzte man 5 Lachter und 7 Lachter zurück auch wieder zwei Firstenstöße und einen Strossenstoß an (40014, Nr. 257, Film 0060f). Im Prinzip war das so beschriebene Abbauverfahren bereits als eine Art Firstenstoßbau zu bezeichnen. In diesen Tiefbauen unterhalb der Stollnsohle tauchte nun aber ein neues Problem auf und deshalb fuhr Herr Schmiedel am 14. August 1816 wieder nach Oberscheibe und hat dort „wegen Entfernung des, in den dasigen Tiefbauen eingetretenen Wettermangels, mit dem Steiger verschiedenes überlegt und veranstaltet.“ (40014, Nr. 257, Film 0071f) Der Abbau ging davon unbenommen aber weiter und bis zum 28. Oktober 1816 war die Grundstrecke, bei allerdings nur noch 1¼ Lachter Weitung, auf 14¾ Lachter erlängt (40014, Nr. 257, Film 0096f). Fünf Lachter zurück stand man mit dem Aushieb der Firsten und der Strosse. Auch der nächste Fahrbogen berichtet von einem nur mäßigen Fortschritt: Man stand am 7. Januar 1817 bei gleichgebliebener Weitung mit der Grundstrecke bei 15 Lachtern (40014, Nr. 258, Film 0003). Bis zur nächsten Befahrung, die schon im Februar erfolgte, hatte man das Ort nur m ¼ Lachter fortgestellt, dafür hatten die First- und Strossenaushibe einen halben Lachter Abstand aufgeholt (40014, Nr. 258, Film 0015). Im nächsten Quartal kehrte sich dies aber wieder um (40014, Nr. 258, Film 0034) und Trinitatis 1817 stand das Streckenort mit 1¼ Lachter Weitung 17 Lachter südlich vom Schacht, während die First- und Strossenstöße 6 Lachter zurücklagen (40014, Nr. 258, Film 0062). So blieben die Verhältnisse auch Crucis 1817 (40014, Nr. 258, Film 0085f). Nebenbei hatte man als Geschworener aber auch noch andere Aufgaben, über welche uns Herr Schmiedel am 16. Januar 1817 einmal berichtete (40014, Nr. 258, Film 0007f): „Auf Vater Abraham gefahren und habe daselbst dreyen Lehrhäuern, welchen des Häuergedinge aufzufahren gestattet worden, bei 8½ Lachter Teufe des Kunstschachtes einen Querschlag – welcher, um ein Stücke sehr schwerköstige Zimmerung abzuwerfen, Stundte 7,0 gegen Abend, nach den jetzigen Eisenstein Abbauen getrieben werden soll – bey 1 Lachter Höhe für 10 Thl. – Gr. incl. Pulver verdingt, übrigens aber daselbst seit meiner kürzlich hier gehaltenen Befahrung nichts veränderliches befunden.“ Der schon einmal im Sommer 1816 konstatierte Frischwettermangel in den Tiefbauen setzte offenbar auch dieses Jahr wieder ein. Am 4. Dezember 1817 war es so schlimm, daß Herr Schmiedel notierte (40014, Nr. 258, Film 0105f), im Streckenort 17 Lachter südlich vom Kunstschacht bestehe „seit mehreren Wochen Wettermangel, welcher nunmehr so überhand genommen, daß die Luft zum Einathmen gar nicht mehr tauglich ist, auch in selbiger kein Licht brennend erhalten werden kann.“ Autsch ‒ wenn die Lampe ausgeht, sollte man aber schleunigst hier ausfahren... Daher hatte man nun den Försten und Strossenaushieb in nur noch 4 Lachter Teufe des Kunstschachtes und 15 Lachter nach Süden verlegt ‒ der Abbau sollte schließlich nicht unterbrochen werden ‒ und ein Ort in Quergestein Stunde 10,3 gegen Süd mit fallender Sohle angeschlagen, um „dasselbe mit den obgedachten, wetterbenöthigten Tiefbauen in Verbindung zu bringen.“ Zu diesem Zeitpunkt war diese Strecke schon 21 Lachter fortgestellt und man erwartete den Durchschlag nach noch 4½ Lachtern. Am 9. März 1818 konnte der Geschworene dann berichten, daß man mit 15 Mann Belegung wieder in 8½ Lachtern Teufe des Kunstschachtes ein Ort mit 1¼ Lachter Weitung betreibe und es 10¼ Lachter gegen Süd ausgelängt habe; außerdem werde je ein Försten- und ein Strossenstoß zu je ⅜ Lachter Höhe nachgerissen (40014, Nr. 259, Film 0021). Und: „Noch ist zu bemerken, daß an nächstvergangenem Mittwoche mit dem, aus dem Fundschachte in 4 Lachter Teufe Stunde 2,1 in Quergestein gegen Mittag mit abfallender Sohle betriebenen Orte, bey 42 Lachtern Länge der Durchschlag auf die 4 Lachter tiefer liegende Strecke und die daselbst befindlichen, bereits oben sub. No. 1 und 2. beschriebenen Eisensteinbaue, auf welchen man seit beynahe ½ Jahr, der gänzlich verdorbenen Wetter wegen, gar nicht gelangen konnte, gemacht und hierdurch ein vollkommen guter Wetterwechsel bewirkt worden ist.“ Über diesen erfolgreichen Durchschlag berichtete Herr Schmiedel auch auf der Bergamtssitzung am 4. April 1818 in Annaberg (40169, Nr. 221, Blatt 112).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon bei der nächsten Befahrung am 13. Mai 1818 heißt
es aber im Fahrbogen, es herrsche in 8½ Lachtern
Teufe
wieder Wettermangel, daher habe man sich wieder auf die 4 Lachter- Sohle
verlegt, wo bereits über 30 Lachter vom Kunstschacht entfernt das Lager
ort- und förstweise abgebaut werde (40014,
Nr. 259, Film 0041f).
Von seiner Befahrung am 13. Juli des Jahres berichtete Herr Schmiedel aber, man baue wieder im Tiefsten bei 8½ Lachter Teufe des Kunstschachtes gegen Nord ab und das Ort sei nun 8 Lachter vom Kunstschacht fortgestellt. Dahinter erfolgte gleich Försten- und Strossenaushieb (40014, Nr. 259, Film 0061f). Außerdem ist ein Häuer abgegangen. So setzte man die Arbeit auch im Quartal Crucis 1818 fort (40014, Nr. 259, Film 0080f). Bis zum 30. November des Jahres war das Ort im Tiefsten auf 12 Lachter ausgelängt (40014, Nr. 259, Film 0110f). Von der Sitzung des Bergamtes am 7. Oktober 1818 steht im Protokoll zu lesen, daß der neue Bergmeister von Zedtwitz die Grube befahren hat. Auch er meinte, das Lager nehme „eine mehr wellenförmige Gestalt“ an. Außerdem wurde angeordnet, des Wettermangels wegen ein neues Steigort anzulegen (40169, Nr. 221, Blatt 113). Am 29. Dezember 1818 gab es keine bemerkenswerten Veränderungen, nur war zu konstatieren, daß das Wetterort aus dem Tiefsten mit ansteigender Sohle erst vor 14 Tagen in Angriff genommen worden ist (40014, Nr. 259, Film 0122). Auch bei der Befahrung am 10. Februar 1819 ging der Abbau in gleicher Weise vonstatten (40014, Nr. 261, Film 0011). Außerdem wurde das Wetterort im Lagerstreichen, vom Abbauort 22 Lachter nach Westen angesetzt, mit ansteigender Sohle gegen Nord getrieben, um es mit dem 3 Lachter höher liegenden Stolln in Verbindung zu bringen und frische Wetter auf den Abbauen zu erlangen. Vom Streckenkreuz an war es nun 5 Lachter ausgelängt. Bis zur Befahrung am 4. Juni 1819 hatte man es 30 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 261, Film 0050ff). Den Vortrieb dieses Durchschlags zu beschleunigen, um die Wetterlösung zu verbessern, fand auch auf der Sitzung des Bergamtes am 3. Juli 1819 dessen Zustimmung (40169, Nr. 221, Blatt 115). Von seiner Befahrung am 23. September 1819 berichtete Herr Schmiedel, man treibe in 4 Lachtern Teufe des Förderschachts ein Ort mit ¾ Lachter Weitung Stunde 7,1 gegen West und habe dieses nun 32 Lachter erlängt. Bei 31 Lachter ist der Durchschlag in die aus den Tiefbauen mit ansteigender Sohle getriebene Strecke erfolgt (40014, Nr. 261, Film 0081f). Ferner wurde in derselben Sohle 41 Lachter vom Förderschacht nach Südosten das „daselbst von den Vorfahren schon einigermaßen bebaute Lager... mittels Nachreißung eines ⅜ Lachter hohen Förstenstoßes“ abgebaut. In gleicher Weise fuhr man auch den Rest des Jahres 1819 mit dem Abbau fort. Die Belegschaft ist jetzt wieder auf 16 Mann angestiegen (40014, Nr. 261, Film 0101f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Januar 1820 blieb man mit dem
Abbau auf der Sohle 4 Lachter unter dem Stolln (40014,
Nr. 262, Film 0010f). Bis zum 1. April des
Jahres war das Ort gegen Nord 33 Lachter von der Hauptförderstrecke aus
erlängt (40014,
Nr. 262, Film 0034f). 1½
Lachter von diesem Orte zurück war ein Abteufen 3 Lachter tief
niedergebracht und auch mit dem Firstenaushieb in südlicher Richtung fuhr
man fort.
Im Mai 1820 war wieder hoher Besuch aus dem Oberbergamt zu Freiberg in Scheibenberg zu Gast, worüber Herr Schmiedel notierte (40014, Nr. 262, Film 0045ff, Abschrift in 40169, Nr. 221, Blatt 116f): „26. May 1820 habe ich den auf Ihro Wohlgeboren, dem Herrn Bergrath Freiesleben aus Freyberg auf Werners Erinnerung Erbstolln zu Markersbach, Vater Abraham zu Oberscheibe und Beständige Einigkeit bey Scheibenberg abgehaltenen Befahrungen beygewohnt und Dieselben haben hierüber nachstehendes in gegenwärtigem Fahrbogen zu bemerken anbefohlen:“ (...) II. Vater Abraham zu Oberscheibe anlangend „Bey 8 Lachter Teufe im Kunstschachte und zwar 5 Lachter von selbigem westlich, waren 6 Mann in einem so eben angefangenen, nach dem Fallen des anjetzt hier bebaut werdenden Eisensteinlagers – welches der Hauptrichtung nach Stundte 11,0 streicht, 15 bis 20 Grad gegen Abend sich verflächt und bey einer Mächtigkeit von ¼, ½ bis 1 ¼ Lachter aus dichtem und fasrichen Brauneisenstein, eisenschüssigem Glimmerschiefer, Quarz, braunem Hornstein und bisweilen etwas Eisenglanz besteht – zu 3/3 niedergebracht werdenden Abteufen beschäftiget, um sowohl solches mit einer aus dem Kunstschachte 2 Lachter tiefer herankommenden Strecke in Verbindung zu bringen, als auch mehre Höhe zu Anlegung eines Strossenbaus zu erlangen. (...) Sodann war in derselben Sohle, jedoch 15 Lachter von dem soeben beschriebenen Abteufen gegen Mitternacht Abend, ein Ort nach dem Streichen des Lagers mit 4 Mann zu 2/3 belegt, um dasselbe mehr in die Länge zu untersuchen. Es war dasselbe hier 10 bis 12 Zoll mächtig (...) Von diesem Orte fuhren Hochgedachter Herr Bergrath zurück, bis an das sub 1. erwähnte Abteufen und von diesem 1½ Lachter Stundte 11,3 gegen Mittag auf einer auf dem Lager getriebenen Strecke, wo solche zwar in dieser Richtung noch einige Lachter weiter fortging, jedoch dermalen mit Bergen versetzt war, von hier weg aber schien das Lager ein niedrigeres Streichen angenommen zu haben, indem auf solchem ein Ort noch gegen 9 Lachter beynahe rechtwinklig von jenem gegen Abend erlängt befunden wurde. Auf letzterer Tour bemerkten die Grubenvorsteher, wie hier durch die bedeutende Veränderung des Lagers, in Ansehung seines Streichens und weil dasselbe auch immer weniger mächtig zu werden scheine, solches nicht mehr die früheren günstigen Aussichten gewähre und zu befürchten stehe, daß, wenn selbiges, wie es jetzt den Anschein habe, noch weiter gegen Abend sich wenden sollte, ganz aufhören könnte. Wie nun hierauf Hochgedachter Herr Bergrath diesen Umstand in Erwägung zogen und besagtes Lager genau untersuchten, so bemerkten dieselben, daß entweder in dieser Gegend das Lager in zwey Trümer auseinandergehe, welches jedoch nicht ganz wahrscheinlich sey, oder daß dasselbe, da wo solches die bedeutende Krümmung mache, in dieser Richtung nicht fortsetzen werde, sondern vermutlich in seinem Streichen nur eine faltenartige Biegung machen und wenn darauf ausgelängt werde, wieder auszurichten seyn werde, auch solches um so wahrscheinlicher sey, weil dasselbe in oberen Sohlen auf eine Länge von 40 bis 50 Lachter, mithin von der dermaligen Krümmung in Mittag und Mitternacht, sein richtiges Streichen und Fallen gehabt und nie solche bedeutenden Krümmungen gezeigt habe. Um aber über die Beschaffenheit, Streichen und Fallen des Lagers, so wie insbesondere die auf selbigem verführten Baue (da solche auf dem Grubenrisse, weil sie einander decken, nicht gehörig zu ersehen seyn) mehr Aufschluß zu erlangen, als wovon alle fernern Dispositionen und die Erwartungen, die man sich vom Nachhalt des dermahligen Lagers überhaupt zu machen habe, zunächst abhängen, ordneten dieselben an: Daß von jedweder Hauptstreckensohle, in welcher intereßante ältere oder neuere Baue liegen, besonders bey 8 Lachter Teufe des Kunstschachtes, Special Risse, auf welchen nicht sowohl die Richtung der Strecken, sondern vorzüglich das Streichen und Fallen des Lagers oder die Linien des Hangenden und Liegenden genau anzugeben wäre, gefertiget werden sollen, welches um so nöthiger sey, weil alte Strecken und Abbaue, wenn solche, wie dermalen befunden wurde, nicht mehr nöthig, um die Zimmerung zu ersparen, von Zeit zu Zeit wieder versetzt würden; und so, wie diese Risse bey dieser Grube im Allgemeinen auch für die Zukunft sehr nöthig wären, so werde noch besonders aus selbigen sich genauer bestimmen lassen, auf welchem Wege anjetzt das Lager am ehesten wieder auszurichten seyn dürfte, auf jeden Fall aber sey es vorerst zu Erreichung dieses Zwecks nöthig, das im Tiefsten, oder aber in 10½ Lachter Teufe des Kunstschachtes, bereits aufgehauenen Ort gegen Mittag weiter fortzustellen, sodann aber Querschläge ins Hangende des Lagers zu treiben.“ Über das Sommerhalbjahr 1820 hatte man sich dann wieder auf die tiefere Sohle verlegt, wo 6 Lachter nach West und 14 Lachter vom Kunstschacht gegen Nordwest in der sogenannten 8 Lachter Strecke eine ⅜ Lachter hohe Strosse nachgerissen wurde (40014, Nr. 262, Film 0076). So ist es auch bei den nächsten Befahrungen am 18. Oktober (40014, Nr. 262, Film 0088f) und am 22. Dezember 1820 (40014, Nr. 262, Film 0111) geblieben, nur ist die Belegschaft wieder auf 15 Mann etwas gesunken. Bei seinem Fahrbogenvortrag am 30. Dezember 1820 in Annaberg erinnerte Herr Schmiedel daran, daß den Gewerken die von Bergrat Freiesleben angemahnte Rissanfertigung aufgegeben werden solle (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 118).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner Befahrung am 6. März 1821
berichtete Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen
(40014, Nr. 264, Film 0000),
man betreibe nun ein Untersuchungsort in 4 Lachter Teufe des
Förderschachts Stunde 8,3 gegen Abend im Streichen des Lagers und habe
dieses auch schon 30½ Lachter erlängt. 3 Lachter hinter diesem Ort hatte
man ein Überhauen 2 Lachter hochgebrochen. Außerdem heißt es dort:
„Vor dem Orte ist besagtes Lager 14 bis 18 Zoll (rund 45 cm), in dem Überhauen aber gegen 30 Zoll (etwa 76 cm) mächtig, fällt 60 Grad gegen Mittag und besteht aus Glimmerschiefer, Quarz, braunem Hornstein, dichten, auch etwas faserigen Brauneisenstein...“ Gegenüber früheren Angaben zur Mächtigkeit des bebauten Lagers, die gewöhnlich in Lachtern erfolgten, fällt der Wechsel der Maßeinheit ins Auge. In der mit dem Untersuchungsort verfolgten Richtung muß die Mächtigkeit also deutlich abgenommen haben.Die nächste Befahrung erfolgte am 14. Mai 1821, worüber im Fahrbogen festgehalten ist (40014, Nr. 264, Film 0050f), es sei nun bei 8 Lachter Teufe des Kunstschachts und 6 Lachter vom Kunstschacht gegen West ein Abteufen im Lager in Umtrieb. Gleichzeitig habe man ein Streckenort in ebendieser Sohle auf 8½ Lachter ausgelängt. Weil bislang noch immer keine aktuellen Grubenrisse vorlagen, sprach man am 26. Mai 1821 dem Schichtmeister gegenüber das Missfallen des Bergamtes aus (40169, Nr. 221, Rükseite Blatt 119). Als solcher fungierte jetzt ein Herr Carl August Lange. Neben diesen, für den Geschworenen wichtigen Untersuchungsarbeiten, schritt aber auch der Abbau fort, worüber Herr Schmiedel am 18. Juli 1821 berichtete (40014, Nr. 264, Film 0070f), man baue in 9 Lachter Teufe des Kunstschachtes und 7 Lachter von selbigem gegen Abend das ⅝ Lachter mächtige Lager ab. Zugleich hatte man das Untersuchungsort in gleicher Sohle 11 Lachter fortgebracht, wo das Lager aber nur ⅜ Lachter mächtig sei. Zwar erfolgte am 21. Dezember 1821 noch einmal eine Befahrung der Grube durch den Geschworenen, doch war gegenüber den letzten Fahrberichten keine wirkliche Veränderung im Grubenbetrieb eingetreten (40014, Nr. 264, Film 0120f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner Befahrung am 25. Februar
1822 fand Herr Schmiedel das Ort in 9 Lachter Teufe auf 13 Lachter
erlängt und 4 Lachter zurück wurde stroß- und förstweise abgebaut (40014,
Nr. 265, Film 0023f). Bis
zur Befahrung am 6. August 1822 war dieses Ort 14½ Lachter erlängt und der
Strossen- und Firstenaushieb stand 5½ Lachter zurück (40014,
Nr. 265, Film 0058f).
Fast wortgleich lautete auch der letzte Fahrbogen Herrn Schmiedel's vom 28. Oktober des Jahres (40014, Nr. 265, Film 0072f). Im Dezember löste ihn dann Herr Johann August Karl Gebler in der Funktion als Berggeschworener in Scheibenberg ab. Dessen Handschrift ist leider weniger ordentlich und schwerer zu lesen, als die seines Vorgängers und so müssen wir uns für einige Lücken mehr in unseren Transkripten aus diesen Unterlagen entschuldigen. Auch scheint es neue Gliederungsvorschriften für die Fahrbögen gegeben zu haben; vielleicht aber schaute sich der Geschworene bei seinen ersten Befahrungen auch einfach nur alles besonders genau an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erste Befahrung dieser Grube durch
den neuen Geschworenen erfolgte jedenfalls am 8. April 1823. Darüber
berichtete Herr Gebler in seinem Fahrbogen (40014,
Nr. 267, Film 0027f):
Vater Abraham Fdgr. in Oberscheibe. „Dieses Grubengebäude ist belegt mit
Eisensteingewinnung. „Da sich in dem bey 12 Lachter mitternächtlicher Entfernung vom Kunstschachte in dem vorigen Quartal noch gangbar gewesene Tiefsten 10 Lachter unter der Stollnsohle die Anbrüche sehr verringert und fast gänzlich abgeschnitten hatten, so hat man dasselbe gegenwärtig ja verlaßen und zur Sicherheit des Baues mit Bergen auszustürzen angefangen, setzt dagegen die Gewinnung des Eisensteins auf der gegen 2 Lachter höher liegenden Sohle auf dem daselbst vorhandenen Mittel fort, so sich gegen das vorige Quartal von etwas besserer Beschaffenheit, nämlich (?) in größere derben Nieren zeigen. Es ist dieser Bau mit 5 bis 6 Mann belegt.“ Versuchsbaue. „Das in 18 Lachter Teufe unter Tage gegen Morgen in der Stunde 9,0 angesetzte Ort ist mit 2 Mann belegt, um (...?) in der Nähe befindliche Eisensteinlager anzufahren.“ Wegräumung der Hindernisse. „Da diese größtentheils nur in Haltung der Grundwaßer und in Sicherung der Grubenbaue durch Zimmerung bestehen, so wurde die erste mittels 5 Kunstsätzen von 10 bis 15 Zoll Weite an einem 12 Ellen hohen, in einer ganz hölzernen Radstube aufgehängten mit einem Streckengestänge in Verbindung gesetzten Kunstrade zu Sumpf, die Schächte und Strecken aber durch kräftige Schachtzimmerung und auf den letzteren überall durch Verwendung doppelter Thürstöcke in brauchbarem und sicheren Zustande erhalten.“ Zum Zeitpunkt seiner nächsten Befahrung am 30. Juni 1823 hatte sich die Belegung nicht verändert (40014, Nr. 267, Film 0047f). Wir zitieren aus dem Fahrbogen des Herrn Gebler zunächst die Abschnitte: Eisensteingewinnungsbaue. „Es befindet sich derselbe bey 12 Lachter mitternächtlicher Entfernung vom Kunstschacht, in der Teufe von 10 Lachter unter dem Stolln, wo man, so wie im verflossenen Quartal, immer noch fortfährt, die dort vorhandenen, (?) bald mächtiger, bald schwächer vorkommenden Mittel stroß- und förstweise abzubauen, ohne daselbst weiter in die Teufe gehen zu können, da die Anbrüche an diesem Punkte dem Streichen nach nicht fortsetzen zu wollen scheinen. Es ist dieser Bau mit 6 Mann belegt. Als Versuchsbau zur Entdeckung neuer Eisensteinmittel wird der Betrieb des bey 18 Lachter Teufe unter Tage angelegten Ortes in der Stunde 9,0 gegen Morgen fortgesetzt, um das wahrscheinlich in der Nähe befindliche Eisensteinlager zu entdecken.“ Die ,Wegräumung der Hindernisse' befand Herr Gebler „überall auf das regelmäßigste erledigt“. Außerdem notierte er noch über „Die Hauptabsichten für die Zukunft sind theils auf die Fortsetzung der Tiefbaue unter Voraussetzung des Wiederentdeckens neuer Eisensteinmittel, und hiernächst auf die Anlage eines neuen Eisensteinabbaues in der 18 Lachter Sohle auf dem zu vermuthenden, vorhin erwähnten, zu Zeit aber noch nicht angefahrenen Eisensteinlagers gerichtet.“ Noch eine Befahrung durch den Geschworenen gab es am 6. Oktober 1823 (40014, Nr. 267, Film 0068f). Jetzt heißt es, das Versuchsort in 18 Lachter Teufe sei zugunsten der Gewinnung eingestellt. Der zeitherige Gewinnungsbau wurde mit „12 Lachter unter der Stollnsohle und 12 Lachter vom Kunstschacht“ gelegen beschrieben, dort fänden sich aber „nur schmale und unzusammenhängende Nester von Eisenstein“ und das Lager wäre von den Alten „längst bebaut.“ Man hatte erhofft, den Bedarf an Eisenstein dort noch auszubringen, „ohne daß sich etwas neues darüber sagen läßt.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr ist eine Befahrung
der Grube durch den Geschworenen gleich am 12. Januar 1824 erfolgt (40014,
Nr. 271, Film 0002f).
Hinsichtlich der Belegung gab es keine Veränderungen und darüber hinaus
hielt Herr Gebler in seinem Fahrbogen nur kurz fest:
„In Behuf der Eisensteingewinnung fährt man fort, in der Teufe von 8 und 9 Lachter unter dem Stolln die daselbst vorhandenen Nester und Mittel fernerweit auszuhauen und stehet nun der Erfolg, wie sich das hier vorhandene Lager fernerweit verhalten wird, zu erwarten. Soweit es die Umstände gestatten, wird abwechselnd der bey 18 Ltr. Teufe angelegte Versuchsort zu Aufsuchung eines anderen naheliegenden Lagers gegen Mittag Morgen betrieben. Die vorhandenen Hindernisse, die Verwahrung der Grube und Waßerhaltung betreffend, wird durch den Steiger und zwey Zimmerlinge gehörig versorgt.“ Demgegenüber gab es bei der Befahrung im Februar 1824 nichts neues. Am 22. März des Jahres notierte der Geschworene in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 271, Film 0019), die Gewinnung erfolge jetzt wieder 4 Ltr. unter der Stollnsohle und 30 Ltr. gegen SW vom Tageschacht. Da die 8 und 9 Lachter- Sohle in der angegebenen Richtung „ausgekuttet“ ist, wurden außerdem neue Untersuchungsstrecken begonnen und es wurden Hilfsbaue zur Erleichterung der Förderwege aufgefahren. Von seiner Befahrung am 5. April berichtete Herr Gebler (40014, Nr. 271, Film 0022f), der Abbau erfolge wie zuvor auf der 4 Ltr.- Sohle, wo der Eisenstein 10 bis 20 Zoll mächtig anstehe. Daneben beginne man, auch in der 6 Ltr.- Sohle die vorhandenen Nieren abzubauen, nachdem die dazu im März begonnene Förderstrecke durchgeschlagen wurde. Der unterhalb liegende Teil der 8 Lachter- Strecke, soweit er nicht mehr erforderlich bleibt, werde dagegen mit Bergen ausgesetzt. Ähnlich lautet auch sein Fahrbericht vom 15. Juli 1824 (40014, Nr. 271, 0046), nur baute man nun wieder in 8 Ltr. Teufe unter dem Stolln und 30 Ltr. vom Kunstschacht gegen West, mittels First- und Strossennachriß das Lager ab, welches hier aber höchstens noch ½ Lachter mächtig sei und „eingestreute derbe Nieren... Eisenstein“ führe. Die abgebauten Strecken werden „sogleich mit Bergen versetzt und verwahrt.“ So blieb es auch das zweite Halbjahr. Auch bei der letzten Befahrung der Grube im Jahr 1824 am 7. Dezember (40014, Nr. 271, Film 0074) fand der Geschworene eigentlich nichts anderes Bemerkenswertes vor, „als daß man mit Untersuchung desjenigen Eisensteinlagers, welches bereits vor langer Zeit in der Teufe 15 Lachter unter Tage und von dem jetzigen Tageschachte aus 30 Lachter gegen Morgen mittels Betrieb des Röschen- oder Waßerlaufortes entdeckt worden, einen Anfang gemacht hatte. Das daselbst befindliche Lager scheint mächtig zu seyn, ohne daß man übrigens jetzt schon vermögend wäre, über sein Streichen, Fallen und wahre Mächtigkeit etwas genaues bestimmen zu können. Der hier angetroffene Eisenstein ist übrigens von ganz ähnlicher Beschaffenheit, als auf den gegenwärtig gangbaren alten Bauen.“ Die Inangriffnahme des neuen Lagers am 3. Tageschacht war auch wieder einen Vortrag aus dem Fahrbogen im Bergamt Annaberg, und zwar bei dessen Sitzung am 31. Dezember 1824, wert (40169, Nr. 221, Blatt 121). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 22. Januar 1825
kam es auch wieder zu einer Generalbefahrung durch das Bergamt
Annaberg, diesmal aber aus einem speziellen Grund: 1825 mußte Heinrich
Gotthold Nietzsche mit dem Hammerwerk in Obermittweida Konkurs
anmelden und die Familie mußte sich neu orientieren (und wie wir später noch aus anderen
Grubenakten erfahren, hat letzterer bereits 1807 den Erla'er Hammer
von den Gebrüdern Reiboldt erworben) und so machte sich eine Taxation der 64 Kuxe, die zum
Obermittweida'er Hammer gehörten, notwendig (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 121). Schau
an: Es waren nur noch 64 ‒ also genau die Hälfte. Im Jahr 1768 gehörten
dagegen noch Dreiviertel der Schichten zu diesem Hammerwerk, das übrige
Viertel denen von Elterlein in Pöhla. Was man dabei befunden hat,
erfahren wir aus der Grubenakte leider nicht. Nur ist hier vermerkt, daß
zu Vater Abraham noch immer „100
Lehn und 30 Posten“ gehörten, zu
Neuglück Fdgr. am 3. Tageschacht hingegen eine gevierte Fundgrube
sowie eine obere und zwei untere Maßen.
Herr Gebler befuhr diese Grube in jedem Quartal mehrfach, wenn auch des öfteren im Grubenbetrieb keine bemerkenswerten Veränderungen vorzufinden waren und dann Eingang in den Fahrbogen fanden. Sein Fahrbericht vom 13. April 1825 ist dann wieder etwas ausführlicher (40014, Nr. 273, Film 0024) und beinhaltet hinsichtlich des Abbaus: „In Betreff der Eisensteingewinnung betriebt man 1.) noch immer den in der Teufe von 6 Ltr. unter der Stollnsohle vom Tageschachte 30 Ltr. gegen Mittag befindlichen Abbau, woselbst auf dem dortigen Lager der Eisenstein ¼ bis ⅜ Lachter mächtig von vorzüglicher Güte zwar, doch mehr nur nestrig ansteht. Man bemüht sich, mittelst Versuchen durch Fortgehen an dem abendlich abgebauten Felde dem Baue mehr Länge zu verschaffen. (...) Nächstdem gewinnt man 2.) auf dem obern vor einiger Zeit in der Teufe von 15 Ltr. unter Tage mittelst des gegen Mittag Morgen getriebenen Wasserlaufs entdeckten Eisensteinlagers Eisenstein, welcher mit dem auf den Tiefbauen von ähnlicher Beschaffenheit und Güte ist. Das Lager erscheint zwar mächtig allhier, da solches weder vollkommen durchbrochen, noch bis jetzt hinlänglich zu untersuchen gewesen ist, so läßt sich über dessen Streichen und Mächtigkeit bis jetzt nichts bestimmtes angeben. (...)“ Auch den Fahrbericht vom 12. Juli 1825 wollen wir hier komplett zitieren (40014, Nr. 273, Film 0047f): „Dienstags den 12ten July bin ich gefahren auf Vater Abraham Fdgr. in Oberscheibe, belegt mit
Eisensteinabbaue. „1) Der bey einer Teufe von 6 Ltr. unter dem Stolln und 30 Ltr vom Tageschacht gegen Abend befindliche Abbau ist mit 6 bis 8 Mann belegt. Das auf diesem Bau anstehende Lager ist von der Mitternachtsseite her auf die Länge von 4 bis 5 Ltr. 1 Ltr. mächtig, anjetzt zum größten Theile aus sehr gutem Brauneisenstein bestehend, hat sich daher zur Zeit ansehnlilch verbeßert und man ist nicht ganz ohne Hoffnung, es könne sich das Lager auch vielleicht in seiner ferneren Ausdehnung an der Mittagsseite bey seinem allmählichen Aufsteigen auch wohl wieder mächtiger werden. Wegen der jetzigen mehren Ergiebigkeit dieses Abbaus ist man daher auch willens 2) der 2te Abbau, (...?) der sich bey 3 Ltr. Höhe über der Stollnsohle 120 Ltr. vom Tageschachte gegen Mittag Morgen auf der vom Schachte gegen diese Weltgegend abgehenden Wasserlauf befindet, bey mehrer Verbreitung der erwähnten mächtigen Anbrüche im Tiefsten, ganz einzustellen.“ Unterhaltung. „Die Unterhaltung der Grube mittelst Auswechslung der alten Zimmerung und Verwahrung der (?) abgebauten Punkte gehet ihren gewöhnlichen Gang. Man hat jetzt einen Theil des Schachtes verzimmert und ist jetzt damit beschäftigt, ein Stück der Länge des (?) untüchtig gewordenen und durch den heftigen Förstendruck hereingebrachte Thürstöck- Zimmerung von ohngefähr 3 Ltr. Länge auszuwechseln. Die Wasser werden durch die vorhandene Kunst zu Sumpf gehalten.“ So blieb es auch im zweiten Halbjahr: Von seiner Befahrung am 3. Oktober 1825 berichtete Herr Gebler (40014, Nr. 273, Film 0066f), es gehe weiterhin förstenweise Abbau auf der 6 Lachter- Strecke um. Das Lager sei hier ½ bis ¾ Ltr. mächtig und das darinnen befindliche Trum von Eisenstein „ist etwas mächtiger, als ehedem“, weswegen das Gewinnen des quartaliter erforderlichen Förderquantums besser vonstatten gehe. Der zweite Abbau 120 Ltr. (die Angabe scheint uns etwas zu groß ?) vom Schacht gegen Morgen war ebenfalls belegt, über Streichen, Fallen und Mächtigkeit dieses Lagers ließe sich aber noch immer nichts angeben, da man es noch immer nirgends vollends durchbrochen habe.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während des folgenden Winterhalbjahrs
waren wieder 15 Mann auf der Grube beschäftigt. Über seine Befahrung am
17. Februar 1826 berichtete Herr Gebler bezüglich des
Eisensteinabbaus (40014,
Nr. 275, Film 0017):
„1) Der Tiefbau 6 Ltr unter dem Stolln und vom Kunstschachte 26 Ltr gegen Mittag (?) ist (?) mit 4 und 6 Mann belegt, welche den etwa auf 10 Ltr Länge hier anstehenden und sich in einer krummen Linie gegen Mitternacht Morgen herumziehenden, von ⅛ bis ½ Lachter mächtigen Eisenstein theils först-, theils strossenweise gewinnen. Das hier bebaute Lager stellt gegenwärtig die besondere Eigenheit auf, daß während es jetzt und schon seit drey Jahren gegen Abend aufsteigt, es an dem gegenwärtigen mitternächtlich morgendlichen Endpunkte, nämlich da, wo es am mächtigsten ist, sich in die Teufe zu ziehen und niederzusetzen anfängt. Ob dieß nun nur eine (?) punktuelle Abweichung von der Regelmäßigkeit auf (?) ein paar Lachter Länge und Teufe seyn, oder ob das Lager hier in seinem Fallen einen Absatz oder Stuffe bilden und künftig im Durchschnitte angesehen diese Gestalt annehmen wird, ...“ Die kleine Skizze dieser Stufe mitten in seinem Text fügen wir hier gleich ein:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat der
Fahrbögen aus dem Jahr 1826:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„...stehet zu erwarten, obgleich das
Eintreten (?) dieses Umstandes des wahrscheinlichere bleibt, ein
solches Verhalten desselben, nämlich das Fortaufsteigen des Lagers, wegen
der Unzulänglichkeit der hiesigen Kunst in die Teufe auch zur Zeit für
dieses Gebäude das nützlichste seyn würde.
2) Der zweyte Eisensteinbau in der Nähe des 3ten Tageschachtes auf dem Wasserlaufe 3 Ltr über der Stollnsohle ist mit 2 Mann belegt und der hier brechende Eisenstein meistens von sehr guter Beschaffenheit. Ohngeachtet man auch jetzt noch nicht mit völliger Bestimmtheit das Streichen und Fallen dieses Lagers nebst seiner Mächtigkeit angeben kann, so scheint es doch, als wenn es in der Std. 10,0 streichen und gegen Mitternacht Abend fallen würde.“ Ansonsten ging aber alles den gewohnten Gang und jedes Quartal wurden hier an die 40 Fuder Eisenstein gefördert. Bei seiner Befahrung am 14. März des Jahres fand Herr Gebler demgegenüber keine bemerkenswerten Veränderungen vor (40014, Nr. 275, Film 0024). Auch bis zum 1. Mai 1826 waren keine bedeutenden Änderungen im Grubenbetrieb im Fahrbogen festgehalten (40014, Nr. 275, Film 0040f), nur bemerkte der Geschworene noch: „Das in dem vorigen Quartal anscheinende Niedersetzen des Lagers hat nicht stattgehabt, vielmehr fährt dasselbe fort, obgleich nur sehr allmählig und langsam, aber doch anhaltend, aufzusteigen.“ So ging es über den ganzen Sommer 1826 stetig weiter. Am 18. September diesen Jahres berichtete Herr Gebler dann von seiner Befahrung der Grube (40014, Nr. 275, Film 0072f), mit dem ersten Eisensteinabbau „fährt man ununterbrochen fort, so daß man nunmehro durch Umfahrung des Lagers in der mitternächtlich morgendliche Seite gelangt ist. Der Eisenstein steht zwar nicht mächtiger als ⅛ bis ⅜ Lachter an, ist aber von vorzüglicher Güte. Das Lager selbst scheint mehr steigen als fallen zu wollen, ob sich gleich jetzt in der mitternächtlichen Seite eine Stelle findet, wo es sich abermals etwas zu senken scheint.“ Auch der andere Abbau in 18 Lachter Teufe des dritten Tageschachtes schritt wie zeither fort. Das Streichen und Fallen dieses Lagers war nach wie vor nicht zu bestimmen, doch liefere es sehr guten Eisenstein. Der Geschworene fügte noch hinzu, das Holz der Kunstradstube leide unter dem Druck und ist wandelbar geworden, es bedürfe einer größeren Reparatur. Bei dieser Gelegenheit solle auch das Kunstrad ausgewechselt werden. Das war allerdings ein, wenngleich notwendiges, so doch ziemlich großes Vorhaben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deswegen war Herr Gebler auch
schon am 9. Oktober erneut vor Ort und berichtete (40014,
Nr. 275, Film 0079),
das neue Kunstrad werde bereits gefertigt und bekäme einige Schaufeln
mehr, als das bisherige. In Vorbereitung der Arbeiten habe man „bedenkliche
Stellen“ in der Grube zusätzlich verwahrt, sowie „einen
Communicationsschacht auf das Tiefste des Abbaus durch alte Firstenbaue
angelegt, um nach dem Ersaufen der Grube (was infolge des Radwechsels
ja unumgänglich eintrat) bey Wiedergewältigung des Tiefsten gegen
(unerwartete?) Ereignisse möglichst gesichert zu seyn.“
Das Abschützen und Herausreißen des alten Rades sowie die Reparatur der Zimmerung der Radstube solle nun in den nächsten Tagen beginnen und alles werde wohl mehrere Wochen dauern. Über seine Befahrung am 30. Oktober heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 275, Film 0085), das alte Rad ist bereits herausgebaut und nun werde mit 8 bis 10 Mann in zwei Dritteln die Radstube neu ausgezimmert und ihr „die verlorengegangene Weite wiedergegeben.“ Schon am 6. und am 7. November 1826 war der Geschworene erneut vor Ort, um den Fortgang der Arbeiten zu begutachten (40014, Nr. 275, Film 0086) und befand, „daß der mitternächtliche niedere Theil der Radstube sowie deren kurze Stöße von unten heraus fast gänzlich in neue Zimmerung gesetzt waren.“ Außerdem hatte er noch weitere Veranlassung, zu berichten über: Aufbereitung des klaren Eisensteins durch Waschen auf dem Hammerwerk Obermittweida. „In Ansehung der von Eu. hochverordneten Oberbergamte empfohlenen Erhöhung des Metallgehalts der gewonnenen Eisensteine durch sorgfältiges Ausscheiden, ingleichen durch Pochen und Waschen, habe ich hier zu bemerken, daß man schon seit einiger Zeit seitens des Hammerwerks Obermittweyda angefangen hat, den von den obgedachten Grubengebäude in der Gestalt groben Sands oder in sogenannten Grubenklein erhaltenen Eisenstein auf einer Art liegenden Herd zu verwaschen, mittelst welchen Processes man aus 5 Ctr. angefahrenen klaren Eisensteins 4 Ctr. gewaschenen erhalten hat. Zur Zeit ist dieses Verfahren, welches ich beaugenscheiniget habe, fortgesetzt und für gut befunden worden.“ Hinsichtlich der weiteren Verarbeitung des Erzes in den Hammerwerken ist dies eine seltene Erwähnung. Auch für das Bergamt waren diese Ergebnisse natürlich nicht uninteressant und Herr Gebler trug daher dazu am 2. Dezember auch in Annaberg vor (40169, Nr. 221, Blatt 122A).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber auch das Großprojekt schritt ja fort
und am 21. November 1826 hatte der Geschworene zu berichten (40014,
Nr. 275, Film 0091), er habe an diesem
Tage nicht nur 60 Fuder ausgebrachten Eisensteins zu vermessen gehabt,
sondern auch:
„An dem heutigen Tage abends ist noch Gott sey Dank glückliche
Beendigung der zeitherigen Reparaturarbeiten an der Radstube und nach
vollbrachtem Hängen des neuen Rades wieder angeschützt worden und ist nun
zu wünschen, daß man nach erfolgtem Abgewältigen keine durch den
Wasseraufgang etwa entstandenen Brüche vorfinden möge.“
Der Umbau war also erfolgreich beendet, nun hieß es „nur“ noch, die bis zur Stollnsohle natürlich ersoffenen Tiefbaue wieder zu sümpfen. Nur drei Tage später aber vermeldete Herr Gebler sehr zufrieden (40014, Nr. 275, ebenfalls noch auf Film 0091), er habe „auf Vater Abraham Fdgr. noch 20 Fdr. Eisenstein vermeßen, wodurch das auf dieses Quartal entfallende Quantum an 80 Fdr. anjetzt erfüllt worden. Es ist dieser Umstand um so erfreulicher, da man 5½ Wochen hindurch für die Gewinnung von Eisenstein auf dem oberen Bau über dem Stolln, welcher gleichwohl nur sehr schwach betrieben wird, (?) da man sich während dieser Zeit täglich mit 10 Mann in der Radstube zu beschäftigen gehabt hat.“ Das war sicher tatsächlich sehr erfreulich für die Gewerken, für uns aber ist es in erster Linie eine technologische Meisterleistung der Belegschaft ! Am 28. November berichtete Herr Gebler dann (40014, Nr. 275, Film 0092), „daß man mit der angefangenen Niedergewältigung der bis auf den Stolln aufgegangen gewesenen Wasser ohngefähr 2½ Ltr in dem Kunstschachte niedergekommen war.“ Auch die letzte Eintragung im Jahr 1826 in den Fahrbögen des Geschworenen betraf noch einmal die Grube Vater Abraham (40014, Nr. 275, Film 0087): „Auch ist am heutigen Tage von dem Steiger auf Vater Abraham Fdgr. in Oberscheibe gemeldet worden, daß in der verfloßnen Nacht die Wiedergewältigung der Tiefbaue glücklich geendigt und man außer einer Menge hoch aufgetragener Schlämme und außer dem Umstande, daß die besonders zur Beförderung des Wetterwechsels durch alte Baue vom Stolln niedergehende Communications Strecke etwas verbrochen gewesen, man alles andere doch in erträglich gutem Zustande gefunden habe.“ Es war vollbracht und im Wesentlichen alles glücklich verlaufen. Neue Herausforderungen kündigten sich aber auch schon an: „Übrigens stelle der obere über dem Wasserlaufe befindliche Eisensteinbau bedeutende Schwierigkeiten auf, in so fern sich große Lasten von dem dortigen Lager niederzögen, daß man dessen unbekannter Mächtigkeit wegen auf das schicklichste anzuzeigen noch nicht vermocht hat.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleich am 5. Januar 1827 war Herr
Gebler wieder auf der Grube und fand den Tiefbau unter der Stollnsohle
wieder zu drei Dritteln belegt (40014,
Nr. 278, Film 0003).
Der andere Abbau nahe des dritten Tageschachts war nur in einer Schicht
mit drei Arbeitern belegt, nach
wie vor aber sei hier kein Streichen und Fallen anzugeben. „Man wird
indessen nunmehro einen Versuch machen, in der Richtung gegen Mittag Abend
so hindurchzugehen, daß man nur die Begrenzungslinien desselben berührt,
um sich über das Unbekannte die nöthige Auskunft zu verschaffen, zugleich
aber auch die Gewinnung zu erleichtern und sichrer zu stellen,“ hielt
der Geschworene hierzu in seinem Fahrbogen fest. Bei der geringen Belegung dieses zweiten Abbaus schritten die Arbeiten dort aber langsam voran und so war von den Befahrungen Ende Januar und Anfang März nichts neues zu berichten; der Geschworene fand „alles noch in gutem Stande und der zeitherigen Ordnung.“ Am 20. April 1827 war Herr Gebler bei Vater Abraham nur übertage zugegen, um den geförderten Eisenstein und das vorhandene Grubenholz zu besichtigen (40014, Nr. 278, Film 0033). Dann folgte aber doch noch eine längere Eintragung im Fahrbogen (40014, Nr. 278, Film 0035): „Am Abend diesen Tages nach meiner erfolgten Nachhausekunft meldete man, mit Ende der Mittagsschicht, also nach 18 Uhr den auf der Grube Vater Abraham zu Oberscheibe eben jetzt bey dem Ausfahren, auf der Hängebank des Kunstschachtes in der Stollnsohle unerwartet erfolgten Tod eines daselbst sehr brauchbar gewesenen und rechtschaffenen Bergarbeiters nahmens Krauß, der, ohne zuvor eigentlich krank gewesen zu seyn, und nachdem er noch diese Mittagsschicht hindurch seine Bergarbeit gehörig verrichtet, an der erwähnten Stelle sich niedergesetzet, rückwärts über gelehnt habe und augenblicklich, vermuthlich vom Schlage getroffen, verschieden sey. Auf diese Meldung sind nach vorgängiger Anfrage um Erlaubnis Arzt und Wundarzt sogleich zu dem Entleibten geholt worden, jedoch ohne Erfolg.“ Die Bergarbeiterfamilie Krauß
aus Raschau ist uns auch als
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner Befahrung der Grube am
3. Juli 1827 berichtete Herr Gebler dann in seinem Fahrbogen (40014,
Nr. 278, Film 0053f):
„1) Der Hauptabbau des zu dieser Grube gehörigen Eisensteinlagers befindet sich bekanntlich in der 8 Ltr Sohle unter dem Stolln, vom Kunstschachte 25 Ltr gegen Abend und gegen Mitternacht Abend, ist über 10 Ltr lang und mit 6 bis 8 Mann belegt. Der Eisenstein steht hier ohngefähr ¼ bis ⅜ Ltr mächtig auf dem ½ bis ⅝ Ltr mächtigen, aus Hornstein bestehenden Lager an. 2) Der 3 Ltr über der Stollnsohle auf dem sogenannten Wasserlauf ohnfern des 3ten Tageschachtes befindliche Abbau ist mit 2 Mann belegt. Das Abbauen des Eisensteins mittelst Förstenbau auf diesem Punkte hat man seiner Gefährlichkeit wegen, indem sich bey der großen und unbekannten Mächtigkeit des Lagers hier an dieser Stelle (?) im Ganzen gezogen vor der Hand eingestellt, diesen Bau mit Bergen versetzt und damit ausgesetzt, das Lager aber mittelst Betrieb eines an der abendlichen Seite desselben angesetzten Ortes zu umfahren angefangen, um es vielleicht mit zu durchfahren und dadurch zu hinlänglicher Kenntnis der zu dieser Zeit noch unbekannten Verhältnisse dieses Lagers zu gelangen und dabey darauf Eisenstein zu gewinnen. In Behuf der Unterhaltung und Wasserhaltung war nichts weiter zu bemerken, als daß für den Tagschacht eine Reparatur desselben durch Ein- und Auswechseln einer Anzahl Joche und Kappen nothwendig geworden ist...“ Der unter 2) beschriebenen Einstellung des Abbaus am 3. Tageschacht halber trug Herr Gebler dazu am 28. Juli 1827 wieder im Bergamt vor. Gegen die Einstellung und das Aussetzen des Abbaus hatte man dort aber nichts einzuwenden (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 122). Während der Ortbetrieb im zweiten Lager also so schnell keine neuen Erkenntnisse brachte, kam man im ersteren wieder einmal an ein Verwinden, wie man im Fahrbogen vom 9. Oktober 1827 lesen kann (40014, Nr. 278, Film 0076): „Der Abbau in der 8 Lachter Sohle fängt nicht nur an, sich immer mehr nach den zwey Weltgegenden Mitternacht und Mittag Morgen zu erlängen, das Lager stellt auch in der Nähe des mitternächtlichen Endpunktes auf den letzten zwey bis drey Lachtern Länge die Besonderheit auf, daß sich dasselbe hier wieder in die Teufe senkt, daher man sich genöthigt gesehen, auf demselben niederzugehen und zu Haltung der Wasser eine Drückelpumpe einzubauen. Ob man daselbst weiter niedersetzen oder ob dieses Neigen nicht etwa – das glaublichste – nur eine punktuelle Erscheinung sey, das Lager aber im Ganzen in seinem Ansteigen verbleiben wird, muß die Erfahrung lehren.“ Der zweite Abbau wurde mit 2 Mann betrieben, welche dort mittels Ortsbetrieb Eisenstein gewannen. „Über Streichen, Fallen und Mächtigkeit läßt sich noch nicht das allermindeste angeben.“ Am 29. Oktober 1827 fand der Geschworene keine bemerkenswerten Veränderungen vor (40014, Nr. 278, Film 0081), nur „scheint sich das Lager im Hauptabbau doch nicht weiter niederzusetzen.“ Na, was ein Glück ‒ dann kann der Betrieb auch dort also normal weitergehen. Insgesamt hatte man in diesem Jahr wieder 240 Fuder Eisenstein ausgebracht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Jahr 1828 ging der
Grubenbetrieb seinen gewöhnlichen Gang weiter, jedenfalls steht in den
regelmäßigen Fahrberichten Herrn Gebler's nur selten etwas wirklich
neues zu lesen (40014, Nr. 280).
Allerdings muß es Anfang diesen Jahres einen tödlichen Unfall gegeben
haben, denn der Geschworene notierte unter dem 4. Februar, an diesem Tage
„habe ich der Beerdigung des freytags, den 1. Febr. auf Vater Abraham
Fdgr. verunglückten Bergarbeiters Bergner beygewohnt und mich hierauf nach
Annaberg in die rücksichtlich dieses Gegenstandes abgehaltene
Bergamtssession begeben.“ (40014, Nr. 280,
Film 0011) Normalerweise fanden die Sitzungen
in den Bergämtern immer am Ende des Monats statt ‒ wenn es hierzu eine
besondere Sitzung gegeben hat, muß es also ein Arbeitsunfall gewesen sein.
Vielleicht finden wir auch die Registratur zu dieser Sitzung noch, dann
werden wir an dieser Stelle einfügen, was dem Bergmann Bergner
widerfahren ist. Die Belegung der Grube blieb aber konstant bei 15 Mann.
Man hat wohl schnell Ersatz gefunden. Im Sommer 1828 hielt der Geschworene in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 280, Film 0042), daß der Abbau am Kunstschacht nun eine Ausdehnung von bis zu 25 Lachtern erreicht habe. Da das Lager keine Anstalten mache, „sich wieder empor zu heben,“ müsse man weiter mit der Pumpe das Wasser niederhalten. Der zweite Abbau am dritten Tageschacht oberhalb des Wasserlaufs wurde mit kleinerer Belegung ebenfalls betrieben. Der dortige Firstenbau hatte inzwischen 2 Lachter Höhe erreicht, ohne daß man aber das hier besonders mächtige Lager durchbrochen habe. Außerdem lobte Herr Gebler die Erfahrung des Steigers hinsichtlich der Zimmerung, „um mit der Grube nicht unglücklich zu werden.“ Am 1. August diesen Jahres gab es demgegenüber keine Veränderung im Betrieb (40014, Nr. 280, Film 0056f). Man trieb auch wieder Versuchsbaue, aber „der in die entgegengesetzte Weltgegend bey etwa nur 20 Ltr Entfernung vom Kunstschacht gegen Mittag Morgen gemachte Versuch hat bis jetzt noch zu keinem sonderlich ausgezeichneten Resultate geführt, indem man immer nur alten Mann, aber nicht das Lager selbst angetroffen.“ Auch in diesem, im Vergleich zu den Gruben am Emmler doch bedeutenden Bergwerk schlug man also jetzt in die Baue der Vorfahren ein... Bei seiner Befahrung im letzten Quartal des Jahres fand der Geschworene auch nicht viel Neues vor (40014, Nr. 280, Film 0082f). Erneut lobte er die Arbeit der Belegschaft: In Ansehung der Unterhaltung fand er alles „in dem besten Gange und in der vollkommensten Ordnung.“ Da es im Jahr 1828 keine größeren Unterbrechungen durch Reparaturen gab, kam insgesamt ein Ausbringen von 320 Fudern Eisenstein zusammen. Überhaupt scheinen in diesen Jahren die Gewerken ziemlich konstant nicht mehr als 80 Fuder pro Quartal abgenommen zu haben. Sobald diese Menge ausgebracht war, konnte sich die Belegschaft um Unterhaltungs- und Versuchsarbeiten kümmern, was dem Betrieb sicherlich zuträglich war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nicht anders ging es im Folgejahr 1829
weiter. Herr Gebler war am 12. Januar wieder vor Ort und befand,
das vom Kunstschacht aus unter der Stollnsohle bebaute Lager „erhebt
sich weiter“ und nach einiger Zeit werde man wohl der Pumpe entbehren
können. Der andere Abbau beim 3. Tageschacht, 15 Lachter unter Tage und 3
Lachter oberhalb der Stollnsohle auf dem Wasserlauf gelegen, war noch
immer nicht durchbrochen, stand aber mit kleinerer Belegung ebenfalls in
Betrieb (40014, Nr. 280, Film 0100).
Auf den 28. Februar dieses Jahres datiert dann ein Eintrag in der Grubenakte, daß die Vernehmung „bezüglich der Verunglückung des Bergarbeiters Trommler aus Mittweida“ stattgefunden habe. Was diesem passiert ist, ist an dieser Stelle jedoch nicht dokumentiert (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 124). Auch aus dem Jahr 1829, und zwar vom
27. April, stammt ein Schreiben von Carl Heinrich Nietzsche,
inzwischen auf dem Hammerwerk Erla ansässig, in dem er sich über die
unzureichende Aufbereitung des Eisensteins beschwert. Der Steiger sehe nur
auf die Menge, nicht aber auf die Qualität des Eisensteins, weswegen er
das Bergamt darum bat, dem Steiger Anweisung zu geben, den Stein besser
auszuschlagen (40169, Nr. 221, Blatt 125).
Das Pochen und Waschen hatte man wohl 1826 nur auf dem Hammer in
Bei seiner Befahrung am 7. Mai 1829 stellte Herr Gebler dann fest, das Lager im ersten Abbau „verschmälert sich sehr,“ der Eisenstein bricht hier nesterweise, auch als „Sand“ in aufgelöstem Glimmerschiefer eingestreut. Letzterer wurde auf dem Hammer Obermittweida verwaschen, wo man aus 5 Fudern Sand immerhin noch 3 Fuder Eisenstein erhält (40014, Nr. 280, Film 0133). Im zweiten Lager am 3. Schacht hatet man sich „etwa 2½ Ltr förstenweise überhauen“ ‒ man betrieb also jetzt einen Firstenbau. Das Streichen und das Fallen sowie die Mächtigkeit seien aber noch immer ungewiß. Eine weitere Grubenbefahrung durch den Geschworenen fand am 6. Juli 1829 statt (40014, Nr. 280, Film 0147f). Jetzt heißt es im Fahrbogen, der erste Abbau sei bereits 35 Lachter vom zweiten Tageschacht gegen Abend fortgerückt und das Lager liege beinahe söhlig. Weiter schrieb er aber auch: „Fast bekommt es das Ansehen, das dieser zeitherige Abbau nunmehr nicht von allzu langer Dauer seyn dürfte, indem sich das Lager an diesem Punkte gegen Morgen und gegen Mitternacht nicht weiter fortziehen, in seiner Mächtigkeit nicht wieder zunehmen und wieder in die Tiefe zu gehen... scheint.“ Der größte Teil der Belegschaft, nämlich sechs bis acht Mann, blieben aber an diesem Punkt angelegt. Der zweite Abbau am 3. Tageschacht war dagegen nach wie vor nur mit zwei Mann belegt. Durch diesen, „sehr viele Hoffnung versprechenden Abbau läßt sich vielleicht der Abbau im Tiefsten, wenn man (...) nach einigen Jahren denselben zu verlassen sich genöthigt fände, wieder ersetzen.“ Auch nach seiner Befahrung am 3. September diesen Jahres hielt Herr Gebler wieder fest (40014, Nr. 280, Film 0147f), das Lager nordwestlich vom Kunstschacht „zieht sich (...) immer mehr zurück und zusammen.“ Das Ausbringen wird aber durch das andere Lager gestützt, welches inzwischen wohl fast durchörtert gewesen sein muß, denn der Geschworene berichtete nun, es sei wenigstens 1 Lachter mächtig, streiche etwa Std. 5,0 und fällt 50° gegen Mittag Abend. Der Firstenbau hier war inzwischen 3 Lachter hoch, 4 Lachter lang und jetzt mit 4 Mann belegt. So hielt man den Betrieb auch im letzten Quartal 1829 im Gange. Das Lager am dritten Schacht „liefert sehr schönen Eisenstein,“ hielt Herr Gebler in seinem Fahrbericht vom 12. Oktober noch fest (40014, Nr. 280, Film 0171f). Außerdem war der Geschworene jedesmal auf der Grube, wenn wieder eine Ladung von 40 Fudern ausgeschlagen und zum Vermessen und zur Verladung bereit gewesen ist. 1829 brachte die Grube Vater Abraham nach den Angaben in den Fahrbögen insgesamt 280 Fuder Brauneisenstein aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Befahrung im ersten Quartal
Reminiscere 1830 fand am 1. Februar statt
(40014, Nr. 280, Film 0197f).
Der alte Abbau am Kunstschacht wird immer kürzer und es scheine, er werde
auskeilen, um „desto vortrefflicher beweist sich der andere.“ Dort
plane man nun, einen Schacht auf diesem anlegen. Im abgebauten Feld wurde
zwar mit Bergen ausgesetzt, dennoch „sinkt das Hangende nieder und
zersprengt das Holzwerk.“ Mehrfach betonte der Geschworene in seinen
Fahrbögen aber, die Unterhaltung der Grube werde stets „sehr wohl
besorgt.“
Am 3. Mai 1830 heißt es im Fahrbericht, die Qualität des Eisensteins im alten Lager bessere sich wieder, das Lager sei aber nur noch ¼ Ltr mächtig. Die Mächtigkeit des Lagers im zweiten Abbau gibt Herr Gebler nun mit „wenigstens 3 Ltr“ an (40014, Nr. 280, Film 0224). Auch über seine Befahrung am 3. August 1830 berichtete der Geschworene, der erste Bau werde weiter kürzer und „das völlige Auskeilen und Aufhören dieses Lagers steht also, wenn auch erst in ein paar Jahren, zu erwarten.“ Das zweite Lager war mit 4 Mann belegt und dieser Firstenbau liefere quartaliter 30 bis 35 Fuder sehr schönen Eisenstein ‒ nur noch 5 bis 10 Fuder kamen also noch aus dem älteren Abbau (40014, Nr. 280, Film 0246f). Crucis 1830 waren wieder einmal Reparaturen am Kunstschacht nötig und es wurden „schadhafte Kunstsätze und andere Maschinentheile ausgewechselt.“ Wegen der dadurch natürlich unvermeidlich aufgehenden Wasser mußte man den Tiefbau stehen lassen (40014, Nr. 280, Film 0256). Im anderen Abbau „ist man darauf bedacht, die entstehenden Weitungen durch zweckmäßige Zimmerung und Bergeversatz zu verwahren.“ Der geplante Hilfsschacht dort soll bei 8 Lachter Teufe das Lager treffen. Insgesamt war es für die Grube ein gutes Jahr und so kamen wieder 320 Fuder Ausbringen zusammen. Überhaupt hat man hier in den 1820er und 1830er Jahren sehr konstant um die 300 Fuder Eisenerz jährlich gefördert, wie es auch aus den Erzlieferungsextrakten hervorgeht (40166, Nr. 22 und 26). Das lag natürlich auch daran, daß die Hammerwerksbesitzer als Eigenlöhner der Grube einen bestimmten Bedarf an Erz pro Jahr hatten und mit ihren damaligen technischen Möglichkeiten gar nicht mehr hätten verarbeiten können. Sie hatten verständlicherweise natürlich auch kein Interesse daran, Mehrmengen an Erz an die Konkurrenz zu verkaufen und diese damit zu stärken, vielmehr waren sie darauf bedacht, die eigene Rohstoffbasis möglichst langfristig zu erhalten ‒ umso mehr, wenn (wie wir gerade gelesen haben) auch hier die Erzvorkommen endlich waren. Das erscheint im Vergleich mit heutigen Entwicklungen sehr nachhaltig gedacht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als Herr Gebler am 4. Februar
1831 das nächste mal die Grube befuhr
(40014, Nr. 281, Film 0012),
waren die Reparaturen offenbar abgeschlossen, denn der Abbau im Tiefsten
war wieder belegt. Das Lager dort verliert immer mehr an Länge und ist „auf
nur noch 6 Lachter zusammengeschwunden.“ Das andere Erzlager am 3.
Tageschacht ist jetzt von „starken Fäulen oder mächtigen Schichten aus
Eisenocker und losem Gestein durchsetzt,“ in denen aber „ansehnliche
Nieren von dichtem Brauneisenstein einbrechen.“ Diese Fäulen machen
den Abbau „etwas gefährlich“, auch der vorhandene Druck erfordert
große Vorsicht in diesem Abbau und bei dessen Verwahrung; alles wird aber
„auf das zweckmäßigste besorgt“. Bei seiner nächsten Befahrung im Quartal Trinitatis 1831 fand der Geschworene auf der Grube 14 Mann angelegt. Der Tiefbau scheint sich seinem Ende immer mehr zu nähern, da sich der hier befindliche Nieren immer mehr verkürzte. Herr Gebler schätzte ein, daß man hier nur noch „ein paar Quartale“ Eisenstein ausbringen kann. Das Ausbringen hat sich zum großen Teil auf den zweiten Abbau verlagert, wo man einen neuen Tageschacht zur Erleichterung der Förderung anlegen wolle, damit aber immer noch nicht begonnen hat. (40014, Nr. 281, Film 0024f) Am 18. Mai 1832 hatte sich der Abbau im Tiefsten auf eine Länge von kaum noch 4 Lachter verkleinert. Nun will man den neuen Schacht im zweiten Lager ansetzen, wozu Gebler mit dem Steiger übertage die nötigen Messungen vorgenommen und den Ansatzpunkt vorläufig bestimmt hat. (40014, Nr. 281, Film 0036) Dann fand der Geschworene bei seiner Befahrung am 2. November 1831 (40014, Nr. 281, Film 0070) aber, daß sich im Tiefsten wieder „etwas Eisenstein an dem südlichen Ende desselben auf die Länge von 1 Ltr. mit etwa ¼ Ltr Mächtigkeit angelegt und hierdurch die Hoffnung erregt, hier noch vielleicht eine Zeitlang fortbauen zu können.“ Der Abbau am 3. Tageschacht oberhalb des Wasserlaufs war jetzt mit 4 bis 6 Mann belegt. Dort wurde gerade ein „Communications- Ort“ zum 3. Tageschacht, 5 Lachter über dessen Füllort oder in 15 Lachter Teufe unterm Tage angelegt, um den Wetterwechsel und die Fahrung und Förderung zu erleichtern. Es soll die bisherige „krumme und viel längere Linie der Wasserlaufsohle“ ersetzen, ist bislang 10 Lachter fortgebracht, das Gegenort aus dem Eisensteinabbau war 2 Lachter fortgestellt. Den Eisensteinabbau dort erschwerten nicht nur die fehlenden Wetter, auch „der Mangel an Bergeversatz hindert ihn völlig.“ Hierzu trug der Geschworene am 26. November 1831 auch wieder im Bergamt Annaberg vor (40169, Nr. 221, Blatt 125). Ansonsten lief im Jahr 1831 aber alles normal und am Ende des Jahres stand erneut ein Ausbringen von 320 Fudern zu Buche. Seltsamerweise fehlen Fahrberichte zur Grube Vater Abraham in den Aufzeichnungen des Berggeschworenen im folgenden Jahr 1832. Jedoch muß alles seinen gewohnten Gang weitergegangen sein, denn Herr Gebler war siebenmal vor Ort, um jedesmal 40 Fuder ausgebrachten Eisensteins zu vermessen (40014, Nr. 281, Film 0102ff), insgesamt belief sich die Förderung in diesem Jahr also wieder auf 280 Fuder.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem vergangenen Jahr war wohl etwas
übriggeblieben und noch nicht ausgeschlagen, denn als Herr Gebler
am 25. Februar 1833 zum Vermessen kam, standen diesmal 50 Fuder Eisenstein
zu Buche
(40014, Nr. 281, Film 0169).
Von seiner Befahrung am 6. März des Jahres berichtete der Geschworene, der
Abbau im Tiefsten 8 Lachter unterm Stolln und bei 18 Lachtern Erlängung
vom Kunstschachte gegen Mittag Morgen „ist schon seit geraumer Zeit von
sehr kleinem Umfange, nämlich ohngefähr 1 Ltr lang... Man hat immer die
Hoffnung gehabt, das Lager an dieser Stelle wieder sich bauwürdiger zeigen
und sich erlängen zu sehen. Inzwischen ist solches bisher noch nicht
erfolgt und ist bey Fortsetzung des Versuchs das weiter zu erwarten. Desto
vorzüglicher beweist sich der in der Nähe des 3ten Schachtes und zwar über
der Sohle des Wasserlaufes bekanntlich schon seit mehreren Jahren gangbare
Hauptbau...“ Man hat bisher auf etwa 8 Lachtern Länge nur 2½ Ltr in
die Höhe gebaut und will sich nun auf Höhe der Wasserlaufsohle gegen Süden
„ausbreiten“.
Im Fahrbogen vom 13. Mai 1833 (40014, Nr. 281, Film 0190) heißt es dann, der Abbau im Tiefsten gegen Mittag Abend „ist nur noch als Versuchsbau zu betrachten. Allen Bemühens ohngeachtet... ist es nicht wieder günstiger geworden.“ Eine Zeitlang wird dieser Bau aber noch mit 2 Mann belegt, da man hier doch noch etwas Eisenstein gewinnt. Der zweite Firstenbau im Süden ist von der Sohle aus inzwischen 4 Lachter hoch geworden und liefert für das erforderliche Förderquantum den meisten Eisenstein. Dieser Bau macht aber „öfter Schwierigkeiten, indem sich große Stücken Lagermasse unaufhörlich losreißen und sogleich abgefangen werden müssen... Der Abbau, wie der ganze Betrieb bei Vater Abraham erfordert, seiner Eigenthümlichkeiten wegen, eine ganz eigne Behandlungsweise, Kenntnis und Erfahrungen... für den dieselbe beaufsichtigenden Steiger.“ Noch weitere achtmal war der Geschworene in diesem Jahr auf der Grube, um jeweils zwischen 20 und 40 Fudern Eisenstein zu vermessen. Obwohl diese Mengen stärker schwankten, als in den Vorjahren, hat das Ausbringen auch im Jahr 1833 wieder insgesamt 320 Fuder umfaßt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Grube Vater Abraham erhielt 1833 sogar in August Schumann’s Postlexikon von Sachsen einen eigenen Verweis, da es mehrere Erzgruben dieses Namens im Erzgebirge gab. Zu dieser heißt es im Ergänzungsband 18: „bei Scheibenbg. oder Oberscheibe, auf Eisen, wo auch der ägypt. Jaspis (säch. Aegyptenstein) u. brauner muschlgr. Jaspis vorkommen; sie gehört zum Hammer Obermittweida.“ Letzteres ist nicht ganz korrekt, denn die Grube hatte zu dieser Zeit mit den von Elterlein's auf Pöhla noch immer auch einen zweiten Besitzer und Abnehmer für das ausgebrachte Erz. Mit dem „ägyptischen Jaspis“ dürfte ein tiefroter, dichter und schleifwürdiger Hämatit (Roteisenstein) gemeint gewesen sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im folgenden
Quartal Reminiscere 1834 blieb der Abbau unter dem Stolln am Kunstschacht
noch mit zwei Mann belegt, „um theils, was sich noch an Eisenstein
gewinnen läßt, zu benutzen, theils die zeitherigen Versuche...
fortzusetzen.“ Der Hauptteil der Belegschaft war aber inzwischen auf
dem Abbau am dritten Tageschacht angelegt
(40014, Nr. 289, Film 0010). Nach seiner Befahrung am 29. Juli 1834 schrieb Herr Gebler in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 289, Film 0040f), der untere Abbau werde noch immer betrieben, aber es „stellt sich dermalen noch nirgends etwas auf, woraus sich Veranlassung auf die Vermuthung zu einem sich hier wieder ausbreitenden Eisensteinabbau schöpfen ließe.“ Der obere Abbau zeigte sich dagegen „fortdauernd ergiebig, (...) erfordert aber des großen hier vorkommenden Druckes wegen für seine Behandlung ungemeine Vorsicht.“ Außerdem plante man nun auch, einen Stollnflügel vom 2. Tageschacht aus bis an den Abbau am 3. Schacht herantreiben. Diesen Plan befand man nach dem Fahrbogenvortrag auch im Bergamt Annaberg für „sehr zweckmäßig“ (40169, Nr. 221, Blatt 126). Im Fahrbogen vom 12. September 1834 ist der zweite Abbau dann das erste Mal in der Reihenfolge der Beschreibung an die erste Stelle gerückt. Hier arbeiteten jetzt 8 Mann. Die Mächtigkeit des Lagers dort gabt Herr Gebler mit mindestens 1 Lachter an, sie sei aber „nicht zuverlässig zu bestimmen“ und es besteht aus dichtem Brauneisenstein. Der alte Abbau war noch mit 4 Mann belegt, welche jetzt 36 bis 40 Lachter vom Kunstschacht nordwärts dem Lager folgten, und „der Nieren (ist) nicht mehr breit, aber zieht sich noch fort.“ (40014, Nr. 289, Film 0051) Das Ausbringen blieb dabei absolut konstant: In jedem Quartal war der Geschworene zweimal vor Ort, um jedesmal 40 Fuder, respektive im ganzen Jahr 1834 wieder eine Förderung von 320 Fudern zu vermessen. Aus dem folgenden Jahr gibt es einen ersten Fahrbericht zur Grube Vater Abraham vom 6. Februar 1835 (40014, Nr. 289, Film 0073f). Eigentlich hatte sich bis dahin nichts weiter geändert. Auch der alte Abbau am Kunstschacht wurde fortgeführt, „ist (er) doch des Abbaus werth und dient zugleich als Versuchsbau.“ Eine zweite Befahrung durch den Geschworenen fand am 11. Mai 1835 statt, wobei er jedoch wieder nichts neues zu berichten fand (40014, Nr. 289, Film 0078). Auch bei seinem Besuch am 9. November 1835 hatte sich hinsichtlich des Abbaus nichts verändert. Die Jahresförderung summierte sich auch in diesem Jahr auf 320 Fuder Eisenstein. Nur den bereits ein Jahr zuvor gefaßten Plan, den Abbau am dritten Tageschacht mit einem Stollnflügel tiefer anzufahren, nahm man nun in Angriff und hatte dieses Flügelort bereits 20 Lachter fortgestellt. Es soll dort etwa 5 Lachter mehr Teufe als der Wasserlauf einbringen und so „auf eine Anzahl Jahre“ dort die Wasserhaltung erübrigen (40014, Nr. 289, Film 0126f). Obwohl in der Fahrbogenakte ein Vermerk über eine weitere Befahrung in diesem Jahr fehlt, stellte Herr Gebler etwa denselben Inhalt auch in seinem Fahrbogenvortrag in Annaberg am 5. Dezember des Jahres dar, wobei er berichtete, das Flügelort sei inzwischen 22 Lachter erlängt (40169, Nr. 221, Blatt 126c). Auf dem „kleinen Bau“ am Kunstschacht waren jetzt nur noch 2 Mann angelegt. Außerdem hielten die Gewerken in diesem Jahr eine Erhöhung des Steigerlohns für angebracht. Auf deren Antrag hin wurde am 14. Juli 1835 im Bergamt Scheibenberg genehmigt, daß dieser um 4 Groschen auf nun 2 Thaler, 4 Groschen pro Woche angehoben wurde (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 126).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch bei der Befahrung am 7. März 1836 fand
der Geschworene nichts neues hinsichtlich des Abbaus vor
(40014, Nr. 289, Film 0161f).
Die Grube war mit 14 Mann belegt, der Abbau im Tiefsten des Kunstschachtes war
noch immer umgängig und liefere sehr
guten Brauneisenstein. Mit dem Stollnflügel in Richtung des dritten Tageschachts
war man inzwischen 30 Lachter fortgerückt, hatte dessen Vortrieb aber zunächst
wieder eingestellt, „um sich zunächst mit dem nötigen Vorrat Eisenstein zu
versehen und die Kosten zu sichern.“ Ferner war noch zu berichten, man habe auf bergamtliche Anordnung einen Versuch gemacht, auf dem Stollnflügel die bisher gebräuchliche Zimmerung von Türstöcken aus starken, gespaltenen Stämmen durch solche aus schwächeren, runden Stämmen zu ersetzen, zugleich unter Anwendung von Pfählen für den Verzug anstatt der bisher gebrauchten „ganzen Schwarthen“. Der Holzbedarf dieser Grube war ja auch enorm... Herr Gebler befand hierzu jedoch, daß a) die Kosten sich kaum ändern dürften, da man eine größere Zahl der schwächeren Stämme benötige, und b) daß bei dem hier schon mehrfach erwähnten starken Druck diese Art der Zimmerung „nicht sattsam haltbar“ ist. Dies trug er auch am 2. April 1836 in Annaberg vor (40169, Nr. 221, Blatt 127). Nachdem dann bis Anfang Mai 1836 die ersten 130 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen waren, sollte eigentlich auch der Vortrieb des Stollnflügels fortgesetzt werden, doch war jetzt das vörrätige Ausbauholz alle. Herr Gebler fand es am 5. Mai daher „wünschenswerth, das auf das Forstjahr 1836/37 fallende Stammholz bereits jetzt erlangen zu können.“ (40014, Nr. 289, Film 0174f) Nach seinem diesbezüglichen Vortrag in Annaberg meinte man dort aber, man könne das selbst nicht genehmigen, bestenfalls gegenüber der Forstbehörde befürworten (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 128). Ob die Grube solches erhalten hat, steht hier nicht geschrieben, doch war der Stollnflügel bei seiner dritten Befahrung der Grube in diesem Jahr am 5. August 1836 wieder belegt (40014, Nr. 289, Film 0198). Wie eigentlich in jedem Jahr, war Herr Gebler außerdem achtmal zugegen, um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen, dessen Menge sich 1836 auf 300 Fuder summiert hatte. Im folgenden Jahr 1837 hat die Grube insgesamt 360 Fuder Eisenerz gefördert (40014, Nr. 294). Weitere Fahrberichte zum Grubenbetrieb haben wir aber nicht gefunden. Die Fahrbögen des Geschworenen Gebler reichen noch bis zum Quartal Trinitatis 1838. Bis dahin war er noch zweimal auf der Grube, um, wie üblich, jeweils 40 Fuder zu vermessen. Danach muß Herr Gebler aus dem Dienst in Scheibenberg ausgeschieden sein. Am 30. Juni 1838 erfolgte der Fahrbogenvortrag auf der Bergamtssitzung in Annaberg jedenfalls durch einen Obersteiger Schiefer und einen Bergamtsauditor Freiherr von Herder. Dies kann allerdings nur ein Nachfahre des bekannten Berghauptmanns gewesen sein. Sie berichteten zu diesem Zeitpunkt, daß das Stollnort 43 Lachter vom zweiten Tageschacht Stunde 9,4 vorangebracht sei und das noch etwa 100 Lachter bis zum dritten Schacht fehlten. Das Ort stand „in lettigem Brockenfels und eisenschüssigem Glimmerschiefer“ und weil es nach wie vor an Ausbauholz mangele, empfahlen sie erneut „gespaltene Hölzer“ für die Türstöcke zu verwenden (40169, Nr. 221, Blatt 130).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wahrscheinlich schon ab Anfang 1839 war
Theodor Haupt als Geschworener in Scheibenberg tätig. Seine erste Aufgabe
auf dieser Grube war, über einen Bruch in der Kunstradstube
am 21. Mai 1839 zu berichten (40169, Nr. 221, Blatt 132ff),
welcher namentlich für die Tiefbaue am zweiten Tageschacht katastrophale Folgen
hatte. Er schrieb darin:
„Die 15 Lachter- Strecke, als Aufschlagwasser Rösche
dienend, ist von a bis b zu Bruche gegangen, ebenso der kurze Stoß
c d der Radstube und der lange c e. Ob nun bis e zu Bruche
ist, läßt sich zwar nicht sehen, aber aus der Extension des Bruches bis b
folgern, sowie auch aus der Art der Zimmerung der ganzen Radstube. Aus letzterem
Grunde ist es mehr als wahrscheinlich, daß auch der lange Stoß d f der
Radstube zu Bruche gegangen oder wenigstens sogleich vollends zu Bruche gehen
würde, sobald man den alten Mann nebst Holzstücken und Rad heraus schaffen
wollte. Der kurze Stoß c f ist noch in festem Zustande, jedenfalls würde
er aber den übrigen folgen, wenn man den Bruch gewältigte. Diesem allem gemäß
ist die Radstube als ganz zu Bruch gegangen anzunehmen.
Das Rad hat sich, wie g h zeigt, gelegt. Vor allem erscheint es nothwendig, den Aufschlagewassern, welche jetzt in den Schacht hinein auf den Stolln fallen, einen neuen und zwar solchen Weg zu bahnen, daß dieselben dem Bruch nicht zu nahe kommen. Die Zimmerung der Radstube ist, wie fig. (zeigt), wo, wenn ein Glied fehlt, der ganze Körper seine Spannung verliert und zum Bruche führt.“ Scheibenberg, den 25. Mai
1839
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die seinem Bericht beigefügte Skizze zur Lage des Verbruchs (Schnittzeichnung, zubruchgegangene Bereiche mit Schraffur versehen. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40169 (Bergamt Schwarzenberg), Nr. 221, Rückseite Blatt 132.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skizze des Grundrisses der Radstube in Theodor Haupt's Bericht vom 25. Mai 1839. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40169 (Bergamt Schwarzenberg), Nr. 221, Blatt 133.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesen Bericht trug Herr Haupt am
gleichen Tage in Annaberg vor, wo man ihm zunächst dahingehend folgte, daß
unbedingt der Wasserlauf zu sichern sei, um nicht den unweit entfernten zweiten
Tageschacht in Gefahr zu bringen (40169, Nr. 221, Blatt 136).
Ferner legte man auf dieser Sitzung fest, daß die Eigenlehner (hier heißen sie
mal wieder so) befragt werden sollten, ob sie in Anbetracht des Mangels an
Ausbauholz und des nur noch geringen Anteils des hier am zweiten Schacht
gewonnenen Eisensteins am Ausbringen der Grube die Wiederherstellung und
gegebenenfalls Ausmauerung der Radstube in Betracht ziehen wollen. Dies zu
klären, beschloß man, am 13. Juni 1839 eine Generalbefahrung durchzuführen, zu
welcher die Eigentümer der Grube mittels Patent vom 10. Juni 1839 geladen wurden (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 133).
Dieser Ladung ist nebenbei auch zu entnehmen, daß sich sowohl die Familie von
Elterlein, als auch die Familie Nietzsche, denen die Grube zehn
Jahre
Herr Breitfeld hatte also inzwischen auch das Erla'er Hammerwerk von Herrn Nietzsche erworben. Wie wir aus anderen Recherchen schon wissen, waren die Familien Nestler und Breitfeld bereits verschwägert. In der Registratur zu dieser Generalbefahrung heißt es einleitend, man wolle im Ergebnis der Inaugenscheinnahme Entschließung über den ferneren Betrieb bei dieser Grube fassen, aber auch den Grubenhaushalt betreffende Punkte erörtern (40169, Nr. 221, Blatt 137ff). Der folgende Text folgt zunächst der dafür üblichen Gliederung und führt unter Punkt I. die Belehnung und unter II. die Belegung der Grube auf. Dann heißt es unter Punkt: III. Befund bei der Befahrung, man fuhr zunächst über den zweiten Tageschacht bis Stollnsohle an und nahm Radstube und Kunstrad von dort aus in Augenschein, wo man Haupt's Befund vollkommen bestätigte. Der Anordnung vom 25. Mai zufolge war man mit der Gewältigung der 15 Lachter- Strecke befaßt. Dies schnellstmöglich zu bewältigen, hatte man das tiefe Stollnort in Richtung dritter Tageschacht (welches inzwischen 60 Lachter vom zweiten Schacht fortgerückt war, mithin noch etwa 40 Lachter bis zum dritten fehlten) sistiert und dessen Belegung hier eingesetzt. Die Abbaue am dritten Tageschacht standen in Betrieb. Unter Punkt: IV. Oeconomische Verhältnisse, heißt es dann weiter, gegenwärtig würden
und zwar letzteres in natura, sprich: In Form des ausgebrachten Erzes. Seit dem Jahr 1737 habe man hier 35.830 Fuder Erz im Wert von 51.835 Thalern, 10 Groschen gefördert; zwar bestanden keine Grubenschulden, doch ein Rezeß in Höhe von 53.977 Thalern, 23 Groschen und 4 Pfennigen. Letzterer wäre natürlich bei weitem nicht so hoch aufgelaufen, wenn man keinen Verlag erstattet, sondern den Wert des ausgebrachten Erzes mit den Kosten voll verrechnet hätte. Schließlich sind unter Punkt V. Resolutionen, dann die Beschlüsse aufgeführt. Aus nachvollziehbaren Gründen waren die Eigentümer keineswegs gesonnen, den aufwendigen Neubau einer Wasserkunst in Angriff zu nehmen. Dagegen war seitens des Bergamtes nur einzuwenden, daß man dieses Lager noch wenig untersucht und stets verlassen habe, wenn dessen Mächtigkeit und Gehalt nachließen. Auch könnten sich ja die beiden anderen Lager in größerer Teufe auch hier erschließen lassen, wozu dann allerdings die Heranholung tieferer Stolln geeigneter erscheine. Man schlug daher vor, durch ein 25 bis 30 Lachter tiefes Bohrloch die Existenz und Lage der anderen Lager in diesem Bereich zu prüfen, was die Besitzer auch zusagten. Nach dieser Grundsatzentscheidung wurde festgelegt, den Kunstschacht abzuwerfen und zu verfüllen, auch die Querschläge zur Aufschlagwassererschrotung werden abgeworfen, da man hier ja des Wassers nun nicht mehr bedürfe. Anschließend sei das tiefe Stollnort schwunghaft zu betreiben, um am dritten Tageschacht nun einen umfangreicheren Abbau zu etablieren. Die Eigentümer wünschten eine Erhöhung des bisherigen Förderquantums von 80 auf wenigstens 100, besser 150 Fuder Erz pro Quartal, damit dieses im Verhältnis zu den laufenden Kosten günstiger käme, wogegen nichts einzuwenden war. Dann erinnerte man sich noch der
Schlußendlich wurde noch der bisherige, langjährige Schichtmeister Richter auf dessen Wunsch hin von seiner Funktion entbunden und vorläufig durch Handschlag als neuer Schichtmeister Christian Carl Gottlieb Schubert aus Crandorf angenommen. Am 26. Juni 1839 fragte dann noch das Oberbergamt in Freiberg nach, ob man nicht wegen nachlässiger Unterhaltung der Kunstradstube doch noch jemanden zur Verantwortung zu ziehen habe (40169, Nr. 221, Blatt 147), was man aber seitens des Bergamtes in Annaberg am 22. Juli abschlägig beantwortete, indem die Ursache dieses Verbruchs „in örtlichen und zufälligen Umständen“ zu suchen sei und die Grubenvorsteher kein persönliches Verschulden treffe (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 147). Am 27. Juli 1839 schrieb man daraufhin aus Freiberg zurück nach Annaberg, man wolle „es dabei bewenden lassen,“ traf zugleich aber Anordnung, daß „solche gefährlichen Punkte künftighin durch die Geschworenen sorgfältigst überwacht werden“ sollen (40169, Nr. 221, Blatt 149).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab Reminiscere 1840 gibt es wieder eine Akte mit gesammelten Fahrbögen des Geschworenen Theodor Haupt (40014, Nr. 300). In dem ersten darin enthaltenen Fahrbogen auf Reminiscere 1840 berichtete er, er habe am 23. Januar 1840 die Grube Vater Abraham zu Oberscheibe befahren. Dar Stollnort in Richtung des dritten Tageschachtes stand nun bei 77 Lachter vom Kunstschacht aus und hora 9 in Südost und „ganz nah bei dem Eisensteinlager.“ Die alten Probleme waren aber noch dieselben: „Das Stollnort ist jetzt außer Betrieb nicht allein, weil es an Schnittwaren zum Abtreiben fehlt, sondern auch, weil der Zudrang von Waßer davor so außerordentlich stark wurde, daß man bei 3½ Zoll starken Pfählen kein Getriebe mehr anbringen konnte, indem das Waßer das Gebirge aufgelößt hatte und von allen Seiten gewaltsam vorschob.“ Man sei nun gesonnen 2 Lachter zurück vom Stollnort einen kleinen Umbruch zu treiben, um auf diesem die Wasser aufzufangen, das Hauptort so zu trocknen und dann weiterzugehen. Zu diesem Punkt meinte das Bergamt nach dem Fahrbogenvortrag am 25. Januar 1840, wenn der Umbruch zu nahe am Stolln verlaufe, könnte er diesen gefährden, sei er aber weiter entfernt, möglicherweise seinen Zweck verfehlen. Es sei daher angeraten, daß Stollnort selbst unter Anwendung von Vorpfändung wieder in Schlag zu nehmen (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 149). Außerdem war natürlich der Abbau in 15 Lachter Teufe am dritten Tageschacht in Umgang, „die Anbrüche haben sich gebessert“, waren ½ Lachter stark und von meist guter Qualität. Seit kurzem ist noch ein weiterer Betriebspunkt 1¾ Lachter höher in Angriff genommen worden. Hier wurden ungarische Hunte eingesetzt, sonst wurde die Förderung noch durch Karrenlaufen besorgt. Man hoffe in diesem Quartal auf eine Produktion von 100 Fudern (40014, Nr. 300, Film 0011f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr Haupt war schon am 6. Februar 1840 erneut auf dieser Grube und berichtete nun, das Stollnort sei anweisungsgemäß wieder in Angriff genommen worden und man habe zunächst „die zerdrückten Thürstöcke ausgewechselt.“ Am Eisensteinbau hatte sich so schnell natürlich nichts verändert (40014, Nr. 300, Film 0024). Am 24. März 1840 war Herr Haupt wieder vor Ort und hielt in seinem Fahrbogen fest, daß man wegen des „übergroßen Gebirgsdrucks“ erneut das Stollnort verlassen und bei 73 Lachter von der Radstube eine Umfahrung in Richtung hora 10,4 Südost begonnen habe, deren Ort inzwischen 20 Ellen erlängt sei. Dort hatte man aber erneut starke Wasser erschroten. Zumindest aber hatte sich „in der Sohle des Umbruchs festes Gebirge eingefunden,“ darüber lagen „Letten und ganz aufgelößter Glimmerschiefer mit vielen Bruchstücken von Eisenstein, welche mich in der (...) Vermuthung von der Nähe eines Eisensteinlagers bestärken.“ (40014, Nr. 300, Film 0035) Beim Abbau am dritten Tageschacht wurden zur gleichen Zeit insgesamt vier Örter im Firstenbau betrieben, die zwischen 2 und 3¾ Lachter über der Wasserlaufsohle lagen. Bei seiner nächsten Befahrung am 10. April 1840 fand der Geschworene nur „zu bemerken, daß das tiefe Stollnort noch mit 4 Mann umbruchsweise betrieben wird. Der Betrieb geht aber sehr langsam und ist seit letztem Quartal nur 0,3 Lachter vorgerückt. Der Grund davon liegt darin, daß ein ziemlich fester Glimmerschiefer mit Quarz und Spuren von Brauneisenstein (...) sich eingestellt hat, daß ferner der unverändert große Wasserzudrang sowie ungewöhnlich matte Wetter den Betrieb sehr beschwerlich machen.“ (40014, Nr. 300, Film 0045f) Ohne im Fahrbogen festzuhalten, wieviel denn davon, teilt uns Herr Haupt dann in seinem Fahrbogen auf Trinitatis 1840 mit, daß er am 18. Mai hier den Eisenstein vermessen und hiernach die Grube befahren habe (40014, Nr. 300, Film 0050). Der Stollnumbruch war nun 9 Lachter vom Hauptstolln ausgelängt und stand größtenteils in festem Glimmerschiefer, auf der Sohle bereits in Hornstein mit Spuren von Eisenstein. Seine nächste Befahrung führte der Geschworene am 5. Juli 1840 durch und hielt nun im Fahrbogen fest (40014, Nr. 300, Film 0065), daß auf dem Stollnumbruch „die Wasser sich verloren“ haben. Bauwürdiger Eisenstein habe sich aber noch nicht angefunden. Abbau erfolgte unverändert am dritten Tageschacht 2½ bis 4 Lachter über der Wasserlaufsohle oder in 15 Lachter Teufe. In diesem Quartal werden wohl 96 Fuder ausgebracht werden, schätzte er noch ein. Kurz darauf mußte er aber auch „wegen einer daselbst vorgekommenen Verunglückung“ erneut auf Vater Abraham anfahren und am 25. Juni 1840 „nahm ich auf Directorial Anordnung an dem Leichenbegräbnisse eines verunglückten Bergarbeiters in Scheibenberg theil.“ (40014, Nr. 300, Film 0072 und 0073) Auch das gehörte zu den Aufgaben der Geschworenen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner nächsten Befahrung am 17. Juli
1840 fand Herr Haupt das Stolln- Umbruchsort wieder mit 4 Mann belegt und
„nun von dem Hauptstollnflügel 16,3 Lachter und im Ganzen 89½ Lachter von der
Radstube entfernt. 1 Lachter zurück vom Ortstoß hat man ein kleines
Eisensteinmittel durchfahren, das aber an beiden Ulmen sich schon wieder
ausgekeilt hat...“ (40014, Nr. 300, Film 0080f) Außerdem wurden beim dritten
Tageschacht die Eisensteinbaue so betrieben, wie früher, und „ist von ihnen
nur zu bemerken, daß der Eisenstein überall mächtig und meist von sehr guter
Beschaffenheit ansteht.“ Bis zum 11. August 1840 war das Stollnort bis 92 Lachter von der Radstube fortgestellt, allerdings fehlte es für den weiteren Stollnvortrieb wieder mal an „Schnittwaaren und anderem Holzwerk’“ Auch bemängelte Herr Haupt, es fehle ein „Specialriß über diesen Grubenbau“, um ihn vollenden zu können. Sonst lief der Betrieb aber in seiner gewöhnlichen Weise ab (40014, Nr. 300, Film 0093). Am 18. September 1840 ist Herr Haupt noch einmal auf Vater Abraham angefahren, fand dabei im Betrieb keine wesentlichen Änderungen vor, nur hatten sich die Anbrüche im Abbau sehr verringert und nur noch an einem von vier Punkten stehe sehr schöner Eisenstein an (40014, Nr. 300, Film 0111f). Von Luciae 1840 bis Anfang Reminiscere 1841 wurde Herr Haupt in seiner Funktion als Berggeschworener dann von Schichtmeister Schubert aus Raschau vertreten. Von diesem liegen aber keine Fahrberichte zu dieser Grube in der Fahrbogenakte vor. Dagegen fanden wir in der Grubenakte im Sitzungsprotokoll des Bergamtes einen Fahrbogenvortrag von Herrn Schubert vom 24. Oktober 1840, in dem er berichtete, daß das Stollnort nun 88 Lachter vom zweiten Tageschacht entfernt stehe (40169, Nr. 221, Blatt 151).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 29. März des Jahres 1841 war Herr Haupt
wieder als Geschworener in Scheibenberg im Amt und hat in seinem Fahrbogen unter
diesem Datum über Vater Abraham berichtet, daß nur der Abbau am dritten
Schacht belegt sei (40014, Nr. 300, Film 0162).
Vor dem Stollnort waren sehr matte Wetter und Haupt schlug deshalb vor,
einen Durchschlag zur 15 Lachter Strecke herzustellen. Dazu soll bei etwa 65 Lachter vom zweiten Tageschacht ein kurzer Querschlag getrieben und von diesem
dann ein Gesenk geteuft werden. Diesen Plan trug Herr
Haupt am 3. April 1841 auch im Bergamt Annaberg vor (40169, Nr. 221,
Blatt 153). Seitens des Bergamtes sah man hierzu aber eine
Erklärung der Herren und Frauen Gewerken für erforderlich an, da eine
Außerdienststellung der 15 Lachter- Strecke (das frühere Wasserlaufsort) die
Wiedererrichtung eines Kunstgezeugs am zweiten Schacht endgültig unmöglich
machen werde. Eine solche wurde mittels Patent auch eingeholt und die Liste der
Adressaten verrät, daß sich die Eigentümer der Grube wieder etwas verändert
hatten ‒ als solche werden hier nämlich aufgeführt (40169, Nr. 221,
Blatt 157f):
Auf welchem Umweg Frau Stolle zu Kuxen der Grube gekommen ist, haben wir noch nicht herausfinden können. Dieselben erklärten sich jedenfalls am 9. Juni 1841 dahingehend, man wolle die 15 Lachter- Strecke noch so lange unterhalten, bis klar erwiesen sei, daß am dritten Tageschacht auch ausreichend Erzmittel für den ferneren Grubenbetrieb ausgerichtet werden können. Dann könnte man auf eine Wiederinangriffnahme der Tiefbaue am zweiten Schacht verzichten (40169, Nr. 221, Blatt 163ff). Den Plan mit dem Durchschlag hat man indessen in Angriff genommen: Über seine Befahrung der Grube am 18. Mai 1841 heißt es im Fahrbogen, der Querschlag sei 73 Lachter vom zweiten Schacht angehauen und bereits 3,8 Ltr. nach Nordost ausgelängt (40014, Nr. 300, Film 0177). Am 7. Juni fand der Geschworene das Gesenk 4 Lachter von der Wasserlaufsohle entfernt angesetzt und bereits 2 Lachter tief niedergebracht (40014, Nr. 300, Film 0186). Das nächste Mal war Herr Haupt am 12. Juli auf der der Grube und fand hier 16 Mann und den Steiger angelegt. Von der Belegschaft ist der Durchhieb zwischen der Stolln- und der 15 Lachter- Sohle bewirkt worden und das Stollnort solle nun wieder belegt werden (40014, Nr. 300, Film 0197f). Der Abbau am dritten Schacht ging seinen gewohnten Gang, die Anbrüche dort wechselten stark, „vermindern sich an einem, verbessern sich an andern Puncten.“ Noch einmal war Herr Haupt am 3. August 1841 auf der Grube, wo jetzt 15 Mann angelegt waren. Von diesen lagen 4 Mann vor dem Stollnort, welches hora 8,7½ SO. nach dem dritten Tageschacht getrieben wurde. Man stand jetzt bei 21,3 Lachter vom Verumbruchungspunkt und noch 10 Lachter vom dritten Schacht entfernt. Weitere 5 Mann waren beim Abbau am 3. Schacht an drei Punkten eingesetzt. Der unterste Punkt lag 19 Lachter vom Durchschnittsschacht nach Ost entfernt und 1½ Lachter über der 15 Lachter- Sohle. Hier hatten sich neuerdings unangenehm viele Wasser eingestellt. Der zweite Abbaupunkt lag 3¼ Lachter über der 15 Lachter- Sohle und 11 Lachter vom Durchschnittsschacht entfernt, dahinter wurde noch stoßweise Eisenstein abgebaut. Der dritte Bau schließlich lag ungefähr 1 Lachter in Ost vom Hilfsschacht entfernt, war mit einem Förstenbau vergleichbar und derzeit 1½ Lachter hoch und gegen 3 Lachter lang. Hier fand man aber „weniger ein zusammenhängendes gutes Eisensteinlager, als vielmehr größere und kleinere Nester brauchbaren Steins.“ (40014, Nr. 300, Film 0211f) Crucis 1841 wurde Herr Haupt dann „infolge hoher Finanzministerialverfügung und hoher Oberbergamtsanordnung“ wieder abgeordnet. Als sein Vertreter wurde diesmal der Rezeßschreiber Lippmann aus Annaberg bestellt. Von diesem liegen aber keine weiteren Fahrberichte zur Grube Vater Abraham aus dem Jahr 1841 vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang des Jahres 1842 folgte dann der nächste schwere Unglücksfall nach dem Verbruch der Kunstradstube 1839. Am 30. Januar meldet Schichtmeister Schubert dem Bergamt einen plötzlichen Wasserabfall in den Bauen am dritten Schacht und daß das Stollnort daher vermutlich schon nahe vor diesem Schacht stehe. Durch den Wasserabgang sei der Stolln verschlämmt worden, so daß man ihn habe vorläufig sistieren müssen (40169, Nr. 221, Blatt 165). Am 7. Februar mußte Herr Schubert dann auch noch einen Verbruch im dritten Schacht auf 2 Lachter Höhe melden (40169, Nr. 221, Blatt 166). Bereits auf die erste Meldung hin ist der Geschworene Schiefer aus Annaberg am 2. Februar 1842 angefahren und hatte vorerst eine Erhöhung des Tragwerks im Stolln angeordnet (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 166). An diesem Tage fand Steiger Schubert außerdem einen Firstverbruch bei 95 Lachter Länge des Stollns vom zweiten Tageschacht weg vor. Aufgrund der Gefahr für die anfahrende Mannschaft schlug letzterer nun vor, einen vierten Tageschacht etwa 40 Lachter südöstlich vom dritten auf die dortigen Eisensteinbaue abzusenken. Da sich das Lager in dieser Richtung in die Höhe ziehe, würde der nur 8 bis 9 Lachter tief werden. Herr Schiefer trug am 5. Februar 1842 über diesen Plan in Annaberg vor und erhielt die Genehmigung dafür. Diese übermittelte er auch gleich am 9. Februar an den Steiger und legte bei seiner Befahrung zugleich fest, daß der Abbau zugunsten der Säuberung des Stollns und dem Absinken des 4. Tageschachtes vorläufig zu sistieren sei (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 168). Nach Prüfung der Risse wurde am 26. Februar der Ansatzpunkt des neuen Schachtes 34 Lachter vom dritten Stunde 5,3 gegen Ost entfernt festgelegt (40169, Nr. 221, Blatt 170). Nach seiner nächsten Befahrung konnte Herr Schiefer dann am 28. Mai 1842 in Annaberg berichten, daß der vierte Tageschacht nicht nur begonnen, sondern inzwischen bereits 12 Lachter unter der Hängebank in die Abbaue eingeschlagen habe (40169, Nr. 221, Blatt 171ff). Er müsse noch um 1 Lachter bis zur Sohle der dortigen Feldstrecke verteuft werden, jedoch könne nach dem erfolgreichen Abteufen nun auch der Abbau wieder aufgenommen werden. Auch der Stolln war wieder gesäubert, wegen des hier aber „unhaltbaren Gebirgszustandes“ wollte man bei 89 Lachter vom zweiten Schacht aus nun einen Querschlag gegen Süd auffahren. Bevor sich Herr Schiefer das ansehen konnte, mußte aber Steiger Schubert am 23. Mai 1842 melden, daß sich „das noch anstehende Wasser nun förstenweise von selbst unter Zerdrückung der Zimmerung durchgebrochen“ habe... Das Pech nahm kein Ende. Daraufhin wollte man nun wieder das Hauptstollnort angreifen, um es doch noch irgendwie auf den dritten Schacht durchzuschlagen. Am 10. Juni 1842 war Herr Schiefer wieder vor Ort und berichtete darüber am 2. Juli auf der Bergamtssitzung, der vierte Schacht sei nun vollständig niedergebracht und schon beim Aushieb des Füllorts habe man „schönen Eisenstein“ gewinnen können (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 173f). Der dritte Tageschacht hingegen sei nun ganz verbrochen und infolge des Wasserabgangs im Mai der gesamte Ausbau um 5 Lachter abgegangen. Das Wasser hatte sich bis auf 4 bis 5 Lachter Höhe oberhalb der 15 Lachter- Strecke aufgestaut, weswegen man nun die Wasserzugänge auf höherer Sohle aufsuchen und fassen wollte. Da man nun nur noch im Neuglücker Feldesteil baute, wurde außerdem Markscheider Neubert angewiesen, dieses Feld zu vermessen (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 176). Am 24. Mai 1843 sagte Schichtmeister Schubert die 100 Lehne auf 30 Posten im alten Feldteil am 2. Tageschacht los (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 181). Am 24. Mai 1843 mutete der Schichtmeister stattdessen eine neue Fundgrube samt 1. bis 4 oberes Maß (40014, Nr. 298, Blatt 92) und am 22. Juni des Jahres zusätzlich noch die 5. und 6. obere Maß (40014, Nr. 298, Blatt 93). Am 27. Juni 1843 bekam er die gevierte Fundgrube sowie die 1. bis 6. obere Maß auf Johann August Schumann's Grund „am Vater Abrahamer alten Kunstschacht auf dem schon bebauten Lager“ unter dem neuen Namen Vater Abraham gevierte Fundgrube und obere Maßen bestätigt (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 185, Abschrift in 40014, Nr. 298, Blatt 91). Eigentlich hatte die Gewerkschaft dort ja
schon lange
Das Grubenfeld wurde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daß der dritte Schacht zubruchgegangen ist, erfahren
wir ganz nebenbei auch in Zusammenhang mit dem Kalksteinabbau bei Oberscheibe: Den Protokollen über Mutungen und
Verleihungen im Bergamt Scheibenberg zufolge hatte Carl Gottlob Stölzel am 13. Februar 1819 „den
zeither im Freien gelegenen, auf dem Süß'schen Erbguthe zu Oberscheibe
unterhalb des dasigen Kalkofens angeseßnen Stolln“ vor dem Bergamt zu
Scheibenberg gemutet, und zwar „auf Eisensteinflöße, auch andere
Metalle und Mineralien“ (40014, Nr. 211, Film 0137) und erhielt
diesen auch am 26. Mai 1819 bergüblich verliehen, nachdem er offenbar
in der Zwischenzeit ins Freie gefallen war. Über den Stolln selbst heißt
es in der Bestätigung, er sei „Stunde 2,5 gegen Morgen nach dem
vorliegenden Kalklager getrieben, jedoch gänzlich verbrochen.“ (40014,
Nr. 43, Blatt 287)
Bis zum 13. August 1821 wurden 60½ Lachter des Stollnverlaufs gewältigt (40014, Nr. 264, Film 0079f). Danach setzen die Erwähnungen des Stollns in den Berichten des Berggeschworenen aber wieder aus und ab dem Jahr 1822 fehlen Befahrungsnachweise dieses Flößstollns in den Fahrbögen des Geschworenen gänzlich. Der Stollnbetrieb muß also erneut aufgegeben, der gemutete Stolln wahrscheinlich aber noch nicht ins Bergfreie gelassen worden sein. Eine weitere Eintragung im Lehnbuch besagt nämlich, daß Carl Gottlob Stölzel 1827 zum Stolln noch eine gevierte Fundgrube hinzu gemutet habe (40014, Nr.43, Blatt 311b). Demnach wurde am 5. Juli 1827 „dem Muter, Erbrichter Karl Gottlob Stölzel zu Oberscheibe zum Betriebe seines in der Nähe von Scheibenberg an der Crottendörfer Straße sich befindenden Kalkbruche zu dem Mitbetriebe deßelben auf Eisensteinflöße der von diesem Kalkbruche abwärts gegen Abend liegende, schon vor langen Zeiten angelegte und in Stunde 7,4 bis in solchen Kalkbruch getrieben gewesene, aber nach und nach zubruche gegangenen Stolln (...) ingleichen eine gevierte Fundgrube (...) unter dem Namen Stölzels gev. Fdgr. und Flößstolln bestätigt und in Lehn gereicht.“ Eine zu späterer Zeit nachgetragene Anmerkung zur Mutung besagt dann allerdings (40014, Nr.43, Blatt 311b), alles sei wieder: „Losgesagt im Quartal Reminiscere 1829.“ Deshalb findet sich auch in den Erzlieferungsextrakten die Bezeichnung Stölzel's Flößbruch nur noch bis 1828. Der Grundeigentümer, Erbrichter Stölzel zu Oberscheibe, versuchte sich 1842 stattdessen im Eisenerzbergbau nahe der Grube Vater Abraham. Er mutete am 27. Juli dieses Jahres „die zweite bis achte obere Maß auf dem mit der Vater Abrahamer Wasserlaufsohle 21 Ltr. morgendlicher Entfernung vom kürzlich zubruche gegangenen 3. Tageschacht, auf dem die Gewerkschaft von Vater Abraham bereits 1787/1789 die Fundgrube nebst 1 oberen und 2 unteren Maaßen unter dem Namen Neues Glück.“ Der Geschworene Theodor Haupt hat das gemutete Feld besichtigt und dazu noch an das Bergamt mitgeteilt, es solle 30 Lachter östlich vom neuen Vater Abraham’er Tageschacht zu liegen kommen und hora 6 in Ost gestreckt werden (40014, Nr. 298, Blatt 77f). Daraufhin erhielt er sie am 28.9.1842 unter dem Namen Vater Abraham obere Maßen auch verliehen (40014, Nr. 43, Blatt 348b und 40169, Nr. 220, Blatt 1). Irgendwann ,kürzlich' vor dem Sommer 1842 ist der 3. Tageschacht also auch hiernach zubruchgegangen. Wahrscheinlich aber war der Betrieb seines Kalkbruches einträglicher und Herr Stölzel hat auf seinen oberen Maßen nicht wirklich etwas im Hinblick auf die Gewinnung von Eisenerzen unternommen. Vielleicht wollte er sich damit ja nur das Feld zwischen dem Flößstolln und dem Kalkbruch sicherstellen. Die Akte zu den oberen Maßen von Vater Abraham enthält jedenfalls nur noch einen Fristsetzungsantrag des Besitzers vom 18. Januar 1845, der auch genehmigt worden ist (40169, Nr. 220, Blatt 2). Da wir sonst nichts darüber finden konnten, sind diese sieben oberen Maße also spätestens 1847 wieder ins Bergfreie gekommen. Stattdessen hat sich
dann bereits
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Geschworenendienst- Versorger Lippmann ist dann am 13. Juli 1842 erstmals überhaupt auf dieser Grube angefahren. Darüber berichtete er (40014, Nr. 321, Film 0056f), daß zwei Mann den Stolln aufsäubern, damit 85 Lachter von der Radstube aus vorgerückt sind und noch 15 Lachter bis Ortstoß verblieben seien. Nächstdem würden dann die beiden Gegenörter in der 13 Lachter- Sohle fortgetrieben, die nur noch 1¾ Lachter auseinanderstehen und in Kürze durchschlägig gemacht werden. Außerdem schritt noch „die angeordnete Absinkung des kleinen Hilfsabteufens in 5 Lachter östlicher Entfernung vom dritten alten Tageschacht fort“, womit bis jetzt ½ Lachter Teufe erreicht waren. Über die Gewinnung heißt es: „An Abbauen geht dermalen nur der vom alten dritten Tageschacht über der 13 Lachter- Sohle in NO. gelegene Bau um, wo der Eisenstein zwar hübsch mächtig, aber etwas unrein vorkommt, so daß er viel Ausscheiden erfordert.“ Sein nächster Eintrag aus dem Sommer 1842 lautet nur ganz knapp: „Am 25. August 1842 habe ich auf Vater Abraham Fdgr. den Betrieb revidirt.“ (40014, Nr. 321, Film 0070) Vom 15. September 1842 gibt es wieder einen ausführlichen Eintrag in dem Fahrbogen von Herrn Lippmann (40014, Nr. 321, Film 0078f): Es waren 16 Mann inklusive dem Steiger auf Vater Abraham angelegt. Davon lagen 6 Mann auf den Eisensteinbauen, die jetzt sämtlich oberhalb der 12 Lachtersohle lagen. „Der Eisenstein ist auf allen 3 Puncten, die eine Länge von 9 Lachter vom 4ten Tageschacht in W. ausmachen, von guter Beschaffenheit und ½ bis 1 Lachter mächtig. Das Streichen des Lagers ist im Ganzen angesehen hier hora 6, sein Fallen 35° in Nord.“ Außerdem war aber noch zu berichten, daß das Hilfsabteufen am dritten Tageschacht über einen kurzen Querschlag von 2¾ Lachter Länge mit der 15 Lachterstrecke durchschlägig geworden ist. „Hierauf wird man nun bei 1¼ Lachter Teufe des kleinen Wasserschachtes eine zweite Strecke anhauen und in Süd dem Wasser entgegentreiben.“ Dem Eintrag im Sitzungsprotokoll des Bergamtes zufolge trugen hierzu am 1. Oktober 1842 bereits wieder die Geschworenen Haupt aus Scheibenberg und Schiefer aus Annaberg vor (40169, Nr. 221, Blatt 177).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luciae 1842 war Herr Haupt jedenfalls wieder nach Scheibenberg zurückgekehrt und hat gleich am 14. Oktober auch Vater Abraham wieder befahren. Seinem Fahrbericht ist zu entnehmen (40014, Nr. 321, Film 0092), daß weiter der ortweise Abbau am 4. Tageschachte über der 13 Lachtersohle betrieben wurde, wo der Eisenstein 1 Lachter mächtig ist, ein zweiter förstenartiger Bau von jenem 9 Lachter in Abend gelegen, dort das Lager nur ½ Lachter mächtig, aber ebenfalls von sehr guter Qualität war. Der dritte Punkt ist noch der alte, vom 4. Tageschacht 18 Lachter in West gelegene, wo der Eisenstein zwar mächtig, aber sehr gering ist und „nach der Höhe eine Verbesserung nicht erwarten läßt, da man an diesem Punkte wohl nicht mehr viel Gebirge über sich haben kann.“ Der Geschworene empfahl, durch Verbindungsbaue einen 18 Lachter langen Förstenbau aus diesen drei Punkten zu etablieren. Die Wasserstrecke aus dem Gesenk am 3. Tageschacht war inzwischen 2 Lachter nach Süden fortgebracht. Von seiner nächsten Befahrung der Grube am 21. November 1842 berichtete Herr Haupt, der Abbau erfolge wir zuvor, die Wasserstrecke sei nun 5 Lachter ausgelängt und außerdem „hat man einen 3 Lachter langen Umbruch von der Communicationsstrecke bis an die alte 15 Lachterstrecke getrieben, um ein starkes Knie der alten Strecke wegzubringen und mittelbar einen stärkeren Damm zwischen der 15 Lachter Strecke und dem verbrochenen 3ten Tageschachte zu bilden.“ (40014, Nr. 321, Film 0103f) Am 19. Dezember 1842 war Herr Haupt wieder hier und hat „auf Vater Abraham Eisenstein vermessen und hernach die Grube befahren.“ Darüber berichtete er in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 321, Film 0119f), das Streichort hora 5 bis 6 in Ost von den bisherigen Bauen am 4. Schacht war bis jetzt 2,5 Lachter erlängt. Die beiden Überhauen bei 9 und 18 Lachter Entfernung vom 4. Schacht „enthalten sehr hübsche Anbrüche.“ Das Wasserort war nun 6 Lachter in Süd lang und man hat dort in eine alte Strecke durchgeschlagen, die ziemlich viel Wasser hinzugebracht hat. Man wolle die alte Strecke gewältigen, da sich auf dem tiefen Stolln nicht mehr Wasserabnahme bemerkbar gemacht hatte. Darüber berichtete Herr Haupt auch in Annaberg am 31. Dezember des Jahres (40169, Nr. 221, Blatt 178). Ferner kritisierte Herr Haupt aber noch: „Recht dringlich macht sich jetzt ein vollständiger Riß und es ist unbegreiflich, wie die Grubenadministration einer Grube, die Jahrhunderte schon besteht, darin so zurückhaltend verfährt.“ Es geht doch nichts über einen guten Plan... Für das Jahr 1842 erstellte der Schichtmeister Schubert wieder eine Anzeige zum Grubenbetrieb, der zufolge die Belegung in dem abgelaufenen Jahr bei 7 bis 10 Mann gelegen hatte, durch die aufgrund der ganzen Zwischenfälle aber nur 240 Fuder Erz im Wert von 400 Thalern gewonnen worden sind (40169, Nr. 221, Blatt 180ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seine nächste Befahrung führte Herr Haupt am 19. Januar 1843 durch (40014, Nr. 321, Film 0131f). Hinsichtlich der Abbaue war alles wie zuvor, die Gewältigung der Wasserstrecke war auf 14 Lachter fortgerückt. „Eine Wasserzunahme vor diesem Ort hat aber bis jetzt ebenso wenig stattgefunden, wie eine Abnahme vor dem tiefen Stollnort.“ Auch am 14. Februar fand der Geschworene nichts bemerkenswertes, nur die Gewältigung des Wasserortes war um weitere 3 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 321, Film 0142f). Bei seiner Befahrung vom 16. März 1843 hielt Herr Haupt in seinem Fahrbogen fest, daß die Anbrüche am 4. Tageschacht noch geringer geworden, dagegen in den beiden Überhauen gleich geblieben seien (40014, Nr. 321, Film 0156f). Die Wasserstrecke war nun auf 20 Lachter Länge gewältigt und 5 Lachter weiter bereits der Ortstoß zu sehen. Hier kämen aber nur wenige Wasser, daher wurde deren weitere Gewältigung eingestellt. Am erreichten Punkt „hat man ein starkes Rauschen an der westlichen Ulme und will dem... jetzt nachgehen.“ Darüber berichtete Herr Haupt am 1. April des Jahres auch wieder im Bergamt in Annaberg (40169, Nr. 221, Blatt 179). Über den Sommer 1843 vertrat noch einmal Herr Lippmann den Geschworenen. Von ihm liegen in der Fahrbogenakte aus der Zeit bis Luciae 1843 aber keine weiteren Fahrberichte zu Vater Abraham vor. Am 27. Mai 1843 ist jedoch über einen Fahrbogenvortrag durch Lippmann und Schiefer im Sitzungsprotokoll des Bergamtes festgehalten, daß es am vierten Tageschacht gänzlich an Eisenstein mangelte. Man hatte zur Suche nach Anbrüchen auf der 12 Lachter- Sohle einen Querschlag angehauen und einen zweiten auf der 13 Lachter- Sohle, mit beiden aber noch nichts ausgerichtet. Man habe deswegen die Fortstellung der Ortsbetriebe angeordnet. Bei der Befahrung der 15 Lachter- Sohle am dritten Tageschacht befand man, das hier angelegte Wasserort habe noch nichts gebracht. Geschworener Schiefer hatte deswegen vorgeschlagen, den tiefen Stolln wieder anzugreifen, um den Wasserstand dort abzusenken. Dem folgte auch das Bergamt und ordnete hier die Anlage eines Querschlags an (40169, Nr. 221, Blatt 183f). Einen weiteren Fahrbogenvortrag durch Lippmann und Schiefer hat es am 26. August 1843 gegeben, wonach der vierte Tageschacht noch einmal um 3,5 Lachter verteuft und damit bis auf die 15 Lachter- Sohle durchschlägig gemacht wurde. Seine Gesamtteufe betrug damit 16,5 Lachter (zirka 33 m) (40169, Nr. 221, Blatt 186). Als Herr Haupt wieder in seinem Amt in Scheibenberg war, fuhr er gleich am 14. Dezember 1843 wieder hier an und berichtete, man treibe das tiefe Stollnort mit 4 Mann weiter. Parallel ging Abbau an drei Punkten um, zum einen in 13 Lachter Teufe und westlich vom 4. Tageschacht, wo man den Eisenstein ortweise in Nord verfolgte, ein zweiter Punkt in 12 Lachter Tiefe und der dritte, ein Firstenbau, wiederum 1 Lachter höher und in zirka 7 Lachter westlicher Entfernung vom Tageschacht. Der Eisenstein war nur von mittlerer Beschaffenheit, indem er entweder nur als einzelne große Köpfe oder mit Quarz und Glimmerschiefer verunreinigt brach. Außerdem bemerkte der Geschworene noch: „Recht dringend macht sich daher die Unterfahrung der dasigen Lagerformation mit dem tiefen Stollnorte, deßen schwunghaften Betrieb ich deshalb dem Steiger abermals ans Herz gelegt habe.“ Auch für das Jahr 1843 erstellte der Schichtmeister Schubert eine Anzeige zum Grubenbetrieb, der zufolge die Grube in dem abgelaufenen Jahr wieder mit 17 Mann belegt war. Durch diese Mannschaft wurde neben den Hilfsbauen der Abbau zwischen der 10 und 13 Lachter Teufe am 4. Tageschacht auf dem dort hora 7,8 streichenden, 30° nach Südwest fallenden und 0,3 bis 0,9 Lachter mächtigen Lager betrieben. Man hatte eine Lagermasse von zirka 24,5 Kubiklachtern ausgehauen und dabei 320 Fuder Erz im Wert von 533 Thalern, 10 Neugroschen gewonnen (40169, Nr. 221, Blatt 187).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Empfehlung des Geschworenen hat der Steiger auch Folge
geleistet: Bei
seiner Befahrung am 12. Februar 1844 fand Herr Haupt das Stollnort in
Betrieb und 14 Lachter fortgerückt, so
daß man nur noch 3 Lachter vom Saigerpunkt der 15 Lachterstrecke zurückstand. „Obschon
sich nun in neuerer Zeit vor diesem Orte wiederum Wasser eingefunden, ohne daß
an irgend einem anderen Puncte eine Abnahme zu bemerken ist, so hofft man
dennoch, das Ziel, das Eisensteinlager zu unterfahren, dießmal zu erreichen,“
schrieb Herr Haupt in seinem Fahrbogen. Die übrige Mannschaft war wie
zuvor mit der Gewinnung in zwei Bauen westlich vom 4. Tageschacht befaßt. Die
Anbrüche waren aber wieder im Abnehmen (40014, Nr. 322, Film 0010f).
Herr Haupt war noch einmal am 15. März 1844 auf der Grube und befand, daß sich vor dem Stollnort die Wasser und die Gesteinsfestigkeit mehren, sonst aber hatte sich nichts verändert (40014, Nr. 322, Film 0028). Im April dieses Jahres wurde der Berggeschworene schon wieder abgeordnet und ab Mai 1844 vertrat ihn dann diesmal der Markscheider Friedrich Eduard Neubert. Derselbe war aber ‒ zumindest der Akte mit seinen Fahrbögen zufolge ‒ das ganze Jahr 1844 nicht ein einziges Mal auf Vater Abraham. Überhaupt fällt schon in den letzten Jahren auf, daß die Häufigkeit der Befahrungen auf Vater Abraham gegenüber dem Zeitraum, als noch Herr Gebler in Scheibenberg die Funktion des Geschworenen innehatte (bis 1838), drastisch abgenommen hat. Danach gibt es in den Akten mit den Fahrbögen der Geschworenen gar keine Nennungen der Grube mehr. Obwohl diese Aktenüberlieferung erst Reminiscere 1847 endet, fanden scheinbar auf Vater Abraham schon seit 1845 nur noch wenige der früher fast monatlich üblichen Befahrungen durch die Geschworenen mehr statt (40014, Nr. 322). Doch findet man in der Grubenakte noch weitere Auszüge aus den Sitzungsprotokollen des Bergamtes Annaberg, u. a. vom 29. Juli 1844, auf welcher Sitzung Geschworener Schiefer und Markscheider Neubert aus ihren Fahrbögen vorgetragen hatten (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 188). Sie berichteten, daß man jetzt mit dem Querschlag auf der 15 Lachter- Sohle nun nahe des vierten Schachtes doch wieder Eisenstein angetroffen habe, welcher dort in 16 bis 20 Zoll großen ,Putzen' vorkomme. Den Querschlag werde man in der Hoffnung, bessere Erzmittel anzufahren, weiter fortstellen. Der Anzeige des Schichtmeisters Schubert auf das abgelaufene Jahr 1844 kann man dann noch entnehmen, daß man in diesem Jahr mit 17 Mann Belegschaft zwischen der 9 Lachter- und der 15 Lachter- Sohle zirka 22 Kubiklachter Lagermasse ausgehauen hatte und dabei 296 Fuder Eisenstein für die Bezahlung von 493 Thaler, 10 Neugroschen ausgebracht hatte (40169, Nr. 221, Blatt 190).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen weiteren Fahrbogenvortrag gab es in
Annaberg am 22. Februar 1845, wo Schiefer und Neubert berichteten,
man habe den Querschlag auf der 15 Lachter- Sohle nunmehr alles in allem 14
Lachter gegen Südost fortgestellt, dabei auf 2,3 Lachtern Länge „lagerartiges
Gestein“
durchfahren, dann aber 11,7 Lachter nur noch in Glimmerschiefer gefahren und das
Ort daher aufgegeben. Stattdessen hatte man nun einen Querschlag in die
Gegenrichtung angehauen, aber nach 3 Lachtern auch hier das Liegende des Lagers
erreicht. Außerdem hatte man ein Gesenk auf der 15 Lachter- Sohle angelegt. Auf
der Stollnsohle hatte man den Querschlag bei 81 Lachtern vom zweiten Schacht nun
27 Lachter in Stunde 12,2 nach Süden ausgelängt, auch hier aber keine Erzmittel
ausrichten können. Der Steiger wollte auch dieses Ort einstellen, doch
Geschworener Schiefer hat dessen Wiederbelegung angeordnet, was auf der
Sitzung auch die Zustimmung des Bergamts fand (40169, Nr. 221, Blatt 191). Einen Fahrbogenvortrag gab es wieder am 26. Juli 1845, bei dem Schiefer und Neubert vorstellten, daß man auf der Stollnsohle nun bei 83,4 Lachter Länge ab dem zweiten Schacht nun ein Ort Stunde 6,4 gegen Ost getrieben und dort bei 26,3 Lachter Erlängung ein 16 bis 18 Zoll starkes Brauneisenstein- Trum überfahren hatte. Dieses Ort solle nun bis an den vierten Schacht weiter getrieben werden, wofür Schiefer die Stunde vorgegeben und wozu das Bergamt sein Einverständnis erklärte (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 193). Noch einmal trugen die Bergbeamten am 27. September des Jahres 1845 in Annaberg vor, daß man mit dem Querschlagsort auf der Stollnsohle nunmehr bei 27,9 Lachter Erlängung auf das Gesenk auf der 15 Lachter- Sohle durchgeschlagen hatte (40169, Nr. 221, Blatt 195). Auch gab es in diesem Jahr Differenzen mit den Grundeigentümern über die Höhe der Entschädigung für die Flächeninanspruchnahme durch den Haldensturz. Schichtmeister Schubert teilte dem Bergamt am 11. November 1845 mit, daß den Gewerken namentlich die Ausgleichszahlung in Höhe von 5 Waag Eisen, was immerhin 12½ Thalern jährlich entsprach, für die in Anspruch genommene, 107 Quadratruthen umfassende Fläche auf dem Grund von Johann Gotthold Nestler zu hoch erscheine und daß man um eine Lokalexpedition bitte (40169, Nr. 221, Blatt 196). Eine solche wurde auch für den 29. November anberaumt, zu der neben schon genannten Herrn Nestler auch Karl Gotthilf Frenzel geladen war, dem der Boden am dritten, inzwischen ja verbrochenen Tageschacht gehörte (40169, Nr. 221, Blatt 199). In der Zwischenzeit hatte besagter
Nestler am 24. November 1845 an das Bergamt geschrieben und eine ,Kapitalisierung'
angeboten, welche durch eine Abstandszahlung von 300 Thalern für die
Naturalabgabe in Eisen erfolgen sollte. Ansonsten berief er sich jedoch auf den
schon 64 Jahre alten
Dem Protokoll zu dieser Lokalbesichtigung (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 206ff) ist dann zu entnehmen, daß die Haldenfläche am 3. Schacht 36 Quadratruthen umfasse, wofür Herr Frenzel bisher jährlich 2 Thaler Grundzins erhielt. Da man den Schacht nun ja nicht mehr benötigte, einigte man sich für die Einebnung der Halde auf eine einmahlige Zahlung in Höhe von 18 Thalern, wobei Herrn Frenzel aber freigestellt blieb, ob er die Halde tatsächlich einebnen oder auch so belassen wolle. Im Gegenzug verzichtete dieser auf weitere Ansprüche bei späteren Bergschäden. Für den Abfuhrweg vom vierten Schacht (der von nun an oft als ,Neuschacht' bezeichnet wird), der ebenfalls über das Frenzel'sche Grundstück führte, forderte dieser für die zurückliegenden drei Jahre eine nachträgliche Zahlung von 10 Thalern. Schichtmeister Schubert bot hingegen 5 Thaler an. Man einigte sich schließlich auf 8 Thaler. Auf die Höhe der zukünftig jährlich zu entrichtenden Ausgleichszahlung konnte man sich dagegen nicht einigen, so daß dies „unvermittelt“ blieb. Hierzu gab es am 9. August 1847 eine Besichtigung durch den Geschworenen Schiefer, wobei er eine streitige Fläche von 14 Quadratruthen ermittelte. Man einigte sich für die Jahre 1846 und 1847 auf einen jährlichen Zins von 1 Thaler, danach von 15 Groschen jährlich, falls Frenzel die auf Erbrichter Fiedler's Grund gelegenen Haldensturzflächen als Hutweide nutzen könne. Dies nahm man am 14. August 1847 in Annaberg zu Protokoll (40169, Nr. 221, Blatt 218ff). Zu der Offerte des Herrn Nestler konnte sich Schichtmeister Schubert ohne Rücksprache mit den Gewerken natürlich nicht sogleich äußern. Seinem Schreiben vom 24. Dezember 1845 zufolge hatte sich die Gewerkschaft aber damit einverstanden erklärt (40169, Nr. 221, Blatt 210). Bleibt noch aus der Anzeige des Schichtmeisters über den Grubenbetrieb auf das Jahr 1845 anzuführen, daß man in diesem Jahr mit einer Belegung von 18 Mann auf den oberen Sohlen am Neuschacht 12,5 Kubiklachter und auf der 15 Lachter- Sohle weitere 3,5 Kubiklachter Lagermasse ausgehauen hatte, was am Ende einem Ausbringen von 272 Fudern Erz im Wert von 453 Thalern, 10 Neugroschen entsprach (40169, Nr. 221, Blatt 212f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem folgenden Jahr 1846 haben wir auch in
der Grubenakte keine Fahrberichte der Geschworenen finden können. Der Anzeige
des Schichtmeisters auf dieses Jahr zufolge hat man einerseits an verschiedenen
Punkten der 9 Lachter- Sohle am Neuschacht, andererseits zwischen der Stolln-
und der 15 Lachter- Sohle an drei Punkten abgebaut und alles in allem 13,25 Kubiklachter
ausgehauen. Dabei konnte man 304 Fuder Erz im Wert von 506 Thalern,
20 Neugroschen ausbringen (40169, Nr. 221, Blatt 214f).
Einen weiteren Fahrbogenvortrag durch den Geschworenen Schiefer und Markscheider Neubert gab es dann am 1. Mai 1847, wobei sie berichteten, daß auf der 15 Lacher- Sohle nahe am 3. Schacht ein Bruch von rund 10 Lachtern Länge gefallen sei (40169, Nr. 221, Blatt 216f). Die Wasserzugänge an dieser Stelle waren „nicht unerheblich.“ Wegen des aufgelösten Gebirges hatte Schiefer angeordnet, statt der Gewältigung besser einen Umbruch herzustellen, den man 70 Lachter vom 2. Schacht ansetzen und in gerader Linie Stunde 7,5 nach Südost treiben solle, womit sich das Bergamt vollkommen einverstanden erklärte. Noch einmal trug Herr Schiefer am 3. November 1847 im Bergamt Annaberg vor, daß man mit dem Umbruch auf der 15 Lachter- Sohle schon nach 4 Lachter Erlängung in Preßbaue der Alten gekommen sei. Außerdem hatte der Geschworene zu Herstellung eines bequemeren Förderweges zwischen dem Abbau und dem Neuschacht das Auffahren einer Strecke bei 6 bis 7 Lachter Teufe angeordnet, was die bergamtliche Genehmigung fand (40169, Nr. 221, Blatt 221). Die Anzeige des Schichtmeisters schließlich besagt, daß man im Jahr 1847 mit 16 Mann zwei Firstenbaue, einmal über der 9 Lachter- Strecke und einmal oberhalb der Stollnsohle betrieben, außerdem ein neues Versuchsort auf der Stollnsohle bei 44 Lachter Länge vom zweiten Schacht angehauen und 35 Lachter erlängt hatte, dabei aber keine neuen Mittel ausrichten konnte. Das Ausbringen summierte sich auf 288 Fuder Eisenstein für 480 Thaler (40169, Nr. 221, Blatt 222). Für das Jahr 1848 zeigte Schichtmeister Schubert an, daß man mit 17 Mann Belegung die Überhauen oberhalb der Stollnsohle, der 9 Lachter- und der 7 Lachter- Strecke weiter betrieben hatte. Das Ausbringen erreichte erneut eine Menge von 288 Fudern (40169, Nr. 221, Blatt 223). Fahrberichte aus diesem Jahr gibt es auch in der Grubenakte nicht. Den nächsten Fahrbogenvortrag durch Geschworenen Schiefer gab es erst am 31. März 1849, worin dieser berichtete, daß der Umbruch auf der 15 Lachter- Sohle zur Umfahrung des zwei Jahre zuvor entstandenen Bruchs immer noch nicht durchschlägig, wenn auch inzwischen 30 Lachter lang geworden sei. Das Versuchsort in der Stollnsohle bei 44 Lachter Länge vom zweiten schacht hatte man bis auf 41 Lachter ausgelängt, aber einstweilen wieder sistiert. Stattdessen hatte man in der 15 Lachter- Sohle am Neuschacht ein neues Versuchsort gegen Südwest angeschlagen, bislang aber nur unregelmäßige Brauneisensteinbutzen im Glimmerschiefer gefunden (40169, Nr. 221, Blatt 224). Der Anzeige des Schichtmeisters auf dieses Jahr zufolge hatte sich der Abbau im Jahr 1849 auf die Stollnsohle sowie die 7 Lachter- Strecke am Neuschacht begrenzt. Dabei hatte man aber 320 Fuder Erz im Wert von 535 Thalern, 10 Neugroschen ausbringen können (40169, Nr. 221, Blatt 225).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Jahr 1850 gibt es einen Fahrbogenvortrag vom 7. August durch den neuen Geschworenen Friedrich Gotthold Troll (40169, Nr. 221, Blatt 226). Ihm schien das Lager im Niveau der 15 Lachter- Sohle nun auszukeilen, weswegen er ein Querschlagsort 17 Lachter nördlich vom Neuschacht gegen Süd wieder in Angriff nehmen ließ. Es sei aber „der letzte Versuch,“ in dieser Richtung etwas auszurichten. Schichtmeister Schubert vermerkte in seiner jährlichen Anzeige für das Jahr 1850, man hatte wie zuvor mit 16 Mann Belegschaft Überhauenbetrieb auf der Stolln- und der 15 Lachter- Sohle sowie oberhalb der 7 Lachter- Strecke in Umgang gehalten (40169, Nr. 221, Blatt 228). Dabei hatte man erneut 288 Fuder Erz ausgebracht. Am 13. September 1851 erhielt der Schichtmeister namens der Gewerken zum bisherigen Grubenfeld noch die 1. bis 4. untere Maß bestätigt, so daß das Feld nun insgesamt eine gevierte Fundgrube, sechs obere und vier untere Maßen umfaßte (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 229A).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den nächsten Fahrbogenvortrag in Annaberg
hielt bereits wieder ein neuer Geschworener (40169, Nr. 221, Blatt 229B).
Am 8. Mai 1852 berichtete hier Adolph August Friedrich Thiele, daß die
Zimmerung immer aufwendiger werde, zumal nun die Abbaue in die Nähe des
verbrochenen, dritten Schachtes gerückt seien. Die Eisensteinförderung hingegen
sei „verhältnismäßig gering.“ Er forderte daher zu einem schnellen
Aushieb der noch verbliebenen Erzmittel auf, um den Holzaufwand gering zu
halten. Zu Aufsuchung eines „muthmaßlich vorliegenden Brauneisensteinlagers“
hatte man in 18 Lachter Teufe am 2. Tageschacht ein neues Untersuchungsort
Stunde 5,4 gegen Südwest angehauen und inzwischen 12 Lachter ausgelängt.
Zu diesem Versuchsort berichtete Herr Thiele am 7. Dezember 1852, man habe es 40 Lachter weit fortgebracht, stehe damit aber nur in Glimmerschiefer, so daß es eingestellt worden ist. Stattdessen wurde nun ein neues Ort Stunde 7 gegen West angehauen. Über die Abbaue schrieb er, sie seien „arm an Eisenstein.“ (40169, Nr. 221, Blatt 235) Den nächsten Fahrberichtsvortrag in
Annaberg hielt Herr Thiele am 30. Juli 1853 (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 240).
Diesmal ging es wieder darum, daß Steiger und Schichtmeister Schubert „gerissene Stämme“ verbauen ließen,
was der Geschworene untersagte. Vonseiten des Bergamtes protokollierte man noch,
widrigenfalls eine Einschränkung der Holzzuweisungen in Betracht zu ziehen. Da
war doch
Von seiner Befahrung der Grube am 26. August dieses Jahres gibt es wieder einmal einen vergleichsweise ausführlichen Fahrbericht (40169, Nr. 221, Blatt 243ff). Demnach baute man jetzt gerade in 12 Lachter Teufe südöstlich vom 4. Schacht, wo man das Lager in Richtung Nordost verfolgte. Ein Versuchsort 52 Lachter vom 2. Schacht hatte man 15,5 Lachter Stunde 3,4 gegen Südwest ausgelängt, nichts brauchbares angetroffen und es wieder sistiert. Ein weiteres Versuchsort auf der 15 Lachter- Sohle vom 4. Schacht ausgehend gegen Süd und Südost hat zwar nach 6 Lachtern das Lager wieder erreicht, doch habe man es dort „nicht in der gewöhnlichen Mächtigkeit“ vorgefunden, so daß man auch diesen Versuch wieder aufgab. Am 3. September 1853 trug Geschworener Thiele daraus in Annaberg vor, daß man „zu Wiederemporbringung der Grube“ in 10 Lachter Teufe des 4. Schachtes ein Ort in Richtung Nordost treiben und des 15 Lachter- Streckenort wieder belegt werden solle (40169, Nr. 221, Blatt 242). Außerdem gab es 1853 wieder Streit mit Grundbesitzer Nestler ‒ diesmal aber um ausstehende Fuhrlöhne (40169, Nr. 221, Blatt 230ff und 236ff). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Jahr 1854 begann zunächst einmal mit
personellen Veränderungen: Schichtmeister Schubert wandte sich am
17. Januar an das Bergamt mit der Mitteilung, daß Steiger Schubert
aufgrund seines Alters von nunmehr schon 76 Jahren aus dem Dienst ausscheide und erbat für
ihn, wegen seiner Verdienste um das Bergwerk und seiner doch 63jährigen Anfahrzeit, eine angemessene Pension aus der
Knappschaftskasse (40169, Nr. 221, Blatt 245).
Eine Rentenversicherung, wie wir sie heute kennen, gab es ja noch nicht. Am 8. Februar 1854 entschied man daraufhin in Annaberg, daß ihm das ,Knappschaftsalmosen'
in Höhe von 16 Groschen pro Woche gewährt werden solle (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 247).
Das waren also 64 Groschen oder 2 Thaler, 4 Groschen; oder, nach der
Währungsumstellung nach der Reichsgründung, 6 Mark und 40 Pfennige Rente im Monat. Nach 63 Arbeitsjahren...
Zugegebenermaßen ‒ damals kostete auch ein ganzes Brot beim Bäcker noch 3 Groschen. Gehen Sie doch heute mal mit 30 Cent in der Tasche zum Bäcker (also, falls Sie noch einen finden, der noch selber bäckt und nicht nur Teiglinge aufwärmt). Da die Funktion ja wieder besetzt werden mußte, benannte der Schichtmeister am 5. Februar 1854 den Zimmerling Carl Heinrich Krauß aus Oberscheibe als Steigerdienst- Versorger, was man seitens des Bergamtes auch genehmigte (40169, Nr. 221, Blatt 246). Für die Aufsichtsführung erhielt er 6 Neugroschen zusätzlichen Wochenlohn. Am 8. April des Jahres trug erstmals Herr Troll als Berggeschworener in Annaberg aus seinem Fahrbogen vor (40169, Nr. 221, Blatt 249f), wobei seitens des Bergamtes der „neuerlich eingeleitete Betrieb“ den erhofften Beifall fand. Ein Versuchsort auf der 15 Lachter- Sohle gegen Nord vom Neuschacht aus hatte man zwar aufgegeben und wieder versetzt, daraufhin aber ein zweites in südliche Richtung getrieben und dort das Eisensteinlager wieder ausrichten können. Hier wurde jetzt neuer Abbau nach West und Ost etabliert. Auch 4 Lachter tiefer aus dem Durchschnittsschacht zur Stollnsohle heraus wurde ein neues Untersuchungsort getrieben. Am 24. Juni 1854 war Geschworener Thiele auf der Grube, um dem neuen Steigerdienst- Versorger Krauß das Inventar zu übergeben (40169, Nr. 221, Blatt 261ff). Wir zitieren einmal daraus, was zur technischen Ausstattung einer großen Grube, wie Vater Abraham damals gehört hat:
Außerdem war auch noch Ausbauholz vorhanden, unter anderem 18 Stämme, 35 Stammholzspitzen, 124 Schalen und 752 Spundbretter und Schwarten. Ganz anders sah die technische Ausstattung einer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste Fahrbogenvortrag im Bergamt
erfolgte am 7. August 1854 wieder durch den Geschworenen Thiele (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 265f).
Das Feldstreckenort auf der 15 Lachter- Sohle war inzwischen 21 Lachter gegen
Westen erlängt, womit man bei 7 Lachter und bei 10 Lachter kleine Trümer
überfahren und dann bei 20,5 Lachtern Erlängung ein 10 bis 15 Zoll mächtiges
Lager von Mulm und Brauneisenstein angefahren hatte.
Von seiner Grubenbefahrung am 31. Dezember 1854 trug Herr Thiele dann am 13. Januar 1855 in Annaberg vor, daß man westlich vom Neuschacht ein weiteres „Schächtchen“ bis auf die 17 Lachter- Strecke abgesenkt, dort dichten Brauneisenstein getroffen und „das benöthigte Quantum“ gewonnen habe. Am 24. März 1855 wurden Schichtmeister Schubert auf seine Mutung vom 1. Februar hin zum Besten der Grube noch weitere sechs obere Maße, nämlich die 7. bis 12. obere südöstliche Maß, bestätigt (40169, Nr. 221, Rückseite Blatt 268, Abschrift in 40014, Nr. 297, Rückseite Blatt 42). Außerdem beantragte er am 29. März eine Lohnerhöhung für Steigerdienstversorger Krauß, der von nun an 5 Neugroschen mehr und alles in allem 1 Thaler, 20 Neugroschen Wochenlohn erhielt. Auf die Periode 1855 bis 1857 war ein Betriebsplan einzureichen. Weil 1856 das Bergamt Scheibenberg endgültig aufgelöst und als Revierabteilung im wiedererrichteten Bergamt Schwarzenberg fortgeführt wurde, bekam diesen, von Eduard Breitfeld aufgesetzten Plan Geschworener Tröger aus Schneeberg zur Begutachtung (40169, Nr. 222, Blatt 1ff). Für uns ist daraus von Interesse, daß Herr Breitfeld im Mittel von einer Belegung mit 13 Mann ausging, mit denen man aus den 2 bis 4 Lachter mächtigen Lagern pro Quadratlachter Fläche etwa 16 Fuder Eisenstein, pro Quartal etwa 80 Fuder bzw. pro Jahr also 320 Fuder insgesamt, zu gewinnen trachtete. Mehr war es nicht, weil der Eisenstein nur „nesterweise“ einbrach. Der Anzeige über den Grubenbetrieb im Jahr 1855 von Schichtmeister Schubert kann man entnehmen, daß in diesem Jahr mit 10 Mann Belegschaft, und zwar auf der 15 Lachter- und der 17 Lachter- Sohle am Neuschacht, 184 Fuder gewonnen wurden (40169, Nr. 221, Blatt 270). Aus der Anzeige auf das Jahr 1856 erfährt man, daß die Belegschaft wirklich auf 13 Mann angewachsen ist, durch die auf der 12 Lacher- und auf der 17 Lachter- Sohle insgesamt 264 Fuder gewonnen worden sind (40169, Nr. 221, Blatt 273). Außerdem habe man das Stollnmundloch auf 9 Lachter Länge vom Tage herein in Mauerung aus Schlackenziegeln gesetzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schließlich erfolgte am 18. April 1857
auch noch die Umwandlung des Grubenfeldes nach den Maßgaben des Gesetzes über
den Regalbergbau von 1851 (40169, Nr. 221, Blatt 272).
Wir erinnern uns, daß nach der
Am 10. April 1858 wurden Herrn Schubert noch einmal weitere 6.055 Quadratlachter bestätigt, so daß es nun insgesamt 27.785 Quadratlachter oder 28 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 222, Blatt 5f). Eduard Breitfeld hatte zuvor auch noch eine Eduard Fundgrube bei Oberscheibe gemutet. Am 2. Juni 1858 beantragte Schichtmeister Schubert die Konsolidation mit dem südöstlich angrenzenden Grubenfeld (40169, Nr. 222, Blatt 6). Die lehnte das Bergamt Schwarzenberg aber am 7. Juni ab, weil die beiden Gruben unterschiedliche Besitzer hatten: Während die Eduard Fundgrube Herrn Breitfeld allein gehörte, waren an der Vater Abraham Fundgrube ja außerdem noch Herr Nestler und Frau Stolle beteiligt, welche der Zusammenlegung auch zustimmen müßten (40169, Nr. 222, Rückseite Blatt 6). Weil eine solche Zustimmung bis Ende des Jahres nicht vorlag, kam die Sache wieder ad acta. Stattdessen teilte das Gerichtsamt dem Bergamt am 14. Dezember 1858 mit, daß Carl Gotthilf Nestler seinem Schwiegersohn Eduard Wilhelm Breitfeld 32 Kuxe von Vater Abraham abgetreten habe (40169, Nr. 222, Blatt 10). Damit ist der letztere aber noch immer nicht in den Alleinbesitz der Grube gekommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Derweil berichtete Schichtmeister Schubert
in seiner Anzeige auf das Jahr 1857, daß man in diesem Jahr mit 11 Mann Belegung
mit Überhauenbetrieben auf der 12 Lachter- sowie auf der 17 Lachter- und auf der
Stollnsohle 272 Fuder Eisenerz im Wert von 816 Thalern gefördert hat (40169, Nr. 222, Blatt 8).
Wie man leicht errechnen kann, wurde das Fuder also nach wie vor zu einem Wert
von 3 Thalern verrechnet.
Auch die nächste Anzeige des Schichtmeisters über den Grubenbetrieb im Jahr 1858 nennt uns eine Belegung mit 11 Mann sowie Überhauen auf der 15 Lachter- und auf der Stollnsohle als Quelle der Förderung, welche in diesem Jahr mit 264 Fudern etwas gesunken ist (40169, Nr. 222, Blatt 13A). Nicht anders lautete auch die Anzeige auf das Jahr 1859, nur ist die Belegschaft wieder auf 8 Mann gesunken, dagegen die Förderung auf 288 Fuder im Wert von 864 Thalern wieder etwas angestiegen (40169, Nr. 222, Blatt 18f). Reminiscere 1860 ist auch Geschworener Tröger wieder auf der Grube angefahren, worüber er in seinem Fahrbogen berichtete (40169, Nr. 222, Blatt 19), man betreibe das 15 Lachter- Streckenort vom ehemaligen dritten Tageschacht aus in nördliche Richtung als Versuchsbau weiter, außerdem zwei Abbaue, einerseits 2,5 Lachter über dem Stolln und 39 Lachter vom Durchschnittsschacht aus und andererseits 36 Lachter nördlich vom vierten Schacht oberhalb der 15 Lachter- Sohle, wo man bereits 7 Lachter hochgebrochen hatte. Dort stand der Eisenstein „in großen Flözen, die in Mulm und Glimmerschiefer eingeschlossen sind,“ an und Herr Tröger meinte, namentlich „dieser Bau scheint einen bedeutenden Nachhalt zu gewähren.“ Na, schau´n wir mal... Außerdem befand der Geschworene, daß die Förderung günstiger zu stehen käme, wenn man zwischen den zweiten und dem vierten Schacht wieder einen neuen absinken würde. Einen Antrag auf das Absenken eines neuen Schachtes reichte Schichtmeister Schubert denn auch am 20. August 1860 ein (40169, Nr. 222, Blatt 20). Nach seiner Befahrung berichtete Herr Tröger am 25. August 1860, daß man dieses Schachtabteufen bereits begonnen habe (40169, Nr. 222, Blatt 21). Der Anzeige auf 1861 kann man entnehmen, daß dieser neue Schacht den Namen Frenzelschacht erhalten hat. Nach seiner Befahrung am 19. Oktober 1860 hielt Geschworener Tröger in seinem Fahrbogen fest, daß dieser Schacht 65 Lachter südöstlich vom 2. Tageschacht angesetzt und nun 6 Lachter tief abgesunken war (40169, Nr. 222, Rückseite Blatt 33). Zu diesem Zeitpunkt waren noch 9 Bergarbeiter auf der Grube angelegt. In der Anzeige von Schichtmeister Schubert über das Jahr 1860 liest man dann, daß bei dem geschilderten Betrieb durch eine Belegschaft von 9 Mann insgesamt 242 Fuder Eisenstein im Wert von 726 Thalern ausgebracht worden sind (40169, Nr. 222, Blatt 22).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 13. April des nächsten Jahres 1861
erschienen dann vier der Bergleute im Bergamt zu Schwarzenberg, nämlich
um Beschwerde einzulegen, daß ihnen seit Januar nur noch Herr Breitfeld anteilig Lohn gezahlt habe, die anderen Besitzer hingegen nicht (40169, Nr. 222, Blatt 24). Seit Beginn des Quartals Trinitatis 1861 fuhren sie deshalb nicht mehr an, nur Steigerdienstversorger Karl Heinrich Krauß kümmere sich um die Unterhaltung der Grube. Das ging so natürlich nicht und das Bergamt forderte die ihm bekannten Besitzer, nämlich
am 17. April schriftlich auf, die Lohnzahlung „unverweilt“ zu regulieren (40169, Nr. 222, Blatt 25ff). Der erstere verwahrte sich natürlich, er hatte schließlich gezahlt, der zweite wollte „diese Angelegenheit in kürzester Zeit ordnen.“ Wir gehen mal davon aus, daß es wirklich erfolgt ist, sonst hätten die Arbeiter wohl weiter gestreikt. Der Schichtmeister berichtete nämlich in seiner Anzeige auf das Jahr 1861, daß man ‒ allerdings mit nur noch 6 Mann Belegung ‒ dennoch 70 Fuder Erz im Wert von 210 Thalern gefördert habe (40169, Nr. 222, Blatt 30). Von seiner Befahrung am 2. Mai 1861 berichtete dann Herr Tröger, daß der Frenzelschacht nunmehr 9 Lachter Teufe erreicht hatte, dort aber wegen des bedeutenden Wasserzudrangs wieder aufgegeben worden ist, obwohl nur noch 3 Lachter Teufe bis auf die 12 Lachter- Strecke fehlten (40169, Nr. 222, Blatt Rückseite 34). Auch mit einem neuen Versuchsort nach Nordosten habe man „kein günstiges Resultat erlangt.“ Im September 1861 forderte das Bergamt die Besitzer auch zur Vorlage eines neuen Betriebsplanes auf, was jedoch bis 3. März 1862 nicht geschehen ist (40169, Nr. 222, Blatt 31). Stattdessen reichte Schichtmeister Schubert am 9. April 1862 mit der Begründung, es gäbe „keine Aussicht auf Eisensteinabsatz,“ namens des jetzigen Alleinbesitzers Eduard Wilhelm Breitfeld Antrag auf Fristhaltung der Grube ein (40169, Nr. 222, Blatt 32). Die wurde auch am 12. April unter der Auflage, die Grube in fahr- und förderbaren Zustand zu erhalten, genehmigt (40169, Nr. 222, Rückseite Blatt 32). Daher steht in der Anzeige des Schichtmeisters auf das Jahr 1862 auch zu lesen, man hatte nur noch 4 Mann auf der Grube angelegt, die aber alles in allem nur noch 113 Schichten verfahren hätten. Aus einem Überhauen über der Stollnsohle hatten diese noch 15 Fuder Erz im Wert von 45 Thalern gefördert (40169, Nr. 222, Blatt 36). Interessant ist in dieser Anzeige noch, daß Herr Schubert das Förderquantum hier erstmals auch mit 300 Zentnern angegeben hat, woraus man nun errechnen kann, daß ein Fuder Eisenstein bei Vater Abraham zu diesem Zeitpunkt 20 Zentner oder exakt eine metrische Tonne gewogen hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf das Jahr 1863 reichte der Schichtmeister
nur einen ,Vacat- Schein' ein, da ja kein Grubenbetrieb mehr
stattgefunden hat (40169, Nr. 222, Blatt 37).
Am 2. Februar 1864 sagte Herr Breitfeld von dem 1857 bestätigten Grubenfeld zunächst 15.785 Quadratlachter los, so daß vorläufig noch 12.000 Quadratlachter verblieben. Im losgesagten Teil lagen der 1. und der 2. Tageschacht. Die Lossagung wurde im Bergamt am 17. Februar protokolliert und dem Besitzer die Auflage erteilt, die beiden Schächte über dem Stolln zu verbühnen und sie auszustürzen (40169, Nr. 222, Rückseite Blatt 37). Wegen fortbestehenden Mangels an Absatz sagte Herr Breitfeld dann aber am 20. Juni 1864 auch das verbliebene Grubenfeld los (40169, Nr. 222, Blatt 39). Dies war das Ende des aktiven Bergbaus bei Vater Abraham zu Oberscheibe... Was in dieser Zeit hier ausgebracht worden ist, haben wir in nachfolgender Grafik illustriert. Nach den in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 1, 22 und 26) enthaltenen Zahlenangaben kommen wir auf eine Förderung von insgesamt 34.035 Fudern Eisenerz und wenn wir die Angabe aus dem Jahr 1862 zugrundelegen, daß damals das Fuder Erz auf dieser Grube genau eine Tonne gewogen hat, dann waren das auch 34.035 t Eisenerz in der Zeit von 1673 bis 1862.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Nachwehen
bei Vater Abraham bis ins 20. Jahrhundert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der weitere Inhalt der Grubenakten umfaßt
dann den üblichen Schriftverkehr mit der Bergamtskasse, dem Gerichtsamt in
Scheibenberg, den betroffenen Grundeigentümern usw. (40169, Nr. 222, Blatt 39ff).
Als solche sind darin aufgeführt:
Da zu diesem Zeitpunkt niemand Einwände und Bedenken äußerte, wurde das Grubenfeld am 20. Juli 1864 gelöscht und ausgetragen (40169, Nr. 222, Blatt 46). Damit war Herr Breitfeld aber noch nicht aus der Verantwortung... Geschworener Tröger wurde mit einer Schlussbefahrung beauftragt, über die er am 8. Oktober 1864 in Schwarzenberg vortrug, daß die drei Tageschächte bereits ausgestürzt seien, der Stolln aber noch nicht zugesetzt. Dessen Zimmerung sei aber noch in gutem Zustand (40169, Nr. 222, Blatt 47). Für das Jahr 1864 reichte Schichtmeister Schubert noch einmal einen Vacatschein ein, da außer dem Zufüllen der Schächte kein weiterer Betrieb mehr stattgefunden hat (40169, Nr. 222, Blatt 54). Zugleich zeigte er am 31. Dezember 1864 im Bergamt an, daß er den Obersteiger Wagner aus Rittersgrün beauftragt habe, sich bezüglich der Stollnverwahrung mit dem Grundbesitzer Frenzel ins Vernehmen zu setzen. Herr Breitfeld wolle dem Besitzer des Bodens am Stollnmundloch eine einmalige Entschädigung zahlen, der habe sich jedoch noch nicht dazu entschieden. Derweil zeigte der Gemeindevorstand am 24. April 1865 dem Bergamt Senkungen im Bereich der Schächte sowie einen Verbruch in dem oberhalb des Mundlochs liegenden Grundstück des Bauerngutsbesitzers Ullmann an (40169, Nr. 222, Rückseite Blatt 57). Der zur Begutachtung ausgesandte Geschworene Tröger berichtete hierzu am 1. Mai 1865, am ,Fundschacht' (vermutlich dem 2. Tageschacht) habe sich die Füllmasse in der Schachtsäule um 2 Lachter gesetzt, zwischen diesem und dem Neuschacht (dem 4. Tageschacht) gäbe es eine 2 Ellen tiefe Einsenkung und schließlich einen ebenfalls 2 Ellen tiefen Einbruch über dem Stolln im Garten des Herrn Ullmann, über dessen Verfüllung sich letzterer aber bereits mit Herrn Breitfeld dahingehend geeinigt hatte, daß er sie selbst vornehmen wolle (40169, Nr. 222, Blatt 58).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine kurze Episode begann noch einmal am 21. Februar 1865 mit einer neuen Mutung des Grubenfeldes. Am 23. September 1865 wurde dem Steiger Friedrich Gottlob Blechschmidt aus Bermsgrün ein Grubenfeld von 3.527 Quadratlachtern oder 4 Maßeinheiten unter dem alten Namen Vater Abraham Fundgrube bestätigt (40169, Nr. 222, Blatt 55 und 67). Wie üblich, folgte kurz darauf die Aufforderung des Bergamtes an den neuen Besitzer, die verantwortlichen Leiter des Betriebes zu benennen und einen Betriebsplan einzureichen. Der schrieb dann am 1. Dezember 1865 nach Schwarzenberg, Herr Schubert aus Crandorf solle Schichtmeister bleiben und die Steigerfunktion übernehme er selbst. Außerdem zeigte er dem Bergamt die Vergewerkschaftung an, indem er jeweils 32 Kuxe (also je ein Viertel) an
Soweit, so gut ‒ aber in demselben Schreiben beantragte er gleich auch noch, „weil noch keine Aussicht auf eine Verwerthung des Eisensteins“ bestehe, die Fristhaltung der Grube bis Ende 1866 (40169, Nr. 222, Blatt 69f). Seitens des Bergamtes wurden die benannten Gewerken erst einmal für den 18. Dezember 1865 persönlich geladen und am 20. Dezember hierzu protokolliert, daß Herr Wallner den Vorsitz des Grubenvorstands und Herr Henker dessen Stellvertretung übernehme (40169, Nr. 222, Blatt 74ff). Ansonsten aber folgte das Bergamt den Anträgen Blechschmidt's und gab auch dem Fristhaltungsantrag statt. Weil die Grube ohnehin in Fristen gehalten worden ist, reichte der neue und alte Schichtmeister für das Jahr 1865 wieder einen Vacatschein ein (40169, Nr. 222, Blatt 86). Bereits am 27. März des folgenden Jahres 1866 sagte dann aber Herr Wallner als Vorstandsvorsitzender alles wieder los (40169, Nr. 222, Blatt 90).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während die beabsichtigte Wiederaufnahme also platzte, zeigte Herr Tröger dem Bergamt am 3. Mai 1866 an, daß erneut Tagesbrüche auf Herrn Ullmann's Grund entstanden seien (40169, Nr. 222, Blatt 102f), wobei
Ferner teilte Herr Tröger noch mit, er sei mit Herrn Ullmann „unter anhoffender Genehmigung durch das Bergamt“ übereingekommen, daß letzterer gegen eine „Grundentschädigung“ in Höhe von 15 Thalern die Verfüllung selbst übernehme. Dem stimmte man am 5. Mai 1866 in Schwarzenberg zu, vermeldete den ganzen Vorgang sicherheitshalber aber am 19. Mai auch an das Oberbergamt in Freiberg (40169, Nr. 222, Blatt 107ff und 40001, Nr. 3006, Blatt 62f). Darin heißt es gleich noch, daß der letzte Betreiber die Blechschmidt'sche Gewerkschaft gewesen sei, deren gesamtes Vermögen ausschließlich im Besitz des Grubenfeldes bestanden habe, dort folglich nichts zu holen sei. Deshalb gewährte man auch in Freiberg am 13. Juni 1866 die Auszahlung der 15 Thaler an Herrn Ullmann (40169, Nr. 222, Blatt 113). Derweil hatte sich Geschworener Tröger wieder vor Ort ein Bild gemacht und berichtete am 12. Juni 1866 in Schwarzenberg, daß die ersten beiden Brüche bereits wieder völlig zugefüllt seien, der dritte hingegen durch den Grundbesitzer mit einer „Pfostenlutte“ versehen worden sei, um das hier austretende Stollnwasser nutzen zu können. Das funktionierte allerdings nicht gleich und die Auffüllung um die Lutte herum ist erneut um 2½ Ellen abgegangen. Allerdings liefe auch das Stollnwasser jetzt wieder am Mundloch ab ‒ es müsse also selbst durchgebrochen sein (40169, Nr. 222, Blatt 111f). Bei zu seiner nächsten Besichtigung am 7. Oktober 1866 fand Herr Tröger diese Einsenkung bis auf 7 Lachter abgegangen vor. Erneut bot sich Herr Ullmann an, die Auffüllung selbst vorzunehmen. Herr Tröger gab dessen Bitte um die Erstattung von 2 Thalern Aufwand dafür an das Bergamt weiter (40169, Nr. 222, Blatt 116). Das Königlich Sächsische Finanzministerium in Dresden genehmigte denn am 23. März 1867 auch diese Auszahlung aus der Hauptbergkasse (40169, Nr. 222, Blatt 122). Der Berg hatte aber seine Ruhe noch nicht wieder gefunden... Am 15. Mai des nächsten Jahres war Herr Tröger erneut vor Ort und mußte an das Bergamt berichten, daß auch auf Herrn Frenzel's Grund ein neuer Tagebruch entstanden sei. Der lag diesmal 32 Lachter unterhalb des oberen Schachtes (welchen ?) und sei bei einer Ausdehnung von 5 Lachtern in der Länge und 2,5 Lachtern in der Breite 1 Lacher tief (40169, Nr. 222, Blatt 124f). Der Geschworene vermittelte wieder und der Grundeigentümer erklärte sich bereit, gegen eine Aufwandsentschädigung von 8 Thalern den Bruch selbst zu verfüllen, was er bis zu seiner nächsten Anwesenheit am 16. Juni 1867 auch getan hatte (40169, Nr. 222, Blatt 126).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Anfang 1869 das Allgemeine Berggesetz im Königreich Sachsen in Kraft getreten ist, wurden die Bergämter aufgelöst und durch Berginspektionen ersetzt. Für Oberscheibe war die Berginspektion in Zwickau territorial zuständig. Von dort meldete Berginspektor Gustav Netto dann am 15. April 1871, daß schon wieder neue Tagesbrüche im Stollnverlauf entstanden seien (40169, Nr. 222, Blatt 127). Unterhalb des Gutsweges und nur 3 Lachter vor der Haustür des Frenzel'schen Wohnhauses sei der Stolln auf 9 Lachter Länge eingebrochen. Ein bißchen kratzen wir uns an dieser Stelle am Kopf und erinnern uns, daß Schichtmeister Schubert in seiner Anzeige auf 1856 doch eigentlich vermerkt hatte, daß der tagesnahe Stollnabschnitt auf 9 Lachter Länge ausgemauert worden sei ? Herr Netto schlug dem Landesbergamt in Freiberg aber vor, er wolle gegen eine „Beisteuer“ in Höhe von 4 Thalern zur Verfüllung erwirken, daß Frenzel von weiteren Forderungen absehe, wozu er seitens des Landesbergamtes am 27. April auch ermächtigt worden ist (40169, Nr. 222, Blatt 128). Am 14. Juni 1871 berichtete Herr Netto daraufhin aber, daß der Eigentümer nicht bereit war, den Stolln auf den vollen 30 Lachtern Länge unter seinem Grundstück in seine eigene Verantwortung zu übernehmen (40169, Nr. 222, Blatt 129ff). Außerdem erfahren wir aus diesem Schreiben noch, daß schon 1853 dem Müller Arnold die Stollnwasser zur Nutzung verliehen worden sind. Der Berginspektor wollte daraufhin in der trockenen Jahreszeit die Verfüllung der Brüche bergbehördlicherseits veranlassen, was im Oktober 1871 für 6 Thaler Kosten auch durch den Steiger Karl Heinrich Trommler ausgeführt worden ist. Außerdem erfahren wir aus diesem Schreiben noch, daß erst 1853 dem Müller Arnold die Stollnwasser erneut zur Nutzung bestätigt worden sind. Bereits 1758 hatte ein Friedrich Stölzel „das übrige Vater Abrahamer Stolln Waßer“ verliehen bekommen (40014, Nr. 43, Blatt 48ff). Damit war aber noch immer nicht Schluß: Auf eine neue Anzeige durch Friedrich Hunger vom 22. Oktober 1877 hin mußte Herr Netto wieder nach Oberscheibe und erstatte am 13. November darüber Bericht, er habe etwa 150 m südöstlich vom ehemaligen Kunstschacht (also vom 2. Tageschacht ?) eine Einsenkung von 1,0 x 1,5 m Ausdehnung und 0,5 m Tiefe vorgefunden, es sei aber „eine unmittelbare Gefahr nicht vorhanden.“ (40169, Nr. 222, Blatt 133f) An derselben Stelle hatte sich auch zwei Jahre später wieder die Oberfläche gesenkt, worüber Herr Netto aber in seinem diesbezüglichen Fahrjournal am 5. Juni 1879 zu der Einschätzung gelangte, es handele sich nur um „eine Störung der Feldarbeit.“ (40169, Nr. 222, Blatt 139f) Die nächsten Senkungen gab es am 21. April 1880 wieder bei Herrn Frenzel zu verzeichnen (40169, Nr. 222, Blatt 140f). Diesmal wurden dem Besitzer 36,- Mark Entschädigung angeboten, aber der wollte auch jetzt nicht auf ggf. später erneut eintretende Ansprüche aufgrund von Bergschäden verzichten. Danach gab es längere Zeit Ruhe, aber es war noch immer nicht das Ende: Nach seiner Besichtigung am 24. Juni 1891 berichtete Inspektor Stephan aus Zwickau nach Freiberg, es sei wieder ein rund 8 m langer Bruch auf Ullmann's Grund nahe des Stollnmundlochs eingetreten und man könne auf dessen Grund noch Kappen der Türstöcke erkennen (40169, Nr. 222, Blatt 147ff). Diesem Bericht ist folgende Skizze beigefügt, welche uns eine Vorstellung über die Lage des Stollns bezüglich der betroffenen Grundstücke gibt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie man aus diesem Bericht noch erfährt,
handelt es sich bei der Parzelle 27b um das frühere Frenzel'sche
Grundstück, das 1889 Herr Ullmann erworben hatte. Bei ,L' (in der
Skizze links oben) befand sich jener Bruch, den der letztere schon 1866 zu einer
Art Brunnen umgebaut hatte und dessen Wasser er nun zur Bewässerung seiner
unterhalb liegenden Wiese nutzte. Wenn dort ‒ relativ weit oberhalb des Mundlochs
‒ Stollnwasser austrat, konnte das nur heißen, daß das Mundloch inzwischen
gänzlich verbrochen war. Auch Herr Stephan fand es im Gelände schon nicht
mehr und schrieb deshalb, daß es sich „muthmaßlich bei m2“
befunden habe...
Jedenfalls schlug der Berginspektor nun eine Verrohrung des Stollns vor. Einen staatlichen Zuschuß zur Verwahrung des Stollns schloß man in Freiberg am 10. Juli 1891 aber aus (40169, Nr. 222, Blatt 149). Daraufhin passierte wieder einige Zeit nichts, bis Gemeindevorstand Fiedler am 9. Februar 1894 dem Landesbergamt anzeigte, unter dem Bauernweg sei eine Schleuse zubruchgegangen, durch welche das Stollnwasser laufe (40169, Nr. 222, Blatt 150). Der zur Begutachtung dahin entsandte Berginspektor Wappler aus Zwickau berichtete am 20. Februar 1894, es sei nur der Deckel der Schleuse gebrochen. Außerdem schätzte er ein, daß „das reichliche Stollnwasser für die Gemeinde einen großen Werth“ besäße und schon deshalb eine Forderung nach Übernahme von 31,- Mark Kosten für die Instandsetzung abzulehnen sei (40169, Nr. 222, Blatt 151f). Dem folgte auch das Bergamt in seinem Schreiben an Herrn Fiedler vom 16. März 1894 (40169, Nr. 222, Blatt 153). Der letztere gab aber nicht klein bei und wandte sich mit einem neuen Schreiben am 4. April 1894 an den Revierausschuß in Zwickau- Cainsdorf. Dort fühlte man sich erst einmal gar nicht zuständig und verwies zurück an das Landesbergamt. Von dort aber erhielt Herr Fiedler am 10. April die Aussage, auch nach dem Allgemeinen Berggesetz obliege die Reparatur dem Grundbesitzer (40169, Nr. 222, Blatt 155). In der Zwischenzeit hatte sich Herr A. Hartung vom Revierausschuß die Situation vor Ort aber doch einmal angesehen und meinte nun, der Stolln habe schon bestanden, bevor der Dorfweg gebaut worden ist, mithin sei der Erbauer der Überbrückung des Stollnverlaufs auch für deren Instandhaltung zuständig (40169, Nr. 222, Blatt 156). Man nahm zwar den Antrag der Gemeinde für die Sitzung des Revierausschusses am 25. August 1894 auf die Tagungsordnung, lehnte ihn aber schlußendlich doch wieder ab (40169, Nr. 222, Blatt 159f). Noch einmal wurde am 2. Juni 1896 durch Herrn Louis Heß aus Oberscheibe ein Tagesbruch auf dem Flurstück 104 an das Bergamt gemeldet. Inzwischen war Berginspektor Borchers in Zwickau dafür zuständig, der nahe am 4. Tageschacht eine eher „unbedeutende Pinge“ von etwa 1,0 m Durchmesser und 1,7 m Tiefe vorfand. Die könne Herr Heß selbst auffüllen (40169, Nr. 222, Blatt 162f). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während das Tagesbruchgeschehen langsam
abflaute, gab es noch einmal neue Interessenten. Bereits
am 13. April 1875 hatte der Fabrikant
und preußische Kommerzienrat Hermann Gruson aus Buckau bei Magdeburg
durch seinen Bevollmächtigten, Hüttenverwalter Carl Friedrich Fritzsche
in Schwarzenberg, ein Grubenfeld unter dem Namen Himmelfahrt bei Oberscheibe
gemutet (40169, Nr. 150, Blatt 1). Es wurde
bergamtlich am 13. Dezember 1876 verliehen und umfaßte eine Fläche von 393.000
m² oder 99 Maßeinheiten.
Mit ihm trat wieder ein neuer Akteur im Revier auf den Plan. Hermann August Jaques Gruson (*1821, †1895) entstammte einer hugenottischen Familie aus dem nordfranzösischen Fleurbaix, die sich Mitte des 17. Jahrhunderts in Mannheim und später in Magdeburg niederließ (21859). Hermann Gruson hatte 1855 in Buckau bei Magdeburg die ,Maschinen- Fabrik und Schiffsbauwerkstatt H. Gruson', auch ,Eisengießerei & Maschinenfabrik Buckau-Magdeburg‘ genannt (21859, Nr. 025), begründet. An der Mündung der Sülze in die Elbe entstand eine Werft. Wichtiges Standbein seines Unternehmens war aber die angeschlossene Gießerei. Dort verbesserte er die Festigkeit von Gußeisen durch ,Gattieren' (Mischen verschiedener Roheisensorten) so deutlich, daß Hartguß- Produkte aus den Grusonwerken zu einem Markenprodukt wurden und große Bedeutung, besonders für die Entwicklung des Maschinen- und des Eisenbahnbaus in Deutschland, gewannen. 1886 wurde das Grusonwerk in eine Aktiengesellschaft umgewandelt (wikipedia.de). Natürlich benötigt man für die Eisen- und Stahl- Herstellung Eisenerz. Hermann Gruson hat daher 1870 als erste in Sachsen die Grube Mutter Gottes vereinigt Feld samt Gott mit uns und Friedrich Erbstolln in Berggießhübel erworben, die er nach seiner ersten Tochter in Marie Louise Stolln umbenannte und in den nächsten Jahren umfassend modernisierte und erweiterte. Die Ergiebigkeit dieser Lagerstätte blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, so daß der Bergbau dort 1892 wieder eingestellt wurde. Ab 1873 engagierte sich der Besitzer der Grusonwerke dann auch im Westerzgebirge und gründete hier die Schwarzenberg‘er Eisenhütte (40024-1, Nr. 96). Dieses Hüttenwerk befand sich im längst in der Stadt Schwarzenberg aufgegangenen Ortsteil Sachsenfeld, zwischen der Bahnlinie nach Aue und dem Schwarzwasser, südlich der heutigen Bundesstraße B 101.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um sich das für die Hütte benötigte Eisenerz
zu sichern, erwarb Hermann Gruson 1873 zunächst die vier, bis dahin
Zweigler’schen Grubengebäude bei Langenberg:
Wir
werden auch dem Namen Zweigler im Zusammenhang mit den hier genannten
Gruben, wie Hausteins Hoffnung und Riedels Fundgrube in In den folgenden Jahren war H. Gruson direkt (oder indirekt über die Schwarzenberger Hütte) aber auch noch an weiteren Gruben im Westerzgebirge und im Vogtland beteiligt, von denen wir hier ihrer Anzahl wegen nur einige tabellarisch anführen wollen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da sich die Schwarzenberg'er Eisenhütte
allerdings nicht rentierte, wurde sie am 24. Mai 1875 an die
belgische Aktiengesellschaft Société anonymes des mines et usines de Hof- Pilsen-
Schwarzenberg übertragen (40024-1, Nr. 96, Blatt 23).
Auch hier war Hermann Gruson noch wesentlich beteiligt und hielt von den
17.400 zum Wert von je 500 Schweizer Franken ausgegebenen Aktien allein deren
2.120; außerdem war er Mitglied des Verwaltungsrates. Hauptaktionär war jedoch die Bank
zu Brüssel, die fast 7.500 Aktien besaß; der Rest verteilte sich auf 70 weitere
Aktionäre (40024-1, Nr. 96, Rückseite Blatt 92f).
Ab 1882 firmierte die Gesellschaft unter dem deutschen Namen ,Aktiengesellschaft
für Bergbau und Hüttenbetrieb Hof- Pilsen- Schwarzenberg' (40024-1, Nr. 96, Blatt 162). Die
Schwarzenberg'er Hütte bildete eine ihrer Zweigniederlassungen. Die
Grubenfelder, die sich noch in ihrem Besitz befanden, wurden aber nur in Fristen
gehalten.
Offenbar rentierte sich aber keine ihrer Unternehmungen so richtig und so wurde vom Verwaltungsrat der Gesellschaft am 30. Juni 1885 die Liquidation beschlossen (40024-1, Nr. 96, Blatt 162). Die Hütte in Schwarzenberg wurde stillgelegt und das Gelände verkauft. Im Juni 1889 wurde die Hütte abgerissen und der Hochofen gesprengt. Danach wurde auf dem Gelände zunächst durch die Firma M. Förster aus Berlin (auch dies ein Name, der uns im weiteren Text noch wiederbegegnen wird), eine Schamottestein- Fabrik und nach dem Verkauf an Friedrich August Gehlert im Jahr 1894 eine Stanz- und Emaillierfabrik errichtet. Diese Firma führte in ihrem Namen ‚Emaillier- und Stanzwerke Schwarzenberger Hütte E. J. Belger‘ den Ursprung des Standortes noch bis 1945 fort (siehe z. B. 30049, Nr. 6075, 6077 und 6079). Diese Industrieanlagen gibt es jedoch alle nicht mehr und auf dem Gelände befindet sich heute ein Einkaufszentrum. Das Grusonwerk bei Magdeburg wurde dagegen unter dem Namen ,Otto Gruson & Co. Eisen- und Stahlwerk Magdeburg-Buckau‘ von den Erben fortgeführt (30942, Nr. 58). Durch Fusion mit anderen Betrieben kam es zur Aufweitung der Betriebsflächen und es entstand die ,Maschinenfabrik Buckau AG‘. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges zunächst als ,Staatliche Aktiengesellschaft für Maschinenbau „AMO“ und dann unter dem Namen ,VEB Schwermaschinenbau Georgi Dimitroff Magdeburg‘ hatten die ehemaligen Grusonwerke auch noch in der DDR Bestand (magdeburg.de). Nach diesem Exkurs nach Sachsen- Wittenberg und in die (seit 1815) preußische Provinz Sachsen aber wieder zurück nach Oberscheibe: Der erhaltenen Croquis zufolge schloß das Feld der Grube Himmelfahrt zwar das alte Feld von Vater Abraham (um den 2. Tageschacht) aus, jedoch die Halden im Bereich der oberen Schächte ‒ und auch gleich noch den Kalkbruch südwestlich von Scheibenberg ‒ mit ein (40040, Nr. k7642).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Verleihungsurkunde wurde H. Gruson
am 5. Januar 1876 übersandt und der neue Besitzer ‒ wie es nun üblich war ‒ dazu
aufgefordert, die technischen Beamten zu benennen, einen Betriebsplan
einzureichen und seinen Angestellten die Unfallverhütungsvorschriften bekannt zu
machen (40169, Nr. 150, Blatt 2f).
In seinem Antwortschreiben vom 13. Januar bestimmte Herr Gruson seinen
Grubenverwalter Carl Friedrich Fritzsche zum Betriebsleiter und zeigte
zugleich an, daß „wegen der obwaltenden und allem Anscheine nach noch länger
anhalten werdenden Geschäftskrisis“ zurzeit keine Betriebsaufnahme denkbar
sei (40169, Nr. 150, Blatt 4f).
Am 6. Februar 1877 wurde seitens des Bergamtes in Freiberg die
Betriebsaussetzung auf vier Jahre ab der Verleihung (also bis Ende 1880)
genehmigt (40169, Nr. 150, Rückseite Blatt 5).
Am 30. April 1877 benannte Herr Gruson dann Franz Robert Pilz aus Freiberg als neuen Betriebsleiter für alle ihm in Sachsen gehörigen Gruben (u. a. auch für die Grube Glücksrad bei Moschwitz), da Herr Fritzsche nach Hof verzogen ist. Seitens des Bergamtes in Freiberg lehnte man zunächst ab, ihn als ,Bergingenieur' anzuerkennen, da er keinen Abschluß einer Bergakademie vorweisen konnte und legte Herrn Gruson nahe, ihm ein anderes Dienstprädikat zu erteilen. Als ,Bergverwalter' wurde er dann am 30. Mai 1877 anerkannt (40169, Nr. 150, Blatt 7ff). Am 31. März 1878 erhielt Herr Pilz anstelle des Herrn Fritzsche dann auch Vollmacht, den Grubenbesitzer in Sachsen zu vertreten. Wie es auch bei anderen Verleihungen an diesen Besitzer im Schwarzbachtal gewesen ist (dazu weiter unten mehr), kam es auch hier: Wirklich etwas geschehen ist nicht. Stattdessen hat H. Gruson kurz vor Ablauf der Betriebsfrist am 10. Juli 1879 für den stolzen Preis von 168.222,50 Mark das Feld an die Societé anonyme des mines et usines de Hof - Pilsen - Schwarzenberg überlassen, was man am 19. Juli 1879 im Bergamt Freiberg zu Protokoll nahm (40169, Nr. 150, Blatt 11f und 40024, Nr. 10-478). Auch die haben aber nicht wirklich wieder etwas praktisches unternommen. Nur wurde seitens der neuen Besitzer am 16. Februar 1882 Ernst Emil Braune als neuer Vertreter benannt ‒ auch der war zugleich auf der Schwarzenberg'er Hütte tätig ‒ und derselbe beantragte als erste Amtshandlung wieder Betriebsaussetzung, welche auch zunächst bis 1884 gewährt und nochmals bis Crucis 1885 verlängert worden ist (40169, Nr. 150, Blatt 12ff). Im Herbst 1885 wurde das Feld wieder losgesagt. Im Oktober 1885 erfolgte noch eine Befahrung durch den Berginspektor E. Th. Böhme von der regional zuständigen Berginspektion Zwickau, über die er nach Freiberg berichtete, es sei nur „die alte Abraham'er Halde“ zu finden und ein neuer Betrieb nie eingeleitet worden (40169, Nr. 150, Blatt 17). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danach hatte sich Gustav Zschierlich
‒ auch dies ein Name, der uns weiter unten im Text wieder begegnen wird ‒ um
1899 unter anderem bei Oberscheibe Schurffelder verleihen lassen (40024, Als nächster folgte dann die Neue Sächsische Erzbergbau AG mit Sitz in Leipzig. Auch diese Aktiengesellschaft war zu dieser Zeit ebenso im Schwarzbachtal engagiert. Das ihr in Oberscheibe am 1. August 1923 verliehene Grubenfeld schloß nun gleich auch noch die alte Grube St. Andreas am nordwestlichen Gegenhang mit ein. Geschehen ist natürlich nichts ‒ das Feld wurde von 1924 bis 1927 nur in Fristen gehalten und am 4. Oktober 1927 wieder losgesagt (40169, Nr. 219, Übersichtsblatt). Bevor sich möglicherweise doch noch gewinnträchtige, auflässige Grubenfelder wieder Dritte sicherten, die zwar nichts unternahmen, aber auf einen guten Preis beim Verkauf der Bergbaurechte spekulierten, ließ sich der sächsische Staat, vertreten durch das sächsische Finanzministerium, die Gewinnungsrechte auch in diesem Feld am 20. September 1928 selbst übertragen. Da dies in jenen Jahren an vielen solcher Orte geschah, überstieg es selbst die Möglichen des Staates, hier tatsächlich wieder aktiv zu werden. Auch jetzt wurde daher das Feld von 1928 bis 1940 ausschließlich in Fristen gehalten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges schließlich teilte das Technische Büro für Bergbau und Brennstoffindustrie (TBBI) am 17. Oktober 1949 dem Landkreis Annaberg mit, daß das (immer noch in staatlichem Besitz befindliche) Abbaurecht bei Vater Abraham und St. Andreas an die UdSSR übertragen werde und daß es in einem neuen Grubenfeld namens „Mittelfeld“ aufgehe (40169, Nr. 219, Blatt 21f). Das Feld unter dem alten Namen dagegen ist schon am 10. August 1949 erloschen. Es steht hier zwar nicht ausdrücklich drin, aber wir wissen alle, daß nun die Wismut AG bzw. SDAG Wismut überall im Erzgebirge nach Uranerz suchte... Zwischen Scheibenberg und
Schwarzbach hat die Wismut kein Uranerz gefunden. Vielleicht zum Glück ‒ denn um
das „Erz für den Frieden“ zu gewinnen, kannte man damals keine Rücksicht
auf Landschaft und Bewohner... Über die Sanierung einiger der
Hinterlassenschaften des Wismut- Bergbaus zwischen Raschau und Langenberg haben
wir bereits in einem anderen
Damit endet nun aber endgültig auch die Geschichte des Eisenerzbergbaus in Oberscheibe. In den folgenden Kapiteln berichten wir nun über die Gewinnung der Eisen- und Manganerze im Schwarzbachtal zwischen Schwarzbach und Langenberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Eigenlehnerbergbau im 18. und 19.
Jahrhundert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemerkungen
zum Eigenlehner- Bergbau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevor wir mit der Geschichte des Bergbaus
selbst fortfahren, halten wir es für notwendig, einige Bemerkungen zum
Eigenlehner- Bergbau einzufügen, da es schon in vergangenen Zeiten um
diesen Begriff so einige Verwirrung gab. Bleiben wir zunächst beim Wort: Umgangssprachlich werden die (ohnehin auch ähnlich klingenden)
Bezeichnungen ,Eigenlöhner' und ,Eigenlehner' meist völlig
gleichbedeutend verwendet. Auch diverse
Nachschlagewerke stellten diese beiden Begriffe nämlich zumeist gleich. So heißt es
etwa im (damals) Neuesten Berg- und Hütten- Lexikon von C. F. Richter, erschienen 1805:
„Eigenlehner, Eigenlöhner, nennt man denjenigen, welcher entweder allein auf seine eigenen Kosten oder in Gesellschaft anderer, deren Zahl aber nicht über 8 Personen stark seyn darf, ein Gebäude muthet, in Lehn nimmt, selbst bearbeitet, es mit so viel Arbeitern belegt, als erforderlich ist, und die Baukosten entweder von der Grube oder seinem Vermögen bestreitet und den Überschuß in seinen Nutzen verwendet. Der Bergbau, welcher durch Eigenlöhner betrieben wird, ist für die Zukunft nicht von dem anhaltenden Nutzen, wie der der Gewerken, weil die ersteren bloß vor der Hand auf ihren Nutzen sehen und daher die Grube nicht so zweckmäßig bergmännisch bearbeiten als die letzern, auch, wenn kostspielige Baue vorfallen, z. B. Kunstgezeuge anzulegen, die Eigenlehner öfters nicht so leichter Mühe die Baukosten tragen können, als die Gewerken.“ Das nur unwesentlich jüngere Allgemeine Bergwerkslexikon erläuterte 1808 (ohne aber dabei aber den Begriff des ,Eigenlehners' anzuführen) ausführlicher: „Eigenlöhner (Bergwerksverfassung). Wenn jemand, entweder für sich allein oder mit Zuziehung andrer, deren Zahl sich jedoch nicht über 8 belaufen darf, ein Gebäude muthet und in Lehn nimmt, dieses Gebäude mit eigner Hand bearbeietet, die dazu erforderlichen Kosten aus dem Gebäude nimmt, die fehlenden aus eignen Mitteln aufbringt, und den Überschuß allein erhält, oder kurz, sich seinen Lohn selbst giebt, so wird er ein Eigenlöhner genannt... Es versteht sich von selbst, daß die Eigenlöhner allen Gewinn und Verlust von dem Gebäude gemeinschaftlich tragen. Nach dem Maaße ihrer Antheile müssen die Eigenlöhner ihre Beyträge (Zubußen) unter sich reguliren.... Der Eigenlöhner Bergbau ist der älteste. Alle jetzt gewerkschaftlichen Zechen sind ehemals Eigenlöhnerzechen gewesen. Und noch heut zu Tage sind es Eigenlöhner, welche den ersten Grund zu den Berggebäuden legen. Denn wir haben vielleicht kein einziges Beyspiel in neuern Zeiten, eben so wenig als in ältern, daß eine ganz neue Zeche von einer Gewerkschaft aufgenommen worden wäre...“ Auch noch im 1864 erschienenen Bergmännischen Wörterbuch von F. Wenckenbach heißt es nebeneinander: Eigenlöhner, Eigenlehner „1) Personen, welche ihr Bergwerkseigenthum mit eigener Hand betreiben; 2) Theilnehmer an einem solchen Grubenbetriebe, deren Zahl nicht über acht betragen darf und welche gesetzlich keine Gewerkschaft zu bilden brauchen und ihren Bergbau unabhängiger, wesentlich nur nach eigenen Verträgen unter sich betreiben dürfen.“ In Meyers Konversationslexikon (zeno.org, peterhug.ch) wird wieder der zweite Begriff vorangestellt, doch ist die knappe Erklärung fast dieselbe (Band 5, Ausgabe 1906): Eigenlehner (Eigenlöhner), „nach älterm Bergrecht Leute, die einen Bergbau mit eigner Handarbeit betreiben; eine Gesellschaft von Eigenlehnern durfte aus nicht mehr als acht Personen bestehen, von denen mindestens vier die Arbeit mit eigner Hand verrichten mußten.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es gab schon früher vielerlei Diskussionen, welcher dieser beiden Begriffe denn nun der richtige sei. Als Beispiel zitieren wir den Leipziger Universitätsprofessor des deutschen Rechts, Julius Weiske (*1801, †1877), der sich 1839 um die beiden Begriffe folgende Gedanken machte: Eigenlöhner oder Eigenlehner ? „Dieses Wort wird bekanntlich bald auf die eine bald auf die andere Weise geschrieben, und fast scheint es, als ob Eigenlöhner gewöhnlicher wäre. Man sagt, um diese Schreibart zu rechtfertigen: Eigenlöhner seien die, welche sich selbst lohnen und meint damit zugleich den Unterschied zwischen ihnen und den Gewerken, welche durch Bergleute ihre Zeche bauen lassen, anzugeben. Abgesehen davon, daß dieser Gegensatz gar nicht einmal richtig ist, er vielmehr unter den Bergleuten, welche als Eigenlöhner selbst bauen und denen, welche für Gewerken bauen und durch diese gelohnt werden, gesucht werden müßte, ist die Bildung des Wortes auf die gedachte Art höchst willkürlich, und das Verhältnis der Eigenlehner so wenig genau bezeichnend, daß man schon deshalb an seiner Richtigkeit zweifeln muß. Könnte man denn dann nicht z.B. jeden Bauer im Gegensatz zu seinem Knechte einen Eigenlöhner nennen ? Dann ist diese Wortbildung aber auch in sofern willkürlich, als das Selbstlohnen erst die Folge des Selbstbauens ist, so daß man nach der Regel a potiori fit denominatio (lat.: „nach der Hauptsache richtet sich die Benennung“) weit eher ein Wort erwarten sollte, welches dem Selbstbaue seinem Ursprung verdankte. Bei dem fraglichen Streite hat man ganz übersehen, auf die geschichtliche Bildungsweise des Wortes, die hier allein den Ausschlag geben kann, Rücksicht zu nehmen. Indem wir nun an diese erinnern, wird es sich sogleich ergeben, daß die Schreibart: Eigenlehner die allein richtige ist. Das Eigenlehnerverhältnis kommt besonders in den sächsischen Berggesetzen zur Sprache und wir wollen daher auch aus diesen seine Entstehung nachweisen. In der älteren Zeit findet sich das Wort Eigenlehner als ein Hauptwort gar nicht, und eben so wie man früher z.B. statt Beklagter sagte: der, auf den die Klage geht, so sagen auch die Bergordnungen des 16ten Jahrh. statt Eigenlehner: die, welche ihr eigenes Lehen, (oder auch ihre eigene Zeche) bauen. [Sächs. Bergord. v. 1554 a. 101 (C. A. II. p.146.) Schmelzordnung von 1589 (C. A. II. p.227.)] Dann werden die Gewerkschaften den eigenen Lehnschaften öfters entgegengesetzt in der Verord. v. 1621. (C. A. II. p.275) Endlich ist in der Erzvorkaufordnung von 1668 (C. A. II. p.355.) abwechselnd von Eigenlehnern und Eigenlehnschaften im Gegensatze zu Gewerkschaften die Rede. Die richtige Ableitung des Wortes Eigenlehner liegt also wohl, wie sich aus diesen Gesetzesstellen ergiebt, auf der Hand, und es ist daher zu verwundern, daß gleichwohl spätere sächsische Gesetze Eigenlöhner schreiben, und diese Schreibart auch bisher die gewöhnliche geblieben ist. Früher wurden die Eigenlehner z.B. Einspännige genannt. Schließlich bemerken wir noch, daß auch das Wort eigen in Eigenlehner seinen guten Grund hat. Es kamen nämlich in mehreren Bergrechten z.B. in den bayrischen und österreichischen Lehnschaften vor, die darin bestehen, daß besonders einzelne Theile einer Grube Anderen nach einer Art Afterpacht zum Abbau überlassen wurden. Die, welche eine solche Lehnschaft erhielten, bauten nicht ihr eigenes Lehen, sondern das Anderer. Da aber Eigenlehner eben die sind, welche ihr eigenes Lehen bauen, so ergiebt es sich von selbst, daß jenes eigen seinen guten Grund hat, und unsere Eigenlehner von jenen, die fremde Lehen bauen, unterscheidet. Julius Weiske.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Diskussion um diese Begrifflichkeit wurde sicherlich auch durch die Veränderungen in der Berggesetzgebung um die Mitte des 19. Jahrhunderts in den deutschen Staaten (Ablösung des Regalrechts durch die Einführung kapitalistisch orientierter Berggesetze, etwa das Allgemeine Berggesetz für das Königreich Sachsen im Jahr 1868) angefacht, als man sich um eine modernere Fassung des Bergrechts natürlich viele Gedanken machte. Auch nach dem 1. Weltkrieg traten weitere Veränderungen im Bergrecht ein, indem etwa der staatliche Vorbehalt über bestimmte Bodenschätze gesetzlich fixiert wurde (in Sachsen z. B. durch das Gesetz über das staatliche Kohlenbergbaurecht vom 14. Juni 1918). Damit erfolgte endgültig die Trennung zwischen dem Grundbesitz einerseits und dem Verfügungsrecht über die Rohstoffe im Untergrund unter der Oberfläche andererseits. Da wir uns in diesem Beitrag nun gerade (oder zumindest vorrangig) dem Eigenlehner- Bergbau auf Eisen- und Manganerz und damit auch noch einem Bergbau auf noch lange Zeit unter die grundeigenen zählende Rohstoffe widmen, wollen wir an dieser Stelle noch den preußischen Geheimen Oberbergrat C. Voelkel ausführlich zitieren, von dem man doch meinen sollte, daß er weiß, wovon er spricht. Derselbe veröffentlichte 1921 in der Berg- und Hüttenmännischen Zeitschrift Glück Auf einen langen Artikel, der sich eigentlich juristischen Problemen der Ableitung des Bergwerkseigentums aus dem Grundeigentum widmet; worin aber gerade der Herleitung des ,Eigenlehners' aus dem feudalistischen Lehnsrecht widersprochen wird: Lassen wir ihn also zu Wort kommen: Bergwerkseigentum oder Lehen ? „(...) Es ist bereits sehr viel über das Bergregal, aber noch verhältnismäßig wenig über das daraus abgeleitete Recht zum Bergwerksbetriebe geschrieben worden. Im folgenden soll als Beitrag zur Abhilfe dieses Mangels eine kurze Übersicht über die Entwicklung gegeben werden. Ein tieferes Eingehen auf die Quellen würde den Rahmen dieser Zeitschrift überschreiten. Da das Recht zum Bergwerksbetriebe sich auch aus dem Grundeigentum herleiten kann und nach einer früher weit verbreiteten Ansicht in ältester Zeit immer daraus hergeleitet hat, so ist auch der sogenannte Grundeigentümerbergbau in den Kreis der Betrachtungen einzubeziehen. Das Recht zum Bergwerksbetriebe ist, soweit Mineralien dem Verfügungsrechte des Grundeigentümers unterliegen, im Grundeigentum, soweit ein Bergregal des ursprünglichen, unbeschränkten Inhalts bestand, im Bergregal enthalten. Eine erhöhte rechtswissenschaftliche Bedeutung erlangt es erst, wenn es aus dem Rechte des Grundeigentümers oder Regalherrn losgelöst und einem ändern übertragen werden soll. Will der Grundeigentümer das Abbaurecht einem ändern überlassen, so ist die dafür gegebene Rechtsform der Pachtvertrag, der dem ändern das Recht gibt, die Mineralien gegen Entgelt zu gewinnen. Die Auffassung, daß es sich hierbei nicht um eine Pacht, sondern um den Verkauf zukünftiger Sachen — der abzubauenden Mineralien — handle, ist nicht haltbar und vom Reichsgericht mit Recht verworfen worden. Als ein Pachtverhältnis hat man es sich also vorzustellen, wenn z. B. im Bereiche des Sachsenspiegels, wo gewisse Silberablagerungen dem Rechte des Grundeigentümers unterlagen (Buch 1 Art. 35 § 2), ein solcher Grundeigentümer jemandem die Erlaubnis zum »Brechen« des Silbers erteilte, oder wenn da, wo das Löwenberger Goldrecht galt, ein Landwirt einem Bergmann das Suchen nach Gold unter seinem Acker gestattete, oder wenn im Wurmrevier, als dort die Steinkohlen noch nicht als regale Mineralien anerkannt waren, ein Grundeigentümer die Steinkohlen auf seinem Grundstück einen ändern abbauen ließ. Nicht anders sind aber auch die Abbauverträge geartet, die heutzutage ein Grundeigentümer in Hannover mit einem Kaliunternehmer oder ein Grundeigentümer im sogenannten Mandatsgebiet mit einem Kohlenunternehmer abschließt. Die schuldrechtliche Form der Pacht genügt aber nicht immer dem wirtschaftlichen Bedürfnis, das unter Umständen eine festere Gestaltung, eine Verdinglichung des Rechtes des Unternehmers erfordert. Für eine solche Verdinglichung sind die tatsächlichen Voraussetzungen gegeben, da das Unternehmen immer an eine bestimmte Örtlichkeit gebunden ist. Indessen passen die dinglichen Grundformen des bürgerlichen Rechts (Nießbrauch, Grunddienstbarkeit usw.) regelmäßig nicht auf den vorliegenden Fall. Über die Bildung einer besondern Rechtsform für den Grundeigentümerbergbau ist aus der altern Zeit nichts Näheres bekannt. Später behalf man sich im Gebiete des gemeinen Rechts mit der sogenannten irregulären Personalservitut (= persönliche Dienstbarkeit), im Gebiete des Allgemeinen Landrechts mit der von diesem gebotenen Möglichkeit, jedes schuldrechtliche Verhältnis, das eine Beziehung zu einem Grundstück hatte, durch Eintragung in das Grundbuch mit gewissen dinglichen Wirkungen auszustatten. Eine Grundlage für den bergbaulichen Realkredit boten freilich solche Berechtigungen nicht. Eine solche Grundlage ist für den Grundeigentümerbergbau erst durch die neuzeitliche Berggesetzgebung in Gestalt der »selbständigen Kohlenabbaugerechtigkeiten« innerhalb des Mandatsgebietes und der »selbständigen Salzabbaugerechtigkeiten« innerhalb der Provinz Hannover geschaffen worden. Der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt, daß unter demselben rechtlichen Gesichtspunkt der Fall steht, daß ein Bergwerkseigentümer die Ausübung seines Rechts einem ändern gegen Entgelt überläßt. Das ist regelmäßig Verpachtung des Bergwerks. Auch für diesen Fall, allerdings nur für eine besondere Abart, nämlich die Überlassung der seit der Berggesetznovelle vom 18. Juni 1907 dem Staate verliehenen Salz- und Solquellenbergwerke an Private, ist durch diese Novelle eine besondere — allerdings ungenutzt gebliebene — dingliche Rechtsform geschaffen worden, das in wesentlichen Beziehungen dem Bergwerkseigentum gleichgestellte vererbliche und veräußerliche Gewinnungsrecht nach § 38 c des Allgemeinen Berggesetzes. Es unterscheidet sich von den selbständigen Abbaugerechtigkeiten im Bereiche des Grundeigentümerbergbaues vorzugsweise dadurch, daß es einerseits zeitlich beschränkt sein kann, anderseits aber nicht nur als Grundlage des hypothekarischen Kredits, sondern auch als Grundlage der Gewerkschaftsbildung geeignet ist. Nach dieser kurzen Abschweifung sind noch die bergbaulichen Verhältnisse solcher Ländereien ins Auge zu fassen, die nicht im Eigentum eines einzelnen stehen, sondern der gemeinsamen Nutzung einer großen Gemeinschaft unterliegen, ein Fall, der im frühesten Mittelalter, als der Grundbesitz noch nicht restlos in »Hufen« aufgeteilt war und weite Landstriche als »gemeine Mark« oder »Almende« allen Markgenossen offenstanden, eine erhebliche praktische Bedeutung hatte. Für den, der annimmt, daß das Bergregal in Deutschland von Anfang an bestanden habe, bietet dieser Fall kein besonderes bergrechtliches Interesse. Dagegen ist er für die Anhänger der entgegengesetzten Meinung, die ein ursprüngliches Recht des Grundeigentümers an allen Mineralien annehmen, der Ausgangspunkt für ihre Hypothese über die Entstehung der Bergbaufreiheit. »Wie in der gemeinen Mark«, sagt Achenbach, »anfänglich sogar ein Recht zur Aneignung von Grund und Boden durch Abmarkung (comprehensio, captura usw.) von den Genossen ausgeübt wurde, wie zu den gemeinen Nutzungen unzweifelhaft die Steingewinnung gehörte, so berechtigt alles zu der Annahme, daß die Gewinnung der Fossilien jeder Art ebenfalls eine Befugnis der Genossen war. Das Auffinden von Minerallagerstätten und die durch mehrere versuchte Ausbeutung derselben führte ganz von selbst zur Entstehung von Normen über die Frage, innerhalb welcher Grenzen der einzelne Unternehmer zur Gewinnung des Minerals allein befugt sein sollte«. Mag nun diese Hypothese Achenbachs über die Entstehung der Bergbaufreiheit in Deutschland richtig sein oder nicht, jedenfalls ist es ein starkes Mißverständnis, wenn daraus in dem oben erwähnten Artikel der Deutschen Bergwerkszeitung der Schluß gezogen wird, daß der älteste Bergbau kommunistisch betrieben worden sei, etwa ebenso wie das Weiden der Schafe auf der gemeinschaftlichen Feldflur. Achenbach betont ja gerade besonders, daß die Natur des Bergbaus von vornherein zur Ausscheidung bestimmter Bergwerksfelder für den einzelnen Bergbaulustigen geführt habe, und zwar mit vollem Recht, denn an einer und derselben Stelle können vielleicht mehrere ihre Schafe weiden, aber nicht gleichzeitig Bergbau treiben. Diesen selbstverständlichen Gedanken drückt auch das Landbuch des Schweizer Kantons Uri (Art. 275) mit den Worten aus: »Jeder Landmann ist befugt, auf Allmend Erz zu graben, und wenn einer an einer Stelle anfangt und Werkzeug liegen läßt, so soll ein Jahr lang niemand anders daselbst arbeiten mögen«. Die Besitzergreifung von Bergwerksfeldern in der gemeinen Mark schuf der Natur der Sache nach kein Pachtverhältnis, sondern eine dingliche Berechtigung. Diese Betrachtung der Entstehung von Abbaurechten aus dem Grundeigentum heraus bietet auch gewisse Anhaltspunkte für die Prüfung der Frage, welche Rechtsformen die Übertragung von Bergbaurechten durch die Bergregalherren angenommen hat. Auch hierfür findet man in Urkunden aus dem 13. Jahrhundert gelegentlich die Bezeichnung locatio (lat.: Vermietung, Verpachtung). Indessen war das Streben des eigentlichen Bergmannes nach möglichster Verselbständigung seines Rechtes wohl noch stärker. Dazu kam, daß das Verhältnis des Regalherrn zu den regalen Mineralien nicht so eng war, wie das des Grundeigentümers zu Teilen seines Grund und Bodens. Dies gilt im besondern für die spätere Zeit, wo das Regalrecht dem Regalherrn nicht mehr ohne weiteres die Befugnis gab, in jedem Teile des Regalgebietes jederzeit nach Belieben mit dem Abbau der regalen Mineralien zu beginnen, diese Verwirklichung des Regalrechts vielmehr einen besondern Hoheitsakt des Regalherrn, die sogenannte Feldesreservation, voraussetzte. (...) Nach alledem ist es leicht begreiflich, daß das aus dem Bergregal entstandene Bergbaurecht schon in sehr früher Zeit einen dinglichen Charakter annahm. Volle Selbständigkeit erhielt der Bergbautreibende, wenn ihm der Regalherr das Regalrecht selbst für ein bestimmtes Gebiet und für gewisse Mineralien übertrug. Das war zulässig, ist aber nur in seltenen Fällen vorgekommen. Regelmäßig wollte der Regalherr nicht sein Regalrecht zugunsten eines ändern aufgeben, sondern auf dem Boden des Regalrechts eine besondere Berechtigung entstehen lassen. Da das älteste deutsche Recht bekanntlich zwischen den verschiedenen Möglichkeiten einer dinglichen Berechtigung nicht scharf unterschied, so kann es nicht auffallen, wenn die Goslarer Gewohnheiten von einem »Eigen« an Bergwerken, die Kuttenberger Bergordnung von einer »proprietas« (lat.: Eigentum) sprechen. Mit der Entwicklung des juristischen Unterscheidungsvermögens unter dem Einfluß des römischen Rechts stellte sich aber die Erkenntnis ein, daß das Bergbaurecht doch etwas anderes ist als das gewöhnliche Eigentum. Die Juristen dachten an die Anwendung der Regeln über den Erbzinsvertrag, die Emphyteuse, den Lehnvertrag. In den Bergordnungen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts führt das Bergbaurecht fast durchgängig die Bezeichnung »Lehn« oder »Lehen«. Es entstand durch »Verleihung« (Leihung, Beleihung, Belehnung, Verlehnung) vonseiten des Regalherrn oder des von ihm dafür bestellten Beamten. Der Muter nahm das Bergwerk oder die Zeche »ins L e h n «. Mehrere Muter wurden durch einen »Lehnsträger« vertreten. Diese Annäherung an das Lehnrecht war aber rein äußerlich und beschränkte sich im wesentlichen auf die Übernahme einiger geläufiger Ausdrücke aus der Lehnrechtssprache. Nicht unerwähnt bleiben darf übrigens auch, daß, wenn in den Bergordnungen von einem »L e h n « die Rede ist, darunter sehr häufig nicht das Lehen im Sinne der Lehnrechtssprache, sondern etwas ganz anderes zu verstehen ist. »Lehn« (Laue, laneus) war nämlich auch die Bezeichnung für ein bestimmtes Einheitsmaß, regelmäßig von 7 Lachtern oder 7 Geviertlachtern, und als solche gleichbedeutend mit »Grubenfeld«. Abarten des Lehns in diesem Sinne sind das »Hauptlehn«, das »Herrenlehn«, das »Beilehn«, das »Haldenlehn« usw. Um die Vaterschaft des Bergwerkslehns streiten sich also das feudum (Lehen, lateinisch: beneficium; seit dem 9. Jahrhundert feudum von fehu: das Gut) hieß das Nutzungsrecht an einem Gut und der laneus. In manchen Zusammensetzungen ist die Abstammung zweifelhaft, z. B. beim »Eigenlehn«, dem »Bergwerk des Eigenlehners«, der nicht im fremden Bergwerk gegen Lohn, sondern im eigenen Felde selbst Bergarbeit verrichtet, der sich übrigens, zur Anregung sprachgeschichtlicher Studien, ebensooft »Eigenlöhner« schreibt, da er sich sozusagen selbst Lohn zahlt. Sachliche Einwirkungen hat das Lehnrecht, wie eine Vergleichung der Bestimmungen der Bergordnungen mit denen der libri feudorum (eine langobardische Lehnsrechtsammlung aus dem 13. Jhdt.) deutlich zeigt, überhaupt nicht gehabt. Nur wurde in der Rechtswissenschaft vielfach die von den Glossatoren an der Superfizies und Emphyteuse entwickelte, später auch auf das Lehnrecht übertragene Lehre vom »geteilten Eigentum« auch auf das Bergwerksrecht angewendet, indem man dem Regalherrn das Obereigentum (dominium directum), dem Bergbautreiber das nutzbare Eigentum (dominium utile) an dem Bergwerk zuschrieb. Dieser Rückblick kann nicht die Neigung erwecken, das »Bergwerkslehen« wiedererstehen zu lassen. Findet man an dem Namen Geschmack, so muß an ihn mindestens zunächst mit einem klaren und bestimmten Inhalt anfüllen. Das »Obereigentum« ist längst als ein unbrauchbarer, einem Irrtum der Glossatoren entsprungener Begriff erkannt. Brauchbar könnte er höchstens für unsere Feinde zur leichtern Durchführung ihres Vernichtungswillens werden. Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts räumt das Lehen dem Bergwerkseigentum das Feld. Diese Namensänderung, die sich namentlich auch im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten findet, bedeutet aber keine Änderung des Inhalts des Bergbaurechts. Auch das Bergwerkseigentum ist lediglich das dingliche ausschließliche Recht zur Aufsuchung und Gewinnung bestimmter Mineralien innerhalb bestimmter örtlicher Grenzen. Der Bergwerkseigentümer ist nicht Eigentümer der verliehenen Mineralien vor ihrer Gewinnung. V o r ihrer Loslösung aus dem Erdinnern sind diese überhaupt nicht fähig, Gegenstand des zivilrechtlichen Eigentumsbegriffs zu sein. In der Bergrechtswissenschaft hat sich diese alleinrichtige Auffassung allerdings erst in neuester Zeit durchgesetzt. Als zu einem bergrechtlichen Funde noch die Aufschließung der Lagerstätte in einem großem Umfange gehörte und es sprachüblich war, die Verleihung »auf einen Gang« zu erteilen, lag die Versuchung nahe, das Bergwerkseigentum einem zivilrechtlichen Eigentum an dem zum Teil erschlossenen Gange gleichzusetzen, obgleich schon die Ausdehnung des Gewinnungsrechts über die Lagerstätte hinaus auf die sogenannte Vierung dieser Auffassung entgegenstand. Nachdem sie überwunden war, stritten sich die Juristen darüber, ob die verliehenen Mineralien vor ihrer Gewinnung pars fundi (lat.: Teil des Grundes) oder res nullius (lat.: herrenlose Sache, inbesitznehmbare Dinge) wären oder im Eigentum des Staates ständen, eine Streitfrage, die zu keinem Ziele kam und kommen konnte, weil, wie schon gesagt, der zivilrechtliche Eigentumsbegriff überhaupt unanwendbar ist, solange sich die Mineralien noch im Erdinnern befinden. Um diese unfruchtbaren Doktorfragen abzuschneiden, ersetzte das Sächsische Berggesetz (das von 1868) die Bezeichnung »Bergwerkseigentum« durch »Bergbaurecht«...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nun haben wir zwar verschiedene Meinungen und viel Interessantes dazu gehört, doch kratzt man sich nur noch mehr am Kopf und fragt sich: Wie heißt es denn nun richtig ? Vielleicht kommt Herr
Voelkel der tatsächlichen Sprachgeschichte ja damit am nächsten, wenn er auf
eine mögliche Ableitung des Begriffs aus dem
Den Begriff des ,Eigenlöhners' muß man dagegen wohl gänzlich in den Bereich der Legende verweisen, auch wenn er immer wieder, selbst in Fachpublikationen, vielfach kolportiert wird. Bei konsequenter Deutung des Begriffs würde er nämlich bedeuten, daß der Bergmann sich selbst seinen Lohn zahlt. Eine Lohnzahlung erfolgt aber vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. Der Bergmann ist als Eigenlehner jedoch beides in einer Person ‒ wir würden ihn heute als ,Selbständigen' bezeichnen. Einen Lohn gibt es also nicht. Er finanziert seinen Lebensunterhalt aus dem Gewinn, sofern er denn welchen abwirft, des von ihm betrieben Bergbaus. Der Begriff ,Eigenlöhner' ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nur eine Verballhornung des Wortes Eigenlehner. Interessanterweise lesen wir auch im Schriftverkehr der Bergbehörden ‒ regional allerdings durchaus verschieden ‒ häufiger die Schreibweise ,Eigenlehner', während diese selbst sowie außenstehende Dritte das Pendant mit dem ,ö' vorziehen... Der Begriff des ,Eigenlehners' scheint uns gegenüber dem des ,Eigenlöhners' deshalb ziemlich gewiß der dem Ursprunge nach zutreffendere zu sein, auch, wenn wir dessen tatsächliche Herkunft hier nicht wirklich erklären können. Es steht aber jedem Leser frei, sich dazu weitere Quellen aus der alten Literatur zum Thema zu suchen. Außerdem nuschelt ,dor Saggse'
sowieso, er nimmt es mit Endungen und Aussprache nicht so ganz genau und
überhaupt: ,Die sächsische Sprache' gibt es gar nicht. Beim Lesen eines
Fachbuchs habe ich mal erstaunt festgestellt, daß meine Muttersprache eigentlich ,Nordwest-
Osterländisch' ist und selbst im Arzgebirg ,hot fei jedes Tal ä bissel ne
annere Schbroch'. Abgesehen von der Lautsprache kann die verschiedene
Schreibweise des Wortes aber auch noch ganz andere Gründe haben: Die
hiesige Territorialherrschaft, die Schönburger, hatten nicht nur umfangreiche
Besitzungen in Böhmen inne, auch ihre Stammsitze in Glauchau und Lichtenstein
hatten sie dem böhmischen König als Lehen angetragen und dadurch für lange Zeit
vor dem Zugriff der Wettiner bewahren können. Die tschechische Sprache kennt nun
gar keine Umlaute. Hier am Emmler befinden wir uns bekanntlich bis zur
Säkularisierung im 16. Jahrhundert außerdem auf Klosterland. Die Mönche in
Grünhain schrieben Latein und auch die lateinische Sprache kennt keine Umlaute.
Wollte man einen Umlaut lateinisch schreiben, setzte man dem Vokal ein ,e'
nach. Das ging auch in die Entwicklung
unserer eigenen, deutschen Schrift ein. Hier wurden die Umlaute erst durch Nachstellung
eines ,e' geschrieben (das ,ü' oft auch durch Nachstellung eines ,i'),
welches im Laufe der Zeit erst über den Vokal wanderte und schließlich zu zwei
Punkten vereinfacht worden ist. So war sowohl der ,Lehner', als auch der
,Löhner' irgendwie schon da und nur lokale Sprachgewohnheiten führten
dann dazu, daß beide Worte nebeneinander fortbestanden haben und daß namentlich
bei der Bergbehörde in Annaberg mit Scheibenberg vorzugsweise ,Eigenlehner'
geschrieben wurde. Dazu gleich noch ein
Weil uns das aber an dieser Stelle zu kompliziert wird, überlassen wir sprachgeschichtliche Studien besser anderen, dieses Themas besser Kundigen und ziehen ‒ zumindest in unserem weiteren Text ‒ den Begriff ,Eigenlehner' dem anderen vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Soviel zum Wort. Was aber war ist denn dann eigentlich der Inhalt des Begriffs ,Eigenlehner' ? Manche Autoren sind der Auffassung, daß der Eigenlehnerbergbau überhaupt die älteste Form gewerblich betriebenen Bergbaus gewesen sei (Siebert, 1954, wikipedia.de). Das erscheint aber bei genauerem Hinsehen auch unwahrscheinlich, denn der Begriff ,Eigenlehner' kommt in den alten Bergordnungen überhaupt nicht vor. Tatsächlich ist das Wort eine Erfindung der Neuzeit. Erst ab dem Ende des 18. Jahrhundert taucht diese Bezeichnung, wahlweise ,Eigenlehner', oder eben auch ,Eigenlöhner' geschrieben, häufiger in den Akten auf. Vermutlich diente der Begriff damals zur Abgrenzung eines ,privat' betriebenen gegenüber dem üblicherweise gewerkschaftlich betriebenen Bergbau. Wie uns Herr U. Jaschik zu diesem Thema erläuterte, kann man aber dennoch davon ausgehen, das am Anfang des Bergbaus in einer Region sehr oft ein Eigenlehner gestanden hat. Das mußte aber keine Einzelperson sein. Schon in frühen Quellen steht geschrieben, daß die Grube in 4 Schichten aufgeteilt wurde. Diese Schichten sind am Anfang tatsächlich 4 Schichten Arbeitszeit, also 4 Mann arbeiten je 6 Stunden, gewesen. Später wurden daraus 4 Anteile und mindestens einer mußte auch wirklich arbeiten. Aus diesen 4 Schichten entwickelten sich mit der Zeit über mehrere Schritte zunächst 32 Teile und später die allgemein bekannten 128 Kuxe. Auch spielte der Betrieb der Grube, um nicht ins Freie zu fallen, eine Rolle. Eine Eigenlehnergrube konnte man auch mit einer ,Bose', einer halben Schicht, oder als Weilarbeit betreiben. Eine „richtige“ Grube dagegen aber nur mit einer ganzen Schicht, also 8 Stunden. Ein Eigenlehner konnte seine Grube auf diesem Wege bis zum Sankt Nimmerleinstag Tag betreiben, wenn er kein oder nur sehr wenig Erz gefunden hat. Es bestand aber immer die Gefahr, daß er vertrieben wurde, wenn die Nachbargrube fündig wurde. Schon im Iglauer Bergrecht A von 1249 steht dazu: „Wer in seinem Stollen Erz findet dem soll man vom Fundpunkt aus 7 Lehen messen, dazu erhält er das Recht an den unfündigen Gruben in diesen 7 Lehen.“ Ähnlich im Freiberger Bergrecht A von 1307, hier schon etwas ausführlicher: „Gehit das ercz vor sich, so sal der czendener und dy gewerken ganghäuwere seczen, dy sich wol behalden haben, dy sal der bergmeister bestetigen. Dy gewerken mogen hutluthe seczen und sullen vor iczlichin hütman eyn czweyundrysteil seczen durch das, das sy geboren, alz recht ist, und dy sal der bergmeister bestetigen mid deme eyde.“ Im Klartext: Mit dem fündig werden wird dem „Eigenlehner“ ein großes Grubenfeld verliehen, das er bebauen muß. Das geht nicht mehr allein. Er ist gezwungen, entweder weitere Gewerken ins Boot zu holen, oder die 32 Teile selber zu übernehmen und damit für alle Kosten allein aufzukommen. Selbst wenn er das tat, war er dann aber kein Eigenlehner mehr. Ein Eigenlehner kann faktisch in seiner Grube machen, was er will und niemand redet ihm rein. Mit einer halben Schicht kann er seine Grube bauhaftig halten. In dem Moment, wenn die Grube fündig wird, beschrieben wird der Begriff des Fündigwerdens erst im Freiberger Bergrecht B nach 1382, gelten andere Regeln: „Fyndet der erste ercz, da er der mase zcu gert, zo sollen dy burger synen gang hauwen lazen [zcu] dem mynste zcwene, dy daby syn. Daz ercz zal zcu dem mynsten eyns lochters lang syn zcu vuzsze uff der sole. Unde gib[t] daz ercz zcu dem mynsten dry marg unde eynen vyrdung sylbers,“ Dann müssen also 32 Teile vergewerkt werden, der Landesherr bekommt seinen Anteil, es muß ein Hutmann eingestellt werden und der Bergmeister bestimmt den weiteren Bergbau. Eine Rolle spielt auch das Ackerteil. Das findet man schon im Freiberger Bergrecht A: „Wo eyn man ercz suchen will, das mag her thun mit rechte. Kumpt jenre, des das erbe is, und vordert syn ackirteil, das ist eyn czweyunddristeil, und butet syne kost wissentlich czweyn erhaften mannen, ee man kerben und seil ynwirft, der hat is mit rechte.“ Das heißt: Der Besitzer des Grund und Bodens muß seine Rechte schon vor dem Teufen eines Schachtes anmelden. Ihm steht dann eines der zweiunddreißig Teile zu, das er aber selber bauen oder aber finanzieren muß. Dasselbe trifft ja auch für den Eigenlehner zu. Oft haben auch „angestellte“ Bergleute neben ihrer normalen Schicht eine eigene Grube mit einer halben Schicht als Eigenlehner betrieben. In Iglau kennt man dann noch die Lehenhäuer. Dann hatte der Grubenbesitzer einzelne Lehen unterverliehen. Der Lehenhäuer hat also diese Lehen eigenständig auf Gewinn und Verlust betrieben. Er mußte natürlich an den Besitzer der Grube einen Obolus dafür zahlen. Er war im übertragenen Sinne also auch ein Eigenlehner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Offenbar war man sich Ende des 18. Jahrhunderts selbst bei der königlichen Kammer in Dresden nicht so richtig sicher, was unter den ,Eigenlehnern' oder auch ,Eigenlöhnern' denn nun eigentlich zu verstehen sei und beauftragte daher im Juni 1786 das Oberbergamt, doch gefälligst einmal genaue Auskunft dazu zu geben. Eigentlich galt ja grundsätzlich immer noch das alte Bergrecht ‒ nur die Durchführungsbestimmungen, die Bergordnungen, hatten sich verändert. Aus Freiberg erging jedenfalls am 7. Oktober 1786 die folgende Aufforderung an alle Bergämter, die wir in den Akten der Bergämter Annaberg und Johanngeorgenstadt abschriftlich wiedergefunden haben (40007, Nr. 363 und 40012, Nr. 1179): „Was Se. Churfürstl. Durchl. zu Sachsen, Unser gnädigster Herr, wegen Bestimmung des Eigenlöhner und Gesellen Bergbaus sowohl, als in Ansehung der Frage, ob und in welcher Maaße den Gewercken die An- und Ablegung der Bergarbeiter zustehe, gnädigst Uns anbefohlen haben, besage (?) Beyfüge des mehren; Ober Berg Amtswegen wird daher sämmtl. Berg Aemtern andurch verordnet: was sowohl in Ansehung des einen als des andern observantiae in denen Ihnen gnädigst anvertrauten Refieren sey, und worauf sich dasselbe gründe, vollständig und nach Befinden mit Belegung der darzu gehörigen Acten, und Beyfügung eines umständlichen Gutachtens bey Uns anzuzeigen. Insonderheit aber haben dieselben in sothaner Anzeige genau zu bemercken: 1.) unter welchen Umständen die Intereßenten eines Berggebäudes für Eigenlöhner oder für Gewercken angesehen werden, 2.) als das Anhalten hierzu durch die Muthung, worinnen sich der Muther als Eigenlöhner oder Bevollmächtigter einer Gewerckschaft präsentirt, gegeben, oder, ob von den Berg Aemtern selbst bey der Bestätigung, nach Ansehen einer gewißen Observanz oder speciellen gesetzlichen Bestimmungen diese Distinction gemacht werde; und sodann insonderheit 3.) ob diese Bestimmung in der Zahl der den Intereßenten zustehenden Antheile der Zeche liege, so, daß keinen derselben z. B. mit weniger als einer ganzen oder halben Schicht, d. i. 32 oder 16 Kuxe, ins Gegenbuch getragen werden darf, oder ob 4.) diese Bestimmung in der Anzahl der Personen selbst, sie möge das ihnen zugehörige Gebäude zu gleichen oder ungleichen Theilen besitzen, ihren Grund habe, und wenn dieses ist, 5.) wenn bey einer Zeche zwey, drey oder mehrere Personen bauen, jedoch als würckliche Gewercken aufgeführet werden, diese als solche charackterisirt und wesentlich von den Eigenlöhnern unterscheidet, oder 6.) ob bloß die eigenhändige Arbeit der Eigenlöhner sie zu solchen qualificire, oder ob 7.) der Unterschied zwischen ihnen und den Gewercken darinnen liege, daß die Kosten des Gebäudes von ersteren nach willkürlicher Übereinkunft unter sich selbst durch sogenannten Gesellen Verlag und von letztern durch bergamtlich authorisirten Zubuß Anschlag mittelst der gedruckten und gestempelten Zubußzeddel aufgebracht werden, überhaupt aber 8.) ob und wie Eigenlöhner und Gewercken im Gegenbuche distinguirt werden; ingleichen 9.) ob auch zwischen Eigenlöhnern und Gesellen etwa sonst noch ein Unterschied gemacht werde, und worinnen derselbe bestehe; 10.) ob die Hammerherren in Ansehung ihres Bergbaues und den ihnen selbst gehörigen Eisenstein Zechen für Eigenlöhner gehalten werden; 11.) ob und was für Vorzüge den Eigenlöhnern und Gesellen vor anderen Gewercken zustehe? 12.) ob ihre Lehnträger und Versorger von dem Berg Amte verpflichtet werden oder 13.) ob ihnen ordentliche Schichtmeister und Steiger zu halten verstattet sey, 14.) zu was für Obliegenheiten sie hinwiederum in Ansehung der Landesherrlichen Gebühren, sowie 15.) in Ansehung der Geschäfte vor dem Berg Amte, ingleichen 16.) in Ansehung der Anweisung deßelben wegen Veranstaltung ihres Grubenbaues verbunden sind, und 17.) wenn sie den Bau ihrer Gruben nicht eigenhändig, sondern durch andere, in ihrem Lohn stehende Arbeiter betreiben, ob und in welcher Maaße ihnen diese selbst an- und abzulegen verstattet werde oder nicht? Eben so haben auch sämmtliche Berg Aemter in Ansehung der andern eingangs gedachten Frage 18.) anzuzeigen, ob den Gewercken die An- und Ablegung ihrer Arbeiter bisher willkürlich verstattet worden oder nicht? 19.) ob dieses indistincte, oder mit Concurrenz des Berg Amtes, und dann in welchem Maaße selbst geschehe oder 20.) ob diese An- und Ablegung der Arbeiter, den Schchtmeistern und Steigern der Gewercken überlaßen gewesen, und ob von diesen sothane An- und Ablegung allein, oder ebenfalls unter Vorwißen des Bergamtes, wenigstens unter Communication mit den Herrn Refier Geschworenen geschehen sey? Als welches ebenfalls eines wie das andere, nach Befinden der Umstände mit Anführung vorhandener Gesetze, oder im Fall einer Observanz, mit Factis, und darauf sich gründenden Acten zu belegen, und wie es in der Zukunft diesfalls am dienlichsten einzurichten seyn dürfte, mit umständlichen Gutachten zu begleiten ist. Freyberg, am 7. Octobr. 1786 Se. pp. verordnetes Ober Berg Amt“
Gezeichnet ist das Schreiben übrigens vom
damaligen
Berghauptmann Carl Wilhelm Benno von Heynitz (*1738, †1801), dem Bergkommissionsrat
Johann Friedrich Wilhelm Charpentier (*1738, †1805), C. S. L. von Schirnding
sowie vom Direktor des Oberberg- und Hüttenamtes Georg Adolf Freyherr von
Gutschmidt (*1764, †1825). Als Eingangsvermerk beim Bergamt
Annaberg mit Scheibenberg ist allerdings erst der 28. Februar 1787
vermerkt. Da sich die letzten vier Punkte nur mit der Anstellung und
Entlassung der Bergarbeiter befassen, darf man wohl annehmen, daß wieder ein
Streitfall zu diesem Thema zwischen Bergbehörde und Hammerwerksbesitzern der konkrete Auslöser für diese
Berichtsaufforderung gewesen ist. Dieses spezielle Thema bildete auch
später noch den Auslöser für weitere
Wie oben schon angemerkt, war man sich in der Wortwahl schon damals sogar innerhalb der sächsischen Bergbehörde uneins, denn in dem hier zitierten Schreiben aus Freiberg steht wieder der Begriff ,Eigenlöhner' ‒ in Bergamt zu Annaberg verwendete man dagegen ziemlich konsequent den Begriff ,Eigenlehner'.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lassen wir also wieder die Zeitzeugen zu Wort kommen und zitieren zunächst aus dem Bericht des Bergamtes Annaberg, mit der Post abgegangen nach Freiberg am 6. April 1787. In der Akte ist leider nur das Konzept des Berichtes in einer nicht besonders gut lesbaren Handschrift erhalten, während die Reinschrift vermutlich in einer Oberbergamtsakte noch ihrer Wiederentdeckung harrt... An das Churf. Sächs. Hochverordnete Ober Bergamt zu Freyberg Gehorsamste Anzeige „Eu. hochl. Oberbergamt hat unterm 7. Oct. 1786 wegen Bestimmung des Eigenlehner und Gesellen Bergbaus sowohl als über die... auf welche sothane Anzeige besonders zu richten, (angewiesen?). Zu schuldigster Befolgung dieses hohen Anbefohlnißes nun sollen Eu. hochv. Oberbergamte, wie diese Gegenstände den Bergwercks Verfassung halber in denen gnädigst uns anvertrauten Berg Amts Refieren Annaberg, Scheibenberg, Oberwiesenthal, Ehrenfriedersdorf und Geyer, (haben wir) nach Anweisung aber in gedachter hochgütigen Ober Bergamts Verordnung vorgeschriebenen Puncten folgendes geziemend anzuzeigen. ad 1. Ist jede neu aufgenommene Zeche, solange der Lehnträgern ebensolche nicht ganz oder zum Theil vergewerckschafte und solches beym Bergamte angezeigt, auch vorher darzu einen Aufstand sich erbethen und solchen erhalten habe, zeither als Eigenlehner Zeche betrachtet, sobald aber als der Lehnträger etwa Vergewerckschaftung (?) und Zubuße darauf angeschlagen hat, als eine Gewercken Zeche angesehen und dernach behandelt werde. Wenn dagegen der Lehnträger ohne Hülfe eines Aufstandes Theilnehmer zum Betrieb der aufgenommenen Zeche erlanget, oder selbige fast zur gleichen Zeit mit ihm darzu entschlossen und die Zeche (bestellt?) daß die sie quartaliter die zu verbauenden Kosten von jedem privata seines Antheils bey (geben?) keineswegs aber solche darauf Zubuß Anschlag als welchem die Kosten dem Ertrag (...?) gleichkommt, sondern vielmehr ihn übersteigt oder (...?) erreiche, aufgebracht werden sollen, zu bebauen sich verabredet und solches beym Bergamt angezeigt haben, so heißt die Zeche anhero eine Eigenlehner Zeche und wird auch als solche (...?) behandelt. Die Zahl der Intereßenten einer solchen Eigenlehner Zeche ist zwar in der Bergordnung vom Jahr 1589, Art. 36 nun auf 4 Personen eingeschränkt, weil aber der Angriff einer Grube kostbar ist, ja manche Personen sich damit beschäftigen, den ausfallenden Verlust bey (...?) Alß ist schon seit langer Zeit bey dieser Anzahl nicht stehengeblieben, sondern hat solche bis aufs Alteren? bis auf 8 Personen ansteigen laßen, jedoch nicht zugegeben, daß mehrer zum Bau einer Eigenlehner Zeche mit einander in Verbindung getreten, so solche dann die Anzahl der dabey intreßirten Personen sich höher belaufe, ist die Zeche als eine Gewerken Zeche anzusehen und Zubuße angeschlagen worden. ad 2. Da, wie nun erst gedacht, eine jede Zeche bey ihrer Aufnahme und ehe Gewercken in selbige gebracht sind, eine ordentliche Eigenlehner Zeche ist; so findet bey deren Muthung die Distinction in Gewerken oder Eigenlehner Zeche gar nicht statt, sondern jede Zeche gehört insgemein zur letzteren Gattung. Eben so wenig kann auch bey Bestätigung einer erst aufgenommenen Zeche selbige eine andere Eigenschaft beygelegt werden, weil vor der Bestätigung kein Aufstand ausgefertigt wird und ohne diesen niemand die Vergewerkschaftung einer Zeche gültigerweiße unternehmen darf. ad 3. Wie schon erwähnt, sind auf dem Zubuß Anschlag deßen nun bis auf 8 ansteigenden Anzahl der Intereßenten die Attribute einer Eigenlehner Zeche, die Zahl der Antheile die einer dießer Intereßenten an selbiger Zeche besitzen kann, ist ganz willkürlich und überhaupt ihre Beschaffenheit nach gar nicht darzu qualificirt, daß sie das Criterion einer Eigenlehner Zeche mit ausmachen könne, indem derjenige, der die bestimmte Anzahl Kuxe zu verbauen sich nicht getrauen könnte, von den Theilnehmern einer Eigenlehner Zeche (...?) hiernächst aber die Vereinigung einer Anzahl Eigenlehner zum Betrieb einer Grube nichts als eine bloße Societaet ist, bey solcher aber die Socii parter inaequaler conferiren können, auch würde durch die Bestimmung der Kux Anzahl, die jeder Eigenlehner haben sollte sowohl den 8 (Position?) über als Privat Eigenthum als auch ihm Freyheit in der Aquisition deßelben (?) werden und bey einigen aber mit Veräußerung eines Theils seiner Kuxe sich rathen, aber auch die Aufbringung der Kosten erträglicher machen und (?) da übrigens theils noch von den Erz (?) künftigen guten Zustand der Zeche (...?) an diesem allen behindert so wie dagegen aber andere durch Aquisition mehrer Kuxe (...?) aber den Forttrieb der Zeche befördern zu hoffen, abgehalten werden. Es dürfte daher wohl am besten gethan seyn, wenn auch fernerhin wie bisher, jedem Eigenlehner frey stünde, so viel Kuxe als er aquiriren und zu beköstigen sich getrauen kann, bey einer Eigenlehner Zeche zu bauen. ad 4. Die Beantwortung dieser Frage ist in der vorangeführten mit enthalten, (?) daß bloß die Anzahl der Intereßenten einer Grube deren Qualität einer Eigenlehner Zeche bestimmt, hierbey aber auf die Größe der Antheile eines jeden (?) gar keine Rücksicht genommen, noch weniger aber wie individuelle (?) diese Antheile (?) werden. ad 5. Daß man zwey, drey oder über die Zahl der bey einer Eigenlehner Zeche zugelaßnen Intereßenten sich nicht belaufende Anzahl (?) einer Zeche als Gewerken gebauet, ist, soviel wir uns erinnern und in Erkundigung ziehen können, in obgedachter (?) noch nie der Fall gewesen, auch es gegenwärtig noch nicht (?) selbige mitwirken sollte, so kann eine Zeche zwey, drey oder mehrere Personen bauen, jedoch als (?) Gewercken aufgeführet werden, als durch nichts als durch den Zubuß Anschlag und durch das Verfahren mit den Intraden von einer Eigenlehner Zeche unterschieden werden. ad 6. Die eigenhändige Arbeit der Eigenlehner auf ihrer Zeche macht ebenfalls kein Unterscheidungs Zeichen aus, woran man ihre Qualität als Eigenlehner erkennen könne, ja es hat solche (?) mit dem Begriff einer Eigenlehnerzeche einigermaßen in Widerspruch denn bey diesen sollen wie ad 3.) angegeben worden, nicht mehr als 8 Personen intereßirt sey die (Umstände?) der Grube können eine Belegung von mehr als 8 Personen nöthig machen und diese mehren müßten von der eigenhändigen Arbeit als (?) einer Eigenlehnerzeche (?) auch in die Gesellschaft mit aufgenommen werden, welche aber nach der einmal bestimmten Anzahl der Intereßenten einer solchen Zeche gar nicht statt findet. Im Gegentheil ist der Fall häufig, daß die Eigenlehner gar nicht auf ihrer Grube arbeiten, ja öfter aus solchen Personen bestehen, die mit den Bergwerken gar nicht umzugehen wißen. So besizet zum Beispiel im Neudörfer Refier der Hr. Steuereinnehmer Fischer zu Ehrenfriedersdorf die mittlere kleine Vierung und die Grbrüder Nizsche zu Mittweyde (nebst?) den Hrn. von Elterlein zu Pöhla das Eisensteingebäude Vater Abraham im Scheibenberger Refier, welche Gruben nothwendig ganz durch andres Personal ihrer Eigenthümer, aber Eigenlehnerweise betrieben werden, auch ist es in Ehrenfriedersdorfer Refier auf den beyden dasigen, sehr höfflichen Eigenlehner Zechen (?) und Morgenröthe gewohnt, daß einige der dasigen Eigenlehner andre für sich arbeiten laßen, als welche überhaupt in den Fall, daß ein Theil der Eigenlehner selbst die Arbeit auf der Grube verrichtet, der andere Theil aber darzu sich nicht entschließen will, oder fast daran gehindert wird, auch anderweit in den uns anvertrauten Refieren alßo gehandhabt wird. Eben so wenig ist es auch den Intereßenten einer eigentlichen Gewerken Zeche verwehret, die Zubuße ihrer bauenden Kuxe, wenn sie anders mit Bergarbeit umzugehen wißen, selbst abzuarbeiten, daß also die eigenhändige Arbeit auf der Grube niemanden zu einem Eigenlehner macht, im Gegentheil aber auch ein jeder ohne solche Eigenlehner seyn kann. ad 7. Das Unterscheidung (?) einer Eigenlehner und Gewerken Zeche besteht wie schon obangedacht a) in der bestimmten und nicht über 8 sich belaufenden Anzahl der intereßenten, und b) darinnen, daß diese die Kosten ihres Grubenbaues nicht wie bey Gewerken Zechen mittelst Zubuß Anschlags, sondern mittelst eines im Voraus nicht zu bestimmenden, verhältnißmäßigen Betrages unter sich aufbringen und werden darüber keine gestempelten Zeddel ausgestellet. Insoferne nun ist dieser Unterschied willkürlich, als es von denen nicht über 8 sich belaufenden Intereßenten einer Grube abhänget, ob sie solche eigenlehnerweiße oder als eine Gewerken Zeche betreiben wollen. So ihre Anzahl aber (steiget?), so (...?) und die Zeche kann bloß gewerkschaftlich betrieben werden. ad 8. Da die Eigenlehner so gut wie die Gewerken einer Zeche ungleiche und der Größe nach von ihrer Willkühr abhängende Kux Antheile bestehen können, und mit diesen ebenfalls ins Gegenbuch eingetragen werden, so folgert daraus von selbst, daß darinnen der Form nach die Eigenlehner und Gewerken nicht distingirt werden, doch wird letzteren im Gegenbuche sowohl als auf den Ausbeut Bogen und allen andern in (?) ausgefertigten Grubenverzeichnissen eine besondere Abtheilung und Rubric angewiesen. ad 9. Eigenlehner und Gesellen Zechen sind so, wie die Subjecte derselben, durchaus synonymische Benennungen, folglich ist auch kein Unterschied zwischen beyden möglich, es müßte denn dießer seyn, daß Eigenlehner Zeche einer solchen Grube etwa, die nur ein einziger Intereßent als Eigenlehner bauet, Gesellen Zeche aber diejenige seyn, die von mehrern eigenlehnerweiß gebauet wird. Früher kann auch wohl dieser Unterschied statt gefunden haben, der aber nichts wesentliches in (sich) involvirt und die Gattungen der Gruben unnöthigerweise vermehret; so ist er schon längst außer Beobachtung und selbst die Benennung Gesellen oder Gesellenzeche außer Gebrauch gekommen, wird man nur beym Durchsehen alter Nachrichten an ihre Existenz in der bergmännischen Sprache erinnert. ad 10. Die Hammerherren, jedoch nicht nur Hammerherren, sondern wie jede andere Person, werden in Ansehung ihres Bergbaus auf den ihnen selbst gehörigen Eisenstein Zechen allerdings für Eigenlehner gehalten, auch durchgängig als solche behandelt. ad 11. Vorzüge haben die Eigenlehner oder Gesellen vor anderen Bergwerks Intereßenten und vor denen einer Gewerken Zeche ganz und gar nicht, es müßte denn die Befreyung von dem Zubuß Anschlag und von den Verfahren mit dem Retardat oder auch die Gestattung quartaliter nur einmal anzuschneiden, dafür angehalten werden wollen, im übrigen aber sind sie ganz allen jenen Verbindlichkeiten wie die Gewerken Zechen unterworfen, denn sie müßen a) beym Bergamt anschneiden b) ihre Register daselbst einlegen und examiniren c) die Löhne ihrer Arbeiter daselbst bestimmen laßen d) die (?) Gewerken obliegenden Quatember und Verschreibegelder nebst anderen Bergamts Gebühren, wie diese, abentrichten, und überhaupt sich in allen denen Berggesetzen (?) bezeigen, auch, wie weiter unten angeführet wird, denen Veranstaltungen des Bergamts in Ansehung ihres Grubenbetriebes Folge leisten, besonders aber werden auch ad 12. Hr. Lehnträger und Versorger dem Bergamte vorgestellt und anders nicht als mit deßen Genehmigung bestellet, auch von selbigen in Pflicht genommen, welches alles umso nöthiger ist, da die Lehnträger und Versorger die ganze Gesellschaft representiren und also an letzterem vom Bergamte eingehenden Verfügungen ihnen infirmiert werden müßen, auch die Berichtigung in den Landesherrlichen Gebühren ist von ihnen zu bewerkstelligen und öfters das ganze Vermögen der Gesellschaft ihnen (...?) anvertraut werden muß. ad 13. Schichtmeister und Steiger zu halten ist ihnen nicht nur verstattet, sondern eu. hochv. Oberbergamt sich aus denen ehehin vom Bergamt Ehrenfriedersdorf (?) Anzeige zu erinnern geruhen, wird solches sogar verlanget werden. Es haben auch die bedeutenden Eigenlehner Zechen als in Scheibenberger Refier das Eisensteingebäude Vater Abraham und in Ehrenfriedersdorfer Refier die Zwitter Zechen Morgenröthe und (Schnorr'en Liegendes?) nicht nur ihre Steiger, sondern auch ihre Schichtmeister, welche eben so wie bey den Gewerrken Zechen, (von?) letzteren per plurima vota der Intereßenten und ersteren vom Bergamt aus denen darzu von denen Intereßenten vorgeschlagenen Subjectis gewählt und bestellet werden. Dabey stehet es jedoch denen Intereßenten frey den zu bestellenden Steigern und Schichtmeistern aus ihren Mittel zu kühren, deren Lohn hingegen wird so wie den Arbeitern (?) vom Bergamte bestimmt und die Eigenlehner sind nicht befugt, darin eigenmächtigerweise eine Vermehrung oder Verminderung vorzunehmen. Kleinen Eigenlehner Zechen hingegen und besonders solchen, die mit nicht mehr als höchstens 2, 3 bis 4 Mann bebauet werden, wird die Bestellung besonderer Schichtmeister und Steiger nicht abverlangt, sondern nachgelaßen, solange bis sie in beßre Umstände kommen, bloß einen Versorger oder Lehnträger zu haben, (der) aber alle Geschäfte eines Schichtmeisters und Steigers besorgt und verhältnißmäßig auch die darzu erforderliche Zünftigkeit haben muß. ad 14. In Ansehung der Landesherrlichen Gebührniße sind die Eigenlehner Zechen von denen Gewerken Zechen ebenfalls ganz und gar nicht unterschieden, sondern sie müßen wie diese die Quatembergelder, Zehnden und Zwanzigsten Gebührniße, auch wenn es Eisenstein Zechen sind, die Ladegelder abentrichten, können aber auch dargegen auf alle denen Gewerken Zechen zugeführte landesherrliche Begnadigung Rechnung machen, und sowohl zum (?) als Zehenden, Zwanzigsten Erlaße, wie zum Beispiel nur neuerl. bey Vater Abraham zu Oberscheibe, ingl. Morgenröthe, Segen Gottes und (hintere Einigkeit?) zu Ehrenfriedersdorf geschehen, gelangen, als auch Vorschüße aus der (?) Schurfgelder Caße zur Ausführung einer oder anderen, ihre Kräfte übersteigenden Untersuchung auf ihrer Grube Ansprüche machen, als zu solchem Ende sie auch von denen darzu qualificirten Producten, die (...?) Beyträge zu bemeldeten Caßen abführen müßen. ad 15. Die Geschäfte beym Bergamte besorgen die Eigenlehner so wie die Gewerken durch ihren Schichtmeister, Steiger, Versorger oder Lehnträger und diese müßen sich daselbst zum Anschnitt zu Registereinlegung Aufrechnung und anderen nöthigen Verrichtungen zu der bestimmten Zeit, so wie die Vorsteher der Gewerken Zechen anfündig werden, auch wenn sie für einige Verrichtungen sich zu Schulden kommen laßen, wie diese mit deren gesetzten Strafen angesehen. ad 16. Da die Eigenlehner so wie die Intereßenten einer Gewerken Zeche allen dem Bergbau zugeführten (?) begnadig und theilhaftig werden können, diese aber hauptsächl. das Aufnehmen von einzelnen Zechen sowohl als des Bergbaus überhaupt zur Absicht haben, und bey selbigen von allen (?) darauf zu sehen ist, daß solche dem Interesse des Landesherren und publici so (?) als möglich sey und auch damit solche dieser Absicht entsprechend geliefert werden, die (direction?) derßelben ebenden Bergämtern cumulative mit Eu. hochv. Oberbergamte übertragen ist, hiernächst aber, wie der Betrieb einer Zeche der Willkühr der Intereßenten überlaßen und auch, nebst der Voraussetzung des landesherrl. Interesses auch den Credit des Bergbaus, für deßen Erhaltung deshalb sorgen, denen Bergämtern mit obliegt, so ist nichts billiger, als nothwendiger, als daß die Veranstaltung des Grubenbaues bey denen Eigenlehner Zechen eben so wie bey den Gewerken Zechen, dem Bergamte zukommen, es ist auch solche in sämmtliche obbenannte (?) dem Bergamte (...?) gemacht, vielmehr solcher ohne Widerrede Folge geleistet worden. Dieße Veranstaltungen des Grubenbaus bey denen Eigenlehner Zechen nun, werden, so wie bey denen Gewerken Zechen, ihren Vorstehern, ingl. den Schichtmeister, Steiger oder Versorger der Grube (?) aufegegeben, auch deren Befolgung von ihnen erwartet und sie bey deren Unterlaßung zur gebührenden Verantwortung gezogen, übrigens aber die Eigenlehner bey diesen Veranstaltungen in eben dem Maße, wie die Vorsteher der Gewerken Zechen, mit ihren Vorstellungen gefördert und hierbey vorzügl. ihrer Vermögens Zustände mit in Betrachtung genommen. ad 17. 18. 19. und 20. Mit der Veranstaltung des Grubenbaues steht die An- und Ablegung der Arbeiter in (?) Verbindung und so wenig jene, wie (...?) von der Willkühr der Eigenlehner oder Gewerken abhänget, so wenig ist auch diese selbigen (überlassen?). Denn erst wenn die Baue veranstaltet sind, läßt sich die Zahl der darzu erforderlichen Arbeiter bestimmen und ebenso unzweckend seyn Vermehrung oder Verminderung, (...?) sowohl dem landesherrl. und privat Intereße ebenso nachtheilig, als wenn der Bau nicht bergmännische genug verführet wird, mithin macht die An- und Ablegung der Arbeiter einen Gegenstand, der dem Bergamte obliegenden Sorgfalt für die Beförderung des Endzwecks beym Bergbau mit aus, und kann auch nur vom Bergamte (?) werden. Außerdem ist aber auch besonders die Ablegung der Arbeiter unter gewissen Umständen eine (?) von Strafe wegen begangenen Vergehungen, diese aber kann nur von dem competenten Bergamte und zwar nicht (?) praevia causae cognitione auferlegt werden. Die Gewerken oder Eigenlehner also, welche deßwegen, daß sie selbst oder ein anderer (...?) Arbeiter beleidigt, aber sonst durch deßen Vergehungen (laedirt?) werden, dieße Arbeiter eigenmächtigerweiße ablegen wollten, würden reine Selbsthülfe und (?) begehen, und eben damit dergleichen Ungebührniße verhindert wider die Möglichkeit, daß einem oder dem anderen Arbeiter von denen Eigenlehnern oder Gewerken Unrecht geschehen möge, entfernt werden, können die Gewerken und Eigenlehner sich der Ablegung der Arbeiter durch aus nicht anmaßen, es würde auch, wenn selbige statt fünden sollten, deshalb Unordnung einreißen, die Grube wohl gar mit ungeschickten Arbeitern belegt und hierbey dem Eigensinn und die Production den Gewerken und Eigenlehnern zum Bewegungsgrund genommen werden. So nun die Ablegung deshalb nur allein vom Bergamte vorgenommen werden kann, damit dieses ersehe, ob Grund darzu vorhanden sey, und solche nicht eben ohne daß es die Umstände der Grube nothwendig machen, ober die abzulegenden Arbeiter verschuldet haben, so ist auch die Anlegung ohne des Bergamts Vorwißen und Genehmigung dießerhalb nicht zu gestatten, weil außerdem daß das Bergamt untersuchen muß, ob die Vermehrung der Mannschaft nöthig sey, auch noch von selbigen zu prüfen ist, ob der anzulegende Arbeiter in Ansicht seines vorherigen Verhaltens auch beym Bergbau gebrauchet werden kann und besonders, ob er auf der Grube, wo er vorher angefahren, bergmännisch abgekehret, auch mit einem (?) ingl. Attestat versehen sey? Dieße Vorschriften der Berggesetze nun werden ganz gewiß vernachläßiget und die Eigenlehner Zechen ein Zukunfts Ort für fernere Untreue und Ungebührniße wegen anderwärts abgehender Arbeiter werden, wenn das Bergamt bey denen Eigenlehner Zechen nicht eben so, wie bey denen Gewerken Zechen über die Anlegung und ablegung der Arbeiter disponiren sollte. Es ist auch schon in denen sämtlichen eingangs gedachten Bergamtsrefieren weder denen Gewerken, noch denen Eigenlehnern gestattet worden, selbige haben sich auch (?) nie angemaßet, sondern die An- und Ablegung der Arbeiter auf ihren Zechen nie anders als mit Vorwißen und Genehmigung des Bergamts erfolgt, dergestalt, daß, wenn ein oder mehrere Arbeiter entweder an- oder abgeleget werden sollen, die Gewerken oder Eigenlehner solches durch ihre Vorsteher dem Bergamte vortragen und um Vergünstigung ansuchen laßen, welche nach vorgängiger Untersuchung der Umstände und nach deren Bewandniß entweder ertheilt oder versaget wird. So wie das Bergamt es anordnet, muß die An- und Ablegung auf denen Eigenlehner- oder Gewerken Zechen antweder erfolgen, oder unterbleiben. Auch nicht die Schichtmeister oder Steiger der Gewerken oder Eigenlehner können solche von sich unternehmen, ohne darüber verantwortlich und strafbar zu werden, sondern das Bergamt (...?) ist in jedem Fall dabey erforderlich. Ob nun wohl wie eben gemeldet die Art der Kosten Aufbringung bey Eigenlehner Zechen von der bey denen Gewerken Zechen darinnen verschieden ist, daß jene bloß erst wenn der Kosten Aufwand bekannt sit, dieße aber vorher mittelst des Zubuß Anschlages geschiehet, so sind doch, was die Vertheilung des Überschusses anbelanget, die Eigenlehner Zechen denen Gewerken Zechen vollkommen gleich, und jene können so wenig als dieße Verlag oder Ausbeute ohne Vorwißen des Bergamtes, noch anders, als nach einzelnen Kuxen schließen, und ist ihnen nicht verstattet, den ganzen ausfallenden Überschuß, er sey so beträchtlich, als er wolle, auf einmal unter sich zu vertheilen. So hat zum Beispiel im vorigen Jahre die Eigenlehner Zeche Morgenröthe am Sauberg zu Ehrenfriedersdorf im Quartal Reminiscere 2 gr, 4 pf. und Hoffnung Gottes am Globenstein im Scheibenberger Refier im Quartal Luciae 6 gr. – Verlag auf einen Kux und bekanntermaßen die ehedem zum Annaberger Refier gehörige St. Catharina zu Raschau eine geraume Zeit (...?) erst mit Verlag und dann Ausbeute, eben so wie bey Gewerken Zechen geschloßen, eben auch diejenigen Gruben, welche von Gewerkschaften anderer Gebäude nicht als Beylehn, sondern als besondere Zechen alleine gebauet werden, wie z. B. nur bemeldte St. Catharina zu Raschau und die Kiesgrube im Geyerschen Refier werden für Eigenlehner Zechen gehalten und die Gewerkschaften in Rücksicht deßelben für eine persona mystica angesehen, auch aus nomine collectio in das Gegenbuch eingetragen, die Kosten aber ebenfalls ohne Zubuß Anschlag abentrichtet und (?) Zurücktheilung kann das Verfahren mit dem Retardat nicht angewendet werden. Eben diese Unwirksamkeit des Retardat Verfahrens bey Eigenlehner Zechen hat bisher mancherley Unbequemlichkeit und öftere Verlegenheit veranlaßt, maßen bisher kein im oberen Berggesetze bestimmtes Mittel vorhanden gewesen, andurch diejenigen Intereßenten einer solchen Zeche, welche ihre Kuxe nicht gehörig abgeführt? So wie bey denen Gewerken Zechen mit dem Retardat geschiehet daru angehalten werden. Nur zuweilen haben zwar die Eigenlehner gleich bey Errichtung der Gesellschaft, durch besonderen unter einander eingegangenen Vertrag, sich dieserhalb sichergestellt, nach (?) aber ist dieses nicht geschehen, auch hat nicht selten die Vollziehung dieses Vertrages Weitläuffigkeiten veranlaßt und die andern richtig zahlenden Intereßenten sind dadurch gar zu oft in dem gehörigen Betrieb ihrer Grube gehindert, ja selbigen vielmals die Aufläßigkeit damit zugezogen worden. Es ist daher eine gesetzliche Vorschrift, wie gegen die Intereßenten einer Eigenlehner Zeche, welche sich säumig in Abentrichtung ihrer Kosten erweisen, zu verfahren und selbigen ihnen zu erlangen sey? nothwendig. Hierbey aber dürfte nach Disposition der Altenberger Bergordnung Art. XII. am schicklichsten anzuwenden seyn, denn in diesen ist denen Gewerken der dortigen Zwitter Gebäude nachgelaßen, die Kosten auch ohne Zubuß Anschlag durch wöchentliche Zusammenlegung aufzubringen, dabey aber festgesetzet, daß (wenn) einige Gewerken sich darin säumig erweisen, seine Kuxe verlustig seyn soll, wenn er der diesfalls vom Bergamt an ihn ergangenen Auflage binnen 4 Wochen keine Folge geleistet hat. Da auch die Intereßenten einer Eigenlehner Zeche wirkliche Socii und in aller Rücksicht, besonders aber als dann, wenn sie ihre Grube eigenhändig bearbeiten, mit engen als die (?) einer Gewerkschaft mit einander vereinigt haben, ingl. zur Erhaltung einer Societaet aber Vertreulichkeit das unentlehnliche Erforderniß ist, und des öfters dadurch gestört werden kann, wenn ein Intereßent seine Kuxe ganz oder zum Theil an Persohnen überläßt, welche die andern von ihrem Consortio entfernt zu halten wünschten, auch überhaupt die Rechte nicht haben wollen, daß ein Socio ein Contract aufgedrungen werde, so daß es sehr zur Vermeidung der Zwistigkeiten unter den Eigenlehnern beytrage, wenn es in ihre Gewalt gestellt würde, die Kuxe, so einer ihrer Consorten zu veräußern Vorhabens ist, selbst für sich zu aquiriren und dadurch das Eindringen eines unangenehmen Socii abzuwenden. Zu diesem Betracht glauben wir, den Vorschlag zu (?), daß das (?) unter denen Eigenlöhnern eingeführet und jedem Intereßenten einer Eigenlöhner Zeche die Verbindlichkeit auferlegt werde, seine Kuxtheile, ehe er sie an andre und auswärts an catrane überläßt, zuvor denen übrigen Intereßenten dieser Zeche anzubiethen und sie ihnen um den nehmlichen Preiß, den ein anderer dafür zahlen will, zu überlaßen. Wie denn auch um die in Bezahlung der Kosten (?) Intereßenten einer Eigenlehner Zeche darzu ansuchten zu können, unsern Dafürhalten nach, es dienlich sey und die (?) wie nur angeführtermaßen in der Altenberger Bergordnung ratione derjenigen Zechen, die ihre Kosten eben so wie die Eigenlehner ohne Zubuß Anschlag aufbringen, verordnet ist, allgemein festgesetzet würde, daß jeder Eigenlehner (?) binnen 4 Wochen von Zeit des ihm diesfalls infirmirten bergamtlichen Auflage die auf sein Antheil kommenden Kosten nicht abentrichtet, sothanen Antheils co ipso verlustig sey und solche (?) andere Intereßenten dieser Zeche zur freyen Disposition zufallen sollten. Anlangend hiernächst die übrigen Verfaßungen bey denen Eigenlehner Zechen, da solche außer der Anzahl der Intereßenten und der Kostenaufbringung (?) mit denen der Gewerken Zechen durchgängig gleichsinnig sind, diese aber theils auf gesetzliche Disposition, theils auf Observanz sich gründen, überhaupt aber (?) sind die zur Zeit beständigen (?), so dürfte solche unserem ohnmaßgeblichen Gutachten nach, noch fernerhin beybehalten, jedoch um ihre Beobachtung zu sichern und allen (?) und Zweifel zu begegnen, noch durch besondere höchste Verordnung zu authorisiren und ihnen dadurch (?) beyzulegen seyn. Mit gebührender Submißion und schuldigster Hochachtung allstets beharrend 31. Maerz 1789, Das Bergamt allhier.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Bericht aus dem
Bergamt Johanngeorgenstadt mit Schwarzenberg auf obigen Fragebogen des
Oberbergamtes von 1786 hin ist etwas kürzer ausgefallen (40012, Nr. 1179,
Blatt 7ff). Auf den ersten Blick lautet die Antwort ähnlich, doch gibt es
Unterschiede in der Hervorhebung einiger Punkte:
An Eu. Churfürstl. Hochlöbl. Oberbergamt in Freyberg Unterthänig gehorsamster Vortrag „Bey Bestimmung der allgemeinen Fragen über die besonderen Gerechtsame der Eigenlöhner und in wieferne die An- und Ablegung der Arbeiter den Gewercken zustehe? Sollen wir auf das erlaßene hohe Generale vom 7. Octob. 1786 und m. m. vom 5. Martii 1787 was deshalb in Ansehung des einen oder des anderen observantia in denen gnädigst uns anvertrauten Bergamts Revieren sey, nach denen aufgegebenen Puncten folgendes untertänig anzeigen und bemercken. 1.) unter welchen Umständen die Intereßenten eines Berggebäudes für Eigenlöhner oder für Gewercken angesehen werden? Nur diejenigen sind in hiesiger Revieren vor Eigenlöhner gehalten worden, welche mit Beystimmung Schönbergs Berg Informationen part. 2, Fol. 21 und 22 und des Bergbau Spiegels post moccem lit. Hertwigs Bergbuchs ob pocc (Einspänniger ?) A sub duplici arterimo durch eigene Handarbeit in einem Grubengebäude alleine arbeiten und für sich bauen, welche nach anliegenden Actis sub No. 805, Fol. 17b von einigen Berg Arbeitern nach der ordentlichen Schicht bey ihrer Weile wie etwa einer oder der andere solche nach Busen oder halben Schichten arbeiten können, und bey sich öfters ereignet, daß sie zuweilen kaum 3 bis 6 gr. auch wohl gar nichts erhalten. In solcher Erwägung ist man zufrieden gewesen, wenn dergl. Arbeiter durch Ausschürfen neuer Gänge des Landes herrschaftl. und gewerckschaftl. Interesse mit Aufbringung neuer Gruben befördert, und hierbey durch einen und ihren Mitteln, welche insgemeinter Lehnträger und Versorger ist, richtigen Anschnitt gehalten und die Register, nach einem geschriebenen (?) Formular, als bey Gewercken Zechen eingeleget haben; (...?) selbige doch wenn selbige keine Einnahme dabey gemacht, teilen tibus actis allegation und darin sub No. 2280 für beständig (?) werden müßen. 2. Ob das Anhalten hierbey durch die Muthung... oder ob von dem Bergamte selbst bey der Bestätigung... diese Distinction gemacht werde. Nicht sowohl aus der Muthung und Bestätigung könnte man dieses Recht der Eigenlöhner in weiteren Verstande, (?) als vielmehr nach dem 36. Articul Chürf. Sächs. Silber Bergwercks Ordnung wo es heißt: ,Worüber auch 1, 2, 3 oder 4 auf (?) einer oder mehr Zechen bauen, und durch solche zugleich oder eine (?) solche erregen? wollen, daß soll unser Hauptmannn und Bergmeister gestatten‘, ingl. die hohe Oberbergamts Verordnung vom 20. Junii 1770, wo eine ,dergl. Consortschaft auf 8 Personen sich höchstens erstrecke‘ jedoch schon (?) Zubuß Anschlag nach ihrer Übereinkunft, worzu sie sich im Bergamte bekennen, gehalten werden soll. Wie sie denn auch in Haltung richtigen Anschnittes und Einlegung der Quartalsregister und Abstattung der Bergwercks Gefälle vor andern Gewerckschaften keine Ausnahme haben. Dagegen diejenigen, welche über acht Gesellen sich erstrecken, nach nurbemerkter hohen Verordnung nicht mehr als Eigenlöhner oder Gesellen angesehen und ohne öffentlichen Zubuß Anschlag zu bauen nicht erlaubt, auch einer weiteren Vereinzelung ihrer Kuxe als eine halbe Schicht auf jeden Gesellen nicht zugestanden werden soll. 3. Ob diese Bestimmung in der Zahl der den Intereßenten zustehenden Antheile der Zeche liege… Dieses sollte nach nurbemerkten hohen Verordnung in Ganzen beobachtet werde; weilen aber die Lehnträger öfters a) nur alleine in das Gegenbuch sich eintragen laßen, auch nur genug haben, wenn sie die Belehnung eines gemutheten Lehns an Fdgr. Maaßen und Stolln vom Bergamte erhalten, und dann sich mit ihren übrigen Gesellen in Absicht der nach den Anschnitt Registern gethanen Arbeit und Kosten Beytrag berechnen, b) bey würcklicher Zugewährung der Kuxe auch sich nach der mehr oder wenigern Anzahl ihrer Gesellen, welche würckliche Handarbeit mittreiben, richten müßen, c) hiernächst auch noch andere privat Gewercken, wozu auch öfters Zubuß Anschlag gehalten wird, einnehmen, um ein Gruben Gebäude solange deren noch keine Einnahme zu Bestreitung der Ausgaben eingehen kann, indeme daßelbe über ihre Weil und Schichten Arbeit noch mehr Kosten Aufwand erfordert, geschwinder zu einem glücklichen Endzweck zu bringen; So scheinet es uns immer, daß die Haupt Fdgr. eines Eigenlöhners diejenige bleibe, welche wie ad (?) 1tens unterthänig zu bemercken gehabt, wo die eigene würckliche Handarbeit der Bergleute, sie werde durch einen oder soviel als sich dabey intereßiren können und wollen, verrichtet. 4. Ob diese Bestimmung in der Anzahl der Personen... ihren Grund habe. Wie gleich unterthänig zu bemercken gewesen, nicht die Anzahl der Persohnen, sondern der Betrieb der Gesellen oder Eigenlöhner durch Arbeit, welche ihnen nicht von Gewercken gelohnet, sondern von ihnen selbst auf glücklichen Erfolg gewahret wird. 5. Was, wenn bey einer Zeche... würckliche Gewerken aufgeführt werden, diese als solche characterisirt und von Eigenlöhnern unterscheidet. Im Gegensatz der vorigen Beantwortung ad Paragr. 4, daß da Gewercken, welche aus 1, 2, 3, 4, bis 8 und mehr Persohnen bestehen, ihre Beyträge zu Bestreitung der angeschnittenen Kosten bey jedem in Lehn habenden Gebäude durch würckliche eigenhändige Arbeit entweder nicht thun können oder wollen, solche durch Geldbeyträge thun, und folglich durch Bergarbeiter und Lohn verrichten laßen, und jede Aufsicht über diese Arbeiter, nach Vorschrift der Churf. Bergordnung Schichtmeister und Steiger bestellen laßen. Da bey denen Eigenlöhnern ad art. 36 der Churf. Bergordnung, weil selbige den Grubenbau unter Aufsicht des Bergamtes (?) versehen können, als Gewercken, welche das (?) nur aus den Berichten des Bergamtes und ihrer Vorsteher kennen und davon urtheilen müßen. 6. Ob bloß die eigenhändige Arbeit der Eigenlöhner sie zu solchen qualificire... Wie bereits die in denen vorstehenden Antworten anzuführen gewesenen Gründen solche bekräftiget dürften. 7. ob der Unterschied zwischen ihnen und den Gewerken darinnen liege, daß die Kosten des Gebäudes von ersteren nach willkürlicher Übereinkunft... von letzteren durch bergamtlich accreditirten Zubußanschlag... aufgebracht werden. Dieser Unterschied, sowie er nach obiger hoher Oberbergamts Verordnung die Sache sofort entscheiden würde, hat bey denen Rothenberger Gewerken Eisenstein Berggebäuden diese Abweichung, daß jeder Gewerke nach gehaltenem Anschnitt des Schichtmeisters und Steigers die, nach seinen Kuxen beyzutragende Zubuße, welche die Arbeiter theils in Brod, theils in baarem Gelde nach den unterm 26. (?) 1780 gnädigst approbirten Verhältnis abhohlen, annoch baar abführt; welches? auch auf dem Oelpfanner Stollen von denen Hrn. Reinfelden zu Erla, und denen Hrn. Hennigen auf dem Henneberger Eisenstein Berggebäude ebenso gehalten wird; auch bis hierher zu keinen Klagen Anlaß gegeben, indem jeder seine Beyträge richtig abgeführt und hiermit die anfänglichen Zubuß Zeddel Fertig- und Stempelung besonders am Rothenberg unnöthig gemacht hat. 8. Ob und wie Eigenlöhner und Gewerken im Gegenbuch eingetragen werden. Man hat zwar nach demjenigen, was ad Paragr. 3. oben anzuführen gewesen, beym Gegenbuche, weil jeder Gewerke nach Hertwigs Bergbuch (...) den Nahmen erhält, es mag einer oder mehr in Bergwerk sich einlaßen, die Gaben Gottes (?) das Glück und Seegen erworben, und dadurch den Nahmen eines Gewerken erlanget, seine besondere Distinction gemacht; jedennoch aber nach denen vorangeschickten unterthänig vorgetragenen Verhältnißen, die erforderliche Unterscheidung gemacht, welche auf weitere höchste Entscheidung für die Folge beruhen dürfte. 9. Ob auch zwischen Eigenlöhnern und Gesellen etwa sonst ein Unterschied gemacht werde... Deshalb sind uns keine weiter bekannt, weil die (?) gewöhnliche (?) jetzo nah gnädigsten Generalien nicht mehr statt finden und (?) auch zwischen Eigenlöhnern und Gesellen keinen besonderen Unterschied mehr haben dürfte. 10. Ob die Hammerherren in Ansehung ihres Bergbaus... für Eigenlöhner gehalten werden. Da dieselben nach demjenigen, was wir unterthänig angeführet ad Paragr. 1. nicht so, wie die armen Bergleute, ihre eigenhändige Arbeit treiben können und wollen, ad Paragr. 5. durch andere Bergleute, welche sie lohnen, den Bergbau betreiben laßen und deshalb besondere Schichtmeister und Steiger halten, nach Vorschrift der Bergordng. anstellen zu laßen müßen sich in der berggesetzlichen Obliegenheit befinden, weil sie diejenigen nicht selbst unter sich befolgen können, was der 36. Articul Churf. Bergordnung auf gewiße Weise 2, 3 bis höchstens 4 Gewerken nachläßt. Ad Paragr. 7 dasjenige, was in Absicht ihrer Fabriken wegen Lohnung der Arbeiter ihnen gnädigst nachgelaßen, von keinen weiteren Folgen wider die Churf. Bergordn. seyn kann. Zumehr ihre Eisenstein Zechen meist so beschaffen, daß sie fündig geworden, immer davon ansehnliche Posten Eisenstein quartaliter gefördert, vermeßen und zur Einnahme gebracht und solchem nach nicht bey der Weile betrieben werden, sondern nach gräfl. Hohensteinischen Berg Ordn. Art. 14 bergläufiger Weise nach der Bergordnung gebauet werden und als Gewerken der Churf. Bergordnung nach... darbey aber hat er sich zu bescheiden, daß sich der Bergordnung gemäß verhalte, sonderlich der Bergbeamten Rath in Ansehung nützlicher Gebäude willig annehme, verhalten. 11. Ob und was für Vorzüge den Eigenlöhnern und Gesellen... zustehen. Haben die ad 1. und 3. bemerkten Eigenlöhner 1) keinen besonderen Schichtmeister und Steiger zu halten gehabt, da einem unter ihnen, gemeiniglich der Lehnträger des Gebäudes, die Administration deßelben anvertraut worden, welche obbemeldter Lehnträger, wenn er des Schreibens nicht selbst erfahren, durch einen der Schichtmeister sich die Register fertigen läßet und 2) dabey wohlbesonderer Pflicht nach hoher Verordnung Acta 2115 Fol. 1 wie solche Fol. 6b gnädig approbirt und Fol.7 seqq. abgefordert worden, ablegen müßen, jedoch keine besondere Caution wie andere Schichtmeister zu (?) den Cassen und ferner beystellen dürfen. 3) keine gedruckten, sondern nur geschriebene Register nach richtig gehaltenem Anschnitt, welcher quartaliter auch einmal in der 13. Woche geschehen darf, über die erforderlichen Ausgaben und (?) Bergwerks Gefälle… Zehnden und Lade Gelder, sowohlbescheinigter Einnahme über vermeßenen Eisenstein und Flöße ingl. ausgeschmolzenen Zinn, mit Fortführung des Receßes einzulegen verbunden sind. 4) Ist denenjenigen, welche wie Paragr. 1. bemerkten Eigenlöhnern (?) keine hinlängliche Einnahme gemacht mit den Bergamts Verschreibe und Quatember Geldern, auch anderen Gebühren, zur Erhaltung ihrer Baulust erforderliche Nachsicht gegeben werden. 5) Hat man ihnen auch bey der Defectur und Judification der Register, wenn nicht Haupt Mängel vorgekommen, ihren Bau dabey zu erleichtern (?) ja 6) das Muth- und Bestätigungs Geld öfters erlaßen. 12. Ob ihre Lehnträger und Versorger... verpflichtet werden. Daß solches geschehe, erweisen die ad Paragr. 11 subl. allegirten Bergamts Acten, was... die Obliegenheit solcher Lehnträger in mehrern erfüllen dürfte. 13. Ob ihnen ordentliche Schichtmeister und Steiger zu halten, verstattet sey. Da ad 11. und 12. von denen Eigenlöhnern, welche durch würckliche Handarbeit ihre in Lehn erhaltenen Gebäude und Zechen, wie bemerket, selbst unter sich zu administriren, nachgelaßen ist, so ist bey denen übrigen und Gewerken Zechen, wo die Arbeiter entweder durch den nachgehaltenen Anschnitt ausfallenden und von ihren Schichtmeistern reparirten Betrag oder durch die auf erfolgten öffentlichen Zubuß Anschlag gedruckten und gestempelten Zubuß Zeddeln eingegangenen Zubußen gelohnet worden, Schichtmeister und Steiger zu Erhaltung guter Ordnung umso viel mehr nöthig gehalten worden. 14. Obliegenheit in Ansehung der landesherrl. Gebühren Da ihnen mit der Bestätigung eine Fdgr. Maaßen, Stollns oder anderen nachgelaßnen Lehens nur das dominium utile bekanntermaßen zukommet, und dann dem Dominio directo des Churf. Bergregals folget; daß jeder Lehnträger, er sey aus dem Mittel der mehrmahlen beschriebenen Eigenlöhner, oder aus dem Mittel der Gewerken, welcher in der Persohn des Schichtmeisters für jedes Gebäude eintritt, alle die Abgaben zu entrichten hat, welche durch die Churf. Bergordn. resolutioner und generalia festgesetzet oder durch die Länge der Zeit zur observanz geworden sind, so folget unsere ganz ohnmaßgeblichen Erachten nach soviel daraus, daß ein jeder, welcher sich in im landesherrl. Freyen Lehn von dem Bergmeister reichen läßt, wegen dem commodorum, die er von dem dominum utile nach Beschaffenheit eines ganzen Lehns oder gewißer Theile oder Kuxe daran genießet, eben dadurch zu denen oneribus, welcher davon abfangnen verbunden seyn müße, und außerdem seiner Belehnnung hinwiederum nach Berg Recht verlustig werde. 15. in Ansehung der Geschäfte vor dem Bergamte Alles dasjenige entweder selbst als Lehnträger, oder durch seinen Bevollmächtigten dem Schichtmeister thun müße, was die Churf. Bergordnung, der hierauf begründete weiteren gnädigst befehlenden hohen Oberbergamts und Bergamts Verordnung zum Besten des Grubenbaus und deßen Haushalt erforder? Da im gegentheil das Willkürlilche in die größte Unordnung ausufern würde und mit der Churf. Bergordn. nicht übereinkommen dürfte. 16. in Ansehung der Anweisung deßelben wegen Veranstaltung ihres Grubenbaus verbunden sind. Weil das Berg Amt sowohl auf das landesherrl. als gewerkschftl. Interesse verpflichtet ist und ebendaher nicht zugeben kann, daß ein Raubbau verführet, die Zimmerung und dergl. verwahrloset und durch zu hoch in Anschnitt gebrachte Kosten und dergl. der Recess zum Nachtheil des landesherrl. Zehnden, als der von Gewerken zu gewarteten Höhe der Ausbeuten, wider Gebühr erwerde. Und 17. Wenn sie den Bau ihrer Gruben... durch andere in ihrem Lohn stehende Arbeiter betreiben, ob und in welchem Maße ihnen diese selbst an- und abzulegen verstattet sey? Diese Frage setzet die Bestimmung voraus, daß weil das Berg Amt auf den nutzbahren Bau jeden Gebäudes zu sehen, ob in einem oder dem anderen Quartal die Einnahme des Gebäudes, die Ausgabe des Quartals bestreiten laße? Oder die Gewerken durch einen gewißen Beytrag die Kosten darzu aufbringen müßen? Sobald eine Abänderung hierbey nothwendig wird und zwar in dem letztern Fall vorzüglich, muß der Schichtmeister mit seinen Gewerken, besonders bey Eisenstein Gruben, ihre Entschließung dem Bergamte gehörig eröffnen, auf welche Maße die Gewerken nach ihren Kräften die Zubuß Beyträge geben wollen. Weil niemand über Vermögen als Gewerke besonders, zu zwingen. Macht nun diese Erklärung eine Ablegung der Arbeiter nöthig? So ist der Schichtmeister verbunden, jedesmal ein Verzeichnis des gantzen Personales dem Bergamte vorzulegen, hierbey nebst denen Steigern zu eröffnen, welche von denen Bergarbeitern am brauchbarsten und welche aus privat Umständen einer besonderen Mitleidenheit verdiente, worauf, wenn seitens des Bergamtes keine Nebenabsichten bey dem Schichtmeister und Steiger entdeckt werden, solche Arbeiter zum ablegen (?) und sodann der Grubenbau nach bestem Wißen und Gewißen mit denen Vorstehern veranstaltet, dahingegen bey der Anlegung einiger Mannschafft, wenn solche nur von einem oder zwey Mann gewesen sind, solche durch die Vorsteher mit ihren Kundschafften, wie dem Bergmeister und Geschworenen vorstellig gemachet und wenn sich nichts bedenkliches dabey gefunden, anzulegen nachgelaßen worden. In Ansehung der andern eingangs gedachten Frage, 18. Ob die Gewerken die An- und Ablegung ihrer Arbeiter bisher willkürlich verstattet worden oder nicht? So ist durch die nur vorangeführte Erläuterung des sub. No. 17 bemerkten P. auch diese Frage, mit Übereinstimmung des 9. Paragraphen der allergnädigsten Berg Resolution vom 7. Jan. 1709, denen Gewerken überhaupt nicht die An- und Ablegung der Arbeiter verstattet, weil kein Steiger ohne Vorwißen und Einwilligung, der Schichtmeister auch, nach Beschaffenheit des Bergamts Arbeiter an- und abzulegen Macht hat, noch auch das Bergamt nach demjenigen, was ad. 17. in der Erläuterung zu bemerken gewesen, ohne Communication mit den Gewerken oder denen Vorstehern die Gruben mit Anlegung mehrer Persohnen als nöthig jemals beschwert hat. (...) Woher wir ganz ohnvorschreiblich dafür halten; daß es nach angeführten und beschriebenen Verhältnißen bey diese Verfassung gemeltet zu laßen seyn dürfte, damit derjenige, was das dominum directum in der Churf. Bergragali verlanget, zum Besten des Domini utilis, ebenfalls beobachtet und zwar nützlichen Ausführung weiter erhalten werden möge! Wir stellen solches jedoch allen höheren Ermeßen pflichtschuldig anheim und kommen, was uns desfalls anbefohlen werden wird, etwa so unterthänigst und gehorsamst nach. Johanngeorgenstadt mit Schwarzenberg, am 24. Martii 1789, Das Bergamt allda.“ Beide Quellen nennen wie von alters her die Maximalzahl von acht Teilhabern als ein wesentliches Kriterium für eine eigenlehnerweise betriebene Grube. Während man aber in Annaberg und Scheibenberg zunächst einmal jede neu (oder wieder) aufgenommene Grube als Eigenlehnergebäude behandelte, bis ein erster Anschnitt und Aufstand vorgelegt wurde, in welchem sich die Teilhaber ggf. auf eine andere Betriebsform ‒ also eine Gewerkschaft ‒ vereinbart haben, blieb es dabei. In Johanngeorgenstadt dagegen stellte man die eigene Arbeit auf der Grube in der Antwort auf Frage 1 voran. Das ist eigentlich wie heute: Jeder Landkreis hat für jedes Bundesgesetz seine eigene Durchführungsverordnung...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf diese Berichte
hin hatte man in Freiberg wieder einige Jahre später dann einen Entwurf für ein ,Regulativ'
für den Eigenlehnerbergbau erarbeitet, welchen man 1798 mit erneuter
Aufforderung zur Stellungnahme an alle Bergämter versandte (40007,
Nr. 363):
„Nachdem wir in Erwaegung der von sämtlichen Berg Aemtern auf unser untern 7ten Octbr. 1796 erlaßne Verordnung erstatteten Anzeigen über die besonderen Gerechtsame und Obliegenheiten der Eigenlöhner der Nothdurft zu sein, befunden, höchsten Orts auf die Erlaßung eines besonderen Regulativs über diesen Gegenstand zu einer allgemeinen Vorschrift anzutragen, auch hierzu allbereits angeschloßne Punctation entworfen haben, woher aber die Berg Aemter mit ihren etwa habenden gutachterlichen Erinnerungen darüber zu hören gesinnt sind, so wird Ober Berg Amts wegen an sämtliche hierauf verzeichnete Berg Aemter hierdurch arrondirt, angeregte Punctation in Erwägung zu nehmen und ob? auch was dieselben zweckmäßig dabey zu erinnern haben mögten? Binnen vier Wochen a dato gutachterlich bey uns anzuzeigen. Freyberg, den 16. Januar 1798 Sr. Churf. Durchlaucht zu Sachsen verordnetes Ober Bergamt“ Das Schreiben unterzeichneten diesmal die Herren Charpentier, von Schirnding, Freyherr von Gutschmidt, Bergrat Carl Wilhelm von Oppel (*1767, †1833), sowie Abraham Gottlob Werner (*1749, †1817).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anlage dazu bildete
der folgende Entwurf einer:
Punctation zu einem Regulativ über die Gerechtsame und Obliegenheiten der Eigenlöhner und Gesellen in sämtlichen Berg Amts Revieren exclusive Freyberg. §1. „Die im Gegenbuch eingetragenen Theilhaber eines Berg Gebäudes, deren Anzahl aus 1 bis höchstens acht Personen besteht, sie mögen gleiche oder ungleiche Theile haben, sind sie für Eigenlöhner zu erachten und werden, wenn es Bergleute sind, dem Sprachgebrauch nach auch Gesellen genannt.“ §2. „Diesen bleibt nachgelaßen, ihre Zeche durch einen aus ihrer Mitte oder durch eine andere Person administriren und die Rechnung führen zu laßen. Diese von ihnen einstimmig oder per plurima nach der Kux Anzahl zu erwählende Person ist jedoch von selbigen dem Bergamte zur Verpflichtung zu präsentiren und von diesem in der Qualität eines Schichtmeisters Versorgers, da ferner wieder deßen Tüchtigkeit etwas erheblilches nicht zu erinnern ist in Pflicht zu nehmen, hierzu aber den Steiger einer Gewerken Zeche zur Vermeidung alles Verdachts wegen Vermischung und Entwendung der Producte das Gezähes und übriger Berg Materialien nicht zu zu laßen. So lange noch kein Schichtmeister Versorger, worzu jedoch das Bergamt die Eigenlöhner und Gesellen anzuhalten hat, angestellt und verpflichtet werden, vertritt der Lehnträger deßen Stelle mit aller Befugniß und Obliegenheit derselben. §3. Sämtliche Eigenlehner und Gesellen haben nach diesen ihren Administrator prorale ihrer an der Zeche habenden Antheile zu ihrer und kann dahero ehe und bevor das Berggebäude nicht zu Überschußvertheilung gelangt, mit deßen Cautions (Gestellung?) so lange nachgelaßen werden, bis die Eigenlehner nicht selbst darum anzusuchen oder das Bergamt solches zur Sicherstellung des höchsten Landesherrlichen Interesses vorwaltende besondere Umstände noch für nothwendig findet. §4. Stehet den Eignelöhnern und Gesellen die zum Betrieb ihres Berggebäudes von Quartal zu Quartal erforderlichen Kosten durch bloße Verabredung und Übereinkunft unter sich (wobei die Mehrheit der Kuxe ebenfalls entscheidet) einzubringen haben nun dießelben diesen Kostenbeytrag unter sich festgesetzt, so hat der Schichtmeister Versorger an dem nehmlichen Tage, an welchem in jedem Berg Amtsrevier die gewöhnliche Zubuß Anschlag erfolgt, solche im Berg Amte durch Einreichung eines unter seinem Nahmen ausgestellten Zeddels, auf welchem das Berggebäude das Quartal und der auf jeden Kux festgesetzte Kostenbeytrag bemerkt ist, anzumelden. Jeden Eigenlöhner und Gesellen ist nachgelaßen, sich zu eben dieser Zeit im Berg Amte mit einzufinden, und dieser Anmeldung mit beyzuwohnen, auch wenn er Erinnerungen darwider zu machen hat, bey solchem vorzubringen, In diesem Fall hat das Berg Amt sämtliche Eigenlöhner und Gesellen an einem der nächsten Berg Amts Tage vor sich zu erfordern und selbige hierüber durch richterliche Intervention zu vergleichen oder die Entrichtung des Kostenbeytrages nach Mehrheit der von selbigen nach Anzahl der Kuxtheile zu colligiren. den Stimmen festzusetzen. Diesen solchergestalt bestimmten oder von den Schichtmeister Versorger im Berg Amte bloß angemeldeten Kostenbeytrag sind sämtliche Eigenlöhner abzuentrichten schuldig und findet darüber ex nost dawider keine Erinnerung statt, weil sie ihren Administrator zu vertrauten und ihre Erinnerung tempestive vorzubringen unterlaßen haben, im Fall hingegen, daß von dem Schichtmeister Versorger von Verabredung und Festsetzung dieses Kostenbeytrages beim Berg Amte zur bestimmten Zeit etwas nicht angemeldet worden, so sind die Eigenlehner und Gesellen in selbigem Quartal aufgegangenem und durch das Reviergeschworenen Unterschrift gewißlich erkannten Kosten nach der Kux Anzahl die jeder besitzt, abzustatten.“ §5. „Der Schichtmeister Versorger hat jeden Eigenlöhner und Gesellen über die erfolgte Bezahlung seines Antheiles zu den Kostenbeyträgen jedesmal gesande schriftliche Quittung zu ertheilen. Würde aber ein Eigenlöhner und Geselle diesen seinen schldigen Beytrag nicht entrichten, so liegt de Schichtmeister Versorger ob, nach Ablauf des Quatals wenn und zu vor das Register beim Berg Amt eingelegt ist, letzteres schriftlich oder mündlich, jedoch mit bestimmter Angabe des schuldigen Beytrages und der Kuxe worauf solcher abzuentrichten, um eine schriftliche Auflage säumigen an Tehilhaber zu imporiren. Das Bergamt hat hier auf letztern in einer dergleichen Auflage binnen 2 mal 14 Tagen aufzuerlegen, und darinnen zugleich einen Tag nach Ablauf dieser Frist festzusezen, an welchem derselbe die Bezahlung durch Production der vom Schichtmeister Versorger hierüber erhaltenen Quittung zu bescheinigen haben, auch solcher die Verwarnung beyzufügen, daß er im unterbleibenden Falle seiner Kuxe verlustig seyn solle. Da ferner nun die geschehene Bezahlung an dem festgesetzten Tage nicht bescheiniget und der Schichtmeister Versorger um die Vollstreckung des Retardats ansucht, als worüber das erforderliche per registraturam ad acta zu bemerken, so hat das Berg Amt an das Gegenbuch Verordnung zu caducirung dieser Kuxe, die solchergestalt eben so wie bei Gewerken Zechen ins Retardat verfallen, ergehen zu laßen. Die hierdurch erwachsenden Kosten werden in diesem Fall im Register als Ausgabe verschrieben, gegentheils aber von dem Theilhaber, wenn er zum Eigenthums Recht durch die Bezahlung satuirt, getragen.“ §6. „Die von den Eigenlöhnern und Gesellen abzustattenden Kostenbeyträge werden nach Anlastung des von Gegenschreiber auszustellenden und zum Register zu bringenden Gewerken Verzeichnißes unter eben den Lohnungen, wie bei Gewerken Zechen, als Einnahme verrechnet, keineswegs aber diesen selbige unter den Grubenschulden in Ansatz gebracht werden.“ §7. „Auf Eigenlöhner Zechen, wo die Gesellen selbst arbeiten, haben dießelben quartaliter nur einmal, wenn aber selbige mit besondern Arbeitern belegt ist, quartaliter zweimal und wenn das Gebäude sich frei verbauet oder Überschuß giebt, dreimal anzuschneiden.“ §8. „Bleibt zwar den Eigenlöhnern und Gesellen, so lange sich die Grube nicht frei verbauet oder Überschuß giebt, noch ferner nachgelaßen, statt der gedruckten Register Bogen blos geschriebene, jedoch leserlich und reinlich zu führende Register zu halten und einzulegen. Doch muß in solchen Einnahme und Ausgabe unter den gehörigen und vorgeschriebenen Capitteln ordentlich verrechnet und der Abschluß samt der Aufrechnung sämtlicher Einnahme und Ausgabe, ingleichen die Fürhung des Rezesses schlechterdings nach der Anweisung des gedruckten Registers schematis formirt werden.“ §9. „Die Register der Eigenlöhner und Gesellen Zechen sind zu der nämlichen Zeit, da bei jedem Bergamt die Register Einlage überhaupt festgesetzt ist, ein zu legen, und die Rechnungsführer bei deßen Unterlaßung nicht zum Schmelzen Erzliefrung, Vermessen oder Verwagung ihrer Producte zu zu lassen oder auch nach Befinden durch Strafen darzu anzuhalten.“ §10. „In Ansicht der Aufrechnung und der darbei vorkommenden Verrichtungen haben die Schichtmeister Versorger auf Eigenlehner und Gesellenzechen das nehmliche, was dem Gewerken Schichtmeistern obliegt, zu beobachten. Jedoh sind die dabei (?) werdenden Strafen, wo dergleichen angebracht, bei Eigenlöhner und Gesellenzechen auf die Hälfte zu setzen.“ §11. „Bleibt zwar nachgelaßen, daß die Auslohnung der Arbeiter und (?) auf Eigenlehner und Gesellenzechen, so lage sie sich nicht frei verbauen oder Überschuß geben, von dem Schichtmeister Versorger außerhalb des Amts Haußes bewerkstelligt werde. Es haben aber dießelben sich der Auslohnung mit andern als conventions mäßigen Münzsorten, ingleichen mit Victualien und Waaren schlechterdings zu enthalten. In Ansicht der Auslohnung der Arbeiter auf den von Hammerwerks Besitzern eigenlöhnerweise hat es (im) Johanngerogenstädter und Schwarzenberger Revier bei dem, was vermöge höchsten Rescripts vom 26ten Julii 1787 angeordnet worden, zur Zeit noch sein Bewenden. §12. Die (Gefälle?) und übrigen Bergamts Gebühren auf Eigenlehner und Gesellen Zechen sind in der Maaße ferner abzuentrichten, wie sie in jeder Bergamtsrevier bis itzo hergebracht sind. §13. Von den bei Eigenlehner und Gesellen Zechen ausfallenden Überschuß sind zuvörderst und ehe die Theilhaber davon etwas an sich nehmen dürfen, die vorhandenen Grubenschulden abzuzahlen und bei deren abschläglicher Bezahlung zur erforderlichen Distribution zuvor bergamtliche Genehmigung zu suchen. Der nach Abstoßung der wirklichen Grubenschulden verbleibende Überschuß hingegen kann auf vorher davon beschehene Anmeldung zum Bergamte nach Ablauf des Quartals unter den Eigenlöhnern und Gesellen gegen deren zum Register zu bringende Quittung verabfolget werden. §14. Wenn eine Eigenlöhner Zeche nicht mit besonderen Bergarbeitern belegt ist, sondern die Arbeit von den gesellen selbst verrichtet wird, so ist diesen nachgelassen, gegen Verschreibungen der Hälfte des gewöhnlichen Wochenlohns ihre Berggebäude durch Weilarbeit mit 4 Stunden des Tages vor- oder nachmittags zu belegen. Außerdem haben Eigenlöhner ihre Berggebäude nach Vorschrift der Bergordnung der anno 1589 art. 23 bauhaft zu erhalten, und ist denenselben hierunter keine Frist und Nachsicht weiter als inhalts des 32. Art. gedachter Bergordnung zu ertheilen. §15. Die Veranstaltung des Grubenbaus auf Eigenlehner und Gesellenzechen bleibt zwar der Einsicht und dem Ermeßen des Berg Amtes, das aber hierbey auf die statthaften Vorschläge der Theilhaber Rücksicht zu nehmen hat und bey hierüber entstehenden Differenzen den Entscheid und Anordnung des Ober Berg Amtes ferner überlaßen. Es haben aber die Berg Aemter in Ansicht des stärkeren oder schwächeren Betriebes eines dergleichen Gebäudes die Belegung nach den von den Eigenlöhnern und Gesellen in dem Quartal verwillilgten Kostenbeyträgen und nach dem von selbigen angezeigten Bedürfniß der benöthigten Bergwerks Producte zu veranstalten. §16. Was hingegen die Auswahl der Arbeiter bei vorfallender An- und Ablegung derselben beläuft; so hängt solche lediglich von der Erlaubniß und der Anordnung des Berg Amts ab, welches aber gleichwohl darbei auf Vorschläge und Erinnerungen der Eigenlöhner oder dem Vorsteher, so weit thunlich, Rücksicht zu nehmen, nicht weniger auf solchen Eigenlöhner Gebäuden, die von Hammerwerks Besitzern, wenn sie zur Bergarbeit geschickt und tauglich sind, und deßhalb nicht die Ablegung eines wirklichen Bergarbeiters nothwendig wird, darauf anzulegen hat, wie wohl auch selbige bey nothwendig werdender Veränderung der Mannschaft erst und vor anderen wirklichen Berg Arbeitern wieder abzulegen sind; gehalten auch bei denen von Siedewerkern auf einige Zeit feirich werdenden Arbeitern, wenn deren Anlegung auf den den nähmlichen Besitzern zugehörigen Kiesgruben gesucht wird, unter den nähmlichen Bedingungen ein gleiches statt haben soll.“ §17. „Würde ein Eigenlöhner und Geselle seine Kuxe ganz oder zum Theil an einen andern in dem Revier einheimischen Gewerken veräußern und sich dießerhalb beim gegenbuch melden, so hat der Gegenschreiber die ZUgewährung nach Maasgebung des in der allergnädiigsten Bergresolution de anno 1709 §20 enthaltenen Disposition nicht zu hindern, iedoch sobald dadurch die anzahl der Theilhaber einer Zeche über 8 steigt, solches beim Berg Amte zu melden, damit daßelbe weil nunmehr der Eigenlöhner (?) aufhört, die nöthige Verfügung treffen könne. Würde hingegen ein Eigenlöhner oder Geselle oder selbige insgesamt einander mehrere Kuxe an fremde Personen bringen, oder selbige ihrer ganzen Zeche vergewerken wollen, so hat der Gegenschreiber die Zugewährung anderer Gestalt nicht, als gegen Beibringung des Loco citato vorgeschriebenen Aufstandes und samt erlangter bergamtlicher Conceßion zu bewerkstelligen. Nach erfolgter Vergewerkschaftung des Gebäudes hat das Bergamt mit Anstellung eines ordentlichen Schichtmeisters zu verfahren, jedoch bleibt darbei nachgelaßen, den Schichtmeister Versorger, der das Gebäude zeither administriret hat, wenn wider deßen Person und Geschicklichkeit nichts zu erinnern, denen Gewerken in der zu erlaßenden Puncte mit in Vorschlag zu bringen.“ §18. „Endlich ist den Eigenlöhnern und unverwehrt in Ansicht der wechselseitigen gerechtsamen Obliegenheiten und Verbindlichkeiten gegen einander durch besondere Vorträge eines oder des anderen noch besonders festlich zu setzen. Jedoch hat ein dergleichen Vertrag anderer Gestalt keine Gültigkeit, als wenn sie sämtliche Theilhaber einstimmig (inmaßen in diesm Fall die Pluralität nichts bewirkt) in Person oder durch hinlänglich legitimirte gevollmächtigte vom Berg Amte dazu bekannt, solcher von denenselben bestätigt und ins Bergbuch eingetragen worden. Letztres hat solchenfalls eine beglaubte Abschrift zum Gegenbuch abzugeben und der Gegenschreiber bei denen hierauf erfolgende Zugewährung deßen in dem Gewährschein und daß der neue Eigenlöhner oder Geselle hiernach verbindlich sey, zu verwahren. Die Verbindlichkeit eines dergleichen Vortrags besteht jedoch nur so lange, als die Zeche eigenlöhnerweise betrieben wird. Auch ist den Eigenlöhnern und Gesellen nicht gestattet, dem etwas zu inseriren, was den Berggesetzen überhaupt und diesen ihnen zustehenden Gerechtsamen und Obliegenheiten insbesondere entgegen läuft und eine mehre Ausdehnung der ersten oder Verringerung der letztern in sich begreift.“ §19. „Inmaßen in allen anderen hier nicht ausdrücklich bestimmten Fällen Eigenlehner und Gesellen mit denen Gewerken durchgängig gleiche Befugniße und Obliegenheiten haben.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was hatten die Bergämter dazu
anzumerken: Aus Annaberg mit Scheibenberg kam (vermutlich schon auf eine
erste Aufforderung hin, denn das Schreiben ist auf den 17. März 1792
datiert) die folgende Antwort nach Freiberg (40007, Nr. 363):
Gehorsamste Anzeige vom 17.März 1792 „(...) Wie wir nun dieße Punctuation möglichst genau durchgangen und solche mit den zeither beym Eigenlehner Bergbau vorgekommenen Fällen statt gefundenen Observanzen verglichen haben; als haben wir dabey folgende ohnmaßgebliche Vorschläge zu thun und der Prüfung eines höchlich Oberbergamtes zu unterwerfen, uns bewogen gefunden. ad.1 dürfte die Anzahl der am Betrieb einer Eigenlehnerzeche Antheil nehmenden Personen deshalb stärcker anzunehmen und bis auf 16 Individua zu bestimmen seyn, weil die Aufbringung des Kostenbedürfniß leichter wird, je größer die Anzahl der Theilhabenr ist. (…) ad.4 wollen wir (?) dabey angetragen haben, daß bey den Zwitter, Eisenstein und Flößzechen die Regulirung des individuellen Kostenbeytrages allemal acht Tage nach erfolgtem Zinnschmelzen oder Vermeßen, bey anderen Gruben hingegen, als Kobald oder Silberzechen (?) in No. 4. Woche des folgenden Quartals vorgenommen werde, denn die (?) Zwitter auch Eisenstein und Flößzehen laßen sich immer bis zum nächsten Schmelzen oder Vermeßen mit Brod, Materialien, auch wohl Geld von Hammerwerksbesitzern, oder anders verlegen und bringen nur denjenigen Theil ihres Aufwandes, der durch die Producten Bezahlung nicht getilgt worden, (erst dann in Anrechnung?) wenn man Gewißheit erlangt hat, durch individuelle Kostenbeyträge unter sich auf. (…) Da hiernächst ad Pct. 5 bey Gewerkenzechen die auf Retardat Verfahren wider einen säumigen Gewerken verwendeten Kosten in jedem Fall (berichtigen?) nur seine Zubuße nicht, im Register verschreiben und folgl. von der ganzen Gewerkschaft gemeinschaftl. getragen werden, so kommen wir des ohnmaßgeblichen Dafürhaltens, daß auch bey Eigenlehner Zechen gedachte Kosten wenigstens das erstemal, als nach Vorschrift des $5. gedachthen Regulativs wider einen (?) verfahren werden muß, um so mehr nicht gefordert, sondern wie bey Gewerkenzechen im Register verschrieben werden. (...) Wie uns nun bey dem übrigen Inhalt der eingangs gedachten Punctation einige Veranlaßung zu mehren Bemerkungen und Vorschlägen nicht vorgekommen ist; (…) mit gebührender Submission (...) allstets beharrend Das Bergamt allhier.“ Etwas andere Schwerpunkte setzte man wieder im Bergamt zu Johanngeorgenstadt (40012, Nr. 1179, Blatt 3ff): Unterthänigster gehorsamster Berichts Vortrag „Bey der von Eu. Churfürstl. Hochlöbl. Oberbergamt wegen der besonderen Gerechtsame und Obliegenheiten der Eigenlehner entworfenen Punctuation zu einem höchsten Orts festzusetzenden Regulativ hätte wir nach der hohen Genrali vom 16. Jan. ob? Auch was wir zweckmäßiges dabey zu erinnern haben möchten? (..) nichts weiter ehrerbietigst zu bemerken, als daß Bey dem 11. Punct, in Absicht des den Arbeitern besonders auf denen Zechen, welche von Hammerwerksbesitzern eigenlehnerweise gebaut werden, zur Bestimmung des Lohns dabey nicht gedacht werden möchte, wie Anordnung des Lohns für jeden Arbeiter nach deßen Fleiß, Geschicklichkeit und übrigen guten Betragen, auch des Zeugnisses der Grubenvorsteher, vom Bergamt lediglich und allein gesetzt werden soll... Johanngeorgenstadt mit Schwarzenberg, den 28. Febr. 1793 Das Bergamt“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus den 1830er Jahren (er ist als
Entwurf undatiert, die Stellungnahme des Bergamtes Altenberg datiert aber
auf den 27. August 1832, die des Bergamtes Annaberg erst auf den 28. Mai
1833) stammt ein weiterer
Entwurf für allgemeine Regelungen zum Eigenlehnerbergbau. Diese ,General
Anweisung, nach welcher die bauenden Eigenlehner in sämmtlichen Berg Amts
Refieren sich zu achten haben' haben wir in Abschrift sowohl in den Akten des
Bergamtes Annaberg, als auch in denjenigen des Bergamtes Altenberg
gefunden (40007, Nr. 363 und 40006, Nr. 1879) und sie hat sage und
schreibe bereits 116 Paragraphen. Die deutsche Bürokratie läßt
grüßen... Und wir verzichten darauf, den Volltext dieser Generalanweisung
des Oberbergamtes hier zu zitieren, zumal wir nicht wissen, ob sie jemals
in Kraft gesetzt worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weil es offenbar bis dahin immer noch keine verbindliche Verordnung gegeben hat, richteten die Besitzer der erzgebirgischen Hammerwerke
am 10. März 1834 ein Gesuch direkt an das königlich- sächsische
Finanzministerium (40012, Nr. 1179). Schauen wir einmal, was den ‒ in den oben
zitierten Fragebögen schon immer gesondert benannten ‒ Hammerherren noch immer
auf der Seele lag:
Unterthänigstes Gesuch (...) wegen Entwerfung eines zeit- und sachgemäßen Regulativs in Beziehung auf den Eisenstein Bergbau und Auslohnung der Bergarbeiter, mit verbundener Beschwerde gegen das Bergamt Johanngeorgenstadt „Jedes Gesetz, jede Anstalt trägt das Gepräge der Zeit, in welcher jenes emanirt und diese errichtet wurde, an sich und muß dieses tragen, ja die eigenthümlichen Verhältnisse, die Erfordernisse, welche sich dabey herausstellen, sind jedesmal von der Zeit bedingt. Dieser im Allgemeinen richtig stehende Satz leidet besondere Beziehung auf unser vaterländisches Eisenhüttenwesen und den damit in Verbindung stehenden Eisensteinbergbau. Je mehr notorisch das Eisenfabrikwesen seit Jahren durch mannigfache unglückliche Verhältnisse ganz tief herabgesunken ist, wofür als sprechendster und untrüglichster Beweis die Überschuldung der Eisenhüttenwerke und der Umstand, daß zeither mehrere derselben ad kastam gebracht und in der Regel unter dem halben Taxwerth verkauft wurden, gelten muß, um so mehr bedingt es nicht nur unser eigenes, sondern vorzüglich auch das Interesse des Staats, alles zu ergreifen, was, wenn auch nicht den frühern Flor, daß das Fortbestehen eines so wichtigen Gewerbzweiges, der Tausende in unserem armen Gebürge Brod giebt, ferner möglich machen kann. Wenn nun unter die drückendsten und nachtheilgsten Verhältnisse, unter welchen wir als Hammerwerksbesitzer seufzen die durch ältere bergrechtliche und convinirte, den jetzigen Zeiten und Verhältnissen gar nicht mehr angemessenen, gesetzlichen Verordnungen eingeführte drückende Beschränkung des Willensfreyheit bey Betreibung des Eisensteinbergbaus und die von den Bergämtern, besonders dem Bergamt Johanngeorgenstadt, hierüber gemißbrauchte Strenge gehört, so nahen wir uns vertrauungsvoll der höchsten Behörde, unterthänigst bittend: um ein festes Regulativ in Beziehung auf unseren Eigenlöhner- Eisensteinbergbau, welches den jetzigen Zeit- und Commercial- Verhältnissen angemessen ist, und die Bergämter in die Schranken einer blos berathenden Behörde zurück weist, nicht aber die Freyheit in der Benutzung unseres Eigenthums wider alle Grundsätze des natürlichen und allgemeinen bürgerlichen Rechts zu unserem offenbaren Nachtheil beschränkt, und stellen in dieser Beziehung folgendes unterthänigst vor: 1tens. Das Bergamt Johanngeorgenstadt maaßt sich privative die Anlegung und Ablegung der auf unseren Eisensteingruben für unsere Rechnung arbeitenden Bergleute an. Dies mag wohl bey fiscalischen oder gewerkschaftlichen anderem Bergbau, wo die Gewerken gestreut, entfernt und oft in mehrerer Herren Ländern wohnen, eine sachgemäße Einrichtung seyn, allein bey uns, die wir in der Nähe unserer Gruben wohnen, deren eigener Vortheil eine zweckmäßige und gute Einrichtung der uns zugehörigen Eisensteingruben bedingt und die eine auch auf Anstellung solcher Grubenvorsteher Bedacht nehmen, die bevorzugte Kenntniß des Eisensteinbergbaus besitzen, ist eine solche bergamtliche Einmischung nicht an ihrem Platz und sogar nachtheilig und dann umso mehr, wenn wir uns des besondere Wohlwollens des Bergmeisters nicht zu erfreuen haben, was leider von dem Herrn Bergmeister Fischer zu Johanngeorgenstadt gilt, worüber wir uns weiter unten näher auszusprechen werden. Wer aber kann wohl ein stärkeres Interesse für die zweckmäßige Betreibung des Eisensteinbergbaus haben, als wir ? Unser ganzes Fabrikwesen ist damit in zu inniger Verbindung, als daß nicht das Eine durch das Andere bedingt würde und nur zweckmäßige Anlegung der Arbeiter ein günstiges Resultat erzielen kann. Will uns nun der Bergmeister nicht wohl, so kann er uns bey der jetzigen Verfassung dadurch schaden und beeinträchtigen: a) daß er entweder auf unseren Eisensteingruben weit entfernte Bergleute anlegt, welche in der Regel später und schon ermüdet zur Schicht kommen, oder b) schon höher gelehrte Leute den Gruben dadurch aufzudringen sucht, daß er andere, die um geringeren Lohn dasselbe leisten, die Bergarbeit verweigert, oder c) daß er nicht fähigen Arbeitern den Lohn beschert und fähigen Arbeitern solches verweigert, oder wohl gar kürzen will, was besonders sub a) und b) der Bergmeister Fischer gethan, wie im Fortgang der unten unterthänigst gebetenen commissarischen Untersuchung sich als wahr darstellen wird. Daher ist es höchste Noth, daß in einem neuen besonderen Regulativ wir berechtigt werden, unsere Bergleute und Grubenvorsteher selbst an- und abzulegen, indem dies von uns mit mehr Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt und Umsicht geschehen wird, als vom Bergamt. Gerne bescheiden wir uns übrigens daß die bergamtliche Behörde, weil der Staat allerdings Interesse bey dem richtigen Betrieb unseres Eisensteinbergbaus hat, solchen beaufsichtige und eingreife, wenn wir zweckwidrig handeln, allein weiter kann es nicht gehen, wenn wir nicht leiden sollen, und der Umstand, daß unser eigenes Interesse bey der Sache das des Staates so sehr überwiegt, bürgt dafür, daß wir die An- und Ablegung der Bergleute und deren Vorsteher eben so gut besorgen werden, wie das Bergamt und mit Dank werden wir dabey und bey dem Betrieb des Eisenstein Bergbaus das Bergamt in bedenklichen Fällen immer noch als berathende Behörde anerkennen. Nur mußte uns die zeitherige Strenge, mit offenbarer Animosität diesfalls über uns angewandte Ober Vormundschaft des Bergamts Johanngeorgenstadt verletzen. Daß die Beurtheilung des practischen Bergbaus, wie bereits gedacht, gar keine solche über alle Begriffe anderer einsichtsvoller Männer gehende Wissenschaft ist, darüber würde sich in unserer vaterländischen Ständeversammlung, als man aus diesem Gesichtspuncte die Beybehaltung des zeitherigen Bergamts Gerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange zu rechtfertigen versuchte, so kräftig umfassend und erschöpfend ausgesprochen, daß es überflüssig wäre, hierüber gegenwärtig noch ein Wort zu sagen. 2tens. Ein zweiter wichtiger Gegenstand eines künftigen neuen Regulativs in Beziehung auf den Eisensteinbergbau der Hammerwerksbesitzer ist die Lohnbestimmung für die Bergleute. Auch diese maaßte sich das Bergamt zeither privative und ohne Zustimmung der Gewerken an. Mag nun dies auch bey jedem Bergbau anderer Art gelten, auf unseren Eisensteinbergbau paßt es nicht. Unser Eisenfabrikwesen ist rein mercantilisch und der Eisensteinbergbau steht damit in engster Verbindung. Bey edleren Erzen, besonders bey Silber, wird eine Ausbeute gewonnen, die immer ihren positiven feststehenden Werth hat, und nicht von dem Steigen und Fallen der commerciellen Verhältnisse und Conjuncturen abhängig ist, nicht so bey Eisensteingruben. Der Werth des Eisensteins hängt von dem glücklichen Absatz der Eisenfabricate ab ‒ verringert sich deren Preis, vermindert sich deren Absatz, so kömmt der Hammerwerksbesitzer in dieselbe Verlegenheit, wie jeder andere Fabricant auf möglichste Ersparniß bey der Production und Fabrication Bedacht zu nehmen, und muß ihm, wie jedem anderen Fabricant, verstattet seyn, wenn er eben so tüchtige Arbeiter für billigeren Lohn erhalten kann, an die Stelle der ersteren, wenn diese für ein billigeres Lohn nicht arbeiten wollen, andere, die billiger arbeiten, zu nehmen. Es kann kein Grund vorhanden seyn, einen Unterschied zwischen Hammerwerksbesitzern und andern Fabricanten zu machen. Einer wie der andere hängt von commerciellen Verhäältnissen ab; einer wie der andere muß wagen, auf Credit zu geben und einer wie der andere ist Herr seines Geschäfts. (...) Zwar wird die bergamtliche Behörde dagegen das alte Lied anstimmen, der Bergmann könne, wenn die Lohnbestimmung lediglich von uns abhängig gemacht werde, gedrückt werden ‒ er erhalte ohnehin einen nur geringen Lohn ‒ sein gefährlicher Beruf bedinge in dieser Beziehung eine Bevorzugung vor anderen Arbeitern und es werde sich unter anderen Verhältnissen niemand mehr diesem Berufsstand anschließen, allein darauf repliciren wir eventuell, es wäre sehr engherzig und ein solches gravamen de futuro entgegen zu stellen und zu fürchten, daß wir unsere Bergarbeiter, wenn die Lohnbestimmung von uns abhängig wäre, schnöderen Gewinns halber drücken würden. Und daß dieser Fall nicht eintreten dürfte, dafür steht wohl kein sprechenderer Beweis ein, als die Thatsache, daß die Hammerwerksbesitzer in Theuerungs Jahren ihre Bergarbeiter mit großer Aufopferung ganz uneigennützig unterstützt und theilweise nicht abgelegt haben, wo ein eingeschränkter Betrieb ihres Fabrikwesens ihren Interessen besonders angemessen gewesen wäre, welche Thatsache sich bex einer näheren commissarischen unpartheyischen Prüfung als völlig wahr darstellen würde. Wer übrigens behauptet, der Bergmann habe ohnehin einen geringeren Lohn, welcher mit seiner Arbeit in Mißverhältniß stehe, der irrt sich sehr oder ist mit den Löhnen nicht vertraut (...). Allerdings verdienen unsere Eisensteinbergleute vom 14jährigen Bergjungen an bis zum 70jährigen Häuer für eine Schicht täglich mehr nicht, als circa 2 gr. 4 pf. bis 4½ gr. in Pr. Cour. Dies scheint wenig, wenn man erwägt, daß es in der Bergordnung de anno 1589 heißt: Der Häuer solle 8 Stunden oder 1 Schicht auf dem Gestein arbeiten. Da jedoch der Bergmann in der Regel nur 4½ höchstens 5 Stunden (...) auf dem Gestein arbeitet, so hat er gewiß einen schönen Lohn, dessen sich bey uns ein Maurer oder Zimmermeister, der dem Bergmann, weil dieser das ganze Jahr Arbeit hat, (...) und jener im Winter verdienstlos ist, nicht erfreuen kann. Es ist nehmlich bekannte Thatsache, daß es fast ohne Ausnahme mit der 8stündigen Schicht, (...) also gehalten wird, der Bergmann kommt früh 4 Uhr, meistens auch später, auf der Grube an. Ist der letzte Arbeiter da und das ganze Personale versammelt, so wir im Huth- oder Zechenhause eine Stunde mit Beten, bisweilen auch Schlafen zugebracht. Um 5 Uhr soll die Einfahrt geschehen. Vom Steiger wird nun die Arbeit angeordnet, dann eingefahren und oft vor 6 Uhr gar nicht gearbeitet. Von 8 bis ½9 Uhr auch wohl bis 9 Uhr ist sogenannte Aufsetzstunde zum Brodessen, halb 12 Uhr wird ausgefahren und precise 12 Uhr geht der Bergmann nach Hause. Folglich kann von einem geringen Lohn der Bergleute keine Rede seyn. Gefährlichkeit des Berufs war wohl in älteren Zeiten vorhanden, wo noch der Bergbau höchst unvorsichtig betrieben wurde. Allein bey dem jetzigen vorsichtigen Leitung und Betreibung des Bergbaus ist der Beruf des Bergmanns nicht mehr, wenigstens nicht mehr gefährlich, als der eines Maurers oder Zimmermanns, und wenn hie und da in unseren Zeiten ein Bergmann verunglückte, war in der Regel Unvorsichtigkeit der Grund. (...)“ An dieser Stelle sei
kurz darauf zurück verwiesen, daß es von alters her und nach sämtlichen früheren
Bestimmungen in den
3tens. „Möchte in einem solchen Regulativ zu bestimmen seyn, daß die Auslohnung der auf unseren Eisensteingruben arbeitenden Bergleute, wie es seit rechtsverwährter Zeit geschehen, in denen bey jedem Fabrikwesen gangbaren Münzsorten und nicht in Conventionsmünzen, sondern nach dem 21 Fl. Fuß erfolgen kann. Ob nehmlich schon von jeher unsere Bergleute früher mit coursirenden Österreichischen, geringhaltigeren Münzsorten und später mit preußischen Courant ausgelohnt wurden, denenselben auch bey Übernehme der Arbeit diese von jeher übliche Art der Auslohnung bekannt war, dieses unter den Augen des Bergamtes geschehen, nie ein Hahn darüber gekräht hat, so ist doch neuerlich eine schriftliche Vorstellung unserer Bergleute am Rothenberge dem Oberbergamte übergeben worden, wegen Verweigerung der ihnen neuerdings zugemutheten und vom Bergmeister Fischer der oberbergamtlichen Verordnung zuwider ihnen abgezwungenen 8 Knappschaftsschichten, worinnen sie unter mehrern Gründen für ihre Weigerung mit anführen, daß sich ihr Lohn ohnehin schon durch die Art der Auslohnung verringere. (...) 4tens. Vor Jahrhunderten erhielten bey Begründung der Hammerwerke deren Besitzer Concessionen zu Anlegung der ihnen noch angehörigen Mahlmühlen. Die Motive war unverkennbar, den Besitzern der Eisenwerke das Auslohnen der Arbeiter (und dahin gehören auch ihre auf Eisensteingruben angelegten Bergleute) mit Brod zu erleichtern und den Verkehr des Eisenabsatzes in entfernte Gegenden, wo Getreidebau florirt, insofern zu erleichtern, als der Fuhrmann durch Getreide Rückfahrt für die Eisenwerke, in den Stand gesetzt werde, das Eisen in jene Gegenden für eine billigere Fracht zu verfuhren. Und ist es ja auch unstreitige Thatsache, daß seit undenklichen Zeiten die Bergarbeiter der Hammerwerksbesitzer mit Brod, welches man ihnen vorschußweise gab, unter den Augen des Bergamtes ausgelohnt wurden. Neuerlich will uns das Bergamt Johanngeorgenstadt wegen des (?) Anführens einiger Bergleute, sie wären mit schlechtem, zu leichten und zu theuren Brod ausgelohnt worden, das fernere Auslohnen mit Brod verbieten. Auch das würde das Sinken unseres Bergbaus zur Folge haben, da es mit der untergelegten Beschwerde dieselbe Bewandtnis hat, wie mit der sub. 3. erwähnten (...). Noch im Jahre 1793 (ist) von der in Beziehung auf das Eisenhüttenwesen höchst verordneten, in den Personen des Herrn Kammerherrn und Berghauptmanns von Heynitz und Herrn Creisamtmann Just zu Schwarzenberg bestandenen hohen Commission, das Auslohnen mit Brod bey dem Eisenhüttenwesen und Eisenstein Berggebäuden nicht nur vorzüglich angemessen befunden worden, sondern die commissarische Erörterung und Bestimmung von 1793 auch die allerhöchste Genehmigung erhalten hat und seit dieser Zeit als gesetzliche Norm für uns bestanden, wonach allerhöchsten Orts fortwährend resolvirt worden ist (...). Wir (haben) aber unseren Bergleuten, deren obgedachte Beschwerde ungegründet war, wie mit dem Auslohnen mit Brod bedrückt, ihnen vielmehr in Theurungsjahren in mehreren Fällen das Brod weit wohlfeiler, als es uns kam, verabreicht, wie auch stets die als Norm festgesetzte Schwarzenberger Brodtaxe zum Anhalten genommen (...) Wenn man sich reiflich die Frage stellt, wie soll ein Bergmann, der ganz arm ist und dessen Verdienst für seine Bedürfnisse zwar ausreicht, aber von Tag zu Tag null für null aufgeht, bey der sich darstellenden Unsicherheit wochenlang bis zum nächsten Lohntag Brod creditiren? Geld kann der Hammerwerksbesitzer nicht immer vorschießen, er muß ja seine Fabricate größtentheils auf 3 bis 6 Monate, oft noch länger bürgen, und würde odft in Verlegenheit kommen, die Bergleute an Lohntagen nicht befriedigen zu können, wenn ihm der Eisensteinabsatz in Getreide- Gegenden, den nur die Getreide- Rückfahrt möglich macht, fehlte (...) 5tens. Der Bergmeister Fischer in Johanngeorgenstadt will die Beschränkungen des gewerkschaftlichen Bergbaus auch auf unseren Eigenlöhner Bergbau übertragen und hat uns schriftlich das Recht als Eigenlöhner abzusprechen gesucht, weil wir nicht mit eigenen Händen die Bergarbeit auf diesen Gruben leisten, nicht berücksichtigend den herrschenden Grundsatz, daß die Eigenthümer einer Grube, wenn ihre Zahl nicht über 8 ist, in die Categorie der Eigenlöhner und deren Berechtigungen gehören, was selbst vor einiger Zeit in unserer Stände Versammlung öffentlich unbestritten behauptet und schon in Köhlers Anleitung zu den Rechten und Verfassungen bey dem Bergbau im Königreich Sachsen, 2. Ausgabe vom Jahr 1824, Seite 240 sub 2. und nota 81 klar ausgesprochen ist. Soll der Bergbau künftig den Interessen der Betheiligten, was jetzt mehr als je nöthig ist, entsprechen, soll eine Aufmunterung zu dessen Betrieb, der für das Erzgebürge höchst wünschenswerth ist, von Erfolg seyn, so müssen dergleichen Versuche, die Unternehmer und ihre Rechte zu beeinträchtigen, nicht statt finden, es muß ein freies, nicht wie bisher gefesseltes Handeln der Betheiligten ins Leben treten...“ Weil dieser Satz eigentlich dem ganzen Sinn der Sache besonders schön Ausdruck verleiht, beenden wir mit ihm auch unser Transkript. Ja, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rang nicht nur Deutschland mit sich selbst um staatliche Einheit; zugleich rang die sich ausbreitende, kapitalistische Produktionsweise mit den althergebrachten Regelungen, namentlich im Bergbau, in dem sich solche noch am längsten hielten. Das Bergamt zu Johanngeorgenstadt seinerseits hielt sich eigentlich nur an die Anweisungen, die in der oben zitierten ,Punctation' enthalten waren (siehe z. B. §11, in dem es um die Art der Auslohnung ging); und die Hammerherren ihrerseits pochten auf das Recht auf ein freies, nur durch die kommerziellen Bedingungen bestimmten Handelns; nicht nur in ihren Fabriken, sondern ebenso im diesen angeschlossenen Bergbau. Ob sie ihr Versprechen, den Lohn ihrer Bergleute nicht zu ,drücken', allerdings tatsächlich eingehalten haben, lassen wir offen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehr interessant ist letztlich noch die Liste
der Unterzeichner dieser Petition ‒ quasi ein ,Who is who' der damaligen
Eisenhammerbesitzer: In der Abschrift finden wir den Pfeilhammer und Großpöhla, damals
im Besitz von Carl Ludwig von Elterlein und Amalie
verw. von Elterlein, das Hammerwerk Mittweida im Besitz von Christiane Concordia
Stolle und Christian Andreas Richter, das zu Erla, welches eigentlich
zu dieser Zeit schon im Besitz von Carl Heinrich Nietzsche gewesen sein
müßte, der aber ist (selbst Bergkommissionsrat) hier nicht genannt, stattdessen Christiane von
Stieglitz und Carl Gotthilf Nestler, das Hammerwerk zu Breitenhof
müßte im Besitz von Hans Heinrich
von Elterlein gewesen sein. Ferner sind die Hammerwerke zu Wittigsthal, Rittersgrün und Schönheide
aufgeführt, als deren Besitzer Friedrich
Gottschald und Carl Edler von Querfurth gezeichnet haben, und
schließlich ‒ allerdings mit dem Zusatz:
„soweit es das Allgemeine betrifft“
‒
noch Herr Lattermann in Morgenröthe- Rautenkranz, C. L. Reichel zu
Unterblauenthal und Gruber & Süßmilch zu Wildenthal.
Ob diese Petition etwas bewirkt hat, wissen wir nicht, denn darüber sagen die Bergamtsakten leider nichts aus. Was wir aber wissen, ist, daß im Jahr 1851 das Gesetz über den Regalbergbau in Kraft getreten ist, welches die schon mehrfach angeführte, bis dahin noch immer gültige Bergordnung von 1589 ablöste; diese Angelegenheit sich endgültig dann aber mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Berggesetzes für das Königreich Sachsen im Jahr 1869 erledigt haben dürfte. Aber zu dieser Zeit ging es mit den Eisenhämmern im Erzgebirge auch schon mehr und mehr bergab...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bis dahin jedenfalls war der ,Eigenlehner' im Grundsatz ein selbstständiger Bergbautreibender, der alleinige Inhaber oder auch der Mitinhaber des Bergbaurechts in einem Bergwerk, welches von ihm auch selbst bebaut und betrieben wurde. Natürlich stand auch der Eigenlehner nicht in einem rechtsleeren Raum, sondern hatte sich wie jeder andere Bergbautreibende auch an die jeweils geltenden Bedingungen und bergrechtlichen Vorschriften zu halten. Hatte er also tatsächlich ein vielleicht nutzbares Vorkommen erschürft, hatte er dies der regionalen Bergbehörde (dem jeweils zuständigen Bergamt) anzuzeigen (zu muten) und wenn der Berggeschworene es besichtigt und für bauwürdig befunden hatte, wurde ihm ein Bergwerksfeld bestimmter Ausdehnung zugesprochen (verliehen), in dem er (und zwar erst nach dieser Bestätigung) dann den Abbau aufnehmen durfte. Allerdings gab es für Eigenlehnergruben tatsächlich einige Vereinfachungen. Diese Eigenlehner arbeiteten entweder allein, oder zusammen mit mehreren Mitgesellen (für die sich in den Verleihungseinträgen ‒ zumindest des Bergamtes Annaberg mit Scheibenberg ‒ dann die Bezeichnungen ,Consorten' oder ,Consortschaft' finden). Im Gegensatz zu einer Gewerkschaft, bei der die Anzahl der Gewerken nur durch die Teilung der Kuxe begrenzt war, war dies gewöhnlich nur eine Handvoll ‒ häufig nur zwei, drei oder vier Personen. Die Eintragung des Bergbaurechtes im Bergbuch erfolgte dabei stets nur auf einen Namen (den des ,Lehnträgers') ‒ quasi des vertretungsbefugten Geschäftsführers dieser Gesellschaft, der auch die Funktion des Grubensteigers ausfüllen mußte. Fast immer waren es auf anderen Gruben angelegte Bergleute, die gewissermaßen in Nebentätigkeit (Weilarbeit) noch eine eigene Eigenlehnergrube betrieben haben, in der Hoffnung, sich dadurch ihr Einkommen aufzubessern. Das konnte eigentlich schon aufgrund ihrer endlichen Arbeitskraft kaum funktionieren. Daher findet man in den Fahrbögen der Geschworenen immer wieder die Bemerkung, sie hätten eine oder mehrere solcher Gruben in der Frühschicht (der Hauptschicht) unbelegt gefunden. Das konnte natürlich auch einfach den Grund haben, daß der Bergmann auf der Grube, auf der er eigentlich angelegt war, gerade die Frühschicht verfuhr und der Weilarbeit nur nachmittags nachgehen konnte. Es konnte aber auch viel trivialere Gründe haben: So liest man etwa im Fahrbogen von Theodor Haupt, Berggeschworener in Scheibenberg ab 1840 (40014, Nr. 321, Film 0094), er habe am 27. Oktober 1842 „die Eigenlöhnergruben im Tännichtwalde befahren, von denen aber die Mehrzahl wegen der Kartoffelernte gegenwärtig nicht in Betrieb gehalten wird.“ Ähnliches hielt der Annaberg'er Rezeßschreiber Lippmann unter dem 18. August 1843 (40014, Nr. 321, Film 0094) fest, an jenem Tage seien „die übrigen Eigenlöhnergruben dieser Gegend... theils wegen Wettermangel nicht zu befahren, theils der eingefallenen Ernte wegen außer Belegung“ gewesen. Der Wettermangel ist hier übrigens ein häufiges Problem gewesen, das namentlich in den Sommermonaten ‒ was natürlich auch wieder nur vorgeschoben sein kann, weil zur gleichen Zeit Arbeit auf dem Feld anstand ‒ die oftmals viel zu kleinen Gruben regelmäßig heimsuchte und ebenso deren niedrigen technischen Stand illustriert. Aber auch Absatzmangel wurde oft als Grund für einen nur schwachen und absetzigen Betrieb herangezogen. Wenigstens der Lehnträger (gab es mehrere Gesellen, dann auch einige von diesen) mußte eigentlich selbst auf dem Bergwerk tätig sein. Auch von dieser Regelung gab es freilich Ausnahmen: Selbstverständlich fuhren etwa adlige Hammerherren nicht selbst auf ihren Gruben an. Wolf Samson von Elterlein oder Bergkommissionsrat Carl Heinrich Nietzsche etwa waren im bergrechtlichen Sinne tatsächlich Eigenlehner, da sie selbst Gruben muteten und betrieben, doch fuhren diese natürlich nicht selbst auf ihren Gruben an, waren also keine ,selbst bauenden' Gesellen. Der Lehnträger durfte stattdessen auch beliebig viele Arbeiter auf seiner Grube in Lohn- bzw. Gedingearbeit anlegen ‒ falls er sich dies halt leisten konnte. Zur Unterscheidung dieser Gruppe von Bergwerksbesitzern vom Eigenlehner wählte Sieber in seinem Manuskript von 1954 den Begriff des ,Alleinbesitzers' einer Grube. Eigentlich hätte eine fündige Grube aber dann vergewerkt werden müssen. Bei Vater Abraham etwa tauchen im Laufe der Geschichte auch Kuxe auf, ohne daß wir aber irgendeine Notiz in den Akten darüber gefunden haben, wann dies geschehen ist. Bei dieser Grube könnte es auch mit dem Verkauf des Obermittweida'er Hammerwerks in Zusammenhang stehen, wobei der Besitz an der Grube irgendwie fixiert werden mußte, um ihn veräußern zu können. Sehr schnell kamen diese Kleinstbetriebe
an wirtschaftliche und technische Grenzen, da es dem Einzelnen natürlich immer
an dem nötigen Kapital mangelte, sobald sich die Gruben ausdehnten und der
technische Aufwand stieg. Dennoch gab es noch bis weit in das
19. Jahrhundert hinein Eigenlehnergruben,
und zwar insbesondere dort, wo die geologischen Verhältnisse einen modernen,
„industriellen“ Bergbau einfach nicht zuließen. Genau dies war auch hier am Emmler der
Fall. Selbst wenn es die geologischen Bedingungen aber zugelassen hätten,
überstieg es gewöhnlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Eigenlehner, in
größere Tiefen vorzudringen und einen systematischen Abbau auszurichten. Daher beschränkte sich deren Abbau meist auf den
tagesnahen Bereich und erfolgte mit einfachsten Mitteln. Der Abbau wurde aber
auch durch die von Anfang an nur kleinen
Mit geringstem Aufwand den größtmöglichen Gewinn zu erzielen, führte im 16. Jahrhundert zu Raubbau. Jeder holte hier am Emmler die am leichtesten zu gewinnenden Partien heraus, ohne die Lagerstätte systematisch aufzuschließen und vollständig abzubauen. Nicht selten fuhren die Nachfolger späterer Zeiten dann solchen ,alten Mann' an und klaubten dort auch geringerwertige, von den Alten stehengelassene Erzmittel noch heraus. All dies ist auch in den folgenden Materialien zu den einzelnen Bergwerken wiederzufinden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als der letzte Eigenlöhner des Erzgebirges
gilt übrigens Karl Friedrich Lobegott Schmidt (*1820, †1908). Ein uns leider nicht bekannter Autor
(möglicherweise aber dessen Urenkel Albert Emil Walter Schmidt) hat eine kleine Materialsammlung
zu diesem Mann hinterlassen, in der unter anderem Erinnerungen von Dr. phil.
Conrad Walter Fröbe enthalten sind. Derselbe berichtete:
„Von
all den alten ,Bergwurzeln', die ich als Knabe bei meinem Vater aus- und
eingehen sah, war die merkwürdigste Erscheinung, die mein kindliches Gemüt sehr
beschäftigte, Karl Friedrich Lobegott Schmidt aus Halbemeile, ein Mann, den ich
als eines der letzten bergmännischen Originale unseres Gebirges eines
Gedenkblattes an dieser Stelle für würdig erachte.“
Wir auch und fügen an dieser Stelle ein, daß es sich bei dem Vater dieses Erzählers um Herrn Ernst Julius Fröbe handelte, der zwischen 1882 und 1921 Schichtmeister im Revier und unter anderem als Betriebsleiter und Bergverwalter bei Gnade Gottes vereinigt Feld in Langenberg und deren Nachfolgebetrieben tätig gewesen ist. Dessen Bruder, also der Onkel des Verfassers des nachfolgenden Textes, Robert Fröbe aus Rittersgrün, war Obersteiger auf der Fundgrube Rother Adler und 1887 als Betriebsleiter bei Meyer's Hoffnung Fdgr. bei Schwarzbach benannt. Aber nicht nur dieser personellen Verknüpfungen zu unserem weiteren Thema halber, sondern weil uns diese Geschichte eine sehr menschliche Sichtweise auf die Männer, die hinter dem eben ausführlich besprochenen Begriff stehen und ihn mit Leben erfüllten, gibt, zitieren wir auch sie hier fast vollständig: „Von Zeit zu Zeit pflegte ein kleiner alter beweglicher Mann bei meinem Vater vorzusprechen. Das erste, was er tat, wenn er zu uns kam, war, daß er seinen steten Begleiter, einen Zwilling, Stock und Schirm mit derbem Strick zusammengebunden, in die Ecke stellte, daneben eine viele Pfund schwere, sorgfältig in ein Taschentuch verknotete ,Wand' absetzte, um dann ‒ zur Freude von uns Kindern und zum Schreck der Mutter ‒ seine Pfeife unbekümmert in die Stube auszuklopfen. Sein ganzes Wesen und Behaben atmete eine für sein hohes Alter ungewöhnliche Rüstigkeit und eine gewisse salbungsvolle Würde. Wenn er dann anfing, zu sprechen, rollte ein hartes, polterndes Organ in kräftigen Modulationen ins Zimmer. Das Interessanteste aber war dabei an ihm sein von Runzeln und Furchen hundertfach durchsetztes Gesicht, das seine Sätze mit großer Lebendigkeit und Drastik begleitete, wobei vor allem ein paar buschige eisgraue Brauen über hellen Augen den Dolmetsch seiner Gemütsregungen machten. Dieser Mann, dessen Erscheinung selbst uns Kinder fesselte, war Karl Friedrich Lobegott Schmidt, ein Original auch darin, daß er wohl der letzte ,Eigenlehner' unseres obererzgebirgischen Bergbaus war. Er war in dieser Eigenschaft wahrscheinlich Vertreter der Urform bergbaulicher Unternehmung, die darin bestand, daß ein Mann neben seinem eigentlichen Beruf Bergbau mit eigener Hand trieb, schürfte und mit Schlägel und Eisen seine Grube weiter führte und so im ,eigenen Lohn' stand. Ein solcher ,Eigenlöhner', der die freie Zeit, die ihm sein eigentliches Handwerk übrig ließ, und seine ersparten Groschen und Thaler ins Gedinge steckte, war unser alter Lobegott Schmidt fast anderthalb Jahrzehnte. Sein Berggebäude, das er auf diese Art mit einer bewunderungswürdigen Zähigkeit und mit der alten bergmännischen Hoffnungsfreudigkeit auf einstmalige ,Anbrüch' betrieb, stand auf dem Staatsforstrevier zu Breitenbrunn und gehörte zum Johanngeorgenstädter- Schwarzenberger Bergrevier. Es trug den Namen ,Glück mit Freuden zu Halbemeile', dessen sprachliche Herkunft der alte Bergmann selber bisweilen im Gespräch mit einem: ,Gott bringt Glück mit Freuden' im edelsten Hochdeutsch aufklärte, was gar sonderbar feierlich in seinem sonstigen Halbmeiler Dialekt erklang. Wie Lobegott Schmidt zum Bergwesen gekommen war, das erzählte er jedem ‒ und wäre es der Berghauptmann selber gewesen ‒ mit einem Ernst, der unbedingten Glauben heischte. Ihm sei einmal, so pflegte er dann sehr anschaulich zu sagen, im Traume der Erzengel Gabriel erschienen und habe ihm einen vom Schwimminger herüber streichenden Gang angezeigt. Diese göttliche Sendung war ihm noch dadurch beglaubigt worden, daß er ungefähr an gleicher Stelle einen alten Meilerfleck wußte, wo, wie er von Köhlern erfahren hatte, der Meiler ,ka Ruh' gehalten habe. Und ,wu a Meiler ka Ruh hält, do streicht a Gang!' Dieser Satz aus seinem bergmännischen Katechismus, der mit einer prächtigen prophetischen Sicherheit aus dem Munde des Alten kam, war ihm in seiner Wahrhaftigkeit unanzweifelbar, wie die Bibel selber. Schon diese Gründungsgeschichte zeigt den alten Schmidt als echten Nachfahrer und alten Anhänger vorväterlicher bergmännischer Überlieferung, die ja jedem höffentlichen Bergwerk in seiner Entstehung eine ähnliche Sage schenkt. Nach ordnungsgemäß eingelegter Mutung hatte er dann an der ihm vom Erzengel angezeigten Stelle geschürft und einen Stollen angelegt. Daß es ihm bitterernst mit seinem Vorhaben war, Bergbau auf sene Art zu treiben, bewies die Energie, mit der er der ersten Schwierigkeit, nämlich sich einen Haldensturzplatz zu schaffen, zu Leibe ging. Die Breitenbrunner Forstrevierverwaltung verlangte von ihm hierfür eine Kaution von 1.000 Mark, die dem Kleinhäusler, der nur eine Kuh im Stalle hatte, zu hoch und wahrscheinlich unerschwinglich war. Da wandte sich der alte Lobegott gleich an die richtige Schmiede: Er schrieb einen Brief an den ,Kieng' zu Dresden und beschwerte sich bitter über die Schwierigkeiten, die ihm vonseiten der Forstverwaltung gemacht wurden. Daraufhin erschien denn auch bald ein Beamter vom Bergamt, der die Sache beaugenscheinigte und berichtete, was zur Folge hatte, daß ihm die ,Kautiu' auf 300 Mark ermäßigt wurde. Man sah dem alten Mann den Stolz aus den Augen leuchten, wenn er diese Geschichte erzählte, die gewöhnlich mit dem Ausspruch begann und schloß: ,Jo, unser Kieng is fei ä guer Ma.' Und nun trieb er, der bereits Siebenundsechzigjährige, seit 1887 als Eigenlöhner seinen Stollen unermüdlich ins Gebirge. Soweit er nicht in seiner freien Zeit mit den eigenen Händen arbeitete ‒ oft fuhr er nachts an ‒ mußte ihm seine kleine Bauernwirtschaft, die er in Sächsisch Halbemeile hatte, die Mittel zum Betrieb liefern. Leider erinnerte er damit an jenen Mann, der die Henne schlachtete, um die goldenen Eier zu bekommen ! Das Stück Jungvieh, das er heranzog, oder das Schwein, das er mästete, wurde beim Fleischer versilbert und gab Jahr für Jahr die Thaler, die er zum Unterhalt der Grube brauchte. Dann wurden von dem Gelde ein paar Berghäuer angelegt, bis Kuh und Schwein restlos verbaut war. Diese einzige Zubußquelle für seinen Bergbau auf Halbemeile ließ sich die alte Bergwurzel nicht antasten. Er bestand ihretwegen einmal einen hartnäckigen Kampf, den er persönlich mit dem damaligen Forstrat Täger in Schwarzenberg ausfocht. Als nämlich in einem schneereichen Winter die Straße nach Halbemeile verschneit lag und die Forstverwaltung ihrer Pflicht, sie zu bahnen, nicht sogleich nachkam, erfolgte vom alten Lobegott Schmidt geharnischte Beschwerde. Der Forstrat ließ den Alten zu sich kommen. Er bot ihm an, um dem Fiskus Arbeit und Geld zu sparen, das Kalb, das er im Stalle hatte und zu dem nach seiner Angabe der Fleischer nicht kommen konnte, abzukaufen, um so den Streit aus der Welt zu schaffen. Da hatte er sich aber geirrt ! Scmidts Weitblick sah da eine Gefahr. ,Wos !' bemerkte der, die buschigen Augenbrauen hochziehend, wie es seine Art war, ,dos mach iech nett ! Do gewähne sich de Flascher wag !' Und die Straße mußte gebahnt werden. Denn sonst war das höffliche Bergwerk in Gefahr. Das aber verschlang Jahr um Jahr (von 1887 bis 1900) die Kalbe oder das Schwein und klepperte weiter, ohne auch nur einen Heller Ausbeute zu geben. Schmidt war sein eigener Markscheider und Steiger, sein einziger Zimmerling, Bergschmied und oft genug auch sein einziger Häuer. Wirklich bestand hier bisweilen die ganze Belegschaft in einem ,Steiger und Häuer, Schwarzbart und Naumann', womit ein altes bergmännisches Scherzwort einen einzelnen Mann in Nennung seiner Arbeit, seines Aussehens und Namens zu der stolzen Zahl von vier Mann anschwellen ließ. Den alten Lobegott verdroß solcher Spott nicht. War sein Paket Dynamit zu Ende, so holte er sich vom Raschauer Kalkwerk ein neues, wobei er den Weg ‒ vorschriftsmäßig, ohne einzukehren ‒ in einem für sein hohes Alter respektablen Marsch von Halbemeile nach Raschau und zurück ohne Not hinter sich brachte. Mit einer bewunderungswürdigen Zähigkeit baute er seine Grube fort. Sen Glaube an Anbrüche und Ausbeute, an das ,Glück mit Freuden', konnte die vielen Jahre hindurch nicht erschüttert werden, weder durch die dauernden Mißerfolge, noch durch das Abreden meines Vaters, von dessen bergmännischer Erfahrung er wohl viel hielt. Allen Zweifeln zum Trotz hatte er sich seine eigene Gangtheorie ausgedacht, die er mit pastoraler Würde immer wieder vorführte: Vom Schwimminger herüber kamen dem tauben Gang, auf dem er baute, drei andere Gänge entgegen. Und da, wo die übersetzenden Gänge einfielen, wo sie ‒ wie er sich mit großer Anschaulichkeit ausdrückte ‒ seinem Gang ,ins Kreiz' kamen, erfolgten die Anbrüche: ,Drei Abrüch, erscht Zieh (Zinn), nocherts Wismert (Wismut) und nocherts a Sülwer (Silber).' Ein anderer Glaubenssatz seines bergmännischen Bekenntnisses: ,Eh man sich's versah, waren Wassern und auch Gänge da!' wurde auch von ihm als Trost und Zuspruch geglaubt. Wasser waren nun in der Tat eingefallen in seinem Stollen, und das genügte ihm, um auch an die verheißenen Gänge zu glauben. Außerdem aber baute er ,Gülben' ab Ausscheidungenn von Eisenocker auf seinem Gang, weil er in alten Bergbüchern gelesen hatte, daß sie sichere Vorläufer von Anbrüchen seien. Wie sein Vertrauen aufs Unterirdische, so war auch sein Glauben ans Überirdische unerschütterlich. Eine Gottesfurcht von solchem Urwuchs steckte in ihm, daß er darin wirklich wie ein Zeuge vergangener Geschlechter erschien. Und ebenso glaubte er an die volkstümliche Weisheit seiner Bergsprüche. Meinem Bruder, der sie bisweilen als Geologe anzuzweifeln wagte, entwaffnete er mit der Gegenfrage: ,Sie galäm wuhl a net, wos in dr Bibel stieht ?' Das war für ihn fas eins. Wie so manchem alten Bergmann war ihm Gott und Bergbau aufs innigste verknüpft. Gott war der Bergherr. An seiner Gnade im höfflichen Bergwesen zu zweifeln, war sündhaft. Er hatte seine Grube nicht ohne Grund ,Gott gibt Glück mit Freuden' genannt. Daran glaubte er. Wennn aber dieses Glück kommen würde, dann hatte er für den ersten Anbruch ein ,Gelübd' getan, ein in Prag bestelltes Muttergottesbild der Kirche zu Breitenbrunn zu schenken. Leider hat er es nie einlösen können. Denn der Bergsegen blieb beharrlich aus. Wie schon sein Gelübde zeigt, hatte die nahe Nachbarschaft des Böhmischen Grenzlandes die Konfession dieses einfältigen Gemütes ein wenig katholisch gefärbt. Er gestand, gern in katholische Kirchen zu gehen, des Weihrauchs wegen. Denn: ,Wus noch Weihrach riecht, do kimmt der Teifel net hie !' Da Lobegott Schmidt doch aus des irdischen Rates in bergmännischen Dingen nicht ganz entraten konnte, so hatte er sich in den ersten Jahren an meinen Onkel, den damaligen Obersteiger Robert Fröbe auf Rother Adler in Rittersgrün, gewandt, den er sich auf etwas eigentümliche Weise als seinen Betriebsleiter ohne Lohn und Brot bestellt hatte. Schmidt hatte ihm einmal einen kontrollierenden Bergbeamten genannt. Mein Onkel erfuhr diese Bestallung erst aus einem Schreiben des Bergamtes, das ihn wegen verschiedener bei Glück mit Freuden beobachteter Unzulässigkeiten monierte. Später war dann mein Vater des alten Lobegott bergmännischer Berater, und nun erfolgten die Besuche der alten Bergwurzel innerhalb gewisser Zeitabstände mit großer Regelmäßigkeit. Bei Wind und Wetter lief er den ganzen vierstündigen Weg zu uns und wieder heimwärts noch als Achtzigjähriger an einem Tage, niemals anders als mit Stock und Schirm, der ewig regen Pfeife und der ,Wand', die er dem Vater zur Begutachtung vorlegte. Die Eisenbahn zu benutzen, verschmähte er. Fast immer riet ihm der Vater, die ,Wand', da sie wertlos sei, auf den nächsten besten Steinhaufen zu werfen. Sie wurde jedoch stets wohlverwahrt wieder heimgeschleppt. (...) Karl Friedrich Lobegott Schmidt war einer jener alten, noch tief mit seinen Erinnerungen im erzgebirgischen Bergbau verwachsenen Menschen, eine einfache, ehrliche Haut, gottesfürchtig und voll Begeisterung für den Bergbau. Daß seine Grube nie fündig ward, hat den Alten nicht verbittert. Um 1900 endlich war er so ,bergfertig', daß er seine Grube verkaufte, nicht des schnöden Mammons willen, sondern weil er hoffte, sie gedeihen zu sehen mit Hilfe reicherer Mittel, als er sie ihr je hatte widmen können. Zu seinem Leid erlebte er es nicht, daß sie wieder in Betrieb kam. Wer ihn in seinem hohen Alter aufsuchte, um sich an seinen kernigen, hausbackenen Sprüchen zu ergötzen, fand ihn meist im Bett liegend, fortgesetzt seine Pfeife rauchend, eine speckige Zipfelmütze über die Ohren gezogen, oder aber auch, wenn es die Jahreszeit erlaubte in Unterhosen in der Wirtsstube. 1908 starb er. Auf dem Kirchhof zu Breitenbrunn liegt er begraben. Mit ihm trug man ein Stück alter bergmännischer Tradition zu Grabe.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemerkungen
zum grundeigenen Bergbau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schließlich steht mit dem Bergbau am Emmler
aber auch noch ein weiterer Aspekt in Zusammenhang: Die Unterscheidung zwischen regalen (staatlichem Vorbehalt
unterliegenden) und grundeigenen (die dem Grundbesitzer eigentümlichen) Rohstoffen. Es
ist sehr lange Vergangenheit, daß alle mineralischen Rohstoffe einmal als ein ,Gemeingut des Volkes'
betrachtet worden sind, wie es Bergrat Voelkel in seinem Text oben
anklingen ließ. Allein schon der zunehmende technische Aufwand, sie zu gewinnen, machte
eine Rechtssprechung über das Gewinnungsrecht notwendig.
Das Regalienrecht (lat.: jus regaliae, jus regale oder jus deportus) bezeichnete eigentlich das dem Kirchenherrn, besonders dem König oder Kaiser, zustehende Recht, während einer Sedisvakanz die Einkünfte des verstorbenen Bischofs einzuziehen und freie niedere geistliche Lehen zu vergeben. Derartige Regalien gab es bereits im ersten Jahrtausend. Das juristisch zu den Vermögensrechten gehörende Bergregal, auch Bergwerksregal, gab es damals allerdings noch nicht. Als solches wird das Verfügungsrecht über die ungehobenen Bodenschätze bezeichnet. Es besteht in einem dinglichen Verfügungs- und Gewinnungsrecht des Regalherren hinsichtlich der dem Bergregal unterliegenden Mineralien, auch gegen den erklärten Willen des Oberflächeneigentümers (wikipedia.de). Als obersten Grundherren stand das Bergregal im Prinzip den römisch- deutschen Kaisern und Königen zu. In der Ronkallischen Konstitution ließ Kaiser Friedrich, I., Barbarossa 1158 die Regalien an sich erstmals schriftlich fixieren. Das ius regale montanorum kommt hier aber immer noch nicht vor; außerdem galt diese Konstitution formal nur in Italien. Kaiser Karl, IV., König von Böhmen, legte dann in der Goldenen Bulle im Jahr 1356 fest, daß den sieben Kurfürsten des deutschen Reiches die Regalrechte an den in deren Territorien entdeckten und noch zu entdeckenden Metallen und Mineralien zustanden. Zuvor getroffene Belehnungen an kleinere Herrschaften blieben davon unberührt; in der Regel waren die Kurfürsten aber bemüht, das Bergregal von den Territorialherrschaften zurückzugewinnen. Wörtlich heißt es im Kapitel IX §1: „Das neundt Capitel ist von golt und von silber und von anderm geschmeyd. Presenti constitutione imppettum valitura statuimus. Wir wollen und seczen auch mit gegenwurtikeyt dyß gesecz, das weiglich zu halten und erleuchten das mit ganczer gewissen, das unser nachkummen dye künig von behem und all und ein ieglicher die kurfürste geistlich und werntlich dy furbaß ewiglich wesen, grebnuß goldes und silbers und geschmeyde, zin, kupfer, eysen, bley und welchlei ans geschmeyde geschlecht ez sei und auch salczes, es fünde ist ob noch funden wirt, zu welchen zeiten das sey, in dem obgenannten kunigreich und ertrich und in allen andern thawen der lande, die dem selbigen kunigreich untertenig sein und dye selben egenannten fürsten und in yren fürstentumen, landen, herschafften und zugehorungen recht und redlichen halten mügen und besicze mit allen recht genzlichen nichts auß genummen und auch dy inden haben und die zoll, die in vergangner zeit geseczet seien, nemen, als die undern vorfarn und veter kunig zu behem seligen und der kurfürsten veter und ir vorfarn ordelich genossen haben, biß auff die gegenwurtige zeyt und es auch mit loblycher und bewerter lenger und teglicher gewonheyt und mit ufschriben rechte biß an dise zeit behalten ist.“ So richtig gut Latein sprach der Schreiber dieses Textes wohl nicht mehr, denn die lateinische Floskel unter der Überschrift scheint uns ziemlich verballhornt zu sein. Wahrscheinlich muß es richtig heißen: Constitutio praesenta imperium validum statuimus, was auf Deutsch dann sinngemäß heißen würde: „Gegenwärtige (vorliegende) Einrichtung (bzw. Verfassung) beschließen wir (oder stellen wir auf) kraft unserer Macht.“ Wer es besser weiß, gebe uns bitte Bescheid. Wie man auch hier lesen kann, sind diese Festlegungen in der Goldenen Bulle keineswegs neu. Wie unser Bürgerliches Gesetzbuch bis heute auf dem römischen Recht beruht, so beruhte auch das Bergrecht auf dem römischen Recht. Nach dem römischen Recht standen die ,Früchte des Bodens' ohnehin dem Grundherrn zu, und da der Kaiser formal ja stets der Grundherr gewesen ist, standen ihm folglich auch die Bergbaurechte zu ‒ oder auf verlehntem Grund dem Grundherrn, freilich gegen die Entrichtung des Zehnten an den Kaiser. Das war althergebrachtes Gewohnheitsrecht, das jeder kannte und daher zuvor niemand schriftlich zu fixieren nötig hatte. Dieses Recht galt in ganz Europa, wurde mündlich überliefert und je nach Ort und Lagerstätte abgewandelt und angepaßt. Erst relativ spät wurde es tatsächlich niedergeschrieben, wofür der Grund sicherlich in dem sich ab dem 12. Jahrhundert rasant ausbreitenden Bergbau zu suchen ist. Auch die Bestimmung der Kurfürsten, also der Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, des Pfalzgrafs vom Rhein, des Herzogs von Sachsen und des Markgrafen von Brandenburg, erst später auch des Königs von Böhmen, ist eigentlich schon älter und bereits im „Sachsenspiegel“ des Eike von Repgow enthalten. Nach dem Tod des Stauferkaisers Friedrichs, II. 1250 waren die Kurfürsten vom dynastischen Prinzip, also von der Wahl eines Mitglieds der herrschenden Dynastie, zu sogenannten „springenden Wahlen“ übergegangen. Damit gehörte praktisch jeder Reichsfürst zu den möglichen Thronkandidaten und die Kronprätendenten mußten sich die Wahl durch umfangreiche Zugeständnisse erkaufen, etwa mit der Verleihung von Privilegien an die Kurfürsten, die in Wahlkapitulationen genau festgehalten wurden. Darüber hinaus mußten die Kandidaten seit dem Ende des 12. Jahrhunderts zum Teil immense Geldzahlungen an die Kurfürsten leisten. All dies stärkte Macht und Unabhängigkeit der Landesfürsten im Reich auf Kosten der königlichen Zentralgewalt und hatte eine fortschreitende territoriale Zersplitterung Deutschlands zur Folge. Die genauen Rechte und Pflichten der Kurfürsten und das Verfahren der deutschen Königswahl, die sich bis dahin gewohnheitsrechtlich herausgebildet hatten, ließ Kaiser Karl IV. im Jahr 1356 dann in der Goldenen Bulle endgültig rechtlich fixieren, um künftig Thronfolgefehden und die Aufstellung von Gegenkönigen zu vermeiden. Die Bulle bildete noch bis 1806 die Grundlage der Verfassungsordnung des deutschen Reichs (Hinweise von Herrn U. Jaschik). Da die deutschen Kaiser im eigenen Lande ohnehin ziemlich machtlos gewesen sind, ließ sich auch das Bergregal für sie kaum durchsetzen. Deshalb wohl war es auch Markgraf Otto, dem Reichen, überhaupt möglich, sich das Bergrecht in der Markgrafschaft Meißen bereits Ende des 12. Jahrhunderts anzueignen. Mit dem Westfälischen Frieden im Jahre 1648, der durch Art. VIII § 1 sämtliche Reichsstände in allen ihren hergebrachten Rechten bestätigte, hatten die Kurfürsten endgültig die volle Landeshoheit und damit auch das volle Berg- und Salzregal erlangt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen allgemein anerkannten, geschlossenen Kreis der dem Bergregal unterliegenden Mineralien hat es freilich zu keinem Zeitpunkt gegeben. Seitdem es aber Geld als allgemeines Zahlungsmittel gibt und seitdem man begann, aus Edelmetallen, wie Gold und Silber, Münzen zu prägen, unterliegen jedenfalls die Vorkommen der Edelmetalle dem Verfügungsrecht des jeweiligen Landesherren und wurden zu den Regalien gezählt. Dem gegenüber stehen aber andere, zumeist triviale Rohstoffe, wie etwa Lehm, Sand, Bruchsteine und Torf, auch Kalkstein und Kohle, die zwar ebenso dem Boden entnommen werden, die aber nie dem Bergregal unterlegen haben, sondern immer dem Grundeigentümer gehörten. Der hatte natürlich auch den aus dem Verkauf solcher Stoffe erzielten Gewinn zu versteuern, konnte aber ansonsten über deren Abbau ‒ solange er auf dem eigenen Grundbesitz erfolgte ‒ selbst entscheiden. Das traf wahrscheinlich auch auf den Grundbesitz der Hammergüter Tännicht und Förstel im 16. Jahrhundert zu. Auch Eisenerz unterlag dem Regalrecht lange Zeit nicht, da es als ein so gewöhnliches Metall erschien, das vielerorts in kleinen Lagerstätten („Raseneisenerze“) oberflächennah vorkam und meist in örtlichen Kleinbetrieben für den alltäglichen Bedarf verarbeitet worden ist. Da man auch hier am Emmler das Eisenerz oft nur wenige Meter unter dem Rasen fand, beides braunschwarze Farbe aufweist und da unsere Vorfahren noch nicht zwischen Raseneisenerz und Brauneisenstein zu unterscheiden wußten, konnten sich die ersten Hammerwerksbesitzer sicher sehr leicht auf diese Regelung beziehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch im 19. Jahrhundert erfolgten Verleihungen auf Eisen- und Braunstein mit dem ausdrücklichen Zusatz: ,auf alle Metalle und Mineralien, außer Gold und Silber', welche ausschließlich dem Landesherren zugestanden hätten. Die wirtschaftliche Bedeutung des Eisens nahm aber mit der Zeit so erheblich zu, daß es bereits Karl, IV. in der Goldenen Bulle in die dem Bergregal unterliegenden Rohstoffe einschloß. Auch diese Festlegung ließ sich innerhalb des Kaiserreiches aber nicht einheitlich durchsetzen und wurde in jedem Territorialstaat anders gehandhabt. Auch auf Eisenerz bauende Gruben wurden in der Folgezeit in Sachsen durch die Bergämter verliehen, unterlagen aber nicht im gleichen Umfang, wie die das Münzmetall Silber fördernden Bergwerke auch der technischen und wirtschaftlichen Aufsicht durch die Bergämter, auch, wenn die wirtschaftliche Bedeutung des Eisens die des Silbers der Menge und dem Wert nach längst überholt hatte. Das sieht man schon am Umfang der Aufzeichnungen der Bergbeamten. Hier in der betrachteten Region kam noch die Zweiteilung in kursächsische und gräflich- Schönburg- Hartenstein'ische Besitzungen hinzu. Das schönburgische Bergamt zu Scheibenberg (mit Oberwiesenthal und Hohenstein) wurde erst ab Luciae 1767 mit dem kurfürstlich- sächsischen Bergamt zu Annaberg kombiniert. Vielleicht war ja der Niedergang des Silberbergbaus in der schönburgischen Grafschaft ein Grund, warum man in Scheibenberg auch viele Aufzeichnungen zum Eisenerzbergbau niederschrieb ‒ bei diesem Thema ist es für uns jedenfalls ein Glücksfall, daß viele dieser Quellen, wenn auch unvollständig, erhalten geblieben sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Gesetz, den Regalbergbau für das Königreich Sachsen betreffend, vom 22. Mai 1851 sollte u. a. hierüber mehr Klarheit schaffen und bestimmte im Abschnitt I: Von den Gegenständen des Regalbergbaus, §1, ausdrücklich, daß dem Bergregal nur „alle Mineralien, die wegen ihres Metallgehaltes nutzbar sind (metallische Mineralien)“ unterliegen. Im Abschnitt III: Von der unmittelbaren Erwerbung des Bergwerkseigenthums, §51, wird neben den Zinnseifen nun auch der Raseneisenstein eingeschlossen mit dem einzigen Unterschied, daß darauf verliehene Grubenfelder „in der Tiefe durch das feste Gestein begrenzt“ sind. Im Abschnitt VIII: Die Abtretung des zum Bergbau erforderlichen Grundeigenthums... betreffend, bestimmte dann §212, daß jeder Grundeigentümer verpflichtet war, seinen Grund und Boden, „wenn es beim Betriebe des Bergbaues... nothwendig ist,“ allerdings „gegen vollständige Entschädigung“ an die Bergwerksunternehmer abzutreten. Der §229 bestimmte auch, wie die Höhe der Entschädigung zu berechnen sei. Eine Beteiligung des Grundeigentümers über den Erbkux wurde im Gegenzug nicht mehr gewährt. Speziell für das Voigtländische Revier, wo es offenbar zuvor noch regelmäßig entsprechende Verträge gab, bestimmte der folgende §230, daß auch eine anteilige Produktenabgabe ,in natura' an den Grundeigentümer ‒ zumindest für alle nach dem 5. Januar 1852 aufkommenden Eisensteingruben ‒ nicht mehr statthaft sei. Nicht zuletzt wurde anstelle des Zehnten nun eine Abgabe von 5% auf den Reinertrag des Bergwerks sowie eine fixe, nur flächenabhängige Grubenfeldsteuer (§§265ff) eingeführt. Mit diesen Regelungen fielen
einerseits nun alle
Eisenerze unter die bergbehördliche Aufsicht, umgekehrt aber auch sämtliche „nichtmetallischen“
Rohstoffe aus den Obliegenheiten der Bergbehörde heraus, also Baustoffe, wie Lehm, Ton und Werkstein, aber auch Kalkstein; mit der Ausnahme
solcher Betriebe, welche auf fiskalischem Grund lagen oder die bereits vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes bergrechtlich verliehen gewesen sind. Das
betraf in der hiesigen Region etwa die
Auf solche Rohstoffe bauende, später als „gewerbliche Gruben“ benannte Unternehmen gelangten erst mit der Neufassung der Allgemeinen Bergpolizeivorschriften für das Königreich Sachsen vom 16. Januar 1896 und mit der Verordnung, die Aufsicht über unterirdisch betriebene Brüche und Gruben betreffend, vom 12. Mai 1900, in denen kein Unterschied mehr zwischen Erz-, Kohlen- oder anderen Bergwerken gemacht wurde, wieder unter die technische Aufsicht der Bergbehörde, wozu in Freiberg zunächst die revierübergreifend zuständige Berginspektion III eingerichtet wurde. Noch immer blieben dabei aber ausschließlich „oberirdisch“ betriebene Steinbrüche und Tagebaue weiter ausgenommen, welche nur der Gewerbeaufsicht unterlagen. Auch andere Rohstoffe, die zu dieser Zeit bereits an wirtschaftlicher Bedeutung stark gewonnen hatten, wie etwa die Steinkohle, verblieben weiter unter den grundeigenen Rohstoffen, obwohl die wettinischen Kurfürsten in Sachsen schon seit langem große Anstrengungen unternommen hatten, sich dieses Recht ebenfalls zu sichern. Erst nach deren Abdanken gelangten mit dem Gesetz über das staatliche Kohlenbergbaurecht von 1918 auch Braun- und Steinkohle endgültig unter staatlichen Vorbehalt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frühere
Bergbauversuche am Rothenbach bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wandern wir nun aber gedanklich von Oberscheibe
hinüber zum Emmler.
Auf dem Weg nach Schwarzbach passieren wir dabei rechterhand erst den Schafberg,
dann erreicht man den Emmlerweg und diesem folgen wir dann zunächst in Richtung
Südwesten. Der Schafberg wurde auch die
„Scheibenberger Berg Freiheit“ genannt. Auch hier versuchte man einst,
Erzgänge aufzufinden und zu erschließen.
Folgt man dem Tal des Roten Bachs hinunter ins
Schwarzbachtal, so trifft man
unterhalb des Richterbergs
im Tal dann wieder auf alten Bergbau und dieser hatte schon
ältere Vorläufer, wenngleich man selbst im zuständigen Bergamt im 18. Jahrhundert
schon nicht mehr wußte,
wann hier der Bergbau denn eigentlich aufgenommen worden ist...
Einen ersten Hinweis, nach dem am Rothenbach schon damals ein David Erbstolln in Umgang stand, haben wir jedenfalls aus dem Quartal Trinitatis des Jahres 1575 gefunden (40014, Nr. 331). Leider ist diese Akte aufgrund ihres Alters und Erhaltungszustands gegenwärtig für die Einsichtnahme gesperrt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir blättern weiter in den alten Akten, in diesem Fall in einer Auflistung alter Grubenaufstände, und fanden dabei heraus, daß auch schon vor dem Jahr 1680 „in Richters walt zu Schwarzbach“ eine Grube namens Heilige drei Könige bestanden hat und auf Silber uns alle Metalle verliehen gewesen ist. Ob der Richterwald freilich mit dem Richterberg identisch ist und wo diese Grube genau gelegen hat, ist anhand der knappen Lageangabe nicht wirklich sicher zu sagen. Auch hieß es im Quartal Reminiscere 1681 schon über sie (40014, Nr. 12, Film 0005, links unten): „H. 3 Könige ins Richters walt zu Schwarzbach ist nicht gebauet, wird in Frist erhalten, hat diß quartal – Thl. 18 gr. 2 pf. und vorher Receß 43 Th 9 gr. 1 pf. Summa Receß 44 Thl. 6 gr.“ Das Register dieser Grube hat ein Schichtmeister namens Christian Lohs geführt. Im folgenden Quartal Trinitatis 1681 heißt es dann über die Fristzechen, „sind diß quartal alle gefallen und frey worden,“ auch die Grube Heilige drei Könige (40014, Nr. 12, Film 0006, rechts unten):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine weitere Verleihung just an diesem Fleck ist dann im Quartal Trinitatis 1738 im Bergbelehnungsbuch des Bergamts Scheibenberg zu finden (40014, Nr. 43, Blatt 18): „Den 4. Junii ist Immanuel Schiffeln alhier zu Scheibenberg 1 Fundgrube und tiefer Erbstolln aufn Hrn. Erbrichter Johann Adolph Müllers zu Schwartzbach Revier am Rothenbach auf alle Metalle und Mineralien, sie mögen Nahmen haben, wie sie wollen, verliehen und zum Frischen Glück genennet worden, das Anhalten der Fundgrube ist, wo der Gang mit dem Stolln zuerst entblöset ist, die Muthung No.133.“ Gleich daneben mutete derselbe, offenbar recht unternehmungslustige Immanuel Schiffel aus Scheibenberg noch eine zweite Grube (40014, Nr. 43, Blatt 18b): „Den 18. Junii ist Immanuel Schiffeln aus Scheibenberg ein tiefer Stolln sambt 1 Fundgrube und der obern nechsten Maas auf Johann Heinrich Seltmanns Fluren am Rothenbach zu Schwartzbach auf Silber, Kupffer, Zinn, Bley, Kobold, alle Metalle und Mineralia verliehen, zum Edlen Friedens Baum genennet und von ihm reserviret worden, das Anhalten der Fundgrube nicht eher anzugeben, biß er den Stolln gesäubert und gewältiget haben möchte, s. Muthung No. 136.“ Den Stolln säubern zu müssen, heißt ja: Da war vor diesem Muter schon ein anderer da... Könnte es vielleicht die oben angeführte, wenigstens 50 Jahre älter Grube Heilige drei Könige gewesen sein ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Johannis
reicher Segen Gottes am Rothenbach bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unter dem Namen Johannes reicher Segen Fundgrube samt Zubehör am Rothenbach auf dem Silberemler bei Schwarzbach hat dann ein Johann Christian Kauffmann ‒ wie man weiter hinten in der Akte herausfindet, Bergmann allda ‒ am 28. Juli 1763 im Bergamt Scheibenberg die Verleihung einer Fundgrube nebst tiefem Stolln „auf einem Silbergang“, welcher „auf Johann Christian Lorenß zu Schwarzbach Grund und Boden“ ausstrich, beantragt. Bei diesem Grundbesitzer handelte es sich um den nunmehrigen Erbgerichtsbesitzer in Schwarzbach und der Bergrücken, an dessen Fuß zum Roten Bach hin der Stolln ansetzte, heißt noch heute der Richterberg (40169, Nr.168). Die bergamtliche Verleihung wurde unter dem 20. Juli 1763 im Verleihbuch eingetragen und umfaßte neben der Fundgrube das „1te obere Maß, 1 Wehr und 1 Stolln.“ (40169, Nr. 168, Blatt 4 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 53) Nur zwei Monate später, am 29. September des Jahres wurden ihm ein zweites, drittes und viertes oberes Maß verliehen und am 2. November noch das fünfte bis achte obere Maß (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 54). Außerdem mutete Herr Kauffmann noch „auf einem übersetzenden Gang ohnweit des ietzigen Stollnorts und zwar ½ Lachter zurück und etl. 30 Lachter vom Lichtloch des Stollns weg 1 Fundgrube, welche der nechsten 1 oberen und 1. Unteren Maas auf einem Morgengang so in obigen gemutheten und bestätigten Stolln hora 6 übersezet“ und erhielt auch diese am 27. Juli 1763 „auf alle Metalle und Mineralien verliehen und (ist) zum Freudigen Bergmann genennet worden.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 53) Offenbar handelte es sich um eine auflässige Grube und man fand bei der Gewältigung tatsächlich noch anstehendes Silbererz, denn ein Probierbescheid des damaligen Guardeins Ch. Baumgärtner in Schneeberg weist aus, daß die ihm vom jetzt amtierenden Bergmeister Michael Herrmann Enderlein zugesandten drei Proben von Schlich und Stuferz aus einem Morgengang zwischen einem halben und einem ganzen Loth Silber im Zentner enthielten, jedoch „kein Blau“, womit Kobalterz gemeint war. Nun, irgendwoher mußte der „Silber- Emmler“ ja auch seinen Namen herbekommen haben. Daß man bei der Gewältigung des alten Stollns noch silberhaltiges Erz anstehend vorfand, ist als Indiz dafür zu sehen, daß die Grube einst ziemlich plötzlich ‒ vielleicht infolge des Dreißigjährigen Krieges ? ‒ von den Alten aufgegeben worden ist. Erst im 19. Jahrhundert
war unter dem Namen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Akte finden sich dann mehrere
Grubenaufstände, die sämtlich vom Bergmeister Michael Enderlein selbst
aufgestellt worden sind (40169, Nr. 168, der erste Blatt 6ff (Manuskript) und ab
Blatt 10 die Reinschrift):
Pflichtmäßiger Auffstand
und Grubenbericht „Dieses alte Berggebäude, wovon man keine Nachricht hat und auch nicht weiß, von wem es und zu welcher Zeit daselbst gebaut worden, hat die von mir, dem Bergmeister, beschehene Aufmunterung der Bergleute zur Erschürfung neuer Gänge (?) wieder wegs gemacht, ich eben auf diesem Gebürge noch neue Gänge, um die Zeit (?) Muthung auf obiges Gebäude ebefalls (?) laßen wollen. Für drey Wochen hat also am hiesigen Berge mann, nahmens Johann Christian Kauffmann ein hiesiger Bergmann, der schon Steiger Dienste gethan, diese Grube ausfündig gemacht, solche bergüblich gemuthet und unterm heutigen Dato nach vorheriger Besichtigung in Lehn und Würden erhalten. Bey der am 18ten dieses Monats beschehenen Beaugenscheinigung und Befahrung ist solches folgendergestalt befunden worden: 1. ist der Stolln aus Mittag in Mitternacht in allem 40 Ltr. auf einem hora 12,4 streichenden stehenden Gang ins Feld getrieben und bis auf das Tragwerkmeistens gesäubert. 2. hat man auch das 12 Ltr. vom Stolln Mundloch weg gegen 5 Ltr. tiefes und eben auf dem Gang sich befindendes Lichtloch von Bergen ledig gezogen, (?) vom Stollngang, als auch von denen Gangarten, welche beim Stollnort von einem übersetzenden Morgengang, hora 6 gegen Occidens aufgefunden worden, in Schneeberg zur Untersuchung derselben auf Kobald und Silber probiren lassen, und beydes in frischem Gestein befunden, daß also nicht viel Holtz zur Erhaltung dieses Gebäudes in baulicher (?) erforderlich. 3. haben die Alten ohnweit des Stollnorts in der Firste etwas in die Höhe gebrochen, als auch auf dem Gang etliche Lachter, wo aber noch viel Wasser darinnen stehen, abgesunken, als auch auf einem gleich neben diesem Gebäude und ½ Lachter vom Stollnort zurück hora 6 übersetzenden Morgengang gegen Orient ein halbes Lachter aufgehauen, und vom jetzigen Lehnträger Kauffmann ist auf diesem Gang gegen Occidens neu hinaus gebracht und dadurch schöne, nutzhafte Bergarten sogleich erbrochen, der Gang aber ebenfalls sofort bergüblich angenommen worden. Was nun dieser zwey schönen Gänge Eigenschaften betrifft, so hat durch die am 18ten dieses Monats erfolgte Beaugenscheinigung sich gezeigt, was maßen der erstere über eine Viertel Elle mächtig sey, und in unterem Stoße des ermeldeten Lichtlochs, ingleichen auf der Stolln Firste und Sohle beym Stollnort (?) sey, Arsenical Kieße bei sich führe, ferner die auf dem letztgedachten Morgengang gegen Occ. berührten Ertz Arten in einer milden und zarten Mutter von Gilbe und steinmark- Drusen (?) noch anstehend zu sehen und haben sich solche gegen die Firste eine Spanne lang in die Höhe gezogen, wie denn der Gang das drey gute Querfinger mächtig sich befindet. Der Gehalt aber solcher Arten ist nach des Geschworenen Guardeins zu Schneeberg, Herrn Baumgärtners Probir Zeddel, wohin ich, der Bergmeister, solche versiegelt selbst gesendet und den Probe Zeddel darauf ebenso wieder erhalten, an (ein?) Loth Silber, welches das Edelseyn dieses Ganges sattsam beweist, ausgefallen, dahingegen die Arsenical Kieße, welche man, indem sie sehr derb (?) und einem lichten Kobald ähnlich sehen, auf Kobald mit proben laßen, kein Blau gegeben. Und obwohl von diesen Kießen an die 30 Ctr. zu gewinnen und sogleich einige Einnahme beim Geyerischen Arsenical Werk davon zu machen wäre, ingleichen dem letzteren Morgengang gegen Occ. nach zu trachten wäre, so halte ich, der Bergmeister, aber durchaus dafür, wie es beßer gethan sey, wenn zu drey Dritteln Arbeit um die Distanz dieses Kreuzes beider Gänge, wo die Alten auch schon abzuteufen angefangen, einen Bau unterm Stolln verführet würde, weil zu vermuthen, daß daselbst eine reiche Veredlung dieser beiden Gänge sich bald zeige, und unter Gottes Seegen ein richtiges neues und gutes Berg gebäude dadurch rege würde. Zur Ausführung dieses guten Vorhabens ersuchen wir dannenhero und iede Bergwerks Liebhaber hierdurch freundlich, und hiesigen Refier den (?) und gegen 8 oder zwölff Groschen für den Schürfer, Kauffmann, nicht nur anzunehmen, sondern auch, unter der Bedingung, daß jeder 1 Jahr lang mit 16 Gr. quartals Zubußung auf 1 Kux auszuhalten und eher nicht abgehen wolle, sich aufzuklähren und mit des werthen Nahmens Unterschrift solches zu bewilligen. Diejenigen aber, welche darzu nicht geneigt, werden nicht angenommen, wobey auch noch mit versichert wird, daß alle Quartale richtige und gewiße relation erfolgen, ingleichen der specielle Aufgang mittels Vorzeigung des Registers, iedem individuo zu erkennen gegeben werden soll. Sollte Gott unterm ersten Jahr noch keinen Berg Seegen geben, so wird alsdann wieder ein Patent erlaßen. Auf solche Weise vermeiden sich die passiva bei der Grube selbst, und verhindern die Auflässigkeit, welches der Verderb hiesigen Bergbaus mit ist. Übrigens wünschen wir Gottes Seegen und bleiben einem jeden, dem dieses vorgezeigt wird, zu angenehmen Diensten geschlossen. Uhrkundlich und wissentlich haben wir diesen wahren Bericht in Forma probante von uns gestellt, so geschehen Schwarzbach,
den 20ten July 1763,
Es folgt noch diese: Annotatio. „Solchem nach erfahren wir in einem Jahr mehr, als mit einer unvollständigen und wankelmütigen Gewerkschaft in 5 oder 6 Jahren. Ein jeder einsehende gewerke muß gleich den Entschluß wie zur Einlage bey einer Lotterie faßen, denn der Bergbau ist gleichsam die unterirdische Lotterie, wo aber der Bergseegen den Vorzug für vielen anderen Gütern in der Welt hat. Schlüßlich ist als etwas nothwendiges noch mit zu berühren, welchergestalt die andere Absicht im anzustellenden Bau auf baldige Entblößung des Gegentrums, welches auch schon gemuthet, mit gerichtet sey. Michael Herrmann Enderlein.“ Der Hammerwerksbesitzer Carl Gottschald kaufte auch gleich acht Kuxe, was hier noch vermerkt ist, wenn auch nur unter dem Vorbehalt „wenn die Gewerkschaft complett ist.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Offensichtlich war der Bergmeister sehr um die Protektion der neuen Grube
bemüht. Außerdem sandte er weitere Erzproben nach Annaberg und nach
Oberwiesenthal. Der „Probir Zeddel“
aus Annaberg freilich kam
mit gänzlich negativem Resultat zurück, während man aus Oberwiesenthal
bescheingte, daß die zwei geprüften Proben einmal 2 Loth, zum anderen sogar 3
Loth, 2 Quent Silber (zirka 51,2 g Silber in 52,37 kg Erz oder 0,098%)
enthielten. Die Differenzen aufzuklären, schrieb Herr Enderlein an den
Oberhüttenverwalter Gellert in Freiberg und bat um weitere
Untersuchungen.
Indessen war auch besagter Bergmann Kauffmann nicht untätig und suchte offenbar die restlichen der üblicherweise 128 Kuxe seiner Grube an den Mann zu bringen. Dabei scheint er viel unterwegs gewesen zu sein und forderte gelegentlich auch zuviel an Zubußen, wie das Schreiben eines Schichtmeisters Mönch aus Jena (!) beweist, der sich beim Bergamt in Scheibenberg darüber beschwerte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Quartal später (mit Datum vom 9. September
1763) erstellte der Bergmeister Enderlein einen neuen Aufstand (40169,
Nr. 168, Blatt 24ff, Abschrift Blatt 34ff). Auch, wenn sich vieles
gegenüber dem ersten oben wiederholt (es waren ja nur drei Monate ins Land
gegangen), wollen wir daraus doch folgende, längere Abschnitte zitieren:
Pflichtgebührlicher
Auffstandt und Bericht „Dieses Berggebäude ist zwar ein altes Werk, allein, auf denen Gängen noch gar nicht verritzt, indem ein Stollntrieb von 48 Ltr. Länge die ganze darauf geschehene Arbeit nebst einem kleinen Übersichbrechen beym Stollnort ausmacht, ja, man weiß von demselben keine Nachricht, wann es in alten Zeiten aufgenommen und getrieben worden seyn mag. Vorietzo ist nun es durch die beschehene Aufmunterung meiner, des Bergmeisters, gegen die Bergleute, um gantz neue Silber Gruben auf denen Gebürgen wieder ausfindig zu machen, eigentlich empor gekommen, von einem Berg Steiger nahmens Johann Christoph Kauffmannen gefunden und unterm 28. July a. c. bergüblich gemuthet und so dann berggerichtlich bestätigt und ihm verliehen worden. Unter währender Aufsäuberung und Gewältigung dieses Werks haben sich in denen Bergen noch einige derbe und glauche Arsenical Kieß Stuffen gezeigt, welche sogleich gute Hoffnung gemacht. Ferner hat man, als der Gang im Stolln mit Behauen untersucht werden können, dergl. schöne derbe Kieße erbrochen und dahero nicht gesäumt, den Stolln mit zwey Mann vollends völlig zu säubern. Was nun 1. den Stollntrieb ins Feld betrifft, so ist derselbe aus Mittag in Mitternacht und zwar auf einem eine Viertel, auch dann und wann eine halbe Elle mächtigen, flachen Gang, deßen Hauptstreichen dem compass nach Std. 12 bleibt, 48, 1 Achtel Lachter getrieben, ingleichen 14 Ltr. vom Mundloch weg ein 5 Ltr. saiger tiefes Lichtloch darauf hinein gesunken. Und obwohl die Alten oben mit dem Stollnort auf dem Gang 1 Ltr. in die Höhe gebrochen, auch unter diesem Firsten Versuchs Bau auf der Sohle des Stollns etwa 1 Ltr. tief, welches vorietzo noch nicht gesäubert werden konnte, abgesunken; so haben sie aber doch den gedachten Gang beim Stolln Ort im Liegenden Drusen stehen laßen, und ihm daselbst nicht nachgetrachtet. Weil nun auf solche Distanz auch gleich ein zwei Querfinger mächtiges Morgen Trum in hora 6 übersetzt, die Alten gegen Or. ½ Ltr. ebenfalls darauf aufgehauen, und nichts von bergmännischen Arten anstehend, verlaßen haben, so hat 2. gedachter Lehnträger gegen Occ. darauf aufgehauen und ein erster Einbruch gleich Ertz Arten, die ein Loth Silber gehalten haben und ich, der Bergmeister, selbst zu Schneeberg abgestufft und probiren laßen, getroffen. Nach einer halben Elle wurde auf dem Stollngang sofort wieder erbrochen, allwo er Silber Ertze von 3 Loth, 2 Quent Silbergehalt gehabt hat und dergleichen in der Firste, Sohle und vor Ort anstehend zu befinden., über eine Viertel Elle mächtig und bereits gegen sechs Centner vorräthig sind. Und da auf diese neuen getroffenen Ertze in der Untersuchung ihres wahren Gehalts wegen der noch bey sich führenden arsenicalischen Eigenschaft wohl in Acht genommen werden müssen; so sind von mir, dem Bergmeister, auch unterschiedene einbrechende Arten davon nach Freyberg an den Herrn Berg Commissions Rath und Oberhütten Verwalter Gellerten eingesendet worden, um ihre eigentliche Eigenschaft zu erforschen und einen noch reichern Gehalt, als obiger ist, vielleicht davon zu erhalten, welche Antwort aber noch nicht eingetroffen. Ja, dahero auch dieses nicht wäre, so muß doch jeder Bergverständige, der diese Ertze sieht, zugestehen, daß sehr bald eine reiche Veredlung mit Silbergehalt entweder vorgehen, oder glaucher Kobald darnach brechen müßte. Die größte Wahrscheinlichkeit darzu ist im Abteufen vorhanden, maßen bekannt, daß dergl. Art Ertze unter der Stolln Sohle, wo die Waßer ihr Gleichgewicht halten, den reichsten Silbergehalt erlangt und gar in Gold Ertze sich verwandelt haben, wie das Hohnsteiner Gebürge durch Erfahrung ehedem gelehrt, daß über Stolln aber dergl. Art Ertze gehabt, in der Teufe aber Gold zur Ausbeuthe*) gegeben, wie wohl in jetziger Teufe, so 18 bis 20 Ltr. saiger seyn mögte, und man so gewiß noch nicht angeben kann, ebenfalls bey fernerem Anstehen auf dem Gang reiche Ertze schon zu vermuthen sind, zumahl wie etwa noch einige anscharende Trümer dem Gang zufallen sollten. Indem nun also die Absicht dahin gerichtet, ein ansehnliches Silber Berggebäude in die Höhe zu bringen, der eingangs gedachte Lehnträger, Stgr. Kauffmann und Vorzeiger dieses aber, für sich (allein) nicht imstande ist, solche Absicht auszuführen, also hat man bergamtswegen ihn an diejenigen hohen und vornehmen Herren Gewerken, welche ehedem bey dem Wunderbaren und Neuen Glück am Kaff mitgebaut, sowohl, als auch an andere Bergwerks Liebhaber und Verständige, mit diesen wahren Grubenbericht abgesendet und recommendirt, um denenselben solches zu eröffnen und sie als Gewerken hierbey anzugehen, wie wir denn unseres Orts Selbte gleichergestalt dieserhalb dienstlich ersuchen und pflichtgebührlich hierdurch versichern, daß unser und vieler hoher und niederer Bergverständiger, denen die ietzigen Ertz Arten vorgezeigt worden, Zutrauen zu dieser aufs Neue rege gemachten Grube stark sey, daß sie annehmlich in Kürze sich bald mit reichen Ertzen zeigen und löhnen werde, wir denn von ietzigen anstehenden Ertzarten Vorzeigern dieses einige Sorten zum Vorzeigen und zur Untersuchung mit zu nehmen verstattet worden, doch sollen davon ein mehres nicht, als was gegenwärtiger Auffstand besagt, vorweißlich zu machen suchen. ...“ *) Zur Erklärung dieser Sätze Enderlein's noch die folgende Anmerkung: Die Hohnstein'er (es sind genau genommen Ernstthal'er) Bergwerke im dortigen Zechenberg haben überwiegend kupfer- und silberhaltigen Kiese, vor allem Arsenkies, ausgebracht und man hat darin tatsächlich Gold gefunden; allerdings in so bescheidenem Umfange, daß das Metall bestenfalls zur Prägung einiger weniger Ausbeute- Taler ausgereicht hat. Dennoch gelten diese Gruben als die einzigen Bergwerke in Sachsen, die Gold aus anstehendem Festerz gefördert haben, während alle anderen bekannten Vorkommen dieses Edelmetalls in Mittelsachsen fluviatile Seifenlagerstätten darstellen. Da die Bergämter Scheibenberg und Hohnstein ja bereits zusammengelegt waren, wußte Herr Enderlein um diesen Umstand quasi aus erster Hand (lampertus.de).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ich kann mir nicht helfen, aber der obige
Aufstand klingt mir so, als priese Herr Enderlein selbst die
Bergwerkskuxe wie faule Kartoffeln an... Bis hierhin ist jedenfalls außer der
Aufsäuberung des Stollns und dem Anschlagen des zweiten Querschlags auf dem
Morgengang nicht wirklich viel geschehen und der ganze Kux- Handel beruhte auf
nicht viel mehr, als ein paar Probenanalysen. Von den Probenuntersuchungen gab
es übrigens noch einige mehr: Obwohl keine Herkunftsangabe auf diesem
Probezettel (Blatt 28 der Akte) vermerkt ist, steht zu vermuten, daß inzwischen
in Freiberg die übersandten Proben geprüft worden sind. Nach diesem nun enthalte
der Zentner Erz neben gerade einmal ¼ Loth Silber, auch noch 26 Pfund Wismut !!
Ein weiterer Probierzettel von uns schon bekannten Guardein Baumgärtner in Schneeberg vom 8. Oktober 1763 weist dagegen aus, daß das „Stüffgen Arsenical Blende und Kieß“ ½ Loth Silber enthalte und an Wismut „Nichts“. Die Kosten für die Untersuchung in Höhe von 6 Groschen trug übrigens der Bergmeister selbst. Auch in Oberwiesenthal wurde die Analyse mit neuem Material noch einmal wiederholt und der Probenbericht vom 16. November 1764 weist nun aus, daß die folgenden Erzproben
enthalten hätten. Wem soll man hier glauben ? Der Grubenaufstand endet diesmal jedenfalls nicht, ohne auch den Handelspreis eines Kuxes dieses Gebäudes festzulegen: „Wie wir nun allen denenjenigen, so dieser Auffstand vorgezeigt werden mögte, zu angenehmen Diensten jederzeit bereit verbleiben, auch einen baldigen Bergseegen für diejenigen, so sich darbey einzulassen und einen oder etliche an sich zu kaufen belileben wollen, zugleich herzlich mit anwünschen, und noch mit melden, daß die Gewerken über die angenommenen Kuxe von uns sofort selbst übersendet werden sollen. Also haben wir auch dem Bergamts Tax eines Kuxes bey so höfflichen und bergmännischem Ansehen, indem er zehen Thaler ist, mit inferirt und diese wahre relation unter vorgedrückten Bergamts Secret (Siegel) und gewöhnlicher Unterschrift uhrkundlich und wissentlich von uns gestellt, so geschehen, Scheibenberg,
den 9ten September 1763. Offenbar aufgrund der angeblich festgestellten, hohen Wismut- Gehalte wurde der Kaufpreis pro Kux vom Bergamt so hoch angesetzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die nachfolgende Liste der Kux- Käufer ist
recht interessant: Es erwarben nämlich (in der Reihenfolge der Aufführung):
Von den üblicherweise 128 zu vergewerkenden Kuxen waren also nach der einwöchigen Reise des Kuxkränzlers nach Jena und Weimar insgesamt nur 38 an den Mann gebracht; und dies offenbar ‒ abgesehen von der westerzgebirgischen Hammerherren- Familie Gottschaldt, welche sich sofort 8 Kuxe reserviert hatte ‒ allesamt nur in kleinen Partien und an mehr oder weniger gut Begüterte im entfernten, thüringischen Fürstentum Sachsen- Weimar- Eisenach, dem auch Jena seinerzeit ja angehörte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oben in der Liste der Kuxinhaber genannter
Lehrer Pelz aus Jena meldete in einem Brief an das Bergamt schon am
25. Oktober 1763 Zweifel an den im Aufstand genannten Metallgehalten des Erzes
an. Außerdem fragte er, wieso denn nur zwei „Bergkräfte“ angelegt wären,
wenn die Grube doch so große Hoffnungen mache? Mit der Androhung, seine Zubußen
nicht mehr zahlen zu wollen, fügte er noch hinzu: „Ich für meinen Theil
wünschte, nicht mich mit so vielen Kuxen beteiligt zu haben...“ (40169, Nr. 168, Blatt 48ff)
Ein weiterer Probierzettel vom 5. März 1764 von Johann Christoph Barth in Oberwiesenthal weist dann aber wieder aus, daß von den sechs übersandten „Proben Stüffeln“ zwei kein Silber, die anderen vier zwischen 4 und 6 Loth enthalten hätten. Nun, wenn man eine Stufe Silbererz auf ihren Silbergehalt untersucht, kommen sicherlich andere Gehalte heraus, als wenn man tatsächlich einen Zentner Roherz prüft... Inzwischen hatte Bergmeister Enderlein wohl auch beim Oberhüttenamt in Freiberg nachgefragt, was denn nun die Ursache für die unterschiedlichen Gehalte, und namentlich der hohen Wismutgehalte der Kieserze, sei und am 12. März (auf dem Blatt steht 1769, aber das kann ein Schreibfehler sein) erhielt er Antwort von einem Johann Friedrich Schnick (oder Schuck), jener habe mit Commissions Rath Gellert gesprochen und mit dem Oberhüttenmeister und beide hätten versichert, daß ihnen von den übersandten Proben nichts bekannt sei. (40169, Nr. 168, Blatt 52) Es wird langsam verwirrend... Jedenfalls habe das Oberbergamt am 19. März die Resolution getroffen, daß die Probe zu wiederholen sei.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Juni 1764 verfaßte der Bergmeister einen
neuen
Auffstand und Bericht
„In dem verstrichenen Quartal Reminiscere a. c. ist mit zwey und drey Arbeitern ein und ½ Lachter Stroße mit gewöhnlicher Stollnhöhe á 4½ Elle und in allem also seit der neuern Wiedergewältigung excl. solcher Reparatur und anderer Arbeit vier Lachter auf einem hora 11,4 flach streichenden Gang gegen Septentriones (Mitternacht) aufgefahren worden. Ferner hat man nunmehro incl. 13 ctr. Anbrüche Crucis a. p., wo man allhier gebauet, und welche zum neuen Vorrath geschlagen worden, in allem gegen drei und siebenzig Centner Erz, davon der Centner, nach Angabe des Herrn Commissions Raths und Oberhüttenverwalters Gellerts, 26 Pfd. Wismut hält, in Vorrath.“ Das ist zwar nach wie vor unklar, aber man wiederholt diese Zahl immer weiter... „Was nun dessen Ausschmelzen im Ganzen, weil es, da es (das Wismut) in arsenic steckt, etwas schwer ist, betrifft, so melden wir, wie von wohlgedachten Commissions Rath, an dergleichen Schmeltzer in auswärtigen Refieren, weil die Freybergschen mit dergleichen nicht umzugehen gewohnt wären, nachdem man der Antwort ein Quartal lang vergeblich entgegen gesehen, angewiesen worden. Weil aber dieses zu viel Unkosten verursachte, so haben wir uns bemüht, einen Steiger ohnweit von hier ausfündig zu machen, der in seiner Jugend dergleichen arsenicalische Wismuth Ertze im Großen geschmelzet und dieser soll künftige Woche die Probe in unserm Beyseyn machen. Woferner nun dieses glücklich geht, so dürften die zeitherigen Zubußen und ein mehres abgestoßen werden. Man setzt aber auch, den Fall, daß es wie wohl es nicht zu hoffen steht, damit unglücklich ginge, so haben wir doch die größte Hoffnung auf Silber Ertz für uns, indem in der 3ten Lachter der aufgefahrnen und eingangs gedachten Arbeit sich auf einem steinscheidigen Trümigen, so mit dem Gang aufsetzt, gewachsenes Silber, auch Weißgüldigsches nebst Räsern (?) Glas Ertz merken lassen, welches letzteres acht Loth Silber gehalten und diese Drusen von mir, dem Bergmeister, bis dato noch aufbehalten, und als sichere Spuren eines edlen Ganges und Gebürges vorgezeigt werden, auch unterschiedenen Hohen Vorgesetzten und Bergwerks Verständigen bereits vorgewiesen worden. Über dieses hat auch im Gang selbst gleich nach der dritten Lachter vom übersetzenden Morgentrume weg, wo wir zu arbeiten angefangen, känntliches Glas Ertz in Wismuth Ertz nebst silberhaltigen Schwärtzen, die aber im Gehalt noch nicht untersucht sind, eingebrochen.“ Habe ich das gerade falsch gelesen? Auf dem letzten Probierzettel waren maximal sechs Loth Gehalt in den „Stüffeln“ ausgewiesen und zwei von sechs Proben enthielten gar nichts... „Weil nun das vorhergesetzte sattsam zeigen wird, daß dieses neue Werk alle gute Hoffnung zu Ertzen in Anbrüchen mache, also berichten wir kürzlich noch, wie dieses Abteufen nunmehro in dieser Distanz, wo die Ertz Spuhren sich merken lassen, für die Hand genommen werden soll, und sonst auch das Wismuth Ertz noch fortsetze. Der Bergamts Tax ist zwölf Thaler und wir bleiben Eurer hoch- und wohllöblichen Gewerkschaft zu dienen allzeit bereit...“ Scheibenberg, den 16. Juny 1764. Michael Herrmann Enderlein, Bergmeister. Oh, der Preis für einen Kux ist schon wieder angestiegen, obwohl doch noch gar nicht alle verkauft sind... Dabei ist aus der Probe auf Wismut, geschweige mit dem Ausschmelzen der 73 Zentner Erz im Ganzen, noch immer nichts geworden: „Nach vielen selbstgemachten Versuchen mit dem bewußten arsenicalischen Wismuth Ertz ist endlich auch, wie der Herr Commissions Rath Gellert angewiesen, die Probe mit dem Schneebergischen Steiger vorbey, indem ich drey Centner dahin fahren und daselbst schmeltzen lassen, aber es ist leider noch nichts worden, wobey der Schneebergische Herr Bergmeister alles selbst besorgte...“ (40169, Nr. 168, Blatt 66)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wirklich Sachkundige, wie ein Bergmeister
Stieglitz aus Leipzig, dem man wohl auch Kuxe angeboten hatte, lehnten deren
Erwerb deshalb ab. Er schrieb am 5. September 1764 nach Scheibenberg:
„Was Johannnis reichen Seegen betrifft, so kann ich mich, der ich schon so viel baute, nicht mit einlassen, es müßte denn ein viel sicheres Argument erlangt werden, daraus zu schließen wäre, daß man glücklich seyn könnte, denn aus dem mitgesendeten Anbruch ersehe ich nichts, als arsenical Kieß. Ich habe auch der gemachten Probe an demselben also befunden, kein Kobold, kein Silber ist zu scheiden. Etliche kleine runde Körner, die Wismuth seyn könnten, sind mir zu Augen gekommen, doch zweifle ich noch sehr an dem 26 pfündigen Gehalt und bitte die Sache wohl zu überlegen, ehe sie die Unkosten mit der Fuhre nach Schneeberg tun...“ (40169, Nr. 168, Blatt 72ff) Hier hatte sich wohl inzwischen der Postweg überschnitten, denn angeblich war die Probe in Schneeberg ja inzwischen erfolgt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unverdrossen wurden die Kuxe weiter
angepriesen. Am 20. November 1764 wandte sich Herr Enderlein dazu auch an den
Herrn Monsieur Pistorig (oder Pistorius), Secretair de San Excellence de Comté
der Schönburg- Rochsburg.
In dem Schreiben heißt es: „Weil ich es mir angelegen seyn lasse (...) etliche neue hoffnungsvolle Gruben aufzubringen, (...) so vermelde ich nun, daß Johannis reicher Seegen die schönste Anweisung zu baldigen reichen Silber Ertzfällen vor Augen legt. Eure Hochwohlgebohren ersuche ich dahero dienstergebenst, dasiger Gnädiger Herrschaft den Steiger ohnmaßgeblich zu praesentiren und den Aufstand vorzeigen zu lassen, auch allsoviel allgütigst mit bewürken zu helfen, daß Hochdieselben nur etliche Kuxe mit anzunehmen geruhen mögten, indem das Kaufgeld nach den nähern Umständen nur ein kleiner Hazard ist...“ (40169, Nr. 168, aufgrund der Heftung auf Blatt 79 mit Rückseite und Blatt 84) Ob sich die Linie derer von Schönburg- Rochsburg tatsächlich im Bergbau engagiert hat, geht aus dem Akteninhalt nicht hervor. Es erscheint uns auch eher unwahrscheinlich...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen weiteren Grubenbericht verfaßte M. H.
Enderlein am 11. März 1765. Demnach hatte im Winter der Betrieb weitgehend
ruhen müssen, man habe nur eine Hornstatt am Abteufen ausgebrochen und das
Gesenk um einen weiteren Viertellachter verteuft, wobei man erneut Erz gefunden
habe. Es solle nun auch ein neuer Versuch gemacht werden, die Kieserze „mit
unterschiedenen Zuschlägen zu tractiren“ und: „Die bergmännische Hoffnung
(...) verstärkt sich von Schicht zu Schicht.“
(40169, Nr. 168, Blatt 85ff)
Na ja, der Glaube versetzt bekanntlich Berge. 1766 war Christian Heinrich Hildebrandt im schon mit den vormals schönburgischen Bergämtern Scheibenberg, Oberwiesenthal und Hohenstein-Ernstthal kombinierten Bergrevier Annaberg Geschworener. Als solcher hatte er alle Gruben der Reviere regelmäßig zu befahren und zu begutachten. In seinen Fahrbögen fanden wir zu dieser Grube im Quartal Trinitatis 1766 die Notiz (40014, Nr. 126, Blatt 16): „Freydags, wollte auf dem Johannes Reichen Seegen über Schwarzbach am Luxbächel (?) gelegen fahren, aber keine Arbeiter angetroffen.“ Wieso er den Bachlauf als Luxbächel (einen Luxbach gibt es bei Pöhla und auch bei Niederschlag) bezeichnet, ist unklar ‒ aber auch Geschworene machen mal Fehler. Im Quartal Crucis 1766 fand Herr Hildebrandt die Grube jedenfalls belegt und notierte: „Freydags bis auf dem Johannes reichen Seegen über Schwartzbach am Luxbächel (?) gelegen gefahren, mit 1 Steiger belegt ist, und wo mit dem Stolln Orthe in 60 Lachter hoch stehende Gang weiße gegen Mitternacht vom Mundloch weg so gleich hinder dem auf dem Stolln niedergesunkenen (Gesenk?), durch eine ausstreichende neuartige Wacke dem Gang gegen die 4 Lachter in Klüfften, welche ins Hangende gefahren sehr geschmälert, so daß nur noch von Klüften vor Orth (?) zu etwas befindlich, und viel sich mit dem Stolln Orthe, worüber hauen, und nur mit 5/8 Lachter Höhe durchgefahren, also habe ich dem Steiger, weil sich die Klüffte nieder zu (ziehen?) erschienen, einzurichten, die zurück anstehende Stroße nachzunehmen anbefohlen.“ (40014, Nr. 126, Blatt 29f)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein letzter Grubenaufstand datiert auf den 23. März 1767. Da bis dahin nur ungefähr 150 Thaler Kaufgelder für Kuxe eingegangen waren und die Zubußen spärlich gezahlt worden sind, hatte man die Belegung von vorher drei (Steiger, 1 Häuer, 1 Junge) auf nur noch einen Mann herabgesetzt. Am Stollnort hatte man den Gang an einer Verwerfung verloren, ihn wiederzufinden 1 Lachter weit ins Liegende eingeschlagen und dort glücklich ein Trum mit gleichem Streichen erreicht, das auch etwas Weißgültigerz führte. Herr Enderlein schrieb diesmal in seinem Grubenaufstand, er hoffe, „die Herren Gewerken wollten das Werk mit dem nöthigen Verlag nicht (ver-) laßen (...) und etwa aus Boßheit dasselbe niederschlagen.“ (40169, Nr. 168, Blatt 91ff) Hat aber nichts genützt. Nach den geschilderten und zitierten Dokumenten aus drei Jahren Betrieb endet der Akteninhalt 1767 wieder. Als der Geschworene Hildebrandt die Grube im Quartal Trinitatis 1767 erneut befahren wollte, fand er sie schon wieder ohne Belegung vor: „No. 3te Woche dienstags wollde auf dem Johannes reichen Seegen über Schwartzbach am Luxbach (?) gelegen fahren, allda keine Arbeiter angetroffen.“ (40014, Nr. 126, Blatt 54) Dennoch muß der Betrieb noch einige Jahre weitergegangen sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tatsächlich hatte am 3. Juli 1769 Herr
Christian Friedrich Meyer (die Familie Meyer war auch im Besitz
des einstigen Hammerguts Tännigt) den offenbar zuvor ins Freie gelassenen „Johannis
Reichen Seegen genannden über Schwartzbach am Luxbächel“ Stolln
neu gemutet und erhielt diesen nebst zwei oberen Maßen am 22. Juli 1769 auch
bestätigt. Auch er verwendete dabei seltsamerweise wieder den Namen ,Luxbach'
für den Roten Bach (40014, Nr. 129, Blatt 5 / Film 0006). Die Eintragung im Belehnungsbuch hierzu
lautet (40014, Nr. 43, Blatt 68f):
„Scheibenberg den 22. July 1769 ist beym Bergamte Hr. Christ. Friedrich Meyern allhier auf seine vorstehende Muthung des bisher in freyem gelegenen Johannis Reicher Seegen Berggebäudes am Luxbächel mit dem Stolln am Luxbächel gleichen Namens und da nun auch dem flachgangweiß streichenden und gegen Abend fallenden Gang, worauf ohnweit vom Stolln zurück abgeteuft worden, eine neue Fundgrube nebst der 1. 2. Oberen Maaß auf alle Metalle und Mineral. mit allen Rechten und Gerechtigkeiten verliehen und bestätigt worden. Die Fundgrube soll ebenfalls Johannis Reicher Seegen heißen.“ Eine Randnotiz aus späterer Zeit an dieser Stelle sagt uns aber auch gleich, die Grube sei wieder „ins freye gefallen.“ Auch in den Fahrbögen des Geschworenen Christian Heinrich Hildebrandt aus dem Quartal Reminiscere 1770 lesen wir in seiner Notiz, er sei „Freydags (...) auf dem Johannes Reichen Seegen über Schwartzbach am Luxbächel (?) gelegen gefahren, nur mit 1 Häuer, 1 Jungen belegt war, der Gang zeigte sich mit Arsenical und gelben Kieße mit blendigter Art.“ (40014, Nr. 135, Blatt 4) Einen neuen Grubenaufstand gibt es dann vom 10. März 1770 (40014, Nr. 38, Blatt 57):
Aufstand und Grubenbericht
„Bey diesem Gebäude wird durch den anfahrenden Steiger und übrigen Arbeiter mit Auffahren des auf den hochflachgangnweiß streichenden und gegen Abend wenig flach fallenden Gang getriebenen Haupt Stolln Feldorts bestmöglichstermaaßen continuiret, zugleich aber auch die Stroße zu Fortbringung der ordentlichen Stolln Höhe und Bewürckung guter Wetter (schwer leserlich ?) nachgerißen. Da nun auf diesen Gang selbsten das beste bergmännische Vertrauen zu setzen ist, daß solcher in Ansicht seiner führenden, so vorzüglichen (schwer leserlich?) und (schwer leserlich?) Gangarten bey anschaarenden edlen Geschicken edle Anbrüche faßen, wiederum auch schon bereits Silber Ertze gebrochen, alßo ist nun sowohl der Forttrieb des Stolln Feldorts eine der wichtigsten bergmännischen Absichten...“ Es scheint ganz so, als wiederhole sich die Geschichte... Der Aufstand aus dem Folgejahr (vom 16. Februar 1771) spricht auch nur von Hoffnungen (40014, Nr. 38, Blatt 81):
Aufstand und Grubenbericht
„Da bey diesem Gebäude vor das gegenwärthige die hauptsächliche bergmännische Absicht dahin gehet, mit Treibung des Stolln Feldortes sowohl das dasige edle und annoch unerschrotene Gebürge in einer gantz beträchtlichen Teuffe aufzuschließen, als auch die darinnen übersetzenden Gänge zu überfahren, so wird auch durch den anfahrenden Steiger und Arbeiter mit fernerweitigem Auffahren des Haupt Stolln Feldorts die Arbeit gehörig verführet, ... Dieser Gang machet nun Ansicht(lich) der darauf einbrechenden so höflichen Gangarten, welche bey der Untersuchung in einen gantz feinen Silber Gehalt ausgefallen, die größte Hoffnung, daß bey weiterem Auffahren sothanen Stolln Feldorts und bey mehrern edlen Geschicken gantz balde an ein edles Mittel dürfte gelanget werden...“ Das wird nicht besser und ,Gantz balde' schon gar nicht... Auch im Aufstand vom 5. September 1672 heißt es (40014, Nr. 38, Rückseite Blatt 122): „Da nicht nur derjenige flachgangweiß streichende Gang, worauf bey diesem Gebäude das Haupt Stolln Feld Ort gegen N. getrieben wird sowohl in Ansehung seiner ab und zu führenden Gangarten sowohl aus derben und mit etlichen Loth Silber Gehalt bewiesenen Stufen darinliegender Blende bestehen, als auch, da er mit dem Haupt Schacht paralleles Streichen hat, welche Gänge der Entstehung nach, für die bauwürdigsten zu halten sind, die ganze bergmännische Hoffnung mehret, daß bey weitern Auffahren solchen Stolln Feld Orts bey anscharenden edlen Geschicken und (schwer leserlich ?) Seegen, in edle Mittel durchaus gelanget werde, ...“ Einen von dieser Sorte haben wir noch gefunden, welcher auf den 12. Oktober 1773 datiert ist (40014, Nr. 38, Rückseite Blatt 144): „Bey diesem Gebäude wird durch den anfahrenden Steiger und übrige Arbeiter der Bau noch dermaaßen verführet, wie wir ihn in unseren vorigen Aufständen ausführlich angezeiget und solchem nach mit weiterem Auffahren des gegen NE. getriebenen Haupt Stolln Feld Orts... behörig continuiret... in der bergmännischen Absicht, ... nechst göttlichem Seegen edle Anbrüche auszurichten...“ Wie der Volksmund weiß: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch dieser Betreiber hatte aber offensichtlich kein langes Durchhaltevermögen mehr und so folgte am 6. Juni 1774 die nächste Mutung durch Carl Heinrich Lorentz, wohl ein Verwandter des Grundeigentümers, denn in der Mutung heißt es: „einen alten Stolln, so auf Silber, auch andere Metalle und Mineralien zu suchen angelegt, so auf Carl Gottlob Lorentzens (?) Grund und Boden an dem sogenannden Rothenbach, Schwartzbächer Refier gelegen...“ (40014, Nr. 129, No. 24 / Film 0029) Er erhielt den Stolln vom Bergamt Scheibenberg auch am 8. Oktober des Jahres erneut verliehen. Die Eintragung im Belehnungsbuch hierzu lautet (40014, Nr. 43, Blatt 76): „Scheibenberg den 8. Oct. 1774 ist beym Bergamt Hr. Carl Heinrich Lorenz auf seine vorstehende und bisher erlängte Muthung ein alter Stolln, so auf Carl Gottlob Lorenz Grund und Boden am sogenannten Rothenbach Schwarzbächer Refier lieget, mit dem Nahmen der Edle Friedensbaum mit allen Stolln Gerechtigkeiten... jedoch ältern Recht und dem Bergamt ohnschädlich verliehen und bestätigt worden.“ Eine Randnotiz aus späterer Zeit sagt uns aber auch an dieser Stelle, die Grube sei erneut wieder „ins freye gefallen.“ So findet man im Quartal Reminiscere 1775 auch in den Fahrbögen des Berggeschworenen Hildebrandt die folgende Notiz: „St. Johannis Reicher Seegen über
Schwartzbach Allhier zeigt sich der Gang worauf das Stolln Ort flachgangweise gegen Mitternacht getrieben wird, von der Fürst bis halb Ort nieder schmal, hin und wieder aber 3 und 4 ganze Finger mächtig, von Quartz, Horn, (?) mit anstehender Schwärtze, welche Gangarten etwas Silber halten dürften.“ Die nächste Befahrung dieser Grube ist im Quartal Crucis 1775 erfolgt, über die der Geschworene festhielt: „St Johannis Reicher Seegen über
Schwartzbach
haben voriges Quartal das Tages Lichtloch nebst dem Stolln in guter Reparatur gebracht, den Betrieb des Stolln Ortes betreffend, so wird solches auf dem Johannes Reichen Seegen flachstreichenden Fundgange in Mitternacht auf 1/3 bey 2 Zoll mächtigen Quartz, Horn mit angelaßnen Kobold Schwärtze fort getrieben.“ Die Notiz 1/3 meint, daß die Grube nur mit einer Schicht (einem von drei Dritteln) belegt war. Die letzte Erwähnung dieser Grube in dieser Quelle bilden dann drei Befahrungen im Jahr 1777, über welche es fast wortgleich jedesmal heißt: „St Johannis Reicher Seegen über
Schwartzbach
fahren mit dem Stollnort flachgangweiße in Mitternacht, der Gang drey auch vier Querfinger von Quartz, Horn, Gülben und ausgestreckten Koboldischen Kieß bestehend.“ (Remniscere 1777) Im folgenden Quartal Trinitatis befand Hildebrandt den Gang „4 bis 6 Zoll mächtig“ und Crucis 1777 „der Gang 5 bis 6 Zoll mächtig, und aus Quartz, Horn, braunem Kieß, mit Kobaldischen Beschlag bestehend.“ (40014, Nr. 139) Dies war die vorerst letzte Erwähnung dieser Grube in den Fahrbögen des Scheibenberger Reviers. Wieviel Vortrieb mit dieser minimalen Belegung in dieser Zeit noch vollbracht worden ist, hat der Geschworene nie nachgemessen. Viel kann es jedenfalls nicht gewesen sein, denn nebenbei war ja auch der Ausbau von Stolln und Lichtloch in Ordnung zu halten... Aus diesem Quartal (vom 2. Juni 1777) gibt es aber auch noch einen Aufstand (40014, Nr. 39, Blatt 36), in dem es heißt:
Aufstand und Grubenbericht
„Da bey diesem Gebäude auf dem flachgangweiß streichenden Gang (schwer leserlich ?) das Stolln Feld Ort gegen Mitternacht gegen (schwer leserlich: 80 ?) Lachter fortgebracht worden, das beste Verbauen zu sehen ist, mit weiterem Auffahren in edle Mittel zu gelangen, inmaaßen darzu die für solchem Stolln Orte ab und zu noch immer einbrechenden Gangarten die größte Hoffnung machen...“ Das klingt doch alles sehr bekannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch einmal fast 20 Jahre später taucht
dieselbe Grube dann
wieder auf: Am 24. Februar 1794 wurde „nach
vorhergegangenem Freifahren durch den Geschw. Körbach und auf dessen mündliches
Anbringen dem Muther Carl Friedrich Wellner zum Besten der Cathariner
Gewerkschaft
1.) der im Freyen liegende, am Rudenbächer Gebirge in das Herrn Erbrichter Baumann zu Schwarzbach Erbwaldung gelegene und ehemals von dem Herrn (Bader Meyer?) in Scheibenberg in der Stunde 11 betriebene Johannes Reicher Seegen Gottes auf Silber, Rauschgelb alle Metalle und Minerale mit allen einem Stolln nach der gnädigsten Stollnordnung de ao. 1748 zukommenden Rechten bestätigt. Ingleichen 2.) eine Fundgrube auf einem in 55 Lachter Länge des vorhergedachten Stollns überfahrenen Morgengang unter dem Nahmen David gleichfalls auf Silber, Rauschgelb, alle Metalle und Minerale.“ (40014, Nr. 43, Blatt 166f) Die Grube St. Katharina am Graul belieferte schon immer die Vitriolwerke bei Stamm Asser und in Beierfeld mit Kieserzen und da hier das ,Rauschgelb‘ explizit in der Verleihung benannt ist, wird das Interesse der Gewerkschaft an der alten Grube verständlich. Selbstverständlich erscheint sie nun auch wieder in den Fahrbögen des jetzt in Scheibenberg amtierenden Geschworenen Johann Samuel Körbach. Von seiner Befahrung im Quartal Crucis 1794 berichtete dieser an das Bergamt zu Scheibenberg (40014, Nr. 185, Film 0111): Johannis reichen Seegen Stolln bey Schwarzbach gelegen. „Es wird vom Mundloch herein bey 55 Lachter Länge in Nord auf dem flachen Gang ein Versuch mit Überhauen gemacht, der Gang bestund aus 4 bis 6 Zoll arsenical Kieß, wird ferner mit 2 Mann fortgestellt, Der Quärschlag, welcher vom Mundloch herein bey 55¼ Lachter Länge auf dem übersetzenden grauen Wacken Gang in Abend betrieben wurde zu Ausrichtung arsenical Kieße (unleserlich: vielleicht ,keine Anbrüche´?) erlangt hat, so ist solcher eingestellt worden und wird mit dieser Mannschaft das bemerkte Überhauen betrieben.“ Ein Jahr später hat der Berggeschworene die Grube wieder befahren und notierte darüber (40014, Nr. 193, Film 0014): Fahrbogen über Johannis Reichen Seegen Gottes Stolln am Rundenbecher Gebirge in Scheibenberger Bergamts Refier im Quartal Trinitatis 1795 No. 2te Woche „Allhier wird der Bau mit 2 Mann vom Stolln Mundloch herein bey 55 Lachter Länge in Mitternacht auf einem flach streichenden Gange fürstweis Überhauen, der Gang in selbigen bestand aus 3 bis 6 Zoll Mächtigkeit führt aufgelösten Gneus mit (?) einbrechendem arsenical Kieß. Solches Überhaun wahr von der Stollnfürste mit 4 Ellen Länge und 3 Ellen Höhe ausgehauen, wird fernerweit betrieben.“ Was Herr Körbach hier mit der Ortsangabe „am Rundenbecher Gebirge“ meinte, ist uns noch unklar. Bei seiner nächsten Befahrung im Quartal Reminiscere 1796 erwähnte er einen solchen Ort jedenfalls nicht mehr (40014, Nr. 193, Film 0039): Johannis Reichen Seegen Stolln zu Schwarzbach. „Allhier wird vom Stollnmundloch herein 5+6 Ltr. Entfernung in Mitternacht auf einem Flachgang mit 3 Mann überhauen, war gegen 2 Ltr. hoch überhauen, bestund der Gang aus 8 Zoll mächtigen aufgelösten Gneis, Quarz und einbrechende arsenical Kies.“ 15. Februar 1796 Fast gleichlautend ist auch die Notiz über die Befahrung im Juli 1796 (40014, Nr. 193, Film 0047), wonach er befand „das Stollnort mit 1 Häuer und 1 Jungen beleget, war vom Mundloch flach und stehende Gangweiß in Nord 69 Lachter erlenget, wendet in Stunde 1, der Gang bestund aus 3 bis 4 Zoll aufgelöstem Gneis mit etwas einbrechenden arsenical Kieße, wird solches Ort fernerweits in gedachter Richtung fortgebracht, den Gang mit edeln Erzen auszurichten, betrieben.“ Man glaubte immer noch unerschütterlich daran, hier „edle Erze“ auffinden zu können... Ende 1796 hatte man den Stolln auf diese Weise auf 72½ Ltr. erlängt. Der verfolgte Gang besaß nur 3 bis 4 Zoll Mächtigkeit und „führt aufgelösten Gneis und ab und zu etwas einbrechende Schwefel und arsenical Kiese.“ Nun, das klingt alles nicht wirklich nach einem vielversprechenden Ergebnis... Im nächsten Winterhalbjahr (Reminiscere 1797) notierte Herr Körbach, er habe „den Stolln halb zwölf Uhr fürmittags unbeleget befunden.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da wir keine weiteren Fahrberichte zu dieser
Grube gefunden haben, dürfte dies wohl auch das Ende ihres Betriebes gewesen
sein... In den Quartalen Trinitatis 1794, Crucis und Luciae 1795 ist sie in
dieser letzten Betriebsphase noch in den Erzlieferungsextrakten sächsischer
Bergreviere (40166, Nr. 22) aufgeführt und hat demnach in dieser Zeit 79 Zentner
,Arsenikkiese und Rauschgelbkiese' ausgebracht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Gott segne
beständig Fundgrube am Roten Hahn bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gehen wir nun auf die Geschichte einiger weiterer Gruben aus dieser Betriebsphase ‒ die durch Bergamtsakten weitaus besser dokumentiert und überliefert ist ‒ näher ein. Das dazu überlieferte Material erwies sich bei unseren Recherchen als äußerst umfangreich. Unsere folgende Zusammenstellung stellt deshalb keine Wertung hinsichtlich Betriebsdauer, Ausbringen oder sonstiger Bedeutung einzelner Gruben dar; sie hat sich vielmehr im Laufe der Recherchen „so ergeben“. Wir hoffen aber, mit unserer etwas willkürlich entstandenen Auswahl trotzdem Typisches zum Grubenbetrieb ganz unterschiedlicher Bergwerke mitteilen zu können. Am Ende des Kapitels schließt sich noch ein Abschnitt zu weiteren Gruben, die wir gewissermaßen „nebenbei“ in den Akten auch noch gefunden haben, in diesem Revierteil und aus dieser Zeit an. Wir ordnen die nun folgende Faktensammlung zu diesen Bergwerken nicht zeitlich (nach dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme), sondern räumlich (von West nach Ost ‒ im unteren Schwarzbachtal am Roten Hahn beginnend talaufwärts) und machen dazu einen Sprung hinunter nach Langenberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Anfang machen wir auf diese Weise mit der Grube
Gott segne beständig, die rechts des Schwarzbachs, schon am Fuß des
Graul, gelegen hat. In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere
(40166, Nr. 22 und 26) ist eine Grube dieses Namens im Zeitraum zwischen 1835 und
1866 aufgeführt. In dieser Zeit hat sie fast ausschließlich Braunstein
ausgebracht (1.467 Zentner ≈ 75 t), nur im Jahr 1860 ist daneben ein
Ausbringen von 18 Fudern Eisenstein vermerkt. Es gab aber noch eine zweite
Grube desselben Namens innerhalb des Scheibenberg'er Reviers und
zwar viel weiter östlich im
Nach dem 1875 von Markscheider H. M. Reichelt gefertigten Rollriß (40040, Nr. L8310) hat diese Grube ‒ jedenfalls zu dieser Zeit ‒ westlich des Mundloches des Sieben Brüder Stollns gelegen. Damit aber lag die im Folgenden beschriebene Grube bereits jenseits der Grenze zum damaligen Schneeberg'er Bergrevier. Wahrscheinlich aus diesem Grund ist sie in den Fahrbögen des in den 1830er Jahren in Scheibenberg zuständigen Berggeschworenen Johann August Karl Gebler auch nie ausdrücklich genannt (40014, Nr. 289 und 294). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vermutlich ist die
Grube nach einer ersten Betriebsphase in den 1830er Jahren aber wieder ins
Freie gefallen. Eine neue Mutung erfolgte erst 1851: Am 8. Oktober dieses
Jahres erhielt Friedrich August Kautzsch, allerdings unter dem
Namen Gut Glück Fundgrube eine gevierte Fundgrube bestätigt (40169, Nr. 135, Blatt 1).
Bei dem Namen dieses Lehnträgers fallen uns gleich noch weitere
In dem auf die Periode 1855 bis 1857 eingereichten ,Betriebs- und Oeconomieplan' trägt die Grube dann wieder den früheren Namen Gott segne beständig Erbstolln (40169, Nr. 135, Blatt 2ff). Da inzwischen auch die Umstellung der alten Flächen nach den Vorgaben des Berggesetzes von 1851 erfolgt war, umfaßte deren Grubenfeld nun einen Stolln und zwei Maßeinheiten (zirka 2.000 Quadratlachter Grubenfeld). Der Beschreibung in diesem Betriebsplan zufolge baute man auf einem in Glimmerschiefer eingebetteten Roteisensteinlager, welches ein Streichen von Stunde 6, ein Fallen von 30 Grad in West sowie die beachtliche Mächtigkeit von 7 bis 8 Lachtern aufwies. „In Ermangelung ausreichenden Absatzes“ lag die Grube 1855 allerdings in Fristen. Für die beiden Folgejahre plante Herr Kautzsch nur 10 Lachter vom Mundloch des Stollns entfernt einen etwa 8 Lachter tiefen Schacht neu abzusenken und von diesem aus Feldstrecken im Streichen des Lagers zu treiben. Dabei wollte er 1856 eine Menge von 40 und 1857 von 70 Fudern Eisenstein gewinnen. Der Roteisenstein sollte für den hohen Preis von 3 Thalern, 15 Groschen pro Fuder verkauft werden. Weil die Grube jenseits der Westgrenze des Scheibenberg'er Bergreviers lag, wurde der Betriebsplan durch den Geschworenen Lippmann in Johanngeorgenstadt begutachtet, der am 10. Mai 1856 dort referierte, daß man eigentlich im Quarzbrockenfels baue, in welchem Rot- und Brauneisenstein einbreche. Die Eigenlehner zahlten sich selbst nur 3 Neugroschen pro verfahrener Schicht. Letzteres sagt uns, daß es zu dieser Zeit noch mehrere Gesellen gegeben haben muß. Der Betriebsplan wurde jedenfalls für zweckmäßig erachtet und am 26. Mai 1856 auch vom Oberbergamt in Freiberg genehmigt (40169, Nr. 135, Blatt 7), was man einige Tage später dem Lehnträger Kautzsch mitteilte, zugleich aber auf die noch ausstehende Benennung von Schichtmeister und Steiger verwies. Als Schichtmeister benannte Herr Kautzsch daraufhin am 5. Juli 1857 Christian Carl Gottlieb Schubert aus Crandorf (ein Name der uns noch öfter begegnen wird) und als Steiger David Wenzel vom Junge St. Katharina Stolln, welcher die Funktion für die quasi gegenüberliegende Grube mit übernehmen solle (40169, Nr. 135, Blatt 10). Nach der Umstrukturierung der westerzgebirgischen Bergämter 1856 wurden beide am 18. Juli 1857 und nun schon vom wiederbegründeten Bergamt Schwarzenberg in ihrer Funktion bestätigt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf das Jahr 1856 findet man eine Anzeige über Haushalt und Grubenbetrieb in den Akten (40169, Nr. 135, Blatt 9). Sie ist bereits von oben genanntem Schichtmeister und von Friedrich August Kautzsch unterzeichnet, der jetzt jedoch „Alleineigenthümer“ hinzusetzte. Die Grube hat demnach noch bis Reminiscere 1856 in Fristen gelegen, danach hatte man den geplanten Schacht 5 Lachter tief abgesunken, offenbar schon bei 4 Lachter Teufe das Lager erreicht und dort ein erstes Streckenort angehauen. Dort hatte man 134/5 Fuder Eisenstein gewonnen und für 48 Thaler, 9 Groschen verkauft. Für das Jahr 1857 zeigte Schichtmeister Schubert dann an, man habe den Schacht bis auf 7 Lachter weiter abgesenkt und das Streckenort in 4 Lachter Teufe auf nun 5 Lachter Länge fortgestellt. Die Grube war nur mit zwei Weilarbeitern belegt. Ein Ausbringen gab es in diesem Jahr nicht (40169, Nr. 135, Blatt 14). Stattdessen ließ dich Alleinbesitzer Kautzsch am 24. Juli 1858 weitere 4.345 Quadratlachter Grubenfeld nachverleihen, so daß es insgesamt nun 6.109 Quadratlachter Fläche oder 7 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 135, Rückseite Blatt 14f). Aus der Anzeige des Schichtmeisters auf das Jahr 1858 geht hervor, daß man von der Feldstrecke aus ein Versuchsort 6,5 Lachter gegen Abend ausgelängt und dort ein Gesenk angelegt habe. Außerdem liest man hier überrascht, daß zusammen mit dem vergrößerten Grubenfeld nun auch der Sieben Brüder Stolln zur Grube gehörte. Auf diesem hatte man jedenfalls 20 Lachter (später sind 23 Lachter angegeben) vom Mundloch einen Flügel 4 Lachter gegen Abend getrieben und dort einen Firstenbau „neben alten Preßbauen“ angesetzt. Auch habe eine „Wasserfluth“ einen Bruch auf dem Hauptstolln verursacht, den man wieder gewältigt hatte. Bei all dem wurden 90 Zentner Braunstein gewonnen und für 84 Thaler, 5 Neugroschen (also den Zentner für rund 28 Groschen) verkauft (40169, Nr. 135, Blatt 16). Der Sieben Brüder Stollen stand – zu verschiedenen Zeiten – sowohl mit der in diesem Kapitel beschriebenen Grube Gott segne beständig, als auch mit der im folgenden Kapitel beschriebenen, benachbarten Grube Gnade Gottes in Zusammenhang und soll daher nun zunächst einen eigenen Abschnitt erhalten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sieben Brüder Stolln samt
Karl Heinrich Fundgrube am Roten Hahn
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Gegensatz zu allen auf der Scheibenberg‘er Seite der Reviergrenze gelegenen Eisenerz- und Braunsteingruben gibt es unter diesem Namen Zechenregister, deren Folge im Quartal Crucis 1819 beginnt und zunächst bis Luciae 1824 reicht (40186, Nr. 44791 bis 44797). Vielleicht hängt dies damit zusammen, daß sein Mundloch bereits jenseits der Reviergrenze im schneebergischen Bergamtsbezirk gelegen hat. Es gab allerdings noch eine
zweite Grube dieses
Dieser Sieben Brüder Stolln wurde dem Lehnträger Carl August Hilbert wahrscheinlich Anfang 1819 bestätigt und umfaßte eine Fundgrube sowie den Stolln. Das älteste Einlegeregister zu dieser Eigenlehnerzeche ist vom „Rechnungsführer“ Heinrich Hieronymus Kunz aufgesetzt, beinhaltet die Quartale Crucis und Luciae 1819 und weist neben dem Lehnträger selbst noch Carl Friedrich Lang, Christian Gotthilf Richter und Heinrich Lang als Mitgesellen aus. Als Geschworener zeichnete es Johann Traugott Scheidhauer aus Schneeberg ab; weil es nur eine Eigenlehnerzeche gewesen ist, war kein Schichtmeister bestellt (40186, Nr. 44791). Beim Stollnvortrieb hatte man Luciae 1819 gleich 40 Zentner Braunstein gewinnen und für 13 Thaler, 8 Groschen (folglich den Zentner zu 8 Groschen) an einen Kaufmann Friedrich Lindner in Schneeberg verkaufen können. Auch Reminiscere und Trinitatis 1820 stellte man das Stollnort um 4¾ Lachter Länge fort und brachte dabei 52 Zentner Braunstein aus (40186, Nr. 44792). Dazu verfuhren die vier Gesellen jeder je 18 ledige Schichten auf ihrer Grube. Ein eigenes Inventarium besaß die Grube nicht, vielmehr brachten die Gesellen ihr eigenes Gezähe zur Arbeit mit. Nur die Schmiedekosten und die Bergamtsgebühren wurden geteilt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem Register auf die zweite Jahreshälfte ist dann zu entnehmen, daß man erneut 50 Zentner Braunstein ausgebracht hatte (40186, Nr. 44793). Allerdings ist als „Gewerkschaft“ nun nur noch der Lehnträger Hilbert angeführt, dem alle 128 Kuxe gehörten. Auch im folgenden Frühjahr 1821 verfuhren die vier Gesellen wieder jeder 30 ledige Schichten, brachten dabei das Stollnort um 5 Lachter voran und erneut 100 Zentner Braunstein aus (40186, Nr. 44794). Im zweiten Halbjahr 1821 verfuhren die Gesellen jeder sogar 65 Schichten. Das Stollnort wurde um 6½ Lachter fortgestellt, „die Sohle und die Förste etwas preßgehauen und dabey 120 Centner Braunstein gewonnen“ (40186, Nr. 44795). Die Sache ließ sich doch offenkundig ganz gut an… Für die Quartale Reminiscere und Trinitatis 1822 fehlen Einlegeregister – möglicherweise ist die Grube also unbelegt geblieben. Die nächsten datieren auf das zweite Halbjahr 1822 (40186, Nr. 44796). Darin heißt es, in je 32 durch die vier Gesellen verfahrenen, ledigen Schichten haben sie das Stollnort in diesem Halbjahr um weitere 5½ Lachter fortgestellt. Aus dem vorigen Abschluß (dem fehlenden) seien noch 9 Fuder Eisensteinvorrat verblieben, dazu habe man weitere 7 Fuder gewonnen und diese 16 Fuder Eisenerz für 21 Thaler, 8 Groschen, das Fuder also zu 1 Thaler, 8 Groschen verkaufen können. Außerdem wurden auch 17 Zentner Braunstein gefördert und verkauft, so daß das gesamte Ausbringen bis zu diesem Zeitpunkt nun 679 Zentner Braunstein und 16 Fuder Eisenerz erreicht hatte. In diesem Quartal hatte man somit Einnahmen aus dem Erzverkauf in Höhe von 27 Thalern erreicht. Dem standen Kosten von 23 Thalern, 6 Groschen, 8 Pfennigen gegenüber. Die Differenz von 3 Thalern, 17 Groschen, 4 Pfennigen „wurden dem Eigenlöhner an Receß bezahlt,“ womit sich die Summe von Einnahmen und Ausgaben auf eine schwarze Null belief. Als Geschworener zeichnete dieses Register nun ein Herr Carl Christian Martini ab, Hieronymus Kunz ist weiter Rechnungsführer der Gesellenschaft. Aus dem Jahr 1823 fehlen wieder Register. Im nächsten sind gleich alle vier Quartale des Jahres 1824 zusammengefaßt (40186, Nr. 44797). In diesem Jahr hatten die Gesellen in 24 gemeinsamen ledigen Schichten das Stollnort um weitere 3 Lachter ausgelängt und dabei 7 Fuder Eisenstein und 12 Zentner Braunstein gewinnen können. Wenn wir die vorliegenden Zahlen richtig addiert haben, hatte der Stolln bis dahin wenigstens 24¾ Lachter Länge erreicht. Danach setzen die überlieferten Zechenregister aber erst einmal aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Just um dieselbe Zeit, in der erstmals Zechenregister zum Sieben Brüder Stolln vorliegen, nämlich Reminiscere 1820, wurde auch der Gnade Gottes’er Wasserlösestolln durch die gleichnamige Grube im Schwarzbachtal nach Norden angeschlagen, welcher aber auf der scheibenbergischen Seite der Reviergrenze ansetzte. Er wurde – wie der Sieben Brüder Stolln auch – vom Schwarzbachtal aus nach Norden vorgetrieben, kam nach 109 Lachter Länge im März 1821 im Tageschacht ein und wurde in der Folgezeit zur Untersuchung des Gebirges noch weiter ausgelängt. 1829 wurde eine Wasserkunst nahe des Stollnmundlochs und ein Feldgestänge übertage bis zum Tageschacht errichtet, um auch unterhalb der Stollnsohle abbauen zu können. 1826 (also zu dem Zeitpunkt, als die Zechenregister von Sieben Brüder Stolln gerade wieder aussetzten) erwähnte dann Geschworener Gebler in Zusammenhang mit der Gnade Gottes Fdgr. den Sieben Brüder Stolln und machte den Vorschlag, einen Flügel von diesem bis unter Gnade Gottes zu treiben, weil dieser dort einige Lachter mehr Teufe einbringen würde. Tatsächlich hat man in einer späteren Betriebsphase nach 1870 diesen Plan aufgegriffen und einen Stollnflügel in Richtung Nordosten bis zur früheren Gnade Gottes Fundgrube getrieben. Aus der zweiten Betriebsphase gibt es wieder Zechenregister vom Sieben Brüder Stolln, welche fast durchgehend bis zum Quartal Trinitatis 1853 reichen (40186, Nr. 44798 bis 44810). Zwei Risse zu dieser Grube und dem Stolln datieren auf das Jahr 1851 (40040, Nr. H8619 und H8620). Grubenakten unter dem Namen des Sieben Brüder Stollns gibt es dagegen nur eine einzige, in welcher er nun zusammen mit einer Karl Heinrich Fundgrube „am Roten Hahn“ genannt ist. Diese Akte beinhaltet allerdings im wesentlichen nur die Lossagung dieser Fundgrube „samt Sieben Brüder Stolln“ durch den Bergarbeiter und Grubenbesitzer Weißflog vom 27. September 1853 (40169, Nr. 1562, Blatt 1). Geschworener Julius Lippmann aus Johanngeorgenstadt (wie wir in unserem Abschnitt zur Bergverwaltung schon erwähnten, wurde das alte Bergamt Schwarzenberg ja 1772 aufgelöst und dessen Revier zum Teil dem Bergamt in Johanngeorgenstadt zugeschlagen) hat noch eine Schlußbefahrung durchgeführt, worüber er am 6. Oktober 1853 nach Annaberg berichtete, auf der Grube sei „Roth- und Brauneisenstein in unregelmäßigen Butzen, Nieren und Trümern“ gebrochen und der letzte Besitzer habe den Stolln auf 40 Lachter vom Mundloch gewältigt, dort ganzes Ort erreicht und dabei „nur unmaßgebliche Spuren von Braunstein“ gefunden. Weil die Kosten für einen weiteren Vortrieb seine Kräfte überstiegen, habe Bergarbeiter Weißflog den Betrieb schon Anfang 1853 eingestellt (40169, Nr. 1562, Blatt 3f). Wie wir im nächsten Kapitel noch ausführlich berichten, ist dann im Jahr 1844 der rund 12 Lachter (24 m) tiefe Kunstschacht von Gnade Gottes Fundgrube verbrochen. Mit Hilfe der Wasserkunst hatte man zuvor noch einmal 12 m Teufe unter dem Gnade Gottes Stolln (das waren dann also rund 36 m unter der Oberfläche) erschließen können. Von diesem Zeitpunkt an ging es auf dieser Grube mit dem Eisenerzabbau bergab. Die Tiefbaue unter dem Stolln sind natürlich ersoffen und das Aufsuchen neuer Erzmittel auf der Stollnsohle war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Auf einer Croquis aus dem Jahr 1864 zum Grubenfeld von Gott segne beständig ist neben dem Sieben Brüder Stolln auch eine Halde samt Pinge enthalten und hier mit Gnade Gottes Kunstschacht bezeichnet (40040, Nr. A7393). Das brachte uns auf die richtige Spur, wie diese drei Gruben in räumlichen Zusammenhang gestanden haben. Auf einem weiteren Riß zur Grube Gott segne beständig samt Sieben Brüder Stolln aus späterer Zeit ist nämlich genau derselbe Punkt dann mit Virginienschacht bezeichnet. Man hatte also nach 1870 die alten Gnade Gottes’er Baue in nun knapp 28 m Teufe (also nur 4 m tiefer als der Gnade Gottes Stolln) noch einmal mit dem Flügel des Sieben Brüder Stollns angefahren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
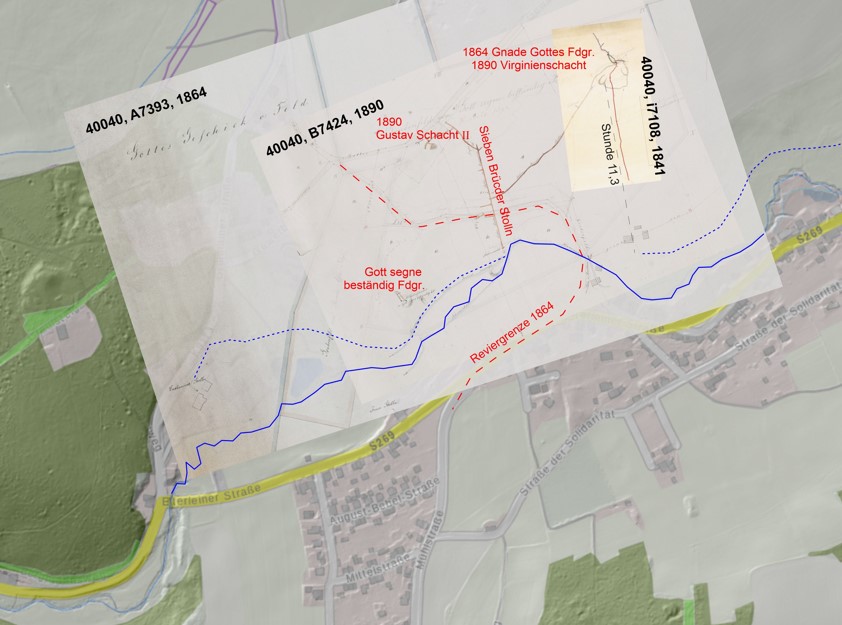 Wir versuchen, die überlieferten Risse einzunorden und in die heutige Topographie einzupassen. Glücklicherweise haben die alten Markscheider diesmal einige wenige Oberflächenpunkte, wie den Anfang des Katharinaer Kunstgrabens und den früheren Straßenverlauf, welcher zu dieser Zeit die Reviergrenze bildete (die sich vom Mönchsteig aus in einer ,Beule' ostwärts verschoben hatte), eingezeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dasselbe noch einmal mit ausgeblendeten Altrissen: Der spätere Virginienschacht ist also mit dem Kunstschacht von Gnade Gottes identisch oder lag zumindest im gleichen Bereich. Jetzt haben wir auch eine Vorstellung davon, wo wir nach den Resten dieser Gruben im Gelände suchen müssen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zunächst aber nahm in der ersten Hälfte des Jahres 1840 eine neue Gesellenschaft den Sieben Brüder Stolln wieder auf. Für die Quartale Crucis 1840 bis einschließlich Luciae 1840 gibt es wieder Einlegeregister, aus denen hervorgeht, daß Carl Friedrich Wilhelm Oeser aus Raschau nun Lehnträger der Grube ist und der zugehörigen gevierten Fundgrube den Namen Karl Heinrich gegeben hat (40186, Nr. 44798). Neben dem Lehnträger wird im folgenden Jahr noch Friedrich August Oeser als Mitgeselle angeführt. Der Grubenbericht sagt aus, daß Herr Oeser zwei Knechte auf der Grube angelegt hatte, „durch welche das Siebenbrüdner Stollnort in dem dortigen mächtigen Quarzlager, welches mit schmalen Trümern von Braunstein und Schwarzeisenstein durchzigen ist, 2 Lachter Stunde 6 gegen Abend gewältigungsweise in Thürstockzimmerung forgebracht wurde, auch sonst aufm Stolln die Zimmerung in gehörigem Zustand unterhalten worden ist. Das Stollnort ist überhaupt vom Mundloche 29 Lachter fortgebracht.“ Die Zubußen von 18 Thalern, 17 Groschen, 4 Pfennigen trug der Lehnträger selbst. Ein Ausbringen gab es nicht. Im Jahr 1843 verfuhren die beiden Gesellen im Quartal Luciae beide 74 ledige Schichten auf dem Stolln, schlugen bei 27 Lachter Länge „auf dem dort aufsetzenden Quarzlager“ ein und längten dieses Ort um 3 Lachter aus (40186, Nr. 44799). Die übrigen drei Quartale wurde die Grube in Fristen gehalten. Ein Ausbringen gab es auch diesmal nicht zu verzeichnen. Der Lehnträger brachte über 29 Thaler Zubußen auf, jedoch summierten sich die Kosten auf über 33 Thaler, so daß rund 4 Thaler Grubenschuld verblieben. So lief es auch im Jahr 1844 weiter: Luciae 1844 verfuhr Carl Friedrich Wilhelm Oeser 78 ledige Schichten, sein Mitgeselle Friedrich August Oeser deren 60, die übrigen drei Quartale blieb die Grube unbelegt in Fristen (40186, Nr. 44800). Man hatte das Stollnort um 1 Lachter erlängt und das Tragwerk im Stolln repariert – dabei aber kein Erzausbringen vorzuweisen. Der Rezeß wuchs daher nun auf über 76 Thaler an. Nicht anders verlief das Jahr 1845. Obwohl die beiden Gesellen Luciae 1845 zusammengenommen 162 Schichten verfahren hatten, fand nur „Gewältigung und Zimmerarbeit“ auf einem Ort gegen Nordost bei 33 Lachter vom Mundloch herein statt, welches man auf 6 Lachter fahrbar machte (40186, Nr. 44801). Im folgenden Jahr 1846 fuhren die beiden nur im Quartal Reminiscere an, gewältigten besagtes Ort um weitere 3 Lachter, wobei auch die anstehende Strosse nachgebracht worden ist (40186, Nr. 44802). Da es auch jetzt keine Einnahmen aus Erzverkauf gab, stieg der Rezeß weiter und summierte sich inzwischen auf 143 Thaler. Danach waren die Arbeiten wieder unterbrochen und 1847 war die Grube nur Luciae belegt (40186, Nr. 44803). In dieser Zeit wurden weitere 2 Lachter „Altung“ gewältigt, nachgestroßt und ausgezimmert. Bis Schluß Luciae 1849 hatten die beiden auf diese Weise 49 Lachter Stollnlänge vom Mundloch herein (wobei möglicherweise aber Querschläge eingerechnet worden sind) wieder fahrbar hergestellt, sonst aber keine Einnahmen erzielt. Der Rezeß war folglich auf 196 Thaler angewachsen (40186, Nr. 44804 und 44805).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1850 hat Herr Oeser seine 128 Kuxe dann an Christian Gotthold Erdmann Weißflog verkauft (40186, Nr. 44806). Der neue Besitzer hat im Quartal Luciae 60 ledige Schichten verfahren, dabei bei 26 Lachter Länge des Stollns auf einem 10 Zoll mächtigen Trum aus Quarz, Hornstein und „Manganerz“ gegen Abend eingeschlagen und dieses Ort 2 Lachter ausgelängt. Einnahmen aus Erzverkauf gab es auch jetzt aber nicht. Auch 1851 war die Grube nur im Quartal Luciae gangbar, in dem der neue Besitzer 70 Schichten und Friedrich August Oeser (der war also noch dabei) 15 Schichten verfuhren (40186, Nr. 44807). Im Grubenbericht heißt es, sie seien „mit dem Stollnorte gegen Nordost um 6 Lachter weiter fortgerückt,“ so daß dieses nun 32 Lachter ausgelängt sei (wohl nur das Hauptstollnort ohne Flügelörter, von denen es ja schon einige gab). Im Jahr darauf wurde das Einlegeregister wieder „vom Lehnträger“ Friedrich August Oeser geführt, Herr Weißflog besaß jedoch weiter alle 128 Kuxe (40186, Nr. 44808). In den beiden Quartalen Reminiscere und Trinitatis des Jahres 1852 haben beide je 150 Schichten in Weilarbeit verfahren und das Stollnort um weitere 8 Lachter „gewältigt“, so daß man nun bei 40 Lachter vom Mundloch gestanden hat. Bei dieser Länge wurde ein Braunsteintrum durchfahren, aus welchem 5 Zentner Braunstein gefördert wurden, den sie für 2 Thaler, 10 Groschen (respektive nun für 14 Groschen den Zentner) verkaufen konnten. Dieser Betrag stand natürlich in keinem vernünftigen Verhältnis zum aufgelaufenen Rezeß, der inzwischen über 283 Thaler betrug. Nebenbei erfährt man aus diesem Register noch, daß die beiden auf der Grube Gottes Geschick am Graul „in wirklicher Bergarbeit“ gestanden haben. Das Register auf Reminiscere 1853 ist wieder von Herrn Weißflog als Lehnträger gefertigt (40186, Nr. 44809). Auf dem bei 40 Lachter Stollnlänge überfahrenen Trum hatte man 3 Lachter gegen Abend ausgelängt und „nesterweise einbrechenden Braunstein“ getroffen, von dem man weitere 14 Zentner gefördert hatte. Die blieben allerdings im Vorrat. Trinitatis 1853 schlugen die beiden Gesellen dann auf einem Trum bei 30 Lachter vom Mundloch herein ein, längten auch hier 3 Lachter „gegen Mittag“ (rückwärts...?) aus und brachten weitere 5 Zentner Braunstein zutage, so daß nun 19 Zentner davon im Vorrat lagen. Der Rezeß hatte bis dahin eine Summe von 328 Thalern überschritten. Damit endet die Überlieferung der Zechenregister, so daß zu vermuten ist, daß auch dieser Lehnträger danach wieder aufgegeben hat. Wie wir oben schon gelesen haben, ging die Karl Heinrich Fundgrube samt Sieben Brüder Stolln danach im Feld von Gott segne beständig auf. Durch deren Besitzer wurden auch die Flügelörter weiter getrieben, wie es auf den folgenden Rissen aus späterer Zeit zu erkennen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zurück zur Grube Gott segne beständig: Wegen „fehlenden Absatzes“ beantragte Herr Kautzsch schon für das folgende Jahr 1859 wieder Fristhaltung für die Grube (40169, Nr. 135, Blatt 17). Der Schichtmeister reichte für dieses Jahr demzufolge auch einen ,Vacatschein' ein, auf dem das ,Vacat' jedoch wieder gestrichen und nachträglich eingefügt wurde, es habe doch ein geringer Abbau auf dem Sieben Brüder Stolln stattgefunden (40169, Nr. 135, Blatt 19). Ausweislich der nächsten Anzeige auf das Jahr 1860 hat die Grube auch in diesem Jahr Reminiscere und Trinitatis in Fristen gelegen. In der zweiten Jahreshälfte wurde jedoch die Untersuchungsstrecke auf dem Sieben Brüder Stolln wieder belegt und auch das Gesenk von der 4 Lachter- Sohle am Tageschacht von Gott segne beständig weiter abgesunken. Dabei hatte man immerhin 18 Fuder Eisenstein und 25 Zentner Braunstein ausgebracht und für 74 Thaler, 8 Neugroschen verkaufen können (40169, Nr. 135, Blatt 21). So ähnlich begann wohl auch das folgende Jahr, denn Geschworener Lippmann fand die Grube bei seiner Anwesenheit am 5. April 1861 unbelegt (40169, Nr. 135, Blatt 22). Außerdem befand er die Schachtkaue desolat, woraufhin bergamtliche Verordnung zur Instandsetzung derselben an den Eigentümer erging. Wie der Anzeige von Schichtmeister Schubert auf das Jahr 1861 (40169, Nr. 135, Blatt 24) zu entnehmen ist, hat man daraufhin in diesem Jahr gleich den ganzen Tageschacht neu verzimmert und ihn um ein weiteres Lachter verteuft. Dazu waren nun 3 Häuer und 1 Weilarbeiter angelegt, durch welche außerdem eine Feldstrecke vom Sieben Brüder Stolln gegen Morgen „zur Untersuchung des dasigen Braunsteinlagers“ 7 Lachter ausgelängt worden ist. Hinter dem Streckenort hat man Braunstein „aus den Stößen und der Förste“ gewonnen. Auch den Querschlag nach der Gegenseite hatte man bis auf 8 Lachter Länge vom Hauptstolln fortgebracht und dort „Nester von Braunstein“ angetroffen. Bei diesen Arbeiten wurden 82 Zentner Braunstein ausgebracht und für 68 Thaler und 10 Neugroschen (respektive den Zentner für 25 Groschen) verkauft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Geschichte ist uns nicht ganz klar geworden, doch vermutlich hatte Herr Kautzsch im folgenden Jahr versucht, das Gebäude zu verkaufen, ist damit jedoch gescheitert. Jedenfalls beschwerte sich der Kalkmacher Christan Friedrich Weigel beim Bergamt, daß der Haldensturz vor dem Mundloch des Sieben Brüder Stollns inzwischen die Wiesen seiner Mutter beeinträchtige. Daraufhin schrieb das Bergamt am 14. März 1862 an den Handelsmann Heinrich Wilhelm Merkel, er solle bei 5 Thaler Strafandrohung den Haldensturz bei dem „in seinen Besitz übergegangen Berggebäude“ abräumen (40169, Nr. 135, Blatt 25ff). Hierzu fanden am 13. Mai und am 6. September 1862 zwei Ortstermine statt, in deren Ergebnis aber das Bergamt dann erneut Herrn Kautzsch und vorsichtshalber auch „seinem angeblichen Besitznachfolger Merkel“ weiteren Haldensturz vor dem Mundloch des Stollns untersagte (40169, Nr. 135, Blatt 43). Ob es sich hier um
einen Verwandten der Bergarbeiterfamilie Merkel, die schon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit weiteren Unterbrechungen ging der Betrieb auf den beiden Gruben Gott segne beständig samt Sieben Brüder Stolln denn auch in gleicher Weise weiter fort. Auch 1862 waren 3 Mann hier angelegt, welche auf dem Abbau 23 Lachter vom Mundloch des Stollns in diesem Jahr etwa 13 Quadratlachter Lagerfläche bei 0,7 bis 0,9 Lachter Mächtigkeit ausgehauen haben. Auch am Tageschacht von Gott segne beständig hatte man in 8 Lachter Teufe einen Eisensteinbau etabliert. Dabei hatte man wieder 10 Fuder Eisenstein sowie 370 Zentner Braunstein gefördert, konnte jedoch nichts davon verkaufen, so daß nun insgesamt 17 Fuder Eisenstein und 410 Zentner Braunstein im Vorrat liegen blieben (40169, Nr. 135, Blatt 46). Interessant ist hier noch der Vermerk, daß die 10 Fuder 180 Zentnern entsprachen, mithin das Fuder zu dieser Zeit auf dieser Grube zu 900 kg gerechnet worden ist. Bei seiner Befahrung am 15. Juli 1863 fand Geschworener Lippmann die Grube wieder unbelegt, zog Erkundigungen ein und schrieb dann in seinem Fahrbogen, daß seit acht Wochen kein Betrieb stattgefunden habe, aber nach seiner Kenntnis auch keine Fristhaltung beantragt worden ist (40169, Nr. 135, Rückseite Blatt 47). Daraufhin wurde Herr Kautzsch am 8. August 1863 vom Bergamt Schwarzenberg natürlich zur Wiederbelegung der Grube spätestens binnen vier Wochen aufgefordert (40169, Nr. 135, Blatt 48). Der aber beantragte, wieder wegen Absatzmangels, am 2. September Fristhaltung, was ihm auch genehmigt worden ist (40169, Nr. 135, Blatt 49f). Der Anzeige auf dieses Jahr 1863 zufolge, hat denn auch nur der Firstenbau 23 Lachter vom Mundloch des Sieben Brüder Stollns in Betrieb gestanden, wo man weitere 250 Zentner Braunstein abgebaut hatte. Immerhin konnte man von dem gesamten angesammelten Vorrat in diesem Jahr auch 648 Zentner Braunstein für 540 Thaler verkaufen (40169, Nr. 135, Blatt 51). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 3. Februar 1864 hat Herr Kautzsch die Grube (bzw. beide im Grubenfeld) dann doch verkauft und zwar für 75 Thaler an den Fabrikanten Ernst Erdmann Zweigler in Wildenau (40169, Nr. 135, Blatt 52). Besagter Ernst Erdmann Zweigler wurde in den Akten als ,Handelsmann' oder ,Fabrikant' benannt. Er hatte 1855 in Wildenau eine Knochenmühle errichtet (30016, Nr. 1777) und im Jahr 1862 dann mit dem Bau einer Holzschleiferei und Papierfabrik begonnen (30049, Nr. 3038). Sie wurde später von seinem Sohn Emil Zweigler als Pappen- und Kartonagenfabrik fortgeführt (wikipedia.de). Ob ihn die Arbeit im eigenen Unternehmen nicht auslastete oder ob er zuviel Kapital vor dem Zugriff der Steuerverwaltung zu retten hatte, können wir nicht wissen. Jedenfalls war die Familie Zweigler auch zuvor schon verschiedenenorts im Bergbau engagiert. Bereits vor 1832 gab es eine Zweiglers Fundgrube samt einem Zweigler Stolln am südlichen Hang des Schwarzbachtales zwischen dem Knochen und Wildenau gelegen (40169, Nr. 364) und 1840 wurde Friedrich August Zweigler unter demselben Namen wieder eine Fundgrube bei Wildenau verliehen (40169, Nr. 355). Von 1855 bis 1857 versuchte sich dann auch Ernst Erdmann Zweigler u. a. mit einem Bechers Glück Stolln am hinteren Rehhübel bei Oberwildenthal (40169, Nr. 455), ab 1868 mit der Rautenstock Fundgrube in Wildenau (40169, Nr. 1513) und ab 1873 mit einer Eisenzeche bei Großpöhla (40169, Nr. 590). Im Jahr 1897 schließlich ließ sich ein William Zweigler erneut eine Fundgrube unter dem Namen Zweiglers Hoffnung bei Wildenau verleihen (40169, Nr. 347). Nun erwarb Ernst Erdmann Zweigler sukzessive also auch einige der Grubenfelder in Langenberg. Außer Gott segne beständig folgten noch:
Für die Betriebsperiode 1864 bis 1866 reichte Herr Zweigler einen neuen Betriebsplan ein, nach dem er 4 Mann anlegen und auf dem Sieben Brüder Stolln weiter Braunstein abbauen wollte (40169, Nr. 135, Blatt 53ff). Ökonomisch blieb es zwar eine ,Null-Nummer', denn die veranschlagten Einnahmen deckten gerade die erwarteten Kosten, dennoch wurde der Plan am 20. Juli 1864 so auch vom Oberbergamt in Freiberg genehmigt. Der neue Besitzer ließ sich auch gleich weitere 3.658 Quadratlachter weiteres Grubenfeld nachverleihen, so daß dasselbe nun 9.767 Quadratlachter oder 10 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 135, Blatt 57). Außerdem zeigte er an, daß der bisherige Schichtmeister in seinem Amt bleiben solle und daß er als Steiger Friedrich August Hartmann von Riedels Fundgrube annehmen wolle. Wirklich passiert ist aber in diesem Jahr sonst nichts, denn Schichtmeister Schubert reichte für 1864 wieder einen Vacat- Schein ein (40169, Nr. 135, Blatt 58). Für das Jahr 1865 kann man dann der betreffenden Anzeige entnehmen, daß nun wieder 2 bis 3 Mann angelegt waren, welche zunächst den Sieben Brüder Stolln auf 75 Lachter Länge gewältigt haben. Der Abbau bei 23 Lachter Länge war wohl ausgeerzt und so wurden bei 45 Lachter vom Mundloch zwei neue Querschläge nach Westen 10 Lachter und nach Osten 2 Lachter getrieben. Dabei wurden 72 Zentner Braunstein ausgebracht und für 48 Thaler verkauft, während der Eisensteinvorrat auf Lager blieb (40169, Nr. 135, Blatt 61). Im nächsten Sommer beantragte aber auch Herr Zweigler wieder wegen Absatzmangels Fristhaltung, was ihm auch am 27. Juni 1866 genehmigt wurde. Außerdem ging Steiger Hartmann ab, worauf Steiger Merkel von Riedels Fundgrube den Dienst auf dieser Grube nun mit versorgen sollte (40169, Nr. 135, Blatt 62ff). Der Anzeige des Schichtmeisters zufolge hatte man bis dahin im ersten Halbjahr aber noch die Flügelorte bei 45 Lachter nach Westen bis 15,5 Lachter und nach Osten bis 16 Lachter ausgelängt. Auf dem ersteren hat man 3,5 Lachter westlich vom Hauptstolln ein Überhauen angelegt. Außerdem wurde bei 36 Lachter vom Mundloch des Sieben Brüder Stollns ein weiterer Querschlag nach Südost angehauen und 9 Lachter fortgestellt. Dabei wurden wieder 78 Zentner Braunstein ausgebracht und konnten auch für 52 Thaler verkauft werden (40169, Nr. 135, Blatt 65).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das war es dann aber auch... Für die Jahre 1867 und 1868 reichte Schichtmeister Schubert nur Vacat- Scheine ein ‒ der Betrieb kam also nicht wieder in Gang. Aufgrund dessen Ablebens mußte Herr Zweigler 1869 als neuen Schichtmeister Wilhelm (Herbert ?) Wagner aus Crandorf annehmen. Mit Albrecht Hartmann aus Mittweida gab es auch einen neuen Steiger. Wirklich etwas zu tun hatten beide aber nicht. Inzwischen war auch das Allgemeine Berggesetz für das Königreich Sachsen in Kraft getreten, die Bergämter waren durch Berginspektionen ersetzt worden und so fand die nächste Befahrung am 21. September 1871 durch den Inspektor Gustav Netto aus Zwickau statt. Der konnte zu diesem Zeitpunkt den Stolln (sicherlich wohl den Sieben Brüder Stolln) noch 25 Lachter vom Mundloch herein bis an einen dort entstandenen Bruch befahren, fand den Grubenbetrieb ansonsten aber seit drei Jahren eingestellt (40169, Nr. 135, Blatt 75ff). Daraufhin vom Landesbergamt in Freiberg zur Wiederinbetriebnahme aufgefordert, stellte Herr Zweigler am 14. Februar 1872 ein letztes Mal einen Antrag auf Verlängerung der Fristhaltung, welcher ihm auch ‒ nun von der II. Abteilung des Finanzministeriums ‒ genehmigt worden ist (40169, Nr. 135, Blatt 81). Am 13. Mai 1873 hat Herr Zweigler die Grube dann an den preußischen Kommerzienrat Hermann Gruson zu Buckau bei Magdeburg verkauft (40169, Nr. 135, Blatt 90). Die weitere Geschichte ist schnell erzählt. Ab Dezember 1877 ist das Grubenfeld in den Besitz der Societé Anonymes des Mines et Usines Hof - Plzen - Schwarzenberg mit Sitz in Brüssel übergegangen (40169, Nr. 135, Blatt 97). Diese Gesellschaft erwarb auch die Felder von Riedels Fdgr., Gelber Zweig samt Julius Stolln und Hausteins Hoffnung. Ab Februar 1882 ist in deren Auftrag ein Ernst Emil Braune aus Obersachsenfeld Bergverwalter. Derselbe saß 1885 in Zwickau und die Societé nannte sich nun Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb (40169, Nr. 135, Blatt 102f). Sonst wurde auch das Feld von Gott segne beständig über die gesamte Zeit bis 1886 aber nur in Fristen gehalten. Einem Fahrbericht des Berginspektors G. Tittel aus Zwickau vom 4. Mai 1885 zufolge bestanden die hier fahrbaren Baue nur noch aus einem Stolln, „Sieben Brüder Stolln genannt,“ welcher mit einer verschließbaren Tür versehen war und der Wasserlösung von Gnade Gottes vereinigt Feld diente; von letzterer Grube auch unterhalten wurde. Er stehe hauptsächlich in festem Gestein und sei nur teilweise mit Türstockausbau versehen. 1886 hat auch dieses
Feld dann der Unternehmer Gustav Zschierlich aus Geyer gekauft,
womit wir aber zu einem weiteren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Gnade Gottes
Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits am 16. Juni 1793 mutete Herr Gottlob Benjamin Reinfeld „auf Herrn Erbrichter Naumann in Schwarzbach Grund und Boden eine Fundgrube auf Eisenstein und alle anderen Metalle.“ Derselbe hat am 17. Juni 1793 auch die beiden nächsten Maße gemutet und mutete am 24. Juli 1793 auch noch zwei weitere obere und eine weitere untere Maß (40014, Nr. 153, Blatt 104ff). Noch ein Blatt weiter ist in dieser Akte aufgeführt, daß ein Herr Carl Friedrich Haustein am 2. Oktober 1793 „nach dem Willen des Herrn Zehndners Reinfeld“ zur Hoffnung Fundgrube noch weitere Maße bis zum 5. oberen und 5. unteren Maß „unter dem Nahmen Gottes Gnade“ mutete. Ob es sich dabei allerdings schon um einen Vorgänger der Gnade Gottes Fundgrube handelte, ist aufgrund der Ortsangabe ,in Schwarzbach‘ eher zweifelhaft.
Der erstgenannte
Grubenname
Aufgenommen wurde diese Gnade Gottes Fundgrube jedenfalls im Jahr 1796 durch den Steiger Carl August Weißflog (40169, Nr. 128, Blatt 1). Herr Weißflog war 1807 Obersteiger auf der Grube St. Katharina. Sein Name wird uns im Revier auch noch an anderen Stellen begegnen… Nur kurz darauf mutete am 25. Februar 1797 der Steiger Carl Gottlob Krauß auch die 1. bis 3. obere Maß nach Gnade Gottes Fundgrube. Sie wurden ihm am 12. April 1797 bestätigt (40014, Nr. 191, Blatt 31). Dem Übersichtsblatt in der betreffenden Grubenakte zufolge
(40169, Nr. 128, Blatt I und
II) wurde unter dem Namen dieser alten Grube
dann durch Gustav Zschierlich im Jahr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
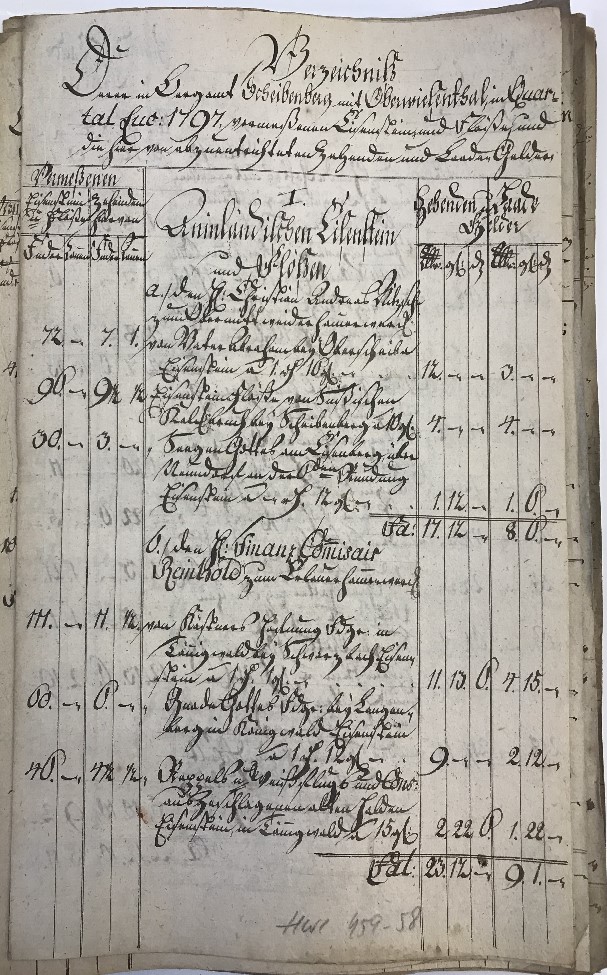 Eines der Zehntenverzeichnisse des Bergamtes Scheibenberg für die Hammerwerksinspektion aus dem Quartal Luciae 1797: Als vorletzte Eintragung von unten ist hier die ,Gnade Gottes Fdgr. bey Langenberg im Königswald' vermerkt, von der in diesem Quartal 60 Fuder Eisenstein ausgebracht worden sind. Zu dieser Zeit paßte die Auflistung der Eisensteinzechen schon nicht mehr auf ein Blatt Papier, wie noch im Jahr 1783. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40022 (Hammerwerksinspektion Schneeberg), Nr. 459, Register Nummer 58.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl in den Aufzeichnungen der Hammerwerksinspektion schon enthalten, wird der Grubenname in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) erst zwischen 1808 und 1811 und nochmals 1849 und 1850 aufgeführt. Sie hat demnach ausschließlich Eisenstein, über beide Zeiträume summiert 615 Fuder (rund 520 t) ausgebracht. Den Angaben über den vermessenen Eisenstein in den Fahrbögen der Geschworenen zufolge lag die tatsächliche Förderung, namentlich in dem dazwischenliegenden Zeitraum, aber bedeutend höher. Nach unseren Recherchen wurden hier zwischen 1797 und 1846 wenigstens 3.950 t Eisenstein gefördert, in der Betriebsphase ab den 1870er Jahren noch einmal 76 t, daneben nun aber auch rund 3.460 t Braunstein. Über das Ausbringen an Eisenocker und ,Farberden' liegen kaum quantitative Angaben vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
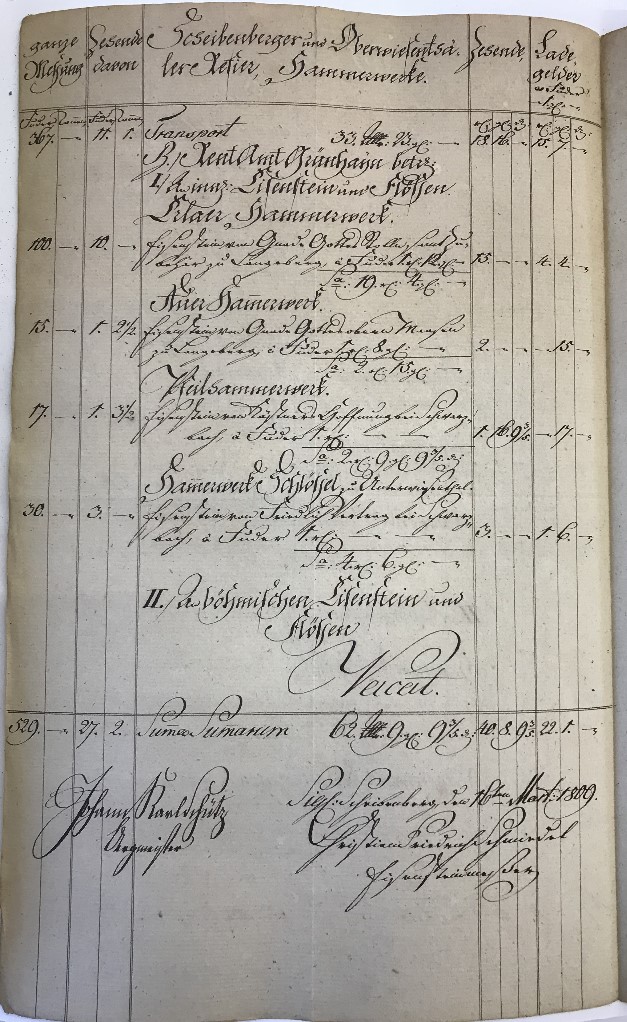 Zehntenabrechnung des Bergamtes in Scheibenberg aus dem Quartal Reminiscere 1809: Hier sind jetzt (obere beide Eintragungen) auch der Gnade Gottes Stolln samt Zubehör und die Gnade Gottes oberen Maßen aufgeführt. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40022 (Hammerwerksinspektion Schneeberg), Nr. 459, Register Nummer 87.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Fundgrube lag zwar auf den Fluren des Ritterguts Förstel, wie man aus späteren Aufzeichnungen herauslesen kann, jedoch auf dem Gegenhang des Emmlerrückens an der Nordseite des Schwarzbachtals, auf dem Sattel zwischen dem Schwarzbach- und dem Oswaldbachtal, dem sogenannten ;Roten Hahn'. Neben der Fundgrube gab es zeitweise untere und obere Maßen unter verschiedenen Besitzern, die unter Carl Heinrich Nietzsche um 1825 zu einem Grubenfeld vereinigt worden sind. Der uns schon bekannte Berggeschworene Johann Samuel Körbach aus Scheibenberg nahm im Jahr 1796 erneut eine Mutung einer Grube dieses Namens entgegen und meldete dies an das Bergamt in Scheibenberg mit folgendem Schreiben (40014, Nr. 193, Film 0051): „An das churfürstl. Sächs. Bergamt zu Scheibenberg
Dienstschuldigste Anzeige Solche Fundgrube befindet sich bey Langberg auf churfürstl. Grund und Boden, Königswald benannt, Soll auf ein Eisenstein Flöz, deßen Streichen morgengangweiß und Fallen in Mitternacht hat als das Mittel der gevierten Fundgrube genommen werden, das Feld in Nord, Süd, Ost und West gestrecket werden, bittet der Muther, Eu. wohllöbl. Bergamt möchte ihm solche Fundgrube unter dem Nahmen Gnade Gottes bestätigen, besichtiget am 22. Sept. 1796. Johann Samuel Körbach, Refiergeschworener.“ Da die Lage hier mit ,im Königswald' beschrieben wird, sind wir uns aber immer noch nicht sicher, ob dies nun ein Vorgänger der gleichnamigen Grube am Roten Hahn gewesen ist. Auch stimmt der hier genannte Name des Muters nicht mit demjenigen überein, der im Protokoll der Generalbefahrung vom Jahr 1807 genannt wurde. Dort nämlich ist Steiger Carl August Weißflog als Lehnträger und etwas später auch Ehregott Gottlieb Tröger als dessen Mitgeselle angeführt (40169, Nr. 128, Blatt 1ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einmal in Betrieb gegangen, wurde auch diese Grube vom Geschworenen Körbach nun jedenfalls regelmäßig befahren. In seinen Fahrbögen für das Quartal Crucis 1797 ist festgehalten (40014, Nr. 196, Film 0049): Fundgrube Gnade Gottes, bey Langberg gelegen. „bey diesem eigenlöhnerischen Grubengebäude wird auf dem Stunde 6 streichenden und in Süd neigenden Eisenstein Lager bey 3 Ltr. unterm Tag der Bau verführet mit Abteufen, solches Lager ist gegen ½ Lachter mächtig, führet Hornstein und grauen Eisenstein.“ Und im folgenden Quartal kann man lesen (40014, Nr. 196, Film 0060): Über Gnade Gottes Fundgrube bey Langberg in Königswald, Luciae 1797 „Befand das eigenlöhnerische Grubengebäude mit 2 Mann beleget, durch solche wurde der Bau bey 3 Ltr. Teufe untern Tag auf dem Stunde 6,4 streichenden und Süd fallenden, ½ Ltr. mächtigen Eisenstein Lager verführet, besteht aus Hornstein, Quarz und grauem Eisenstein.“ Trinitatis und Luciae 1799 notierte er nur: „Habe bey solchem Eigenlöhner Eisensteinzeche nichts veränderliches befunden.“ (40014, Nr. 199) Mit zwei Mann Belegung und nur 3 Lachter untertage ging es nun mal nicht besonders schnell voran. Erst auf das Quartal Crucis 1800 findet man wieder einen etwas längeren Eintrag in den Fahrbögen des Geschworenen (40014, Nr. 200, Film 0036): Gnade Gottes gevierte Fdgr. bey Langberg im Königswald „Es wird der Bau von dem Eigenlöhner bey 6 Ltr. Teufe unterm Tag auf dem sehr mächtigen Lager mittels Ortsbetriebs in Abend verführet, solches Lager führt Hornstein und grauen Eisenstein.“ Der Betreiber war also in den zurückliegenden drei Jahren um 3 Lachter weiter in die Tiefe gekommen und baute nach wie vor Eisenstein ab. Reminiscere 1801 heißt es dann (40014, Nr. 202, Film 0014): „Allhier wird der Bau von den Eigenlöhnern bey 5 Ltr. unterm Tage auf dem Stunde 3 streichenden und Ost fallenden, gegen ¼ Ltr. mächtigen, aus Hornstein und grauem Eisenstein bestehenden Lager mittels Ortsbetrieb in Nord betrieben.“ Fast gleichlautend ist auch Körbach's Vermerk im Fahrbogen vom Quartal Trinitatis 1801 (40014, Nr. 202, Film 0029f): „Es wird der Bau von Eigenlöhnern bey 5 Ltr. Teufe unterm Tag auf dem gegen ⅜ mächtigen, Stunde 3 streichenden und unter einem Wünkel 40 Grad Ost fallenden Eisenstein Lager mit Ortsbetrieb in Nord verführt, besteht solches Lager aus Hornstein und grauem einbrechenden Eisenstein.“ Nur die Mächtigkeit der gerade abgebauten Erzlinse hatte von einem Viertel (≈0,5 m) auf nun drei Achtel Lachter (≈0,75 m) zugenommen und Reminiscere 1802 wird sie sogar mit einem Lachter (≈2,0 m, auf dieses Maß war der Lachter erst ab 1830 vereinheitlicht) angegeben. Bei der größeren Mächtigkeit war man dann auch zum Strossenaushieb übergegangen. Crucis 1802 heißt es im Fahrbogen dann, der Eigenlehner baue nun mittels „Strossenaushieb vom Tage nieder“ das Lager ab (40014, Nr. 202, Film 0096). Er hatte vielleicht nach der Ausbißlinie übertage gesucht. Reminiscere 1803 (im Winterhalbjahr) war man mit dem Abbau aber wieder nach untertage gegangen (40014, Nr. 209, Film 0004): „Es wird der Bau von Eigenlöhnern bey 5 Ltr. untern Tage mit Ortsbetrieb auf dem Eisenstein Lager in Mitternacht fortgestellt, solches Lager führt Hornstein und grauen Eisenstein.“ Dasselbe liest man auch im Fahrbogen vom Quartal Crucis 1803.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste Fahrbericht Körbach's stammt aus dem
Quartal Trinitatis 1804 (40014, Nr. 213, Film 0015) und besagt, es werde
der Versuchsortbetrieb sowie der Strossen- und Firstenaushieb fortgesetzt
und das Lager sei nun 3 Ellen (zirka 1,6 m) mächtig.
Im Fahrbogen auf das Quartal Crucis 1804 heißt es dann, der Abbau erfolge „mittels Ortsbetrieb in Abend in 6 Lachter Teufe auf dem Stunde 6 streichenden und beynahe saiger fallenden gegen 1 Lachter mächtigen Eisensteinlager.“ (40014, Nr. 213, Film 0038) Auch Luciae 1804 lief alles so weiter und der Abbau scheint sich gelohnt zu haben, denn es wurden 190 Fuder Eisenstein an das Erla’er Hammerwerk geliefert (40014, Nr. 213, Film 0056). Dennoch ließ der Eigenlehner die Grube Reminiscere 1805 erst einmal liegen (40014, Nr. 232, Film 0005). Trinitatis 1805 heißt es nur lapidar im Fahrbogen des Geschworenen, es sei bezüglich der Gnade Gottes Fundgrube nichts veränderliches zu bemerken (40014, Nr. 232, Film 0019), und Crucis 1805 hält Herr Körbach fest, das Lager sei „ab und zu ½ bis ¾ Lachter mächtig.“ (40014, Nr. 232, Film 0026). Auch Luciae 1805 fand er nichts bemerkenswertes zu berichten, sieht man davon ab, daß die Grube offenbar ‒ abgesehen vom 1. Quartal ‒ das ganze Jahr durchgängig in Betrieb gestanden hat (40014, Nr. 232, Film 0032).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Herr Körbach im Jahr 1806 aus dem Dienst als Geschworener ausgeschieden ist, nahm für einen Teil der Gruben im Scheibenberg'er Bergamtsrevier zunächst der Protokollist Friedrich August Schmid die Funktion wahr. Er berichtete von seinen oberbergamtlich verordneten Befahrungen im März 1806 bezüglich dieses Bergwerks (40014, Nr. 233, Film 0010f): 2. Gnade Gottes gev. Fdgr. zu Langenberg „Auch dieses Gebäude wird Eigenlöhnerweise – gegenwärtig durch zwei Mann betrieben. Diese beschäftigen sich mit Abbau eines Std. 6 streichenden und 1 bis 2 Lachter mächtigen Brauneisenstein Lagers, welches in einem sanft gegen Nord ansteigenden Gneisgebirge auf- und nahe bis unter die Dammerde heraussetzt. Dieses letztere giebt zugleich die Ursache ab, warum die Eigenthümer dieses Gebäudes zur Zeit noch zu keinem regelmäßigen Abbau ihres Lagers verschritten, vielmehr durch allmähligen Heraushieb des mächtigen Eisensteins eine Pinge von mehr als 20 Ellen im Durchmesser erhalten haben, welche nicht nur allen Unannehmlichkeiten der Witterung ausgesetzt, sondern auch durch täglich theilweises Einstürzen dem Leben der Arbeiter gefährlich wird. Unter diesen Umständen und da die Eigenlöhner seit einiger Zeit selbst darauf bedacht gewesen, ist denselben die Anlegung eines regelmäßigen Abbaus und zu diesem Ende in 4 bis 5 Lachter Entfernung vom Bruche gegen NW. ein Punkt zu Niederbringung eines regulären Schachtes angewiesen worden, bei deßen Verfolgung in wenig Lachtern Teufe unterm Tage das ebenfalls in NW. sich verflächende Lager erreicht werden dürfte.“ Das klingt nicht so richtig vertrauenerweckend, was die Eigenlehner hier veranstalteten... Im darauffolgenden Quartal berichtete Herr Schmid (40014, Nr. 233, Film 0033f) dann: Gnade Gottes gev. Fdgr. bei Langenberg. „Bei diesem durch 2 Mann eigenlönerweise betrieben werdenden Grubengebäude ist man in diesem Quartal mit Aufgewältigung des in der Mitte der dasigen großen Pinge bei ohngefähr 8 Lachter Teufe vom Tage nieder befindlichen alten Schachtes, sowie mit Abbau des Std. 6 streichenden und ohngefähr 2 Lachter mächtigen Brauneisensteinlagers beschäftigt gewesen und hat ersteres bis in eine Teufe von 1½ Lachter von der Hängebank bereits bewerkstellligt. Da nun diese Gewältigung nicht weniger wie jener Abbau vor der Hand blos deshalb unternommen wurde, um, bis man im Standt sein wird, mittels Anlegung eines regelmäßigen Schachtes auch regelmäßig abzubauen, den wenigen noch anstehenden Eisenstein zu gewinnen und dadurch auf einige Zeit mit Vortheil noch zu beschäftigen, die Anlegung dieses Schachtes aber nach erfolgter Holzablieferung (?) ohne Anstand unternommen werden soll; so ist bei der heutigen Befahrung nochmals der den Eigenlöhnern bereits in No. 8te Wo. des Qu. Rem. a. c. zu diesem Behufe angewiesene Punkt in ohngefähr 4 bis 5 Lachter nordwestlicher Entfernung von der gegenwärtigen Pinge in Erinnerung gebracht worden.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab 1806 trat Herr Christian Friedrich Schmiedel
als Berggeschworener in den Dienst im Bergamt zu Scheibenberg ein. Da Herr
Schmid die Grube ja Trinitatis 1806 noch begutachtet hatte, fuhr Herr
Schmiedel erst Luciae 1806 wieder zur
Gnade Gottes Fundgrube und berichtete danach darüber (40014,
Nr. 235, Rückseite Blatt 80 und Blatt 81):
Gnade Gottes Fdgr. bei Langenberg gelegen. Lage. „Dieses Gebäude, welches von den Eigenlehner Steiger Weispflog und Consorten betrieben wird, liegt ohnweit dem Dorfe Langenberg an dem gegen Abend aufsteigenden Gebirge.“ Baue. „Allhier wird von den noch im vorigen Quartal gangbar gewesenen großen Bruche, in welchem der Eisenstein zeithero vom Tage nieder, 4 Lachter weiter gegen Abend ein Tageschacht niedergebracht, mittels welchem man das bisweilen einige Lachter mächtige Eisensteinlager, soweit als man der Waßer wegen niederkommen kann, zu durchsinken, sodann aber auf solchem regulaire Baue anzulegen, gedenkt. Dieser Schacht ist gegenwärtig 6 Lachter tief, und hat man damit bereits zu Ende des 5ten Lachters gedachtes Lager, welches einige 40 Grad gegen Mitternacht fällt, und aus Hornstein, Quarz, ockerigen Braun- und gelben Eisenstein besteht, ersunken.“ Der Steiger Weißflog setzte offenbar die Empfehlung des Bergamtsprotokollisten Schmid um und teufte nun einen Schacht neben dem Tagebau, wenngleich gerade einmal rund 8 m westlich von deren Rand entfernt. Die nächste Befahrung durch den neuen Geschworenen erfolgte Trinitatis 1807. Darüber berichtete er (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 98 und Blatt 99): „Auf Gnade Gottes Fdgr. Eigenlehner Zeche bei Langeberg, gefahren. Dieses Eisenstein Gebäude ist mit 2 Häuern belegt, durch welche bei 6½ Lachter Teufe des Tageschachtes auf dem daselbst ersunkenen Eisensteinlager ein Ort Stunde 8,0 gegen Abend betrieben wird, so bereits 1½ Lachter von erwähntem Schachte fortgebracht ist. Dieses Lager fällt einige 40 Grad gegen Mitternacht und besteht aus Hornstein, Quarz, ockerigen braunen und gelben Eisenstein.“ Veranstaltung. „Da gedachtes Lager bis jetzt noch nicht durchsunken ist, so habe ich unter anhoffender Genehmigung des wohllöbl. Bergamtes veranstaltet, daß mit obbemerkten Schachte, in so ferne es die bei weiterem Absinken etwa zu erschrotenden Waßer gestatten, noch weiter niedergegangen werden soll, um wo möglich das in Frage befangene Lager ganz zu durchsinken und sodann selbiges mittelst Förstenaushieb wohlfeiler abzubauen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der bereits bei Vater Abraham erwähnten Generalbefahrung durch das Oberbergamt halber gab es auch zu dieser Grube im Jahr 1807 einen umfänglichen Aufstand (40001, Nr. 115, Blatt 74ff, Abschrift in 40169, Nr. 128, Blatt 1ff). Die hier formulierte Lagebeschreibung trifft auf jeden Fall auf diejenige Grube am Nordhang des Schwarzbachtales zu: praes. 16ten Juni 1807
Aufstand und Grubenbericht Lage. „Dieses Berggebäude liegt nahe bei dem, unter die Gerichtspflege des Königl. Amtes Grünhayn gehörigen Dorfes Langenberg, an dem von selbigem gegen Nordwest sanft ansteigenden Gebirge, bei dem nach der sogenannten Oswald Kirche zu Waschleithe gehenden Mönchsteige. Dieses Gebirge ist dem Bergmann bekannt, wegen der in selbigem vorkommenden Eisensteinlager, welche nicht nur auf diesem, sondern auch von dem in der liegenden Grubengebäude Kraus Fdgr. bebauet werden.“ Aufkommen. „Diese Grube wurde im Quartal Luciae 1796 von dem Steiger Karl August Weißflog auf St. Katharina in Schneeberger Bergamts Refier, nebst Consorten eigenlehnerweise aufgenommen, und das daselbst befindliche Eisensteinlager anfänglich, und zwar bis zum Quartal Luciae a. p. vom Tage nieder steinbruchweise 6 Lachter tief, mit einer anschließenden Weite abgebaut.“ Einfügung: „18-20 Lr.“ „Besagtes Lager, welches zuweilen 2 bis 3 Lachter mächtig war, und etwa 60 Grad nördliches Fallen hatte, bestand aus Hornstein, Quarz, gelben und braunen ockerigem Eisenstein, auch dichtem Brauneisenstein.“
Einfügung: „Dieses
Lager besteht hauptsächl. „Zu Ende des 6ten Lachters hat man ziemlich häufige Wasser erschrothen, welche das weitere Niedergehen und die Untersuchung qu. Lagers erschwerten und behinderten, dieserwegen sah man sich genöthiget, von diesem Baue abzugehen, und 4 Lachter weiter gegen Abend einen regelmäßigen Tageschacht niederzubringen.“ Jetzige Baue. „Diese Ausführung erfolgte im Quartal Reminiscere a. c. wo man einen neuen Tageschacht 6 Lachter tief niederbrachte, und wegen des nicht haltbaren Gesteins in Bolzenschrot- Zimmerung setzen mußte. In dieser Teufe, wo man das besagte Eisensteinlager wieder erreichte, befindet sich gegenwärtig ein Ort Stunde 8,2 gegen Abend mit 3 Mann belegt, und bei 11/16 Lachter Weitung 1½ Lachter erlängt. Vor diesem Orte hat vorgedachtes Lager, so viel sich jetzt bei dem sehr wenig ausgebreiteten Grubenbau abnehmen lässt, Stunde 3,1 zum Streichen und 30 bis 35 Grad nördliches Fallen; die Bestandtheile desselben sind Quarz, Hornstein, ockeriger gelber und brauner Eisenstein.“ Ausbringen. „Bis Schluß Quartals Luciae 1806 sind auf bemerkter Grube 1.340 Fuder Eisenstein ausgebracht, welcher an das Erlaer Hammerwerk nach des Bergamts Taxe per Fuder 1 Thl. 12 Gr. – verkauft, und dafür Bezahlung von 2.070 Thl. – Gr – Pf. erlangt, wovon die Eigenlehner nach Abzug alles Kostenaufwands ein wirklichen Ausbeut Überschuß von 425 Thl. 10 Gr. 10 Pf. zu Theil geworden ist. Übrigens ist diese Grube belehnt mit 1 gevierter Fundgrube und belegt mit 2 Häuern.“ Oeconomische Umstände. „Die Quartalskosten betrugen im Quartal Luciae a.p. 57 Thl. 17 Gr. 1 Pf. An Receß sowohl als Grubenschuld ist nichts vorhanden.“ Absichten. „Zu mehrerer Erweiterung des Grubenbaues soll der vom neuen niedergebrachten 6 Lachter tiefen Tageschacht, in so ferne es die aufgehenden Grundwaßer gestatten, oder durch einzubauende Pumpen zu gewältigen sind, noch weiter niedergegangen, und mehrgedachtes Eisensteinlager ganz durchsunken werden. Sollten aber wider Vermuthen die Grundwaßer so häufig sein, daß selbige nicht mehr durch eine Handpumpe zu gewältigen wären, so dürfte die Heranbringung eines am Schwarzwaßer anzulegenden Stollns noch ein Mittel sein, obige Ausführung möglich zu machen.“ Unterzeichnet von Friedrich August Schmid und
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach erfolgter Generalbefahrung hielt man im Bergamt Scheibenberg noch fest (40001, Nr. 115, Blatt 77ff, Abschrift in 40169, Nr. 128, Blatt 5ff):
Registratura Anwesende
Se. Hochwohlgeborene,
der Herrn Bergcommissionsrath von Herder, „Bey der von Sr. Hochwohlgeborenen Herrn Bergcommissionsrath von Herder, als hochverordneter Revisions Commissarius mit Zuziehung der ad marginem versammelten (?) Verfahrer und endesgenannter Pretaecoliste (?) unter heutigem Dato auf dem rubricirten Eigenlehner Gebäude abgehaltenen commissarischen Befahrung war 1) in Hinsicht des bereits geführten Grubenbaues folgendes anhero zu bemerken. Nach dem man den hier anfangs auf einem Brauneisensteinlager von Tage nieder mit 6 Lachter Teufe und 18 bis 20 Lachter Weite verfahrenen Steinbruchbau, der häufigen Tagewaßer und weil man überhaupt der Witterung zu sehr ausgesetzt war, auch das gedachte Lager gern noch tiefer untersuchen und abbauen wollte, aufgegeben hatte, war 4 Lachter von dem Tagebau in Abend ein 6 Lachter tiefer Tageschacht niedergebracht, und in dieser Teufe das Eisensteinlager wieder ausgerichtet worden. Als hierüber die Commission ihr Befremden äußerten, und darüber Auskunft verlangte, weswegen man nicht von dem Tagebau ein Ort gegen Abend fortgetrieben, und auf diese Art den ganzen, der darin nothwendigen Zimmerung wegen schwer köstigen Schachtes hätte entbehrlich gemacht habe, so versicherte der anwesende Lehnträger Weißflog, daß jenem Ortsbetrieb besonders der Umstand widerrathen hätte, daß die dem Tagebau sehr häufig zufallenden Waßer auch das Ort und die von selbigem aus verführten Baue nicht selten ganz unzugänglich gemacht, folglich aller Abbau von da aus sehr erschwert haben würden. Ob man nun zwar wohl dieses Anführen der Commission nicht genügend war, in dem auch in den jetzigen Schacht bey der Nähe desselben am Tagebau die Waßer von da aus leicht treffen können, so ließen D. Commis. jedoch (?) dabey (bewenden ?). (Von) dem beregten Tageschachte aus war ein Ort mit fallender Sohle 1¾ Lachter in der Stunde 11,4 gegen Mittag erlängt, doch scheint es, das Eisensteinlager daselbst wegen der geringen Teufe unter Tage noch nicht völlig ausgerichtet zu haben; es strich hier Stunde 8 und fällt so viel sich abnehmen lässt, gegen 70° in Mittag, daß es im Tagebau gerade entgegengesetztes Einschießen hatte, überhaupt auch (?) nach des Bergamts und Lehnträgers Angabe, ein nördliches Fallen von ohngefähr 40 Grad hat. Die Bestandtheile, welche es in der Ortshöhe führte, waren gelber Mulm, Braunstein, rother Hornstein und braunsteiniger Eisenstein, bloß nach der Sohle zu zeigte sich ein etwas reineres Eisensteintrum. Unter diesen Umständen war also der hier zu gewinnende Eisenstein, wenngleich wenigstens in dieser Teufe nach, kein Schwefelkies dabei brach, von keiner besonderen Güte; gleichwohl war das gedachte Ort jetzt allein auf der Grube, und zwar mit 3 Mann belegt, doch hätte man damit die allerdings zu billigende Absicht, das Lager noch mehr nach der Sohle zu untersuchen, in der Hoffnung, dasselbe hier noch bauwürdiger auszurichten. In Ansehung 2) des ferneren Betriebsplans bey der Grube so hat der Lehnträger Weißflog die Absicht, mit dem Tageschachte noch tiefer, und so weit, als er die Grubenwaßer mittelst einer Pumpe zu halten vermag, niederzugehen, um das wahrscheinlich bei größerer Teufe bauwürdiger werdende Eisensteinlager in solcher aufzusuchen und abzubauen. So sehr nun Sr. Commissar nebst dem angefahrenen Bergamt mit der gedachten Absicht zufrieden war, zumal, da selbigen selbst nach dem Verhalten des Eisensteinlagers vor dem fallenden Orte, wo man auf der Sohle noch das beste Haufwerk gewann, es rathsam erschien; so wenig konnten hochdieselben die intendirte Schachtabsinkung als alleiniges Mittel dazu ihren Beifall geben. Sie äußerten vielmehr, unter der Voraussetzung, daß freilich alle wichtige und einigen Geldaufwand erfordernde Ausführungen den Vermögensumständen des Eigenlehners überlassen bleiben müßten, folgende vom Bergamte beifällig angenommene Meinung über den ferneren Betriebsplan der Zeche. 1) Da eine beßere und genauere Kenntnis von der Lage auf Gnade Gottes bebaut werdenden Eisensteinlagers zu erhalten, (?) schüßlichen Grubenbau Veranstaltungen zu treffen, so sey zuvörderst nöthig, einen genauen Riß von dem Gebäude fertigen zu lassen. Zu dem Ende könne man am füglichsten, da noch mehrere Gruben, namentlich Christian Fdgr. am Graul in der Schwarzenberger Refier und Krauß gev. Fdgr. bei Schwarzbach allem Anmuthen nach auf demselben Lager bauten, und eines Risses in gleichem Maße bedürften, mit diesen sich vereinigen, und einen gemeinschaftlichen Riß vom ganzen Lager verfassen, dabei aber den Grauler Riß so weit nöthig mit zu übertragen, weil das besagte Eisensteinlager bis in die dasige Gegend fortzusetzen schien, besonders aber 2) der Herantrieb eines tiefen Stollens und zwar nach Angabe des Markscheiders für Gnade Gottes, wenn anders daselbst ein regelmäßiger und möglichst reichhaltiger Bau verführt werden soll, ganz unentbehrlich. Der Lehnträger Weißflog brachte dazu den Erbstolln von Christian Fdgr. in Vorschlag; noch schicklicher aber fanden Dr. Commissar hierzu den tiefen Stolln von Stamm Asser oder Catharina, wenn nämlich die schon gedachten Eisensteingruben vereinigt den Stollnbetrieb unternähmen. Denn den Christianus Stolln müßte man allein oder nur mit Beitritt von Krauß gev. Fdgr. nach Gnade Gottes herauf bringen, bei Herantrieb eines jener tiefren Stolln aber könnte auch Christian Fdgr. mit theilnehmen und zugleich würde das Eisensteinlager, auf dem man gleich von Stamm Asser oder erst Catharina aus aufthun könnte, in einer noch ganz unbebauten Teufe durchfahren. Übrigens wurde der Lehnträger Weißflog auf Vorstellung, daß der Grundbesitzer Herr Querfurth auf Langenberg sich über den verführten Tagebau beschwerte und die Einebnung der dadurch entstandenen Pinge verlangt habe, beschieden dieselben, wenn nicht mehr gearbeitet würde, nicht gerade einzuebnen, denn das könne der Grundbesitzer nicht verlangen – wohl aber zu verbühnen, oder zu umzäunen. Endlich geben D. Commiss. genannten Weißflog in Bedarf, die von ihm erst bis mit Luciae 1806 eingelegten, auf Rem. und Trin. aber noch ausständigen Registraturen Unzufriedenheit zu erkennen und wiesen denselben an, in diesem Maß zu verfahren...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wohl des Stollnprojektes halber war Geschworener Schmiedel schon im August 1807 wieder vor Ort und berichtete am 29. August 1807 in Annaberg, der Lehnträger treibe nun zunächst aus dem Tagebau heraus einen Querschlag Stunde 11 auf seinen Schacht zu. Weil diese Richtung nicht stimmte, hat der Geschworene angewiesen, auf Stunde 10 einzuschwenken, was man im Bergamt zur Kenntnis nahm (40169, Nr. 128, Blatt 4). Von seiner Befahrung im Quartal Luciae 1807 heißt es dann (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 130 und Blatt 131): „Gnade Gottes bei Langeberg anlangend. Da nunmehro mittelst des, in den auf No. 5te bis 8te Woche vorigen Quartals eingereichten Fahrbogen ausführlich beschriebenen, aus der sogenannten großen Pinge nach dem Tageschachte getriebenen Ortes und damit erfolgten Durchschlag ein vollkommen guter Wetterwechsel in nur bemerkten Tageschacht bewirkt worden ist, so werden anjetzo bei 6½ Lachter Teufe daselbst auf einem Eisensteinlager zwei Örter, als a) eines Stunde 12,6 gegen Mittag und b) eines Stunde 8,6 gegen Mittag Morgen betrieben. Ersteres hat eine Länge von 3¼ Lachter erreicht, letzteres aber ist nur 2¾ Lachter von bemerktem Schachte fortgebracht. Gedachtes Lager fällt ohngefähr 40 Grad gegen Mitternacht Abend, ist 1½ Lachter mächtig und besteht aus Quarz, braunem Hornstein und braunem Eisenstein, auch dichtem Brauneisenstein.“ Reminiscere 1808 fand Herr Schmiedel ungefähr dieselbe Situation vor, nur gibt er etwas andere Richtungen der beiden Örter an, nämlich (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 7 und Blatt 8): a) eines Stunde 10,2, das jetzt „bei 1¼ Lachter Weitung 3½ Lachter“ fortgebracht war und b) eines Stunde 8,4, dieses ist nun 3 Lachter vom Tagschacht erlängt. Auch hier betrieb man nun also Weitungsbau und erweiterte die Streckenörter auf rund 2,5 m Breite.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durch Herrn Karl Gottlob Rau, Hammerwerks- Besitzer zu Schönheide, wurden am 1. Oktober 1807 wurden die nächsten vier oberen Maße als separates Grubenfeld gemutet (40014, Nr. 211, Film 0034) und diesem am 7. Januar 1808 verliehen (40014, Nr. 43, Blatt 243). Nur wenige Tage später, am 12. Oktober 1807, legte auch Carl Heinrich Nietzsche, inzwischen Hammerwerksbesitzer in Erla, Mutung ein auf „vier gevierte nächste untere Maaßen bey dem Gnade Gottes gev. Fdgr. zu Langenberg auf Ritterguth Förstels Grund und Boden nebst den auf beyden langen Seiten derselben die zur Zeit im freyen liegenden sämtlichen gevierten Wehre (4 Stück) und Lehn (weitere acht), ingleichen einen tiefen Stolln“ (40014, Nr. 211, Film 0037, sowie 40169, Nr. 128, Blatt 8) und erhielt diese am 1. Januar 1808 auch bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 243). Herr Nietzsche hatte Christian Friedrich Richter zum Schichtmeister bestellt und gegenüber dem Bergamt schriftlich bestätigt, daß er die eigentlich von diesem zu stellende Kaution selbst tragen werde. Sein Schreiben trägt den Bearbeitungsvermerk „praes. 8ten Februar 1810“ und wurde zu einem späteren Zeitpunkt wieder „caßirt“, wohl nachdem der Schichtmeister aus seinem Amt ausgeschieden ist. Aus diesem Schreiben erfährt man aber auch, daß Schichtmeister Richter eine ziemlich bedeutende Kaution von 100 meißnischen Gulden allein für diese Grube bei der Bergamtskasse hätte hinterlegen müssen (40169, Nr. 128, Blatt 42).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
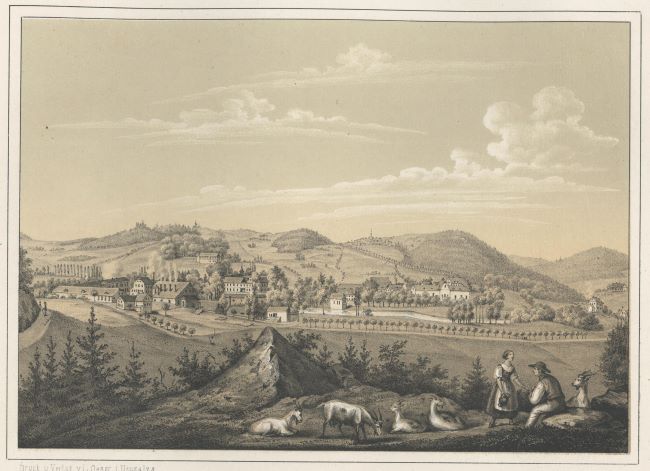 Zeichnerische Darstellung des Erla'er Hammerwerkes um die Mitte des 19. Jahrhunderts, damals schon im Besitz von Nestler & Breitfeld, Aus: Ludwig Oeser: Album der sächsischen Industrie, Band 2, S. 13ff. Bildquelle: Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Hammerherrenhof in Erla, Hofansicht des Verwaltungsgebäudes im Jahr 1906, Foto: Konrad Klemm, Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Eine weitere Ansicht des Hammerherrenhofes zu Erla aus dem Zeitraum um 1906/1908, Foto: Konrad Klemm, Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur erstgenannten Grube, den oberhalb der Fundgrube
liegenden Maßen, heißt es im Fahrbogen des Geschworenen
Schmiedel auf das Quartal Reminiscere 1808 (40014, Nr. 236, Blatt 8f):
Gnade Gottes gevierde Maaßen betreffend. „Auf dieser, von dem Hammerwerksbesitzer Herrn Rau zu Schönheide betrieben werdenden und in No. 1te Woche dieses Quartals bestätigten Grube arbeiten anjetzo 3 Mann, nämlich 1 Steiger und 2 Doppelhäuer. Durch selbige wird ein Tageschacht niedergebracht, um das allhier bei 5 Lachter Teufe aufsetzende Eisensteinlager zu durchsinken und Baue darauf anlegen zu können. Dieser Tageschacht hat bis jetzt eine Teufe von 3¼ Lachter erreicht und ist mit Polzenschrotzimmerung verwahrt.“ Auch die unteren Maße hat Herr Schmiedel am 26. Januar 1808 in Augenschein genommen und darüber berichtet (40014, Nr. 236, Blatt 8 und Blatt 9): Gnade Gottes untere gevierde Maaßen bei Langeberg anlangend. „Diese Grube ist ebenfalls ganz kürzlich von dem Herrn Hammerwerksbesitzer Nitzsche auf dem Hammerwerk Erla aufgenommen und demselben No. 1te Woche dieses Quartals bestätigt worden. Um das allhier befindliche Eisensteinlager, welches z. B. bei Gnade Gottes gevierde Fundgrube der Grundwaßer wegen nicht weiter als bis in 6½ Lachter Teufe unter Tage abgebaut werden kann, gleichwohl aber deßen Tiefstes mit gutem Eisenstein anstehend verlaßen worden ist, in Zukunft mit leichtern Kosten wo möglich gänzlich abzubauen, so hat man in dem nächsten Thale bei Langeberg einen Stolln angelegt und dieser wird anjetzt in Quergestein nach obgedachten Eisensteinlager, um solches zu unterteufen, in der kürzesten Richtung Stunde 11,2 gegen Mitternacht mit 2 Mann betrieben, ist auch bereits 6½ Lachter von dem Mundloche erlängt und mit doppelter Thürstockzimmerung versehen.“ Oh, man sieht gleich: Herr Nietzsche kannte sich aus und wollte nicht kleckern, sondern das Eisenerz für seine Hammerwerke wohlfeil selbst gewinnen... Des raschen Fortgangs bei den beiden neuen Gruben halber war Herr Schmiedel schon am 9. März 1808 wieder in Langenberg. Weil sie zuerst da war, berichtete er auch zuerst über die Gnade Gottes Fundgrube (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 20 und Blatt 21), dort betreibe man auch weiterhin zwei Streckenörter, allerdings haben sich deren Richtungsangaben schon wieder geändert: Der Geschworene las diesmal an seinem Kompaß ab, das erste werde Stunde 7,1 gegen Westen getrieben und sei 3¾ Lachter erlängt und das zweite Ort werde Stunde 4,0 gegen Nordosten vorgetrieben und sei nun 4¼ Lachter ausgelängt. Das abgebaute Eisensteinlager sei hier über 1 Lachter mächtig. Am selben Tage war der Geschworene auch auf den beiden Maßgruben zugegen und berichtete über die Arbeiten bei den oberen gevierten Maßen (40014, Nr. 236, Blatt 21), die Zeche sei mit 4 Mann belegt, der Tageschacht habe inzwischen 5 Lachter Teufe erreicht und in dieser Tiefe habe man ein Ort Stunde 2,0 gegen Süden in Quergestein angeschlagen, dieses bereits 8 Lachter fortgebracht, wo man das Eisensteinlager an- aber noch nicht durchfahren habe, daher dessen Streichen und Fallen noch nicht angegeben werden könne. Das Lager bestehe vor Ort aus Quarz, braunem Hornstein und etwas ockerigem braunen Eisenstein. Über die „Konkurrenz“ der unteren Maße berichtete Herr Schmiedel (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 21): Gnade Gottes untere gevierte Maaßen bei Langeberg anlangend. „Auf dieser Eigenlehner Grube arbeiten jetzt 3 Mann, durch welche der Johannes Stolln in Quergestein Std. 11,2 gegen Nord fortgestellt wird und ist jetzt 12 Lachter erlängt und mit doppelter Thürstockzimmerung versehen.“ Schau an: Der Stolln hat jetzt einen eigenen Namen bekommen. Natürlich mit dem Schutzpatron Johannes einen Namen, den es in der Umgegend gleich im Dutzend gegeben hat...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung der nebeneinander
bestehenden Gruben durch Herrn Schmiedel folgte am 13. April 1808
(40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 30ff). Über die Gnade Gottes gevierte
Fundgrube war zu berichten, daß sie mit 2 Mann belegt war und daß man
ein neues Ort Stunde 2,1 gegen Südwest angesetzt und 3½ Lachter
fortgebracht habe. Außerdem habe man bei 2½ Lachter Entfernung vom Schacht
ein Abteufen niedergebracht, jedoch erst ½ Lachter Teufe erreicht. An
beiden Punkten betrug die Mächtigkeit des Eisensteinlagers 1½ Lachter und
nach wie vor fällt es 40° nach Nordwesten ein.
Bei den vormals unteren Maßen hat man sich vielleicht überlegt, daß es bei den Johannes Stolln vielleicht doch Verwechslungen geben könne und die Grube wieder umbenannt: Man nannte sie jetzt Gnade Gottes Stolln samt Zubehör und meinte mit dem Zubehör die nachgemutete obere Maß. Sie war mit 3 Mann belegt und der Stolln war inzwischen 14 Lachter in Quergestein fortgestellt. Bei den Gnade Gottes'er oberen Maßen hingegen konnte Herr Schmiedel „wegen der durch das in voriger Woche eingefallene heftige Thau- und Regenwetter in dem Tagschachte 1½ Lachter hoch aufgegangenen Grundwaßer nicht befahren werden, jedoch aber wurden daselbst in meiner Gegenwart 9 Fuder Eisenstein vermeßen.“ Das war noch nicht viel, aber immerhin: Hilft wirtschaften. Bei seinem Besuch am 19. Mai 1808 fand der Geschworene bei beiden Maßgruben nichts veränderliches vor (40014, Nr. 236, Blatt 45). Und am 22. Juni 1808 notierte er über Gnade Gottes Stolln samt Zubehör, er sei weiterhin mit 2 Mann belegt, durch welche ein neuer Tageschacht, um das Lager zu untersuchen, niedergebracht werde, welcher inzwischen 3½ Lachter tief sei. Und „bei 2½ Lachter Teufe vom tage nieder hat man ein ½ Elle mächtiges, 25° gegen Süd fallendes Lager durchsunken, welches aus Gneis, Hornstein, Quarz und braunen Eisenstein besteht.“ (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 52) Schließlich befuhr Herr Schmiedel am 28. Juli auch die Gnade Gottes Fundgrube wieder (40014, Nr. 236, Blatt 62f). Sie war jetzt mit 3 Mann belegt, die aber wieder „in der großen Pinge beim Tageschachte“ Erz abbauten. Das Lager war dort ½ Lachter mächtig, fiel 34° gegen Nordwest und bestand aus „mildem Gneis, Quarz, Hornstein, braunem Eisenstein und dichtem Brauneisenstein.“ Am gleichen Tage schaute der Geschworene auch bei Gnade Gottes Stolln vorbei, befand aber nichts veränderliches. Die nächste Befahrung fiel auf den 10. Oktober 1808. Über Gnade Gottes gev. Fdgr. war zu berichten, sie sei weiterhin mit 2 Mann belegt, welche jetzt wieder aus Tageschacht bei 6 Lachter Teufe heraus ein Ort Std. 4,4 gegen Südwest trieben, das bei 1 Lachter Weitung 3⅞ Lachter erlängt war (40014, Nr. 236, Blatt 83). Außerdem hat Herr Schmiedel am 28. Oktober hier 35 Fuder Eisenstein vermessen lassen (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 83). Auch das klingt nicht wirklich viel, ist aber für eine Eigenlehnergrube ganz beachtlich. Auch am 10. Oktober 1808 wurde Gnade Gottes Stolln samt Zubehör befahren, worüber zu berichten war, die Grube sei mit 3 Knechten und 1 Jungen belegt, durch welche bei 3½ Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort Stunde 9,2 gegen Nordwest auf dem angetroffenen Eisensteinlager getrieben werde, und das auf 1½ Lachter erlängt sei. Das Lager war dort 1¼ Lachter mächtig, fiel 24° gegen Nordwest ein. Die Bestandteile waren dieselben, wie stets und überall, nur wird hier auch Eisenglanz (Hämatitkristalle) einmal genannt (40014, Nr. 236, Blatt 83). Schließlich war noch am 3. November 1808 auch die Grube Gnade Gottes obere Maßen wieder an der Reihe (40014, Nr. 236, Blatt 89). Hier waren jetzt 5 Mann angelegt, welche ein Ort bei 5 Lachter Teufe Stunde 2,6 gegen Süd auf einem 22° gegen Nordwest fallenden Lager betrieben und dieses 13½ Lachter fortgebracht hatten. 1½ Lachter vom Streckenort zurück wurde ein zweites Ort Stunde 9,2 gegen Südost betrieben, war aber erst 1¼ Lachter erlängt. Das Lager war an beiden Punkten einen ¾ Lachter mächtig. Am gleichen Tage besuchte Herr Schmiedel auch noch Gnade Gottes Stolln, fand darüber aber nichts bemerkenswertes zu berichten. Bemerkenswert ist aber noch das Ausbringen der drei Nachbargruben, welches auf Luciae 1808 wie folgt angegeben wurde (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 98): Am 7., 8. und 9. Dezember 1808 nämlich wurden
Danach brechen übrigens die Erwähnungen der Gnade Gottes Fundgrube in den Fahrbögen für ein reichliches Jahr ab, woraus man nur folgern kann, daß die eigentliche Fundgrube 1809 stillgelegen hat. Noch kurz vor Weihnachten, nämlich am 23. Dezember 1808, befuhr der Geschworene erneut die Gnade Gottes'er oberen Maßen (40014, Nr. 236, Blatt 99): Die Belegung war unverändert, jedoch trieb man nun in 5 Lachtern Teufe ein Ort Stunde 6,2 gegen Ost in Quergestein vor, welches 15⅞ Lachter erlängt war. Ferner betrieb man 7 Lachter vom Tageschacht in Mittag entfernt auf derselben Sohle das Abteufen weiter, wo man ein Stunde 12,4 streichendes und 30° Ost fallendes Lager von 1 Elle Mächtigkeit aufgeschlossen hatte. Es war aber immer noch nur ½ Lachter abgesunken. Am gleichen Tage auf Gnade Gottes Stolln angefahren, fand Herr Schmiedel darüber zu berichten, daß dort mit unveränderter Belegung das Ort Sunde 9,2 nach Nordwest weiterbetrieben werde. Dort hatte man offenbar bauwürdiges Erz angefahren und das Ort auf 2½ Lachter Weitung verbreitert und auf 2¾ Lachter erlängt (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 99). Bereits am 2. Juli 1808 hatte Herr Nietzsche allerdings zwei untere Maße und zwei der gevierten Wehre wieder losgesagt, was der zum Schichtmeister bestellte Christian Friedrich Richter im Bergamt Annaberg am 7. Juli des Jahres zu Protokoll gab (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 8). Am 5. Januar 1809 nahm man hier außerdem zu Protokoll, daß Steiger Weißflog seine Fundgrube für 400 Thaler an Herrn Nietzsche verkauft habe (40169, Nr. 128, Blatt 9). Daraufhin wurde durch den Schichtmeister Richter am 28. März 1809 noch eine weitere obere Maß zum Besten von Gnade Gottes untere Maßen gemutet (40014, Nr. 211, Film 0056 und 40169, Nr. 128, Blatt 10). Die Bestätigung darüber durch das Bergamt ging an den dahinterstehenden Eigentümer, den „Herrn Bergcommißionsrath Nitzsche Wohlgeb. auf dem Erlaer Hammerwerk.“ Herr Nietzsche ordnete offenbar das Grubenfeld neu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon am 10. Januar 1809 war der Geschworene erneut vor Ort, fand aber natürlich nach der kurzen Zeit nichts Bemerkenswertes (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 104). Am 6. Februar dieses Jahres war dann das Abbauort bei Gnade Gottes Stolln bei gleicher Weitung auf 3 Lachter Länge fortgestellt. Außerdem hatte man vom Schacht aus nun ein Ort Stunde 9,5 nach Südosten angesetzt, aber erst einen Lachter vorgetrieben (40014, Nr. 236, Blatt 114). Die Gnade Gottes obere Maßen waren zur gleichen Zeit nun schon mit 6 Mann belegt, welche das Ort im Quergestein Stunde 6,2 auf 28 Lachter Länge vorangetrieben hatten. Dabei hatte man bei 21 Lachtern Länge ein Stunde 11,6 streichendes, fast saiger fallendes Trum überfahren, welches zwar nur nur 1 bis 2 Zoll mächtig war, aber braunen Eisenstein und inneliegend Glaskopf führte. Außerdem hatte man bei 27 Lachtern Länge ein Versuchsort Stunde 12,4 gegen Mittag angesetzt, das aber erst ¾ Lachter lang war. Herr Schmiedel wies an, das Trum näher zu untersuchen (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 114f). Über seine Anweisung trug der Geschworene am 25. Februar 1809 auch im Bergamt Annaberg vor, wo man diese für „nöthig und zweckmäßig“ befand (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 9). Am 28. März 1809 fand der Geschworene bei Gnade Gottes Stolln nebst Zubehör im immer noch nur 3½ Lachter tiefen Tageschacht schon wieder zwei neue Örter vor, eines davon Stunde 5,5 gegen Nordost war 2⅛ La lang und zweites Stunde 3,6 gegen Südwest 1¾ Lachter lang (40014, Nr. 236, Blatt 129f). Das klingt alles nach einem etwas planlosen Suchen... Dennoch waren am 5. Mai 1809 wieder 77 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 141). Bei den Gnade Gottes'er oberen Maßen war hingegen am 28. März nichts Neues zu berichten (40014, Nr. 236, Blatt 129f). Nach seiner Befahrung vom 12. Mai 1809 notierte Herr Schmiedel über Gnade Gottes Stolln, daß das erste Abbauort mit gleich gebliebener Weitung von 1½ Lachter inzwischen 5¼ Lachter fortgestellt wart, das andere Stunde 5,5 gegen Nordost jetzt 2¾ Lachter lang gewesen ist (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 142). Die Gnade Gottes'er oberen Maßen waren hingegen am 12. Mai nicht belegt (40014, Nr. 236, Blatt 143). Bei seiner nächsten Befahrung am 10. Juli 1809 war die Mannschaft aber wieder vor Ort. Man senkte schon wieder neuen Tageschacht ab, um „das bei der banchbarten Grube sich als sehr bauwürdige bewiesene Eisensteinlager zu durchsinken“, dieser war jetzt 2¼ Lachter tief und bei 2 Lachtern Teufe hatte man „einige Stücken ockerigen braunen Eisenstein getroffen und gewonnen.“ (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 162) Ob das Gnade Gottes'er Stollnort überhaupt noch belegt war, ist schon aus den letzten Fahrberichten nicht mehr klar herauszulesen. Am 10. Juli 1809 berichtete Herr Schmiedel jedenfalls, es seien nur 3 Mann angelegt und diese hatten offenbar den Tageschacht in ihrem „Zubehör“ auf 4½ Lachter Teufe vertieft und dort ein Ort Stunde 6,6 gegen Morgen angesetzt. Dieses stand wohl wieder im Lager, denn das Ort hatte bei 1 Lachter Weitung schon wieder 4½ Lachter Länge erreicht (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 162).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 28. Juli 1809 befuhr Bergmeister
Johann Carl Schütz
selbst die beiden Gruben, worüber man am Folgetag in Annaberg zu Protokoll
nahm, bei der Gnade Gottes Fundgrube habe man mit den Bauen die Endschaft
des Lagers erreicht, den Tageschacht daher wieder zugefüllt und die Grube
in Fristen gesetzt (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 10ff). Betrieb ging
nur noch auf den unteren Maßen um, wo
respektive 3 Mann angelegt waren, welche den Tageschacht auf 3½ Lachter Teufe bis auf ein „im Durchschnitt 1¼ Lachter mächtiges, aus vielen (schwer leserlich: ,einzelnen‘ ?) und dichten Brauneisenstein, sogenannten Eisenpecherz, untergemengten Quarz und Hornstein bestehend, 20 Grad in Mitternacht fallendes Lager“ abgesenkt hatten. Dort hatte man drei Örter angehauen, war mit dem nach Nordosten aber in alten Mann gekommen. Nichtsdestoweniger hatte man hier in den vergangenen anderthalb Jahren 220 Fuder Eisenstein im Wert von 318 Thalern, 8 Groschen ausgebracht. Weiter heißt es in dieser Registratur, Herr
Nietzsche habe, um seine Grube tiefer vom Wasser zu lösen, „an der
nordwestlichen Seite des zum Rittergut Förstel gehörigen, alten Kalkbruchs
im vorigen Jahr den Gnade Gottes Stolln ansetzen und unter beständigem
Abtreiben mit Schwartenpfählen und fortlaufender ganzer Thürstockzimmerung
in sonst hereinkommenden Sand- und Thongebirge 14 Lachter Stunde 10 gegen
Mitternacht Abend fortbringen laßen. Die Fundgrube liegt noch 73 Lachter
vor, aber leider geschieht nichts mehr auf dem Stolln...“ Die „fahrenden
Beamten“ erteilten jedenfalls die Anweisungen an den
Steigerdienstversorger Krauß, den Abbau regelmäßiger auszurichten und das Stollnort wieder zu belegen und „schwunghaft heranzutreiben.“ Bei dieser
Beschreibung des anstehenden Gebirges und des erforderlichen Aufwandes, es
zu durchörtern, kann man solch ein Projekt allerdings schon mal aufgeben.
Erst zehn Jahre
Über den Betrieb bei den Gnade Gottes'er oberen Maßen im Besitz des Hammerwerksbesitzers Rau berichtete Bergmeister Schütz am gleichen Tag, man habe bis jetzt in der nächsten nordöstlichen Maß gebaut, wo aber das Ausbringen von gerade einmal 30 Fudern unreinem Eisenstein mit Braunstein „der Erwartung nicht entsprochen“ hatte (40169, Nr. 128, Blatt 13ff). Der Tageschacht wurde daraufhin wieder verfüllt und stattdessen hatten die hier angelegten
respektive 4 Mann, nun in der nächsten südöstlichen Maß, nur 5⅜ Lachter von der Markscheide entfernt, eingeschlagen. Hier hatte man in nur 1 Lachter Teufe ein auch nur 6 Zoll mächtiges Eisensteinlager ersunken, darunter aber ist man auf „einen fettigen, schwarzen Mulm mit aufgelöstem Feldspath und Porzellenerde“ und schließlich bei 6 Lachter Teufe auf „ordentliches Glimmerschiefergebirge“ gekommen. Hier wiesen die Bergbeamten den Steiger an, daß er dem Eigentümer die bergbehördliche Empfehlung mitteile, daß dieser sich mit dem Eigentümer der Nachbargrube verständigen solle, ob man nicht den Stolln gemeinschaftlich heranbringen könne.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ähnlich lautet auch der Fahrbericht Schmiedel's vom 14. September 1809 über Gnade Gottes Stolln samt Zubehör. Wie zuvor waren 3 Mann angelegt, und diese treiben in 4½ Lachtern Teufe auf dem Lager das Ort mit 1 Lachter Weitung gegen Osten weiter vor, allerdings wird jetzt dessen Richtung mit Stunde 7,2 angegeben (40014, Nr. 236, Blatt 182). Und es scheint sich hier auch weiterhin gelohnt zu haben, denn: „Sodann wurden bei dieser Grube in meinem Beisein 61 Fuder Eisenstein vermeßen.“ Von seiner nächsten Befahrung am 13. November 1809 berichtete er über Gnade Gottes Stolln, man treibe jetzt in 4 Lachtern Teufe ein Ort Stunde 12,2 gegen Süd, welches jetzt 2½ Lachter weit vorangebracht war, und ein zweites Ort Stunde 4,4 gegen Südwest, welches jetzt 1¾ Lachter lang gewesen ist (40014, Nr. 236, Blatt 203). Und wie schon bei Vater Abraham in Oberscheibe, fand der Geschworene auch hier neuerdings „Eisenpecherz“. Vom ausgebrachten Brauneisenerz jedenfalls waren am 20. November 1809 wieder 32 Fuder zu vermessen (40014, Nr. 236, Blatt 204). Noch eine weitere Befahrung bei Gnade Gottes Stolln durch Herrn Schmiedel erfolgte am 7. Dezember des Jahres1809 (40014, Nr. 236, Blatt 214f). Die Belegschaft baute zum einen noch in 4 Lachtern Teufe des Tageschachtes, nun jedoch auf einem Ort Stunde 9,3 gegen Südost, das bereits 3¼ Lachter lang war und zum anderen bei 4½ Lachtern Teufe trieb man ein zweites Ort Stunde 4,4 gegen Nordwest, welches jetzt 2¼ Lachter fortgestellt war. Das Lager war vor den Örtern 1½ Lachter mächtig. Rund um den Tageschacht muß doch schon alles unterhöhlt gewesen sein. Von einem Schachtsicherheitspfeiler hat man hier wohl noch nichts gehört... In den letzten beiden Quartalen fehlen nun auch Notizen über die Grube Gnade Gottes obere Maßen ‒ dort wird man doch nicht in der Zwischenzeit ebenfalls aus dem Feld gegangen sein ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 26. Januar 1810 war der Geschworene erneut in Langenberg, fand aber bei Gnade Gottes Stolln nichts neues vor (40014, Nr. 245, Film 0010). Trinitatis 1810 wird nach längerer Pause auch wieder über die Fundgrube berichtet: Dort war Herr Schmiedel am 10. April 1810 zugegen und fand die Gnade Gottes Fundgrube wieder mit 3 Mann belegt. Man teufte gerade einen neuen Tageschacht an der Nordseite der „großen Pinge“, wo man hoffte, „daß die Vorfahren das Lager dort noch nicht abgebaut haben“. Der neue Schacht war jetzt 3½ Lachter tief und hatte bei 2½ Lachter ein Stunde 2,6 streichendes, 40° in West fallendes und 1 Elle mächtiges Lager durchsunken (40014, Nr. 245, Film 0041f). Diesmal hatte der Geschworene allerdings auch etwas zu bemängeln, nämlich: „Um die Arbeiter in bemerktem Tageschachte sicherzustellen, so habe ich dem Versorger dieses Berggebäudes aufgegeben, daß vor allen Dingen, ehe weiter abgeteuft wird, der in sehr rolligem und zerklüftetem Gebirge niedergebrachte Tageschacht mit der nöthigen Zimmerung verwahret werden soll.“ Junge, Junge ‒ wer trieb hier solcherart Bergbau ? Am 10. September 1810 hatte der Geschworene wieder über den Gnade Gottes Stolln zu berichten (40014, Nr. 245, Film 0090). Inhalts des Fahrbogens war dieser mit 1 Versorger, 2 Häuern und 1 Jungen belegt, durch welche jetzt „vom Tage nieder steinbruchweise“ das 1 bis 1¼ Lachter mächtige und Stunde 6,2 streichende, sich 20° gegen Nord verflächende Lager abgebaut werde. Es bestand aus gelbem Ocker, Gneis, Quarz, braunem Hornstein, dichten Brauneisenstein und „Eisenpecherz“. So war es auch noch bei der nächsten Befahrung am 12. Februar 1811: Es heißt im Fahrbogen, man baue mit 3 Mann Belegschaft „vom Tage nieder das 2 Lachter unter Tage befindliche Lager“ ab (40014, Nr. 245, Film 0155).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Zwischenzeit hatte auch Steiger Carl August Weißflog am 17. Dezember 1810 noch einmal Mutung auf zwei gevierte Maßen „auf dem Eisensteinlager, auf dem bei Gnade Gottes gebauet wird,“ eingelegt und erhielt diese auch am 4. April des Folgejahres auch bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 261f). Nach anderen Quellen erfolgte die Mutung bereits am 17. Oktober 1810 und die Bestätigung am 14. April 1811 (40014, Nr. 211, Film 0084). Im Juni 1811 wurde wohl der Abraum zu mächtig, denn Herr Schmiedel berichtete nun, daß man bei Gnade Gottes Stolln an der östlichen Seite der Fundgrube nun einen neuen Tageschacht absenke, der „in gelbem Ocker und mildem Gneise“ bereits 3 Lachter niedergebracht war (40014, Nr. 245, Film 0208). Nach seiner Befahrung am 12. Februar 1811 berichtete Herr Schmiedel über Gnade Gottes obere Maaßen (40014, Nr. 245, Film 0155): „Diese zwar gemutete, aber noch nicht bestätigte Grube ist mit 1 Häuer und 1 Knecht belegt, durch welche bei 3 Lachter Teufe des Tageschachtes auf dem daselbst ersunkenen Eisensteinlager ein Ort Std. 12,1 gegen Mitternacht mit 1 Lachter Weitung betrieben wird, und bereits 6 Lachter von bemerkten Tageschacht erlängt ist. Das Lager hat dieselbe Beschaffenheit, wie bei vorbeschriebener Grube.“ Am 30. April 1811 heißt es, daß Ort richte sich nun Stunde 11,3 und sei 7 Lachter ausgelängt worden (40014, Nr. 245, Film 0192f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch am 20. August 1811 berichtete Herr
Schmiedel über seine Befahrungen von Gnade Gottes Stolln samt
Zubehör und Gnade Gottes obere Maaßen noch getrennt. Über den ersten
heißt es (40014, Nr. 245, Film 0235),
man sei mit dem Tageschacht bis auf 4 Lachter Teufe niedergegangen und
habe dort ein Ort mit 1 Lachter Weitung im Streichen des Lagers gegen
Südwest angesetzt, dieses auch schon 2 Lachter fortgestellt.
Bei den oberen Maßen hingegen fand er ein Ort Stunde 2,1 gegen Nord angesetzt und dieses jetzt 6½ Lachter erlängt (40014, Nr. 245, Film 0236). Am 14. Oktober 1811 benannte Herr Schmiedel die erstere als Gnade Gottes Fundgrube und berichtete, daß man bei nun schon 5 Lachter Teufe „eines in dem dasigen alten Tagebruche niedergehenden Schachtes ein Ort nach dem Streichen des Lagers“ gegen Südwest betrieb, das bei 1 Lachter Weitung 1 Lachter erlängt war (40014, Nr. 245, Film 0255). Die Angabe des Geschworenen, daß man alle Orte gleich ,mit Weitung' betrieb, verweist darauf, daß man gut bauwürdige Lagerabschnitte angefahren hatte und so hatte Herr Schmiedel auch am 6. November des Jahres auf dieser Grube wieder 100 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 245, Film 0267). Auch bei Gnade Gottes obere Maaßen war man bis zum 6. November 1811 noch weiter in die Tiefe gegangen, hatte mit dem Schacht 4 Lachter Teufe erreicht und dort ein Ort Stunde 1,6 gegen Nord angesetzt, welches bei 1¼ Lachter Weitung bereits 7 Lachter fortgestellt war (40014, Nr. 245, Film 0267). Das Ausbringen belief sich bis zum 11. November hier auf 46 Fuder Eisenstein (40014, Nr. 245, Film 0269). Die letzte Befahrung durch den Geschworenen im Jahr 1811 fand am 23. Dezember statt. Über Fundgrube bzw. Stolln heißt es, sie sei nach wie vor mit drei Mann belegt und, daß das Ort Stunde 5,1 gegen Südwest im Streichen des Lagers bei 5 Lachter Teufe „eines in dem dasigen alten Tagebruche niedergehenden Schachtes“ mit gleicher Weitung von 1 Lachter nun 2¾ Lachter erlängt gewesen ist (40014, Nr. 245, Film 0285f). Über die oberen Maßen berichtete Herr Schmiedel, sie sei mit zwei Mann belegt und, man betreibe das Ort gegen Nord nun in der Richtung Stunde 12,3. Dieses war mit noch 1 Lachter Weitung bis auf 7⅞ Lachter vom Schacht fortgebracht. Danach setzen die Erwähnungen von Gnade Gottes obere Maaßen in den Fahrbögen wieder aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 25. März 1812 war Herr Schmiedel
das nächste mal vor Ort und fand bei der Fundgrube samt Stolln ein neues
Ort, nun Stunde 10,3 gegen Süd angesetzt und bei 1 Lachter Weitung bereits
2 Lachter ausgelängt, in 5 Lachtern Teufe des Tageschachtes vor (40014, Nr. 250, Film 0035).
Die oberen Maße hingegen fand der Geschworene unbelegt. Bis zum 12. Juni
1812 waren bei der Fundgrube dabei wieder 65 Fuder Eisenstein ausgebracht
und zu vermessen (40014, Nr. 250, Film 0061).
Am 13. Juli 1812 notierte der Geschworene in seinem Fahrbogen über Gnade Gottes Fundgrube (40014, Nr. 250, Film 0071f), sie sei mit 3 Mann belegt, durch welche a.) bei 4 Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort Stunde 11,2 gegen Nord in Quergestein betrieben werde, „um das Grubenfeld, so in dieser Gegend noch ziemlich unbebaut ist, aufzuschließen“, dieses war 5¼ Lachter erlängt, und b.) in ebendieser Sohle ein zweites Ort Stunde 7,1 gegen Ost, das 3¾ Lachter erlängt war und hier „brach in der untern Hälfte gelber und brauner ockeriger sowie auch dichter Braunseisenstein in loosen Stücken ein.“ Das klingt doch ganz so, als wäre wieder einmal ein bauwürdiger Lagerabschnitt durchfahren und daß man sich auf die Suche nach neuen Anbrüchen machen mußte... Außerdem traf Herr Schmiedel noch die folgende Veranstaltung: „Um mit dem sub a. beschriebenen Orte nicht in alte Baue zu erschlagen, so habe ich veranstaltet, daß sich mit selbigem nach und nach in Stunde 10,2 gewendet werden soll, dieweil in dieser Richtung das meiste ganze Feld vorlieget.“ Ja, ja ‒ und die Alten waren vorher ja auch schon da... Seiner getroffenen Festlegung halber trug der Geschworene dazu auch im Bergamt Annaberg vor (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 14). Bis zur nächsten bergamtlichen Befahrung am 6. Oktober 1812 war das erste Ort 9 Lachter lang geworden und ‒ da Herr Schmiedel nichts dergleichen in seinem Fahrbericht erwähnt ‒ die Suche nach neuen Anbrüchen wohl bis dahin erfolglos geblieben (40014, Nr. 250, Film 0108). Mit dem zweiten Ort dagegen hatte man mehr Glück; es war inzwischen 11⅛ Lachter erlängt und vor Ort war das Lager jetzt ¼ bis ½ Lachter mächtig, es fällt 10° gegen Nord und besteht „aus gelbem Ocker, mildem Gneis, Quarz, braunem Hornstein, gelben und braunem ockerigen auch dichten Brauneisenstein.“ Bei der Suche nach Erzanbrüchen hatte man im Quartal Crucis 1812 nur 17 Fuder Eisenstein ausgebracht, die am 20. Oktober vermessen wurden (40014, Nr. 250, Film 0116). Die Betreiber gaben die Suche aber nicht auf: Im folgenden Fahrbogen vom 14. November 1812 heißt es, daß man nun bei 5 Lachter Teufe „eines ganz neuerlich abgesunkenen Tageschachtes“ ein Ort Stunde 4,5 gegen Ost in Quergestein, „zur Aufschließung des nach dieser Weltgegend noch unverritzten Grubenfeldes“ betreibe, welches auch schon wieder 6¾ Lachter erlängt gewesen ist (40014, Nr. 250, Film 0121f). Im Quartal Luciae 1812 belief sich daher aber auch das Ausbringen wieder nur auf 16 Fuder Eisenerz (40014, Nr. 250, Film 0128f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Folgejahr hat man das schon über 22
m lange Ort gegen Ost aufgegeben und ein neues in die Gegenrichtung,
Stunde 6,3 gegen West, aufgenommen. Bis zur ersten Befahrung im neuen Jahr
durch Herrn Schmiedel am 11. Februar 1813 war dieses schon wieder
6½ Lachter erlängt (40014, Nr. 251, Film 0014).
Bei seiner Befahrung am 24. März fand der Geschworene bei nun 6 Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort im Streichen des Lagers Stunde 6,1 gegen West in Betrieb vor, welches bei 1¼ Lachter Weitung und ¾ Lachter Höhe (nur rund 1,5 m) 7 Lachter erlängt gewesen ist. Hinter diesem Ort wurde dann der Förstenstoß in einer Scheibe von ½ Lachter Höhe nachgerissen (40014, Nr. 251, Film 0031). Man war also rund 2 m in die Tiefe gegangen und unterfuhr die eigenen Baue auf dieser Sohle, um das Lager ohne Bergefesten komplett auszuhauen. Das Ausbringen im ersten Quartal des Jahres war dabei gegenüber den letzten beiden Quartalen wieder auf 46 Fuder gestiegen (40014, Nr. 251, Film 0037). Bis 14. Juli 1813 war dieses Abbauort bei noch 1 Lachter Weitung um weitere 1¾ Lachter Länge auf nun 8¾ Lachter Gesamtlänge fortgestellt (40014, Nr. 251, Film 0072). Im Sommer 1813 hatte man offenbar aber doch wieder ein neues Ort etwas mehr in Nordostrichtung (Stunde 5,6) aus dem Schacht heraus angesetzt ‒ sonst aber lief der Betrieb in gleicher Weise weiter (40014, Nr. 251, Film 0095). Bis Anfang November war auch das neue Ort bei 1 Lachter Weitung wieder auf 4¼ Lachter erlängt (40014, Nr. 251, Film 0110f), wobei man bis 16. November 1813 eine Förderung von 30 Fudern verzeichnen konnte (40014, Nr. 251, Film 0114).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als Herr Schmiedel am 13. April
1814 das nächste mal auf der Grube zugegen war, fand er schon wieder einen
„neuen Tageschacht“ von 5 Lachter Teufe vor, und von diesem aus ein
Ort auf dem Lager Stunde 6,5 gegen Ost in Umgang, das 6¼ Lachter lang war
(40014, Nr. 252, Film 0034).
Diesmal wurde hinter dem Streckenort eine Strosse von ⅜ Lachter Höhe
nachgerissen (also wurde die Streckensohle um zirka 0,75 m nachgenommen).
Im April 1814 waren hier 18 Fuder Eisenstein zu vermessen
(40014, Nr. 252, Film 0049).
Damit man neue Schächte teufen konnte, mußte der Schichtmeister Christian Andreas Richter, vermutlich nun der Sohn von Christian Friedrich Richter, am 16. April 1814 zugunsten Gnade Gottes Fundgrube die nächsten zwei gevierten Maßen muten (40014, Nr. 211, Film 0103). Die Bestätigung erfolgte am 20. April 1814. Von seiner Befahrung am 28. Juni 1814 berichtete der Geschworene dann (40014, Nr. 252, Film 0057 und 40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 15), es werde bei 5¼ Lachter Teufe des neuen Tageschachtes ein Ort Stunde 6,0 gegen Ost auf dem Lager „zur Wiederausrichtung neuer Anbrüche“ getrieben, das jetzt 11½ Lachter erlängt war. Mit diesem Ort hatte man bereits bei 1½ Lachtern Erlängung einen 4 Ellen mächtigen Brauneisenstein- Nieren ausgerichtet und ein Flügelort in dessen Streichen 5 Lachter gegen Süd getrieben, wo man das Lager aber sehr unrein, mit Quarz und Hornstein gemengt, angetroffen hatte. Es war zwar noch nicht gänzlich durchfahren, aber man hatte das Ort eingestellt und baute nun „förstenweise“ den mächtigeren Teil des Lagers ab. Mit dem Hauptort war man in „gelbes und weißes Thongebirge“ gekommen und hatte auch dieses eingestellt. Man wollte sich nun wieder auf dem Fundschacht einlegen und Örter in die Gegenrichtung treiben. Des starken Wasserzugangs in der Sohle halber kam erneut das Stollnprojekt zur Sprache. Herr Schmiedel aber äußerte bei seinem Fahrbogenvortrag am 6. August 1814 in Annaberg, der Eigenlöhner Nietzsche sei „zum Herantrieb des bereits angefangenen, jedoch wieder verbrochenen Stollns nicht zu bewegen...“ Nach einer erneuten Befahrung trug Herr Schmiedel dann am 24. August 1814 in Annaberg vor, daß sich im neuen Tageschacht „die Anbrüche gänzlich abgeschnitten“ haben und dieser nun verlassen werde (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 16). Man schlage nun im Fundschacht in 4½ Lachter Teufe ein Ort gegen Südwest an. Die Geschichte wiederholt sich: Die Bauwürdigkeit der sogenannten „Lager“ hält, mit seltenen Ausnahmen, nicht wirklich weit aus. Und so hatte Herr Schmiedel von seiner Befahrung am 27. September 1814 auch zu berichten (40014, Nr. 252, Film 0081f), daß mit den 3 hier anfahrenden Mann, „um das hier gewöhnlich bei 5 bis 6 Lachter Teufe unter Tage befindliche Eisensteinlager zu durchsinken, ... ein neuer Tageschacht niedergebracht (wird), dessen Teufe bis jetzt 4¼ Lachter beträgt und womit man auf der Sohle desselben ganzes Gestein, so aus mildem Gneis, gelbem Ocker und braunem Hornstein bestehet, getroffen hat, so daß man der baldigen Erreichung dieses so wichtigen Eisensteinlagers entgegen sehen kann.“ Schon wieder ein neuer Schacht. Nun
ja. Herr von Querfurth hatte nicht ganz Unrecht mit seinen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Immerhin scheint man wieder Glück
gehabt zu haben, denn, wie im nächsten Fahrbogen vom 10. Januar 1815 zu
lesen steht, mußte man sich zwar diesmal bis auf 8 Lachter Teufe
hinunterarbeiten, konnte dort aber im Lagerstreichen ein Ort Stunde 7,3
gegen West anschlagen, daß bei gleich 2 Lachter Weitung inzwischen schon
wieder 4¾ Lachter fortgestellt war (40014,
Nr. 254, Film 0004). Bei ja nur
3 Mann Belegung waren das binnen eines Quartals immerhin rund 76 m³
Ausbruchsvolumen ! Dabei sind bis zum 13. Februar 1815 auch 30 Fuder
Eisenstein ausgeklaubt worden (40014, Nr. 254,
Film 0013).
Am 20. Februar des Jahres fand Herr Schmiedel dann aber auch schon wieder ein neues Ort 4 m höher im Schacht angesetzt und bei 1½ Lachter Weitung 6 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 254, Film 0015). Bis zur nächsten Befahrung am 9. Mai 1815 war dieses Ort in Richtung Stunde 7,4 gegen West bei 1 Lachter Weitung 7½ Lachter fortgebracht (40014, Nr. 254, Film 0041f). Im nächsten Quartal war man erneut in die Gegenrichtung umgeschwenkt und hatte bis zum 24. Juli 1815 ein Ort Stunde 6,3 gegen Ost auf dem Lager bei ¾ Lachter Weitung 4 Lachter fortgestellt. Hinter diesem Ort wurde wieder ein ⅜ Lachter hoher Förstenstoß nachgerissen (40014, Nr. 254, Film 0061f). Auch in dieser Richtung scheint aber bald wieder Schluß mit der Erzführung gewesen zu sein, denn am 26. September 1815 fand Herr Scmiedel wieder ein neues Ort, diesmal Stunde 1,7 gegen Süd, aufgenommen und vom Schacht 2 Lachter ausgelängt (40014, Nr. 254, Film 0081). Die (sonst hier immer recht konstant gebliebene) Belegung hat von 3 auf 2 Mann abgenommen. Bis 12. Oktober sind dabei immerhin auch wieder 51 Fuder Ausbringen zu verzeichnen gewesen (40014, Nr. 254, Film 0085). Bis 6. November wurde dieses Ort um weitere 1¾ Lachtter fortgebracht (40014, Nr. 254, Film 0093) und hatte, nun bei einer Richtung Stunde 3,6 gegen Südwest, bis zum 19. Januar 1816 eine Länge von 5¼ Lachter vom Schacht aus erreicht (40014, Nr. 257, Film 0006f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner nächsten Befahrung dieser
Grube am 13. Februar 1816 berichtete der Geschworene Schmiedel, man
habe das eine Ort Stunde 5,6 noch weiter gegen West geschwenkt und
inzwischen 6½ Lachter fortgestellt. Zugleich habe man ein zweites Ort
Stunde 11,2 gegen Nord ganz neu aufgenommen
(40014, Nr. 257, Film 0012). Bis
zum 17. April hatte man das erste Ort wohl nicht mehr, sondern nur noch
das zweite weiter betrieben und dieses bis auf 4½ Lachter erlängt
(40014, Nr. 257, Film 0034f).
Am 13. Mai 1816 standen aber wieder beide Orte in 7 Lachtern Teufe des Tageschachtes in Betrieb und das Ort Stunde 11,2 gegen Nord war nun 6¼ Lachter, das zweite Ort Stunde 11,6 gegen Süd dagegen 7 Lachter fortgebracht (40014, Nr. 257, Film 0034f). Vor beiden Örtern hat man das Lager ¾ bis 1 Lachter mächtig getroffen. Außerdem fand Herr Schmiedel Grund zu der Veranstaltung: „Da vor dem letztbeschriebenen Ort die Wetter äußerst stehend sind, so habe ich unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: daß auf das wetternöthige Ort ein neuer Tageschacht niedergebracht und dieser so angelegt werden solle, daß er gleich bey dem jetzigen Ortstoß, woselbst die über selbigem befindlichen alten Preßbaue mit benutzt werden können, hereinkomme und wurde daher dem Versorger dieser Punkt über Tage sofort angegeben.“ Seiner Veranstaltung halber trug der Geschworene dazu auch im Bergamt Annaberg aus seinem Fahrbogen vor (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 17). Nun hätte der Gnade Gottes Stolln ja leicht auch Wetterlösung verschaffen können, wozu man das Stollnort freilich hätte heranbringen müssen, was zugegebenermaßen auch nicht ohne Kosten abgegangen wäre. Die sprangen bei einem Ausbringen von 37 Fudern in diesem Quartal (40014, Nr. 257, Film 0051) wohl einfach nicht heraus ‒ oder die Gewerken waren zu geizig, ihren Grubenbetrieb planvoller und langfristiger auszurichten. Wie die Bergbehörde festgelegt hatte, wurde der neue Schacht angelegt, war bis zur nächsten Befahrung am 13. August 1816 schon 4 Lachter niedergebracht und hatte das Lager erreicht (40014, Nr. 257, Film 0070f). Am 26. September hatte man bei 5 Lachter Teufe aus dem neuen Tageschacht ein Ort Stunde 5,6 gegen West angesetzt und 1½ Lachter vorgetrieben (40014, Nr. 257, Film 0085f). Damit fuhr man in der Folgezeit fort und bis 23. Januar 1817 gab es für Herrn Schmiedel hier nichts wesentlich neues zu berichten (40014, Nr. 258, Film 0009).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bis zum 14. Februar 1817 hatte man wohl
den Durchschlag und damit Wetterwechsel erreicht (es steht allerdings
nichts darüber im Fahrbogen), denn man trieb nun ein Ort in 6 Lachter
Teufe Stunde 11,1 gegen Süd, das auch schon 8 Lachter Länge erreicht hatte (40014, Nr. 258, Film 0016).
Am 24. April 1817 fand Herr Schmiedel die Gnade Gottes Fundgrube auch wieder mit 3 Mann belegt, welche bei nun 7 Lachter Teufe aus dem neuen Tageschacht heraus das Ort bei 1 Lachter Weitung Stunde 12,3 gegen Süd trieben und auf 10½ Lachter ausgelängt hatten. Hinter dem Ort wurde wieder eine ⅜ Lachter hohe Strosse nachgerissen (40014, Nr. 258, Film 0041). Bis zum 20. Mai des Jahres hatte man dabei 20 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 258, Film 0048). Bei seiner Befahrung am 29. Mai fand der Geschworene wieder ein neues Ort, diesmal bei 6 Lachter Teufe im Schacht angeschlagen, das bei 1 Lachter Weitung Stunde 8,6 gegen West getrieben und 5¼ Lachter erlängt worden ist (40014, Nr. 258, Film 0051). Außerdem notierte er: „Da bei Besichtigung der Eisenstein Vorräthe sich ergab, daß selbige nicht rein genug ausgeschlagen, sondern noch zu sehr mit Gneus und Quarz vermengt waren, so wurde dem Steiger aufgegeben, selbige nochmals auszukutten und so viel möglich von Bergen zu reinigen.“ Wir hoffen mal, dies wurde auch getan, denn davon wurden im Juni 1817 wieder 32 Fuder vermessen (40014, Nr. 258, Film 0055). Von seiner Befahrung am 28. Juli 1817 heißt es im Fahrbogen, es werde schon wieder ein neuer Tageschacht abgesenkt (40014, Nr. 258, Film 0068). Und am 10. September stellte der Geschworene fest, daß man in 4½ Lachtern Teufe dieses ganz neuen Tageschachts ein Ort auf dem Lager Stunde 8,2 gegen West treibe, das jetzt 2½ Lachter erlängt sei (40014, Nr. 258, Film 0081). Oh, Mann... Herr von Querfurth hatte absolut Recht: Das erscheint alles überhaupt nicht planvoll. Auch Herr Schmiedel kratzte sich wohl am Kopf und nachdem er am 4. November 1817 das Ort 6 Lachter ausgelängt fand (40014, Nr. 258, Film 0096f), legte er fest: „Nachdem aber vor selbigem (dem Streckenort) keine Eisenstein Anbrüche ausgerichtet worden, sondern das Lager blos aus Gneus, drusigem Quarz und braunem Hornstein bestehet, auch übrigens sehr unfreundlich aussieht, so habe ich für rathsam erachtet, dieses Ort einstweilen zu verlassen und dagegen unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: daß bey 6¾ Lachter Teufe des alten Tageschachtes das bereits 6 Lachter Stundte 11,5 gegen Mitternacht ins Feld gebrachte Ort zu Wiederausrichtung neuer Eisenstein Anbrüche weiter fortgetrieben werden soll, wozu man um so mehr Hoffnung hat, da ersagtem Orte noch viel ganzes Feld vorliegt.“ Die angehoffte Genehmigung des Bergamtes wurde nach seinem Fahrbogenvortrag am 22. November 1817 erteilt (40169, Nr. 128, Blatt 18). Da sie es ja auch nicht besser wissen konnten, fügten sich die Betreiber der behördlichen Anweisung natürlich auch und am 3. Dezember 1817 fand Herr Schmiedel besagtes Ort in 6 Lachter Teufe des Tageschachts in Quergestein Stunde 11,3 gegen Nord schon 10½ Lachter vorgetrieben (40014, Nr. 258, Film 0104).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie dem Fahrbogen auf Reminiscere 1818
zu entnehmen ist, hatte man dann aber ein neues Ort Stunde 4,4 gegen Ost
angeschlagen und bis zum 26. Februar 6 Lachter ausgelängt
(40014, Nr. 259, Film 0018).
Bis zum 23. April 1818 war das Streckenort auf Stunde 4,6 verschwenkt und
war bei nun 1 Lachter Weitung 7½ Lachter fortgebracht
(40014, Nr. 259, Film 0035).
Bis zum 9. Juni des Jahres hatte man dabei 28 Fuder Eisenstein ausgebracht
(40014, Nr. 259, Film 0053f).
Im folgenden Quartal hat man wohl das Ort Stunde 11,1 gegen Nord wieder betrieben und es nun mit ¾ Lachter Weitung 4 Lachter fortgebracht; außerdem hatte man ein zweites Ort in 6 Lachter Teufe Stunde 2,4 gegen Nord in Quergestein zu Untersuchung des dort „noch ziemlich unbebauten Grubenfeldes“ angeschlagen und es bereits 8½ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 259, Film 0069). Was mag wohl ,ziemlich unbebaut' meinen... Von seiner nächsten Befahrung am 26. Oktober 1818 berichtete Herr Schmiedel, man treibe nun in 5 Lachtern Teufe „des neuen Tageschachtes“ ein Ort mit ¾ Lachter Weitung Stunde 6,2 gegen West und habe dieses 4 Lachter fortgebracht. Hinter dem Streckenort wird ein Förstenstoß mit ⅜ Lachter Höhe nachgerissen (40014, Nr. 259, Film 0099). Oh, auch hier werden weiter munter immer neue Schächte geteuft... Von der Befahrung im Quartal Luciae 1818 hatte der Geschworene nichts bemerkenswertes zu berichten, nur wurde „dem Versorger aber aufgegeben, den Eisenstein reiner, als die Vorräthe so eben befunden wurden, auszuschlagen.“ (40014, Nr. 259, Film 0105) Davon wurden am 24. November 1818 28 Fuder vermessen (40014, Nr. 259, Film 0108). Am 27. Januar 1819 waren auf Gnade Gottes Fundgrube erneut 22 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 261, Film 0008). Der neue Tageschacht ist auf nun 7 Lachter Teufe verteuft worden, wo man nun ein Ort mit ¾ Lachter Weitung Stunde 6,3 gegen West betrieb und 7 Lachter fortgebracht hatte. Auch jetzt wieder wird hinter dem Ort ein Förstenstoß von ⅜ Lachter Höhe nachgenommen. Außerdem traf Herr Schmiedel die Veranstaltung: „Da man mit obbenanntem Orte zu Anfange dieser Woche förstweise in alte Preßbaue gekommen ist, so habe ich zu Ausrichtung neuer Eisenstein Anbrüche unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: Daß 1 Lachter vom jetzigen Ortstoß zurück ein Ort Stunde 4,4 gegen Abend, als nach welcher Weltgegend noch ganzes Feld vorliegt, getrieben und dadurch das Lager mehr untersucht werden soll.“ Daß man in dieser Richtung seine eigenen Baue unterfährt, war ja nun keine Überraschung. Man könnte nun eine Schwebe stehen lassen (was natürlich auch einen Verlust an nicht gewinnbarem Eisenstein bedeutet), oder die Firste ordentlich verbauen müssen (was natürlich mit Kosten für Ausbauholz oder Mauerung verbunden gewesen wäre), dann aber könnte man durchaus die nächste Scheibe auch unter den alten Bauen aushauen. So vernünftig uns die meisten Anweisungen des Geschworenen erscheinen ‒ hier hätte man es auch anders machen können. Der erhofften Genehmigung durch das Bergamt wegen gab es hierzu wieder einen Fahrbogenvortrag in Annaberg (40169, Nr. 128, Blatt 19). Weder das eine, noch das andere ist im nächsten Quartal erfolgt, vielmehr fand Herr Schmiedel bei seiner Befahrung am 6. April 1819 ein ganz neues Ort in 7 Lachtern Teufe Stunde 12,3 gegen Nord angesetzt, welches in Quergestein getrieben und bereits 9¼ Lachter ausgelängt war (40014, Nr. 261, Film 0037). Am 9. Juni des Jahres war man mit dem Streckenort auf Stunde 10,1 gegen Nord verschwenkt und es, immer noch in Quergestein „nach dem ganz nahe vorliegenden Eisensteinlager“, auf 12½ Lachter fortgebracht. Bei 12 Lachter sei dabei ein ⅛ Lachter ,mächtiges' Lager überfahren worden (40014, Nr. 261, Film 0053). Irgendwie hat man dabei auch noch 19 Fuder Eisenstein ausgebracht. Bis zum 5. Juli des Jahres hatte man 16 Lachter Länge erreicht (40014, Nr. 261, Film 0063f). Dann scheint man es aber aufgegeben zu haben, denn im Fahrbogen vom 26. Oktober 1819 liest man, daß nun wieder das Ort Stunde 6,3 gegen Abend betrieben werde und man es mit ¾ Lachter Weitung 15¼ Lachter fortgestellt habe (40014, Nr. 261, Film 0092). Sie unterfahren jetzt also doch ihre alten ,Preßbaue'. Dabei schwenkte man, dem Streichen des Lagers folgend, bis zur letzten Befahrung in diesem Jahr auf die Richtung 11,2 ein und hatte das Ort bis 25. November bis auf 16¼ Lachter erlängt (40014, Nr. 261, Film 0103). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen weiteren Ortstermin hat es noch am
7. Dezember 1819 gegeben, über den Herr Schmiedel notierte
(40014, Nr. 261, Film 0108f):
„(...) da das auf dieser Grube seit mehreren Jahren bekannte, Eisensteinlager vom Tage nieder bis in 6½ Lachter Teufe fast gänzlich abgebaut und hierbey über 2.400 Fuder Brauneisenstein von guter Beschaffenheit gewonnen worden, ein tieferer Abbau aber, der Grundwaßer wegen, in Ermangelung eines Stollens dermalen mit Vortheil nicht vorzunehmen ist, mit den Gruben Vorstehern wegen Anlegung eines Stollens, dem Wunsche des Eigenlehners, des Herrn Bergcommisssionsrath Nitzsche auf Erla zufolge, die nöthige Überlegung gepflogen und ist man dahin überein gekommen, daß, um den auf obgedachtem Lager in 6½ Lachter Teufe unter Tage anstehen gelassenen Brauneisenstein mit Nutzen zu gewinnen und vortheilhafte Baue anlegen zu können, aus dem Schwarzbachthale ein Stolln Stundte 11,2 gegen Mitternacht, als auf dem kürzesten Wege, welcher sich in dieser Gegend anbietet, und welcher nach so eben beschehener Ausmessung, 90 Lachter in das dasige milde Gebirge bis an die vorliegenden Eisensteinbaue zu betreiben seyn und bey dem Fundschachte 12 Lachter zwey Achtel oder aber unter die zeitherigen Baue 5 Lachter 6 Achtel mehrerer Seigerteufe einbringen dürfte, betrieben werden soll, wobey man noch die sehr wahrscheinliche Hoffnung hat, daß man mit ersagtem Stolln selbst bey nicht weitem Auffahren Eisensteinanbrüche machen werde.“ Darüber trug Herr Schmiedel am 31. Dezember 1819 auch in Annaberg vor (40169, Nr. 128, Blatt 20). Nun endlich ging man das Stollnprojekt wieder ernsthaft wieder an... Zum Stolln hatte Bergkommissionsrat Nietzsche zu Erla auch gesonderte Mutung eingelegt und erhielt denselben, welcher „am rechten Ufer des Langenberger Waßers ganz in Thon und bei 100 Ltr. südlicher Entfernung in Std. 11,1 vom Fundschacht zu Gnade Gottes angeseßen ist, und in (...) Berggebäude eingebracht werden soll,“ am 26. Februar 1820 offiziell bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 278f). Bei seiner nächsten Befahrung am 25. Januar 1820 fand der Geschworene den Stollnbetrieb auch aufgenommen und das Ort bereits 5¾ Lachter fortgebracht vor (40014, Nr. 262, Film 0008f). Dabei hatte Herr Schmiedel noch Anlaß zu der Veranstaltung: „Da auf diesem Stolln das Hangende sowohl als Liegende sehr viel Druck äußert, so wurde dem Versorger aufgegeben, zwischen jedem der bereits angebrachten Thürstöcke noch einen einzusetzen.“ Bis zum 21. März 1820 war das Stollnort dann 14½ Lachter fortgebracht (40014, Nr. 262, Film 0027). Bis zum 26. April war die Richtung des Stollns auf Stunde 10,1 etwas verschwenkt und 21 Lachter waren aufgefahren. Der Vortrieb erfolgte nach Gedingelohn, wobei der Lachter inklusive Zimmerung und Förderung zu 2 Thl. 18 Gr. – Pf. verdingt war. Bemerkenswert fand der Geschworene noch, daß man bei 19 Lachter eine Niere dichten Brauneisenstein angefahren und davon 4 Tonnen gewonnen hatte (40014, Nr. 262, Film 0038f). Bis zum 20. Juni 1820 war der Stolln bereits 32 Lachter vorgetrieben (40014, Nr. 262, Film 0059) und bis zum 19. September waren ab Stollnmundloch 68¼ Lachter Länge erreicht (40014, Nr. 262, Film 0081). Dabei war man wieder auf Stunde 11,1 abgeschwenkt. Der Vortrieb durch Quergestein muß aufwendiger geworden sein, denn der Lachter war nun zu 3 Thaler, 6 Groschen verdingt. Wohl des längeren Förderweges halber, war jetzt auch ein Mann mehr auf der Grube angelegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Zwischenzeit gab es Beschwerden des
Grundbesitzers, des Herrn Carl von Querfurth auf Förstel, auf die wir
„Auf diesen nun in Kürze beschriebenen Lagern werden nun folgende Gruben betrieben. (...) 12.) Gnade Gottes Stolln betreffend, so ist zuvörderst von selbigen mit Bezug auf den § des vorigen Protokolls folgendes zu bemerken: Bey der von diesen Stolln gegen Mitternacht, von dem Herrn Bergcommissionsrath Nitzsche auf Erla betrieben werdenden Zeche Gnade Gottes Fundgrube konnte man auf dem dasigen, Stunde 6,3 streichenden, gegen 20 Grad in Mittag fallenden, ½ Lachter mächtigen, aus mildem Gneus, Quarz, braunem Hornstein, dichten Brauneisenstein und etwas Eisenpecherz bestehenden, am rechten Schwarzbachufer aufsetzenden Eisensteinlager nur bis 6½ Lachter vom Tage nieder, in Ermangelung eines Stollns Abbau verführen, sich aber, da über und in dieser Teufe alles abgebaut ist, der gute Nachhalt dieses Lagers, von welchem in besagter Teufe allein 1.400 Fuder Eisenstein gewonnen worden, einen Hauptplan auszuführen verdient, sich genöthiget, auf Heranholung eines tiefen Stollns Bedacht zu nehmen. Dem von Herrn Geschworenen Schmiedel geschehenen, vom Königlichen Bergamte approbirten Vorschlage zur Folge, wurde nun im Schwarzbachthale der Stolln gegen Mitternacht No. 11te Woche Luciae vorigen Jahres (schwer leserlich ?) und zu betreiben angefangen, seitdem in Stunde 11,2 in besagte Weltgegend bey 3 Mann Belegung 37 Lachter ins Gebirge gebracht. Das schüttige, fast rollige Gebirge gestattet zwar einen wohlfeilen Betrieb, indeß erfordert dieser Stolln zu seinem Ausbau doppelte Thürstockzimmerung, welche mit der Bergförderung und der Gewinnung den Arbeitern auf anfangs für 2 Thaler, – Gr., gegenwärtig aber für 3 Thaler, – Gr. verdungen ist. Dieser Stolln bedarf ohngefähr 90 Lachter Durchörterung bis Fundschacht, woselbst er mit 12¼ Lachter Teufe oder aber mit 5¾ Lachter unter den dasigen Bauen einkommt. Herren Fahrende fanden sowohl den Betrieb, als auch die Zimmerung in bester Ordnung und bezeugten hierüber den Vorstehern ihre Zufriedenheit, wie übrigens auch das ganze Unternehmen, welches Herr Bergcommissionsrath Nitzsche auf eigene Kosten ausführt, lobenswerth ist und vielen bergmännischen Eifer und Plan beurkundet.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ach ja: Dann gab es ja noch die
Gnade Gottes obere Maßen. Von denen fand sich seit 1811 nichts mehr in
den Fahrbögen des Berggeschworenen. Nun aber scheint sie der Steiger
Weißflog wieder aufgenommen zu haben, denn Herr Schmiedel
notierte am 13. Oktober 1820
(40014, Nr. 262, Film 0086f):
„Des von dem Herrn Bergmeister von Zedtwitz Hochwohlgeb. erhaltenen Auftrags zufolge bin ich auf dem Berggebäude Gnade Gottes zu Langenberg gewesen und habe, indem der Schichtmeister desselben, Herr Bergfactor Richter allhier, ingleichen Steiger Karl August Weisflog zu Langenberg und zwar ersterer zum Besten gedachter Grube, letzterer jedoch für sich, neuerlich daselbst geviertes Feld gemuthet, wegen zweydeutigen Ausdrucks in der Weisflogschen Muthung aber einige Differenzen entstanden sind, im Beysein erwähnter beyder Muther, das streitige Feld besichtiget. Wenn nun über die Art und Weise, wie beyde Muther zufriedenzustellen, selbigen mehrer Vorschläge gethan wurden, über einiges aber noch die Erklärung des Eigenlöhners von Gande Gottes Fundgrube, Herrn Bergkommissionsrath Nitzsche auf Erla, nöthig ist, derselbe aber heute nicht zugegen war; als sind die weiteren Verhandlungen einstweilen ausgesetzt...“ Ob und wie die Einigung ausgesehen hat, liest man hier nicht. Auch von den oberen Maßen hört man danach zunächst nichts mehr... Bis zum 10.11.1820 hatten die vier Mann auf Gnade Gottes Stolln das Stollnort derweil schon 80½ Lachter „zur Lösung der vorliegenden, mit Eisenstein Anbrüchen verlassenen Fundgrube gleichen Namens“ vorgetrieben (40014, Nr. 262, Film 0098). Es wurde offenbar auch immer aufwendiger, sich durch das Gestein zu graben, denn der Lachter Vortrieb war nun zu 3 Thl., 12 Gr. verdingt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang des nächsten Jahres war der
Vortrieb des Stollns fast vollendet. Von seiner Befahrung am 12. Januar
1821 berichtete Herr Schmiedel (40014, Nr. 264,
Film 0005), daß die 4 Mann
Belegschaft der Grube den Stolln nun auf 99 Lachter Länge fortgestellt
haben und daß „das tiefe
Stollnort in Quergestein Stundte 10,6 gegen Mitternacht zu Lösung der noch
9 Lachter vorliegenden Fundgrube gleichen Namens, in welcher die
Eisensteinanbrüche der Grundwaßer wegen in Ermangelung eines Stollens
nicht weiter als bis in 7 Lachter Teufe unter Tage abzubauen gewesen,
betrieben (wird).“ Wohl des naturgemäß angewachsenen
Förderweges halber war der Lachter Vortrieb inklusive Zimmerung und
Bergeförderung jetzt zu 3 Thl., 18 Gr. verdingt.
Des naherückenden Durchschlags halber war der Geschworene schon am 15. Februar 1821 erneut vor Ort und hielt in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 264, Film 0019) fest, daß das Stollnort 6 Lachter weiter auf nun 105 Lachter Gesamtlänge ab Mundloch erlängt war und: „wobey zu bemerken, daß vor dem Ortstoße ein aus Hornstein, dichtem Brauneisenstein und etwas Eisenpecherz bestehendes Lager, dessen Streichen, Fallen und Mächtigkeit zur Zeit noch nicht bestimmt angegeben werden kann, überfahren worden ist.“ Noch einen Monat später war das Ziel endlich erreicht: Über seine Befahrung am 20. März 1821 berichtete Herr Schmiedel (40014, Nr. 264, Film 0019): „Der am 7. Dec. 1819 in Angriff genommene (...) nach der vorliegenden Fundgrube getriebene Stolln (ist) bis an den Tageschacht 109 Lachter aufgefahren. Vor drei Wochen ist der Tageschacht wieder belegt und 3⅛ Lachter verteuft worden auf nun 9½ Lachter, daselbst aber gestrigen Tages der Durchschlag in die Förste besagten Stollns gemacht worden...“ Der Tageschacht hatte damit nun eine Saigerteufe von 10 Lachtern, 4 (Einheit unleserlich, üblicherweise Ellen ?) und 7 Zoll (zirka 22,3 m) bis zu seiner Sohle erreicht und der Zugewinn an Teufe betrug 4⅝ Lachter. Den glücklichen Durchschlag vermeldete Geschworener Schmiedel in seinem Fahrbogenvortrag am 31. März 1821 auch im Bergamt Annaberg (40169, Nr. 128, Blatt 25). Damit konnte nun auch wieder der Abbau aufgenommen werden: Der Geschworene notierte in seinem Fahrbogen vom 12. April dieses Jahres darüber (40014, Nr. 264, Film 0037f): Gnade Gottes zu Langenberg betr. „Mit den auf dieser Grube in Arbeit stehenden 4 Mann (...) sind nachstehende Baue belegt: In der Stollnsohle oder aber bey 10½ Lachter Teufe des Tageschachtes wird auf dem daselbst aufsetzenden Eisensteinlager 1.) mit 2 Mann ein Ort Stundte 11,1 gegen Mitternacht zu 2/3, ingleichen 2.) mit 2 Mann ein zweytes Ort Stundte 4,3 gegen Abend ebenfalls zu 2/3 betrieben. Ersteres ist von dem Mundloche 110 Lachter, letzteres aber von dem Tageschacht ¼ Lachter und vor beyden ist das ungefähr 15 Grad gegen Mitternacht fallende Lager 1¼ Lachter mächtig und besteht aus Gneus, drusigem Quarz, braunem Hornstein, dichten und ockerigen Brauneisenstein.“ Im folgenden Quartal hat Herr Schmiedel die Grube am 8. Juni 1821 befahren und berichtete, es sei zum einen nun ein Ort in 10 Lachter Teufe mit ¾ Lachter Weitung im Streichen des Lagers gegen Ost gangbar und 4½ Lachter ausgelängt. Das Eisensteinlager war hier 1¼ Lachter mächtig. Desweiteren stand ein Ort in 11 Lachter Teufe auf der Sohle des Tageschachtes in die Gegenrichtung gegen West in Umgang, das 3 Lachter erlängt gewesen ist. Allerdings war das Lager dort nur ½ Lachter mächtig (40014, Nr. 264, Film 0059f). Am 9. Juli des Jahres wurden auf der Gnade Gottes Fundgrube dann die ersten 8 Fuder ausgebrachten Eisenstein vermessen (40014, Nr. 264, Film 0068). Crucis 1821 fand eine Befahrung durch den Geschworenen am 8. August statt, worüber im Fahrbogen zu lesen steht, man habe nun auf der Stollnsohle in 10¾ Lachter Teufe auch ein neues Ort 6 Lachter vom Tageschacht nördlich entfernt auf dem Lager gegen Abend aufgehauen und 1¼ Lachter erlängt (40014, Nr. 264, Film 0078). Das zweite Ort südlich des Tageschachtes war inzwischen 5¾ Lachter fortgestellt. Bis zum 21. August 1821 waren dabei bereits 40 Fuder ausgebracht und zu vermessen (40014, Nr. 264, Film 0083). Im Herbst dieses Jahres schied der bisherige Steiger aus der Betriebsleitung aus. Anläßlich des Verwiegetages am 7. November 1821 notierte Herr Schmiedel (40014, Nr. 264, Film 0106): „Sodann habe ich den auf Gnade Gottes Fundgrube neuerlich angestellten Steiger, Christian Ehregott Krauß, gehörig eingewiesen und demselben das zu besagter Grube gehörige Inventarium übergeben.“ Kurz darauf stand im Quartal Luciae auch noch eine bergamtliche Befahrung an. Die fand am 12. November statt. Im Fahrbogen ist festgehalten, es seien nun 5 Mann auf Gnade Gottes Fundgrube angelegt. Das Hauptstollnort wird in Quergestein fortgestellt, „um das nach dieser Weltgegend beynahe noch ganz unverritzte oder doch nur bis in sehr geringe Teufe vom Tage nieder untersuchte Gebirge aufzuschließen und neue Eisensteinlager auszurichten“ und hatte inzwischen eine Gesamtlänge von 114½ Lachter bzw. von 5½ Lachter vom Tageschacht aus erreicht. Bei 113 Lachter Stollnlänge habe man erneut ein Eisensteinlager überfahren und dort ein Ort gegen Morgen angehauen, das auch bereits 1 Lachter erlängt gewesen ist. Außerdem war aus dem mittägigen Stoße des Tageschachtes ein Ort in Quergestein Stunde 5,6 gegen Abend in gleicher Absicht angeschlagen und 5¾ Lachter fortgetrieben. Auch hier hatte man ¾ Lachter vom Streckenort zurück ein ¼ Lachter mächtiges Lager überfahren (40014, Nr. 264, Film 0108). Am 20, November 1821 waren dabei 108 Fuder Eisenstein ausgebracht und zu vermessen (40014, Nr. 264, Film 0110). Das kostenaufwendige, annähernd zwei Jahre währende Unternehmen des Stollnbaus hat offenkundig Erfolg gebracht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch am 5. Februar 1822 waren 5
Mann auf Gnade Gottes Fundgrube und Stolln (so wird die Grube nun
bezeichnet) angelegt
(40014, Nr. 265, Film 0014f).
Das Stollnort war 118 Lachter vom Mundloch oder 9 Lachter vom Tageschacht
ausgelängt, „wobey zu bemerken, daß auf der
Sohle desselben kleine Nieren von Brauneisenstein sich wahrnehmen lassen.“
Außerdem notierte Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen noch:
„Vom Stollnort 5 Lachter zurück wird auf einem übersetzenden,
Stunde 5,6 streichenden, etliche 40 Grad gegen Mitternacht fallenden
Eisensteinlager ein Ort gegen Abend betrieben, welches zur Zeit 2 Lachter
von dem Kreutze erlängt ist, ingleichen ist ein Ort auf demselben Lager
gegen Morgen belegt und solches dermalen 4¼ Lachter ins Feld gebaut.“
Das Ort gegen West war bis zur nächsten Befahrung durch den Geschworenen am 20. März 1822 bei 1 Lachter Weitung 4⅛ Lachter und das Ort in die Gegenrichtung 5 Lachter erlängt (40014, Nr. 265, Film 0029f). Nach Osten war das verfolgte Lager nach den Beobachtungen des Geschworenen zwar „ebenso mächtig, jedoch etwas weniger ergiebig an Eisenstein.“ Auf dem westlichen Flügel hat Herr Schmiedel neben den üblichen Mineralien auch wieder „Eisenpecherz“ gefunden. Das Hauptstollnort wurde dagegen erstmal liegen gelassen ‒ der Erzabbau (und damit die Einnahmen) gingen nach dem rund zwei Jahre währenden Stollnvortrieb erst einmal vor. Aber bei seiner nächsten Befahrung am 16. Juli 1822 fand der Geschworene auch das Stollnort wieder mit einem Mann belegt und inzwischen 133 Lachter vom Mundloch fortgestellt (40014, Nr. 265, Film 0052f). Der Lachter Stollnvortrieb war jetzt zu 3 Thalern verdingt. Das Streckenort gegen Abend war noch in Betrieb, allerdings notierte Herr Schmiedel, es sei nun bei 1 Lachter Weitung 2¾ Lachter erlängt, was gegenüber seiner Messung bei der letzten Befahrung nicht stimmen kann. Außerdem hatte man „5 Lachter weiter oder 12 Lachter vom Tageschacht“ ein zweites Lager durchfahren und auf diesem ebenfalls ein Flügelort gegen Abend angesetzt, das 1½ Lachter vom Streckenkreuz erlängt gewesen ist. Am 8. Oktober 1822 war der Geschworene wieder vor Ort und fand das Flügelort auf dem bei 116 Lachter des Hauptstollns oder 7 Lachter vom Tageschacht angefahrenen Lager Stunde 5,6 gegen Abend mit 1 Lachter Weitung nunmehr 5½ Lachter erlängt vor (40014, Nr. 265, Film 0069). Hinter diesem Ort wurde außerdem ein ¾ Lachter hoher Firstenstoß ausgehauen. Danach trat Herr Schmiedel in den Ruhestand. In seiner Funktion als Berggeschworener löste ihn am 7. Dezember 1822 Herr Johann August Karl Gebler ab (40014, Nr. 265, Film 0081f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue Geschworene befuhr die Grube
am 15. Januar 1823 das erste Mal. Sein Vorgänger hatte eine wesentlich
bessere Handschrift und deshalb entschuldigen wir uns, daß in unseren
Abschriften der Fahrbögen des
Herrn Gebler mehr Lücken sind... Offenbar gab es auch neue
Gliederungsvorschriften oder vielleicht hat sich Herr Gebler auch
erst einmal alles selbst etwas genauer angeschaut, als sein langjähriger
Vorgänger. Hier sein erster Fahrbericht (40014, Nr. 267, Film 0007f):
Eisensteingewinnung. „Von dem in der Stunde 11,0 angelegten Tageschacht 7 Lachter gegen Mitternacht und noch 8 Lachter gegen Abend befindet sich ein einige Lachter langer Förstenbau, welcher mit 2 Mann belegt ist, auf welchem Brauneisenstein über ¼ Lachter mächtig und von vorzüglicher Reinheit und Güte ansteht. Ein zweyter Förstenbau befindet sich 12 Lachter vom Schacht gegen Mitternacht, gleichfalls mit 1 und 2 Mann belegt. Der hier anstehende Eisenstein zeigt sich in einem zum Theil sehr mächtigen Hornsteinlager, bricht mehr nestig und zeigt weniger (?) und Reinheit als der auf dem vorigen Baue. Als Versuchsbau hat man mehrere Örter nach verschiedenen Richtungen angelegt und mit solchen theils guten Eisenstein, theils (?) Lager angetroffen, welche aber (?) gegenwärtig keines belegt war (...?) jedoch wird die wechselseitige Belegung derselben nach und nach von neuem statt haben und insonderheit wird man das vor mehrern Jahren zur Beseitigung der Hindernisse durch Grundwaßer von der Schlucht aus dem Dorfe Langenberg gegen Mitternacht bis an den Schacht heran und noch 24 (?) Lachter über denselben hinaus getriebene Stollnort, das in allem (?) 133 Lachter in das Feld gebracht worden, von neuem eine Zeitlang belegen, um es bey der Gebrächheit des Gesteins schnell mehrere Lachter vorwärts zu bringen. Häufige Zimmerung zu Sicherstellung der Grube (?) doppelte Thürstöcke, um Strecken nach allen Richtungen, vorzüglich in Winkelkreutze (...?) durch Bergversatz zu verwahren und auszufüllen, ist die bey Eisensteingruben dieser Art überall vorkommende, aber sehr oft, auch hier, durch reiche Anbrüche auch richtig belohnte (...?) dieses kleine, aber für die Eisensteingewinnung wichtige Grubengebäude das (...?). Die Hauptabsichten bey demselben gehen dahin, durch erwähnte mehrere, von neuem zu unternehmende Versuche das Wohl der Grube auf geraume Zeit hinaus, soweit solches (...?), sicher zu stellen.“ Damit diese Versuche angestellt werden konnten, wurden zugunsten Gnade Gottes Fdgr. am 4. April 1823 noch sechs weitere gevierte Maßen verliehen (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 292). Die nächste Befahrung dieser Grube durch Herrn Gebler erfolgte am 29. April 1823 (40014, Nr. 267, Film 0038). Darüber berichtete er: „Desselben Tages gefahren auf Gnade Gottes Fdgr. in Langenberg, belegt mit
Eisensteinbaue. Von diesen befindet sich der erste 7 Lachter vom Tageschacht gegen Mitternacht und von da 8 Lachter gegen Abend, der zweyte 12 Lachter vom Tageschacht gegen Mitternacht. Auf beyden baut man das daselbst angetroffene, ⅛ bis ¼ Lachter mächtige Eisensteinlager von Brauneisenstein förstenweise ab und jeder desselbe ist abwechselnd mit 1 bis 2 Mann belegt. Die Anbrüche sind stellenweise von vorzüglicher Güte. Versuchsbaue. Durch Forttrieb des bey 7 Lachter Entfernung vom Tageschacht gegen Mitternacht gegen Mitternacht (?) bey 4 Lachter mittaglicher Enrfernung vonn demselben angelegten und beyderseits 10 bis 12 Lachter hinausgetriebenen Örter sucht man sich über das fernere Verhalten des in Abbau begriffenen sowohl, als des etwa nächst anliegenden Lagers das nöthige Licht zu verschaffen.“ Mit diesem Betrieb hatte man bis zum 26. Mai 1823 wieder 60 Fuder Eisenstein gewonnen (40014, Nr. 267, Film 0043), bis zum 27. August 40 Fuder (40014, Nr. 267, Film 0058) und bis zum 6. November weitere 40 Fuder ausgebracht (40014, Nr. 267, Film 0074). Am 5. April 1823 wurde dem Eigentümer auch weiteres Grubenfeld bestätigt. Im einzelnen erhielt Herr Nietzsche:
auf Eisenstein und alle verleihbaren Metalle bestätigt (40169, Nr. 128, Blatt 26). Am 19. Dezember 1823 schaute sich Herr Gebler wieder vor Ort um und berichtete in seinem Fahrbogen darüber (40014, Nr. 267, Film 0083): „Freytags, den 19ten December gefahren auf Gnade Gottes in Langenberg, belegt mit
Eisensteingewinnung. In den bey 7 und 10 Lachter Entfernung vom Tageschacht gegen Mitternacht und daselbst in einigen Lachtern gegen Morgen und gegen Abend angelegten beyden Förstenbaue gewinnt man Eisenstein und ist man in diesem Jahr so glücklich gewesen, in jedem Quartal 40 Fuder zu erlangen. Diese bisherigen Baue sind mir 2 bis 3 Mann belegt. Versuchsbau. Vom Tageschacht 5 Lachter gegen Mittag hat man angefangen, ein Ort gegen Abend zur Aufsuchung eines neuen Eisensteinnierens anzuhauen und hat zur Zeit ein schmales Trümchen angetroffen und sieht man dem glücklichen Ergebnisse, das Anfahren eines anderweitigen bauwürdigen Mittels entgegen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erste Befahrung der Grube durch den
Geschworenen Gebler im Jahr 1824 erfolgte am 11. März (40014,
Nr. 271, Film 0016). Darüber
berichtete er, die beiden Abbaue bei 7 Lachter vom Schacht auf dem Stolln
gegen Abend und bei 10 Ltr. gegen Mitternacht waren gangbar und „die
Anbrüche von der bekannten Beschaffenheit.“
Außerdem habe man einen Querschlag bei 6 Ltr. vom Schacht gegen Mittag angeschlagen und inzwischen 3½ Ltr. damit fortgerückt und „ob man gleich mit demselben wie (...?) oft geschieht, in einen Theil angebautes Feld gerathen war, so hatte man doch auch wiederum eine, wie es schien nicht ganz unbedeutende Niere Eisenstein angetroffen und stehet nun weiterer Erfolg zu erwarten.“ Der Abbau erbrachte bis zum 12. Februar 40 Fuder (40014, Nr. 271, Film 0009) und bis zum 21. Mai 1824 wieder 20 Fuder Eisenstein (40014, Nr. 271, Film 0033). Von seiner nächsten Grubenbefahrung am 13. Juli 1824 berichtete Herr Gebler (40014, Nr. 271, Film 0045f), man betreibe zum einen auf dem Stollnflügel gegen West 7 Ltr. nördlich vom Schacht und 2 Ltr. vom Kreuz mit dem Stolln einen Firstenbau, der schon 1½ Ltr. hochgebrochen war. Ein zweiter Firstenbau wurde 10 Ltr. nördlich vom Schacht und auf dem Flügel 1 Ltr. östlich vom Stolln betrieben. Hier war das Lager von gleicher Beschaffenheit, wie in dem ersten, „doch bricht der Eisenstein hier mehr in kleinen und etwas zerstreut liegenden Nieren.“ Außerdem hat es auf dem Stolln 17 Ltr. vom Schacht gegen Süden einen ungefähr 3 Ltr. langen Verbruch gegeben, der wieder gewältigt wurde. Ferner notierte der Geschworene noch über Versuchsbaue. „Bei 3½ Ltr. vom Tage nieder ist man des Vorhabens, ein Ort aus dem mitternächtlichen Stoße des Tageschachtes gegen Morgen zu Entdeckung eines daselbst noch vermutheten Eisensteinnierens zu treiben, so wie man zu fernerer Entdeckung und Aufsuchung von Eisenstein in der Stollnteufe das Stollnort im Laufe des vorigen Quartals 6 Ltr. weiter gegen Mitternacht fortgetrieben hat.“ Eine weitere Befahrung erfolgte schon am 3. September 1824 (40014, Nr. 271, Film 0056). Die beiden Firstenbaue standen in Betrieb und namentlich der erste war bei gleicher Höhe, wie am 13. Juli schon, nun 2 Lachter fortgestellt. Hinzu war nun aber noch ein dritter Firstenbau gekommen, der auf einem Stollnflügel 14 Ltr. südlich vom Schacht und 11 Ltr. gegen West angesetzt war. Die Befahrung auf das Quartal Luciae erfolgte am 6. November 1824 (40014, Nr. 271, Film 0056). Die Betreiber hatten die Belegung noch einmal aufgestockt und sie setzte sich nun zusammen aus
Der Firstenbau bei 7 Lachtern nördlich vom Schacht gegen Abend war mit 3 Mann belegt und inzwischen 3 Lachter lang geworden. Dabei bringe man „gewöhnlich quartaliter 40 Fuder Eisenstein“ aus. Wenn wir nichts übersehen haben, ist die Grube aber an den Verwiegetagen in diesem Jahr seit dem 21. Mai noch nicht wieder aufgeführt. Erst am 8. Dezember 1824 wurden hier ‒ zumindest den Eintragungen in den Fahrbögen zufolge ‒ tatsächlich wieder 40 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 271, Film 0074). Betreffs der Versuchsbaue war am 6. November 1824 auf der Stollnsohle vom südlichen Schachtstoß aus ein Ort einige Lachter fortgestellt, womit man aber bislang keine neuen Anbrüche ausgerichtet hatte. Außerdem hatte man in 9 Ltr. Teufe aus dem nördlichen Schachtstoß heraus ein Ort aufgehauen, war damit aber erst 2 Ltr. fortgerückt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während des nächsten Jahres 1825 war Herr Gebler zwar regelmäßig zum Vermessen des ausgebrachten Eisensteins vor Ort (und es waren in jedem Quartal genau 40 Fuder zusammengekommen), die erste Grubenbefahrung in diesem Jahr erfolgte aber erst am 19. September. Im Fahrbogen heißt es dazu (40014, Nr. 273, Film 0062): Stollnquerschlagsort. „Unmittelbar in der Nähe des Schachtes hat man von dem stehendgangweise getriebenen Stolln aus einen Querschlag zu Entdeckung von neuen Eisensteinmitteln gegen Morgen zu angelegt und mit 1 Mann 3½ Ltr. weit fortgebracht. Hier habe ich 1 Ltr. Länge bey 1 Lachter Höhe zu 1 Thl. 8 Gr. inkl. des Nachbringens der Zimmerung verdingt.“ Eisensteinbaue. „1) Bey 9 Ltr. Teufe unter Tage oder 3 Ltr. über der Stollnsohle hat man mittelst Aufhauen des kurzen Schachtstoßes gegen Abend ein Ort angelegt und mit demselben in geringer Entfernung einen nicht unbedeutenden Nieren dichten Brauneisenstein angetroffen, welchen man nunmehro förstenweise abbaut. Dieser Bau war mit 2 und 3 Mann belegt. 2.) Der schon ehemals über dem Stolln 7 Ltr. vom Schacht aus gegen Mitternacht vorhandene, mehrere Jahre im Umtriebe gewesene, gegen Morgen und gegen Abend erlängte Förstenbau ist mit 2 Mann belegt und im Großen noch von der ehemaligen Beschaffenheit.“ Versuchsbaue. „Zu Entdeckung neuer Eisensteinmittel sind von dem Steiger (?) von Zeit zu Zeit mehrere Versuche an verschiedenen Punkten gemacht worden.“ Zum Zeitpunkt seiner nächsten Befahrung am 14. November 1825 war der Versuchsbau aber wieder eingestellt, da man zunächst auf 40 Fuder Ausbringen kommen wollte und dazu den Bau 7 Lachter nördlich vom Tageschacht wieder mit 4 Mann belegt hatte (40014, Nr. 273, Film 0075). Mehr gab es von diesem Jahr nicht zu berichten... Bis zum 13. Februar des Folgejahres hatte man aber wieder 25 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 275, Film 0014). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Eintragung in den Fahrbögen des Geschworenen Gebler vom 28. Februar 1826 klingt dann weniger optimistisch (40014, Nr. 275, Film 0020f). Es heißt über den: Eisensteinbau. „So wie zeithero gewinnt man 3 Ltr über Stollnsohle oder bey 9 Ltr unter Tage auf dem daselbst vom Schachte gegen Mitternacht Morgen und bey 10 Ltr Entfernung von demselben angelegten Förstenbau Eisenstein. Es wurde nunmehro, nachdem das zeitherige Lager über den jetzigen Stolln größtentheils abgebaut worden und annoch, wenigstens dem jetzigen Ansehen nach, ein geringer Theil desselben übrig ist, sehr nothwendig und nützlich, von dem hart an der Grenze der Schneeberger und Scheibenberger Reviere und zwar auf der ersteren liegenden Grube, dem Sieben Brüder Stolln, einen Flügel herüberzutreiben, um das unter die Sohle des jetzigen Stollns mit Anbrüchen niedersetzende Lager von Brauneisenstein wiederum unterfahren und hierdurch auf mehrere Jahre hinaus einen nachhaltenden Eisensteinbau erlangen zu können, ein Umstand, auf den ich den Herrn Besitzer der Grube bereits aufmerksam gemacht habe und dessen Wichtigkeit auch von demselben erkannt worden ist.“ Neben dem Text findet sich die mit Bleistift ergänzte Anmerkung: „Wegen (Veranlassung ?) dieses sehr zweckmäßigen Vorschlages soll mit dem Herrn Bergkommissionsrath Nitzsche weitere Rücksprache genommen und sodann das hierzu Erforderliche besorgt werden.“ Ja, wenn das Vorkommen abgebaut ist, ist die ,Wichtigkeit' der Erschließung neuer Anbrüche natürlich unbestritten. Das dürfte auch dem Besitzer der Grube, Herrn Nietzsche, klar gewesen sein. Tatsächlich ist die Gnade Gottes Fdgr. an den folgenden Verwiegetagen mit einem zu vermessendem Eisenstein- Ausbringen auch nicht mehr genannt ‒ die Situation war also ernst und das Fortbestehen dieses Bergwerks in Frage gestellt. Deswegen trug Herr Gebler am 1. April 1826 darüber auch im Bergamt Annaberg aus seinem Fahrbogen vor (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 26). Über die räumlichen Zusammenhänge der genannten
Gruben haben wir uns während der Recherchen lange den Kopf zerbrochen.
Schauen wir in den vorhandenen Rissen nach: Auf dem erst 1841 erstellten Grubenriß von Gnade
Gottes Fundgrube finden wir leider nur einen
Die Grenze zwischen Scheibenberg'er und Schneeberg'er Revier verlief zu diesem Zeitpunkt bereits zwischen dem Mundloch des ersteren und der Grube Gnade Gottes hindurch. Bis 1783 bildete dagegen noch der Mönchsteig die Reviergrenze, welcher über den Graul hinweg verlief, so daß in das Scheibenberg'er Bergrevier auch noch weitere Gruben am Hahn, am Graul sowie in der Heyde bis nach Waschleithe gehörten ‒ dann aber hat man die Reviergrenze hier zugunsten des Schneeberg'er Reviers weiter nach Nordosten bis an die damalige Straßenbrücke über den Schwarzbach verschoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dessen ungeachtet war es grundsätzlich
natürlich eine gute Idee, von einem tiefer angesetzten Stolln aus einen
Flügel heranzubringen und dadurch der Lagerstätte weiter in die Tiefe
folgen zu können.
Dem oben gezeigten
Riß zufolge hat man dieses Unternehmen später unter dem neuen Besitzer
Gustav Zschierlich ab 1874 auch in Angriff genommen.
Zunächst beschritt man aber einen anderen Weg, worüber Herr Gebler nach seiner Befahrung der Grube am 31. August 1826 berichtete (40014, Nr. 275, Film 0068f): Versuchbau. „Da nunmehr das über dem Stolln seit vielen Jahren in Betrieb gestandene Eisensteinmittel nicht nur völlig abgebaut worden, sondern man auch während jenes Abbaus eine Menge Versuche nach verschiedenen Richtungen und nicht allein in der Teufe des Stollns, sondern auch über dessen Sohle gemacht hat, alle aber zu keinem bedeutenden Eisensteinmittel, sondern nur zu dem Auffinden kleiner und unbedeutender Reste von zuweilen nicht einmal vorzüglicher Güte geführt haben, so blieb, sollte die Grube nicht gänzlich zum Erliegen kommen, nichts weiter übrig, als die Untersuchung des zeither bebauten, wichtig gewesenen Lagers unter die Stollnsohle. Nur bleibt aber dieselbe des allzu großen Wasserandrangs wegen mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, so lange man sich entweder durch einen tieferen Stolln wiederum einige Lachter Wasserlösung verschafft, noch auch dieselbe durch Anlage einer kleinen Kunst unnachtheilig machen will. Das erste, der Herantrieb eines anderweiten Stollns ist nicht ohne unbedeutende Kosten, am leichtesten noch, wie schon einmal von mir angezeigt worden, durch Anlage eines Flügelortes von der in das Schneeberger Revier gehörigen Sieben Brüder Zeche aus bewirkbar und der auf mehr als 100 Lachter Länge heranzutreibende Stolln würde demohngeachtet – und hierzu wäre auch noch ein besonderer Schacht gar nicht zu entbehren – einer kleinen Untersuchung zu Folge mehr nicht, als 3 Ltr. mehr Teufe einbringen. Aufwand und Erfolg scheint daher doch wohl bey aller Gebrächheit des Gesteins und Wohlfeilheit des Betriebes in einem nicht genug günstigen Verhältnisse zu stehen, deshalb auch dieses von mir vor einiger Zeit empfohlene Unternehmen aufzugeben sey. Aber sehr empfehlenswert erscheint dagegen das zweyte Hilfsmittel, die Anlage einer kleinen Kunst mit einem etwa 10 bis 12 Ellen hohen Rade, die mit Einschluß des nöthigen Eisenwerks muthmaßlich nicht über 300 Thl. Kosten verursachen und da der Aufwand für das Eisenwerk für die Herren Besitzer der Grube als Eigenthümer eines Hammerwerkes in (?) Betracht käme, vielleicht nicht 150 Thl. erfordern dürfte. Um nun aber doch vorläufig zu erfahren, welches das Verhalten des Eisensteinlagers unter die Stollnsohle seyn werde, sind mit einem ungemeinen Aufwand von Mühe und Anstrengung zwey Versuche von dem Steiger und seinen drey Arbeitern unternommen worden und das folgende festgestellt. Auf der Stelle des zeitherigen Eisensteinmittels, das ist auf dem Stolln 7 Lachter vom Tageschachte gegen Mitternacht, hat man einen Versuch mit Abteufen gemacht, daselbst ganz vorzüglich schönen Eisenstein angetroffen, einige Fuder davon gewonnen und an den Tag geschafft, alsdann der zu häufigen Wasserzugänge und vieler Erschwernisse bey der Gewinnung wegen wieder davon abzulassen sich genöthigt gesehen. An dessen Statt hat nun der sehr thätige und unermüdte Steiger sogleich unter dem Tageschacht angefangen, abzuteufen, um (?) ein leichteres und schnelleres Niederkommen gestatteten, drey bis vier Lachter tief mittelst einer Pumpe niederzugehen, hierauf ein Ort nach dem 7 Lachter entfernten Eisensteinpunkte anzulegen, es bey dieser Teufe anzufahren, genau zu untersuchen und sich von hier aus das nöthige Licht darüber zu verschaffen, ob die Anlage einer kleinen Kunst rathsam werden könne oder nicht. Hierbey wäre es nur sehr zu rathen, es nicht der unter den dermaligen, den Hammerwerken freylich nicht sehr günstigen Conjunktur den Kostenaufwand für das alles (?) Besitzer, Herr Bergcommissionsrath Nitzsche, sich wenigstens anjetzt, rücksichtlich der schweren Wasserhaltung, darzu entschließen, auch zwey Bergarbeiter anzulegen, welcher 4 Mann nicht gewachsen sind, da außerdem ein so schwieriger Versuch nur mühsam und nicht ohne unnöthige Kosten und unter zu großer Beschwerung der Arbeiter von Statten gehen kann.“ Erstmal nachschauen, ob sich der ganze Aufwand denn auch lohnen werde. Das tat auch der Geschworene und notierte in seinem Fahrbogen auf Luciae 1826 darüber (40014, Nr. 275, Film 0079): „9. October gefahren auf Gnade Gottes Fdgr. bey Langenberg belegt mit
Über eine Eisensteingewinnung gab es nichts zu berichten; also kommt Herr Gebler gleich zu sprechen auf die: Hülfsbaue. „Um das unter dem Tageschacht zu Folge meines letzten Fahrbogens angefangene Abteufen mit mehr (Beständigkeit?) fortsetzen zu können, hat man die anfahrende Mannschaft wiederum mit 2 Mann vermehrt, mit deren Hülfe man nun, was dem zuvor nur 4 Mann starcken Personale der vielen beydringenden Wasser und des flüchtigen Gesteins wegen ganz unmöglich fiel, wieder etwas weiter niederzukommen ist und die Teufe von 2½ Ltr erreicht hat. Es stehet daher zu erwarten, daß das angefangene Unternehmen einen glücklichen Fortgang haben werde.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 3. November war Herr Gebler
erneut vor Ort und berichtete danach über den Fortgang der
Untersuchungsarbeiten (40014,
Nr. 275, Film 0086):
„Man ist nunmehro mit dem angefangenen Abteufen ziemlich 4 Ltr. tief niedergekommen, wird nächstens aus demselben, der vorhabenden Absicht gemäß, ein Ort gegen Mitternacht Abend aufhauen, mit demselben die erforderlichen 6 bis 8 Ltr bis an das vorliegende Eisensteinlager auffahren und während dieser Zeit die Wasser mitelst einer Pumpe halten. Daß sich die letzteren bey Erreichung des Lagers vermehren werden, ist höchst wahrscheinlich und dann dürfte es um so nothwendiger werden, ein kleines Kunstrad, zu Vermeidung eines zu großen Aufwandes für Wasserhaltungskosten, zu hängen und in Gang zu bringen.“ Über seine letzte Befahrung am 12. Dezember im Jahr 1826 heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 275, Film 0096), das Abteufen sei nun bis auf 5 Lachter Teufe unter die Stollnsohle niedergebracht und man habe bei 4 Lachter Teufe (um einen Pumpensumpf zu behalten) das Ort in Richtung des bisher oberhalb der Stollnsohle so ergiebigen Lagers angehauen; dieses auch schon 4 Lachter weit fortgestellt. Dort aber hatte man „eben eine bedeutende Menge Wasser durch Aufhauen oder Anfahren eines Sandtrums oder einer Sandschicht bekommen, welche den Forttrieb sehr erschwerte. Die zeitherigen noch nicht allzu stark gewesenen Wasser sind mit einer Schwengelpumpe gehalten worden.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Des für den Fortbestand der Grube so
wichtigen Vorhabens wegen war Herr Gebler im Jahr 1827 relativ
häufig vor Ort ‒ das nächste mal
bereits am 11. Januar, worüber er in seinem Fahrbogen berichtete, aufgrund
der erschroteten Wasser und der „Sandschicht“ habe man sich „von
dem Ort der Versuchstrecke in 4 Ltr Teufe zurückgezogen und sich etwas
gegen Morgen gewendet, in Hoffnung... auf eine weniger schwierige Stelle
zu gelangen und stehet nun der Erfolg abzuwarten.“
(40014, Nr. 278, Film 0004) Schon am 6. Februar 1827 schaute sich der Geschworene erneut nach dem Fortgang der Dinge um und befand, auch auf dem 3 Lachter vom Ortstoß zurück gegen Morgen angesetzten neuen Ort „haben sich die Wasser wieder stark eingefunden“ und der Steiger wolle deshalb nun doch das erste Ort wieder in Angriff nehmen, auch wenn es „mühsam“ wird, durch das „rollige, mit Sand vermengte“ Gestein hindurchzufahren. Man könne dies nur „gewältigungsweise mittelst (?) Abtreiben auf gedoppelten Thürstöcken unternehmen.“ (40014, Nr. 278, Film 0012) Wir würden die hier beschriebene Technik heute als ,Vorpfändung' bezeichnen... Bis zur Befahrung vom 21. März 1827 hatte man noch immer keinen Erfolg zu verzeichnen (40014, Nr. 278, Film 0023): „Wegen sich vor den zum Anfahren des anher (?) Eisensteinlagers aus dem Abteufen unter dem Tageschachte gegen Mitternacht und gegen Mitternachtmorgen angelegten beyden Orten nur endlich mehrenden Schwierigkeiten stand man heut in Begriff, ein neues, noch mehr gegen Morgen gerichtetes Ort aufzuhauen und mit diesem den Betrieb zu versuchen. Es ist sehr zu beklagen, daß dieser unaufschiebliche Hülfsbau eben in eine so nasse, allen hiesigen Eisensteinzechen so nachtheilige und gefährliche Jahreszeit fällt, in welcher sich Wasserzugänge über alle Maßen vermehren, da schon an (?) und zu andern trocknern Zeiten dieser Punkt unter die wasserreichsten und für den Betrieb mit Örtern am meisten schwerhaltigsten gehört. Durch Anlegen mehrer Mannschaften, die sich öfterer abwechseln können, hat man sich möglichst zu helfen gesucht. Aber große Schwierigkeiten wird man noch zu überwinden bekommen, ehe man den gewünschten Zweck erreicht.“ Überhaupt muß das Frühjahr 1827 ein besonders nasses gewesen sein, denn am 20. April hielt Herr Gebler in seinen Fahrbögen fest (40014, Nr. 278, Film 0034f): „Bey dieser Gelegenheit meldete der Steiger von Gnade Gottes Fdgr. zu Langenberg, daß, ob man wohl zeither diese Grube großer Nässe halber einige Wochen habe stehen lassen müssen, man sich doch nunmehro gedrungen finde, wegen mehrer schadhafter Stellen, so der dazu gehörige Stolln bekommen, die Grube wiederum und zu allererst den Stolln zu dessen Wiederherstellung in Angriff zu nehmen, was er hiermit melden wolle.“ Nun kamen auch noch Reparaturen dazwischen... So war auch am 18. Juni des Jahres noch nichts erreicht (40014, Nr. 278, Film 0050): „Der Herantrieb des (...) Hülfsortes rückt überaus langsam der großen Hindernisse und Beschwerden wegen, welche sich dem Abtreiben entgegenstellen, fort. Inzwischen siehet man sich genöthigt, mit dieser Arbeit ununterbrochen fortzufahren. Die Grundwasser werden durch die Pumpenknechte zu 6 Stunden im (Sumpf ?) gehalten.“ Was für eine Schinderei an der Handpumpe... Wie man im Fahrbericht vom 11. Juli lesen kann, hatte man dazu zusätzliche Kräfte aus den benachbarten Gruben angelegt (40014, Nr. 278, Film 0055f): „Da mittelst der zeither hier (?) verliehnen, zum Theil aus dem benachbarten Schwarzenberger Revier entlehnten auch zum Theil verwechselten Mannschaften keineswegs möglich werden wollen, mittelst Ortsbetriebs und Abtreiben auf gedoppelten Thürstöcken bis an das bekannte Eisensteinlager von dem unter dem Schachte befindlichen Abteufen aus zu gelangen, so hat man einen Versuch gemacht, auf der Stelle, wo sich das abzubauende Lager auf dem Stolln – ohngefähr 8 Ltr. vom Tagschachte gegen Mitternacht Abend – befindet, (?) der vorhandenen Schwierigkeiten ohngeachtet, wegen welcher dieser Versuch bereits in dem vorigen Jahre verlassen worden, mit Abteufen (auf dem ?) Lager niederzugehen und dabey Eisenstein zu gewinnen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass man auf diese Weise wohl (?) seinen Zweck erreichen und hier ansehnlichen Eisensteinabbau erlangen werde.“ Man darf nicht vergessen: Über diese ganze Zeit hatte die Grube keinen einzigen Fuder Erz ausgebracht und der Eigner finanzierte trotzdem den besonders aufwendigen und teuren Betrieb weiter. Inzwischen waren hier nun 7 Mann angelegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deshalb also ein neuer Versuch auf dem
alten Lager, wo man offenbar auch mehr Glück hatte, wie der Fahrbogen für
den 17. August 1827 unter der Überschrift aussagt
(40014, Nr. 278, Film 0066):
Versuchs- und Hülfsbau. „Mit dem Abteufen vom Stolln nieder auf dem Eisensteinlager selbst ist man nun ohngefähr 1 Ltr niedergekommen, hat dabey sehr schönen Eisenstein gewonnen und stehet im Begriffe, zur Haltung der Wasser, die man bisher geschöpft hat, eine Pumpe einzubauen. Die in dem ersten 4 Ltr tiefen Abteufen stehende und bis heute noch gangbar gewesene Pumpe herauszureißen und sie in das neue Abteufen zu (hängen?) habe ich der Nützlichkeit wegen für dien Betrieb, in Betreff der mehrern Leichtigkeit für die Wasserhaltung widerrathen, daher empfohlen, eine andere Pumpe für das neue Abteufen vorzurichten.“ Tatsächlich war man damit in die Lage gekommen, bis zum 1. Oktober des Jahres wieder 22 Fuder Eisenstein zum Vermessen bereitzustellen (40014, Nr. 278, Film 0074). Der Fahrbericht vom 18. Oktober 1827 steht deshalb auch wieder unter der Überschrift (40014, Nr. 278, Film 0078f): Abteufen und Eisensteinbau. „Mit Niederbringung des auf dem Stolln vom Hauptschachte 7 Ltr gegen Mitternacht Abend angefangenen Abteufens setzt man ununterbrochen fort. Es ist dasselbe nunmehr 2 Ltr tief und das daselbst vorhandene Eisensteinlager, an dessen Hangenden man niedergeht, liefrt sehr schönen Eisenstein. Die freylich starken Grundwasser werden mittelst einer 6 Zoll weiten Drückelpumpe in 6 stündiger Arbeit zu Sumpf gehalten. Wenn man noch ein paar Lachter niedergekommen seyn wird, wird man anfangen, (?) Abbau anzulegen. Dann dürfte es aber auf jeden Fall das gerathsamste bleiben, einen kleinen Tageschacht anzulegen, weil die Haltung der Wasser mit Menschenhänden allzu viel Aufwand, quartaliter nämlich 50 bis 60 Thl. erfordert, dagegen für eine Kunst auf ebenso lange kaum 10 Thl. nöthig sind.“ Nun gut, aber bauen muß man die Kunst ja auch erst einmal, was auch nicht für 50 Thaler zu machen war... Im Fahrbericht vom 13. November liest man jedenfalls erneut die Empfehlung des Geschworenen, eine Wasserkunst zu errichten (40014, Nr. 278, Film 0083): „Man fährt hier ununterbrochen fort, abzuteufen und nebenbey Eisenstein zu gewinnen, ohngeachtet das flach fallende Lager dem saiger niedergebrochnen Schacht zu entweichen anfängt. So bald man aber nur noch etwa 1 Ltr tiefer niedergekommen seyn wird, soll das Lager nebenbei mit angegriffen und der nächstanliegende Eisenstein abgebaut, das Lager überhaupt durcbrochen übrigens immer tiefer niedergegangen werden, um das Lager wo möglich firstweise abzubauen. Unentbehrlich ist aber für dieses Unternehmen die Erbauung einer kleinen Tageskunst zu Ersparung der schweren Wasserhaltungskosten für Menschenhände.“ Immerhin hatte Herr Gebler hier am 16. November erneut 21 Fuder ausgebrachtes Eisenerz zu vermessen (40014, Nr. 278, Film 0084). Das dürfte die Gewerken sehr erfreut haben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Jahr 1828 blieb man zunächst auf dem Abteufen unter dem Stolln tätig. Die starken Wasserzuläufe erschwerten allerdings die Arbeit und die Drückelpumpe mußte „fast ohne alle Unterbrechung Tag und Nacht in Belegung bleiben.“ Die Belegschaft wurde deshalb auf 8 Mann weiter verstärkt (40014, Nr. 280, Film 0003f). Am 21. Februar 1828 beantragte aber erst einmal der bisherige Schichtmeister Richter seine Entlassung aus der Funktion. Das Schreiben ist auf dem Hammerwerk Obermittweida abgefaßt, wo Herr Richter neue Aufgaben als Bergfaktor gefunden hatte (40169, Nr. 128, Blatt 29). Am 31. März 1828 beantragte Herr Nietzsche daher beim Bergamt, Herrn Christian Carl Gottlieb Schubert als Schichtmeister und Christian Friedrich Jlling als neuen Steiger anzunehmen (40169, Nr. 128, Blatt 30). Der Grubenbesitzer bestätigte zugleich, er werde auch Herrn Schubert „hinsichtlich der Caution vertreten.“ Nach Prüfung der Sachlage folgte das Bergamt dem Antrag und bestätigte beide am 3. Juli 1828 in ihrer neuen Funktion (40169, Nr. 128, Blatt 28). In der Zwischenzeit ist es Anfang Februar 1828 auch zu einem Verbruch auf dem Stolln von ungefähr 4 Lachtern Länge gekommen, der den Wasserablauf so stark behinderte, daß nichts übrigblieb, als das Abteufen einzustellen und ersaufen zu lassen und zunächst den Stolln wieder zu gewältigen (40014, Nr. 280, Film 0014). Wie man es trotz alldem schaffte, bis zum 12. März auch noch 20 Fuder Eisenstein auszubringen (40014, Nr. 280, Film 0019), ist kaum erklärlich. Von seiner Befahrung am 20. März des Jahres berichtete Herr Gebler, man sei volle sechs Wochen lang mit der Wiederherstellung des Stollns beschäftigt gewesen, habe nun aber das Abteufen wieder gesümpft und setze die Untersuchung des Eisensteinlagers fort (40014, Nr. 280, Film 0024). Das Lager war im Abteufen in 3 Lachter Teufe 1 Lachter mächtig und bestand zum größten Teil aus schönem, dichtem Brauneisenstein. Nachdem man es durchbrochen hat, so wird es nunmehr seiner Länge nach in den Stößen untersucht werden. Am 7. Mai 1828 hat der Geschworene die Grube das nächste Mal befahren, man schlug nun in die Stöße des Abteufens ein (40014, Nr. 280, Film 0032f). Hier befand er das Eisensteinlager ½ bis ¾ Lachter mächtig, bestehend aus Hornstein und etwas Mulm und es „führt vortrefflichen schwarzbraunen Eisenstein. Die Wasser sind stark und können nur mit Mühe durch 4 Mann zu 6 Stunden mittelst der Pumpe gehalten werden.“ Dabei brachte man auch Eisenerz aus und regelmäßig, wenn wieder 20 Fuder zusammengekommen waren, war Herr Gebler zum Vermessen desselben wieder zugegen (40014, Nr. 280, Film 0030). Vielleicht stand ja ein persönliches Interesse des Geschworenen dahinter, aber schon am 30. Mai war er erneut vor Ort und befand (40014, Nr. 280, Film 0041), man sei noch mit dem Durchbrechen des Lagers beschäftigt, „um zu erfahren, ob das Lager weiter viel Eisenstein niedersetzt und ob der angetroffene zeither bebaute Nieren sich nicht etwa in dieser Teufe ausschält (?), wird man wieder anfangen, wiederum abzuteufen.“ Bei seiner Befahrung am 7. Juli 1828 hat Herr Gebler „den noch vorhandenen Eisenstein vermessen, hierauf aber den neu angestellten Steiger Jlling der Mannschaft vorgestellt, ihn in seinen Dienst eingewiesen und ihm von dem zeitherigen Versorger das vorhandene Inventarium in meiner Gegenwart übergeben und übernehmen lassen.“ (40014, Nr. 280, Film 0047) Am 11. August des Jahres vermerkte der Geschworene, der Stolln sei nun gänzlich wieder hergestellt. Die Belegschaft ist um einen weiteren Mann auf nunmehr 9 Mann verstärkt worden (40014, Nr. 280, Film 0058). Die Mannschaft hatte nun begonnen, über dem Abteufen einen neuen Tageschacht niederzubringen und hatte dabei 3 Lachter Teufe erreicht; allerdings fehle es an Ausbauholz, da bei der Reparatur des Stollns viel benötigt wurde und die Vorräte fast aufgebraucht worden sind. „Um die Grube nicht stehen lassen zu müssen,“ unterstützte Herr Gebler die Bitte des Steigers um zusätzliche Holzzuteilung und reichte sie dem Bergamt behufs Entscheidung weiter. Bereits am 25. August war Herr Gebler wieder vor Ort, was nun tatsächlich ungewöhnlich häufig gewesen ist (40014, Nr. 280, Film 0064f). In seinem Fahrbogen berichtete er, man sei mit dem neuen Schacht nun auf 7 Lachter Teufe niedergekommen und „wegen des vielleicht bald zu erbauenden kleinen Kunstgezeugs hat man dem Schacht etwas mehr Länge als gewöhnlich gegeben. Es ist derselbe in schöne regelmäßige Zimmerung gesetzt. Den zeitherigen Tagschacht hat man unter Beybehaltung eines luttenartigen Raumes von ohngefähr Fahrschachtweite ausgestürzt, da dessen Wiederherstellung vieles Geld gekostet, aber wenig Nutzen gebracht haben würde, diese Vorrichtung hingegen doch zu Erhaltung der Wetter dient.“ Bis Mitte Oktober war man mit dem Tageschacht „bis auf das mit Eisenstein gemengte Hornlager über der Stollnförste niedergekommen“, beim Abteufen gewann man etwas Eisenstein. Der Durchschlag bis auf den Stolln stehe zu erwarten (40014, Nr. 280, Film 0076). Und am 13. November konnte Herr Gebler dann berichten, daß der neue Tagschacht „fertig auf den Stolln hereingebracht“ war (40014, Nr. 280, Film 0084). „Nach Verwahrung des Stollns an diesem Punkte und der daselbst vorhandenen Pressbaue wird man den Wiederangriff des verlaßnen Abteufens und des daselbst vorhandenen Eisensteinbaus, im nächsten Frühjahr aber die Erbauung einer kleinen Tagekunst vornehmen.“ Am 17. Dezember 1828 war der Geschworene schon wieder auf der Grube und hielt in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 280, Film 0097), man senke jetzt den hereingebrachten neuen Tagschacht unter die Stollnsohle weiter ab, hatte damit schon 2 Lachter Tiefe erreicht, wobei man das Lager durchsinke und etwas Eisenstein gewänne. Die Grundwasser wurden im 3 Lachter westlich liegenden Abteufen mit der Pumpe niedergehalten, was möglich sei, da beide Gesenke über Klüfte in Verbindung stehen. Kurz vor Weihnachten waren auch wieder 20 Fuder Eisenstein zusammengekommen und lagen zum Vermessen bereit (40014, Nr. 280, Film 0098). Insgesamt summierte sich die Förderung in diesem Jahr damit auf 60 Fuder.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner nächsten
Befahrung am 18. Februar 1829 berichtete Herr Gebler dann, der neue
Tageschacht sei bis auf den Stolln 12 Lachter tief und inzwischen weitere
4 Lachter unter die Stollnsohle abgesenkt
(40014, Nr. 280, Film 0110).
Weiter hinab käme man aber nicht,
weil „die
Wasser sehr bedeutend sind, so daß man eine zweite Pumpe benötigen würde,
was aber die Wasserhaltungskosten verdoppeln würde.“
Man baute aus dem
Abendstoß dieses Schachtes heraus nun Eisenstein ab.
Als der Geschworene am 9. März 1829 wieder auf der Grube anfuhr, hatte man bei 3 Lachter Teufe unterm Stolln aus dem Schachtstoß hinausgebrochen und dort das Lager ½ Lachter mächtig und meistens aus derbem, sehr schönem Brauneisenstein bestehend angetroffen (40014, Nr. 280, Film 0117f). Mit dem Bau einer Kunst hatte man aber noch nicht begonnen: „Noch zur Zeit setzt man die sehr kostbare Wasserhaltung mittelst täglich 4 Pumpenknechten fort.“ Die Belegung der Grube war dadurch weiter bei 8 bis 9 Mann geblieben. Am 20. März waren die ersten 30 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0123). Am 10. April 1829 hieß es dann, der Eisensteinbau 3 Lachter unter dem Stolln sei bereits auf 3 Lachter fortgestellt und „hat einen guten Fortgang.“ (40014, Nr. 280, Film 0126) Die vier Pumpenknechte vermögen nur „mit der größten Anstrengung die Wasser zu halten“ und zur Not wurde ihnen noch ein weiterer Gehilfe beigegeben. Mit dem Bau einer kleinen Kunst soll deshalb noch dieses Jahr begonnen werden. In Ansehung der anzulegenden Tagekunst und des dazu erforderlichen Aufschlaggrabens hat Herr Gebler an diesem Tag schon einmal die Umgebung der Grube begangen. Dabei hatte er außerdem wegen „einer kleinen, in der Nähe des Stollnmundlochs der Grube zum Nachtheil der letzteren durch Verschlämmung erfolgten Beschädigung (...)“ eine Besichtigung vorgenommen „und die deshalb von dem Steiger gegen das Ritterguth Förstel sowohl, als von Seiten des letzteren gegenseitig angebrachten Beschwerden auf der Stelle durch Anhörung beyder Theile untersucht, den Gegenstand durch gegebene Bestimmungen und Erklärungen ausgeschieden, die Partheyen beschieden und dadurch die Sache beseitiget.“ Am 12. Mai fand der Geschworene den Abbau unter dem Stolln bereits auf 5 Lachter gegen Abend erlängt vor und man schlug nun auch in die Gegenrichtung ein (40014, Nr. 280, Film 0134f). Bis zum 22. Juni 1829 waren noch einmal 40 Fuder ausgebracht, in Summe also mit 70 Fudern fast schon die Jahresförderung des Vorjahres (40014, Nr. 280, Film 0146). Am 7. Juli 1829 fand Herr Gebler den Eisensteinbau 4 Lachter unter dem Stolln dann schon bis auf 9 Lachter gegen Abend ausgelängt vor. Auch werde querschlagsweise das Lager durchbrochen, das hier ½ bis ¾ Ltr mächtig war (40014, Nr. 280, Film 0148). Im nächsten Monat war „wegen aufgegangener Wasser“ keine Befahrung der Grube möglich und: „Mit Erbauung der hier erforderlichen kleinen Tagekunst scheint man nun ernstlich Anstalten machen zu wollen.“ (40014, Nr. 280, Film 0155)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 2. September 1829 fand der Geschworene den Eisensteinbau nur noch mit 2 Mann belegt vor, die übrigen, außer den Wasserknechten natürlich, waren nun mit dem Kunstbau beschäftigt (40014, Nr. 280, Film 0161f). Dafür hatte man an Bauholz 18 Stämme aus der dem Eigenlöhner eigenen Waldung herangeschafft, gleich viele aus anderen privaten Waldungen gekauft und noch weitere 20 aus königlicher Waldung, da das der Grube für 1829 zustehende Holz bereits völlig verbraucht war. Das Kunstrad war schon fast fertig, rund 11 Ellen (knapp 6 m) hoch und sollte am Stollnmundloch aufgestellt werden. Damit der Stolln das gehobene Wasser auch ordentlich abtragen kann, hatte der Steiger im Stolln, wo es nötig war, die Zimmerung ausgewechselt, so daß dieser „wieder in haltbarem Zustande“ war. Weil der Bau der Wasserkunst in diesem Revier sicher eine der größten Investitionen dieser Zeit gewesen ist (über etwas gleichartiges verfügte man damals ja nur auf Vater Abraham zu Oberscheibe), war Herr Gebler schon am 5. Oktober erneut vor Ort (40014, Nr. 280, Film 0170f), um sich vom Fortgang der Sache zu überzeugen. Er notierte in seinem Fahrbogen, man „belegt die Eisensteinbaue nur wenig und arbeitet eifrig daran, die Kunst baldigst in Gang zu setzen.“ Die Kunstradstube war bereits zum größten Teil fertig und in Kürze werde das Rad gehängt. Am 19. November 1829 befand Herr Gebler dann, daß man mit Erbauung des neuen Kunstgezeugs fast ganz zu Stande gekommen war (40014, Nr. 280, Film 0180). Es waren noch die Böcke zum Tragen der Kunstschwingen aufzusetzen und das Feldgestänge zusammen zu schließen. Auch fehlte noch einiges Eisenwerk für das Einkuppeln der Bruchschwinge und des Kunstkreuzes am Schacht und für das Einhängen des Balanciers, was aber alles nebst dem Einhängen der Kunstsätze in 14 Tagen fertig sein solle, wenn die Witterung keine Hindernisse in den Weg legt. Das eingehangene Rad war 10½ Ellen hoch und „gut gefertigt“ und bereits angeschützt, um Zapfen und Lagern Zeit zum Einlaufen zu geben. Am 14. und 15. Dezember 1829 hat sich der Geschworene erneut dorthin begeben, „um die seit einer Woche fertige und angeschützte Kunst in Augenschein zu nehmen“. Er fand sie „überaus wohl gebaut.“ (40014, Nr. 280, Film 0187f) Die Radstube befand sich in einer hölzernen Kaue über dem Stollnmundloch. Von dort aus bewegte sich ein 80 Lachter langes Feldgestänge „auf leichten halben Schwingen ruhend, über dem Schacht ein gewöhnliches halbes Kreuz.“ „Im Gange fand ich diese schöne neue Kunst aber nicht, vielmehr den Kunstgraben völlig eingefroren.“ Na, so was... Die Ursache sah Herr Gebler darin, daß die Zuleitung der erforderlichen Aufschlagewasser „unter leeren Vorwürfen vonseiten des Ritterguts Förstel unnötig gestört worden“ sei, die Aufschlagewasser deshalb mal schwächer, mal stärker herbeigekommen waren und in der Nacht vom 10. zum 11. Dezember habe dann der Frost das erste Paar Spundstücke vor der Radstube aufgeschoben. Das war nun ganz besonders blöd, denn das Wasser ist dadurch unkontrolliert dem Stolln zugelaufen, wo es bei 6 Lachter vom Stollnmundloch „einen Bruch gemacht habe, wonach der gewöhnliche Ablauf verhindert wurde und die Grube gänzlich ersaufen mußte.“ Die Belegschaft hatte zwar sofort Hand angelegt, den Verbruch im Stolln wieder zu öffnen, aber an dieser Stelle stehe besonders unhaltbares, guriges Gestein an, so daß das Abtreiben bei der strengen Kälte „eine sehr üble Arbeit“ war. Immerhin konnte man bislang den Abfluß halbwegs wieder herstellen. Der Steiger wurde vom Geschworenen mit den nötigen Anweisungen versehen und „es wird der möglichste Fleiß angewendet werden.“ Am 22. Dezember war Herr Gebler wieder nachschauen und notierte, die Gewältigung des Stollns gehe des großen Drucks und der strengen Kälte halber leider nicht so schnell vonstatten, wie erhofft (40014, Nr. 280, Film 0189). Darüber trug Herr Gebler am 23. Januar 1830 auch im Bergamt Annaberg vor (40169, Nr. 128, Blatt 32).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bis zum 25. Januar
1830 brauchte man noch, um diesen Verbruch vollständig aufzuwältigen
(40014, Nr. 280, Film 0194f).
Bei seiner Befahrung am 16. Februar 1830 war die Kunst wieder im Gange, doch waren die Grundwasser, „nachdem sie durch Ereignisse der Witterung und durch andere Gefälle entstandenen Störungen bald einmal niedergewältigt gewesen, bald einmal wieder aufgegangen waren und fanden sich am heutigen Tage noch nicht ganz wieder niedergebracht.“ (40014, Nr. 280, Film 0203) Schon im Vorjahr hatte sich der Steiger beschwert, daß die Benutzung der Aufschlagewasser vom Rittergut Förstel gestört werde. Herr Gebler schaute sich den in der Nähe des zum Gut gehörigen Wohngebäudes befindlichen Schützen an und suchte auch Gelegenheit, den Gutsverwalter Koch zu sprechen. Dabei stellte er aber fest, daß „von Störungen keine Rede seyn“ könne und daß die Ursache für den schweren Schaden wohl vielmehr im „unbefohlenen, verkehrten und höchst tadelnswerthen Benehmen des Steigers Jlling“ zu suchen sei, der meine, die Befugnis zu haben, die Wasser aus dem Schwarzbach beliebig wegzunehmen – ach, und nebenbei stellte er nun auch noch fest, daß die Aufschlagewasser der Grube doch noch gar nicht verliehen waren. Der Steiger hätte in den vorhandenen Schützen einen Einschnitt oder Schlitz zum Durchgang oder Überfall anbringen sollen, durch den das für die Kunst benötigte Wasser dem Graben gleichmäßig zuläuft, anstatt den Schützen herauszunehmen oder mit dessen Herausreißen zu drohen, was natürlich umgekehrt den Betrieb der Mühle des Gutes störte. Auf Gebler's Eingreifen hin hat der auf dem Gut in Arbeit stehende Zimmermann den Schlitz im Schützen auch sogleich angebracht. Am 18.2.1830 wurde durch Gebler auch dem (am 16. Februar abwesenden) Steiger sein Verhalten vorgehalten. Am 13. März war erneut ein Schaden durch die „angestoßenen Spundstücke“ bei der Kunst entstanden, daher wurden nun „Zimmerlinge aus Johanngeorgenstädter Revier herbeigezogen, um diesen Punkt gehörig zu verwahren, auch einige Spundstücke mehr zu legen.“ (40014, Nr. 280, Film 0207) Am 23. März 1830 fand der Geschworene dann endlich „die Reparaturen alle verrichtet und die Kunst im Gange, man wird nun endlich die Eisensteinbaue wieder gehörig in Angriff nehmen können.“ (40014, Nr. 280, Film 0212) Um den Wasserstreit beizulegen, wurden die Beteiligten am 6. April 1830 zusammengerufen und auch Herr Gebler hat sich an diesem Tage „auf das Grubengebäude Gnade Gottes Fdgr. zu Langenberg begeben und den zwischen dem dortigen Grundbesitzer, Herrn Rittmeister von Querfurth und zwischen dem Eigenlöhner bey jener Grube, Herrn Bergcommissionsrath Nitzsche, in Betreff der bey derselben neu erbauten Kunst erforderlichen Verhandlungen beygewohnt.“ (40014, Nr. 280, Film 0218) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Tag darauf wurde die
Bergamtssitzung von Scheibenberg ins Freie verlegt und es erfolgte „nach (...) an Ort und
Stelle vorgenommener Bestätigung der Kunstaufschlagewasser eine
Besichtigung der (...) erbauten, neuen Kunst durch Eu. Königl. Bergamt.“
(40014, Nr. 280, Film 0219) Zu dieser Befahrung im Beisein des Bergmeisters
von Zedtwitz fanden wir in der Grubenakte folgenden recht ausführlichen
Bericht (40169, Nr. 128, Blatt 33f):
Praesentes Protocollirt Bergamt Scheibenberg, „Schließlich war anher zu bemerken, daß (?) Herr Bergcommissionsrath Bergmeister von Zedtwitz unter Zuziehung des Herrn Geschworenen Gebler und Subscripti nach beendigter Session sich auf das Berggebäude Gnade Gottes gevierte Fundgrube zu Langenberg begeben, um das daselbst neuerbaute Kunstgezeug nebst Kunstgraben zu besichtigen. Es ergab sich, daß die Kunstradstube bei 112 Lachter söhliger Entfernung von dem bis 4 Lachter vom Tage (das stimmt nicht: unter dem Stolln) nieder neu abgesunkenen Kunstschachte liegt. An dem westlichen Wellenende des 10½ Ellen (zirka 5,6 m Durchmesser) hohen, 18 Zoll (zirka 46 cm) weit geschaufelten und mit 8 Armen versehenen oberschlächtigen Rades befindet sich eine 22 Ellen, 4 Zoll lange Korbstange, welche eine 2 Ellen 18 Zoll lange Bruchschwinge in Bewegung setzt; an solcher ist das 104 Lachter lange, auf 26 stehenden Feldschwingen laufende einfache Feldgestänge angeschloßen, welches mit dem 2 Ellen (?) Zoll langen Kunstkreutze in Verbindung steht.“ Die Division sagt uns schnell, daß die Feldschwingen in 4 Lachter Abstand erbaut waren, die einzelnen Gestänge folglich 8 m Länge besaßen. „Gegenwärtig ist nur ein Kunstsatz angebaut und zwar bei 11½ Lachter unter Tage oder ¼ Lachter über der Stollnsohle, es ist derselbe 8 Zoll weit. Die Aufschlagewaßer sind dem Gezeug in einem 520 Lachter langen Graben zugeführt, und aus dem Dorfbache oberhalb des Ritterguthes Förstel gefaßt. Die Kosten der Erbauung dieses Kunstgezeugs anlangend, so betrugen solche überhaupt 761 Thl., 13 Gr., 2 Pf. (...) Der Hauptzweck bey Erbauung dieses Gezeugs war, bey vorhabender weiterer Absinkung des Kunstschachtes, die früher stattgefundene Waßerhaltung mittelst Pumpen, welche quartalig einen Aufwand von 60 Thl. erforderte und schon bey der geringen Teufe nicht mehr ausreichend war, abzuwerfen, wodurch man denn jetzt auch 4/5 bis ¾ des zeitherigen Aufwandes erspart hat, (…)“ Auf den folgenden Seiten der Akte findet sich die Abrechnung des Schichtmeisters Christian Carl Gottlieb Schubert über den Bau des Kunstgezeuges vom 14. Mai 1830 und darin noch weitere Informationen über dessen Mechanik (40169, Nr. 128, Blatt 36ff): „Das Radstubengebäude zu diesem Kunstgezeuge steht 112 Lr. (224 m) von dem neu abgesunkenen Kunstschachte (söhlig) gegen Mittag, oder 2⅝ Lr. von dem Gnade Gotteser Stollnmundloche gegen Mitternacht Abend entfernt und die Radstubensohle liegt 3/16 Lr. (37,5 cm) tiefer als die Stollnsohle. Die Aufschlagewaßer sind dem durch das Dorf Langenberg von Morgen in Abend fließenden Bache mittelst eines 520 Lr. (1.040 m) langen Grabens, welcher oberhalb des Ritterguthes Förstel schon in früherer Zeit gefaßt und von dem Besitzer des erwähnten Ritterguthes zur Wiesenwässerung und zeither auch zum Umtrieb einer Mahl- und Dreschmühle benutzt worden ist, auch fernerhin noch mit dazu benutzt wird, entnommen. Das Kunstrad ist 10½ Ellen (zirka 5,6 m) hoch, 18 Zoll (etwa 45 cm) weit geschaufelt und mit 8 Armen versehen. An dem westlichen Ende der Radwelle ist ein gußeiserner 18 Zoll hoher Krummzapfen, an dem östlichen Ende hingegen nur ein Läufer angebracht. Die Korbstange hat 22 Ellen, 4 Zoll (rund 11,8 m) active Länge und dirigirt die nach Mitternacht hin befindliche Bruchschwinge in einer Richtung aufwärts und zwar in einem Neigungswinkel gegen die Horizontalebene von 27 Graden. Das Streichen der Korbstange sowie der ganzen Feldgestänglinie ist circa Stunde 11,4. Die Bruchschwinge ruht mit ihrer Hauptwalze auf einem auf der Erdoberfläche angebrachten Geviere. Beyde Arme derselben, so wohl derjenige, mit welchem die Korbstange verbunden ist, als auch der das Feldgestänge in Bewegung setzende, stehen aufwärts und haben 2 Ellen, 18 Zoll (zirka 1,5 m) active Länge. Auch ist die Bruchschwinge mit einer kleinen Kaue überbaut. Das übrige nur einfache Feldgestänge zieht sich aufwärts in einer Neigung von ohngefähr 4 Graden auf 26 stehenden Feldschwingen, welche sämtlich ebenfalls 2 Ellen 18 Zoll active Länge haben und mit ihren untern Walzen auf 4 Lr. von einander entfernten, in die Erde eingesetzten niedrigen hölzernen Steifen ruhen, nach dem Kunstschachte hin. Die Länge einer Feldstange beträgt 14 Ellen, die Höhe 4¼ Zoll und die Stärke 3¼ Zoll. Die Schlösser derselben sind mit Laschen versehen…“ Im Protokoll des Bergamtes hierzu (und später auch bei Theodor Haupt) wird die Länge der Feldstangen mit 4 Lachtern angegeben, daher benutzte Schichtmeister Schubert hier ein Ellenmaß von ≈ 57,143 cm, welches etwas größer, als die ab 1858 in Sachsen einheitlich festgesetzte Dresdner Elle (0,56638 m) gewesen ist. Ab Sommer 1830 erhielt dann auch Steiger Jlling wöchentlich 2 Groschen Lohnzuschlag für die Wartung dieser Anlage (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 38).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da die in dieser Beschreibung benutzten Begriffe heute
vielleicht nicht mehr jedem geläufig sind, fügen wir an dieser Stelle die
folgende Beschreibung solcher Einrichtungen aus Pierer’s Universallexikon
von 1864 ein, welche uns im Vergleich mit anderen Beschreibungen in
diversen Fachwörterbüchern als die umfassendste erschien:
„Stangenkunst (Spielwerk), Vorrichtung zur Fortpflanzung einer geradlinig hin u. her gehenden Bewegung, bisweilen auf sehr bedeutende Entfernungen od. Tiefen, weil man nicht immer die Kraftmaschine (Wasserrad) in unmittelbarer Nähe bei dem Orte anbringen kann, an welchem man die Kraft braucht; so namentlich im Bergbau zum Betrieb der Pumpwerke, welche das Grubenwasser aus den Schächten od. in Salzwerken die Soole auf die Gradirhäuser heben. Eine S. in freiem Felde heißt Feldgestänge; eine nur kurze heißt Feldgeschleppe od. Geschleppe; geht sie in einen Schacht hinein, so heißt sie Schacht-, geht sie in einer Strecke fort, so heißt sie Strecken-S.; gehen die Stangen senkrecht herab, Seigergestänge. Die ganze Linie, welche ein Gestänge bildet, heißt Gestänglinie. A) Der Haupttheil der S. sind die Schub- (Schieb-)stangen, aus Holz od. aus Eisen. Wenn die S. eine sehr große Kraft zu übertragen hat, so gibt man ihr häufig zwei Schubstangen, welche die zwei entgegengesetzten Arme des Kunstkreuzes fassen, so daß, während die eine Stange hinwärts schiebt, die andere herwärts zieht u. dadurch jede so ziemlich die Hälfte der Kraft überträgt. a) Die hölzernen Gestänge sind vierkantig, aus Fichten- od. Eichenholz u. zwar haben die vertical hängenden einen quadratischen, die horizontal od. schräg liegenden einen rechteckigen Querschnitt. Um sie in ihrer Lage zu erhalten, umgibt od. stützt man sie gewöhnlich durch kleine Gestängwalzen, welche meist mit einem eisernen Mantel umgeben werden, während das Gestänge selbst an dieser Stelle durch eine aufgelegte eiserne Schleppschiene geschützt wird. Die Walzen liegen auf Böcken (Einstrichsböcken) u. werden durch kleine Dächer gegen das Wetter geschützt. Die 20–30 Fuß langen Stangen werden an ihren Enden durch ein Schloß (Kamm) mit einander verbunden; man kämmt sie an diesen Stellen über einander od. läßt sie blos stumpf od. schräg an einander stoßen, legt aber auf zwei gegenüberliegenden od. auf allen vier Seiten hölzerne od. eiserne Schienen (Backen od. Wangeneisen, Laschen, daher Laschenschlösser) auf u. verbindet diese untereinander mit den Stangenenden mittelst durchgehender Schraubenbolzen u. aufgetriebener eiserner Bänder od. Ringe.“ Ein solches Walzen- Kunstgestänge wurde übrigens auf
der Grube Neusilberhoffnung bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„b) Die eisernen Gestänge sind meist aus 10 bis 15 Fuß
langen, 11/2 – 21/2 Zoll dicken Quadrateisenstangen gebildet, welche
ebenfalls mittelst Laschen u. durchgehender Bolzen u. Keile mit einander
verbunden sind.
B) Bei langen Kunststangen lediglich zur Unterstützung der Stangen (also anstatt der Gestängwalzen), vorzüglich aber an den Stellen, wo die Richtung des Gestänges sich ändert, wendet man einen Winkelhebel an, welcher gewöhnlich eine Bruchschwinge od., wenn der Ablenkungswinkel einem rechten Winkel nahe kommt, Gestängskreuze od. Kunstkreuze genannt werden. a) Die Schwingen (Leit- od. Lenkarme, Lenker) theilen das Gestänge in zwei Theile; jeder Theil endigt in ein das Stangenende umschließendes Krückeneisen, welches mit der Schwinge durch einen Bolzen verbunden ist. Bei einem sehr kleinen Bruch- od. Ablenkungswinkel bildet die Schwinge nur einen einfachen Arm, u. es können dann auch beide Gestängarme an einem Bolzen hängen. Gewöhnlich aber hat jeder Gestängtheil seinen besonderen Arm; die beiden Arme der Schwinge (des Zwillings) werden auf einander geschmiegt u. durch schmiedeeiserne Bolzen (Schließen) u. Ringe, auch wohl noch durch eine eingesetzte hölzerne Strebe fest mit einander verbunden. Die Drehachse (das Walzeisen) der Schwinge ist innerhalb der Schwinge vierkantig u. fest eingekeilt. Bei den stehenden Schwingen liegt die Drehachse unten u. die Zapfenlager (Anwellen) sind meist auf einem Rahmen in ein gemauertes Fundament eingelassen; bei den hängenden Schwingen ist der Kopf der Schwinge unten u. die Drehachse ruht oben mit ihren Zapfen auf einem Gerüste (Kunstbock); bei den schwebenden Schwingen ist der Arm horizontal u. in ein senkrechtes, um zwei Zapfen drehbares Säulchen eingezapft, welches an einem Hauptpfosten (Geschleppsäule) angebracht ist; an der Seite desselben ist ein starkes Stück Holz (der Backen) eingelassen, welches das Zapfenloch für den unteren Zapfen des Säulchens enthält. Ein schräges Holzstück (Bug) verbindet den Arm u. das Säulchen u. hilft den Arm tragen. Die ganze Vorrichtung heißt auch ein Kunstbock. Wo man die Schubstange tiefer od. höher, aber in paralleler Richtung fortführen muß, wird das Gestänge abgebrochen (gebrochenes Gestänge) u. eine doppelte Schwinge (Bruchschwinge) angebracht, welche ihre Drehachse in der Mitte hat, so daß der eine Arm eine stehende, der andere eine hängende Schwinge bildet. b) Die Kreuze haben verschiedene Einrichtung: aa) das ganze Kunstkreuz, besteht aus zwei rechtwinkelig sich durchkreuzenden, starken Hölzern, deren vier Enden durch eiserne Schienen (Wangeneisen) od. schmiedeiserne Kopfstangen verbunden sind; durch die Mitte des Kreuzes geht eine eiserne Welle, welche in Pfannen ruht; empfängt das senkrechte Holz des Kreuzes (die Schwinge), die Bewegung von der S. in horizontaler Richtung, dann pflanzt das horizontale Holz (die Wage), die Bewegung in verticaler Richtung fort; bb) das halbe Kunstkreuz, unterscheidet sich dadurch, daß die Schwinge nur halb ist, d. h. nicht über den Mittelpunkt des Kreuzes hinausragt; cc) das Viertelkunstkreuz ist ein einfaches rechtwinkeliges Knie, dessen beide Schenkel einen rechten Winkel mit einander einschließen. Muß man die Bewegung in der horizontalen Richtung in einem Winkel ablenken, so wendet man ebenfalls ein Kunstkreuz od. Zwillinge an, deren Arme sich horizontal bewegen u. deren Achse senkrecht in einem dazu geeigneten, starken Gerüste steht; diese Vorrichtung heißt ein gebrochenes Kreuz (Wendebock od. Werkstämpel). C) An dem einen Ende empfängt das Gestänge die Bewegung von der Kraftmaschine, gewöhnlich von einem Wasserrade od. einer Dampfmaschine; am Ende des Gestänges ist daher eine Schwinge od. ein Kreuz, durch welches das Gestänge mit dem Bläuel (Korb-, Stoß-oder Bläuelstange) verbunden ist, das andere Ende der Bläuelstange aber ist an dem Krummzapfen des Kunstrades befestigt, u. so überträgt die Bläuelstange die Drehbewegung des Kunstrades als geradlinige Bewegung auf das Gestänge. Das Gewicht der Bläuelstange wird bisweilen durch ein Gegengewicht (Bläuelgewicht) äquilibrirt. Statt des Bläuels wird wohl auch eine Bläuelschwinge angewendet; sie ist fast in der Mitte beweglich, der kürzere Schenkel mit der S. verbunden, der längere mit einem Schlitze versehen, in welchem der Krummzapfen des Kunstrades geht u. dieselbe von u. nach sich bewegt. D) An dem anderen Ende hängt die Schubstange mit dem einen Arme eines Kunstkreuzes (Kreuzes) zusammen, an dessen anderem Ende die Kolbenstange der Pumpe hängt, indem in das an dem Kreuze angeschlagene Krummeisen die an der Kolbenstange befestigte Krummeisenschiene gehängt wird. Das Ende der Wage, welches die Kolbenstange zieht, versieht man bisweilen bei diesen Kreuzen mit einem Bogenstück u. befestigt die Kolbenstange mit einer Kette daran, wodurch man eine seitliche Verschiebung der Pumpenstange verhindert u. bewirkt, daß dieselbe mit dem Pumpenkolben ganz geradlinig hin u. her geht, wobei zugleich die Reibung am geringsten ist. Wenn sich nun das Wasserrad herumdreht u. dadurch die Warze der Kurbel abwechselnd rück- u. vorwärts zu stehen kommt, so wird hierdurch die Schubstange hin- u. hergezogen u. hierdurch wieder das Kunstkreuz u. die Kolbenstange in Bewegung gesetzt.“ Die geschilderte Bauweise der stehenden Schwingen, die hier gewählt worden ist, ist ziemlich einfach und bringt durchaus mechanische Probleme mit sich. Eines dieser Probleme besteht darin, daß die Bewegung der Feldgestänge nicht vollkommen horizontal in der Übertragungsrichtung der mechanischen Antriebsleistung liegt. Vielmehr bewegen sich die Gestänge auf einem Kreisbogensegment, wie folgende Zeichnung leicht erkennbar macht. Durch die unvermeidliche Auf- und Abwärtsbewegung der Gestänge entstehen Übertragungsverluste, namentlich, wenn sie auch noch bergauf schieben müssen, wie es ja auch hier der Fall war. Man könnte dies vermeiden, indem man die Schwingen mit einem Bogen versieht, auf dem die Gestänge – und dann stets in derselben Höhe – hin- und herlaufen. Wahrscheinlich aber steht der konstruktive Mehraufwand nicht in einem vorteilhaften Verhältnis zum Gewinn an übertragener Leistung, sonst hätte man solche Lösungen wohl öfter angewandt. Verlagert man die Gestänge dagegen auf Walzen, besteht dieses Problem nicht, da die Gestänge dann – ähnlich wie auf dem Kreisbogen – immer auf der Oberfläche der Walzen aufliegen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vergleichbare Bogenkonstruktionen findet man dagegen
häufiger an den Kunstkreuzen, welche die Antriebsleistung in einem spitzen
Winkel auf die Schachtgestänge übertragen. Die Schachtgestänge dürfen
nämlich keinesfalls seitlich ausschwenken, da die an ihnen hängenden
Kolbenstangen der Pumpensätze immer geradlinig in der Achse der
Pumpenzylinder laufen müssen, sollen die Pumpen nicht vorzeitig
verschleißen. Auch das simple Ständerwerk der Feldschwingen auf „Säulen“ beinhaltet noch ein mechanisches Problem, wirken doch entlang der Bewegungsbahn allein schon durch das Gewicht der Gestänge ziemlich große seitliche Schubkräfte auf die Stützen der Schwingen. Sie erhöhen sich periodisch noch durch die Bewegungsumkehr an den beiden Endpunkten der Bewegungsbahn und durch das „Anziehen“ der Gestänge in die jeweilige Gegenrichtung. Eine Bauweise mit Böcken anstelle mit solch einfachem Ständerwerk wäre in jedem Fall stabiler und dauerhafter.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nichtsdestoweniger sind etliche Kunstgezeuge genau in
dieser Form errichtet worden und taten bei guter Wartung jahrzehntelang
ihren Dienst.
Da nun das Original bei Gnade Gottes längst demontiert und verfallen ist, nutzen wir die Digitalisate des Bergarchives, um uns auch ein Bild zu machen, wie solch eine Kunst ausgesehen hat. Dort haben wir folgende, sehr genaue Darstellung einer ähnlichen, wenn auch mit nur 6 Feldschwingen viel kürzeren Anlage gefunden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahr 1839 übrigens beauftragte das Bergamt den zu
dieser Zeit amtierenden Berggeschworenen Theodor Haupt, sich doch einmal gutachterlich zu äußern, ob es nicht „wegen der immer mehr zunehmenden Theuerung und Holzmangel thunlich wäre,“ solcherart Feldgestänge aus Eisen
herzustellen. Herr Haupt reichte daraufhin am 16. November 1839 ein langes
Gutachten ein (40169, Nr. 128, Blatt 46ff), dem man noch entnehmen kann, daß das bis dahin bestehende Feldgestänge von
Gnade Gottes aus
Fichtenholzbalken von je 4 Lachter oder 14 Ellen Länge und 3¼ mal 4 Zoll
Stärke errichtet war und einschließlich Schlösser und Feuchte ein Gewicht
von 18 Zentnern, 74¼ Pfund besaß. Der größeren Festigkeit des Eisens halber
könne man zwar aus Eisen schwächere Gestänge von nur einem Viertel des
Querschnitts der hölzernen Balken fertigen; diese würden aber auch rund 17
Zentner wiegen – eine Last, die das Kunstrad natürlich mitzubewegen hatte.
Die Errichtung würde voraussichtlich auch 268 Thaler kosten, jedoch würde
man aufgrund der besseren Haltbarkeit pro Jahr etwa 4 Stämme Holz
einsparen, mit denen sonst defekte Gestängeteile regelmäßig zu ersetzen
wären. Interessanterweise schlug aber auch dieser Geschworene vor, das
Gestänge zukünftig auf Walzen zu verlagern und nicht auf Schwingen.
Nach seinem Berichtsvortrag hierzu in Annaberg am 23. November 1839 wurde Herr Haupt vonseiten des Bergamts beauftragt, seinen Bericht auch dem Grubenvorstand vorzustellen. Zu diesem Zeitpunkt kam aber ein solch aufwendiger Neubau bereits nicht mehr in Betracht... Schon bis zur Inbetriebnahme war es jedenfalls eine schwere Geburt, aber damit wäre es ja nun geregelt und man konnte zum eigentlichen Geschäft zurückkehren... Schon am 21. April 1830 waren wieder die ersten 25 Fuder Erz zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0220).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 28. April 1830 fand dann auch wieder
eine reguläre Grubenbefahrung durch Geschworenen Gebler statt, über die er
notierte (40014, Nr. 280, Film 0222),
daß der 3½ Lachter unter der
Stollnsohle liegende und 8 Lachter gegen Abend lange Abbau nur mit 2 Mann
belegt sei, während die übrige Mannschaft sich mit Verbesserung des
Aufschlagegrabens befasse, außerdem soll der durch den Bruch im Winter „in
Unordnung gerathene und stellenweise beschädigte“ Stolln vom Mundloch
herein in Angriff genommen werden. Die Wasserknechte wurden nicht mehr
benötigt und die Belegschaft wieder auf 7 Mann reduziert, denn: „Die
Kunst befindet sich in fortlaufend gutem Gange.“
Bei seiner nächsten Befahrung am 11. Mai (40014, Nr. 280, Film 0228) war der Steiger fortdauernd krank und einstweilen als Steigerdienstversorger der Bergarbeiter Kunstmann eingesetzt. Herr Gebler hat davon unbenommen aber „alles in sehr gutem und brauchbaren Zustande gefunden.“ Die Wiederherstellung des Stollns war noch im Gange und der Eisensteinabbau daher nur mit 1 Mann belegt. Am 17. Juni 1830 fand der Geschworene auch das Abteufen wieder belegt (40014, Nr. 280, Film 0238). Nach dem aufwendigen und am Ende beinahe noch gescheiterten Einbau der Wasserkunst wollte der Eigenlöhner natürlich wieder Erz erhalten. In dem Gesenk aber „scheint (das offenbar flach einfallende Lager) aus dem Teufen gegen Mitternacht hinausweichen zu wollen.“ In dem Ort in die Gegenrichtung überwiege der Hornstein, so daß man dorthin nicht fortschreiten werde. Auch der alte Firstenbau auf der Stollnsohle war noch einmal belegt. Die Wasserhaltung mittels der Kunst „geht vortrefflich von Statten.“ Bald werde wohl ein zweiter Pumpen- Satz nötig werden. Tatsächlich scheint sich der Aufwand für den Grubenbesitzer gelohnt zu haben, denn am 1. Juli hatte Herr Gebler hier 50 Fuder Eisenstein zu vermessen und am 14. September 1830 nochmals 15 Fuder (40014, Nr. 280, Film 0239 und 0259), so daß die Grube mit insgesamt 90 Fuder Jahresförderung sogar das Ausbringen der Vorjahre nun übertraf. Bei der Grubenbefahrung am 10. September 1830 war für den Geschworenen bemerkenswert, daß der Firstenbau über der Stollnsohle nun endgültig ausgeerzt war. Um weitere Erzvorräte zu erschließen, hatte man den Kunstschacht auf nunmehr 8 Lachter Tiefe unter die Stollnsohle verteuft (40014, Nr. 280, Film 0258). Am 5. November hat Herr Gebler noch einmal in diesem Jahr die Grube befahren und berichtete in seinem Fahrbogen darüber (40014, Nr. 280, Film 0270), daß man in 4 Lachtern Teufe unter dem Stolln einen Querschlag zur Untersuchung des Lagers gegen Mitternacht getrieben habe, ohne das Lager bisher aber wieder anzufahren. Das Auffinden neuer Erzvorkommen war auch dringend nötig, denn: „Nur hin und wieder beschäftigt sich ein einzelner Mann mit Gewinnung des, noch in dem vom Schachte aus einige Lachter gegen Abend vorhandenen kleinen Abbau, übrigen Eisensteinmittels.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr 1831 fand die erste
Grubenbefahrung durch den Geschworenen am 18. Januar statt (40014, Nr. 281, Film 0006).
Angelegt waren auf der Grube Gnade Gottes jetzt 6 Mann. Von der
Kunst wurden zwei achtzöllige Sätze zuverlässig angetrieben, um die Wasser
zu Sumpfe zu halten. Somit konnte man, 2 bis 3 Lachter vom Kunstschacht
gegen Abend entfernt und und in 4 Lachter Teufe unter dem Stolln, den
Firstenbau betrieben. Das Lager dort fällt außerordentlich flach, bemerkte
Herr Gebler, ist ¼ bis ⅜ Lachter mächtig, aus Hornstein und Mulm
bestehend, dichten Brauneisenstein führend. Zur Aufsuchung des Lagers in
7½ Lachter Teufe unter dem Stolln hatte man ein Ort gegen Mitternacht
angehauen und war damit bereits 6 Lachter fortgerückt, hatte aber das
Lager noch nicht wieder angefahren. „Bleibt zu wünschen, daß sich das
Lager auch bis in diese Tiefe fortziehe und nicht auskeilen möge,“
notierte der Geschworene in seinem Fahrbogen dazu.
Am 23. Februar 1831 hatte sich „vor dem Orte des Querschlags (...) etwas Brauneisenstein eingefunden, weshalb man Hoffnung schöpfte, das Lager bald anzufahren.“ (40014, Nr. 281, Film 0017) Schließlich war bei der Befahrung am 3. März 1831 und bei 9 Lachtern Länge das Lager mit dem Querschlag erreicht (40014, Nr. 281, Film 0019). Mit dem Anfahren des Lagers hatte man aber auch wieder viel Grundwasser angetroffen. Im April hatte man den Querschlag so weit ausgelängt, daß das Lager „ziemlich durchbrochen“ war und in dieser Tiefe hatte man einen neuen Abbau angelegt. Auch der Firstenbau in 4 Lachter Teufe unterm Stolln stand in Umgang (40014, Nr. 281, Film 0028). Hierzu trug der Geschworene am 2. April 1831 auch im Bergamt Annaberg vor (40169, Nr. 128, Blatt 39). Bereits am 16. März hatte der Geschworene hier die ersten 30 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 281, Film 0021). Am 13. Mai 1831 war der Geschworene schon wieder auf der Grube und berichtete in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 281, Film 0035), die Wasserzugänge im Tiefsten hätten so zugenommen, „daß die Kunst diese wegzunehmen nicht mehr vermochte.“ Der Steiger wollte nun zusätzliche Sätze anbauen, Gebler vermutete aber, daß die Zuläufe abnehmen werden, „indem man eine im Gebirge angesammelte Wassermasse angezapft habe.“ Der Firstenbau darüber wurde davon unbenommen weiter betrieben. Keine zwei Wochen später war Herr Gebler erneut vor Ort und befand, der Wasserzulauf habe sich vermindert, der Tiefbau war dennoch noch ersoffen und weitere Kunstsätze daher wohl unumgänglich (40014, Nr. 281, Film 0039). Bei der nächsten Befahrung am 12. Juli war festzustellen, daß man nun, „weil die vorhandenen Tagewäßer niedergezogen worden sind,“ die Wasser zu halten vermochte. Weil man aber mit dem Querschlag nicht nur viel Wasser, sondern auch „guriges und lettiges Gestein“ angetroffen hatte, wurde nun 6½ Lachter vom Querschlagsort zurück eine neue Strecke nach Nordwesten angehauen, um einen besseren Angriffspunkt zu finden. Der obere Abbau blieb solange „als Reserve“ stehen (40014, Nr. 281, Film 0047). Auch darüber gab es in Annaberg einen Fahrbogenvortrag, woraufhin das Bergamt die Veranstaltungen des Geschworenen billigte (40169, Nr. 128, Blatt 40). Bis zum August hatte man das Lager auch mit diesem neuen Ort wieder erreicht (40014, Nr. 281, Film 0053). Es führte an diesem Punkt „viel Hornstein und Nester guten Brauneisensteins, auch etwas Braunstein.“ Man nahm nun im Tiefsten den Abbau auf und am 19. September 1831 waren für Herrn Gebler wieder 30 Fuder ausgebrachten Eisensteins zu vermessen (40014, Nr. 281, Film 0063). Da weitere derartige Vermerke nicht mehr in den Fahrbögen zu finden sind, belief sich die Förderung in diesem Jahr folglich auf nur 60 Fuder insgesamt. Am 20. Dezember des Jahres war der Geschworene noch einmal auf der Grube und berichtete in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 281, Film 0080), daß es auf dem Abbau in 8 Lachter Teufe an Wettern mangele, obwohl der Querschlag doch nur 8 Lachter vom Schacht ausgelängt war. Dem abzuhelfen, wolle man nun einen Durchschlag auf die 4 Lachter- Sohle herstellen. Außerdem hat man im Herbst im Schwarzbach ein Wehr errichtet, damit „die hinlängliche Herbeyführung von Wasser für die Grube wie die Mühle des Ritterguts gewährleistet“ ist. Nach dem Fahrbogenvortrag am 31. Dezember 1831 in Annaberg fand die Vorgehensweise zur Beseitigung der Wetterprobleme die Zustimmung des Bergamtes (40169, Nr. 128, Blatt 41).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das folgende Jahr brachte dann den
Erfolg der vorbeschriebenen Ausrichtungsarbeiten: Herr Gebler war
in jedem Quartal hier, um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen,
dessen Menge zwar von Quartal zu Quartal zwischen 15 und 35 Fudern
schwankte, sich aber am Ende auf 100 Fuder summiert hatte (40014, Nr. 281, Film 0109,
0119, 0149 und 0159).
Darüber hinaus gibt es im Jahr 1832 nur zwei Fahrberichte zu dieser Grube in den Fahrbögen des Geschworenen (40014, Nr. 281, Film 0088 und 0151). Am 29. Oktober 1832 stand der Eisensteinabbau in 6 Lachter Teufe unterm Stolln und 6 Lachter vom Kunstschacht gegen Abend in Betrieb, wo man den Eisenstein „förstenweise“ aushaute. Das Lager beschrieb Herr Gebler hier als ½ Lachter mächtig und es „besteht aus Quarz, Horn, Mulm und sehr schönem schwarzbraunen Eisenstein.“ Den Stolln und den Kunstschacht fand der Geschworen in gutem Zustand vor und fand noch bemerkenswert: „In ihrem Umgange, der regelmäßig gut von statten gehet, bedarf diese Wasserhebungsmaschine nur überaus weniger Aufschlagewaßer, inmaßen dieselben in den dazu gehörigen Spundstücken bey 21 Zoll Weite kaum 1 Zoll hoch gehen.“ Ähnlich lauten auch die Fahrberichte des folgenden Jahres 1833. Am 1. April bauten hier 5 Mann in zwei Örtern 4 und 6 Lachter vom Kunstschacht auf der 6 Lachter- Sohle unter dem Stolln den Eisenstein ab (40014, Nr. 281, Film 0177f). Am 5. Juni 1833 heißt es, man baue jetzt in 6 Lachter Teufe unterm Stolln gegen Abend und Mittag Morgen „meistens strossenweise und niederzu“ ab. Der Bau dehnte sich 6 bis 8 Lachter lang aus. Der Stolln bedurfte wieder einmal der Instandsetzung, war nämlich auf mehreren Lachtern Länge „sehr wandelbar“ geworden, weswegen man Türstöcke auszuwechseln hatte (40014, Nr. 281, Film 0197f). Am 26. August 1833 fand Herr Gebler aber alles wieder „in gutem Stande.“ (40014, Nr. 281, Film 0215) Nach seiner Befahrung am 6. Dezember 1833 notierte er noch (40014, Nr. 281, Film 0215): „Um die Untersuchung des hier vorhandenen Lagers weiter fortzusetzen und sich fernerweite Gelegenheit zum Abbau zu verschaffen, hat man bey 8 Ltr Teufe unter dem Stolln aus dem Kunstschacht ein Ort gegen Mitternacht Abend angelegt, dasselbe zur Zeit gegen 4 Ltr erlängt, auch Eisenstein mit demselben angetroffen.“ Dasselbe wurde aber „wegen zu großen Wasserandrangs“ erstmal wieder eingestellt. Außerdem war der Geschworene in diesem Jahr noch fünfmal auf der Grube, um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen, dessen Gesamtmenge sich in diesem Jahr auf 80 Fuder summierte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch auf dieser Grube brachte der Winter 1833/1834 einige Probleme: So war der Tageschacht in seiner Zimmerung wandelbar geworden und mußte wiederhergestellt werden, was aber Herr Gebler bei seiner Befahrung am 15. April 1834 schon als jetzt beinah fertig befand. Wegen der immer noch „naßen Witterung“ konnte das Tiefste aber nicht betrieben werden und man baute deshalb auf der etwas höheren Sohle Eisenstein ab (40014, Nr. 289, Film 0022). Die nächste Grubenbefahrung fand hier am 26. Mai 1834 statt, jedoch fand der Geschworene „in der Hauptsache (...) wenig Abänderungen.“ Nur war immer noch „der Wasserzudrang auf der 6- und 8-Lachter- Sohle (...) bedeutend.“ (40014, Nr. 289, Film 0030) Selbst am 1. Juli 1834 war die tiefste Sohle noch nicht wieder zugänglich und man fuhr deshalb mit dem Abbau auf den in 4 und 5 Lachter unter dem Stolln gelegenen Försten- und Strossenbauen fort (40014, Nr. 289, Film 0037f). Im August waren schon wieder Reparaturen am Tageschacht erforderlich (40014, Nr. 289, Film 0047). Außerdem notierte der Geschworene in seinem Fahrbogen: „Da sich auf dem bey 4 Ltr. Teufe unter dem Stolln aus dem Kunstschacht gegen Abend vorhandenen Abbau die Anbrüche zu verringern angefangen haben, so wird man die Ausrichtung des Lagers vom Kunstschacht gegen Morgen vor die Hand nehmen, um daselbst vielleicht wieder zu einem ergiebigen Mittel zu gelangen.“ Noch aber reichten die Anbrüche für eine stabile Förderung aus: Herr Gebler war 1834 fünfmal auf der Grube zugegen, um insgesamt 95 Fuder Eisenstein zu vermessen. Im Jahr 1835 hat der Geschworene diese Grube am 24. März befahren, wobei allerdings nichts bemerkenswertes zu befinden war (40014, Nr. 289, Film 0081) und ein zweites Mal am 18. November 1835 (40014, Nr. 289, Film 0128). Der Abbau erfolgte wie bisher unter dem Stolln gegen Abend und der Eisenstein war „von der gewöhnlichen, sehr guten Beschaffenheit, auch hat sich daselbst wiederum ein Trümchen Braunstein eingefunden.“ Die von Herrn Gebler vermessene Menge ist allerdings im Jahr 1835 auf 55 Fuder gegenüber dem Vorjahr spürbar gesunken. Zumindest dieselbe Menge hat man hier auch im Jahr 1836 wieder ausgebracht. Fahrberichte zum Grubenbetrieb findet man allerdings in den Fahrbögen des Geschworenen aus diesem Jahr nicht. Aus dem nächsten Fahrbericht vom 25. Juli 1837 erfährt man dann, daß der Kunstschacht „sehr verletzt“ gewesen ist und repariert werden mußte, die Grube war daher nicht zu befahren (40014, Nr. 294, Film 0051f). Mit der Wiederherstellung war man auch noch im August 1837 befaßt (40014, Nr. 294, Film 0055). Am 24. Oktober 1837 hat Herr Gebler die Grube dann tatsächlich wieder befahren können und berichtete, der Eisensteinbau gehen nun 11 bis 12 Lachter vom Kunstschacht entfernt und nur noch ½ Lachter unter der Stollnsohle um (40014, Nr. 294, Film 0074). Auf Antrag des Schichtmeisters genehmigte das Bergamt am 5. Oktober 1837 außerdem, den Wochenlohn des Steigers Jlling um 3 Groschen auf nun 1 Thaler, 15 Groschen zu erhöhen (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 42). Ein Jahr später wurde der Steigerlohn mit Genehmigung des Bergamts vom 5. Juli 1838 nochmals um 3 Groschen auf nun 1 Thaler, 18 Groschen wöchentlich angehoben (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 44). Ferner war der Geschworene 1837 noch dreimal übertage auf der Grube zugegen, um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen, dessen Menge sich über das gesamte Jahr wieder auf 110 Fuder gesteigert hatte. Der letzte Fahrbericht aus der Feder Karl Gebler's datiert auf den 26. April 1838 (40014, Nr. 294, Film 0112f). Jetzt war die Grube mit 8 Mann und dem Steiger belegt und wurde „lebhaft betrieben.“ Der Abbau in 1½ Lachter Teufe unter dem Stolln gegen Mitternacht Abend und etwa 8 Lachter vom Kunstschacht entfernt stand in gutem Umgange. Der hier brechende Brauneisenstein war von vorzüglicher Güte. Von diesem waren bis zum 28. März 1838 bereits wieder 50 Fuder zutagegefördert. Um das zum Forttrieb des 3 Lachter- Streckenortes benötigte Ausbauholz zu erlangen, beantragte Schichtmeister Schubert am 26. Juli 1838 einen Vorgriff auf die Holzzuweisung für das Jahr 1838/1839 und schlug zugleich vor, aus dem bei Meyers Fundgrube noch vorhandenen Vorrat von 30 Stämmen 10 Stämme gegen Erstattung im nächsten Jahr zu übernehmen. Der Vorschlag wurde so auch am 28. Juli 1838 vom Bergamt genehmigt (40169, Nr. 128, Blatt 43). Nach Trinitatis 1838 besteht eine Lücke in diesen Überlieferungen, da Herr Gebler aus seinem Dienst ausgeschieden ist. Erst Reminiscere 1840 war die Funktion des Berggeschworenen dann mit Theodor Haupt neu besetzt (40014, Nr. 300).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue Geschworene hat diese Grube
bereits am 7. Januar 1840 befahren
und berichtete in seinem Fahrbogen, daß 8 Lachter nordwestlicher
Entfernung vom Kunstschacht über dem tiefen Stolln Förstenbau umgehe und
mit 3 Mann belegt sei (40014, Nr. 300, Film
0003f). Hier standen auch noch „hübsche
Anbrüche von Brauneisenstein“ an; wogegen das bei 14 Lachter
nordwestlicher Entfernung vom Kunstschacht in hora 9 bis 10 NW getriebene
Stollnort schon 2½ Lachter in Glimmerschiefer, ohne auch nur auf eine Spur
von Eisenstein zu treffen, erlängt worden ist. Es stehe aber auch nicht
ganz im Streichen des Lagers, daher hat er angeordnet, querschlagsweise
fortzugehen. Außerdem wolle man ein weiteres neues Ort im Lagerstreichen
vom Kunstschacht aus und „so tief als möglich“ treiben. Bei seiner nächsten Befahrung am 27. Januar 1840 (40014, Nr. 300, Film 0013f) fand der Geschworene einen Querschlag 16½ Lachter vom Kunstschacht aus hora 5,4 SW angesetzt, welcher aber wieder nur Glimmerschiefer durchfuhr, weshalb nun ein weiterer, noch einmal 2 Lachter zurück, angesetzt worden ist. Außerdem wurde 8 Lachter nordwestlich vom Kunstschacht und oberhalb vom Stolln ein Firstenbau betrieben. Seinem Fahrbogenvortrag in Annaberg kann man hierzu noch entnehmen, daß das Stunde 4 gegen Nordwest getriebene Ort von Eisenstein „ganz verlassen“ war, jedoch fortbetrieben werden solle, um ein in 50 Lachter Entfernung vorliegendes Eisensteinlager zu untersuchen. Dieses Lager habe man zu früherer Zeit bereits mit einem 8 Lachter tiefen Schacht ersunken, den Schacht jedoch der starken Wasserzugänge halber wieder verlassen müssen. Vonseiten des Bergamtes wurde diese Vorgehensweise ebenfalls für zweckmäßig erachtet (40169, Nr. 128, Blatt 45). So blieb es auch im März 1840 (40014, Nr. 300, Film 0034). Man betrieb neben dem Abbau zwei Versuchsörter: einmal bei 27 Ltr. Entfernung vom Kunstschacht nach NW und dann bei 8 Ltr. Entfernung nach NO. Bei seiner nächsten Befahrung am 6. April 1840 fand Herr Haupt nur noch diese beiden Versuchsörter in Betrieb vor, „um neue Eisensteinlager auszurichten.“ (40014, Nr. 300, Film 0040) Seine nächste Grubenbefahrung führte Herr Haupt hier am 15. Mai 1840 durch (40014, Nr. 300, Film 0059f). Es fuhren hier jetzt 7 Mann an und der Eisensteinbau über der tiefen Strecke stand noch immer in Umgang, die Anbrüche dort seien noch ziemlich mächtig, aber nur kurz. Deshalb „und umso dringender ist nun die Ausrichtung eines neuen Eisensteinmittels.“ Dazu wurden die beiden Versuchsörter „schwunghaft“ betrieben. Das vordere bei 8 Lachter vom Kunstschacht nach Nordost gehende schien dem Geschworenen „das aussichtsvollste zu seyn, indem man neuerdings ziemlich viel Wasser hereinkommen hat, welches den Mulm hereingeschoben und hiermit ziemlich viel Eisensteinbrocken gebracht hat.“ Am 19. Juni des Jahres war Herr Haupt erneut vor Ort und fand nun 8 Mann auf der Grube angelegt. In dem Förstenbau über der unteren Strecke sind die Anbrüche inzwischen „sehr gering“ geworden, weswegen man nun beabsichtigte, weiter in die Tiefe zu gehen und einen neuen Satz angehängt hat (40014, Nr. 300, Film 0070). Schon knapp einen Monat später war er erneut auf der Grube und berichtete in seinem Fahrbogen, daß „3 Mann auf dem Eisensteinbau liegen, um Eisenstein zu gewinnen und die übrigen 4 Mann theils zur Förderung, theils zum Abtreiben des Kunstschachtes unter der jetzigen tiefen Sohle verwendet werden. Bis jetzt ist der Schacht bereits 3 Lachter tief abgetrieben und soll damit bis auf deßen Vorgesümpfe fortgefahren, sodann eine tiefere Strecke zur Etablierung neuen Eisensteinabbaus getrieben werden.“ (40014, Nr. 300, Film 0078f) Das nächste Mal ist der Geschworene am 3. August 1840 auf Gnade Gottes angefahren (40014, Nr. 300, Film 0087). Noch immer waren drei Mann in dem Förstenbau über der tiefen Sohle vom Kunstschacht in Nordwest beschäftigt, wo aber die Anbrüche immer noch mehr abgenommen hätten. Mit dem Abtreiben im Kunstschacht stand man noch bei 3 Lachter Teufe, wo bereits früher eine Strecke getrieben worden ist. Man gedenke daher, noch 1 Lachter Schachtteufe abzutreiben, um Sumpf zu erhalten und sodann gedachte Strecke, „die vom Schacht in West ungefähr 4 Lachter in West und von da 5 Lachter in NW. getrieben seyn soll, aufzugewältigen und weiter in NW. zu treiben, um die über der jetzigen Strecke abgebauten Eisensteinmittel in tieferer Sohle aufzusuchen.“ Am 3. September diesen Jahres war der alte Firstenbau wegen Mangel an Anbrüchen nun verlassen. Man hatte aber 9 Lachter weiter nordwestlich mittels Überhauen einen neuen etabliert, wo der Eisenstein zwar von guter Beschaffenheit, aber weder mächtig noch ausdauernd im Streichen war. Außerdem war der Kunstschacht nun bis 7½ Lachter unter dem Stolln neu ausgezimmert, hier werde nun in 6 Lachtern Teufe ein Ort, zum Teil in altem Mann, hora 8,6 nach Nordwesten getrieben und damit hatte man hier auch etwas Braunstein angefahren (40014, Nr. 300, Film 0103ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Luciae 1840 bis Anfang Reminiscere
1841 hat Herr Haupt vermutlich andere Aufgaben zugewiesen bekommen.
In dieser Zeit wurde er von dem Raschau'er Schichtmeister Friedrich
Wilhelm Schubert in seiner Funktion als Geschworener vertreten. Dieser
verschaffte sich wohl zunächst gründlich einen Überblick und berichtete
dann recht ausführlich (40014, Nr. 300, Film 0117f),
am 12. Oktober 1840 „habe ich die Grube Gnade Gottes gev. Fdgr.
befahren.
1.) Bei 6 Ltr. unterm Stolln wird mit 6 Mann in dreytrittel das etwa 8 Ltr. hora 9 westlich vom Kunstschachte bis an ein überfahrenes 0,1 Ltr. mächtiges Braunsteinlager erlängte Versuchsort betrieben, welches durch dem zudrängende Wasser wiederum auf ein 2 elligtes Getrieb vertrückt worden und mußte durch Vorsetzen und Abspreitzen einstweilen verwahrt und eingestellt werden, bis diejenigen Waser, welche 3 Ltr. höher von einer ähnlichen Strecke (...?) abgefangen und verfluthert sind, als dann soll ersteres wieder in Angriff genommen und bis an das in oberer Teufe bekannte Eisensteinlager fortgebracht werden. 2.) Auf nur bemerktem 6 Ltr. Ort bei 5 Ltr. westlich vom Kunstschachte ist ein 0,2 Ltr. mächtiges Braunsteinlagertrum überfahren worden, auf welchem gegen Ost ein Ort als Ab- und Versuchbau ausgelängt werden soll. 3.) Bei 3 Ltr. unterm Stolln ist das Eisensteinlager in 9 – 10 Ltr. südl. vom Kunstschachte förstweise bis untern Stolln völlig abgebaut und daher auch sämtliche Baue eingestellt. 4.) Nachdem ich bei genauer Beobachtung des Kunstgezeugs wahrgenommen, daß dasselbe im Sumpfe 1,0 Ltr. unter der 6 Ltr. Strecke von der Sohle (schwankte?) und dadurch viel Sand einschlürfte, wurde bemerklich, daß solches nachtheilige Folgen für das Lederwerk, ja selbst auch für sämtliche Maschinentheile haben können. ZU Beseitigung dieses Nachtheils habe ich angerathen, den Schlauch wenigstens 1 Elle abzukürzen, damit sich die Schlämme und Sandtheile im Sumpfe niederschlagen und die Wasser abfallen können, welches der Steiger zu bewerkstelligen versprach. Der Steiger und 1 Mann sind mit der Unterhaltung beschäftigt. Die Belegung besteht in (...) 8 Mann.“ Das in 6 Lachtern Teufe stark zusitzende Wasser erwies sich danach als großes Problem, und nach seiner nächsten Befahrung am 28. Oktober 1840 (40014, Nr. 300, Film 0122f) hatte Herr Schubert in seinem Fahrbogen „zu bemerken, daß bei 7,4 Ltr. westlich vom Kunstschachte von der 6 Ltr. Strecke bis auf der 3 Ltr. Strecke hinaus einen Bruch gemacht hat; die Ursache des Bruches ist wahrscheinlich der Zutrang der jetzt häufigen Tagewässer, welche seit längerer Zeit das dortige Eisensteinmulmlager durch das lang anhaltende Regenwetter angesaugt und laufent gemacht. Indem mittelst der 6 Ltr. Strecke bei nur noch etwa 3 Ltr. Auffahren das schon auf der 3 Ltr. Strecke bekannt gewesene Eisensteinlager erreicht und hoffentlich bauwürdig ausgerichtet werde, so habe ich Veranstaltung getroffen, den Betrieb der 6 Ltr. Strecke auf Sechsstundenarbeit mit der ganzen Mannschaft, welche incl. des Steigers in 8 Mann besteht, zu betreiben und sollen nöthigen Falles Ledigeschichten verfahren werden, um sobald als nur möglich, mit allem Schwunge durch diesen Lastpunkt mit Hilfe doppelter Thürstockzimmerung durch zu kommen und den Zweck zu erreichen. Ferner war man auf der 3 Ltr. Strecke etwa 1 Ltr. von nur gedachten Bruche zurück beschäftigt, ein Versuchsort hora 12,4 gegen Süd auf dem dort übersetzenden Braunsteinlagertrum aufzufahren, auch ist in dem untergelagerten Eisenmulm nierenweise Eisenstein enthalten. Indem es mir gefährlich erschien, dieses Ort in der Nähe eines so bedeutenden Bruches weiter fortzustellen, so ertheilte ich ferner die Anordnung, den Ortsbetrieb solange einzustellen, bis mit der 6 Ltr. Strecke das Eisensteinlager ausgerichtet und dieselbe gut und tüchtig mit Zimmerung verwahret ist. Mit Beschluß des hier gegenwärtigen Herrn Schichtmeisters Schuberts und Steiger Jllings ist der 6stündige Betrieb... unausgesetzt bis zur Erreichung des Eisensteinlagers fortgesetzt und dem Steiger die größte Sorgfalt hierbei anzuwenden anempfohlen worden.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Herr Schubert in seiner Funktion als Geschworener mit seinen Festlegungen in den Grubenbetrieb eingegriffen hatte, stand er natürlich auch in der Pflicht, die Umsetzung seiner Anweisungen zu prüfen. Am 9. November 1840 fuhr er daher alsbald auch wieder an (40014, Nr. 300, Film 0124), „um die getroffene Betriebsveranstaltung zu refitiren (Bei diesem Wort mußte ich länger nachdenken, aber er meinte: ,revidieren').“ Dabei fand er aber, daß Steiger Jlling der Anweisung entgegen das Ort aber nur in drei Dritteln belegt hatte, weswegen Schubert „Eu. Wohllöbl. Bergamt (bat), demselben hierüber zurechtzuweisen. Bei dieser Arbeit ist der Zutrang des Wassers so häufig, daß die Arbeiter in nur kurzer Zeit durch und durch vernäßt sind und demnach nicht zwei 8stündige Schichten, wie es vom Steiger veranstaltet, zu verfahren imstande sind.“ Übrigens solle zwecks besseren Wetterwechsels die Wetterlutte im Kunstschacht bis auf diese Sohle geführt werden. Hierzu trug Herr Schubert am 21. November 1840 auch im Bergamt Annaberg vor, wobei man sich mit den von ihm getroffenen Veranstaltungen vollkommen einverstanden erklärte (40169, Nr. 128, Blatt 54). Wegen der abweichend von den Festlegungen des Geschworenendienst-Versorgers getroffenen Belegung wollte man Steiger Jlling selbst befragen und bestellte diesen für den 7. Januar 1841 ins Bergamt ein. Zu diesem Termin gab der Steiger an, daß er dieser Anweisung „mit der ihm zu Gebote stehenden Mannschaft nicht durchzuführen vermöge,“ worauf das Bergamt ihn anwies, er solle „einige tüchtige Zimmerlinge von anderen Gruben adhibiren.“ (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 56) Wo es einmal nicht so lief, wie von ihm angeordnet, war Herr Schubert auch gleich 14 Tage darauf erneut vor Ort (40014, Nr. 300, Film 0133), „um den Betrieb der 6 Ltr. Strecke zu refitiren (revidieren), wider Erwarten fand ich die Abtreibe Zimmerung zusammengedrückt und deswegen das Ort verlassen, bei 1,8 Ltr. vom Ortstoß zurück in hora 12 gegen Nord 1,8 Ltr. sowie dann hora 10,4 fernerweit 1,8 Ltr. in Nord... ein Umbruchsort vom Steiger veranstaltet und betrieben worden.“ Hier kam leider genausoviel Wasser an, wie auf dem anderen Ort und der Gebirgsdruck hatte auch nicht abgenommen. Schubert schlug deshalb wieder eine Verfluterung der 3 Lachter- Sohle vor, um wenigstens die Wasser an dem zubruchgegangenen Abbau vorbei zu leiten. Aber alles kam zu spät: „Sonnabends, den 28sten Nov. (1840) als ich auf Riedels gev. Fdgr. zu Langenberg war, kam Steiger Jlling von Gnade Gottes Fdgr. auf dem Ausfahrwege zu mir und zeigt an, daß in der letzten Nachtschicht auf der 6 Ltr. Strecke bei Gnade Gottes bedeutende Wasser gewaldig vor dem Orte heraus gestürmt, die Arbeiter um deswegen die Flucht zu ergreifen nothgetrungen gewesen wären, es hätte sogar die Gewalt des Wassers den Laufkarrn auf der Strecke bis zum Kunstschachte vorgeschoben. Auf genaues Befragen versicherte derselbe, daß zur Zeit die Zimmerung noch ohne Verrückung fortstehe und die Wasser nachgelassen hätten. Hierauf machte ich demselben abermals aufmerksam, alle nur mögliche Vorsicht als auch alle Kräfte aufzubieten, mit dem eiligsten Schwunge in 6stündigen Schichten fortzufahren und muthig das Ziel zu erringen suchen und hiermit das nahe vorliegende Eisensteinlager durch Gottes Hülfe bauwürdig auszurichten.“ (40014, Nr. 300, Film 0134) Zum Glück ist bei diesem Wassereinbruch niemand zu Schaden gekommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl die Grube Gnade Gottes
doch eigentlich hinsichtlich ihres schon langen Betriebes und ihrer
technischen Ausstattung, mit Stolln und Wasserkunst, weit über die
Eigenlehnergruben am südlichen Gegenhang des Schwarzbachtales zu stellen
und der Grube Vater Abraham bei Oberscheibe durchaus vergleichbar
ist, hielt nun das Pech weiter an. Wohl deshalb fand auch Schichtmeister
Schubert nach seiner Befahrung am 3. Dezember des Jahres 1840 eher
wenig lobende Worte in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 300, Film 0138f),
vielmehr „zu berichten, daß
1.) das Kunstgezeug in Ermanglung der nicht in die Radstube gedämmten warmen Stollnwasser, durch das eingewachsene Grundeis angefroren gewesen, wurde durch 4 Mann Arbeitern losgeeist und kam gegen 11 Uhr dasselbe wieder zum Umgang. 2.) Nachdem bei 11 Ltr. nordwestlicher Entfernung vom Stollenmundloche ein Förstenbruch wahrgenommen worden, mußten die Kunstsätze solange abgelegt werden, bis der Bruch aufn Stolln wiederum beseitigt ist. 3.) Ist seit No. 11te Woche die Gewältigung der 6 Ltr. Strecke eingestellt, weil das Mulmgebirge abermals laufend und dadurch das fernerweite Forttreiben beschwerlicher geworden, so hat der Steiger die weitere Gewältigung für bedenklich und unmöglich geachtet. Obgleich einige Pfähle und Thürstöcke gebogen und zersprengt sind, so darf man solches nicht alles dem Druck zuschreiben, sondern es ist wohl auch das unpassend zu schwache Holz als Ursache anzusehen...“ Man solle lieber „starcke Schwardten oder 1¾ zölligte Pfosten“ für die Pfändung und statt „kaum 7 bis 8 Zoll starken Thürstöcken wenigstens 8 bis 10 Zoll starke“ nehmen. Außerdem schimpfte Herr Schubert wieder, der Steiger hielte sich nicht an seine Anordnungen und habe nicht nur die Belegung zu anderen Zwecken eingesetzt, sondern sogar noch ein Versuchsort in der 3 Lachter- Sohle gegen Ost treiben lassen, um damit „an ein von den Vorfahren in gegen 50 Ltr. Entfernung über Tage verlassnen Tageschacht, in welchem wegen häufigen Wasserzudrang Eisenstein verlassen sein soll, zu gelangen.“ Die Verzweiflung muß schon groß gewesen sein, denn seit Sommer 1840 waren die Gewinnungsbaue in Ermanglung weiterer Anbrüche ja inzwischen schon eingestellt. Aber auf Dauer konnte sich auch Steiger Jlling den Anweisungen des Bergamtsvertreters nicht widersetzen und so fand Herr Schubert bei seiner Befahrung am 15. Januar 1841 (40014, Nr. 300, Film 0145) dann endlich seinen Anordnungen zufolge die 6 Lachter- Strecke jetzt in 6-Stundenschichten mit 12 Mann belegt und man stellte dort den Ausbau wieder her. Man hatte zu diesem Zweck also auch die Belegschaft aufgestockt. Auch der Bruch im Stolln war gewältigt. Noch einmal war Herr Schubert in Vertretung des Geschworenen am 8. Februar 1841 auf der Grube und berichtete danach (40014, Nr. 300, Film 0151), die 3 Ltr.- Sohle sei nun auf 5 Ltr. Länge gewältigt und in Türstockzimmerung gesetzt. Noch unklar sei aber, ob sich die Wasser auf die 6 Ltr. Strecke niederziehen werden. Die tiefe Sohle hatte man aber wieder sistiert und stattdessen ein neues Versuchsort auf der 3 Ltr. Strecke vom Kunstschacht hora 2,7 gegen Nord angeschlagen. Dort „sieht (es) sehr freundlich aus, neue Eisensteinlager auszurichten.“ Auf den hier geschilderten Stand vom Februar 1841 geht der folgende Grubenriß zurück, gefertigt vom Markscheider Friedrich Eduard Neubert. Leider ist es der einzige Riß, den wir zu dieser Grube bisher auffinden konnten und der Stollnverlauf ist darin nur teilweise und nicht bis zu dessen Mundloch dargestellt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
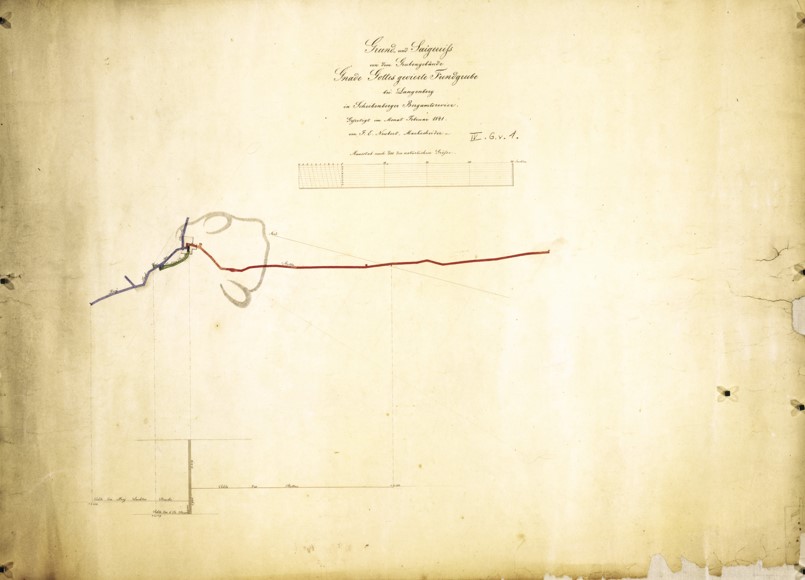 Grund- und Saigerriß über das Berggebäude Gnade Gottes gevierte Fundgrube bei Langenberg, gefertigt im Monat Februar 1841 von F. E. Neubert, Markscheider. Leider ist nur ein Teil des stollnverlaufs dargestellt - die Lage des Mundlochs fehlt... Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (Fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. i7108, Gesamtansicht, Norden ist links oben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
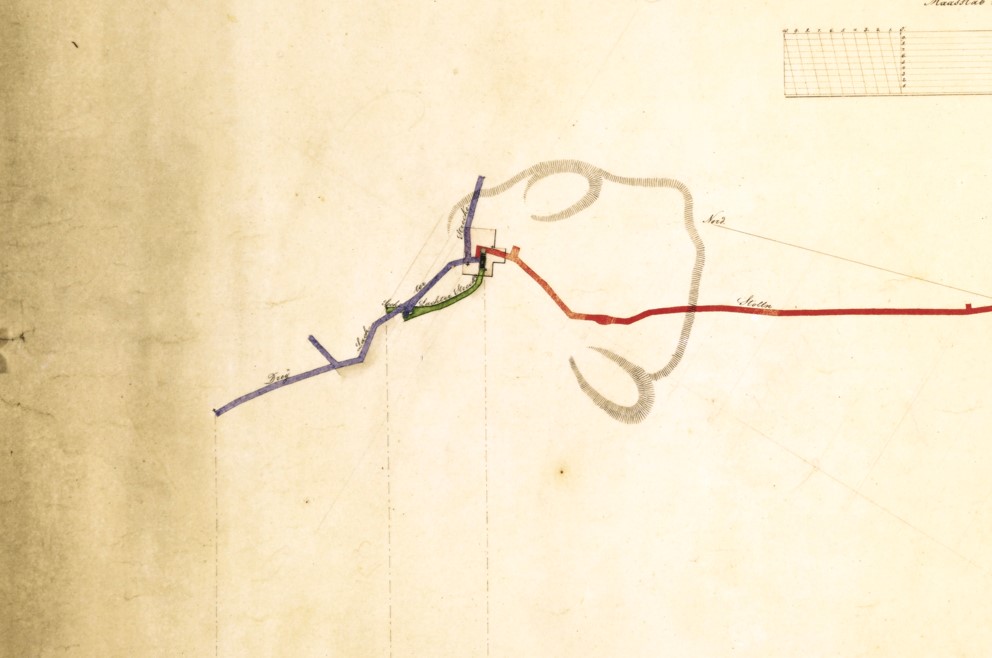 Ausschnitt aus obigem Grundriß, darin rot: Stollnsohle, blau: 3 Lachter- Sohle, grün: 6 Lachter- Sohle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im März 1841 war dann Herr Theodor
Haupt selbst wieder in Scheibenberg und hat die Grube am 26. März auch
gleich befahren (40014, Nr. 300, Film 0160).
Da man die tiefe Sohle wieder außer Betrieb gestellt hatte, war nur noch
die Stammbelegschaft von 8 Mann angelegt. Auch er beklagte danach in
seinem Fahrbogen:
„Leider hat man aber seit zwei Quartalen keine Anbrüche von Eisenstein auf dieser Grube und betreibt zur Aufsuchung neuer Eisensteinmittel in der 3 Lachter- Sohle ein Ort hora 2,4 – 2,7 mit 6 Mann. Vom Kunstschachte aus ist es nun gegen 15 Lachter erlängt und steht jetzt halb in gelbem, halb in schwarzem Mulm. In ersterem haben sich kürzlich auch einige Spuren von Eisenstein gefunden und ist deshalb dieser Ortsbetrieb nicht ohne Hoffnung, da mit 5 – 6 Lachter mehrer Erlängung dasselbe denjenigen Punct unterteufen wird, wo ehemals von oben Eisenstein gefunden, aber wegen Wasserzudrangs verlassen worden sein soll. Die tiefe 6 Lachter- Strecke ist seit Jahresschluß wegen Zudrang von Wasser und dem daraus entspringenden heftigen Gebirgsdruck außer Betrieb.“ Schon 14 Tage später war Herr Haupt erneut vor Ort, um sich vom Fortgang der Arbeiten zu überzeugen und berichtete (40014, Nr. 300, Film 0165f), das Versuchsort stehe in höchst gebrächem Mulm, „worin etwas Hornstein einbricht, der hier immer als Vorbote des Eisensteins angesehen wird.“ Auch der Wasserzudrang nahm aber wieder zu. Das nächste Mal ist der Geschworene am 27. Mai 1841 hier wieder angefahren und gleich nochmals am 28. Mai gemeinsam mit Schichtmeister Schubert (40014, Nr. 300, Film 0183). Jetzt hatte man das Versuchsort bei 3 Lachter Teufe unterm Stolln, leider ohne Eisenstein auszurichten, aber auch wegen des Wasserzudrangs nach 20 Lachtern Länge wieder verlassen. Stattdessen wurde nun die 6 Lachter- Strecke wieder in Angriff genommen. Außerdem wolle man 22 Lachter nordöstlich vom Kunstschacht einen neuen kleinen Tageschacht schlagen. Am 9. Juni 1841 fand die nächste Befahrung statt (40014, Nr. 300, Film 0187). Das 6 Lachter- Streckenort wurde nun umbruchsweise nach Norden weitergetrieben und stand mit einer Ulme in Mulm, mit der anderen in ganz zu Ton aufgelöstem Glimmerschiefer. Beim Vortrieb hatte man schon nach 1 Lachter weiterer Erlängung ein, wenn auch nur 2 bis 3 Zoll starkes, Eisensteinlager angefahren. Von seiner Befahrung am 26. Juli 1841 schließlich heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 300, Film 0204f), die 6 Lachter Strecke habe man noch um 6 Lachter fortgestellt, jetzt aber ‒ diesmal aber wegen Wettermangel ‒ wieder eingestellt. Zunächst werde nun von der 3 Lachter Sohle ein Gesenk, etwa 15 Lachter nordwestlich vom Kunstschacht, auf die untere Sohle durchgeschlagen, um dem Wettermangel abzuhelfen. Dabei hatte man nun endlich auch wieder Eisenstein von guter Qualität gefunden. Schließlich ging auf Betschichten auch noch ein Ort hora 8 Südost in der Stollnsohle um, mit dem das Gebirge in dieser Richtung untersucht und der „der Sage nach“ dort vorkommende Eisenstein ausgerichtet werden sollte. Hierzu gab es am 31. Juli 1841 wieder einen Fahrbogenvortrag im Bergamt zu Annaberg (40169, Nr. 128, Blatt 57). Dem Protokoll ist noch zu entnehmen, daß der Geschworene zugleich Gelegenheit genommen habe, die Grubenvorsteher anzuweisen, den Vortrieb der 6 Lachter- Strecke tunlichst zu beschleunigen, um das unter der 3 Lachter- Strecke ersunkene Eisensteintrum „einzuholen und abbauen zu können.“ Noch einmal war Herr Haupt am 16. August 1841 auf der Grube, danach wurde er erneut zu anderen Aufgaben abgeordnet. Dabei fand er das Gesenk 15½ Lachter nordwestlich vom Kunstschacht im Abteufen begriffen vor. Das Lager war dort ½ Lachter mächtig, strich hora 10 und fiel wechselnd steil in Ost. Dabei erschwerte der Wasserzudrang das Absenken, so daß das Gesenk erst ½ Lachter niedergebracht war (40014, Nr. 300, Film 0221f). Auf dem Versuchsort hora 8 gegen Südost wurden außerdem von jedem Mann pro Woche ein bis zwei Betschichten verfahren, so daß dieses jetzt 6 Lachter fortgebracht war. Bei 4½ Lachter hatte man damit ein 1 Fuß mächtiges Brauneisensteinlager überfahren, was man später förstenweise untersuchen wollte, und bei 5½ Lachter hatte man wieder einmal „alte Arbeit durchfahren“. Hauptsächlich aber wollte man mit diesem Ortsbetrieb die östliche Fortsetzung des Lagers erschließen. Auch dazu trug Herr Haupt am 28. August 1841 wieder in Annaberg vor, wo man nicht umhinkam, „diesen Betrieb als zweckmäßig zu erachten.“ (40169, Nr. 128, Blatt 58)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während seiner Abwesenheit ab Herbst
1841 nahm die Funktion des Geschworenen im Bezirk des Bergamtes
Scheibenberg diesmal der Annaberg'er Rezeßschreiber Julius Magnus Lippmann wahr.
Dieser ist gleich am 2. September des Jahres auf dieser Grube angefahren und berichtete in seinem Fahrbogen darüber (40014, Nr. 300, Film 0233f), daß das Abteufen in Betrieb stand und jetzt in Sechs-Stundenschichten mit je 2 Mann belegt war. Inzwischen war es 1 Lachter tief. Das hier 60° fallende Lager war im südöstlichen Stoß des Gesenks auf nur noch ¼ Lachter zusammengedrückt und der Wasserzudrang über das „offenklüftige Lager“ war so stark, daß man von nun an einer Drückelpumpe bedurfte; außerdem erschwerte Wettermangel das Teufen. Im Kunstschacht war die Wasserhaltung in Betrieb: „Das Kunstgezeug hebt von der 6 Lachterstrecke weg, worunter noch 2 Lachter Sumpf stehen.“ Um dieses Programm umzusetzen, bedurfe es wieder lediger Schichten. Etwas Eisenstein brachte man dabei immerhin zutage, und 1 Mann war mit dessen Ausschlagen befaßt. Das Versuchsort war dagegen bei derzeit 7,3 Lachter Länge vorläufig wieder eingestellt. Anfang Oktober 1841 war das Kunstgezeug abgeschützt, weil der Aufschlaggraben geschlämmt wurde (40014, Nr. 300, Film 0248). Herr Lippmann fuhr deshalb am 19. Oktober wieder an. Jetzt waren mit dem Abteufen 2,6 Lachter Teufe erreicht; die eindringenden Wasser aber „haben sich eher vermehrt, als vermindert.“ Das Versuchsort hora 8,0 nach SO. auf der Stollnsohle war dennoch inzwischen 10 Lachter fortgestellt. Aufgrund der Arbeit im Abteufen „haben die Arbeiter aber wenig Lust auf Betschichten.“ (40014, Nr. 300, Film 0254f) Bei seiner nächsten Befahrung am 10. November 1841 fand Herr Lippman das Versuchsort „in einzelnen Betschichten“ nochmals um 1 Lachter vorgerückt; es stand aber ganz in aufgelöstem Glimmerschiefer, während sich zuletzt noch Mulm gezeigt hatte (40014, Nr. 300, Film 0260f). Das Abteufen stand 3,2 Lachter unterhalb der 3 Lachter- Strecke. Man hatte nun bei 3,0 Lachter ein Ort im südöstlichen Stoß angesetzt und dieses bereits 0,6 Lachter getrieben, dann aber wieder sistiert, weil der bessere Wetterwechsel die Wiederaufnahme der Arbeit auf der 6 Lachter- Strecke erlaubte und die Förderung von dort aus natürlich einfacher war. Nur die Wasserhaltung im Abteufen wurde aufrechterhalten, weil „der aufgelöste Mulm leicht schwimmend werden und dadurch, wie es schon früher der Fall gewesen, den Betrieb wo nicht gänzlich verhindern, doch außerordentlich erschweren könnte.“ Ja, wir erinnern uns... Bei zirka 6 Lachter weiterer Länge des tieferen Streckenorts werde man in das Abteufen durchschlagen, bereits bei 2 Lachtern Länge aber auch in das auf der 3 Lachter- Sohle schon bekannte Eisensteinlager einkommen. Aufgrund der Belegung in vier Schichten rückte das Ort pro Schicht um „ein Getriebe zu 2 Ellen“ fort. Über diese Arbeiten berichtete Herr Lippmann am 27. November in Annaberg (40169, Nr. 128, Blatt 59). Am 9. Dezember 1841 ist der Geschworenendienstversorger erneut auf Gnade Gottes angefahren (40014, Nr. 300, Film 0269f). Allerdings mußte der Betrieb der 6 Lachter- Strecke jetzt „wegen höchst nöthigen Auswechslung von 24 Ellen Fluthern und dreier Dachbalken in der Radstube auf 1 Woche eingestellt werden.“ Das tiefe Streckenort war nun 13 Lachter vom Kunstschacht weg erlängt und man hatte damit ein 6 bis 8 Zoll mächtiges Brauneisensteinlager überfahren, welches hora 12,0 streicht und unter 60 Grad in Morgen fiel; „es ist dieß, wie man aus dem Betrieb der 3 Lachter- Strecke weiß, ein Begleiter des in jener Sohle übersetzenden und mehr als ¼ Lachter mächtigen Lagers.“ Schließlich konnte Herr Lippmann am 23. Dezember 1841 noch mitteilen, daß am 21. Dezember der Durchschlag der 6 Lachter- Strecke bei 16,5 Lachter Länge in das Abteufen glücklich erfolgt war. Das im Abteufen noch 2½ Lachter hoch stehende Wasser drückte sich zuvor erst dann in die Strecke durch, als nur noch 0,1 Lachter starker Pfeiler am Stoß des Abteufens stand. Man werde nun vom Abteufen aus das erschlossene Lager durch Streichörter aufschließen und zum Abbau vorrichten. Mit dem Versuchsort nach Südosten hatte man wieder ein Mulmlager angefahren, das völlig schieferungsparallel zum Glimmerschiefer lag. Über den Durchschlag des Gesenks und das Anfahren des Mulmlagers mit dem Versuchsort informierte Herr Lippmann in seinem Fahrbogenvortrag am 30. Dezember 1841 auch das Bergamt (40169, Nr. 128, Blatt 60).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das nächste Mal war Herr Lippmann
dann am 20. Januar 1842 auf der Grube und berichtete
davon
(40014, Nr. 321, Film 0006f),
man habe nun das mittägliche Streckenort auf der 6 Lachter- Sohle in hora 12 angehauen und 2 Lachter fortgebracht. „Da man aber mit dieser
Richtung, veranlaßt durch ein abgehendes Seitentrum des Lagers, das
eigentlich hora 10,4 streichende und 60 Grad in Mitternacht Morgen
fallende Lager aus dem Ort verloren hat, so erging die Anweisung, sich mit
dem Orte in das... Streichen des circa 0,25 Lachter mächtigen Lagers zu
wenden. Nächstdem wird nunmehro auch das mitternächtliche Streckenort aus
dem Gesenk angehauen werden...“ Zuvor hatte man noch das Verstürzen
eines in der 6 Lachter- Sohle getriebenen, brüchig und entbehrlich
gewordenen Versuchsortes beendet.
Das Versuchsort in der Stollnsohle hora 8 gegen SO. war inzwischen 14 Lachter erlängt. Ab 13 Lachter wurde der Glimmerschiefer härter „und zugleich erscheint derselbe hier auf allen Schichtungs- und andern Klüften mit Braunstein beschlagen. Bei 13,7 Lachtern hat man wieder ein Lager von schwarzem Mulm mit dem unteren Theile des Ortes erreicht...“ Von seiner Befahrung am 11. März 1842 heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 321, Film 0019f), das nordwestliche Ort in der 6 Lachtersohle vom Durchschnittsschächtchen aus sei nun 3 Lachter hora 9,2 fortgestellt und „Der am Ortstoß anstehende Eisenstein ist 0,25 Lachter mächtig und fällt unter 65 Grad in Mittag Abend, das Trum wird in und unter der Ortsohle noch mächtiger...“ Das Streichen wende sich noch weiter in hora 8 NW, wohin man weiter fortgehen wolle. Das Versuchsort in der Stollnsohle hatte man ebenfalls fortgestellt und es war nun 18 Lachter erlängt. Außer Trümern eines „Mulmlagers“ hat man hier aber noch gar nichts abbauwürdiges ausgerichtet. Den bis dahin noch ausgebrachten Eisenstein hat Herr Lippmann am 31. März 1842 „an das Hammerwerk Erlahammer“ vermessen (40014, Nr. 321, Film 0028). Natürlich war die Förderung gegenüber den Vorjahren, in denen man hier regelmäßig zwischen 75 und 150 Fudern Eisenstein ausgebracht hatte, ausweislich der Erzlieferungsextrakte im ganzen Jahr 1842 auf nur noch 65 Fuder abgesunken (40166, Nr. 22 und 26). Zu diesem Stand der Arbeiten trug der Geschworenendienstversorger am 2. April 1842 in Annaberg vor (40169, Nr. 128, Blatt 61). Am 7. April dieses Jahres genehmigte man auf Antrag von Schichtmeister Schubert im Bergamt Scheibenberg auch eine Lohnerhöhung für Steiger Jllig für die Kunstgezeugwartung (40169, Nr. 128, Blatt 62). Aufgrund des auch in Sachsen ab 1841 eingeführten 14- Thaler- Münzfußes hatte man bereits am 30. Dezember 1840 die Löhne neu festgesetzt (40169, Nr. 128, Blatt 56). Schichtmeister Schubert erhielt für seine Tätigkeit auf Gnade Gottes seitdem 15 Neugroschen pro Woche, der Steiger der Grube von 1 Thaler, 28 Neugroschen pro Woche zuzüglich 3 Neugroschen „Kunst- Ledergeld á Satz.“ Letzteres wurde nun um 5 Pfennige pro Woche angehoben. Die nächste Grubenbefahrung unternahm Herr Lippmann am 19. April 1842 (40014, Nr. 321, Film 0030f). Darüber steht im Fahrbogen zu lesen, auf der 6 Lachterstrecke nach Nordwesten „hat sich das Trum ausgekeilt“ und deshalb sei nun das unmittelbar am Durchschnittsschachte in hora 2,2 NO. aufsetzende, 0,3 Lachter mächtige Eisensteintrum angegriffen worden. Das Versuchsort vom Kunstschacht hora 8 SO. auf der Stollnsohle war inzwischen 21 Lachter ausgelängt. Der bisher zwischen 20 und 30 Grad in NW fallende und bedeutend aufgelöste Glimmerschiefer hat erst eine ziemlich söhlige Lagerung und ab 20 Lachter nun ein südöstliches Fallen angenommen. Dort liegt wieder ein schwarzen Mulmlager darauf. Herr Lippmann stellte die Aufschlußsituation anhand einer Skizze der linken Ulme dieser Strecke am Rand seines Textes bildlich dar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferner war an diesem Tage noch zu vermelden:
„Wegen behufig zu ergreifender Maßregeln kann ich in Betreff dieser
Grube beim Kgl. Bergamt nicht unangezeigt lassen, daß (?) der
Grundeigenthümer, der Bergschmiedemeister Dürr auf Gottes Geschick, ohne
eingeholte Erlaubniß und ohngeachtet des ihm jährlich seitens der Grube
gewährten Abtrages, von der Gnade Gotteser Halde einen Flächenraum von 21
Lachter Länge und 7,5 Lachter Breite, also von circa 157 Quadratlachter
eingeebnet hat.“ (40014, Nr. 321, Film 0031)
Über diese Erkenntnisse zur Gesteinslagerung trug Herr Lippmann am 30. April 1842 wieder in Annaberg vor (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 62). Im Hinblick auf die durch den Schmiedemeister Dürr vorgenommene Haldeneinebnung heißt es im diesbezüglichen Bergamtsprotokoll, dies sei nicht zu genehmigen, weil „sich darunter alte Preßbaue befinden.“ Es wurde aber resolviert, ihn erstmal „zuvörderst zu vernehmen.“ Von seiner nächsten Befahrung am 19. Mai 1842 berichtete Herr Lippmann dann (40014, Nr. 321, Film 0040ff), das hora 2,2 vom Durchschnittsschacht angegriffene Trum habe sich schon nach 1 Lachter Länge ausgekeilt „und sind daher die Hoffnungen, die auf den Abbau dieser beiden hier ersunkenen Trümer gebaut waren, vollständig vernichtet.“ Stattdessen hatte man nun das bei 13 Lachter vom Kunstschacht aus überfahrene, nur 8 Zoll mächtige Trum in Schlag genommen und hora 1 NO. bereits 2 Lachter ausgelängt, dabei „dieses Trum immer mächtiger ausgerichtet.“ Es stand nun im Ortstoß 0,25 Lachter mächtig an. Zu bemerken war noch, daß in dieser Sohle wieder Wettermangel eintrat, mithin der Betrieb nicht mehr lange aufrechtzuerhalten sei. Auch der Stolln verlangte erneut einige Auswechslung seines Ausbaus... Außerdem wurde das Versuchsort in der Stollnsohle auf nunmehr 22,5 Lachter nach SO. fortgestellt. „Meines unmaßgeblichen Dafürhaltens wird es zweckmäßig seyn, dieses Ort regelmäßig, wenn auch nur mit 1 Mann, in Belegung zu halten, um das damit verfolgte Ziel, die in einigen und 40 Lachter Entfernung vom Kunstscahchte mit vieler Gewißheit zu vermuthende vorliegende Eisensteinablagerung, schneller zu erreichen, denn die jetzigen Aussichten in der 6 Lachtersohle lassen eine recht baldige Auffindung eines neuen Mittels in frischem Feld lebhaft wünschen.“ Auch darüber trug Herr Lippmann auf der Bergamtssitzung am 28. Mai 1842 wieder vor (40169, Nr. 128, Blatt 64). Ja, was soll man dazu sagen: Die Suche nach neuem Erz wurde immer verzweifelter. Was man noch fand, hat Herr Lippmann am 17. Juni 1842 wieder an das Hammerwerk Erla vermessen. Anschließend erfolgte durch ihn noch eine Befahrung der Grube (40014, Nr. 321, Film 0046f), „insoweit es möglich war, denn der stattfindende Wettermangel erlaubte mir nicht, den in der 6 Lachtersohle befindlichen Eisensteinbau zu beaugenscheinigen.“ Man hatte das Versuchsort nach Südosten mit allen Kräften belegt und auf 25 Lachter vom Kunstschacht aus fortgestellt. „Der Glimmerschiefer stürzt sich abermals ein“ ‒ siehe die Skizze oben ‒ und fiel hier zirka 60 Grad in NW. Dort hatte man ein gelbes Mulmlager angetroffen; dahinter stellte sich der Glimmerschiefer fast saiger auf. Von Interesse ist noch die Bemerkung zur Gewinnung: „Die höhere Feste schließt die Keilhauenarbeit jetzt ganz und gar aus.“ Danach kehrte Herr Haupt erst einmal wieder nach Scheibenberg zurück und bei dessen nächster Befahrung Anfang Juli 1842 war das Versuchsort nach SO. um einen weiteren Lachter erlängt (40014, Nr. 321, Film 0054), wo „das Ort wieder in gelbem und schwarzem Mulm steht.“ Die Tiefbaue waren wegen „gerade eingefallenen Wettermangels“ nicht zu befahren. Am 3. August war wieder Eisenstein zu vermessen und am 11. August 1842 hat Herr Haupt die Grube auch wieder befahren (40014, Nr. 321, Film 0064 und 0066f), worüber er berichtete, die Tiefbaue waren noch nicht wieder fahrbar, „auch ist der darin brechende Eisenstein nicht mehr von guter Qualität, (sie) werden daher nur schichtenweise betrieben.“ Dagegen war das Versuchsort auf der Stollnsohle beständig belegt und inzwischen 31 Lachter ausgelängt. Der zuletzt angefahrene Mulm erwies sich als 2 Lachter mächtig und vor dem Ort nun wieder von dem unterliegenden Glimmerschiefer verdrängt worden. Ziemlich im Mittel des Mulmlagers kam auch ein Hornsteinlager vor, das man später vielleicht einmal untersuchen wolle. Weil alles alles nichts half, faßte man neue Pläne: „Die Nothwendigkeit, die Grube sobald als möglich wieder mehr in Production zu bringen, haben in den Grubenvorstehern den Wunsch gemacht, in circa 50 Lachter östlicher Entfernung vom Kunstschacht einen Versuchsschächtchen niederzubringen, indem sich in dieser Gegend eine Menge Bruchstücke von Eisenstein auf der Oberfläche zeigen und deutliche Spuren von einem alten Schachte sind... weil außerdem mehrere Leute feyerig werden würden, habe ich die projectirte Schachtanlage genehmigt.“ Ob es freilich viel Erfolg verspricht, erneut auf die Baue der Alten zu aufzufahren ? Seiner vorab erteilten Genehmigung halber trug auch der zurückgekehrte Geschworene Haupt am 27. August 1842 aus seinem Fahrbogen in Annaberg vor (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 65). Im Bergamtsprotokoll hierzu steht noch zu lesen, man soll „in dem früher hier niedergegangenen Schachte früher viel Eisenstein gefunden“ haben, ihn aber des vielen Wassers wegen verlassen haben. Gegen die von Herrn Haupt erteilte Genehmigung zum Schachtabteufen fand man auch im Bergamt jedenfalls keine Bedenken, insbesondere aber deshalb, weil die Grube sonst mehrere Arbeiter hätte entlassen müssen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jedenfalls nahm man den Plan auch
sogleich in Angriff und bei seiner folgenden Befahrung am 8. September
1842 (40014, Nr. 321, Film 0077f)
fand Herr Haupt das Schachtabteufen mit 5 Mann belegt, die übrigen
arbeiteten auf dem Versuchsort. Der neue Versuchschacht war 5 Lachter in
gelbem und braunem Mulm mit einigen, aber nur sehr schwachen Lagen von
Brauneisenstein, dann aber, bis jetzt auf 5,5 Lachter Teufe, in
Glimmerschiefer abgesunken. Das Versuchsort stand wieder auf der ganzen
Ortshöhe in Mulm und „verdiene daher, fortgebracht zu werden.“
„Zunächst aber ist von den Grubenvorstehern ein Ortsbetrieb in Vorschlag gebracht worden, der einen Durchschlag zwischen dem Versuchsschacht und dem Hauptstollnort bewirken soll. Dazu beabsichtigt man, sich 1 Lachter hinter dem letzteren mit einem Ort in Schiefer sich anzusetzen und dasselbe hora 3,5 Ost gegen 19,25 Lachter bis an den Tagschacht zu treiben.“ Diesen Vorschlag hielt der Geschworene in Anbetracht eines später möglichen Betriebes nur für allzu vernünftig und er sollte „daher zu billigen und die Ausführung zu genehmigen sein.“ Auch seitens des Bergamtes trug man nach dem Fahrbogenvortrag am 1. Oktober 1842 dagegen keine Bedenken (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 67). Die nächste Befahrung auf Gnade Gottes durch den Geschworenen erfolgte am 7. Oktober 1842, worüber zu berichten war (40014, Nr. 321, Film 0097f), man betrieb das oben in Vorschlag gebrachte Querschlagsort zwischen dem Hauptstolln und dem neuen Schachte und hatte es schon auf 4 Lachter erlängt. Außerdem betrieb aus dem neuen Tageschacht heraus bei 8 Lachter Teufe ein „Sitzörtchen“, um einen Punkt zu untersuchen, „wo vordem von Tage nieder Eisenstein gebrochen haben soll.“ Schließlich beabsichtigte man noch, ein Ort in der Stollnsohle „in die Gegend des alten Tageschachtes circa 15 Lachter vom Kunstschacht in Süd zu treiben, wo früher, wie Steiger Jllig anführte, Eisenstein in der Sohle soll verlassen worden sein, um dies zu verifizieren und später auch ein Ort aus den Tiefbauen dahin zu treiben.“ Ausgerechnet den letztgenannten Versuchsbau fand Herr Haupt denn auch bei seiner nächsten Befahrung belegt (40014, Nr. 321, Film 0097f). Das Ort hatte man bereits 3 Lachter fortgestellt und betrieb jetzt vor allem auf diesem ein Gesenk in der Gegend des alten Tageschachtes, wo man mehrere stehendgangweise streichende und 70 – 80° in Ost fallende, 4 – 12 Zoll mächtige Eisensteintrümer überfahren hatte. Oberhalb waren sie schon abgebaut... Alle übrigen Orte waren eingestellt, teils aus Mangel an Holz, teils weil ein Teil des Kunstschachtes neu verholzt werden mußte. Am 29. November 1842 war der Geschworene noch einmal zugegen und hielt in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 321, Film 0106f), mit dem zuvor erwähnten Gesenk sei man 2 Lachter niedergegangen und nachdem die Zimmerung im Kunstschacht fertig ausgebessert und neue Fahrten gehängt sind, werde es wieder belegt. Mit der 8 Lachterstrecke vom neuen Tageschacht aus hora 6 in Ost hat man bei 6 Lachter Auslängung ein 1 Elle mächtiges, sehr flach in West fallendes Lager aus Braunstein, Brauneisenstein und einem Mittelgestein aus beiden Erzsorten an- und zunächst durchfahren und wolle es nun im Streichen untersuchen. Über diesen kleinen Erfolg berichtete Theodor Haupt am 31. Dezember 1842 wieder in Annaberg (40169, Nr. 128, Blatt 69).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon ab dem Jahr 1842 waren anstelle der früheren,
quartalsweisen Einlegeregister für das Bergamt zusammenfassende
Anzeigen über den Grubenbetrieb nach einheitlichen Vorgaben zu erstellen,
wie wir es auch schon von den zuvor beschriebenen Gruben kennen. Über das
Berggebäude Gnade Gottes gevierte Fundgrube wurde sie vom Schichtmeister
Schubert eingereicht (40169, Nr. 128, Blatt 70f). Im Hinblick auf den
eigentlichen Betrieb erfahren wir daraus nichts neues gegenüber dem, was
wir aus den Fahrbögen schon wissen. Auf der Grube waren im Jahr 1842 neben
dem Steiger 8 Mann angelegt. Durch diese wurden insgesamt 75 Fuder, 1
Tonne Eisenstein, das Fuder zu 1 Thaler, 20 Neugroschen pro Fuder und im
Gesamtwert von 125 Thalern, 10 Neugroschen ausgebracht. Außerdem hatte man
21 Zentner Braunstein ausgebracht und für 10 Thaler, 15 Neugroschen,
respektive den Zentner für 15 Neugroschen, verkauft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im nächsten Jahr hat Herr Haupt (40014, Nr. 321, Film 0133f)
„Am 25. Januar hier Eisenstein vermessen und hiernach den Grubenbetrieb
revidirt.
Am neuen Tageschacht steht das 8 Lachter- Streckenort nun 11,5 Lachter vom Schacht entfernt. Der Eisenstein, der bei 6 Lachter Erlängung angefahren wurde, zieht sich in schmalen Trümern weiter fort, wobei die Schichtung ganz söhlig geworden ist.“ Es soll weiter fortgestellt werden, zunächst aber der bei 10,5 Lachtern angefahrene Roteisenstein untersucht werden. Dieser Roteisenstein „ist 0,1 Lachter mächtig und von sehr schöner Beschaffenheit“ und man hätte die Untersuchung bereits in Angriff genommen, aber der Tageschacht mußte zuvor noch ausgezimmert werden. Vom Stollngesenk am Kunstschacht hat man in 2 Lachtern Teufe eine Strecke hora 10,4 SO. auf einem Eisensteintrum getrieben, aber dieses Trum hat sich bei 2,5 Lachtern Erlängung ausgekeilt. Auch vom Schacht hora 3,4 NO. hat sich ein dortiges Trum von 6 – 7 Zoll Mächtigkeit nach 1 Lachter Vortrieb wieder verloren. Man hat dieses Ort daraufhin hora 7,4 SO. gewendet und abermals ein kleines Trum angefahren. „Dieser kleine Anbruch giebt aber dennoch die Kosten und es soll daher das letzte Eisensteintrum, das man auf 2 Lachter bis jetzt verfolgt hat, weiter untersucht werden...“ Nun, wenn sich´s noch rechnet... Am 9. Februar 1843 war der Geschworene erneut vor Ort und befand, man sei mit der Auszimmerung des neuen Tageschachts fast fertig (40014, Nr. 321, Film 0141f). Daneben war das Ort 2 Lachter unterm Stolln um einen weiteren Lachter fortgebracht, „wobei aber die Anbrüche noch etwas geringer geworden sind.“ Außerdem hatte man, wie geplant, auf der 8 Lachtersohle am neuen Tageschacht ein Örtchen auf dem Roteisensteinlager nach Osten angehauen, dasselbe aber schon bald verloren. Noch einmal hat Herr Haupt die Grube am 2. März 1843 befahren (40014, Nr. 321, Film 0148f), dann wurde er erneut abgeordnet. Diesmal hieß es, im „Neubau“ seien die Wasser aufgegangen und dieser daher sistiert. Stattdessen war das Ort auf der Stollnsohle hora 3,4 wieder belegt, um es mit dem Neuschacht durchschlägig zu machen und auch das Ort 2 Lachter unterm Stolln hora 10 SW werde fortgestellt. Danach vertrat ihn wieder der uns schon bekannte Herr Lippmann.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser befuhr die Grube am 19. April
1843 und berichtete danach (40014, Nr. 321, Film 0163f),
das Ort hora 3,4 NO. sei inzwischen 40 Lachter erlängt, die ersten 31
Lachter hora 8 SO, dann hat man sich bekanntlich hora 3,4 gewendet, um mit
dem neuen Schacht durchschlägig zu werden. Der Neuschacht war noch immer
ersoffen, die Baue unter dem Stolln waren mangels bauwürdiger Anbrüche
allesamt aufgegeben. Wie Herr Lippmann in
seinem Fahrbogenvortrag am 29. April 1843 formulierte, hatte sich das Erz
hier gänzlich ausgekeilt oder war zumindest von unbauwürdiger Qualität
(40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 71).
Stattdessen hat man sich bei 10 Lachter südlicher Entfernung vom Kunstschacht auf ein Abteufen eingelegt und es „in recht guten Brauneisensteinanbrüchen“ bereits 2,5 Lachter abgesenkt; die Wasser wurden mit einer 4zölligen Drückelpumpe niedergehalten. In 2 Lachter Teufe unter dem Stolln hat man ortweise ausgelängt, aber „in nicht zu großen Distanzen überall offene Endschaft erreicht“ ‒ also wieder alten Mann angetroffen ‒ und daher diese Strecken wieder versetzt. „Größere Beständigkeit scheint das Mittel niederzu zu versprechen... Freilich würde es besser sein, wenn man gleich vom Kunstschacht aus in der 3 oder 6 Lachtersohle mit einem Orte nach diesem Punkte hin auslängte.“ Das letztere befand man am 29. April 1843 in Annaberg auch und sei auch seitens des Bergamtes den Eigenlöhnern anzuempfehlen. Nicht viel Neues gab es demgegenüber nach der nächsten Befahrung am 16. Mai 1843 zu vermelden (40014, Nr. 321, Film 0177f). Herr Lippmann fand das auf einem Seitenflügel des Stollns 10 Lachter südlich vom Kunstschacht befindliche Abteufen nun bis 4,2 Lachter abgesunken, aber „von Eisenstein ist jetzt nicht viel zu sehen...“ Das Querschlagsort war nur bis 41 Lachter Länge weitergekommen und der Neuschacht stand noch immer unter Wasser. Auch nach seiner nächsten Befahrung am 15. Juni 1843 hieß es (40014, Nr. 321, Film 0183), auf dem Stollnort habe man nur einzelne Betschichten verfahren, daher sei es immer noch nur 41,5 Lachter erlängt. Stattdessen habe man 3 Lachter östlich vom Kunstschacht „auf einem schmalen Eisenstein- Trümchen gegen Mittag hinausgebrochen und dasselbe bei ½ Lachter Erlängung schon ¼ Lachter mächtig ausgerichtet, so daß man sich... auf nicht unbedeutende Eisenstein (Anbrüche?) Hoffnung machen kann.“ Auch im Gesenk südlich vom Kunstschacht hatte man in 4 Lachter Teufe nach Süden ein Ort 3 Lachter ausgelängt und dann auf drei Eisensteintrümern, die zwischen 4 und 10 Zoll mächtig waren, in Morgen aufgehauen, dort auch schon 1,4 Lachter „bei aushaltenden Eisensteinanbrüchen“ ausgelängt. Am letztgenannten Punkt sind dann aber bis zur nächsten Befahrung am 19. Juli 1843 die Eisensteinmittel schon wieder „sehr spärlich geworden.“ Auf dem Querschlagsort fehlten noch 5 Lachter bis zum Neuschacht (40014, Nr. 321, Film 0193). Den bei diesem Betrieb geförderten Eisenstein hat Herr Lippmann dann am 15. August „an das Hammerwerk Erla“ vermessen und die Grube am Folgetag wieder befahren (40014, Nr. 321, Film 0197). Das Querschlagsort auf der Stollnsohle stand nun bei 44 Lachter vom Kunstschacht aus und auch hier wurde der Glimmerschiefer jetzt härter, so daß Keilhauenarbeit nicht mehr möglich war. Auf der Strecke aus dem Gesenk wird das Eisensteinmittel weiter förstenweise abgebaut, das jetzt 12 – 18 Zoll mächtig war. Allerdings war auch das Ausbauholz fast aufgebraucht. Am 13. September gab es erneut eine Befahrung, von der Herr Lippmann diesmal berichtete (40014, Nr. 321, Film 0193), das Ort auf der Stollnsohle sei nun 50 Lachter lang und müßte den Schacht unterfahren haben, der aber nur 8,5 Lachter tief ist, wo also noch etwa 1 Lachter Teufe fehlte. Unter Beachtung der Verhaltensregeln, weil im Schacht noch ein Wassersumpf steht, wurde von ihm angeordnet, sich an diesem Punkt zu überhauen. Eisensteinabbau erfolgte noch in dem Gesenk südlich vom Kunstschacht. An dieser Stelle findet sich die Anmerkung neben dem Text: „Nach erfolgten mündlichen Zugangs des Steigers ist der Durchschlag freitags in No. 11te Woche glücklich bewirkt worden.“ Über diesen Erfolg berichtete Herr Lippmann am 30. September 1843 auch in Annaberg (40169, Nr. 128, Blatt 73). Am 19. Oktober 1843 konnte Herr Lippmann „nicht befahren, weil die Kaue verschlossen war.“ Na, so was. Dafür hat er nach seiner Befahrung am 17. November wieder ausführlich berichtet (40014, Nr. 321, Film 0215 und 0220f). An diesem Tage hatte man „nach dem früher schon vermeldten Durchschlag mit dem Neuschacht in diesem die Zimmerung bis 8 Lachter Teufe nachgezogen und nach erfolgter Aufsäuberung des früher in gedachter Teufe hora 6 Ost getriebenen Feldortes dasselbe mit 1 und 2 Mann 5 Lachter weiter, im Ganzen aber 13 Lachter vom Neuschacht in braunem Mulm und Letten mit sehr unreinem Braunstein und kleinen Nestern von Brauneisenstein fortgebracht. Nächstdem hat man sich ebenfalls in der 8 Lachtersohle zur Untersuchung der Mulmablagerung auf abbauwürdigen Eisenstein bei 3 Lachter östlicher Entfernung vom Neuschachte mit einem Querschlag angesessen, welcher mit 2 Mann belegt und in der Richtung hora 10 SO bereits 8 Lachter erlängt ist, womit man auch mehrere bis 15 Zoll mächtige rothe Hornsteinlagen und etliche schmale Brauneisensteintrümchen überfahren hat, jetzt aber damit in den darunter liegenden (...) Glimmerschiefer gekommen ist, welcher jedoch, wie hier die Erfahrung gelehrt, sich ebensobald wieder verlieren kann, als er sich eingefunden hat. Man wird also dessen ungeachtet diesen Querschlag noch 10 – 12 Lachter weiter fortbringen, um damit einen Punkt zu erreichen, wo sich schon über Tage (...) auf dem Felde sich zuweilen vorfindende Eisensteinwände bemerklich gemacht hat.“ Das in dem Abbau 10 Lachter südlich vom Kunstschacht unter der Stollnsohle abgebaute Eisensteinmittel war nun „gänzlich ausgehauen.“ Man wollte sich daher, „in Ermangelung mehrentsprechender Punkte, die zur Untersuchung auf zu erhoffende bauwürdige Eisensteinmittel geeignet scheinen, im mitternächtlichen Stoß des Kunstschachtes zu Untersuchung eines hier aufsetzenden (...) Lagers einlegen, welches zwar größtentheils aus röthlich braunem Hornstein besteht, in welchem aber doch hin und wieder einiger Eisenstein mit einbricht.“ Letzteres fand nach dem Fahrbogenvortrag am 25. November 1843 auch die Zustimmung des Bergamtes (40169, Nr. 128, Blatt 74). Die letzte Befahrung in diesem Jahr führte wieder der nach Scheibenberg zurückgekehrte Geschworene Theodor Haupt selbst am 5. Dezember 1843 durch (40014, Nr. 321, Film 0229). Er befand „das Ort in 10½ Lachter Teufe des Kunstschachts hora 5 SW nun 2 Lachter ausgelängt. Es bricht zwar etwas Eisenstein in Hornstein ein, der Hauptzweck ist aber, das südlich gelegene Gebirge zu untersuchen. Der aufgegebene Bau unter dem Stolln ist zu Bruche gegangen. Auf der 8 Lachtersohle am Neuschacht will man auf einem Hornlager hora 9 NW auslängen, um dasselbe zu untersuchen. Auf dem schmalen Eisenstein, den man 3 Lachter vom Schacht überfahren hatte, will man nun in die Höhe brechen, weil man glaubt, daß das Lager höher liege.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus der Anzeige über den Grubenbetrieb im Jahr 1843
erfährt man noch, daß bei gleichgebliebener Belegung und voranstehend
geschilderten Betrieb in diesem Jahr insgesamt nur 48 Fuder, 1 Tonne
Eisenstein im Wert von 80 Thalern, 10 Neugroschen ausgebracht worden sind
(40169, Nr. 128, Blatt 76f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner nächsten Befahrung am
29. Januar 1844 fand Herr Haupt die Belegung von vormals meist 8 Mann und 1 Steiger auf nun nur noch 3 Mann inklusive Steiger reduziert vor (40014, Nr. 322, Film 0003).
Diese hatten das Stollnort vom
Kunstschacht hora 5 in SW. nun 9 Lachter ins Feld gebracht und dabei bei
8½ Lachter Länge ein „kaum 1 Zoll mächtiges Brauneisensteintrümchen“
überfahren. Dieses hat man mit einer in Nord gehenden Strecke 2 Lachter
weit verfolgt, wo es sich bis auf 1 Fuß Weite aufgetan hat. Eine Befahrung
war für Herrn Haupt aber nicht möglich, weil eben die Fahrten des
Schachtes ausgewechselt wurden. Man hätte ja über den Stolln auch dahin
gelangen können, oder ?
Am 6. Februar war man noch mit der Reparatur der Schachtzimmerung befaßt und so wurde die nächste Befahrung am 16. Februar 1844 durchgeführt, nachdem die Zimmerung „nothdürftig reparirt“ worden ist (40014, Nr. 322, Film 0009 und 0014). Darüber berichtete Herr Haupt, daß man, nachdem man mit dem in neuerer Zeit im Schlage stehenden Stollnflügel 8,2 Lachter vom Kunstschacht hora 10,5 NW. auf dem 2 Zoll mächtigen Eisensteintrümchen schon bei 1½ Lachter Erlängung in alten Mann geschlagen hatte, den Hauptflügel hora 5,2 West wieder in Angriff genommen und inzwischen 9,7 Lachter vom Kunstschacht erlängt habe. Kaum geht das Trümchen auf 30 cm Mächtigkeit auf, waren die Alten auch schon da... Vielleicht das letzte größere Vorkommen, das die Alten übersehen hatten, hat der Grube Gnade Gottes in den zurückliegenden Jahrzehnten ihren Bestand und dem Eigentümer die Versorgung mit Eisenerz gesichert. Nachdem die Grube nun so lange stetig in Ausbringen gestanden hat, verließ den Betreiber nun das Glück. Nachdem Herr Haupt am 14. März 1844 erneut auf Gnade Gottes Fdgr. anfuhr, notierte er (40014, Nr. 322, Film 0026f), daß das zuletzt erwähnte Stollnort hora 5,4 nun 13 Lachter ausgelängt sei, „ohne mehr als schwache Trümchen von Brauneisenstein von gar keiner Bedeutung ausgerichtet zu haben. Demungeachtet sieht das Gebirge noch immer einladend aus und verdient, weiter untersucht zu werden.“ Kann man so sehen. Ganz anders sah es der Besitzer, wie wir wissen, der Herr Bergkommissionsrat Nietzsche auf Erla. Die Kosten überstiegen den Nutzen inzwischen bei weitem. Im Fahrbogen steht dazu noch zu lesen: „Die kurze Frist, die dem Betriebe der Grube laut der Erklärung des Herrn Besitzers noch vergönnt ist, macht es daher wünschenswerth, daß der gedachte Stollnbetrieb schwunghaft fortgesetzt werde. Allein der Schacht droht in der bevorstehenden Frühjahrszeit seinen Halt zu verlieren... als auch auf dem Stolln... durch die letzte Fluth Brüche entstanden sind und ein anderer Ausweg für die Arbeiter hiermit gesperrt ist...“ Das geht natürlich nicht und zieht unweigerlich neue Kosten ohne Gewinn nach sich. Folgerichtig hatte man am 30. März 1844 in Annaberg auch die Lossagung von 3 gevierten Maßen und 2 gevierten Wehren durch Schichtmeister Schubert im Auftrag der Besitzer zu Protokoll zu nehmen (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 77). Am gleichen Tage berichtete auch der Geschworene in Annaberg aus dem vorstehenden Fahrbogen (40169, Nr. 128, Blatt 78).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ende April des Jahres wurde Herr Haupt dann aber schon wieder zu anderen Aufgaben gerufen
und für den Rest des Jahres vertrat ihn diesmal der Markscheider
Friedrich Eduard Neubert.
Am 22. April 1844 mußte der Schichtmeister dem Bergamt in Annaberg mitteilen, daß am Vortag der Kunstschacht zubruchgegangen sei (40169, Nr. 128, Blatt 80f). Wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu: Wie es Herr Haupt am 14. März schon befürchtete, ist der Kunstschacht also nun zusammengebrochen... Zugleich machte Schichtmeister Schubert aber den Vorschlag, 50 Lachter nördlich des Stollnmundlochs, „wo ein Pingenzug noch Hoffnung mache,“ einen 7 bis 8 Lachter tiefen, neuen Tageschacht abzusenken. Zum gleichen Thema trug auch Markscheider Neubert am 27. April in Annaberg vor und berichtete darüber hinaus, es seien „durch Tauwetter und Nässe auch auf dem Stolln einige Brüche entstanden“ und die bisherigen Baue seien nun völlig unzugänglich geworden (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 81). Gegen das Abteufen eines neuen Schachtes an der von Schichtmeister Schubert vorgeschlagenen Position hatte man seitens des Bergamtes jedenfalls keine Bedenken. Markscheider Neubert wollte dies wohl sogleich dem Grubenvorstand mitteilen, fand aber die Grube bei seiner Befahrung am 28. Mai 1844 gänzlich unbelegt vor (40014, Nr. 322, Film 0042). Am 11. Juni 1844 ging wieder Betrieb um und Herr Neubert hielt in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 322, Film 0046), es fuhren 4 Mann an, „welche den neuen Schacht bei 33,2 Ltr. südöstlicher Entfernung hora 10,4 vom alten zusammengegangenen Kunstschacht absinken. Dieser ist 4,4 Ltr. tief und man hat mit ihm in 4 Ltr. Teufe... ein 2 bis 3 Zoll mächtiges... Brauneisensteintrum erreicht, unter welchem gelber Mulm ansteht.“ Über den Stand der Arbeiten berichtete Markscheider Neubert am 29. Juni 1844 auch im Bergamt Annaberg (40169, Nr. 128, Blatt 83). Da der Kunstschacht zubruchgegangen und verloren war, sagte der Schichtmeister unter dem 6. Juli 1844 auch den Wasserlauf samt einem Rad Wasser los (40169, Nr. 128, Blatt 84). Unter dem 22. Juli 1844 hat Herr Neubert über seine nächste Befahrung der Grube notiert (40014, Nr. 322, Film 0053f), die nur noch aus drei Mann bestehende Mannschaft habe „aus dem 5,1 Lachter tiefen neuesten Tageschachte in SW. ein Ort 3,8 Lachter erlängt, womit man das Eisensteintrum, das man in 4 Ltr. Teufe ersunken hatte, aufzuschließen beabsichtigt. Dieses Trum hat sich indessen schon in 0,3 Ltr. Entfernung vom Schachte ausgekeilt.“ Herr Neubert fand zwar, es wäre zweckmäßiger gewesen, wenn man mit dem Schacht noch einige Lachter niedergegangen wäre und von dort aus das Feld aufgeschlossen hätte, aber dem stand wahrscheinlich der Erfolgsdruck entgegen. Auch seitens des Bergamtes sah man dies nach dem Fahrbogenvortrag am 27. Juli 1844 so und veranlaßte, daß dies Herr Neubert auch dem Grubenvorstand anempfehlen solle (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 84). Bis zu seiner Befahrung vom 13. September (40014, Nr. 322, Film 0066) hatte man oben erwähntes Ort noch bis auf 12,4 Ltr. erlängt. Da es aber hora 11,4 Süd in Richtung der Hangneigung aufgefahren sei, „hält es nur noch etwa 2,8 Ltr. unterm Rasen.“ Nun, an diesen Punkt hätte man mit einem Schurf von übertage aus leichter herankommen können... Deswegen wohl war die Belegschaft bei seiner Befahrung am 18. November 1844 (40014, Nr. 322, Film 0077) auch „mit der Absinkung eines anderweiten neuen Tageschachtes beschäftigt, welcher von dem zusammengegangenen Kunstschacht 25 Ltr. hora 2,5 in SW entfernt liegt, bereits 6,2 Lachter Teufe erreicht hatte und in Glimmerschiefer stand. Wahrscheinlich wird damit bald ein Mulmlager erreicht werden.“ Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Mit Einfüllung des vor diesem ebenfalls im Laufe dieses Jahres abgesunkenen Schachtes wollte man noch Abstand nehmen, um, falls sich denn wieder ein nutzbringender Abbau etablieren ließe, diesen als zweiten Zugang nutzen zu können. Bei dem Fahrbogenvortrag am 23. November 1844 erklärte sich auch das Bergamt damit einverstanden (40169, Nr. 128, Blatt 86). Der für den Betriebszeitraum 1844 von Schichtmeister Schubert erstellten Anzeige zufolge waren Schluß des Jahres neben dem Steiger noch 5 Mann auf der Grube angelegt. Unter den Punkten ,Abbau‘ und ,Ausbringen‘ steht darin aber nur noch pauschal ein ,vacat‘ (40169, Nr. 128, Blatt 88f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner Befahrung am 9. Januar 1845
fand Herr Neubert die Grube mit 5 Mann belegt, welche einen Bruch
auf dem Stolln bei 27,5 Ltr. vom Mundloch gewältigten und die sehr
verschlämmte Wassersaige säuberten, weil man den Plan gefaßt hatte, den
Stolln bis unter den zuletzt gesunkenen Schacht 25 Ltr. südlich vom
verbrochenen Kunstschacht wieder fahrbar machen, da nämlich wegen der dort
zudringenden Wasser dessen Betrieb eingestellt werden mußte. Dieser
Schacht war nun 7,5 Ltr. tief und stand „in einem Gemenge aus Mulm,
Eisenstein und Hornstein.“ (40014, Nr. 322, Film 0087f) Zu diesem Plan erklärte nach dem Fahrbogenvortrag
auf der Bergamtssitzung am 25. Januar 1845 auch das Bergamt sein
Einverständnis (40169, Nr. 128, Blatt 87).
Behufs der Inangriffnahme dieses Baufeldes mutete der Schichtmeister noch
einmal eine untere gevierte Maß, welche ihm am 23. April 1845 auch
zugesprochen worden ist (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 89). Am 7. März des Jahres fand Herr Neubert sogar wieder 7 Mann angelegt, welche allerdings „mit Ausschluß des Steigers wöchentlich blos 3 Schichten verfahren.“ Die Gewältigung des Stollns war bis 36 Lachter vom Mundloch fortgeschritten, „sonst (ist) aber etwas nicht weiter erfolgt.“ (40014, Nr. 322, Film 0097) Nichts anderes war von der Befahrung am 18. April 1845 zu berichten, nur wurde noch eine „Besichtigung im Beisein von Steiger und Schichtmeister wegen Bestätigung der zum Besten dieser Grube gemutheten ersten untern gev. Maß gehalten.“ (40014, Nr. 322, Film 0108) Man erwarb also zusätzliches Grubenfeld zwischen dem Stollnmundloch und der Fundgrube. Bis zu seiner Befahrung am 21. Juli war der Stolln auf 52 Ltr. Länge gewältigt, dort lagen aber „mehrere bedeutende Brüche“ vor, deren Gewältigung man lieber umging, indem nun frischer Ortsbetrieb behufs der Lösung des bei 25 Ltr. südwestlicher Entfernung vom verbrochenen Kunstschacht niedergebrachten Schachte eingeleitet, und 4,8 Lachter hora 8,5 NW in ganzem Gebirge aufgefahren worden ist. Herr Neubert gab dem Steiger vor, daß er noch 44 Ltr. hora 9,5 fortfahren müsse, um dorthin zu gelangen (40014, Nr. 322, Film 0127f). Bis zum 12. September war man mit diesem Stollnflügel 14,8 Ltr. vom alten Stolln oder bis insgesamt 66,8 Ltr. vom Mundloch vorangekommen, dabei aber in hora 9,2½ abgewichen, weswegen dem Steiger das erforderliche Anhalten wieder gegeben wurde (40014, Nr. 322, Film 0139f). Bis November 1845 hatte man dieses Stollnort bis 73,6 Ltr. vom Mundloch fortgestellt, dann aber zunächst sistiert, weil bei 5 Ltr. vom Mundloch Zimmerung gewechselt werden mußte (40014, Nr. 322, Film 0150f). Über den Stand der Dinge berichtete Herr Neubert am 26. Juli 1845 auch in Annaberg (40169, Nr. 128, Blatt 90). Die Anzeige des Schichtmeisters für das Betriebsjahr 1845 sah so aus wie die letzte: Nebst des Steigers waren 6 Mann angelegt, durch welche die beschriebenen Ausrichtungsbaue betrieben wurden. Abbau und Ausbringen gab es nicht (40169, Nr. 128, Blatt 91).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Folgejahr setzte man den Plan
unverdrossen fort und hatte bis Ende Februar das Stollnort auf 87,75 Ltr.
ausgelängt. Bis zum neuen Schacht fehlten noch 13 Lachter (40014, Nr. 322, Film 0176).
Am 27. März 1846 stand das Stollnort bei 96 Ltr. und es fehlen noch 4 bis
5 Ltr. bis unter den Schacht (40014, Nr. 322, Film 0182).
Der Aufwand wurde aber erheblich und Neubert notierte: „Das
Gebirge, welches zuletzt durchfahren wurde und ein schwarzer, Spuren von
Eisenstein führender Mulm ist, übt einen sehr starken Druck aus, so daß
ganz neue Thürstöcke von ziemlicher Stärke in kurzer Zeit zerknickt worden
sind.“ Außerdem herrschte vor Ort nun „spürbarer“ Wettermangel,
so daß Neubert empfahl, den Tageschacht wieder in Angriff zu
nehmen, bis auf die Stollnsohle zu verteufen und dann ein Gegenort
anzuschlagen.
Im April 1846 hatte man die Belegung wieder auf 3 Mann herabgesetzt, vielleicht aber verfuhren die nun wieder 6 Schichten in der Woche. Das Stollnort wurde weiter betrieben, „dessen Betrieb wegen der schwimmenden Beschaffenheit des Gebirges und bei sehr fühlbarem Wettermangel ziemlich schwierig ist.“ Man hatte inzwischen 99 Ltr. Länge erreicht und es fehlten höchstens noch 2,5 Ltr. bis unter den Schacht. Da dieser immer noch abgesoffen war, war auch Neubert´s Empfehlung nicht durchführbar (40014, Nr. 322, Film 0191f). Am 19. Juni 1846 war Herr Neubert ein letztes Mal auf der Grube ‒ jedenfalls ist dies sein letzter Fahrbericht. Das Stollnort stand bei 101,4 Ltr. und die im Schacht darüber zudringenden Wasser hatten so weit abgenommen, daß dieser nun wieder in Angriff genommen werden konnte. Er mußte von 8,2 noch bis auf 11,3 Ltr. Teufe, nach Abzug der Stollnhöhe um 2,3 Ltr., abgesenkt werden (40014, Nr. 322, Film 0201f). Über diesen Arbeitsstand trug Herr Neubert am 4. Juli 1846 auch im Bergamt zu Annaberg wieder vor (40169, Nr. 128, Blatt 92). Der Aktenbestand enthält zwar noch Fahrbögen bis Reminiscere 1847, doch sind in diesem Zeitraum offenbar keine Befahrungen dieser Grube durch den Geschworenendienstversorger mehr erfolgt. Die Grubenakten sagen dann noch aus, daß Schichtmeister Schubert Mitte 1846 Antrag auf Fristhaltung für die Grube einreichte, was am 11. Juli 1846 auch seitens des Bergamtes genehmigt worden ist (40169, Nr. 128, Blatt 93). Auf dieses Betriebsjahr reichte der Schichtmeister auch noch eine weitere Anzeige zum Grubenbetrieb ein, welche wie die vorige aber auf einer Papierseite Platz fand, weil außer dem Punkt ,Versuchsbaue‘ alle anderen mit einem ,vacat‘ versehen waren... (40169, Nr. 128, Blatt 94). Am 2. Januar 1847 sagte Schichtmeister Schubert auch die verbliebene gevierte Fundgrube nebst dem einen unteren Maß los (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 93).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neue Gnade
Gottes Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Knapp zwei Jahre später versuchte sich wieder ein neuer Bergbaulustiger: Am 11. Oktober des Jahres 1848 erhielt Traugott Friedrich Weigel aus Langenberg eine gevierte Fundgrube unter dem Namen Neue Gnade Gottes Fdgr. „auf dem Grund und Boden des Bergschmieds Christian Friedrich Dürr, auf einem hora 8,4 streichenden und 15° in Mittag Morgen fallenden Eisensteinlager “ verliehen (40169, Nr. 264, Blatt 1).
Der Name des
Bergschmieds Dürr ist uns zuletzt
Herr Weigel
betrieb die Grube jedoch nicht selbst, sondern benannte zunächst Carl
Heinrich Schürer als Lehnträger. Der blieb es aber nicht lange, denn
am 17. Januar 1849 wurde im Bergamt Annaberg zu Protokoll genommen, daß
Herr Schürer verstorben sei und Herr Weigel nun selbst als
Lehnträger
„bei beiden Gruben“
fungiere (40169, Nr. 264, Blatt 2, auch in 40169, Nr. 263, Blatt 2). Herr
Weigel betrieb also zeitgleich noch eine zweite Grube ‒
wahrscheinlich handelte es sich dabei um die Neues Jahr Fundgrube
bei
Ansonsten blieb dies eine recht kurze Episode, denn am 4. Januar 1851 sagte Herr Weigel die Neue Gnade Gottes Fundgrube „infolge des zubruchgegangenen Tageschachtes“ vor dem Bergamt Annaberg wieder los (40169, Nr. 264, Rückseite Blatt 2).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mehr als zwanzig Jahre lag das
Grubenfeld danach im Bergfreien.
Ab 1874
war unter dem Namen „Gnade Gottes vereinigt Feld am
Rittergut Förstel“ dann eine neue Grube im alten Grubenfeld an Gustav Zschierlich verliehen. Er
konsolidierte sie schließlich mit der Gewerkschaft Wilkauer Vereinigt Feld,
zuvor im Besitz der
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Riedels
Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Riedels Fundgrube ist in den
Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) ab 1819 und noch bis 1882
aufgeführt. Sie hat in ihrer vergleichsweise langen Betriebszeit überwiegend Braunstein
ausgebracht, insgesamt rund 77.200 Zentner (rund 3.856 t). Zumindest
hinsichtlich der Braunsteinförderung muß diese Grube damit als eine
der bedeutendsten des Reviers gelten. Eisenstein
wurde, wenn er denn beibrach, natürlich nicht liegengelassen. Das
Ausbringen an Eisenerz summierte sich dagegen aber nur auf zirka 1.646 Fuder (rund 1.395 t).
Sie wurde den beiden Bergarbeitern Christian Gottlob Riedel (auf den wohl auch der Name zurückgeht) und Christian Gottlob Weißflog aus Langenberg, in der Person des von denselben hierzu beauftragten Geschworenen, „im Raschauer Pfarrwalde auf dem vom linken Ufer des Dorfbachs gegen Mittag ansteigenden Gebirge auf einem in 4 Lr. Tiefe ersunkenen Eisen und (Braunstein ?) führenden Lager“ unter dem Namen Riedels Fundgrube am 1. März 1819 bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 285).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erste bergamtliche Befahrung durch
den zuständigen Berggeschworenen, Christian Friedrich Schmiedel,
erfolgte am 3. März 1819. In seinem Fahrbogen
(40014, Nr. 261, Film 0021)
heißt es an diesem Tag allerdings noch, auf dieser „zwar gemutheten, jedoch noch nicht bestätigten
Grube“ werde in 4 Lachtern Teufe des Fundschachtes ein Ort Stunde 7,6
gegen Abend betrieben und war 3½ Lachter fortgebracht. Das Lager sei
jedoch noch nicht gänzlich ausgerichtet.
Am 6. April des Jahres berichtete der Geschworene etwas ausführlicher (40014, Nr. 261, Film 0036f): „Mit den auf dieser Eigenlöhnerzeche anfahrenden 2 Mann wird in 5 Lachter Teufe des Fundschachtes, woselbst das allhier aufsetzende Lager ersunken worden, ein Ort Stundte 7,6 gegen Abend zu 2/3 betrieben, dessen Länge von besagtem Fundschacht 4 Lachter beträgt. Das Lager vor selbigem fällt ungefähr 10 Grad gegen Mitternacht und besteht aus braunem Ocker, mildem Gneus, Quarz, braunem Hornstein und 1 Elle mächtigem, mit etwas Quarz vermengtem Braunstein.“ In Anbetracht der bereits eingetretenen Irritationen mit dem Grundbesitzer, Herrn Carl Edler von Querfurth (siehe den Abschnitt zu Karl's Glück), traf Herr Schmiedel sofort auch Veranstaltung: „In Betracht, daß oberwähnter Fundschacht ganz nahe an einem Wege steht und für die Vorübergehenden Gefahr bringen kann, so wurde den Eigenlöhnern aufgegeben, selbigen gut und dauerhafft zu umzäunen, auch noch überdies mit einer Thür zu versehen.“ Bei den folgenden Befahrungen fand Herr Schmiedel dann keine bemerkenswerten Veränderungen im Grubenbetrieb vor (40014, Nr. 261, Film 0053, 0063f und 0092). Mit zwei Mann Belegung kann man ja auch keine Bäume ausreißen... Am 15. November 1819 fand der Geschworene dann ein neues Ort in nur noch 3½ Lachter Teufe des Tageschachtes Stunde 4,7 gegen Abend vor, dessen Länge 1¼ Lachter betrug (40014, Nr. 261, Film 0100f). Bis zum 14. Dezember 1819 hatten die Betreiber 34 Zentner Braunstein ausgebracht und am 21. Dezember wurden die ersten 13 Zentner verwogen (40014, Nr. 261, Film 0110 und 0113). Am ersten Verwiegetag im neuen Jahr am 10. Februar 1820 wurden nochmals 27 Zentner Braunstein verwogen, so daß man noch 4 Zentner im Vorrat behielt (40014, Nr. 262, Film 0012).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung dieser Grube fand
am 18. Februar 1820 statt, worüber der Geschworene Schmiedel zu
berichten hatte (40014, Nr. 262, Film 0012):
„Freytags, den 18. Februar 1820, bin ich auf mehrern bey Langenberg gelegenen Gruben, wovon erstere sechse auf einem und demselben Lager bauen, gefahren, und ist hierüber folgendes zu bemerken gewesen: (...)“ e.) Riedels Fundgrube betr. „Durch die allhier in Arbeit stehenden 2 Mann werden folgende Baue betrieben: 1.) Aus dem 4 Lachter tiefen Fundschachte wird auf der Sohle desselben mit 1 Mann ein Ort Stundte 4,3 gegen Abend, zur Untersuchung dieses Lagers fortgestellt und ist dasselbe dermalen vor Orte 1 Lachter mächtig, aus braunem Ocker, Gneus, Quarz, Hornstein und nierenweise einbrechenden Braunstein bestehend, besagtes Ort aber zur Zeit 4 Lachter erlängt. Um aber den, auf diesen Braunsteinzechen im Sommer gewöhnlich eintretenden Wettermangel abzuhelfen, wird 2.) bey 3½ Lachter Teufe des von dem Fundschachte 13 Lachter weiter gegen Mitternacht befindlichen, neuen Tageschachtes ein Ort mit 1 Mann Stundte 2,2 gegen Mittag in Quergestein betrieben, um solches mit dem obbeschriebenen Orte in Verbindung zu bringen. Es ist dasselbe bereits 3¾ Lachter erlängt, so daß bis zur völligen Durchörterung noch ungefähr 6¼ Lachter aufzufahren verbleibt.“ Ach ja, der vielbeklagte Wettermangel... Eigentlich ist es nur schwer erklärbar, daß es in diesen, doch nur sehr kleinen Gruben, immer wieder diese Probleme gegeben hat. Bis zum nächsten Verwiegetag am 20. Juni 1820 waren bei dem so beschriebenen Betrieb aber wieder 13 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0059), bis zum 16. August 11 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0067f) und bis zum 19. September noch einmal 5 Zentner Braunstein ausgebracht (40014, Nr. 262, Film 0081). Ansonsten aber fand der Geschworene in diesem Jahr keine bemerkenswerten Ereignisse mehr vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann kam es am 7. Juli 1820 aus Anlaß
der
„Auf diesem in der Kürze beschriebenen Lager werden nun folgende Baue betrieben. §202 (...) Übrigens fanden Fahrende den Fundschacht, welcher nahe an dem Wege von Raschau nach Langenberg steht, gar nicht, den Tagschacht aber nur mit einem Geviere verwahrt und beyde in sehr rolligem und schüttigem Gebirge niedergebracht und indem sie solches dem Eigenlehner ernstlich verwiesen, ordneten sie sogleich an, beyde Schächte nicht nur in gehörige Zimmerung zu setzen, sondern auch, da sie mit einer Kaue übertage nicht versehen sind, behufige Schachtthüren anzubringen und die Ziehschächte gehörig zu bedecken.“ Wir gehen mal davon aus, daß die Anweisungen der Bergbeamten von den Eigenlöhnern auch befolgt worden sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder im Februar des Folgejahres
erfolgte die nächste Grubenbefahrung in Langenberg durch Herrn
Schmiedel, worüber er in seinem Fahrbogen festhielt
(40014, Nr. 264, Film 0016f):
f.) Riedels Fundgrube eben daselbst. „Auf dieser gleichfalls eigenlöhnerweise betrieben werdenden Grube wird auf der Sohle des 4 Lachter tiefen Tageschachtes ein Ort mit 2 Mann nach dem Streichen des allhier aufsetzenden Lagers Stundte 5,5 gegen Abend zu 2/3 betrieben. Besagtes Lager ist daselbst ½ Lachter mächtig und führet Gneus, Quarz, braunen Ocker, und Braunstein. Erlängt ist dieses Ort von erwähntem Schacht 6 Lachter.“ Das 1820 unter 1.) benannte Streckenort ist in diesem Zeitraum also gerade einmal 2 Lachter fortgestellt worden, aber man hatte ja parallel noch den Querschlag zum zweiten Tageschacht aufgefahren. Bis zum Verwiegetag am 20. März hatte man dabei 6 Zentner Braunstein gefördert (40014, Nr. 264, Film 0029) und bis zum 16. April 1821 hatte man neben 15 Zentnern Braunstein auch 2 Fuder, 3 Tonnen Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0038). Am gleichen Tage erfolgte auch wieder eine Befahrung der Grube durch den Geschworenen, über die er notierte: „Sodann bin ich auf Riedels Fdgr. gefahren und habe befunden, daß mit den allhier anfahrenden 2 Eigenlöhnern in 3½ Lachtern Teufe des Tageschachtes auf dem daselbst ersunkenen Lager ein Ort gegen Mittag betrieben wird und solches dermalen 6½ Lachter erlängt ist. Das vor selbigem in mehreren Trümern liegende, braunen Ocker, Hornstein, Quarz und Braunstein führende Lager ist ½ Lachter mächtig und fällt 10 bis 12 Grad gegen Mitternacht.“ Man hatte folglich einen Meter höher ein neues Streckenort angeschlagen. Beim nächsten Verwiegetag am 19. Juni standen auf Riedels Fundgrube dann 13 Zentner Braunstein zu Buche (40014, Nr. 264, Film 0063), am 7. August 14 Zentner (40014, Nr. 264, Film 0077) und bis zum 18. September 1821 waren noch einmal 5 Zentner ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0093). Nach seiner Befahrung am 18. September hielt Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen fest, es werde nun wieder in 4 Lachter Teufe ein Ort „mit ⅞ Lachter Weitung gegen Mittag Abend“ betrieben und dieses sei 6½ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 264, Film 0093). Bis zum 7. November 1821 hatte man erneut 16 Zentner Braunstein gefördert (40014, Nr. 264, Film 0106). Sonst aber fand der Geschworene nichts Bemerkenswertes mehr im Grubenbetrieb vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Jahr 1822 gab es bei Riedels
Fundgrube offenbar keine erwähnenswerten Ereignisse für den
Geschworenen (40014, Nr. 262, Film 0081).
Der Abbau schritt geruhsam fort und am ersten Verwiegetag am
5. Februar 1822 waren wieder 10 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0014),
am dritten am 7. August waren 4 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 262, Film 0059).
Im Dezember 1822 löste dann Herr Johann August Karl Gebler den bisherigen Berggeschworenen in Scheibenberg ab. In dessen erstem Dienstjahr erscheint Riedels Fundgrube aber nur einmal am Verwiegetag am 13. Oktober 1823 in den Fahrbögen, als hier 10 Fuder Eisenstein zu vermessen waren (40014, Nr. 267, Film 0070). Die erste Befahrung durch den neuen Geschworenen erfolgte auf dieser Grube am 12. März 1824 (40014, Nr. 271, Film 0017). Nach wie vor waren hier zwei Mann beschäftigt, über deren Arbeit Herr Gebler in seinem Fahrbogen festhielt: „Aus dem in der St. 12,0 niedergebrachten, nur 3½ Ltr. tiefen Schacht hat man in der St. 12,0 gegen Mittag ein 12 Ltr. erlängtes Ort und von demselben aus mehrere nach allen Richtungen zu Aufsuchung eines Braunsteinlagers getrieben, solches auch mit verschiedenen derselben angefahren und bebaut, (...?) bey einer Mächtigkeit von 1 bis 2, auch 4 und 5 Zoll.“ Weitere Befahrungen erfolgten in diesem Jahr nicht, auch an den Verwiegetagen ist die Grube nicht mehr genannt. Auch später taucht diese Grube in den Fahrbögen des Herrn Gebler nicht mehr auf. Den Angaben in den Erzlieferungsextrakten nach (40166, Nr. 26) wurden in dieser ersten Betriebsphase (von 1819 bis 1826) insgesamt 445 Zentner Braunstein und 2,6 Fuder Eisenstein ausgebracht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine neue Mutung der Grube gab es
im Jahr 1828 durch Gotthold Reppel, woraufhin Geschworener
Gebler die „im Freien liegende Riedels Fundgrube“ am 1. Juli
des Jahres zu besichtigen hatte (40014, Nr. 270, Blatt 69f). Zunächst scheint aber nichts geschehen zu sein, denn
derselbe samt Konsortschaft legte am 14. Oktober 1831 erneut Mutung auf „das
seit langer Zeit im Freien liegende Berggebäude“ ein. Nach
Besichtigung durch den Geschworenen erhielten sie es am 5. April 1832 „unter
dem Namen der früher schon hier in Umtrieb gestandenen Grube Riedels gev.
Fdgr.“ diesmal auch bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 99f und
40014, Nr. 43, Blatt 318).
Auch jetzt fehlen aber Fahrberichte der Geschworenen aus der nachfolgenden Zeit in den Akten des Bergamtes Scheibenberg – viel geschehen ist vermutlich also in dieser Zeit nichts. Stattdessen mutete nun Traugott Friedrich Merkel und Konsorten am 3. Juli 1834 die Grube erneut. Nach erfolgter Besichtigung durch Herrn Gebler wurde auch diesmal die Bestätigung seitens des Bergamtes am 8. Januar 1835 ausgesprochen (40014, Nr. 270, Film 0131ff und 40169, Nr. 286, Blatt 4). Bereits im Verleihbuch ist aber gleich neben der Eintragung angemerkt: „losgesagt im Quartal Trinitatis 1837“ (40014, Nr. 43, Blatt 321). Das haut nicht ganz hin, denn laut Grubenakte ist die Lossagung durch Merkel bereits am 5. Januar 1837 erfolgt (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 4). Mehr enthalten die Akten zu dieser kurzen Episode nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch am selben Tage, am 5. Januar 1837,
legte dann Karl August Ley (oder Lein) erneut Mutung über „die von
Traugott Friedrich Merkel in Raschau eigenthümlich in Lehn gehabte und
betriebene Riedels gev. Fdgr. im Raschauer Pfarrwalde bey Langenberg
gelegen (ein). Diese Fdgr. ist heute von dem Eigenlöhner Merkel mir
zum Besten losgeschrieben und in das Bergfreye zurück gegeben worden.“
(40014, Nr. 270, Film 0202) Sie wurde ihm am
5. Oktober 1837 nach erfolgter Besichtigung durch den Geschworenen
unter dem früheren Namen bestätigt und umfaßte eine gevierte Fundgrube (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 334 und 40169, Nr. 286, Blatt 5). Aus der nachfolgenden Zeit (um 1839) stammt dann
auch die folgende Darstellung der Lage der Grube.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab Reminiscere 1840 war dann Herr
Theodor Haupt als Berggeschworener in Scheibenberg bestellt. Der neue
Geschworene befuhr auch gleich am 10. Januar dieses Jahres alle in Umgang
stehenden Gruben des Reviers. Über diese berichtete er anschließend in seinem Fahrbogen
recht knapp (40014, Nr. 300, Film 0016):
„Auf Riedels gev Fdgr. baut man jetzt in 5 Lachter südlicher Entfernung vom alten Tageschachte das quarzige Braunsteinlager ab. Die Anbrüche sind aber sehr gering. Der Betrieb des neuen Tageschachtes, womit man 2 Lachter saiger niedergekommen ist, bleibt bis zur beßren Jahreszeit ausgesetzt.“ Kaum anders lautete seine Notiz über seine Befahrung vom 16. März 1840 (40014, Nr. 300, Film 0030): „Auf Riedels gev. Fdgr. baut man noch in 5 Lachter südlicher Entfernung vom alten Tageschachte das sehr quarzige Braunsteinlager ab.“ Auch nach seiner Befahrung Trinitatis 1840 notierte Herr Haupt nur (40014, Nr. 300, Film 0041), man betreibe jetzt bei 1 Lachter südlicher Entfernung vom Tageschacht ein Ort „auf einem braunsteinhaltigen Quarzlager“ in Ost. Die Anbrüche seien aber von geringer Güte. Immerhin muß etwas dabei herausgekommen sein, denn am 25. Juni 1840 hat der Geschworene hier den geförderten Braunstein verwogen, aber ohne daß diesmal die Menge festgehalten ist (40014, Nr. 300, Film 0073). Das nächste Mal hat Herr Haupt die Grube am 10. August 1840 befahren und berichtete in seinem Fahrbogen darüber (40014, Nr. 300, Film 0093): „Auf Riedels gev. Fdgr. endlich wird noch an dem früheren Puncte östlich vom Tageschachte und etwa 1½ Ltr. von diesem entfernt Braunstein ort- und förstweise gewonnen, der seit kurzem etwas beßer geworden ist, als sonst hier der Fall.“ Na immerhin... Auch am 8. September 1840 war der Geschworene noch einmal selbst vor Ort, worüber er notierte, daß, während auf anderen Gruben bereits wieder Wettermangel eingetreten sei, man „auf Riedels Fdgr. (...) in 5 Lachter saigerer Teufe östlich vom Tageschacht Braunstein abbaut, wobei jedoch einige Gefahr obwaltet, demgemäß ich angeordnet habe, den Bau erst durch Verholzung zu sichern.“ (40014, Nr. 300, Film 0110)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Ende Crucis
1840 bis Mitte Reminiscere 1841 wurden Herrn Haupt dann andere
Aufgaben übertragen. In dieser Zeit wurde er in seiner Funktion als
Geschworener des Bergamts Scheibenberg durch den Raschau'er Schichtmeister
Friedrich Wilhelm Schubert vertreten.
Der letztere hat gleich am 29. September 1840 (40014, Nr. 300, Film 0113) „bei den mir übertragenen Eisen- und Braunstein Gruben zu Langenberg die Eisen- und Braunstein Vorräthe refitiret (revidiert)“, tags darauf auch „bei Riedels Fdgr 25 Ctr. Braunstein verwogen, nachdem diese Grube befahren, wobei zu bemerken gewesen, daß der ziemlich rund gegen 2,0 Ltr. in Durchlauf (?) weit, wie auch 1,3 Ltr. hoch ausgehauene Braunstein Abbau, nur etwa 5,0 Ltr. vom Tageschacht gegen Süd entfernt, mit einem einzelnen Stempel ohngefähr in der Mitte unterstützt, welches ebensowenig als gar keine Unterstützung ausmacht. Demnach es höchst lebensgefährlich zu sein scheint, traf ich die Anordnung, ohne mehrer angebrachte Unterstützung mit einem von Haldenwänden und Bergen aufzuführenden Pfeiler das fernere Abbauen des Braunsteins auszusetzen. Diesem versprachen auch die anwesenden Eigenlöhner Gebrüder Lein gebührend nachzukommen.“ Ob das erfolgt ist, erfährt man nicht, denn unter dem 17. Dezember 1840 notierte Herr Schubert, er habe an diesem Tage „bei Riedels gev. Fdgr., Friedrich und den übrigen Eigenlöhnergruben bei Langenberg abermals niemand in Arbeit getroffen.“ (40014, Nr. 300, Film 0141)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trinitatis 1841 war
Herr Haupt dann wieder in seinem Amt in Scheibenberg und hat die
Grube am 10. Mai des Jahres wieder selbst befahren, allerdings heißt es im
Fahrbericht
nur knapp, man senke hier den zweiten Tageschacht tiefer ab, namentlich
wegen des häufigen Wettermangels, und hatte damit 5½ Lachter Teufe
erreicht (40014, Nr. 300,
Film 0172).
In gleich knapper Form heißt es von seiner Befahrung am 27. Juli 1841 (40014, Nr. 300, Film 0208): „Auf Riedels gev. Fdgr. endlich ist der neue 8 Lachter tiefe Tageschacht ebenfalls mittels einer Strecke in dieser Woche mit dem alten durchschlägig geworden. Im neuen Tageschacht hat man bei 5 Lachter Teufe sehr schönen Braunstein durchsunken.“ Noch einmal ist Herr Haupt hier am 19. August angefahren und hielt in seinem Fahrbogen diesmal etwas ausführlicher fest (40014, Nr. 300, Film 0224f): „Auf Riedels gev. Fdgr., jetzt eine der besten Braunsteinzechen hinsichtlich der Anbrüche, ist man noch mit der Verbindung des obern und untern Tageschachtes beschäftigt. Der untere Schacht ist 5 Ltr., der obere 7,4 Ltr. saiger tief. Vom untern ist man aber den Braunsteinanbrüchen, die dem obern oder Neuschachte zufielen, nachgegangen, so daß man mit der jetzigen Strecke noch 0,5 Lachter unter dem Tiefsten des letzteren Schachtes fällt. Diese Strecke jetzt regelmäßig herzustellen, ist der vorliegende Plan bei dieser Grube. Im Tiefsten geht die Strecke in Mulm mit etwas Brauneisenstein und Braunstein, über demselben liegt Quarz mit etwas Braunstein durchzogen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab Crucis 1841
wurde Herr Haupt erneut von höherer Stelle zu anderen Aufgaben
abgeordnet. In der folgenden Zeit vertrat ihn in der Funktion als
Geschworener im Bergamt Scheibenberg dann der Rezesschreiber Lippmann
aus Annaberg (40014, Nr. 300,
Film 0230).
Letzterer ist auch gleich am 3. September 1841 auf Riedels Fdgr. gefahren und berichtete darüber (40014, Nr. 300, Film 0236f): „Der Durchschlag der Strecke auf den 8 Lachter hora 12 Süd entfernten, oberen neuen Schacht ist nun erfolgt. Man war nun befaßt, den Schacht auf die in 8 Lachter Teufe einkommende Streckensohle vollends niederzubringen. In dieser Sohle stehen Nieren von sehr schönem Braunstein und auch etwas Brauneisenstein an. Der Braunstein in den oberen Teufen, wo er gleichsam das Bindemittel eines circa 3 bis 4 Lachter mächtigen Lagers von Brockenquarz und stückligem Glimmerschiefer abgiebt, ist von weit geringerer Beschaffenheit, als der in und über der 8- Lachtersohle vorkommende.“ Außerdem war die Zimmerung des alten Schachts wandelbar geworden, weshalb Herr Lippmann deren baldige Auswechslung anwies, was auch nach Anfuhr der neu verschriebenen Hölzer sogleich geschehen solle. Auch am 5. Oktober 1841 war Herr Lippmann zugegen, man war noch mit der Zuführung der Strosse im neuen Tageschacht befaßt, damit aber um vieles vorgerückt. „Der Braunstein bricht hier noch immer in schönen compacten und großen Nieren, wie früher.“ (40014, Nr. 300, Film 0248) Bei seiner Befahrung am 12. November 1841 fand der Geschworenendienstversorger noch denselben Stand (40014, Nr. 300, Film 0265). Erst am 23. Dezember des Jahres konnte er berichten, das Nachstrossen sei nun vollbracht (40014, Nr. 300, Film 0278f). Die Braunstein- Anbrüche im oberen Tageschacht hielten sich hier noch immer so gut als zeither. Vor der Gewinnung steht aber die Sicherung: „Da die Holzanweisung nun erfolgt ist, muß es das Erste der Eigenlöhner seyn, ihre beiden Tageschächte durch einzubauende resp. einzuwechselnde Zimmerung gut und tüchtig zu verwahren.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Letzteres schob man noch etwas auf,
denn noch unter dem 22. März 1842 liest man im Fahrbogen (40014, Nr. 321, Film 0023f):
„Die so nöthige Auszimmerung des Neuschachtes und deren theilweise
Auswechslung im Alten Schachte wollen die Eigenlöhner in nächster Zeit
vornehmen.“
Über den Betrieb bei Riedels gev. Fdgr. heißt es am 22. März, hier, „woselbst 2 Mann anfahren, hat man in der 8 Lachtersohle vom neuen Schacht aus 3 Lachter gegen Mittag Morgen in anfangs noch leidlichen, nach und nach sich aber durch Hornsteinlagen abschneidenden Braunsteinanbrüchen aufgefahren, dasselbe war auch der Fall, als man in derselben Sohle vom gedachten Punkte aus gegen Mittag Abend 1 Lachter lang hinaus gebrochen hatte. Dagegen stehen in diese Sohle gegen Mitternacht Abend noch ganz hübsche Braunsteinanbrüche von bis 0,1 Lachter Mächtigkeit an. Für jetzt haben sich die Eigenlöhner in der 6 Lachtersohle bei 4 Lachter südlicher Entfernung vom alten Tageschachte mit einem Ort angesessen und solches 2 Lachter gegen Morgen getrieben, dabei aber ein mitunter bis zu 0,2 Lachter mächtiges, ziemlich derbes Braunsteintrum, welches man schon mit dem Neuschacht durchsunken hatte (...) überfahren, auch darauf förstenweis mit 1,5 Lachter Höhe 1 Lachter lang in Abend abgebaut.“ Deshalb war auch schon am 11. Februar 1842 erst einmal der ausgebrachte Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 321, Film 0011). Bei seiner nächsten Befahrung am 27. April 1842 fand Herr Lippmann dann endlich die Eigenlöhner „mit der höchst nothwendigen Auswechslung der Zimmerung des Fundschachtes“ befaßt. Am gleichen Tag war auch wieder Braunstein zum Verwiegen bereit (40014, Nr. 321, Film 0032f). Im Gegensatz zu den meisten benachbarten Gruben kam Riedels Fdgr. in diesem Sommer nicht wegen Wettermangels zum Erliegen. Am 21. Juni 1842 berichtete Herr Lippmann vielmehr (40014, Nr. 321, Film 0048), daß die beiden Eigenlöhner nun „die Auswechslung der Zimmerung im Fundschacht vollständig bewirkt, ferner den Neuschacht um einen ½ Lachter in Brockenquarz und Braunstein abgesenkt, somit nun 8,5 Lachter Teufe erreicht und dabei ein circa 0,1 Lachter mächtiges, sehr braunsteinreiches Brauneisensteintrum durchsunken haben.“ Außerdem wurde in der 6 Lachtersohle am Fundschacht das Braunsteinmittel auf weiteren 2 Lachtern Länge gegen Abend förstenweise abgebaut. Allerdings sei der inzwischen auf 150 Zentner angewachsene Vorrat „gegenwärtig sehr schwierig abzusetzen.“ Ab Ende Luciae 1842 und Reminiscere 1843 hat Theodor Haupt seine Aufgaben in Scheibenberg dann wieder selbst wahrgenommen. Am 21. Dezember 1842 hat er auch Riedels Fdgr. wieder befahren und in seinem Fahrbogen dazu festgehalten (40014, Nr. 321, Film 0121f), „diese, mit 2 Mann dann und wann in Betrieb stehende Braunsteinzeche, hat jetzt unter allen derartigen Gruben die besten Anbrüche, aber den unregelmäßigsten Bau. Der eine Punct ist etwa im Mittel zwischen den beiden Tageschächten in circa 4 Lachter saigerer Teufe, wo der Braunstein auf ¾ Lachter Mächtigkeit das Quarzlager in 1 bis 4 Zoll breiten Streifen durchzieht und in hora 2 SW. verfolgt wird, der andere Punct circa 2 Lachter tiefer, ist in der Nähe des obern Tageschachtes, wo der Braunstein zwar weniger schön bricht, aber demohngeachtet noch sehr hübsch ansteht und in hora 4 SW. verfolgt wird.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 20. Februar hat Herr Haupt „die Markscheide zwischen zwei Braunsteingruben bei Langenberg angegeben, sodann für Riedels und Gelber Zweig gev. Fdgr. Braunstein verwogen“ (40014, Nr. 321, Film 0144) und am 2. März erfolgte wieder eine Befahrung. Über diese steht im Fahrbogen zu lesen, man habe nun in 4 Lachter Teufe vom neuen Schacht eine Strecke hora 1,4 SW. getrieben und dort Braunstein angefahren, der in seinem Streichen hora 10 SO. ortweise weiter verfolgt werde (40014, Nr. 321, Film 0149). Danach wurde Herr Haupt aber erneut abgeordnet und Herr Lippmann trat wieder an seine Stelle. Letzterer führte seine nächste Befahrung am 3. Mai 1843 durch und berichtete, man baue weiter in 4 Lachter Teufe vom neuen Tageschacht, es werde dort hora 9,4 SO. ein Braunsteinmittel verfolgt und man wolle zudem in derselben Tiefe ein Ort hora 1 SW. anhauen (40014, Nr. 321, Film 0173). Während viele der benachbarten Gruben in den Sommermonaten regelmäßig wegen matter Wetter ganz außer Betrieb standen, war dies hier nicht der Fall und am 13. Juni 1843 hat Herr Lippmann hier Braunstein verwogen und anschließend die Grube wieder befahren (40014, Nr. 321, Film 0181). Man ging jetzt in 5 Lachtern Teufe vom untern Tageschacht aus in SW mit einem Steigort einem 2 – 6 Zoll mächtigen unter 55° in SO fallenden Braunsteintrum nach, andernteils gewann man auch bei 4 Lachtern Teufe aus dem obern Schacht hora 6 W Braunstein „in nicht unbedeutenden Quantitäten.“ Am 18. Juli 1843 fand wieder eine Befahrung statt, über die Herr Lippmann aber „etwas Bemerkenswertes nicht zu erwähnen“ fand (40014, Nr. 321, Film 0192). Und auch am 18. August 1843, als „die übrigen Eigenlöhnergruben dieser Gegend (...) theils wegen Wettermangel nicht zu befahren, theils der eingefallenen Ernte wegen außer Belegung“ waren, standen Wilkauer vereinigt Feld, Gott segne beständig und Riedels Fdgr. in Umgang. Zu diesem Zeitpunkt betrieb man hier das Steigort in 5 Lachter Teufe des unteren Schachtes und gewann „ziemlich reinen Braunstein.“ (40014, Nr. 321, Film 0200) Am 23. August 1843 erhielt Lehnträger Lein zusätzlich zur Fundgrube noch eine erste untere gevierte Maß bestätigt (40169, Nr. 286, Blatt 6). Von seiner nächsten Befahrung am 21. September 1843 berichtete dann auch Herr Lippman, daß sich die Eigenlöhner jetzt „namentlich in dem neu bestätigten Grubenfeld in 6,5 Lachter Teufe gegen NW mit dem nesterweisen Abbau des theils mit Braunstein vermengten, theils aber auch wirklich ausgeschiedenen 2, 3 und 4 Zoll mächtigen Braunsteintrümern enthaltenden Quarzbrockengesteins beschäftigten.“ (40014, Nr. 321, Film 0207f) Bei seiner Befahrung am 26. Oktober fand er demgegenüber dann „keine erwähnenswerten Veränderungen“ vor (40014, Nr. 321, Film 0216). Noch eine weitere Befahrung durch Herrn Lippmann erfolgte am 22. November 1843 (40014, Nr. 321, Film 0224). Jetzt heißt es aber, die Grube werde wegen „mangelndem Braunsteinabsatz nur schwach betrieben.“ Die beiden Eigenlöhner bauten in 4,5 Lachter Teufe des Neuschachtes und in 5 Lachter südlicher Entfernung von diesem mittelst eines Fallortes den „die ganze aus Quarzbrekzie bestehende Gesteinsmasse durchziehenden Braunstein“ ab. Luciae 1843 kehrte Herr Haupt dann wieder nach Scheibenberg zurück und hatte am 11. Dezember hier den ausgebrachten Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 321, Film 0230).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 23. April 1844 befuhr der
Geschworene dann auch Riedels Fdgr. wieder selbst und berichtete
darüber (40014, Nr. 322, Film 0030f),
hier fahren „wegen Mangel an Absatz des Braunsteins nur dann und wann 2
Mann an, welche vor einem aus dem alten Tageschacht bei 6 Lachter Teufe
circa 6,5 bis 7 Lachter weit und mit circa 1,5 Lachter Ansteigen mit
mehreren Krümmungen getriebenen Orte arbeiten, wo in Quarz und braunem
Mulm schöne Nester von Braunstein vorkommen.“ Der neue Schacht war von
dort nur 1 Lachter entfernt und es wäre vortheilhaft, die Strecke mit
diesem durchschlägig zu machen.
Ende April wurde Herr Haupt aber schon wieder anderenorts benötigt und diesmal vertrat ihn dann der Markscheider Friedrich Eduard Neubert. Letzterer befuhr die Gruben bei Langenberg am 28. Mai 1844, fand dabei diese aber unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0042). Auch am 12. Juni 1844 fand Herr Neubert die Mehrzahl der Gruben außer Betrieb vor, wofür er diesmal neben dem in den Sommermonaten üblichen Mangel an Wetterzug noch Absatzprobleme als Grund anführte (40014, Nr. 322, Film 0047f). An jenem Tage, heißt es in seinem Fahrbogen, „beabsichtigte ich, die übrigen im Tännicht und bei Langenberg liegenden Gruben, als Riedels, Reppels, Köhlers, Gelber Zweig, Friedrich, Gott segne beständig, Hausteins, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. zu befahren, sie waren jedoch sämmtlich außer Belegung, wovon bei den meisten die Unmöglichkeit, die Producte zu verwerthen, die Ursache sein mag.“ Gleich am nächsten Tag war Herr Neubert noch einmal hier (und auf Hausteins Fdgr.) und hat „Braunstein- Schaustuffen behufs deren Einsendung zur zollvereinsländischen Industrie- Ausstellung in Berlin ausgeschlagen.“ (40014, Nr. 322, Film 0050f) Etwas Werbung schadet bekanntlich nicht, hat aber wohl auch nicht so schnell geholfen, denn unter dem 1. August 1844 notierte Herr Neubert in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 322, Film 0056), die Grube war „seit meiner vorigen Befahrung nicht belegt gewesen (...) und wo ich auch nichts Veränderliches fand. Die Eigenlöhner gedachter Grube wollen den Betrieb derselben so lange noch sistieren, bis ein größerer Absatz des Braunsteins erfolgt.“ Auch von seiner nächsten Befahrung am 6. September 1844 berichtete er, auf Riedels gev. Fdgr. fahren nur „dann und wann die beiden Besitzer dieser Grube wieder an und arbeiten vor einem Orte, welches bei 4,3 Ltr. Teufe aus dem Neuschacht in SW. 4,8 Lachter fortgebracht war. Vor dem Orte brechen... recht schöne Nester von Braunstein ein.“ Das Tiefste des Neuschachtes und die aus dem alten Schacht getriebenen Baue waren wieder wegen Wettermangel nicht zu befahren (40014, Nr. 322, Film 0064). Immerhin hat Herr Neubert hier am 7. November 1844 dann aber doch 6 Zentner Braunstein zum Verkauf verwogen (40014, Nr. 322, Film 0073f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Offenbar stieg zumindest bei Riedels
Fundgrube die Nachfrage und damit der Absatz von Braunstein auch jetzt noch nicht
an, den im Januar 1845 fügte Herr Neubert seinem Fahrbogen die
Bemerkung
an (40014, Nr. 322, Film 0092):
„Noch bemerke ich, daß die Gruben Rother Stolln zu Schwarzbach und
Hausteins Hoffnung, Gott segne beständig, Gelber Zweig und Riedels Fdgr.
bei Langenberg, welche ich am 14. und 15. Januar mit besuchte, wiederum
nicht belegt waren.“
Ob Herr Neubert einfach immer nur am falschen Tag zugegen war, weiß man nicht so genau. Jedenfalls muß Betrieb umgegangen sein, denn am 16. Mai 1845 war er hier, um die nächsten 8 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 322, Film 0115). Eine Befahrung der Grube hat im ganzen Jahr dagegen nur einmal am 11. September 1845 stattgefunden, worüber man im betreffenden Fahrbogen lesen kann, die Grube sei (wie viele andere auch) nur „periodisch belegt.“ Am oberen Schacht in 4 Ltr. Teufe war ein Braunsteinbau in Betrieb und hora 2,4 SW 5 Ltr. erlängt. Der Braunstein bräche hier zwar häufig, aber sehr mit Hornstein und Quarz vermengt ein (40014, Nr. 322, Film 0139). Von seinen Befahrungen im Revier am 18. und 19. Dezember 1845 heißt es dann wieder im Fahrbogen, an diesem Tage „besuchte ich übrigens noch die Gruben (...) Köhlers, Riedels, Friedrich, Hausteins und Rother Stolln, welche ich jedoch sämtlich nicht belegt fand.“ (40014, Nr. 322, Film 0159) Am 12. Februar 1846 war die Grube, wenn auch nur mit einem Arbeiter, wieder belegt. Dieser baute in 5 Ltr. Teufe am oberen Schacht Braunstein ab (40014, Nr. 322, Film 0172f). Fast dasselbe berichtete Herr Neubert auch von seinen Befahrungen am 16. März und am 23. April 1846 (40014, Nr. 322, Film 0180 und 0191). Im April fuhren wieder zwei Mann an und es war noch bemerkenswert: „Der Braunstein bricht hier mit Quarz und Hornstein vermengt ein und enthält mitunter etwas Mangansamterz.“ Vom dabei ausgebrachten Braunstein hatte Herr Neubert am 24. Februar und am 23. April zusammen 25 Zentner zu verwiegen (40014, Nr. 322, Film 0176 und 0190). Die Mineralbezeichnung ,Mangansamterz' wissen wir nicht zu deuten und ist uns auch noch nicht begegnet. Weitere Befahrungen fanden in diesem Jahr am 24. Juni, am 13. August und am 8. September 1846 statt, wobei es aber in Anbetracht des geringen Betriebes kaum etwas neues zu berichten gab (40014, Nr. 322, Film 0203, 0213 und 0218). Zuletzt gewann man auch wieder etwas Eisenstein. Von seiner Befahrung am 10. Dezember schließlich berichtete Herr Neubert noch, es fuhren jetzt „regelmäßig 2 Mann an“, in 5 Ltr. Teufe hatten sich die Braunsteinanbrüche ganz verloren, stattdessen brach nun etwas Eisenstein ein (40014, Nr. 322, Film 0233). Im zweiten Halbjahr war Herr Neubert auch nur einmal am 18. Dezember zugegen, um wieder 8 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 322, Film 0233). Ein letztes Mal war Herr Neubert am 21. Januar 1847 auf Riedels Fundgrube. Wie eigentlich fast immer fuhren auch jetzt zwei Mann „periodisch“ an, welche nun in der Nähe des obern Schachtes in 9 Ltr. Teufe Braunstein abbauten (40014, Nr. 322, Film 0237). Vermutlich war Herr Neubert noch nicht das letzte Mal hier, doch dann nicht mehr als Geschworenendienst- Versorger. Mit dem Quartal Reminiscere 1847 endet aber die Reihe der überlieferten Fahrbögen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über den Fortgang berichten uns die
Grubenakten, daß dem Lehnträger am 16. August 1848 zum bisherigen
Grubenfeld (eine Fundgrube und ein Maß) noch zwei gevierte Wehre und ein
geviertes Lehn vom Bergamt bestätigt wurden (40169, Nr. 286, Rückseite
Blatt 6). Über den eigentlichen Grubenbetrieb in dieser Zeit schweigen
sich die Akten aus ‒ wahrscheinlich hat er aber auch keinen größeren
Umfang angenommen, als es bisher der Fall gewesen ist. Den
Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 26) zufolge wurden in der zweiten Phase
(von 1832 bis 1850) immerhin 898,5 Zentner Braunstein und 21 Fuder
Eisenstein gefördert. Von 1851 bis 1856 weisen die Erzlieferungsextrakte
kein Ausbringen mehr aus.
Den nächsten Inhalt der Grubenakten bildet erst wieder eine Anzeige des ab 1850 im Revier tätigen Geschworenen Friedrich Gotthold Troll vom 8. August 1853 über Tagesbrüche „über verlaßnen alten Bauen am Raschauer Kirchsteig.“ (40169, Nr. 286, Blatt 7) Es müssen gleich mehrere gewesen sein, denn es heißt darin, nur der erste sei schon wieder eingeebnet worden, ein zweiter, dicht am Wege, sei zwar auch mit Bergen ausgestürzt worden, noch immer aber der offene Bruchtrichter 3 Ellen tief. Geschworener Troll hatte dem Lehnträger Lein die Verfüllung schon mehrfach angeordnet, seine „Ermahnungen (sind) aber bislang fruchtlos geblieben.“ Auf diese Meldung hin setzte das Bergamt dem Lehnträger am 10. August eine Frist von 14 Tagen, um die Verfüllung abzuschließen, widrigenfalls man die Verfüllung selbst auf Kosten der Gesellenschaft vornehmen lassen werde. Ob die Verbrüche untertage, über die in der nächsten Meldung des Geschworenen nach seiner Befahrung am 23. März 1854 berichtet wird, die Tagesbrüche ausgelöst haben, geht aus dem Text nicht klar hervor ‒ unwahrscheinlich sind Zusammenhänge aber keineswegs. Jedenfalls berichtete Herr Troll unter genanntem Datum nach Annaberg, daß durch die Brüche untertage nur 1 Lachter südwestlich vom Schacht und in 6 Lachter Tiefe die Ulme eingestürzt sei und gerade durch Bergeversatz verschlossen werde. Ein zweiter Punkt in 5 Lachter Teufe solle mittels Kastenzimmerung verwahrt werden. Der Geschworene wies die „schnelle Inangriffnahme“ dieser Arbeiten an (40169, Nr. 286, Blatt 8f). Offenbar wurde die Grube auch weiterhin nur mit spärlichsten Mitteln betrieben, denn am 30. September zeigte der Lehnträger dem Bergamt selbst einen bevorstehenden Bruch an und bat um eine Befahrung (40169, Nr. 286, Blatt 10). Der zur Besichtigung ausgesandte Geschworene Theodor William Tröger teilte aber am 9. Oktober an das Bergamt mit, er habe die Grube gar nicht befahren können, weil die Fahrung den Vorschriften überhaupt nicht entspräche, woraufhin das Bergamt natürlich deren Instandsetzung anwies (40169, Nr. 286, Blatt 11). Diese Aufforderung erging schriftlich am 10. Oktober an die beiden Eigenlehner Carl August Lein und Carl Heinrich Lein (40169, Nr. 286, Blatt 13).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danach wird es etwas unübersichtlich.
Offenbar sollte die Grube nun versteigert werden. Zwischen beiden Brüdern
muß es Anfang des Folgejahres darüber zu ernsthaften „Irrungen“
gekommen sein, weswegen das Bergamt die beiden am 9. Januar 1856 zu einem
Verhör nach Schwarzenberg einbestellte (40169, Nr. 286, Blatt 16). Bevor
hierzu aber irgendetwas entschieden war, meldete am 16. Juni 1856 der
Grundbesitzer Karl August Riedel an das Bergamt, daß „der hart
am Fußwege nach Langenberg liegende Schacht bis über die Kaue heraus
eingebrochen“ sei (40169, Nr. 286, Blatt 23). Natürlich wurde die
Verfüllung angeordnet, welche der Kostenaufstellung zufolge aber durch
Lehnträger
Carl August Lein und Christian Gottlieb Kräher vorgenommen
worden ist ‒ also nicht mehr durch die bisherigen Besitzer gemeinsam
(40169, Nr. 286, Blatt 24).
Eine gerichtliche Versteigerung muß in der Zwischenzeit auch erfolgt sein, denn das Kreisamt Schwarzenberg fragte dann am 3. September 1856 beim Bergamt nach gegebenenfalls bestehenden, noch offenen Forderungen (40169, Nr. 286, Blatt 26). Revisor Laue von der Bergrevier- Rechnungsexpedition bezifferte diese schließlich auf rund 43 Thaler, die sich aus unbeglichenen Quatembergeldern, Bergamtsgebühren, Knappschaftsgefällen, rückständigem Zwanzigsten auf verkauften Braunstein und dergleichen mehr zusammensetzten (40169, Nr. 286, Blatt 28ff). Behufs der Auszahlung der nach Abzug aller Gerichtskosten verbleibenden Licitationsgelder beraumte das Gerichtsamt Schwarzenberg dann für den 4. Februar 1857 einen Eröffnungstermin an (40169, Nr. 286, Blatt 34). Aus dem Protokoll darüber erfährt man, daß der Hufschmied Friedrich Julius Peuschel zu Raschau die Grube am 21. Juni 1856 mit seinem Gebot von 238 Thalern ersteigert hat. Nach Abzug aller offenen Kosten verblieben davon 172 Thaler, die unter den beiden Brüdern Lein zu gleichen Anteilen aufgeteilt wurden (40169, Nr. 286, Blatt 36ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue Besitzer erhielt am 23. Mai 1857 erst einmal bestätigt, daß ihm gemäß den Vorgaben des Berggesetzes von 1851 ein Grubenfeld von 2.401 Quadratlachtern oder 3 Maßeinheiten gehörte (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 45). Herr Peuschel zeigte dann am 10. August 1857 in Schwarzenberg an, daß er den uns von anderen Gruben im Revier schon bekannten Herrn Friedrich August Oehme als Schichtmeister und Christian Gottlieb Kräher als Steiger annehmen wolle (40169, Nr. 286, Blatt 47). Während der erstgenannte auch im Bergamt bekannt war und am 19. September als Schichtmeister bestätigt wurde, äußerte sich Geschworener Tröger, danach befragt, zum vorgeschlagenen Steigerdienstversorger am 21. Oktober 1857 abschlägig, da er wohl ein guter Bergmann, aber wegen fehlender Schulbildung als solcher unbefähigt sei (40169, Nr. 286, Blatt 49f). Daraufhin schlug Herr Peuschel den auf Gottes Geschick anfahrenden Bergarbeiter August Friedrich Meinhold als Steiger vor (40169, Nr. 286, Blatt 52). Während die Steigeranstellung vorläufig offen blieb, wurde der Grubenbetrieb durch den neuen Besitzer dennoch sogleich aufgenommen. Der Jahresanzeige des Schichtmeisters Oehme auf 1857 zufolge (40169, Nr. 286, Blatt 58) hatte er 4 Mann auf der Grube angestellt, durch die in 7 Lachter Teufe des Schachtes ein Feldort gegen Osten um 6 Lachter fortgestellt und dort der anstehende Braunstein förstenweise bis 3 Lachter hoch abgebaut worden ist. Außerdem hatte man den Tageschacht um 5 auf nun 13 Lachter verteuft. Dabei hatte man 200 Zentner ausgebracht und für 133 Thaler, 10 Groschen (also den Zentner für 20 Groschen) verkaufen können. Diese Angabe stimmt übrigens wieder einmal nicht (zumindest nicht genau) mit der in den Erzlieferungsextrakten überein, wonach im Jahr 1857 bei Riedels Fdgr. nur 160 Zentner ausgebracht worden seien (40166, Nr. 26). Dann zeigte Schichtmeister Oehme am 26. Juni 1858 im Bergamt an, daß er keinen Grubenriß zu dieser Grube habe, woraufhin Markscheider Reichelt beauftragt wurde, einen solchen anzufertigen (40169, Nr. 286, Blatt 52A).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem dies erledigt war, konnte Herr Oehme auch einen Betriebsplan auf die Periode 1858 bis 1860 im Bergamt einreichen (40169, Nr. 286, Blatt 53ff). Diesem zufolge beabsichtigte man, auch fernerhin vier Mann anzulegen und in diesen drei Jahren in 8 Lachter Teufe und 3½ Lachter nordöstlich vom Schacht ein neues Feldort hora 1 nach Nordost anzusetzen, rund 24 Lachter auszulängen und dabei den Braunstein im Firstenbau zu gewinnen. Dabei hoffte man bei 432 Thaler Kosten pro Jahr auf jeweils 400 Zentner Ausbringen. Denselben Verkaufspreis, wie im Vorjahr erzielt, würde diese Förderung aber nur Einnahmen von 266 Thalern, 21 Groschen bedeuten. Geschworener Tröger, der, wie üblich, den Betriebsplan zur Begutachtung erhielt, befand ihn in seiner Stellungnahme vom 4. August 1858 (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 56) bergtechnisch soweit in Ordnung, nur scheine ihm die Förderung zu niedrig angesetzt, denn „es könne doch keineswegs die Absicht des Grubenbesitzers sein, nur Zubußen zu zahlen...“ Außerdem lehnte Herr Tröger am 5. August 1858 auch den Bergarbeiter Meinhold als Steigerdienstversorger ab, der zwar „ein untadeliger Bergmann“ sei, doch ebenfalls keine ausreichenden Fähigkeiten besäße, um die Steigerfunktion auszufüllen (40169, Nr. 286, Blatt 57A). Seitens des Oberbergamts in Freiberg empfahl man dem Besitzer daraufhin die Anstellung von Robert Theodor Kirbach, bisher auf dem Adolph Stolln tätig (40169, Nr. 286, Blatt 64ff). Der könne außerdem die Steigergeschäfte auch bei Friedrich Fdgr. und bei Hausteins Hoffnung mit übernehmen, wo die Position gerade auch vakant war. Das wiederum lehnten aber die Besitzer der drei Gruben übereinstimmend ab, weil dessen Lohnforderungen zu hoch seien (40169, Nr. 286, Blatt Rückseite 68). Stattdessen wollte Herr Peuschel auf seiner Riedels Fdgr. nun den Steiger David Menzel als solchen annehmen und ihm für die Versorgung der Steigergeschäfte auf seiner Grube 5 Neugroschen pro Woche zahlen. Damit kam man überein und so wurde Herr Menzel als Steiger auf Riedels Fundgrube am 17. November 1858 vom Bergamt bestätigt (40169, Nr. 286, Blatt 70). Auch der Betriebsplan wurde am 24. November 1858 vom Oberbergamt zugelassen (40169, Nr. 286, Blatt 72). Der Anzeige des Schichtmeisters auf das inzwischen verflossene Jahr 1858 zufolge hatte man in diesem Jahr mit nun inklusive des Steigers 5 Mann Belegung Feldörter in 5 Lachter und in 8 Lachter Teufe betrieben, außerdem von der 7 Lachter- Sohle aus und 14 Lachter nordöstlich vom Schacht ein Gesenk auf die darunterliegende Sohle geteuft. Dabei wurden 360 Zentner Braunstein gefördert und davon 310 Zentner für 237 Thaler, 15 Groschen verkauft (also hatte man in diesem Jahr sogar einen besseren Preis von 23 Groschen pro Zentner erzielen können), der Rest verblieb im Vorrat (40169, Nr. 286, Blatt 83f). Die Zahlenangabe von 310 Zentnern Verkauf stimmt übrigens diesmal mit der in den Erzlieferungsextrakten überein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wer nun denkt, das läßt sich doch ganz
gut an und der neue Besitzer wird die Grube wieder eine Zeitlang
betreiben, der irrt sich. Bereits am 22. Februar 1859 hat Herr Peuschel
die Grube für 445 Thaler an Ernst Erdmann Zweigler wieder verkauft,
was das Gerichtsamt gegenüber dem Bergamt am 24. Mai bestätigte (40169,
Nr. 286, Rückseite Blatt 77f). In der Folgezeit bis 1866 hat Herr
Zweigler dann in Langenberg noch drei
Herr Zweigler ging die Sache nun ernsthaft an: Er stellte einen Bauantrag für eine Kaue an das Gerichtsamt, was am 21. September 1859 im Bergamt protokolliert wurde (40169, Nr. 286, Blatt 80). Die brauchte er wohl auch, denn der Anzeige des Schichtmeisters auf 1859 (40169, Nr. 286, Blatt 84f) ist zu entnehmen, daß er neben den 4 festangestellten Bergleuten noch weitere 6 Weilarbeiter angelegt hatte. Mit der so vergrößerten Belegung betrieb man in 8 Lachter Teufe Firstenbau auf zwei Feldorten gegen Süd und gegen Ost sowie auf einem Ort in 10 Lachter Teufe gegen Ost. Außerdem waren weitere Versuchsstrecken und das im Vorjahr schon erwähnte Gesenk belegt und der Riedelschacht wurde um weitere 2,3 Lachter tiefer abgesenkt. Dabei brachte man 1.012 Zentner Braunstein aus, die man für 988 Thaler, 10 Groschen (also im Schnitt nun für knapp 30 Groschen oder etwas weniger als 1 Thaler den Zentner) verkaufen konnte. Und eigentlich müßten ja auch noch 50 Zentner aus dem Vorjahr in Vorrat gewesen sein... Jedenfalls stimmt diese Angabe wieder einmal nicht mit der in den Erzlieferungsextrakten genannten Verkaufsmenge überein (dort sind 1.236 Zentner für 1859 angegeben). Auch der Streit zwischen den Gebrüdern Lein hatte noch ein Nachspiel: Noch immer standen offenbar Bergamtsgebühren seitens der früheren Besitzer aus (40169, Nr. 286, Blatt 79). Der unbeglichenen Forderungen halber entließ Herr Zweigler am 16. Oktober 1860 den Doppelhäuer Carl August Lein, den früheren Lehnträger, der also weiter auf der ihm früher gehörigen Grube arbeitete, sowie den Lehrhäuer Friedrich Gustav Lein (40169, Nr. 286, Blatt 91). Am 8. November dieses Jahres zeigte Herr Zweigler dann noch die Entlassung des bisherigen Steigerdienstversorgers Menzel und die vorgesehene Anstellung von Friedrich August Hartmann, zuvor auf Herkules samt Frisch Glück am Fürstenberg bei Waschleithe tätig, als neuen beim Bergamt an (40169, Nr. 286, Blatt 94). Aufgrund des angewachsenen Grubenbetriebes sollte dieser nun 3 Thaler Wochenlohn erhalten. Das Bergamt genehmigte die Anstellung am 10. November 1860 (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 94). Außerdem beantragte Herr Zweigler am 19. Oktober 1860
noch die Konsolidation seiner kurz zuvor gemuteten
Der Anzeige von Schichtmeister Oehme auf 1860 (40169, Nr. 286, Blatt 98) ist dann zu entnehmen, daß Herr Zweigler die Belegung noch einmal auf 9 Bergleute und 18 Weilarbeiter, in Summe als nun 27 Mann, vergrößert hatte. Der Abbau erfolgte auf der 10 Lachter- Sohle und 11 Lachter östlich vom Riedelschacht, wo man in diesem Jahr 21 Quadratlachter Feld abgebaut hat. Ferner wurde 40 Lachter nordwestlich vom Riedelschacht ein weiterer Schacht abgesenkt und 100 Lachter nordwestlich der Juno Stolln angehauen, den man noch in 1860 auf 30 Lachter hora 9,4 Südost erlängt hat. Dabei wurden 2.489 Zentner Braunstein ausgebracht und für 2.074 Thaler, 5 Groschen (respektive den Zentner für 25 Groschen) verkauft ‒ eine Fördermenge, die es wohl, außer vielleicht in den Anfangsjahren auf Wilkauer vereinigt Feld, im Revier noch nie gegeben hat. Nur angemerkt sei hier, daß in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 26) für 1860 ein Ausbringen von 2.000 Zentnern angegeben ist. Wie diese Abweichungen zustandekommen, ist unbekannt. Schichtmeister Oehme konnte denn auch im Quartal Crucis 1860 eine Abrechnung vorlegen, nach der es insgesamt 85 Thaler, 27 Neugroschen Ausbeute gab und 298 Thaler 2 Groschen, 8 Pfennige Verlag erstattet wurden, eine Rechnung die man ‒ auch gleich noch am 10. November 1860 ‒ im Bergamt nur allzu gern genehmigt hat (40169, Nr. 286, Blatt 95). Auf den 5. November 1860 datiert auch ein erster Fahrbericht des Geschworenen Tröger zu der vereinigten Grube (40169, Nr. 286, Blatt 120f). Er fand den Juno Stolln ebenfalls auf 30 Lachter vom Mundloch herein fortgestellt und den neuen Tageschacht, 40 Lachter östlich vom alten, auf 12 Lachter Teufe abgesenkt. Dort habe man aber nur „schwache Trümchen von Braunstein“ gefunden, die unbauwürdig seien, was sich wohl auf die Feldstrecke in westlicher Richtung bezogen hat, die in der nachstehend zitierten Anzeige des Schichtmeisters auf das folgende Jahr ebenfalls erwähnt ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr erweiterte Herr Zweigler das Grubenfeld von Riedels Fdgr. noch dreimal. Er erhielt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Betriebsperiode 1861/1863 war wieder ein neuer Betriebsplan fällig, in dem Herr Zweigler festhielt, er wolle im Durchschnitt 23 Mann anlegen und in den drei Jahren den Juno Stolln bis zum Riedelschacht durchschlägig machen. Dabei sollten 3.000 Zentner Braunstein pro Jahr gewonnen und für 1 Thaler der Zentner abgesetzt werden. Über den gesamten Betriebszeitraum rechnete er mit Betriebskosten von 9.773 Thalern und mit mindestens gleich hohen Einnahmen aus dem Erzverkauf (40169, Nr. 286, Blatt 104ff). In seiner Bewertung vom 2. Dezember 1861 hielt Geschworener Tröger fest, er finde den Plan „den günstigen Verhältnissen entsprechend“ und hatte nichts einzuwenden (40169, Nr. 286, Blatt 109). Daraufhin wurde der Betriebsplan am 8. Februar 1862 auch vom Oberbergamt zugelassen (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 112). In der Zwischenzeit konnte Schichtmeister Oehme in seiner Anzeige auf das inzwischen abgelaufene Jahr 1861 (40169, Nr. 286, Blatt 111f) berichten, daß tatsächlich 23 Mann auf Riedels Fundgrube anfuhren, nämlich
Der Juno Stolln wurde um 84 Lachter auf nun 114 Lachter ausgelängt. Bereits bei 26 Lachter Erlängung hatte man ein erstes Flügelort hora 1 Nordost angehauen und 7½ Lachter ausgelängt. Bei 31 Lachter Erlängung hatte man das Lager angefahren und in dessen Streichen hora 3,4 nach Nordost 20 Lachter und nach Südwest 1 Lachter Feldstrecken aufgefahren. Vor beiden Örtern hatte man zudem Gesenke abzuteufen begonnen. Dem unten noch zitierten Fahrjournal des Berggeschworenen zufolge hatte man bei 45½ Lachter Erlängung aber auch das Liegende des Lagers und wieder Glimmerschiefer erreicht. Ein vierter Stollnflügel wurde bei 106½ Lachter Erlängung hora 3 Südwest angehauen und 5 Lachter fortgebracht. Der neue Tageschacht 70 Lachter nordwestlich vom Riedelschacht (Waren es nicht zuvor nur 40 Lachter Distanz oder hatte man schon wieder einen neuen begonnen ?) hatte man im gleichen Zeitraum auf 12 Lachter Teufe niedergebracht und bei 7 Lachter Teufe ein erstes Feldort 7½ Lachter hora 9 Südost und in 12 Lachter Teufe zwei weitere im Streichen des Lagers hora 5 nach Osten 20 Lachter und nach Westen 12 Lachter ausgelängt, auf letzterem aber das Lager nicht mehr bauwürdig vorgefunden und das Ort wieder sistiert. Auf dem Riedelschacht selbst hatte man in 10 Lachter Teufe und 15 Lachter östlich vom Schacht in diesem Jahr 17 Quadratlachter Feld abgebaut. Einem Fahrbericht des Berggeschworenen vom 23. August 1861 zufolge lag die Belegung zu diesem Zeitpunkt sogar bei 25 Mann und der Abbau werde „mit sehr günstigem Erfolg“ betrieben (40169, Nr. 286, Blatt 126). Das Ausbringen summierte sich in diesem Jahr jedenfalls auf 3.625 Zentner Braunstein (diesmal stimmt die Menge mit der Angabe in den Extrakten wieder überein), die man für 2.567 Thaler, 15 Groschen verkaufen konnte (40169, Nr. 286, Blatt 111f). Den erwünschten Preis von 1 Thaler pro Zentner konnte man dabei freilich nicht erzielen, vielmehr ist er auf 21 Groschen pro Zentner wieder gefallen. Ja, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt... Diese Gesetzmäßigkeiten sind ja allgemein bekannt und waren auch damals genauso wirksam.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem Fahrjournal des Geschworenen Tröger vom 1. Oktober 1861 (40169, Nr. 286, Blatt 114) zufolge wurde zu diesem Zeitpunkt der Abbau in 12 Lachter Teufe in östliche Richtung verführt, womit er im Vergleich mit den Angaben in der Anzeige des Schichtmeisters oben nur den neuen Schacht gemeint haben kann, „wobei in dem Quarzbrockenfels Braunsteinausscheidungen von Centner Größe und stalactitenförmiger Bildung“ vorgekommen seien. Der Abbau werde aber durch „Sumpfwasser“ behindert, da der Juno Stolln noch nicht eingebracht sei. Es fehlten zwar nur noch 4 Lachter Auslängung, doch werde auch dessen Forttrieb durch Lettenklüfte im Glimmerschiefer und starken Wasserzudrang behindert. Des erwarteten Durchschlags halber war Herr Tröger bereits am 23. Januar 1862 wieder vor Ort und berichtete uns in seinem Fahrjournal (40169, Nr. 286, Blatt 115), daß das Juno Stollnort nun bei 110½ Lachter Erlängung unter dem Tageschacht stehe, welcher gegenwärtig auf 14 Lachter abgesenkt sei. Es blieb eigentlich nur noch 1 Lachter abzuteufen, doch waren die Wasserzuläufe so groß, daß „der Grubenbesitzer genöthigt war, den Orthäuern wasserdichte Kutten machen zu lassen, die sie über die Kittel zogen, um Schutz gegen die von der Förste hereinkommenden Wasser zu verschaffen.“ Es dauerte noch bis zum 24. Mai 1862, bis man dann im Bergamt Schwarzenberg zu Protokoll nehmen konnte, daß der Schacht in 16 Lachter Teufe auf die Stollnsohle niedergekommen war (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 121). Von der Stollnfirste bis zur 13 Lachter- Streckensohle, „wo das Lager aus weichem Thon und Schiefermasse mit Mulm“ bestand, stand der Schacht in „Schrothzimmerung“ (vermutlich ist Vollschrot- Ausbau gemeint), darüber auf 8,4 Lachter Teufe im Quarzbrockenfels ohne Ausbau und auf den oberen 3,4 Lachtern Teufe in „Bolzenzimmerung mit Pfosten- Auspfählung.“ Die letztere war offenbar reparaturbedürftig, weswegen man seitens des Bergamtes dessen Ausbesserung anwies. Dies zu kontrollieren, war Herr Tröger am 26. Juni 1862 wieder vor Ort und fand im Tageschacht bis zur 8 Lachter- Streckensohle neue Wandruthen und Auspfählung eingebaut (40169, Nr. 286, Blatt 123). Allerdings befand er auch, daß der Schacht in dem Abschnitt, wo er den Brockenfels durchsinkt, nur 3 Ellen, 4 Zoll lichte Weite besäße, so daß hier die Fahrung innerhalb des Fördertrums eingebaut worden sei. Das war natürlich auch damals schon unzulässig und der Geschworene hat die Nutzung als Fahrschacht sofort untersagt, vielmehr angeordnet, daß man einen neuen Fahrschacht von übertage bis auf die 8 Lachter- Sohle teufen solle. Schließlich hatte Herr
Zweigler schon am 13. Juli des Vorjahres dem Bergamt angezeigt, daß er
mit dem Mühlenbesitzer Johann Heinrich Freitag zu Raschau noch
keine Einigung über den Grundzins für die auf dessen Grund und Boden
vorgesehene Haldensturzfläche vor dem Mundloch des Juno Stollns,
sowie für Kaue und Ausschlagplatz erzielen konnte. Auch ein Kaufangebot
über die betreffende Fläche habe letzterer abgelehnt, woraufhin Herr
Zweigler nun um ,Expropriation' besagter Fläche ersucht hatte
(40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 101). Das wäre eine staatliche
Beschlagnahmung gewesen. Das diesbezügliche Gutachten des Berggeschworenen
Tröger datiert erst auf den 25. Mai 1862 (40169, Nr. 286,
Blatt 116ff) und besagt, man habe sich inzwischen mit dem Grundbesitzer
doch vereinigt und von eine Expropriation könne abgesehen werden. Herr
Zweigler hatte die benötigte Fläche von 175½ Quadratruthen, Wegerecht
und Stollnrösche eingeschlossen, für 180 Thaler von Herrn Freitag
gekauft. Eine ähnliche Geschichte gab es schon einige Jahre
Nicht zuletzt erhielt Herr Zweigler am 6. September 1862 vom Bergamt nochmals weitere 37.301 Quadratlachter Grubenfeld bestätigt, so daß das gesamte Feld von Riedels Fundgrube samt Juno Stolln nun 118.693 Quadratlachter oder 119 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 124).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schichtmeister Oehme konnte dann
in seiner Anzeige auf das Jahr 1862 berichten, daß mit Schluß des Jahres
21 Mann auf der Grube angelegt seien. Man hatte am Riedelschacht in 10 Lachter
Teufe und 11 Lachter südlich von diesem 6 Quadratlachter und in 12 Lachter
Teufe und 6 Lachter östlich von diesem 40 Quadratlachter Feld abgebaut.
Dabei hatte man die enorme Menge von 5.411 Zentnern Braunstein ( !! )
ausgebracht und zum Preis von 25 Neugroschen pro Zentner sämtlich
verkauft. (Warum in den Erzlieferungsextrakten für 1862 nur ein Ausbringen
von 5.381 Zentnern festgehalten ist, bleibt unklar...) Daneben hatte man
auch noch 218 Fuder Eisenstein gefördert und davon 102 Fuder zu 2 Thaler,
5 Groschen verkaufen können. (Letztere Angabe stimmt mit der in den
Extrakten überein.) Auch hier findet man nun die Angabe, daß das
Volumenmaß 1 Fuder ein Gewicht von 17 Zentnern beinhaltete (40169,
Nr. 286, Blatt 132f).
Bei solch erfolgreichem Betrieb ergab die Berechnung des Schichtmeisters im Quartal Luciae 1862 auch, daß man wieder 70 Thaler, 6 Groschen, 6 Pfennige Verlag erstatten und überdies noch 807 Thaler, 19 Groschen, 5 Pfennige Ausbeute auszahlen könne, was das Bergamt am 24. Januar 1863 auch genehmigte (40169, Nr. 286, Blatt 127ff). Es verwundert daher auch nicht, daß Geschworener Tröger bei seiner Befahrung im Quartal Crucis 1863 auf der Grube 35 Mann ( !! ) angelegt fand (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 134). Das waren mehr, als bei Wilkauer vereinigt Feld in deren besten Zeiten... Den Grubenbetrieb anlangend, berichtete Herr Tröger, man habe mit einem Strossenbau auf der 12 Lachter- Sohle 7,5 Lachter vom Stollnkreuz in den Juno Stolln durchgeschlagen und dort noch bis 1,5 Lachter unter der 12 Lachter- Sohle „eine Einlagerung von sehr gutem Braunstein“ angetroffen, dann aber bis Stollnsohle Hornstein mit Braunsteintrümern, „wovon reichlich die Gewinnungskosten gedeckt werden.“ Ferner liest man noch: „Das mittägige Flügelort, vor welchem zur Zeit keine Erze einbrechen, ist mit 4 Mann in Betrieb, um damit unter die Baue der früheren Grube Junge Gesellschaft zu gelangen.“ Wohl zu diesem Behufe erhielt Herr Zweigler am 9. September 1863 noch einmal weitere 75.360 Quadratlachter Grubenfeld bestätigt, so daß es insgesamt nun schon 194.053 Quadratlachter umfaßte (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 135). Junge, Junge ‒ Herr Zweigler
hatte große Pläne... Wenn er die umgesetzt hätte, hätte er auch gleich bis
auf den
Auch die Anzeige des Schichtmeisters auf das Jahr 1863 (40169, Nr. 286, Blatt 137f) berichtet uns, daß man den Juno Stolln vom Riedelschacht aus um weitere 19,6 Lachter auf nunmehr 133,6 Lachter vom Mundloch fortgebracht habe. Das südwestliche Flügelort wurde um 11,5 auf nun 21,5 Lachter ausgelängt und ein weiteres Flügelort nach Ost angehauen und 4,2 Lachter erlängt. Der Abbau konzentrierte sich wohl wieder auf den Bereich des Riedelschachtes, wo man auf der 12 Lachter- Sohle und 17 Lachter südöstlich vom Schacht 50 Quadratlachter Feld abgebaut hatte. Ausgebracht hatte man dabei 4.592 Zentner Braunstein, welchen man für 3.978 Thaler sämtlich verkauft hatte, im Schnitt also für 26 Groschen den Zentner. Daneben hatte man auch wieder 315 Fuder Eisenstein gefördert und alles, zusammen mit dem aus dem Vorjahr verbliebenen Vorrat also 431 Fuder, für 874 Thaler (folglich im Schnitt für je 2 Thaler, 1 Groschen das Fuder) verkauft. Diese Angaben kommen denen in den Erzlieferungsextrakten nahe, stimmen aber wieder nicht überein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im nächsten Jahr 1864 hielt der
einträgliche Betrieb an: Geschworener Tröger berichtete in seinem
Fahrbogen vom 19. Juli 1864 (40169, Nr. 286, Blatt 137f), daß beide
Stollnflügelörter „in schwunghaftem Betriebe stehen“ und inzwischen
35 bzw. 40 Lachter ausgelängt waren. Sie „halten im Braunsteinlager,
jedoch zur Zeit ohne Veredlung.“ Dagegen war der Abbau über der 12
Lachter- Sohle „sehr ergiebig, so daß wöchentlich mindestens 100
Centner gefördert werden.“
Aber Herr Zweigler hatte offenbar immer noch nicht genug und ließ sich am 3. August 1864 weitere 45.874 Quadratlachter zum bereits bestätigten Grubenfeld hinzu verleihen, so daß es nunmehr insgesamt 239.927 Quadratlachter oder 240 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 138). Außerdem erwarb Herr Zweigler im Jahr 1864 noch die Gruben
Sein nächster Betriebsplan für die Riedels Fdgr. auf die Periode von 1864 bis 1866 sah vor (40169, Nr. 286, Blatt 141ff), auf dem „hora 6 streichenden und in Mitternacht fallenden, 1 bis 2 Lachter mächtigen Lager, welches aus Quarz, Hornstein, Gneis, braunem Ocker und nierenweis einbrechendem Braunstein besteht,“ weiterhin oberhalb der 12 Lachter- und der 10 Lachter- Sohle abzubauen. Dabei strebte Herr Zweigler ein Ausbringen von 6.500 Zentnern Braunstein und 200 Fuder Eisenstein pro Jahr an. er rechnete mit 4.750 Thalern Einnahme pro Jahr, allerdings auch bei 4.893 Thalern Kosten im Jahr 1864. Bei einem Kassenbestand Schluß des Jahres 1863 von 1.744 Thalern würden nach Ablauf der Periode 1.342 Thaler übrigbleiben. Eigentlich war es also trotzdem eine „Nullnummer“. Herr Tröger jedenfalls hatte in seiner Stellungnahme vom 24. September zu diesem Betriebsplan „keine Bedenken“ und so wurde er am 5. Oktober 1864 auch vom Oberbergamt genehmigt (40169, Nr. 286, Blatt 147). Die Anzeige des Schichtmeisters auf 1864 (40169, Nr. 286, Blatt 149f) sagt uns dann auch, daß man mit 32 Mann Belegung die beiden oben erwähnten Flügelörter betrieben und auf 65,4 bzw. 30,1 Lachter ausgelängt habe. Auf der 10 Lachter- und auf der 12 Lachter- Sohle wurden in diesem Jahr 47 Quadratlachter östlich vom Riedelschacht ausgehauen. Dabei hatte man 286 Fuder Eisenstein und 5.800 Zentner Braunstein ausgebracht und sämtlich auch absetzen können (Volltreffer: Beide Angaben stimmen mit denen in den Erzlieferungsextrakten überein.). Für das Fuder Eisenstein erzielte man einen Preis von durchschnittlich 1 Thaler, 24 Groschen; für den Zentner Braunstein nur noch von 20 Groschen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berggeschworener Tröger
berichtet uns dann in seinem Fahrbogen vom 6. Februar 1865 (40169,
Nr. 286, Rückseite Blatt 150), daß man bei 50 Lachter Erlängung vom
Streckenkreuz mit dem nordöstlichen Flügelort bei 14,3 Lachter Teufe in
den Juno Tageschacht (er hat einen Namen bekommen) durchgeschlagen
sei und das Ort noch 10 Lachter weiter ins Feld gebracht habe, dort aber
in den Glimmerschiefer gekommen war.
In der Jahresanzeige auf 1865 (40169, Nr. 286, Blatt 153f) heißt es, daß Schluß dieses Jahres auf Riedels Fdgr. 38 Mann angelegt waren und daß der östliche Stollnflügel nun 93,4 Lachter vom Kreuz ausgelängt war, wo man einen weiteren Tageschacht 16 Lachter tief niedergebracht hatte. Abbau ging auf der 8 Lachter-, auf der 10 Lachter- und auf der 12 Lachter- Sohle zwischen 7 und 17 Lachter östlicher Entfernung vom Riedelschacht um, wo man in diesem Jahr 62 Quadratlachter Feld ausgehauen hatte. Obwohl dies die größte, bis dahin jemals binnen einen Jahres abgebaute Feldfläche gewesen ist, sank das Ausbringen auf 210 Fuder Eisenstein und 4.571 Zentner Braunstein doch spürbar ab. Während der Braunstein für 3.047 Thaler, 10 Groschen vollständig verkauft werden konnte (wenn auch wieder nur für 20 Groschen der Zentner), blieb der Eisenstein im Vorrat liegen. Aus dem Fahrbogen des Berggeschworenen vom 22. Januar 1866 (40169, Nr. 286, Blatt 152) erfährt man noch, daß sich bei dem weiteren Vortrieb des nordöstlichen Stollnflügels matte Wetter eingestellt haben, woraufhin man den neuen Schacht im Köhlers Hoffnung'er Feld angesetzt habe. Der war zu diesem Zeitpunkt 15 Lachter niedergebracht und der Durchschlag stehe bevor. Ferner berichtet uns Herr Tröger, daß man mit dem Stollnvortrieb zwar nicht, wohl aber mit dem Tageschacht abbauwürdige Braunsteinlager durchsunken habe. Wohl aus diesem Grund änderte sich im weiteren Verlauf auch die Zweckbestimmung dieses Schachtes, der nun Köhlerschacht genannt wurde: Im Bergamt wurde nach dem Fahrbogenvortrag des Geschworenen am 7. April 1866, „bergpolizeiliche Maasregel betreffend,“ protokolliert (40169, Nr. 286, Blatt 157), daß dieser Schacht inzwischen auf das Juno Stolln- Flügelort durchschlägig sei und eigentlich nur als Flucht- und Wetterschacht habe dienen sollen, nun aber auch zur Förderung genutzt werden solle. Da er aber nur 3,5 Ellen lichte Weite aufweise, könne man Fahrung nur innerhalb des Fördertrums einbauen, was natürlich zu untersagen sei. Das sah man im Bergamt auch so. Am 14. Februar 1866 teilte Herr Zweigler dem Bergamt mit, er wolle den bisherigen Obersteiger Hartmann entlassen und an seiner Stelle den Doppelhäuer Eduard August Merkel für 4 Thaler Wochenlohn als Steigerdienstversorger annehmen, was das Bergamt auch genehmigte (40169, Nr. 286, Blatt 155). Am 21. Juni war Herr Tröger erneut zu einer Befahrung vor Ort und berichtete, daß man das im Köhlerschacht in 4 Lachter Teufe angetroffene Lager nach Süden untersuche und sehr guten Braunstein, bis zu 16 Zoll mächtig, angetroffen habe. Auch am Fundschacht gäbe es weiterhin gute Anbrüche, doch wolle der Besitzer Fristsetzung beantragen, da „die Eisenbahn vom hiesigen Bahnhofe außer Betrieb gesetzt und der Absatz daher gänzlich unterbrochen“ sei (40169, Nr. 286, Blatt 160). Am 23. Juni 1866 beantragte Herr Zweigler dann auch für die drei ihm gehörigen Gruben Riedels Fdgr., Gelber Zweig und Gott segne beständig Fristhaltung, „weil die gewonnen werdenden Eisen- und Braunsteine nicht zum Verkauf gebracht werden können,“ was vom Bergamt unter diesen Umständen genehmigt worden ist (40169, Nr. 286, Blatt 158f). Nach Ablauf des Quartals war die Eisenbahnverbindung von Schwarzenberg aber offenbar wieder in Betrieb und auch der Grubenbetrieb wieder im Gange. Jedenfalls berichtete Herr Tröger in seinem Fahrjournal vom 17. September 1866 (40169, Nr. 286, Blatt 161), man habe mit dem Flügelort vom Juno Stolln nun 9,5 Lachter nordöstlich vom Köhlerschacht ein Eisensteinlager, hora 9 streichend und 20° nach Nordost fallend, angefahren. Besagtes Flügelort hatte man weitere 10 Lachter fortgestellt und hierbei bei 6¼ Lachter weiterer Auslängung ein bis 0,5 Lachter mächtiges Braunsteintrum überfahren, auf diesem auch nach Südosten ausgelängt. Dagegen wären die Anbrüche am Riedelschacht geringer geworden. Dasselbe berichtete auch Schichtmeister Oehme in der Anzeige auf das Jahr 1866 (40169, Nr. 286, Blatt 163f). Angelegt waren auf Riedels Fdgr. nun 49 Mann ‒ eine Belegung, die nie wieder übertroffen worden ist. Abbau ging wie zuvor auf der 8 Lachter-, auf der 10 Lachter- und auf der 12 Lachter- Sohle zwischen 9 und 20 Lachter östlicher Entfernung vom Riedelschacht um, wo man in diesem Jahr 58 Quadratlachter Feldfläche abgebaut hatte; ferner auch auf der Stollnsohle am Köhlerschacht weitere 3,5 Quadratlachter. Dabei wurden 23 Fuder Eisenstein ausgebracht und zum Vorrat gelegt sowie 5.518 Zentner Braunstein. Vom letzteren konnten 5.493 Zentner für 3.662 Thaler verkauft werden (der erzielte Preis blieb bei 20 Groschen für den Zentner), der Rest kam zum Vorrat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleich am 26. Januar 1867 wurden Herrn
Zweigler noch einmal 52.559 Quadratlachter Grubenfeld verliehen, so
daß es nun (allein bei Riedels Fdgr., denn er besaß ja auch noch
die Gruben Gelber Zweig und Gott segne beständig, seit
30. September 1866 außerdem die Grube
Am 10. Mai des Jahres 1867 brachte dann der Zimmermann Friedrich Hartmann aus Raschau im Bergamt Schwarzenberg seine Besorgnis vor, daß der intensive Abbau, wie er durch Riedels Fundgrube betrieben werde, die Oberfläche gefährde, wovon auch sein Grund bereits betroffen sei (40169, Nr. 286, Blatt 165). Das Bergamt beauftragte den Geschworenen Tröger daraufhin mit „unverweilter Erörterung und Anzeige.“ Derselbe erstatte auch schon eine Woche später seinen Bericht (40169, Nr. 286, Blatt 167f). Demnach hatte es tatsächlich schon 1866 einen ersten Tagesbruch und 14 Tage vor seiner Besichtigung einen zweiten gegeben, und zwar „durch Zubruchgehen alter Baue über der 10 Lachter Strecke, wo seit undenklichen Zeiten vom Tage nieder Abbau statt gefunden hat,“ und diese Verbrüche untertage „griffen nun zutage aus.“ Über die Abbauführung kam der Geschworene aber zu der Ansicht: „Was ferner das Urtheil Hartmanns über den fehlerhaften Betrieb der Grubenbaue, wodurch deren baldiges Zusammenbrechen nicht verhindert werden könne, betrifft, so muß ich dessen Urtheil gänzlich zurückweisen.“ Im Gegenteil fand er gerade bei Riedels Fundgrube die Strecken auf bedeutende Längen mit neuer Türstockzimmerung versehen und in gutem Stand. Im Übrigen habe auch Grubenbesitzer Zweigler nicht nur die Tagesbrüche wieder auffüllen lassen, sondern dem Grundbesitzer auch Entschädigung angeboten, wenn dieser denn mit ihm Rücksprache nähme. Daraufhin wies auch das Bergamt am 29. Mai 1867 Herrn Hartmann's Beschwerde zurück (40169, Nr. 286, Blatt 169). Die Anzeige des Schichtmeisters Oehme auf das Jahr 1867 (40169, Nr. 286, Blatt 178f) besagt dann, daß wie im Vorjahr 49 Mann angelegt waren. Das Flügelort des Juno Stollns hatte man, wie es Geschworener Tröger schon beschrieben hatte, noch über den Köhlerschacht hinaus getrieben, dann aber „wegen bedeutender Wasserzugänge“ sistieren müssen. Stattdessen hatte man neue Versuchsörter auf der 8 Lachter- und 12 Lachter- Sohle am Riedelschacht angehauen. Abbau ging wie zuvor auf der 8 Lachter-, auf der 10 Lachter- und auf der 12 Lachter- Sohle zwischen 10 und 22 Lachter östlicher Entfernung vom Riedelschacht um, wo man in diesem Jahr die Rekordfläche von 68 Quadratlachter Feld abgebaut hatte. Außerdem hatte man 16 Lachter nördlich vom Köhlerschacht weitere 12 Quadratlachter abgebaut. Dabei wurden zum einen 10 Fuder Eisenstein ausgebracht, so daß der Vorrat nun auf 243 Fuder angewachsen war, wovon man aber diesmal auch 85 Fuder absetzen konnte. Zum anderen förderte man die Rekordmenge von 7.080 Zentnern Braunstein, wovon man 6.181 Zentner für 4.120 Thaler, 10 Groschen (wieder für 20 Groschen der Zentner) absetzen konnte; mithin verblieb ein Vorrat von 924 Zentnern. Die Verkaufszahlen stimmen wieder mit den Angaben in den Erzlieferungsextrakten überein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 31. Januar 1868 ersetzte Herr
Zweigler zunächst einmal den bisherigen Steigerdienstversorger
Merkel durch den Steiger Friedrich August Wolf, den er ohnehin
auf seiner Grube Gelber Zweig angestellt hatte (40169, Nr. 286,
Blatt 172ff), was man seitens des Bergamtes auch am 8. Februar des Jahres
genehmigte. Auch die Belegung bei Riedels Fdgr. wurde nun deutlich
reduziert: Der Anzeige des Schichtmeisters auf das Jahr 1868 (40169,
Nr. 286, Blatt 180f) ist zu entnehmen, daß man mit noch 32 Mann Belegung
zunächst 90 Lachter östlich vom Köhlerschacht einen „4. Riedelschacht“
auf 6 Lachter Teufe abgesenkt, aber wegen zuviel Wasserzugangs wieder
aufgegeben hatte. Danach hat man 10 Lachter zurück einen „5. Riedelschacht“
8 Lachter tief abgesunken und nordöstlich vom Köhlerschacht einen
Stollnquerschlag in dessen Richtung angehauen. Auch die Versuchsörter am
Riedelschacht waren weiter belegt. Der Abbau dort hatte sich
inzwischen auf 8 bis 24 Lachter vom Schacht entfernt, wo man in diesem
Jahr 60 Kubiklachter und am Köhlerschacht weitere 17 Kubiklachter
ausgehauen hatte. Dabei konnten 4.027 Zentner Braunstein, aber kein
Eisenstein mehr ausgebracht werden. Zusammen mit dem vom Vorjahr
verbliebenen Vorrat wurden 1868 aber alle 4.951 Zentner Braunstein für
3.300 Thaler, 20 Groschen verkauft.
Das Jahr darauf brachte mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Berggesetzes für das Königreich Sachsen organisatorische Veränderungen in der Bergbehörde mit sich. Leider endet damit auch die Überlieferung der Betriebsanzeigen. Auf Riedels Fundgrube gab es auch personelle Veränderungen, denn Herr Zweigler stellte am 30. Juli 1869 den Obersteiger Albrecht Hartmann wieder als technischen Leiter für alle vier, ihm inzwischen gehörigen Gruben in Langenberg an (40169, Nr. 286, Blatt 182f). Ansonsten aber schritt der Betrieb offenbar in gleicher Weise fort und den Angaben in den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen zufolge brachte man erneut 3.888 Zentner Braunstein zum Absatz. Das erste Fahrjournal des Berginspektors Gustav Netto aus Zwickau vom 26. Juli 1870 berichtet uns von einem Verbruch, etwa 50 Lachter vom Mundloch des Juno Stollns entfernt. Da man ihn nicht gewältigen konnte, fuhr man einen Umbruch auf (40169, Nr. 286, Blatt 184f). Damit hatte man aber auch keinen rechten Erfolg, denn ein Dreivierteljahr später, am 18. März 1871, berichtete Herr Netto, daß man den Umbruch in der nördlichen Ulme des Stollns „wegen Wasserzugang in unhaltbarem Gestein“ aufgegeben und einen neuen an der Südseite angehauen habe (40169, Nr. 286, Blatt 186f). Weil die Stollnsohle um 4 bis 5 Lachter überstaut war, so daß nur noch die 8 Lachter- Sohle fahrbar war, ordnete Netto außerdem Vorbohren beim Vortrieb des Umbruchs an. Weiter liest man in diesem Fahrjournal noch, daß ein Bruch unter dem südlichen Giebel des Hauses No. 13 eingetreten sei, wozu Herr Netto aber notierte: „Die unterm 21. April 1870 erwähnte Frage, (ob dies) durch Grubenbetrieb entstanden sei, dürfte sich dadurch erledigt haben, daß es einige Wochen später abgebrannt und an anderer Stelle wieder aufgebaut worden ist.“ Auch 'ne Art Lösung... Von seiner Grubenbefahrung am 21. September 1870 berichtete Inspektor Netto dann (40169, Nr. 286, Blatt 188f), daß der Umbruch nach 18 Lachter Länge den Juno Stolln wieder erreicht hatte, das aufgestaute Wasser gezäpft und alles wieder instandgesetzt sei. Wegen Mängeln in der Zimmerung fand er aber auch Veranlassung, die Auffahrung einer zusätzlichen Verbindung zwischen der 12 Lachter- Sohle und dem Juno Stolln anzuordnen. Bei seiner Befahrung am 7. März 1872 fand er diese dann auch hergestellt (40169, Nr. 286, Blatt 190f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Mängel in der Ausbauunterhaltung
hielten offenbar in der Folgezeit an, denn bei seiner Befahrung am
11. Januar 1873 sistierte der Berginspektor den Eisensteinabbau 4 m
oberhalb der Stollnsohle am Köhlerschacht „wegen nachlässig
eingebrachter Zimmerung“ gleich ganz (40169, Nr. 286, Blatt 192f).
Offenbar war die Nachfrage nach Eisenerz aber wieder angestiegen, denn man
hatte den Brauneisensteinabbau wieder aufgenommen und hierzu „ein altes
Schächtchen“ gewältigt. Das dabei vorgefundene Lager war „anscheinend
ziemlich mächtig, jedoch in Richtung und Mächtigkeit sehr veränderlich,“
notierte Herr Netto noch.
Am 19. Oktober 1872 mutete Herr Zweigler noch einmal 53.384 Quadratmeter Grubenfeld hinzu, die ihm auch am 16. Juli 1873 bestätigt worden sind (40169, Nr. 286, Blatt 194). Jedoch muß er zuvor auch einen Teil des Grubenfeldes losgesagt haben, den trotz der Nachmutung sank die Gesamtfläche des Grubenfeldes von Riedels Fdgr. auf 197.588 Quadratlachter (790.352 m²) oder 198 Maßeinheiten. Bis dahin hat in den 14 Betriebsjahren unter Ernst Erdmann Zweigler Riedels Fundgrube mit 60.618 Zentnern Braunstein und 1.083,4 Fudern Eisenerz (Angaben in den Erzlieferungsextrakten und (ab 1868) in den Jahrbüchern) ihre höchste Förderung und ihre größte Blütezeit erlebt. Am 19. September 1873 notierte der Berginspektor dann in seinem Fahrjournal, daß sich die Grube seit Mai 1873 im Besitz von Hermann Gruson befinde, welcher einen „hauptsächlich auf die Gewinnung von Eisenstein gerichteten, regelmäßigen Betrieb eingeführt“ habe (40169, Nr. 286, Blatt 195). Wie wir von den Gruben, über die wir in unserem Text oben bereits berichtet haben, schon wissen (und bei den beiden anderen noch lesen können), hat besagter Gießereibesitzer und Maschinenbaufabrikant aus Buckau bei Magdeburg neben Riedels Fundgrube auch die anderen drei Zweigler'schen Gruben
aus dem Besitz des Herrn Zweigler 1873 sowie gekauft und außerdem 1875 noch
Grubenfeld bei der alten Grube Vater Abraham zu Oberscheibe gemutet. Damit wäre Ernst Erdmann Zweigler eigentlich außen vor, doch weil man von dem Verkauf im Bergamt noch nichts wußte (oder er noch nicht rechtskräftig gewesen ist), fragte das Bergamt am 21. Oktober 1873 noch beim Vorbesitzer nach der weiteren Aufsichtsführung, nachdem Berginspektor Netto am 12. Oktober berichtet hatte, daß „ein gewisser Nagel (...) als Steiger fungiert,“ während Steiger Merkel auf Friedrich Fundgrube verstorben und Steiger Hartmann nach Meyers Hoffnung abgegangen sei (40169, Nr. 286, Blatt 197ff). Herr Zweigler erbat erst einmal Aufschub und nachdem man aus Freiberg am 6. Februar 1874 erneut nachfragte, teilte er am 12. Februar 1874 den Verkauf an Gruson mit. Nach einem Grundbuchauszug aus späterer Zeit betrug der Kaufpreis übrigens 27.590 Thaler (40169, Nr. 286, Blatt 217), was sicher zumindest für Herrn Zweigler kein übles Geschäft gewesen ist...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die im Weiteren handelnden Personen
kennen wir inzwischen auch schon: Bevollmächtigter Gruson's in
Sachsen war der Generaldirektor der Schwarzenberg'er Eisenhütte, Oscar
Schrader. Erster Betriebsleiter für die Gruson'schen Gruben bei
Langenberg wurde Karl Friedrich Fritzsche, was man auch seitens des
Landesbergamtes in Freiberg am 16. Februar 1874 genehmigte. Am 2. März
1874 teilte Oscar Schrader dem Bergamt mit, daß die Übernahme der
Zweigler'schen Gruben bereits am 1. Mai des Vorjahres erfolgt sei und
zunächst der „zuvor auf einer unserer böhmischen Eisenerzgruben
tätige“ Absolvent der Freiberg'er Bergschule, Robert Nagel, die
Aufsicht als Steiger geführt habe. Nun aber wurde dieser „infolge
Betriebseinschränkung“ wieder entlassen und mit der weiteren
Steigerdienstversorgung solle nun der Zimmerling Heinrich Ludwig Ficker
„interimistisch“ beauftragt werden (40169, Nr. 286, Blatt 207).
Weil Inspektor Netto diesen als „zuverlässigen Mann“
einschätzte und die Grube „wegen ungünstiger Conjunctur im
Braunsteingeschäft“ auch nur noch mit 3 Mann belegt war (40169,
Nr. 286, Blatt 208f), genehmigte am 7. April 1874 auch das Bergamt dessen
Anstellung als Steiger (40169, Nr. 286, Blatt 212).
Ferner fand am 26. März 1874 noch
eine Befahrung der zugänglichen Baue durch Netto und Bergverwalter
Fritzsche statt, weil der Stuhlbauer Emil Zimmermann aus
Langenberg am 17. März um Prüfung gebeten hatte, ob der Abbau sein Haus
gefährde. Weil dieser an das Bergamt schrieb, er „wolle nicht zum
zweiten Male dieser Gefahr ausgesetzt sein,“ können wir vermuten, daß
es vielleicht derselbe war, dessen Haus No. 13 nach einem Verbruch unter
dem südlichen Giebel im Jahr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurz darauf ist unter Beteiligung von
H. Gruson die Societé anonymes des Mines et Usines Hof -
Plzen - Schwarzenberg mit Sitz in Brüssel gegründet worden. Wie bei
den anderen vormals Zweigler'schen Gruben auch, nahm man erst am
22. Dezember 1877 nach Einholung eines Grundbuchauszuges in Freiberg die
Überlassung der Gruben an diese Gesellschaft zu Protokoll (40169, Nr. 286,
Rückseite Blatt 233).
Bereits in deren Auftrag teilte Bergverwalter Fritzsche dem Bergamt am 21. Januar 1875 mit, daß man, weil „der Betrieb wieder besser forciert“ werde, anstelle von Steigerdienstversorger Ficker nun Carl Gottlob Richter aus Langenau, zuvor Steiger auf der Grube Grauer Wolf bei Schönbrunn, als solchen in Langenberg anstellen wolle, was das Bergamt in Freiberg auch genehmigte (40169, Nr. 286, Blatt 219f). Daraufhin führte auch Inspektor Netto am 21. Mai 1875 wieder eine Befahrung durch. In seinem Fahrjournal lesen wir darüber, daß auf der Sohle des Juno Stollns Ortsbetriebe vom Riedelschacht nach Süd und am Köhlerschacht nach Ost aufgenommen worden sind. Außerdem senkte man 210 m hora 1,6 Südost vom Riedelschacht noch einen neuen Schacht ab (40169, Nr. 286, Blatt 221f). Ein halbes Jahr später war der Inspektor wieder auf Riedels Fundgrube und berichtete unter dem 23. November an das Bergamt, daß der neue Schacht bei Abmessungen von 1,5 x 4 m eine Teufe von 24 m erreicht habe. Nun wolle man von dessen Sohle aus dem südlichen Juno Stolln- Ort entgegen fahren. Zu bemängeln fand der Berginspektor aber, daß zum wiederholten Male jegliche Schachtabdeckung oder Überbauung fehle (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 222). Dem Fahrjournal vom 23. Juni 1876 ist dann zu entnehmen, daß der neue Schacht nun den Namen Karlschacht erhalten habe und daß man im Begriff stand, zur Wasserhaltung beim weiteren Abteufen eine Locomobile anzuschaffen. Ferner berichtete Herr Netto unter dem Punkt ,specielle Besichtigung des Bergeversatzes in ausgehauenen Räumen', daß hierzu keine besonderen Anordnungen erforderlich seien, weil er „die Überzeugung gewonnen habe, daß man sorgfältig auf Ausstürzung leerer Räume bedacht ist.“ (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 227f) Einen Tag später erbat Bergverwalter Fritzsche beim Bergamt die Genehmigung zur Verwendung von Dynamit, weil „der Eisenstein zu hart“ sei (40169, Nr. 286, Blatt 223), was nebenbei dafür spricht, daß man noch welchen gefunden hatte. Allerdings mit der Einschränkung auf eine ,versuchsweise' Anwendung erteilte man in Freiberg am 28. Juni 1876 hierzu die Genehmigung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daß man wieder Eisenstein abbaute,
liest man auch im nächsten Fahrjournal von Berginspektor Netto vom
11. Dezember 1877. Man habe nordwestlich vom Karlschacht „einen
Eisensteinbutzen“ angefahren (40169, Nr. 286, Blatt 229f).
Außerdem war Herr Netto aber an diesem Tage zugegen, um
Erörterungen wegen des Herrn Weber gehörigen Hauses anzustellen ‒
wie man aus dem nächsten Fahrjournal erfährt, das Nachbarhaus jenes
Stuhlbauers Zimmermann in Langenberg, welcher sich schon
Kein Vierteljahr später, am 22. Februar 1878, berichtete Herr Netto dann in seinem Fahrjournal, daß man doch just „bei der vorzüglichsten Eisensteinablagerung zwischen dem Zimmermann'schen und Weber'schen Hause“ einen weiteren Schacht im Profil von 1,5 x 3 m schon 21 m niedergebracht hatte und nun mit Hilfe der von der Locomobile angetriebenen Wasserhaltung, die man für den Karlschacht angeschafft hatte, noch unter die Juno Stolln- Sohle niedergehen wolle (40169, Nr. 286, Blatt 234f). Dort brauchte man sie nämlich nicht mehr, denn im Fahrbericht vom 7. November 1878 liest man, daß man den letzteren bereits wieder ausgestürzt hatte (40169, Nr. 286, Rückseite Blatt 235). Außerdem hatte man 108 m nordöstlich vom Köhlerschacht schon wieder einen neuen Schacht abgesenkt und ihm den Namen Robertschacht gegeben. Letzterer war bei einem Profil von 1,1 x 3,25 m bereits 27,5 m tief, auf die Stollsohle durchschlägig und sollte nun ebenfalls weiter verteuft werden. Vielleicht ging dieser Name ja auf den neuen Betriebsleiter zurück, denn Herr Fritzsche ist inzwischen nach Hof umgezogen und so mußte man seitens der Societé einen neuen benennen. Als solcher trat nun Franz Robert Pilz diese Stellung an (40169, Nr. 286, Blatt 231f). Bis zur nächsten Befahrung durch Berginspektor Netto am 28. März 1879 hatte man den Robertschacht 9 m unter die Stollnsohle abgesenkt. In dieser Sohle hatte man ein Ort auf den Eisensteinbutzen zu angehauen. Das hier anstehende Gestein beschrieb der Inspektor als „rother, glimmerreicher Letten, auf braunem Mulm aufliegend,“ und es erfordere sehr starke Zimmerung (40169, Nr. 286, Blatt 240f). Zwei Jahre später fand dies sogar in die Ausgabe der Jahrbücher für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen Eingang. Dort liest man unter der Rubrik: VIII. Andere wichtige Ausführungen, Betriebsvorgänge etc. im Jahre 1879. A. Erzbergbau. IV. Bergrevier Schwarzenberg. „3) Auf Riedels Fundgrube bei Langenberg hat man nach Abwerfung und Ausstürzung des in sehr druckhaftem Gebirge stehenden Carl Schachtes ungefähr in der Mitte zwischen diesem und dem Köhlerschachte mit Hilfe einer Lokomobile einen neuen Schacht, Robert Schacht genannt, 26 m tief bis auf den Junostolln und 8 m unter denselben abgeteuft und in dieser Sohle bei ca. 20 m vom Schachte gegen SW. das Brauneisenstein und Braunstein führende Gebirge angefahren, dessen horizontale Verbreitung dadurch zwischen dem Robert- und dem Köhlerschachte in einer Breite von nahezu 100 m bei gleicher Länge nachgewiesen worden ist und bereits zu einer verhältnissmässig bedeutenden Gewinnung von Eisenstein Anlass gegeben hat.“ Die Gewinnung des Eisensteins war also immerhin „verhältnismäßig bedeutend“ und was dies bedeute, darüber mache sich jeder Leser seine eigenen Gedanken... Der Text ist wahrscheinlich von Berginspektor Netto verfaßt worden, denn eine ungefähr gleichlautende Abschrift findet sich auch in der Grubenakte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das nächste Fahrjournal in der
Grubenakte datiert erst auf den 21. April 1881 und ist bereits vom
nächsten Berginspektor R. Friedemann unterzeichnet (40169,
Nr. 286, Blatt 245f). Demnach war noch immer eine ziemlich starke
Belegschaft von 19 Mann auf Riedels Fundgrube angelegt. Man baute
wohl noch immer nahe am Köhlerschacht, denn an diesem fand der
Inspektor in seinen ,bergpolizeilichen Bemerkungen' die Fahrung
mangelhaft.
In der Zwischenzeit hatte sich bekanntlich die Societé in Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb umbenannt. Die Schwarzenberg'er Hütte gehörte nach wie vor zu deren Kapital. Als Bergverwalter fungierte bei der Schwarzenberg'er Hütte inzwischen Herr Emil Braune und auch der Betriebsleiter für die Gruben hatte wieder gewechselt; diese Funktion nahm nun Herr Wilhelm Beyer wahr (40169, Nr. 286, Blatt 242). Herr Braune teilte dann am 5. Juli 1882 namens der AG aus Schwarzenberg nach Freiberg mit, daß „die aufgeschlossenen Eisen- und Manganvorkommen abgebaut sind und Versuchsörter keine weiteren Erzmittel erschlossen“ haben. Man wollte daher nun „diesen Reviertheil verlassen“ und hatte bereits damit begonnen, alle Schächte, die in nicht standfestem Mulm und gebrächem Glimmerschiefer standen, auszustürzen (40169, Nr. 286, Blatt 246). Anschließend wolle man aber noch den westlichen Revierteil untersuchen,
wozu der Faciusschacht am Raschau'er Kalkwerk als Angriffspunkt
dienen solle. Weil der nun aber im Grubenfeld von Gottes Geschick vereinigt Feld stehe,
habe man sich bereits mit deren Verwaltung über die Schachtnutzung
geeinigt. Von dort aus sollten dann Versuchsörter nach Osten getrieben
werden, was man kurz darauf auch in Freiberg so genehmigte (40169,
Nr. 286, Blatt 247). Außerdem benannte man seitens der AG am 24. Juli 1882
noch einmal einen neuen Steiger: Die Aufsichtsführung sollte nun
Christian Leberecht Schulz übernehmen, der zuvor bei Frisch Glück
in Globenstein als solcher tätig war (40169, Nr. 286, Blatt 250). Aus der Lage des Faciusschachtes
nicht nur in einem anderen Grubenfeld, sondern auch in der westlichen
angrenzenden Schneeberg'er Revierabteilung ergab sich auch noch die Frage der
Aufteilung der Zahlung der Knappschafts- und Revierkassenbeiträge, weshalb
sich die Schwarzenberg'er Hütte an das Landesbergamt in Freiberg wandte
(40169, Nr. 286, Blatt 252). In diesem Schreiben liest man einleitend: „Wie
dem Hohen Bergamt bekannt, treiben wir bei Riedels Fundgrube vom
Faciusschacht aus den Katharinaer Stolln fort...“ Daraus könnte man ja nun
schließen, daß der Stolln tatsächlich bis auf den Schacht durchschlägig
gemacht worden sei, was aber im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Befahrungsbericht von
Berginspektionsassistent L. Menzel über seinen ,Besuch' am
29. Juni 1882 berichtet uns dann, daß das Ausstürzen der Schächte im
östlichen Teil des Grubenfeldes im Gange war (40169, Nr. 286, Blatt 248f).
Der Faciusschacht sei zuvor nur zur Hebung von Trinkwasser genutzt
worden und gleich zu Beginn der Rekonstruktion zusammengebrochen... Man
sei nun mit der Gewältigung befaßt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Selbst der Aktiengesellschaft wurde
aber dann das Unternehmen zu teuer... Am 20. Januar 1883 ersuchte die
Schwarzenberg'er Hütte beim Bergamt in Freiberg um Genehmigung für „einige
Tiefbohrungen“ anstelle des weiteren Stollnvortriebs, weil das Gestein
sehr hart und der Vortrieb daher „kostspielig und zeitraubend“ sei
(40169, Nr. 286, Blatt 253). Die Genehmigung wurde vom Bergamt auch
erteilt, man wies nur auf die erforderlichen Nutzungsvereinbarungen mit
den betreffenden Grundeigentümern hin.
Als Herr Menzel am 10. Mai 1883 wieder in Langenberg war, hatte man das Projekt schon in Angriff genommen. In seinem Befahrungsbericht liest man, daß man „in einer Teufe von 26 - 28 m gelben Mulm mit eingesprengten Körnern von Hartmanganerz“ angetroffen habe (40169, Nr. 286, Blatt 254). Obwohl spätere Quellen auf eben jene Bohrungen immer wieder Bezug nehmen, haben diese offenkundig nichts bauwürdiges mehr ergeben. Am 4. August 1883 stellte die Betriebsleitung daher Antrag auf Betriebsaussetzung an das Bergamt (40169, Nr. 286, Blatt 255). In Freiberg gab man dem Antrag auch statt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon am 23. Januar 1883 teilte
Bergverwalter Emil Braune namens der Schwarzenberg'er Hütte
außerdem nach Freiberg mit, daß man die vier vormals Zweigler'schen Gruben
Riedels, Gelber Zweig, Hausteins Hoffnung und Gott segne
beständig Fundgrube unter dem Namen ,Raschau'er Gruben'
vereinigen und zukünftig einen gemeinschaftlichen Betrieb durchführen
wolle. Betrieb habe in letzter Zeit ohnehin nur noch bei Riedels
Fundgrube stattgefunden (40169, Nr. 287, Blatt 1). Im gleichen Atemzug
schrieb er auch nach Freiberg, daß „eine Anzahl Langenberg'er
Bergleute“ (aus dem weiteren Akteninhalt erfährt man, daß es fünf
Männer waren) bei ihm ersucht hätten, den Bergbau auf eigene Rechnung
wieder aufzunehmen, da sie sonst arbeitslos würden. Der Verwaltungsrat der
AG habe es genehmigt. Sie wollten den 1882 verstürzten Riedelschacht
wieder aufwältigen und die Aufsicht könne der auf Gottes Geschick
vereinigt Feld angestellte Steiger Friedrich August Meinhold
führen (40169, Nr. 287, Blatt 3).
Seitens des Bergamtes in Freiberg erhob man keine Einwände, doch sei vorher Klarheit über die Rechtsträgerschaft zu schaffen, da schließlich die Aktiengesellschaft als Eigentümer im Lehnbuch eingetragen sei (40169, Nr. 287, Rückseite Blatt 3). Daraufhin bestätigte Herr Braune am 3. Februar 1885 dem Bergamt, daß die AG auch weiterhin die Versicherungsbeiträge für die Arbeiter zahlen werde. Sie fordere die Beiträge zwar von den Arbeitern wieder ein, doch dürften diese den geförderten Braunstein im Gegenzug auf eigene Rechnung verwerten. Man wolle die beschäftigungslosen Bergleute dadurch unterstützen, jedoch nur die Revierkassenbeiträge und die Feldsteuern zahlen und sonst kein finanzielles Risiko eingehen (40169, Nr. 287, Blatt 5). Danach präzisierte Herr Braune am 16. Februar noch, daß die Aufsicht vor Ort der Zimmerling Christian Gotthold Weißflog führen solle (40169, Nr. 287, Blatt 6). So wurde der Betrieb auch in Freiberg genehmigt. Am 9. März 1885 sagte Herr Braune außerdem den abgebauten, östlichen Teil des Grubenfeldes von Riedels Fundgrube los und fragte in diesem Zusammenhang beim Bergamt nach der Verfahrensweise, da dort noch ausgeförderte Eisensteinvorräte lagerten. Das Bergamt empfahl ihm daraufhin, eine privatrechtliche Übereinkunft mit den betroffenen Grundeigentümern zu suchen (40169, Nr. 287, Blatt 8). Die Lossagung ist am 18. April bestätigt und am 17. Oktober 1885 eine Nachtragsurkunde ausgestellt worden, der zufolge sich das Grubenfeld von Riedels Fundgrube um 297.704 m² auf nun noch 492.648 m² oder 124 Maßeinheiten verringert hatte (40169, Nr. 287, Blatt 14ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Zwischenzeit nahmen die fünf
Bergarbeiter den Betrieb tatsächlich noch einmal auf, was einem
Fahrjournal vom 1. Mai 1885 von Berginspektor E. Th. Böhme zu
entnehmen ist (40169, Nr. 287, Blatt 10f). Demnach war der Betrieb schon
seit 9. März wieder im Gange. Pro Zentner Braunstein, den die Arbeiter „an
chemische Fabriken“ verkaufen wollten, war eine Abgabe von 25 Pfennig
an die Aktiengesellschaft vereinbart. Dazu hatten sie den früher 28 m
tiefen Riedelschacht bis zur 6 Lachter- Sohle wieder gewältigt, wo
zwei neue Feldstrecken belegt waren. Am Bolzenschrotausbau des Schachtes
fand der Inspektor nichts auszusetzen. Der Juno Stolln war teils
verbrochen, teils zugesetzt. Beim Vortrieb der Strecken war nun allerdings
ein Bruch in der Streckensohle oberhalb eines alten Überhauens auf der 8
Lachter- Sohle entstanden. Der Inspektor wies per Zechenbucheintrag an,
das betreffende Streckenort einzustellen, den Hohlraum auszusetzen und
zukünftig neue Strecken nur seitlich versetzt zu alten Bauen anzuschlagen.
Diese Anweisung bestätigte auch das Bergamt am 25. Juni 1885 gegenüber
Herrn Braune (40169, Nr. 287, Blatt 12).
Da Steigerdienstversorger Weißflog in den Ruhestand ging, blieben aber schon bald nur noch vier Mann Belegung übrig. Herr Braune teilte daher am 25. August 1885 an das Bergamt mit, daß nun Friedrich August Riedel die Aufsicht übernehmen solle, was man auch in Freiberg genehmigte (40169, Nr. 287, Blatt 13). Offenbar lohnte sich der Aufwand aber doch nicht und es blieb bei einer nur kurzen Episode. Am 31. Dezember 1885 zeigte Herr Braune die erneute Sistierung des Betriebes beim Bergamt an (40169, Nr. 287, Blatt 17). Wie üblich, erfolgte eine Befahrung, über die Inspektor G. Tittel am 22. Januar 1886 berichtete, daß gerade die angeordnete Ausfüllung des Verbruchs auf der 6 Lachter- Sohle erfolge. Der Riedelschacht und die Schachtkaue befanden sich in ordnungsgemäßem Zustand und daher seien keine weiteren Anordnungen erforderlich (40169, Nr. 287, Blatt 19). Daraufhin genehmigte das Bergamt auch die Fristhaltung der Grube bis Ende 1886.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem allen ungeachtet, mutete Herr
Braune am 17. Dezember 1885 noch einmal eine Fläche von 6.596 m²
Grubenfeld nach, was ihm auch am 6. April 1886 bestätigt wurde (40169,
Nr. 287, Blatt 22f). Es blieb aber auch im Jahr 1887 bei der
Betriebsaussetzung. Stattdessen füllt den weiteren Akteninhalt eine
Auseinandersetzung mit dem Grundeigentümer Johann Heinrich Bock um
die Haldensturzfläche vor dem Mundloch des Juno Stollens (40169,
Nr. 287, Blatt 25ff). Herr Braune beantragte sogar die Enteignung
der Fläche, was der Anwalt des Grundeigentümers aber entschieden ablehnte,
weil die Grundzinsvereinbarung nicht Sache des Bergamtes, sondern des
bürgerlichen Rechts sei. Wir erinnern uns an die langen Streitereien zu
eben diesem Inhalt mit Herrn Carl von Querfurth auf Förstel... Nach
vielem Hin und Her entschied schließlich auch das Bergamt, daß „die
Partheien die Angelegenheit auf dem Rechtswege zum Austrage bringen“
sollten (40169, Nr. 287, Blatt 49).
Wegen „der jetzigen Productenpreise“ beantragte Herr Braune am 6. Januar 1888 erneut Fristhaltung, die ihm auch für ein weiteres Jahr genehmigt worden ist (40169, Nr. 287, Blatt 56). Im Laufe dieses Jahres hat dann die Aktiengesellschaft die Bergbaurechte in den vier vormals Zweigler'schen Grubenfeldern zu Langenberg an den Kaufmann Paul Friedrich Helmuth Förster in Berlin verkauft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besagter Herr Paul Förster war
seit 1884 alleiniger Inhaber eines ,Laboratoriums für Erzanalysen M. Förster' in Berlin, was man aus der
Wie für die anderen drei Gruben auch benannte er auf die Aufforderung seitens des Bergamtes hin am 14. März 1889 den Bergingenieur Adolf Albrecht Götting, Absolvent der Clausthal'er Bergakademie, als seinen zukünftigen Vertreter in Sachsen. Zugleich aber hatte er schon am 13. Januar 1889 weitere Fristhaltung für die Gruben beantragt. Dabei blieb es dann auch für die folgenden Jahre. Zwar änderte sich noch zweimal sein beauftragter Bevollmächtigter in Sachsen, doch blieb der Betrieb der Gruben bis 1893 ausgesetzt (40169, Nr. 287, Blatt 63ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 20. Januar 1893 nahm man schließlich
in Freiberg zu Protokoll, daß Herr Förster auch Riedels
Fundgrube an Gustav Zschierlich verkauft habe (40169, Nr. 287,
Blatt 73). Damit gehörten dem letzteren nun sämtliche Bergbaurechte in und
um Langenberg...
Aufgrund des Besitzwechsels wurde
der Berginspektionsassistent
K. G. Günther zu einer Befahrung ausgesandt, über die er am 3. Mai
1893 aber nur zu berichten hatte, daß alles Schächte verfüllt seien und
folglich zu
Erinnerungen kein Anlaß bestehe (40169, Nr. 287, Blatt 74f). Was danach im
Revier noch geschah, lese man weiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Friedrichs
Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26)
wurde diese Grube ab 1791 und mit nur wenigen Unterbrechungen noch bis 1885
aufgeführt. In ihrer vergleichsweise langen Betriebszeit hat sie sowohl
Braunstein, als auch Eisenstein ausgebracht. Mit einem Ausbringen von
insgesamt über 3.506 Fudern Eisenstein (rund 3.386 Tonnen) und über 23.276
Zentnern (rund 1.458 Tonnen) Braunstein gehörte sie zu den bedeutendsten
Gruben am Emmler, in jedem Fall kann sie als die beständigste der Gruben
auf den Fluren des Gutes Förstel gelten.
Eine erste Verleihung unter diesem Namen ist sogar schon im Quartal Reminiscere 1749 zu finden. Im Verleihbuch des Bergamts Scheibenberg findet man die Eintragung: „Den 21. Maji sind Johann Friedrich Riedeln aus Raschau 2 Lehn auf 1 Posten auf dem Guth Förstel auf Braunstein verliehen worden, vgl. Muthung sub No. 234, heißet Friedrich.“ (40014, Nr. 43, Blatt 33) Eine weitere Verleihung an denselben Muter mit derselben Ortsangabe – allerdings mit einem anderen Grubennamen – datiert auf den 4. März 1750, worüber eine Seite weiter eingetragen ist: „Johann Friedrich Riedeln aus Raschau verliehen worden zwey Lehn auf 1 Pos. aufm Guth Förstel auf Braunstein und alle Metalle und Mineralien und heißt die Zeche St. Johannis.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 33) Noch eine weitere Eintragung findet man Crucis 1752 im Verleihbuch. Jetzt heißt es, „den 20. Sept. ist von mir, dem Bergmeister Samuel Enderlein, Carl Friedrich Weigeln in Raschau auf Christian Friedrich Teubners Erbwald alda, eine Fundgrube in einer alten Binge auf Eisenstein verliehen und Friedrichs Fundgrube genannt worden.“ (40014, Nr. 43, Blatt 37) Ob auch die nach dem Muter Christian Friedrich Arnold benannte, am 24. November 1762 bestätigte und auf dem Grund und Boden des Muters gelegene Christian Friedrich Fundgrube zu Langenberg (40014, Nr. 43, Blatt 52) etwas mit der späteren Friedrich Fundgrube zu tun hatte, erscheint eher unwahrscheinlich. Nur zwei Monate später erfolgte aber eine weitere Verleihung unter dem ähnlichen Namen Christian Friedrichs Lehne an Carl Friedrich Riedel über „4 Eißenstein Lehn auf Christian Heinrich Jacobs Erbguth alda, wobey das Anhalten bey Hrn. Schichtmeister Bocks Lehnen genommen werden soll“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 52).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner ersten Befahrung der Friedrich Fundgrube berichtete der uns schon bekannte Berggeschworene im Scheibenberger Revier, Johann Samuel Körbach, nur kurz (40014, Nr. 185, Film 0016): Friedrich Fdgr. Braunsteinzeche bey Langenberg. „Allhier wird der Bau durch den Eigenlöhner, 4 Ltr. vom Tage nieder auf einem in Süd fallenden Lager, welches aus 12 bis 19 (schwer leserlich ?) Zoll mächtigen Braunstein bestehet, deßen Streichen Stunde 5 ist, verführet.“ 2ten April 1792 Fast gleichlautend ist die Notiz des Geschworenen zur Friedrich Fundgrube in seinem Fahrbogen vom Folgejahr (40014, Nr. 185, Film 0053): „Über die Braunsteinzeche Friedrichs Fundgrube bey Langenberg gelegen, Allhier wird durch die Eigenlöhner 4 Ltr. vom Tage nieder auf dem in Ost streichenden und unter einem Winkel gegen 20 Grad in Nord fallenden Lager, das aus 5 bis 8 Zoll mächtigen Braunstein besteht, der Bau in Ost fortgestellet.“ 24. April 1793 Aufgrund der besser gewordenen Aufschlussituation war das Streichen und Fallen des Lagers nun wohl genauer zu bestimmen. Das nächste Mal taucht diese Grube dann erst wieder im Quartal Reminiscere 1797 in den Fahrbögen von Herrn Körbach auf, als dieser festhielt (40014, Nr. 196, Film 0003): Braunsteinzeche Friedrichs Fundgrube bey Langberg „Es wird von Langberg aus an dem in Ost und Süd aufsteigenden Gebirge auf Herrn Quärfurts Grund und Boden von dem Eigenlöhner bey 4 Ltr. Teufe untern Tag der Bau auf einem Stunde 4 streichenden und gegen 30 Grad fallenden Lager, so aus Braunstein bestehet und 10 Zoll mächtig ist, vermittelst Ortsbetrieb in Mitternacht verführet.“ Sign. Scheibenberg, am 28. Januar 1797 Johann Samuel Körbach, Berggeschworener. Warum die Überlieferung an dieser Stelle abreißt, ob das Lager erschöpft war oder warum sonst der Eigenlehner aus dem Feld gegangen ist, wissen wir noch nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das nächste Mal findet eine Grube dieses Namens im Quartal Luciae 1806 in den Fahrbögen des Scheibenberg'er Berggeschworenen Christian Friedrich Schmiedel Erwähnung, worin es heißt (40014, Nr. 235, Blatt 82): Friedrich Fundgrube betreffend. Lage. „Diese Grube, welche ebenfalls eigenlehnerweise betrieben wird, liegt am Gegengebirge, von dem Dorfe Langeberg gegen Mitternacht Morgen.“ Baue. „Bei 4½ Lachter Teufe des Tageschachtes, allwo man ein ½ Lachter mächtiges, aus drusigen Quarz, dichten Braunstein und Brauneisenstein bestehendes Lager ersunken hat, wird auf selbigem ein Ort Stunde 2,4 mit 2 Mann gegen Mitternacht betrieben und ist bereits 2 Lachter fortgebracht.“ Die Lageangabe, daß diese Grube nordöstlich von Langenberg und ,auf dem Gegengebirge' läge, kann hier allerdings nicht stimmen, zumal als Nachbargrube auf der Folgeseite die Grube Gelber Zweig genannt wird und die lag nun ganz gewiß südlich der Ortslage und am Nordabhang des Emmlerrückens. Luciae 1807 heißt es außerdem in dieser Quelle, am 3. Dezember des Jahres seien „in meiner Gegenwart (des Geschworenen) (...) bei Friedrichs Fundgrube zu Langeberg 30 Centner Braunstein verwogen worden.“ (40014, Nr. 235, Blatt 137) Danach setzten die Erwähnungen in den Fahrbögen der Geschworenen aber auch schon wieder aus...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 10. November 1808 hatte auch Carl Christian Edler von Querfurth, inzwischen der Sohn, selbst eine gevierte Fundgrube unter dem Namen Carl´s Glück „auf dem seinem zum Rittergut Förstel gehörenden, ihm eigenthümlichen Grund und Boden“ gemutet. Diese erhielt er am 5. Januar 1809 bestätigt. Zur Verleihung ist ausnahmsweise einmal folgende Croquis kleinen Maßstabs in der Akte abgeheftet, welche uns eine Vorstellung von der Lage des Grubenfelds gibt, und darin sind auch eine alte und eine neue Friedrich Fundgrube angerissen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese neue Fundgrube unter demselben Namen haben am
5. Januar 1811 die Bergarbeiter Christian Gottlob Weißflog und
Christian Gottreich Weißflog als Eigenlehner gemutet. Im Lehnbuch
heißt es, es sei eine gevierte Fundgrube „auf dem Hrn. Kaufmann
Querfurth junior gehörigen Grund und Boden zu Langeberg“ auf einem
Braunsteinlager. Sie erhielten sie am 23. Februar 1811 unter dem Namen
Friedrich auch bestätigt (40014, Nr. 211, Film 0079,
40014, Nr. 43, Blatt 260 und 40169, Nr. 95, Blatt 1). Nach obiger
Zeichnung lag die neue weiter westlich als die alte Friedrich
Fundgrube.
Der Steiger Carl August Weißflog aus Langenberg war diesmal im „Familienbetrieb“ nicht mit dabei ‒ der hatte zu dieser Zeit wohl gerade bei Gnade Gottes zu tun. Auch die neuen Eigenlehner fanden in 4 Lachter Teufe das ½ Lachter mächtige, 10° bis 15° gegen West fallende, aus gelbem Ocker, milden Gneis Quarz und Braunstein bestehende Lager vor. Darin hatten sie ein Ort Stunde 6,6 gegen West mit abfallender Sohle angelegt und bis 20. März 1811 auf 4½ Lachter erlängt (40014, Nr. 245, Film 0174). Erst am 23. Januar 1812 hat der Geschworene Schmiedel Friedrichs Fundgrube bei Langenberg erneut besucht und befunden, es fahre hier ein Versorger und ein Häuer an, man habe in 4 Lachter Teufe mit dem Fundschacht das Lager ersunken und treibe nun ein Ort gegen Nordost vor, das bis dahin auf 6½ Lachter ausgelängt war (40014, Nr. 250, Film 0011f). Von seiner Befahrung der Grube am 25. März 1812 berichtete Schmiedel, daß die beiden Eigenlehner selbst anfahren und nun in 3¼ Lachter Teufe aus dem Fundschacht ein Ort im Streichen des Lagers Stunde 6,5 gegen West treiben, welches 4 Lachter erlängt war (40014, Nr. 250, Film 0035). Fast gleichlautend ist auch der Bericht des Geschworenen zu seiner Befahrung vom 11. Mai 1812: Die Mächtigkeit des Lagers wird jetzt mit ¼ bis ⅜ Lachter angegeben und das betriebene Ort gegen West war nun 4½ Lachter erlängt (40014, Nr. 250, Film 0052). Einen Fahrbogenvortrag hat es hierzu in der Bergamtssitzung am 8. August 1812 gegeben: Vom damaligen Obereinfahrer Carl Amandus Kühn wurde protokolliert, daß die Eigenlöhner wegen Wettermangels in der Grube einen zweiten Schacht absenkten, die Schachtteufe aber sistiert werden mußte, weil Regen sie zugeschlämmt habe (40169, Nr. 95, Blatt 2). Danach setzen die Erwähnungen des Grubenbetriebs in den Fahrbögen erneut aus, woraus nichts anderes zu schließen ist, als daß die Eigenlöhner wieder aufgegeben haben... Doch findet man im Fahrbogen des Herrn Schmiedel vom 18. Januar 1814 die Notiz, daß auf Friedrichs Fundgrube nun wieder drei Mann angelegt seien, durch die in 5 Lachtern Teufe ein Ort Stunde 9,6 gegen Südost betrieben werde, welches auch schon 4¾ Lachter ausgelängt sei (40014, Nr. 252, Film 0009). Vielleicht ließ der nachfolgende Muter ja ein paar Männer erst einmal nachschauen, ob es sich lohnen könne, die Grube wieder aufzunehmen ? Auch aus dem Fahrbogen vom 6. Mai 1814 geht hervor, daß auf Friedrichs Fundgrube drei Mann anfuhren, daß man das Lager in 6 Lachtern Teufe „des neuen Tageschachts“ ersunken, und darauf ein Ort gegen Nordost 6¼ Lachter getrieben habe (40014, Nr. 252, Film 0043f). Am 13. Mai 1814 gab es hier auch 36 Fuder Eisenstein zu vermessen und 20 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 252, Film 0046). Wer zu diesem Zeitpunkt als Betreiber hier dahinterstand, ist nicht so richtig klar...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder ein Jahr darauf, am 1. März 1815, mutete
dann der
Schichtmeister Christian Friedrich Schubert in Raschau die wieder
im Freien liegende
Friedrich Fundgrube in Herrn von Querfurth's Waldung bei
Langenberg. Die Bestätigung erfolgte am 6. April 1815 (40014, Nr. 211,
Film 0113, 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 267 und 40169, Nr. 95, Blatt 3).
Bei seinen Besuchen am 10. Januar und am 20. Februar 1815 allerdings befand der Geschworene Schmiedel die Grube noch nicht belegt vor (40014, Nr. 254, Film 0005 und 0016). Wie dann im Fahrbogen vom 30. März 1815 zu lesen steht, hatte Herr Schubert die Grube nun wieder mit 4 Mann belegt. Sie brachten (schon wieder) einen neuen Tageschacht nieder, um das dort „sich weit verbreitende Eisensteinlager zu durchsinken und abzubauen.“ Man war mit dem Schacht schon 5 Lachter niedergegangen und hatte in der Schachtsohle das Lager erreicht (40014, Nr. 254, Film 0028). Von seiner nächsten Befahrung der Grube am 4. Oktober 1815 berichtete Herr Schmiedel dann, es werde nun mit 3 Mann Belegschaft in 5½ Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort Stunde 11,3 gegen Süd betrieben und sei 2 Lachter fortgebracht (40014, Nr. 254, Film 0084). Am 6. Dezember des Jahres heißt es im Fahrbogen, besagtes Ort verlaufe nun Stunde 11,0 gegen Süd und sei bei 1 Lachter Weitung 4½ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 254, Film 0103). Außerdem notierte Herr Schmiedel noch: „Auf eben diesem (wie bei Friedrichs Fundgrube) Lager wird auf der benachbarten Köhlers Hoffnung Fundgr bei 5 Lachtern Teufe des Fundschachtes ein Ort bey 1 Lachter Weitung... betrieben. Das vor selbigem beinahe horizontal liegende Lager führt hier nur schmale Trümer von 1 bis 2 Zoll mächtigen Braunstein, übrigens aber blos gelben und braunen Ocker...“ Vielleicht waren demzufolge geringe Bauwürdigkeit des Lagers der Grund für die ständigen Eigentümerwechsel. Am 26. Februar 1816 fand der Geschworene die Grube unbelegt (40014, Nr. 257, Film 0018), am 18. März 1816 aber fuhren wieder 2 Mann an. Jetzt wurde in nur noch 4½ Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort Stunde 3,4, gegen Nordost betrieben und war 3 Lachter fortgebracht. Ein zweites Ort Stunde 7,3 gegen Ost hatte ebenfalls 3 Lachter Länge erreicht (40014, Nr. 257, Film 0025f). „Das Lager daselbst ist 1½ Lachter mächtig, fällt ungefähr 10 Grad gegen Mitternacht Abend und besteht aus gelbem Ocker, Gneus, Quarz und Braunstein,“ heißt es weiter im Fahrbericht. Darüber hinaus fand Herr Schmiedel noch Veranlassung zu folgender Veranstaltung: „Da diese Örter mit verschiedenen Krümmungen und ansteigender Sohle sehr mangelmäßig betrieben werden, hierdurch aber nicht nur das Braunsteinlager nicht gehörig abgebaut werden kann, sondern auch die Förderung sehr erschwert wird und der Wetterzug gehemmt wird, letzteres jedoch um so mehr zu vermeiden ist, weil auf den in diesem Gebirge befindlichen Braun- und Eisensteinzechen, bey sehr wenig Teufe unter Tage, im Sommer die Wetter sehr stockend werden, so habe ich unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: daß obgenannte Örter sofort eingestellt werden sollen, dagegen aber soll auf der Sohle des 4½ Lachter tiefen Tageschachtes nach dem Streichen des Lagers zuförderst ein Ort Stundte 4,0 gegen Morgen, sodann Flügelörter getrieben und auf diese Weise besagtes Lager gehörig abgebaut, zu Erlangung frischer Wetter aber, dieses Ort mit einem noch 8 Lachter vorliegenden alten Tageschacht in Verbindung gebracht werden.“ Das macht doch eigentlich Sinn. Hierzu fand auch ein Fahrbogenvortrag auf der Bergamtssitzung am 20. April 1816 in Annaberg statt, jedoch ohne weitere Festlegungen (40169, Nr. 95, Blatt 4). Da nun die Bergbehörde die ,angehoffte Genehmigung' zu diesem Plan nicht im Protokoll erklärt hatte, hielten sich die Betreiber auch nicht daran: Denn während Herr Schmiedel bei seinen Befahrungen Trinitatis und Crucis 1816 bei dieser Grube gar keine erwähnenswerte Veränderung fand, notierte er am 20. November des Jahres nur, daß man ‒ also doch eigentlich, wie zuvor schon, immer noch ‒ das Ort Stunde 6,3 gegen Ost in 4½ Lachter Teufe des Tageschachtes betreibe und es bis dahin auf 6¾ Lachter Länge fortgestellt hatte (40014, Nr. 257, Film 0102).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Erwähnung der Grube findet
man erst wieder im Fahrbogen des Berggeschworenen vom 10. September 1817:
Noch immer waren zwei Mann angelegt, durch welche in 5 Lachter Teufe des
Tageschachtes nun ein Ort in Quergestein Stunde 8 gegen West „nach dem
sehr nahe vorliegenden Braunsteinlager“ betrieben und welches 6 Lachter
ausgelängt worden ist (40014, Nr. 258,
Film 0080f). Hatte man das ,Lager'
schon wieder verloren oder waren es auch hier wieder nur ,nesterweise
einbrechende', lokale Erzanreicherungen ?
Aber in der größten Not hilft auch die kleinste Hoffnung: „Von dem Ort 3 Lachter zurück waren förstenweiß Spuren von Braunstein wahrzunehmen, weshalb ich den Versorger des Gebäudes angewiesen habe, daselbst in die Höhe zu brechen, um zu sehen, ob der Braunstein sich verbessere und mächtiger werde.“ Das scheint auch der Fall gewesen zu sein, denn bei seiner Befahrung am 12. Februar 1818 fand Herr Schmiedel (40014, Nr. 259, Film 0012f): 1.) ein Ort gegen West auf 9 Lachter erlängt, wo das Lager aus mehreren Trümern bestand, insgesamt ¾ Lachter mächtig war und „milden Gneus, gelben Ocker und nesterweise einbrechenden Braunstein mit sich führte“ und 2.) von diesem Ort 3 Lachter zurück ein Überhauen von 1 Lachter Höhe. Das Lager in diesem war 1 Lachter mächtig und bestand aus gelbem Ocker, mildem Gneus und 4 bis 6 Zoll mächtigem Braunstein. Außerdem machte sich der Geschworene Gedanken um die Sicherheit der Tagesoberfläche und traf die Veranstaltung: „Da bey und in der Nähe des Tageschachtes das Gebirge durch Abbau mehrerlei Art, nach verschiedenen Richtungen durchfahren und durchbrochen, hierdurch aber selbigem die Haltbarkeit benommen worden ist; so habe ich dem Versorger qu. Gebäudes aufgegeben, daß sowohl in dem sub. No. 2. beschriebenen, mit ziemlicher Weitung betrieben werdenden Überhauen, als auch künftig auf andern Bauen, wo es thunlich, Bergfesten stehen gelassen werden sollen.“ Besser ist das... Auch hierüber kam es im Bergamt Annaberg auf der Sitzung am 28. Februar zu einem Vortrag aus dem Fahrbogen, wobei diesmal aber Herrn Schmiedel's ,Veranstaltungen' ausdrücklich bestätigt worden sind (40169, Nr. 95, Blatt 5f). Zumal man sich im nächsten Quartal schon wieder neu anlegte und in nur noch 5 Lachtern Teufe des Fundschachts nun ein Ort Stunde 7,2 gegen West betrieb und 8½ Lachter erlängt hatte (40014, Nr. 259, Film 0053). Da man auch dort aber nicht wirklich fündig geworden ist, traf Herr Schmiedel erneut Veranstaltung: „Da vor diesem Orte die Braunstein Anbrüche nur sehr gering befunden wurden, so habe ich unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: daß die Belegung des vorbeschriebenen Ortes um 1 Mann geschwächt, mit diesem aber in eben derselben Sohle, von dem Tageschachte gegen Morgen, woselbst an verschiedenen Stellen auf besagtem Lager noch 2 bis 3 Zoll mächtiger Braunstein anstehet, ein Ort getrieben und mit selbigem dieses Lager mehr untersucht werden soll.“ Wenig mehr Glück scheint man dann mit dem nächsten Versuch gehabt zu haben, denn von seiner Befahrung am 1. September 1819 berichtete der Geschworene, man trieb nun in 5 Lachtern Teufe des Fundschachts ein Ort Stunde 2,6 gegen Süd und hatte es 9¾ Lachter erlängt. Hinter dem Streckenort hieb man noch ¼ Lachter hoch die Förste aus (40014, Nr. 259, Film 0081). Aber schon am 7. Dezember des Jahres war man erneut umgeschwenkt und betrieb nun in 6 Lachtern Teufe des Fundschachts ein Ort Stunde 4,6 gegen West und hatte es 11½ Lachter erlängt. 4 Lachter dahinter hieb man wieder ⅜ Lachter hoch die Förste aus (40014, Nr. 259, Film 0112).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vermutlich war das von diesem Schacht
aus ohne großen Aufwand erreichbare Feld dann abgebaut. Von seiner
Befahrung am 5. Mai 1819 berichtete der Geschworenen Schmiedel, es
werde nun wieder ein neuer Tageschacht abgesenkt, angeblich, um den vom
Fundschacht aus betriebenen Bauen frische Wetter zu verschaffen (40014,
Nr. 261, Film 0041f).
„Es ist derselbe bereits 5½ Lachter in braunem Ocker und mildem Gneise niedergebracht, da aber selbiger bis jetzt nur mit ganz leichter, dem Drucke nicht genügsam widerstehender, auch übrigens fehlerhafter Zimmerung und keiner Fahrung versehen ist, so wurde dem Lehnträger aufgegeben, besagten Schacht ohne den geringsten Anstandt mit dauerhafter, guter Zimmerung und gehöriger Fahrung, überdies aber zu Vermeidung besorglicher Gefahr, noch mir einer Thür, der gegebenen Anweisung gemäß, zu versehen.“ Wenn der Bergbau den Eigenlehnern schon nicht viel einbrachte, so durfte er wenigstens nichts kosten... Das Gottvertrauen der Männer ist immer wieder verwunderlich. Am 23. Juni 1819 hielt Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen fest, der neue Schacht sei nun 6 Lachter tief und man habe „zu Ende voriger Woche der Durchschlag auf die wetternöthigen Baue gemacht.“ Nun setzte man mit Ortsbetrieb gegen Mitternacht den Aufschluß fort (40014, Nr. 261, Film 0058f). Am 5. November des Jahres hatte man das Ort in 5½ Lachter Tiefe gegen Mitternacht mit ¾ Lachter Weitung 4 Lachter weit fortgebracht (40014, Nr. 261, Film 0058f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner nächsten Befahrung am
18. Februar 1820 berichtete Herr Schmiedel (40014,
Nr. 262, Film 0014ff):
„Freytags, den 18. Februar 1820, bin ich auf mehrern bey Langenberg gelegenen Gruben, wovon erstere sechse auf einem und demselben Lager bauen, gefahren, und ist hierüber folgendes zu bemerken gewesen: (...)“ c.) „Auf Friedrichs Fundgrube wird in 7 Lachter Teufe des Fundschachtes ein Ort mit 2 Mann Stundte 2,3 gegen Mitternacht betrieben, vor welchem das in mehreren Trümern liegende, überhaupt gegen 1¾ Lachter mächtige Lager milden Gneus, braunen Hornstein und Braunstein führet. Erlängt ist dieses Ort von dem Fundschachte 15 Lachter, nämlich 13 Lachter gegen Abend und 2 Lachter gegen Mitternacht. 1.) Da in dieser Teufe, an dem abendlichen Stoß des, von dem Fundschachte 14 Lachter gegen Abend befindlichen neuen Tageschachtes, 6 bis 8 Zoll mächtige Braunstein Anbrüche wahrzunehmen gewesen, so habe ich unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet, daß daselbst ein Ort aufgehauen und mit 1 Mann betrieben wird, ingleichen 2.) die an dem östlichen Stoße des Fundschachtes sehr wandelbar befundene Zimmerung ehemöglichst repariert werden soll.“ Man war also auch am neuen Tageschacht noch einmal 1½ Lachter niedergegangen und grub sich von dort aus wieder in nördlicher Richtung (also unter die vorherigen Baue) weiter vor. Wenn die Zimmerung binnen weniger als einem Jahr schon wieder ,wandelbar' geworden ist, hat man zwar die Anweisung des Geschworenen, den Schacht auszuzimmern, befolgt, aber nicht gerade das beste Material dazu verwendet... Einem weiteren Protokoll über eine Befahrung, welche am 7. April 1820 durch den Geschworenen Schmiedel und den Bergmeister von Zedtwitz vorgenommen worden ist, ist zu entnehmen, daß der Eigenlöhner zu diesem Zeitpunkt bereits die Mutter der Lehnträgers, Christiane Charlotte, verwitwete Schubert gewesen ist und ihr Sohn Christian Friedrich Schubert jetzt die Aufsicht in der Grube führe (40169, Nr. 95, Rückseite Blatt 6). Eigentlich ging es in dem Protokoll aber um einen offenstehenden Schacht nahe an der Halde, dessen Verfüllung binnen drei Tagen dem Lehnträger angeordnet wurde. Bis zum nächsten Verwiegetag am 20. Juni hatte man bei diesem Betrieb immerhin 9½ Zentner (40014, Nr. 262, Film 0059) und bis zum 9. November 1820 noch einmal 6 Zentner Braunstein ausgebracht (40014, Nr. 262, Film 0096). Am 9. November fand auch wieder eine Befahrung der Grube statt, über welche im Fahrbogen zu lesen steht, es werde mit zwei Mann Belegung das Ort in 7 Lachter Teufe Stunde 11,3 gegen Nord weiter betrieben und sei nunmehr 4½ Lachter von der Förderstrecke oder 17½ Lachter vom Schacht ausgelängt (40014, Nr. 262, Film 0096f). Bis zum letzten Verwiegetag im Jahr 1820 am 9. Dezember hat die Arbeit noch einmal 17 Zentner Braunstein gebracht (40014, Nr. 262, Film 0110). Und auch am 6. Februar 1821 waren wieder 7½ Zentner zu verwiegen (40014, Nr. 264, Film 0015).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am gleichen Tage erfolgte auch wieder
eine Befahrung durch Herrn Schmiedel (40014, Nr. 264, Film 0015),
von der er berichtete:
„Sodann habe ich nachstehende Gruben befahren, als (...)“ b) Friedrichs Fundgrube bey Langenberg. „Mit den auf dieser Eigenlehnerzeche anfahrenden 2 Mann wird auf dem in 7 Lachter Teufe des Fundschachtes aufsetzendem Lager ein Ort gegen Mitternacht zu 2/3 betrieben, vor welchem dasselbe bey ⅞ Lachter Mächtigkeit aus braunem Ocker, mildem Gneus und Braunstein besteht. Die Erlängung dieses Ortes beträgt von dem Fundschacht 13¼ Lachter.“ Bis zur nächsten Befahrung am 29. Mai des Jahres war besagtes Ort „mit ¾ Lachter Weitung“ gegen Nord 14½ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 264, Film 0056). Bei den Verwiegetagen erscheint der Grubenname dagegen erst wieder am 19. Juni 1821 (40014, Nr. 264, Film 0063); es waren bis dahin aber auch 25 Zentner Braunstein ausgebracht, weswegen der Betrieb recht kontinuierlich fortgeschritten sein dürfte. Bei seiner Befahrung am 28. August 1821 fand der Geschworene die Grube unbelegt (40014, Nr. 264, Film 0086ff), was vielleicht aber wieder einmal stehenden Wettern geschuldet war, denn bis zum Verwiegetag am 18. September des Jahres hatte man hier erneut 12 Zentner Braunstein gewonnen (40014, Nr. 264, Film 0093). In seinem Fahrbogen vom gleichen Tag heißt es, daß ein Ort in 6 Lachter Teufe gegen Abend mit 1 Lachter Weitung betrieben werde und inzwischen 15½ Lachter erlängt sei (40014, Nr. 264, Film 0093). So blieb es auch den Rest des Jahres (40014, Nr. 264, Film 0116ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei der ersten Befahrung von Friedrichs
Fundgrube im Jahr 1822 am 18. April fand Herr Schmiedel ein Ort in
6 Lachtern Teufe gegen Abend 5¼ Lachter weit getrieben vor (40014,
Nr. 265, Film 0041).
Der erste Verwiegetag fand am 5. Februar statt. Bis dahin waren
6½ Zentner Braunstein ausgebracht (40014,
Nr. 265, Film 0014).
Bis zum dritten Verwiegetag am 7. August 1822 belief sich die Förderung
auf gerade einmal 4 Zentner (40014,
Nr. 265, Film 0059).
Gewaltig war das nicht...
Ansonsten fand der Geschworene in diesem Jahr über diese Grube nichts Bemerkenswertes mehr zu berichten. Im Dezember 1822 wurde Herr Schmiedel in seiner Funktion als Berggeschworener dann von Johann August Karl Gebler abgelöst.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue Geschworene befuhr diese Grube erstmals am 30. April 1823 und hielt in seinem Fahrbogen darüber fest (40014, Nr. 267, Film 0039): „Denselben Tages gefahren auf Friedrich Fdgr. daselbst, belegt mit 2 Mann, als
Unmittelbar in der Nähe der vorigen Grube (Gelber Zweig) betreibt man hier in der nächsten Umgebung des ohngefähr 6 Lachter tiefen Tageschachtes die Gewinnung von schwarzbraunem Eisenstein mittels angefangener Anlage eines Ortes und Aushieb des angetroffenen Eisensteinlagers, und ist die Unternehmung auf diesem Punkt gleichsam nur erst im Entstehen begriffen. Die Mächtigkeit des vorhandenen Eisensteins beträgt 8 bis 12 Zoll.“ Nun, ,im Entstehen begriffen' war diese Grube eigentlich nicht mehr. Anstelle von Braunstein hatte man bis zum 26. Mai des Jahres hier nun 12 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 267, Film 0046) und auch am 18. August 1823 waren weitere 14 Fuder zu vermessen (40014, Nr. 267, Film 0056). Der nächstfolgende Befahrungsbericht des Herrn Gebler vom 29. August 1823 fiel auch etwas ausführlicher aus (40014, Nr. 267, Film 0058f): „Denselben Tages gefahren auf Friedrich Fdgr. daselbst, belegt mit
Eisenstein- und Braunsteingewinnung. Aus einem in der St. 4,7 angelegten, gegenwärtig 3 Lachter tiefen Schachte hat man aus dem mitternächtlichen Stoße zwey Örter, und zwar eines in der Richtung des Schachtes selbst, das andere mit diesem in der Winkelkreutzstunde zu Untersuchung eines Braunstein- und Eisensteinlagers getrieben, ingleichen bey 1½ Lachter Teufe unter Tage durch Angriff des mittäglichen Stoßes etwas Eisenstein gewonnen. Man hat die Absicht, mit diesem Schachte theils weiter niederzugehen, theils die in der erwähnten Teufe (?) werdenden Mittel abzubauen und weitere Untersuchungen anzustellen. Die hier, so wie fast überall auf allen Eisensteingruben des Schwarzbacher und Langenberger Reviers, während der Sommerzeit fehlenden Wetter sucht man mittels einer durch die Halde vom Tage nieder in alten Mann eingeführte Wetterlutte einzuführen. Außerdem befinden sich auch noch bey 15 Lachter und bey 29 Lachter weiterer Entfernung gegen Abend zwey zu dieser Grube gehörige 9½ Lachter und 7½ Lachter tiefe und unter sich miteinander nicht, aber mit dem vorhin angegebenen, neuen Schachte in Verbindung stehende Schächte, woselbst aber vor der Hand nichts gethan wird.“ Über diese Lösung mit den
Bis Jahresende 1823 hatte man hier jedenfalls noch einmal 13 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 267, Film 0079).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 8. Januar 1824 übernahm Christian
Friedrich Schubert offiziell die Lehnträgerschaft für die Grube,
welche bis dahin formal noch seinem Vater bzw. dessen Witwe zustand
(40169, Nr. 95, Rückseite Blatt 10).
Außerdem wurde am 29. Mai 1824
Carl Heinrich Lobegott Herrmann und Konsorten aus Raschau „der
Stolln, welcher vom herrschaftlichen Wohngebäude des Ritterguts Förstel in
Stunde 12 ohngefähr (84, Schrift im Falz verdeckt) Lachter gegen
Mittag unmittelbar über der Eisensteinzeche Gelber Zweig Fdgr und
Friedrich Fdgr. bei Langenberg“ angesetzt war, unter dem Namen
Nachbarschaft Stolln bestätigt, „ingleichen das bei dessen Betriebe
erschrotene Stollnwasser“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 300). Nach
der Lagebeschreibung könnte dies eigentlich nur der
Die nächste Befahrung dieser Grube durch den Geschworenen fand erst am 25. November 1824 statt (40014, Nr. 271, Film 0068). Es waren jetzt 3 Mann hier angelegt, durch die „fast gleich neben dem hier vorhanden gewesenen Tageschacht“ ein neuer Schacht abgeteuft wurde, der bis dahin 3 Lachter tief abgesunken war. Dort hatte man auch gleich ein Eisensteinlager angetroffen und sofort in Verhieb genommen. Vorbildlicherweise hatte man den alten Schacht wegen seiner Baufälligkeit gleich zugestürzt. Weitere Befahrungen von Friedrich Fundgrube findet man in den Fahrbögen von Herrn Gebler im Jahr 1824 nicht, jedoch ist die Grube wieder mehrfach mit Ausbringen genannt. So hatte der Geschworene am 14. Oktober hier 34 Fuder (40014, Nr. 271, Film 0063) und am 3. Dezember 1824 weitere 25 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 271, Film 0073). Der Grubenbetrieb schritt also stetig fort.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 13. Januar 1825 war der Geschworene
wieder vor Ort und berichtete, der Betrieb des Ortes in 3 Ltr. Teufe werde
fortgesetzt und dabei dichter Brauneisenstein gewonnen
(40014, Nr. 273, Film 0005).
Außerdem notierte Herr Gebler: „Da dieses Lager aber nunmehr
gegen den Tag aufsteigt und schwach wird, man sich hingegen zugleich in
der Nähe des obern 10 Ltr. davon entfernten Schachtes befindet, so hat man
die Absicht, mittels Forttriebs des zeitherigen Ortes in den erwähnten
Schacht durchschlägig zu machen und sich dadurch Wetter für diejenige
Jahreszeit, wo es an solchen immer fehlt, zu verschaffen. Man würde mit
diesem noch ungefähr 2½ Ltr. fortzugehen haben...“ Bis zum 10. Februar
des Jahres hatte man dabei immerhin schon wieder 15 Fuder Eisenstein
ausgebracht
(40014, Nr. 273, Film 0016). Nachdem am
20. Mai 1825 die
bergamtliche
„Donnerstags, den 2ten Juny habe ich mich nach dem Tännicht und nach Langenberg begeben und die dortigen Eisensteingruben besucht, wobey ich gefunden, daß 1) bey Friedrich Fdgr. bey Langenberg auf der bey einem königl. Bergamte erbothenen (?) Stelle dem dortigen Eisensteinabbau mittels einer Wetterlotte aus Brettern, für die man vom Tage herein ein kleines Schächtchen angelegt, nach Einlegen jener aber wieder zugefüllt hatte, Wetter zugeführt worden waren.“ Auf den 7. Juli 1825 datiert aber dann ein Bergamtsprotokoll, daß Lehnträger Schubert die ihm bei der bergamtlichen Befahrung vom 20. Mai auferlegte Strafe von 5 Thl. – Gr. – Pf. an die Scheibenberg'er Bergknappschaftskasse noch nicht bezahlt habe. Sollte die erneute Frist wieder überschritten werden, wurde der Geschworene Gebler als Waagemeister angewiesen, Brauneisenstein einzubehalten. Auch die ,gehörige Verbühnung mit wenigstens 6 Zoll starken Hölzern samt deren Überstürzung' seines dritten und vierten Tageschachtes war noch nicht erfolgt, wofür aber Holzmangel als Grund angegeben wurde. Sie soll nun schleunigst nachgeholt werden (40169, Nr. 95, Blatt 11). Außerdem wurde in diesem Zusammenhang noch festgehalten, daß Schubert die Lehnträgerschaft abgegeben und seinem vorherigen Mitgesellen Friedrich August Korb übergeben hat. Über die Befahrung durch den Geschworenen am 15. Juli 1825 heißt es im Fahrbogen nur (40014, Nr. 273, Film 0048): „Auf Christbescherung und auf Friedrich Fdgr. war man mit Ausscheiden der (?) gewonnenen Eisensteine beschäftigt, um selbige (?) vermessen zu lassen.“ Im Fahrbogen auf den 25. Juli 1825 wird daraufhin erwähnt, daß Herr Gebler an diesem Tage hier 25 Fuder Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 273, Film 0050). Auch am 19. September fand Herr Gebler den Abbau selbst eingestellt (40014, Nr. 273, Film 0062): „Desselben Tages habe ich mich fast auf alle Eisensteingruben, so bey Langenberg und im Tännicht liegen, begeben, habe solche aber fast durchgehends, meistens des im Sommer eintretenden Wettermangels wegen, unbelegt gefunden. Auf Friedrich Fdgr. indessen und auf Kästners Hoffnung beschäftigte man sich mit Ausschlagen von Eisenstein. Auch hat an dem etwas matten Betriebe der gegenwärtige Mangel an Eisensteinabsatz seinen Antheil.“ Weitere Befahrungen dieser Grube fanden in diesem Jahr durch den Geschworenen nicht statt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Umstand des unzureichenden Absatzes
wird auch bei der nächsten Befahrung durch Herrn Gebler in seinem
Fahrbogen festgehalten
(40014, Nr. 275, Film 0021):
„Desselben Tages (am 28.2.1826) habe ich mich auf das mit 2 Mann
belegte Grubengebäude Friedrich Fdgr. bey Langenberg begeben und gefunden,
daß das dortige Eisensteinlager sehr mächtig geworden ist und sehr guten
Brauneisenstein enthält. Trotzdem können diese Eigenlöhner, wie
verschiedene andere, zur Zeit keine Abnahme finden und haben deshalb einen
ansehnlichen Vorrath von ersterem liegen und betreiben die Grube nur
allmählig.“ Zum Glück hatte man zumindest in einigen der Gruben aber noch einen zweiten Rohstoff. Wie der Geschworene nach Seiner Befahrung am 24. April 1826 notierte, schwenkten die Betreiber nun wieder auf diesen um (40014, Nr. 275, Film 0038f): „Wegen eines ansehnlichen Vorrathes von gewonnenen, über Tage sich befindenden, ausgeschlagenen und zum Verkauf vorgerichteten Eisensteins betreibt man dermalen diesen Abbau nicht, sondern hat sich, nachdem man von dem zeitherigen niedern Tageschachte nach dem obern nach Abend zu gelegenen eine Communicationsstrecke getrieben und mit demselben durchschlägig geworden, zu dem von solcher bey 8 Ltr. Teufe einige Lachter weiter gegen Mittag Abend und gegen Mittag gelegenen Braunsteinabbau (zugewandt ?). Es stehet hier der Braunstein auf einem Lager von etwa 1 Elle Mächtigkeit in verschiedenen Trümern und Schichten 2 bis 4 Zoll mächtig an.“ Einige Tage später berichtete Herr Gebler (40014, Nr. 275, Film 0040), er habe am 28. April „auf Meyers Hoffnung Fdgr. und Freundschaft Fdgr. im Tännicht und Friedrich Fdgr bey Langenberg und Köhlers Fdgr. bey Raschau den vorhandenen Braunstein theils besichtigt, theils verwogen.“ Wieviel davon bis dahin ausgebracht war, steht hier leider nicht geschrieben. Stattdessen notierte Herr Gebler dann, daß er am 8. Juni 1826 bei Friedrich Fdgr. 26 Fuder Eisenstein vermessen habe (40014, Nr. 275, Film 0053). Die Lieferung ging an zwei Hammerwerke, deren Namen leider unleserlich sind. Am 9. November 1826 hatte Herr Gebler dann noch einmal 35 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 275, Film 0087). Weitere Befahrungen dieser Grube fanden auch in diesem Jahr durch den Geschworenen nicht statt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bis zum 16. Februar 1827 waren hier nur 6 Fuder Eisenstein ausgebracht und zum Vermessen bereit (40014, Nr. 278, Film 0016). Dieses Frühjahr muß ein sehr nasses gewesen sein und so mußte auch Herr Gebler an seinem ersten Befahrungstermin in diesem Jahr unverrichteterdinge wieder abreisen (40014, Nr. 278, Film 0022): „Freytags, den 16ten März habe ich mich auf mehrere der Langenberger Eisenstein und Braunsteinzechen begeben, als Köhlers Fdgr., Friedrich Fdgr. und Neu Geschrey Fdgr., dieselben aber wegen vieler Niederfälle (?) sich gesammelter zum Theil etwas aufgegangener Waßer, auch der Abwesenheit der Eigenlöhner wegen nicht befahren können.“ Zumindest bei Friedrich Fundgrube haben Niederschläge und Tauwetter ernsthaften Schaden angerichtet, weswegen auch der Geschworene zu tun bekam. Am 30. März notierte er (40014, Nr. 278, Film 0024), „habe ich mich nach Langenberg in Betreff eines daselbst bey der jetzigen nassen Witterung niedergegangenen alten Schachtes (...) begeben.“Aus seinem Fahrbericht vom 6. April 1827 (40014, Nr. 278, Film 0026f) erfahren wir auch, daß der zusammengebrochene Schacht zur Friedrich Fdgr. gehört hat: An jenem Tage nämlich „habe ich mich wiederum nach Langenberg begeben und (...) den Zustand des bey Friedrich Fdgr. durch Thauwetter und Nässe entstandenen Tagebruchs und was hier fernerweit zu thun, untersucht, ...“ Zum Glück ist bei dem Schachtbruch offenbar niemand zu Schaden gekommen. Auch am 18. April war Herr Gebler wieder unterwegs und berichtete (40014, Nr. 278, Film 0032f): „Desselben Tages habe ich mich nach Langenberg begeben, den Zustand mehrerer von dem zeitherigen Thauwetter beschädigter Eisenstein- und Braunstein- Gruben, auch die Punkte, wo es Brüche gemacht hat, zu untersuchen und insonderheit den Tagebruch auf Friedrich Fdgr. wieder besehen und die nöthigen Anordnungen gegeben. Zugleich habe ich eine Stelle auf der Halde besichtigt, wo man statt des bey dem Niedergehen des Bruches zusammengegangenen Braunsteinschachtes einen andern an dessen Stelle niederbringen und den zusammengegangenen mit den Bergen aus dem neuen ausstürzen und den Tagebruch einebnen will.“ Die Betreiber gaben durch das Unglück also keineswegs auf und dachten schon wieder über die Art und Weise des ferneren Betriebes nach... So konnte der Geschworene in seinem Fahrbogen vom 17. August 1827 auch berichten, daß die beiden Eigenlöhner wieder in 3 Ltr. Teufe und wenige Ltr. vom Schacht gegen Abend Eisenstein abbauten und daß das „nicht unbedeutende Brauneisensteinlager sich bis an den Tag hinauszieht, so daß man bey 2 bis 3 Ellen Teufe unter dem Rasen den Eisenstein würde wegnehmen können, welches Verfahren, hier vom Tage niederzugehen, ohnstreitig das nützlichere, einfachere und wohlfeilere werden dürfte, ob man gleich in diesem Jahre nicht dazu kommen wird. Es bedarf auf dieser Grube des großen hier vorhandenen Drucks wegen mehr an Stammholz, als dergleichen kleine Gruben gewöhnlich und (...) daß das diesjährig empfangene Holz bereits verbraucht ist, kann man den Zustand der Zimmerung in der Grube doch nur besorglich finden.“ Braunsteinbau. „In der Nähe des bey einiger Entfernung von dem jetzigen ersten Schachte an Statt des in dem verflossnen Frühjahr niedergegangenen, von neuem niedergebrachten, 7 Ltr. tiefen Hülfsschachtes gewinnt man Braunstein. Es ist zwar zwischen beyden Schächten dermalen eine Communication, jedoch eine beschwerliche (?) und, solange die Grube nicht mit bessrer und sicherer Zimmerung versehen wird, nicht einmal ungefährliche, vorhanden. Das Thauwetter und die große Nässe des letzten Frühjahrs haben die Baue dieser Grube den meisten Schaden gethan.“ Zu diesem Fahrbericht erfolgte auch wieder ein Vortrag auf der Bergamtssitzung in Annaberg am 25. August 1827, wobei das Bergamt den Veranstaltungen des Geschworenen und namentlich einem Vorgriff auf die Holzzuweisung für das nächste Jahr zustimmte, so daß der ,besorgliche' Zustand der Zimmerung wieder ausgebessert werden konnte (40169, Nr. 95, Blatt 12). Weitere Nennungen der Friedrich Fundgrube in den Fahrbögen aus dem Jahr 1827 gibt es allerdings nicht, auch nicht mit einem Ausbringen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits im Jahr 1827 brachte die
Entdeckung eines „Grünsteinlagers“
im
Auch aus dem Jahr 1828 gibt es keinen einzigen Bericht über eine Befahrung durch den Geschworenen und über den Grubenbetrieb. Herr Gebler war Anfang des Jahres nur zweimal übertage zugegen, um die „in der Kaue liegenden Braunsteinvorräthe“ zu begutachten (40014, Nr. 280, Film 0011 und 0024). In den Quartalen Trinitatis und Crucis 1828 hat er die Grube nur besucht, um den dort ausgebrachten Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0036, 0066 und 0079). Am 1. November 1828 hatte er „eine Feldstreitigkeit zwischen den Eigenlöhnern der beyden Gruben Friedrich Fdgr. und Gelber Zweig Fdgr beyderseits zu Langenberg nach vorgängiger mittelst Messung angestellter Untersuchung beyzulegen gesucht und die Lehnträger beschieden.“ (40014, Nr. 280, Film 0080) Dergleichen gehörte natürlich auch zu den Aufgaben des Geschworenen und ließ sich nun mal nicht am Schreibtisch erledigen. Anschließend war Herr Gebler noch zweimal auf Friedrich Fdgr., um den ausgeförderten Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0083 und 0097). Die Gesamtförderung in diesem Jahr summierte sich auf 102 Fuder Eisenstein. Damit war Friedrichs Fundgrube schon zu den bedeutenderen Eisenstein- Zechen dieser Zeit im Langenberg'er Revierteil zu rechnen. Obwohl offenbar auch Braunstein gefördert worden ist, liegen zu diesem keine Mengenangaben in den Fahrbögen vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste
Grubenbefahrung durch den Geschworenen fand am 14. Mai 1829
statt, worüber er berichtete (40014,
Nr. 280, Film 0137),
die beiden Eigenlöhner hätten hier
„aus dem 8 Ltr.
tiefen zweiten Schacht bei 6 und 8 Ltr. Teufe Örter gegen Abend und Morgen
angesetzt, welche sich wiederum nach verschiedenen Richtungen teilen. Sie
dienen, das vorhandene Braunstein- und Eisensteinlager in seinen
verschiedenen Richtungen zu untersuchen und dadurch Gelegenheit zum Abbau
zu erlangen.“
Die im Vorjahr bezüglich der Feldgrenzen getroffene Regelung wurde offenbar eingehalten: „Zu gleicher Zeit ist man mit dem Grubengebäude Gelber Zweig durchschlägig geworden und hält nun mit diesem nach einer im vorigen Herbst angegebenen Richtungslinie Markscheide einander.“ Allerdings war auch hier kein Braunstein zu verkaufen und „ist dessen eine große Quantität vorräthig.“ Danach war Herr Gebler noch viermal (40014, Nr. 280, Film 0145, 0157, 0180 und 0184) in diesem Jahr auf der Grube zugegen, um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen, dessen Gesamtmenge sich im Jahr 1829 auf 77 Fuder summierte. Wie das vorige endete, so begann auch das neue Jahr: Im Juli und im August war der Geschworene vor Ort, um den Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0241 und 0249); am 21. Juli 1830 außerdem, um „den in der Kaue vorhandenen Vorrat an Braunstein“ zu untersuchen (40014, Nr. 280, Film 0244). Am 13. Oktober 1830 fand wieder einmal eine Befahrung statt, über die im Fahrbogen zu lesen steht (40014, Nr. 280, Film 0266): „Aus dem hier vorhandenen 8 Ltr. tiefen Tageschachte ist aus dessen Abendstoße bey 4 Ltr. Teufe ein Ort gegen Abend getrieben, welches aber sehr bald die Richtung der stehenden Stunde annimmt, nicht allzuweit mehr von der Markscheide mit Gelber Zweig entfernt ist und mit einigen Lachtern Länge gegen Mitternacht zu einem kleinen Brauneisensteinabbau führt. Bey 6 und 7 Ltr. Teufe hat man ähnliche Örter in ähnliche Richtungen getrieben und das daselbst mit Braunstein abwechselnde Brauneisensteinlager verschiedentlich durchfahren, weshalb man denn von beyden mehrere kleine Abbaue antrifft.“ Am 1. November schließlich war noch einmal Eisenstein zum Vermessen bereit (40014, Nr. 280, Film 0269). Insgesamt hatte man auf Friedrichs Fundgrube 1830 demnach nur 48,5 Fuder Eisenstein gefördert ‒ die fallende Tendenz des Vorjahres setzte sich also fort. In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) ist für dieses Jahr eine Menge von 54½ Fudern angegeben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Jahr 1831
fehlen Berichte über Grubenbefahrungen in den Fahrbögen des Geschworenen
ganz. Jedoch war Herr Gebler viermal vor Ort, um den ausgebrachten
Eisenstein zu vermessen (40014,
Nr. 281, Film 0036, 0049, 0072 und 0075),
dessen Menge zwischen 7 und 20 Fudern pro Quartal schwankte und sich am
Ende des Jahres auf 52 Fuder, 5 Tonnen summiert hatte. Das entsprach ungefähr der Menge des Vorjahres. Auch im Jahr 1832 fanden offenbar keine Grubenbefahrungen durch den Geschworenen bei Friedrichs Fdgr. statt. In diesem Jahr war Herr Gebler auch nur zweimal vor Ort (nämlich am 1. Mai und am 29. Juni), um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 281, Film 0116 und 0130), wobei ausweislich der Fahrbögen aber lediglich 15 Fuder zusammengekommen sind. Während in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) für das Vorjahr eine Menge von 62 Fudern angegeben ist, stimmt die niedrige Zahl für das Jahr 1832 mit der Angabe in diesen Quellen überein. Außerdem hatte man hier aber den Erzlieferungsextrakten zufolge im Jahr 1831 auch 65 Zentner und 1832 weitere 40 Zentner Braunstein gefördert. Die Krise bei letzterem hielt jedoch weiter an, wozu Herr Gebler etwa am 9. Juni 1831 in seinem Fahrbogen notiert hatte, er habe an diesem Tage wieder einmal „die Braunsteingruben meiner Revier besucht und solche fast durchgehends an Absatzmangel leidend angetroffen.“ (40014, Nr. 281, Film 0044) Da man den Braunstein wohl noch immer nicht erträglich absetzen konnte, machte man sich im nächsten Jahr 1833 wieder auf die Suche nach neuen Eisensteinanbrüchen. In den Fahrbögen des Berggeschworenen aus diesem Jahr findet man dazu aber nur die eine Notiz, er habe „Desselben Tages (am 12. September 1833) ...diejenigen Stellen in dem Holze bey dem Ritterguth Förstel besichtigt, wo zwey neue Schächte, und zwar einer von Seiten der Grube Friedrich Fdgr. und der andere für das Grubengebäude Gelber Zweig, und zwar mit der möglichst geringsten Benachtheiligung des Hrn. Grundbesitzers angelegt worden sind.“ (40014, Nr. 281, Film 0218) Am 30. September 1834 ist dann auch wieder in den Fahrbögen vermerkt, Herr Gebler habe an diesem Tag auf Friedrich Fundgrube 22 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 289, Film 0054). Berichte über Grubenbefahrungen in diesem Jahr gibt es dagegen wieder nicht. Nicht anders war es in den folgenden Jahren: Am 13. Juli 1835 hat der Geschworene auf Friedrich Fundgrube 27 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 289, Film 0105). Und auch 1836 war Herr Gebler nur einmal auf der Grube, um diesmal 10 Fuder zu vermessen (40014, Nr. 289, Film 0176). 1837 und bis Trinitatis 1838 wird die Grube in den Fahrbögen des Geschworenen nicht mehr genannt (40014, Nr. 294). Danach muß Herr Gebler andere Aufgaben übernommen haben, ohne daß sofort ein anderer zum Berggeschworenen bestimmt worden ist. Ab Reminiscere 1840 übernahm diese Dienststellung dann Theodor Haupt (40014, Nr. 300).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue
Geschworene hat die in Umgang stehenden Gruben seines Reviers natürlich
auch zeitnah alle befahren. Zu Friedrich Fundgrube bei Langenberg
findet man in seinen Fahrbögen die folgende Notiz unter dem 10. Januar 1840 (40014, Nr. 300,
Film 0014f):
„Nachmittags habe ich ferner die Gruben bei Langenberg und im Tännichtwalde befahren... Auf dieser mit 2 Mann belegten Grube wurden die beiden im Mittel zwischen beiden Schächten in 7 Lachter saigerer Teufe in West und Ost betriebenen Strecken noch fortgetrieben und sind zusammen nun 9½ Lachter in größtentheils hübschen Anbrüchen von Brauneisenstein erlängt worden.“ Seine nächste Befahrung fand am 7. April 1840 statt, worüber er berichtete, es werde nun von dem im Mittel zwischen beiden Schächten in Ost gehenden Orte, das inzwischen 8 Lachter von der „Communicationsstrecke“ aus erlängt ist, nur noch wenig Braunstein gewonnen. Nach Westen waren die Anbrüche besser, wo man 4 Lachter ausgelängt hatte. Dort hatte man 3 Lachter vom Streckenkreuz aus im Lager ein Steig- und ein Fallort angelegt, ist mit letzterem aber in alten Mann gekommen... Schon wieder. Die Alten waren aber auch schon überall. Von der Befahrung am 10. August berichtete Herr Haupt (40014, Nr. 300, Film 0092): „Auf Friedrich gev. Fdgr. hat man in 8 Lachter Teufe die Communicationsstrecke zwischen beiden Schächten frisch verholzt und sodann von dieser aus 2 Lachter vom obern Schachte in Ost ein Ort auf sehr hübschen Braunstein getrieben.“ Auf mehreren anderen Gruben des Reviers ruhte zu diesem Zeitpunkt bereits der Betreib des alljährlichen Wettermangels im Sommer halber bereits ganz. Auch im September arbeitete man hier, wenn auch auf der oberen Sohle, noch weiter. Der Geschworene notierte unter dem 8. September in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 300, Film 0109): „Auf Friedrich Fdgr. baut man noch immer auf der 6 Lachter Sohle, da die Tiefbaue wegen Wettermangel noch nicht wieder fahrbar sind. In gedachter Sohle betreibt man nämlich 2 Örter in Ost, das eine bei 1 Lachter, das andere bei 8 Lachter nördlicher Entfernung vom obern Tageschachte. Vor dem ersteren gewinnt man namentlich Braunstein, vor dem letzteren ist der Braunstein in geringerer Menge vorhanden und dafür bricht hier etwas Eisenstein, der wegen seiner Durchdringung mit Braunstein vorzüglich schätzenswerth seyn dürfte. Beide Örter sind von der Communicationsstrecke zwischen beiden Schächten 3 – 4 Lachter erlängt.“ Außerdem lobte er: „Übrigens ist zu bemerken, daß die umgehenden Baue auf dieser Grube ungleich besser unterhalten werden, als auf vielen anderen Gruben des Tännichtwaldes.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Ende Crucis 1840 bis Mitte Reminiscere 1841 wurden Herrn Haupt wohl andere Aufgaben übertragen. In dieser Zeit wurde er in seiner Funktion als Geschworener des Bergamts Scheibenberg durch den Raschau'er Schichtmeister Friedrich Wilhelm Schubert vertreten. Dieser fand die Grube am 5. Oktober 1840 aber unbelegt (40014, Nr. 300, Film 0113). Auch unter dem 28. November hielt Herr Schubert in seinem Fahrbogen fest: „Auf dem Rückwege habe ich bei Gelber Zweig gev. Fdgr., Friedrich gev. Fdgr., Gott segne beständig gev. Fdgr., Ullricke gev. Fdgr. und Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. niemand in Arbeit getroffen.“ (40014, Nr. 300, Film 0134f) Und noch einmal liest man unter dem 17. Dezember 1840, er habe an diesem Tage „bei Riedels gev. Fdgr., Friedrich und den übrigen Eigenlöhnergruben bei Langenberg abermals niemand in Arbeit getroffen.“ (40014, Nr. 300, Film 0141) Warum die Arbeit im Herbst dann doch so lange ruhte, ist unklar. Die Eigenlöhner mußten ja eigentlich darauf achten, daß der Geschworene ihre Gruben nicht mehrfach hintereinander unbelegt vorfand, denn dann hätten sie ins Freie fallen können. Die nächste Befahrung führte Herr Schubert am 21. Januar 1841 (40014, Nr. 300, Film 0146f) durch und berichtete danach, der Nässe wegen sei auch hier der Tageschacht wandelbar geworden. „Es scheint bedenklich, ob die Zimmerung dem Druck bei dem lang anhaltenden Regen zu widerstehen vermag, so habe ich die Eigenlöhner angewiesen, so bald als möglich den Tageschacht mit neuer Zimmerung zu versehen.“ Über den Grubenbetrieb hieß es, in 7,5 Ltr. Teufe sei 9 Ltr. nördlich und dort wiederum 4 Ltr. gegen Ost ein Ort bis an das Braunsteinlager, welches hier in mehreren Trümern vorliegt, erlängt. Dort hat man in der Firste auch ein Eisensteinlager angetroffen, welches aber später bebaut werden solle. Noch 2,1 Ltr. tiefer und 5,5 Ltr. vom Tageschacht entfernt ist eine weitere Strecke getrieben, die mit der oberen durchschlägig gemacht werden soll. Auf dieser ging ebenfalls ein Braunsteinabbau um, vor welchem aber nur 2 bis 3 Zoll starke Trümer anstehen. Der dortige Streckenausbau war aber so mangelhaft, daß Herr Schubert dort „nicht verweilen (wollte), um genauere Beobachtung zu machen.“ Außerdem hat er an diesem Tag 30 Zentner des geförderten Braunsteins verwogen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab Trinitatis 1841 war Herr Haupt auch hier wieder da, hatte in seinem Fahrbericht aber gleich zu bemängeln (40014, Nr. 300, Film 0208): „Auf den Gruben Hausteins Hoffnung, Gott segne beständig und Friedrich Fdgr. habe ich nicht fahren können, weil die daselbst anfahrenden Leute, ohngeachtet sie Tags vorher bestellt worden sind, nicht zugegen waren.“ Ab Crucis 1841 wurde Herr Haupt erneut von höherer Stelle zu anderen Aufgaben beordert. In der folgenden Zeit vertrat ihn in der Funktion als Geschworener im Bergamt Scheibenberg der Rezeßschreiber Lippmann aus Annaberg (40014, Nr. 300, Film 0230). Dieser hat auch gleich am 15. September 1841 die Eigenlöhnergruben im Tännicht und Langenberg befahren und berichtete danach in seinem Fahrbogen über Friedrich gevierte Fundgrube (40014, Nr. 300, Film 0242), da die Baue auf der 9 Lachter- Sohle wegen Wettermangels noch immer nicht zugänglich waren, betrieb man auf der 6 Lachter- Sohle vom unteren Schacht aus ein Ort hora 3,6 NO. ein Ort, das bis jetzt 6 Lachter erlängt ist, in einem Brauneisensteinlager. Und: „Die höchst wünschenswerthe Erneuerung der Zimmerung im oberen oder alten Schacht soll im nächsten Quartal vorgenommen werden.“ Vor seiner nächsten Befahrung am 11. November 1841 hatte sich ein Bruch ereignet, der übel hätte ausgehen können (40014, Nr. 300, Film 0261f): Die Eigenlöhner nämlich hatten „den 9 Lachter tiefen Fundschacht durchweg wieder neu verholzt, und zwar mit der hier gebräuchlichen Wandruthenzimmerung. Da sich der obere Theil des Schachtes nach und nach um ½ Lachter gegen Mitternacht hienüber hatte verschieben lassen, so kesselte derselbe noch während der Auswechslung auf 2½ Lachter Teufe von oben herein aus, jedoch ohne weiteren Unfall. Der untere, schon neu ausgezimmerte Theil des Schachtes versetzte sich hierdurch auf 4 Lachter Teufe voller Berge und altes Holz, und ein nicht geringer Theil der Halde mußte zum Ausstürzen des entstandenen leeren Raumes verwendet werden.“ Es war wohl nicht nur wünschenswert, sondern allerhöchste Zeit, den Schachtausbau in Ordnung zu bringen... Wieder einmal hatten die Betreiber Glück, daß niemand zu Schaden gekommen ist. Es dauerte dann noch einen Monat, dann konnte Herr Lippmann am 8. Dezember 1841 berichten (40014, Nr. 300, Film 0268f), daß der Fundschacht wieder leergezogen worden ist und man wieder in der 6 Lachter- Strecke und 7 Lachter vom unteren Tageschacht nach Süden ein Braunsteinmittel abbaute. Am 13. Januar 1842 war Herr Lippmann dann hier, um den bis dahin ausgebrachten Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 321, Film 0003).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seine nächste Grubenbefahrung führte Herr Lippmann hier am 9. März 1842 durch (40014, Nr. 321, Film 0033), worüber er in seinem Fahrbogen festhielt: „Die Nachbargrube (von Gelber Zweig) Friedrich gev. Fdgr. erfreut sich noch immer derselben Anbrüche wie früher. Das auf der oberen oder der 6 Lachterstrecke bei circa 12 Lachtern nordöstlicher Entfernung vom neuen oder untern Tageschacht von den beiden Eigenlöhnern gefaßte Braunsteintrum giebt sich mitunter bis zu 0,1 Lachter mächtig. An den Punkten, wo der Braunstein ganz derb und dann allemal von ziemlicher Festigkeit sich einfindet, ist derselbe immer mit etwas Eisenstein vermengt, den man beim Ausschlagen möglichst zu entfernen sucht, da er ein geringes Aussehen verursacht.“ Am 27. April befand der Vertreter des Geschworenen, man sei hier mit dem Auskutten und Sieben des „in großen Vorräthen gewonnenen und zu Tage geförderten klaren Mulms, behufs der Ausziehung des darin vorkommenden Braunsteins“ befaßt (40014, Nr. 321, Film 0033). Am 18. Mai 1842 hatte er dann aber erst einmal Eisenstein „an das Hammerwerk Pfeilhammer“ zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0040). Man baute jetzt beides ab, wie auch aus dem nächsten Fahrbericht Lippmann's vom 21. Juni 1842 (40014, Nr. 321, Film 0049f) hervorgeht: Die hier anfahrenden zwei Mann „liegen auf der 6 Lachtersohle, da die tieferen Baue wegen Wettermangel wieder nicht zugänglich sind. Man beutet in vorgedachter Sohle einestheils bei 7 Lachter Entfernung vom untern Tageschachte mittelst Fallortes gegen Süd hübsche Braunsteinanbrüche aus, wobei man stellenweise zwar mit auf alten Mann stößt, dessen Gewinnung jedoch, da er sehr braunsteinreich ist, sich durch Ausklauben und Sieben hinlänglich belohnt. Anderntheils und hauptsächlich verfolgt man in derselben Teufe bei 3 Lachter Entfernung vom neuen Tageschacht mit einem in Morgen aufsteigenden Steigorte eine in mehreren Trümern hier vorkommende Brauneisensteinablagerung, deren Gesamtmächtigkeit sich mitunter bis zu 0,2 Lachter erweißt.“ Am 15. November 1842 war wieder Eisenstein zu vermessen, aber diesmal gibt es keine Angaben zur Menge und zum Abnehmer (40014, Nr. 321, Film 0101f). Auch bei seiner letzten Befahrung in diesem Jahr, am 21. Dezember 1842, baute man weiter in 6 Lachtern Tiefe des untern Tageschachtes, wo eine Strecke 4 Lachter in NNO. und von da eine fallende Strecke 3 Lachter in SO. sowie eine zweite in NW 2 Lachter lang in braunem Mulm mit Nestern von Eisenstein und Braunstein getrieben waren. Außerdem wurde auch die andere Strecke noch 3 Lachter weiter erlängt, wo „etwas Braunstein ansteht, den man bis auf bessere Zeiten stehen lassen will.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr 1843 fand erst wieder am 3. Mai eine Grubenbefahrung durch Herrn Lippmann statt, worüber er berichtete (40014, Nr. 321, Film 0174), die hier anfahrenden zwei Mann „bauen auf der oberen oder 6 Lachterstrecke bei 11 Lachter nordöstlicher Entfernung vom unteren oder Neuschacht recht guten, bald in mehreren Trümern... bald in einem Trum... einbrechenden Brauneisenstein ortweis, bald steigend und bald fallend wegen seiner unregelmäßigen Einlagerung, ab. Gleichzeitig gewinnt man hier auch Braunstein, welcher schmitzenweise von sehr schöner, milder, mulmiger Beschaffenheit mitunter beibricht.“ Zu bemängeln fand er dabei: „Die Erneuerung des Ausbaus im Neuschacht ist dringend nothwendig.“ Am 13. Juni 1843 ist Herr Lippmann erneut auf Friedrich Fdgr. angefahren und berichtete nun (40014, Nr. 321, Film 0182), die beiden Eigenlöhner seien, „der außerordentlich schwachen Wetter ungeachtet, mit allerdings dringender Auswechslung der Zimmerung auf den zwischen beiden Schächten in 6 Lachter Teufe befindlichen Communicationsstrecke beschäftigt. Die Anbrüche an Eisenstein haben sich dermalen vermindert.“ Im nächsten Monat war dann wieder Eisenstein „an das Hammerwerk Pfeilhammer“ zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0192) und am 13. Oktober 1843 „wurde von Friedrich gev. Fdgr. bei Langenberg eine Eisensteinprobe auf Erlhammer vermessen.“ (40014, Nr. 321, Film 0213) Der Betrieb der Grube war dagegen schon Ende September des Jahres wegen Wettermangels eingestellt und auch im November 1843 fand Herr Lippmann sie unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0209 und 0225). Das blieb wohl auch so, denn auch nachdem Theodor Haupt im Dezember 1843 nach Scheibenberg zurückgekehrt ist, gibt es bis einschließlich April des Folgejahres keine Fahrberichte zu dieser Grube mehr. Herr Haupt muß anderenorts sehr gefragt gewesen sind, denn ab Mai 1844 wurde er wieder in seiner Funktion in Scheibenberg ‒ diesmal durch den Markscheider Friedrich Eduard Neubert ‒ vertreten. Was Herr Lippmann vor einem Jahr schon angeraten hatte, haben die Eigenlöhner dann wohl doch vernachlässigt, denn im ersten Fahrbericht des Herrn Neubert zur Friedrich gev. Fdgr. vom 10. Mai 1844 (40014, Nr. 322, Film 0038f) heißt es dann, die Belegschaft sei gerade „mit Aufgewältigung des untern oder neuen Schachtes, welcher kürzlich zum Theil zusammengebrochen war, beschäftigt. Damit sind zugleich die Communicationsstrecken dazwischen zu Bruche gegangen. Der obere oder alte Schacht war wegen Wettermangel nur bis etwa 5 Lachter Teufe zu befahren.“ Außer dem alljährlich im Sommer auf den kleinen Gruben eintretenden Wetterproblemen fand Herr Neubert in seinem Fahrbogeneintrag unter dem 12. Juni 1844 (40014, Nr. 322, Film 0047f) noch eine andere Erklärung für die Betriebsunterbrechung. An jenem Tage, schrieb er, „beabsichtigte ich, die übrigen im Tännicht und bei Langenberg liegenden Gruben, als Riedels, Reppels, Köhlers, Gelber Zweig, Friedrich, Gott segne beständig, Hausteins, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. zu befahren, sie waren jedoch sämmtlich außer Belegung, wovon bei den meisten die Unmöglichkeit, die Producte zu verwerthen, die Ursache sein mag.“ Es gab wohl gerade wieder einen Preisverfall mangels Nachfrage nach Erz und da hielt man lieber die Vorräte zurück, als sie ohne jeden Wertgewinn zu verschleudern. Aber eigentlich gab es ja immer auch genügend andere Arbeit auf den Gruben und so konnte Herr Neubert noch hinzufügen: „Bei Friedrich gev. Fdgr., die wegen Wettermangel nicht belegt war, bemerke ich, daß der Neuschacht bis etwa 5 Ltr. Teufe wieder gewältigt und neu ausgebaut ist.“ Der Mangel an Wetterzug blieb den ganzen Sommer bestehen. Seinem Fahrbogen über die 10. bis 13. Woche Crucis 1844 (September) fügte Herr Neubert am Schluß noch an (40014, Nr. 322, Film 0068): „Übrigens bemerke ich noch, daß ich in No. 10te und 11te Woche zu mehreren Malen die Gruben Distlers Freundschaft, Hausteins Hoffnung, Friedrich, Gelber Zweig, Köhlers und Reppels gev. Fdgr. bei Langenberg... besuchte, diese aber stets unbelegt fand.“ Auch unter dem 15. November 1844 (40014, Nr. 322, Film 0075) trug Herr Neubert wieder in seinem Fahrbogen ein, an jenem Tage „begab ich mich zuvörderst nach dem Berggebäude Distlers Freundschaft gev. Fdgr., um dasselbe zu befahren, was jedoch wegen der sehr schlechten Wetter im dasigen Tageschachte unmöglich war und verfügte mich dann über die Gruben Ullricke, Hausteins, Gott segne beständig, Friedrich und Gelber Zweig gev. Fdgr., die ich sämmtlich unbelegt fand, nach dem im Freien liegenden Julius Stolln...“ Erst Ende November nahm man den Grubenbetrieb wieder auf. Im Fahrbericht vom 6. Dezember 1844 (40014, Nr. 322, Film 0083f) heißt es nun: „Bei Friedrich gev. Fdgr. hatte der Betrieb seit zwei Wochen mit zwei Mann wieder begonnen, nachdem sich im neuen oder unteren Tageschacht bessere Wetter eingefunden hatten. Man gewältigte eine Strecke, die in 4,5 Ltr. Teufe hora 3,0 NO. getrieben ist und im letzten Frühjahr beim Zusammengehen des Schachtes mit zu Bruche gegangen war und war damit 4 Ltr. fortgerückt.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner Befahrung am 14. Januar 1845 fand Herr Neubert die Belegschaft noch mit der Gewältigung beschäftigt. Wenn man damit fertig sei, wolle man in 3,1 Ltr. Teufe des Neuschachtes auf einem 0,2 Ltr. mächtigen Eisensteintrum einschlagen (40014, Nr. 322, Film 0089). Am 14. März fand er die Grube unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0100), aber von seiner Befahrung am 11. April heißt es in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 322, Film 0105f), die 2 Mann „fahren jetzt fast täglich an“ und betrieben in 3 Ltr. Teufe vom Neuschacht aus einen 1,0 bis 1,2 Ltr. weiten Abbau auf einem Eisensteinmittel. Nachdem man es nunmehr 5 Ltr. hora 9,0 in NW erlängt hatte, habe man es aber wegen Aussetzens des Eisensteins wieder sistiert und stattdessen in gleicher Teufe ein Ort in NO angehauen, das jetzt 3 Ltr. erlängt war. Am 6. Juni, am 16. Juli und am 18. August 1845 hat Herr Neubert hier dem Verwiegen von insgesamt 44 Zentnern Braunstein, sowie dem Vermessen von 22 Fudern, 2 Tonnen Eisenstein beigewohnt (40014, Nr. 322, Film 0119f, 0126 und 0133). Der Eisenstein ging an den Pfeilhammer, im Oktober außerdem 2½ Fuder „als Probe“ nach Erla (40014, Nr. 322, Film 0144). Wohin dagegen der Braunstein verkauft wurde, das haben die Geschworenen leider nie notiert. Am 11. September 1845 hatte Herr Neubert noch einmal 13 Zentner Braunstein zu verwiegen, so daß sich die Gesamtförderung in diesem Jahr auf 57 Zentner summierte (40014, Nr. 322, Film 0138f). Von seiner Befahrung am gleichen Tage berichtete er, die anfahrenden zwei Mann hatten im oberen oder alten Schacht in 6,8 Ltr. Teufe ein Ort angehauen und 2 Ltr. in hora 4,7 SW erlängt, wo man ein Eisensteinmittel vermutete, bislang nur „Nestchen“ von Eisen- und Braunstein gefunden habe. Daneben war ein Braunstein- Abbau von der Communicationsstrecke aus 3,3 Ltr. vom obern Schacht bei 0,5 bis 0,9 Ltr. Weite 2 Ltr. in NW ausgelängt, aber auch dort war man nur auf spärliche, nesterweise Vorkommen getroffen. Bei seinen letzten Befahrungen in diesem Jahr am 18. und 19. Dezember fand Herr Neubert die Grube wieder unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0159). Die nächste Befahrung im Jahr 1846 fand am 12. und 13. Februar statt, worüber man im Fahrbogen lesen kann, daß man das Eisensteinmittel in 6 Ltr. Teufe des oberen Schachtes weiter abbaute und, wie Herr Neubert einschätzte, „zeigte sich dasselbe noch von recht leidlicher Beschaffenheit.“ (40014, Nr. 322, Film 0173) Bei seinen Befahrungen am 16. und 17. März fand Herr Neubert die Mannschaft mit Zimmerungsarbeiten beschäftigt, da es an mehreren Punkten Brüche machen wollte. Danach soll der Eisensteinabbau in 7 Ltr. Teufe des oberen Schachtes in SW wieder aufgenommen werden (40014, Nr. 322, Film 0180). Über seine Befahrung am 14. April 1846 schließlich hielt er in seinem Fahrbogen fest, daß man bei schöner Witterung nun mit Aufbereitung des gewonnenen Eisensteinhaufwerks befaßt sei und nur bei ungünstiger Witterung werde weiter in 7 Ltr. Teufe des obern Tageschachts der 2 Ltr. südwestlich vom Schacht ausgerichtete „Eisensteinbutzen, welcher von ziemlich beträchtlichen Umfange zu sein scheint,“ abgebaut. „Da hier der... Eisenstein meist in ziemlich großen, mit etwas Mulm umgebenen Blöcken vorkommt, so ist der Abbau wegen des hierdurch bedingten starken Druckes und wegen der vielen... Zimmerung etwas schwierig.“ Auch im oberen Schacht war wieder Zimmerung auszuwechseln (40014, Nr. 322, Film 0184f). Mit der Erneuerung der Zimmerung war man auch im Juni noch beschäftigt. Außerdem hatte man aber dennoch 38 Fuder, 1 Tonne Eisenstein zum Vermessen sowie 16 Zentner Braunstein zum Verwiegen bereit (40014, Nr. 322, Film 0198f und 0202). Am 8. September 1846 fand Herr Neubert die Grube wegen Wettermangels nicht belegt (40014, Nr. 322, Film 0218f). Am 10. Dezember fuhren wieder zwei Mann an, die aber bis zuletzt lediglich Zimmerung im oberen Schacht und auf der Kommunikationsstrecke ausgewechselt hatten. Nachdem dies beendet war, wurde in 8 Ltr. Teufe des unteren Schachts ein Ort zur Ausrichtung von Braunsteinanbrüchen aufgehauen, das nun 1 Ltr. in SO. erlängt war (40014, Nr. 322, Film 0232f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 21. Januar 1847 fand Herr Neubert die Grube wieder einmal nicht belegt vor. Bei seinen Befahrungen am 18. und 19. Februar dagegen fuhren wieder zwei Mann an, die nun wieder in 7,5 Ltr. Teufe und 4,5 Ltr. südöstlich vom unteren Schacht Braunstein abbauten (40014, Nr. 322, Film 0237 und 0241f). Mit dem Quartal Reminiscere 1847 enden diese Überlieferungen im Aktenbestand der Fahrbögen der Geschworenen des Bergamtes Scheibenberg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon vor dem Jahr 1857 wurden von der
Bergbehörde ,Anzeigen' zum Betriebsablauf des zurückliegenden
Jahres von den Besitzern der Gruben abgefordert und eine
Betriebsplanpflicht eingeführt. Der ersten Anzeige für Friedrich
Fundgrube auf das Jahr 1856 (40169, Nr. 95,
Blatt 13) ist zu entnehmen, daß
der Besitzer nunmehr der ,Handelsmann' Johann Gottlieb Merkel
aus Raschau war. Die Grube ist mit 4 Mann in Belegung gehalten worden, die
getriebenen Abbauörter habe man mit Bergen versetzt und sämtliche Fahr-
und Förderstrecken standen in Türstockzimmerung. Dabei hat man
ausgebracht:
- 141
Zentner Braunstein für 66 Thaler, 8 (Neu-) Groschen sowie Der Eisenstein ging an die Hammerwerke Erla und Obermittweida. Als Schichtmeister für die Grube wurde im Oktober 1857 August Herrmann Oehme verpflichtet. Die Steigerfunktion versorgte der Steiger von Wilkauer vereinigt Feld, Friedrich Fürchtegott Wendler, für die Friedrich Fundgrube mit (40169, Nr. 95, Blatt 19f). Letzteres war nur eine ,interimistische Lösung', aber sicherlich auch die kostengünstigste für die Besitzer der Grube. Sie blieb deshalb fortbestehen, worauf der Geschworene Tröger das Bergamt am 5. August 1858 wieder hinwies und einen Vorschlag einer geeigneten Person forderte (40169, Nr. 95, Blatt 21). Außerdem erfolgte im August 1857 die Umformierung des Grubenfeldes nach dem Gesetz über den Regalbergbau von 1851. Der Betriebsplan auf das Jahr 1857 ist von Carl Wilhelm Merkel unterzeichnet (40169, Nr. 95, Blatt 14ff). Er sah bei Einnahmen von 267 Thalern Ausgaben in gleicher Höhe vor, so daß der Saldo eigentlich nur ,eine schwarze Null' sein würde. Wahrscheinlich wurde es aber nur ,eine rote Null', denn aus der Anzeige auf das abgelaufene Jahr 1857 (40169, Nr. 95, Blatt 20) geht dann hervor, man habe in diesem Jahr ausgebracht: - 109
Zentner Braunstein sowie Der Betrieb bei der Grube gewann in den Folgejahren an Umfang. Der Anzeige auf das Jahr 1858 ist zu entnehmen, daß nun 6 Mann angelegt waren, durch die 445 Zentner Braunstein und 40 Fuder Eisenstein gefördert worden sind. Letztere behielt man in Vorrat; der Braunstein dagegen wurde zum Preis von 370 Thalern, 25 Groschen, also der Zentner für 25 Groschen, verkauft (40169, Nr. 95, Blatt 23). Auch im Jahr 1859 wurden nur 20 Fuder Eisenstein ausgebracht, während die Förderung von Braunstein bei 190 Zentnern lag. Außerdem begann man nun auch bei Friedrich Fundgrube mit der Anlage eines Stollens, für den eine Richtung von hora 10 Südost angegeben ist (40169, Nr. 95, Blatt 24). Und im Jahr 1860 wurde mit 654 Zentnern Braunstein und 46 Fudern Eisenstein der bisherige Höchststand der Förderung erreicht (40169, Nr. 95, Blatt 26). Aus diesen Erfolgen heraus hat der Besitzer auch eine Nachverleihung weiteren Grubenfeldes beantragt, welche ihm am 22. Juni 1861 bestätigt worden ist. Es umfaßte nun 36.030 Quadrat- Lachter oder 144.120 m² (knapp 14,5 ha). Die Zeit der aus dem Mittelalter stammenden Kleinstbetriebe war auch auf der Friedrich Fundgrube nun vorbei.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächsten
Anzeige über den Betrieb im Jahr 1861 (40169, Nr. 95, Blatt 29)
ist dann zu entnehmen, daß nun 9 Mann auf der Grube angelegt waren. Der
vor zwei Jahren begonnene Stolln war zwar erst 35 Lachter fortgerückt,
aber bei 28,5 Lachtern Länge bereits auf die 8 Lachterstrecke
durchgeschlagen. Wenn er schon nach dieser kurzen Distanz in eine 16 m
tief verlaufende Strecke eingekommen ist, muß dieser Stolln
vergleichsweise weit oben am Talhang angesetzt worden sein. Außerdem wurde
in diesem Jahr auch der neue Friedrich Schacht abgeteuft. Dabei
brachte man aus:
- 440
Zentner Braunstein sowie Es ist zwar hier kein Verkaufswert angegeben, dafür aber ein Verhältnis des Fudermaßes zu den neuen, metrischen Einheiten: Das Fuder hat hiernach im Jahr 1861 bei der Friedrich Fundgrube 17,5 Zentner gehalten, also 875 Kilogramm. Der Betriebsplan für die Periode 1861/1863, den das Oberbergamt in Freiberg am 9. Juni 1861 zuließ, sah bei Einnahmen von 1.499 Thalern, 26 Groschen einen Überschuß gegenüber den Ausgaben von 49 Thalern, 13 Groschen vor (40169, Nr. 95, Blatt 31ff). Das ist immerhin keine schwarze oder rote Null mehr, aber doch nur eine recht bescheidene Rendite von etwas über 3% in drei Jahren. Warum es im Sommer 1862 einmal zum Stillstand kam, ist leider nicht dokumentiert, aber Geschworener Tröger fand die Grube bei seiner Befahrung am 26. August 1862 einmal unbelegt und forderte den Besitzer zur Wiederinbetriebnahme binnen 4 Wochen auf, da eine Sistierung ja nicht angezeigt war (40169, Nr. 95, Rückseite Blatt 37). Es war aber sicher nur ein zufälliges Zusammentreffen von Umständen, denn die Anzeige auf dieses Jahr sagt wieder aus, daß sie ständig mit 6 Mann belegt gewesen ist. Diesmal hatte man gar keinen Eisenstein, aber wieder 355 Zentner Braunstein gefördert, von denen 285 Zentner für den Gesamtpreis von 234 Thalern, 20 Groschen verkauft werden konnten. Auch im folgenden Jahr 1863 wurde der Stolln (allerdings jetzt mit der Richtungsangabe hora 8,4 in Südwest) weiter betrieben und hatte nun 45 Lachter Länge erreicht (40169, Nr. 95, Blatt 41f). In diesem Jahr brachte man wieder 140 Fuder Eisenstein aus. Zusammen mit 12 Fudern aus dem noch vorhandenen Vorrat konnten 152 Fuder bei einem Erlös von 255 Thalern, 20 Groschen verkauft werden. An dieser Stelle ist nun übrigens auch angegeben, daß das Fuder jetzt 16 Zentner halte (glatt 800 kg). Demnach entspräche die verkaufte Menge also 2.432 Zentnern oder knapp 122 metrischen Tonnen. Seltsamerweise wird in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 1) hier eine Zahl von 2.609 Zentnern genannt, was noch annähernd dem vorherigen Verhältnis mit 17,2 Zentnern auf 1 Fuder entspräche. Vielleicht wurde aber noch der alte ,Bergzentner' zu 112 bis 114 Pfund in der Umrechnung verwendet. Außerdem hat man in diesem Jahr aber auch noch 530 Zentner Braunstein ausgebracht und davon 525 Zentner im Wert von 437 Thalern, 15 Groschen verkauft, was etwa 23 bis 25 Groschen pro Zentner entsprach.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für nächsten drei Jahre von 1864 bis
1866 war wieder ein Betriebsplan einzureichen
(40169, Nr. 95, Blatt 43ff).
Geschworener Tröger hat denselben für gut befunden und das
Oberbergamt in Freiberg hat ihn am 5. Oktober 1864 auch bestätigt.
Der Anzeige auf das Jahr 1864 zufolge waren jetzt wieder 9 Mann angelegt. In diesem Jahr hatte man zwar keinen Eisenstein ausgebracht, aber vom noch vorhandenen Vorrat wurden 155 Fuder für 266 Thaler verkauft. Dividiert man die Angabe von 2.648 Zentnern in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 1) durch diese Menge, so resultiert daraus nun ein Verhältnis von glatt 17 Zentnern pro Fuder. Außerdem wurden in diesem Jahr 895 Zentner Braunstein im Wert von 716 Thalern gefördert und komplett verkauft (40169, Nr. 95, Blatt 49). Der Preis lag nun bei 24 Groschen pro Zentner. Im folgenden Jahr gab es zunächst einmal Ärger mit den Anliegern, welche sich daraufhin an die Amtshauptmannschaft in Schwarzenberg wandten. Diese zeigte dem Bergamt am 6. Mai 1865 die Beschwerde an, daß der ‒ den Fördermengen entsprechend auch angewachsene ‒ Haldensturz inzwischen schon „auf den Communicationsweg von Förstel nach Mittweida“ übergreife (40169, Nr. 95, Blatt 51). Das Bergamt gab die Beschwerde an den Betreiber weiter, und weil wir in der Akte nichts Gegenteiliges gefunden haben, wird sich Herr Merkel wohl um eine Sicherung der Haldenböschung und um die Umlagerung der betreffenden Menge an der Wegseite der Halde gekümmert haben. Die Förderung stieg in diesem Jahr weiter an und mit nun 13 Mann Belegschaft brachte man 127 Fuder Eisenstein und 1.005 Zentner Braunstein aus (40169, Nr. 95, Blatt 53f). Auch 1866 steigerte sich der Betrieb weiter: Es waren 16 Arbeiter auf der Friedrich Fundgrube angelegt, und 140 Fuder Eisenerz sowie 1.460 Zentner Braunstein wurden ausgebracht (40169, Nr. 95, Blatt 55f). Der Großteil konnte abgesetzt werden, 20 Fuder Eisenerz und 160 Zentner Braunstein verblieben am Jahresende als Vorrat. Die Einnahmen aus dem Erzverkauf lagen in diesem Jahr bei 1.075 Thalern. Da der Betrieb nun einen beachtlichen Umfang angenommen hatte, ist auch der Geschworene am 18. Juli 1867 wieder einmal auf der Grube angefahren und hat in seinem Fahrbogen berichtet (40169, Nr. 95, Blatt 57): „Bei dieser Grube wurde 2 Lachter südlich vom Stollnmundloch ein Tageschacht 7 Lachter niedergebracht und bei 3 Lachter Teufe das Mulmlager erreicht, solches daher auf 4 Lachter durchsunken ist. Im Schachttiefsten wurde ein Ort in nordöstlicher Richtung getrieben, mittelst welchem raunsteinhaltiger Mulm gewonnen wird, welcher gesiebt und gewaschen einen hübschen Braunstein erzielen läßt. In den übrigen Grubenbauen wird nach gewohnter Weise ein Ort aufgemacht, ein anderes wieder verstürzt und auf diese Art das Mulmlager durchfahren, um die Braunsteinnester abzubauen.“ Wie man sieht, wurde nicht mehr ,selektiv' Erz gewonnen, sondern das Lager mehr oder weniger systematisch im Pfeilerbruchbau durchfahren und dabei komplett ausgehauen ‒ anders wäre eine Steigerung der Förderung in diesem Maße auch gar nicht zu erreichen gewesen. Der hier genannte, neue Tageschacht ist der Wilhelmschacht gewesen. Mit der Anzeige auf das Jahr 1867 (40169, Nr. 95, Blatt 58f) ist der Höhepunkt des Betriebes ‒ zumindest, was die anfahrende Mannschaft anbetrifft ‒ erreicht, die wie folgt zusammengesetzt war:
Hinsichtlich des Betriebes wird von dem neuen Wilhelmschacht berichtet, daß dort auch die neue Kaue errichtet worden sei. Auf den Abbauen am Carlschacht habe man 10 Kubiklachter, am Friedrichschacht 21 Kubiklachter und am Wilhelmschacht 28,5 Kubiklachter Lagermasse ausgehauen, in Summe also 59,5 Kubiklachter oder 476 m³ Gestein. Daraus hatte man 30 Fuder oder 480 Zentner Eisenstein (24,0 t) und 3.290 Zentner Braunstein (164,5 t) gewonnen. Betrachten wir nur die letzte Zahl für sich, so ergibt sich daraus, daß der Kubikmeter des ,Mulms' im Mittel ungefähr 0,34 t Braunstein enthielt. Während man die geringe Menge Eisenstein im Vorrat behielt, wurden 1867 einschließlich des Vorrates aus dem Vorjahr 3.400 Zentner Braunstein für 2.266 Thaler, 20 Groschen verkauft. Schauen wir uns aber zunächst einmal auf den erhaltenen Grubenrissen an, wo die jetzt genannten Baue eigentlich gelegen haben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Jahr 1868 brachte, der Anzeige über
den Grubenbetrieb (40169, Nr. 95, Blatt 60f)
zufolge, dann einen ersten Rückgang. Die Mannschaftsstärke ging auf 22
Mann zurück. Eisenstein wurde nicht ausgebracht, jedoch noch einmal eine
beachtliche Menge von 3.500 Zentnern (152,5 t) Braunstein. Davon wurden
3.050 Zentner für 2.033 Thaler, 10 Groschen verkauft.
Anfang des Jahres 1869 trat dann das Allgemeine Berggesetz für das Königreich Sachsen in Kraft. Das Oberbergamt wurde in Landesbergamt umbenannt und die Bergämter wurden aufgelöst und durch Berginspektionen ersetzt. Die Bergbehörden mischten sich nicht mehr ,lenkend' oder ,dirigierend' in die Betriebsabläufe ein, achteten jedoch umso mehr auf die Durchsetzung der sukzessive eingeführten Unfallverhütungsvorschriften. Vom 13. Oktober 1869 stammt das erste Fahrjournal (auch das hatte man umbenannt und es gab nun einen doppelseitigen A4- Vordruck) des nun für die Langenberg'er Gruben zuständigen Berginspektionsbezirks Schneeberg (40169, Nr. 95, Blatt 62). Es gab auch sofort einen Zechenbucheintrag, weil auf den Schächten (außer am Wilhelmschacht ‒ denn dort stand doch eigentlich eine neue Kaue) ein solider Schachtdeckel oder aber eine Überbauung mittelst verschließbarer Kaue fehlte. Da wir in den Bergamtsakten oft nur Auszüge aus den Fahrjournalen hinsichtlich der Festlegungen der Beamten finden, sagen sie uns leider nicht mehr viel über den eigentlichen Betrieb. Das nächste Fahrjournal wurde am 29. Oktober 1870 von Gustav Netto aufgesetzt und klang nicht besser (40169, Nr. 95, Blatt 64): Er befand „den Stollnschacht ebenso wie das Haspelgerüst in so schlechtem Zustand, daß die Förderung untersagt wurde.“ Mit dem ,Stollnschacht' war der nur 3 Lachter bis auf das Mulmlager tiefe Wilhelmschacht nahe am Mundloch des Friedrich Stollns gemeint. Und es kam noch schlimmer: Bei deiner Befahrung am 16. August 1871 fand Gustav Netto den Carl- und den Friedrichschacht zusammengebrochen und schon eingeebnet vor und auch der obere Schacht (welcher noch ?) war in solch schlechter Beschaffenheit, daß er durch Zechenbucheintrag sofort anordnete, ihn neu auszuzimmern, dann zu vertiefen und mit dem unteren Schacht (es gab noch einen fünften ?) in Verbindung zu bringen. Offenbar hatte der Besitzer zwar den Abbau forciert, alles andere aber vernachlässigt... Und nun ging die ,Gründerzeit' leider schneller vorbei, als gedacht. Auch hatte Steiger Wendler seine Funktion inzwischen niedergelegt und so brauchte es einen neuen Steigerdienstversorger auf der Grube. Allein die Bestellung eines neuen Steigers füllt nun etliche der folgenden Seiten in der Akte. Zunächst einmal erbat Johann Gottlieb Merkel, daß der Sohn Carl Wilhelm Merkel diese Funktion ausüben solle, was das Königl. Landesbergamt in Freiberg mit dem Vorbehalt „bis auf Weiteres versuchsweise“ am 19. Februar 1872 sogar genehmigte. Und „bei der Gelegenheit geben wir Ihnen auf...“ die von Herrn Netto bereits geforderten Maßnahmen umzusetzen, einen Betriebsplan für 1872/1873 einzureichen und das Rißwerk nachbringen zu lassen (40169, Nr. 95, Blatt 68). So hatte sich Herr Merkel senior das sicher nicht vorgestellt... Am 12. Oktober zeigte Herr Netto dann dem Landesbergamt an, daß „der Steiger Merkel“ verschieden und die Position somit erneut vakant sei (40169, Nr. 95, Rückseite Blatt 73), woraufhin das Bergamt in Freiberg natürlich Herrn Merkel aufforderte, einen neuen zu benennen. Nun schlug Herr Merkel am 30. Oktober den Doppelhäuer Friedrich August Korb als Steigerdienst- Versorger vor, „welcher seit vielen Jahren zu meiner Zufriedenheit bei mir in Arbeit gestanden hat.“ (40169, Nr. 95, Blatt 76) Bei diesem Namen klingelt´s bei uns: War doch 1825 ein Mann gleichen Namens sogar Lehnträger der Grube... Derselbe kann es aber nicht gewesen sein, denn als Herr Netto diesen am 29. November 1873 hinsichtlich seiner Qualifikation überprüfte, notierte er, der jetzige Herr Korb sei erst 1837 geboren. Das Urteil des Berginspektors zu seinen Fähigkeiten fiel jedoch sehr positiv aus, denn Korb habe bereits damit begonnen, „einen rationelleren und weniger gefährlichen Betrieb der durch seinen Vorgänger trotz vielfacher Ermahnungen sehr verwahrlosten Grube einzurichten“ und gab der Anstellung seine Zustimmung, woraufhin sie auch durch das Landebergamt am 5. Dezember des Jahres genehmigt wurde (40169, Nr. 95, Blatt 77f). Das war aber auch nicht die Lösung, denn als Herr Netto am 22. April 1874 auf der Grube war, mußte er feststellen, daß Korb noch im November 1873 wieder abgegangen sei, mithin die Grube schon wieder ohne technische Aufsicht war. Der Inspektor notierte noch, die Grube sei in so desolatem Zustande, daß häufig, sowohl in der Grube, als Übertage, Brüche entstehen... Auch bei der nächsten Inspektion hatte sich nichts gebessert, nur versorge gegenwärtig ein Herr Schulz die Steigergeschäfte, welchen Herr Netto in Anbetracht der Zustände aber als nicht für diese Funktion befähigt einschätzte (40169, Nr. 95, Blatt 82f). Selbstverständlich forderte das Bergamt am 2. Juni 1874 und erneut am 25. September 1875 Herrn Merkel wieder zur Abstellung der Mängel und zur Anstellung eines geeigneten Steigers auf, nun auch unter Androhung von 5 Thaler oder 15,- Mark Strafe bei Nichtbefolgung binnen 14 Tagen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daraufhin klagte Herr Merkel in
einem Schreiben an das Bergamt vom 13. Oktober 1875 (40169, Nr. 95, Blatt 87),
er habe
„bedeutend
mehr verbaut, als ich Erz zutage gefördert habe, ferner hatte ich großen
Kostenaufwand, die aufsteigenden Wasser zu bewältigen“ und bat um
Straferlaß. Nebenbei erfährt man aus diesem Schreiben, daß er am 13. Mai
die Friedrich Fundgrube an Gustav Zschierlich in Chemnitz
verkauft, dieser aber den Kaufpreis nicht überwiesen und am 1. Oktober
seine Kaufzusage wieder rückgängig gemacht habe. Herr Zschierlich
war bereits Eigentümer der Gnade Gottes Fundgrube und wird später
noch eine größere Rolle im Revier spielen. Einen Steiger schlug Herr
Merkel nicht vor. Das Bergamt lehnte daher einen Straferlaß ab und
drohte mit Vollstreckung, wenn Merkel nicht umgehend einen Steiger
benenne.
Letzterer brachte daraufhin am 20. Oktober 1875 den Zimmerling Johann Leonhart Seifert „von hier“ in Vorschlag (40169, Nr. 95, Blatt 90). Nach einer Befahrung am 24. November 1875 schrieb Netto an das Bergamt, er habe besagten Seifert geprüft und er fand ihn „des Schreibens unkundig, er hat von der Benutzung des Compasses keine Idee,“ auch keinerlei Zeugnisse vorzulegen, kein Knappenbuch etc. und schätzte ihn insbesondere „in Anbetracht der hier obwaltenden Verhältnisse“ als ungeeignet für diese Funktion ein (40169, Nr. 95, Blatt 95). Sein nächstes Fahrjournal machte den Ernst der Lage wieder deutlich, fand er doch die beiden Schächte gefährdet und die unteren Baue unter Wasser stehend vor (40169, Nr. 95, Blatt 99). Auch den nächsten Vorschlag Merkel's, den allerdings schon „bejahrten“ Zimmerling Johann Gottlieb Reppel mit der Funktion zu betrauen, wies Netto aus gleichen Gründen zurück. Er könne sie schon deswegen nicht befürworten, „weil die Stellung der Steiger im Allgemeinen dadurch herabgezogen würde, welche vielmehr in dieser Zeit allgemeinen Fortschritts möglichst gehoben werden sollte.“ Auch diesen Familiennamen hören wir doch in Zusammenhang mit dem Bergbau am Emmler nicht das erste Mal... Während Herr Merkel nun seinen Schwiegersohn ins Gespräch brachte, fand Herr Netto bei seiner Befahrung am 3. Mai 1876 wenigstens einige der Festlegungen umgesetzt und schrieb noch dazu: „Die Zechenstube ist noch nicht zusammengebrochen.“ (40169, Nr. 95, Blatt 113) Na ja, wenn das nicht irgendwie schon nach Häme klingt... Eine Empfehlung von Seiten des Bergamtes an Merkel, doch den Steiger Lang aus Bernsbach anzustellen, wies der nun aber mit der Begründung ab, jener verlange für diese Tätigkeit ja einen Lohn von 3,- Mark am Tag und „Meine Grube kann einen solch hohen Lohn beanspruchenden Steiger nicht tragen.“ (40169, Nr. 95, Blatt 115ff) Darum nämlich ging es hier eigentlich. Ob der Unduldsamkeit vonseiten des Bergamtes wohl langsam doch etwas hilflos gegenüberstehend, hat Herr Merkel schließlich Berginspektor Netto in Schneeberg aufgesucht, welcher ihm nun riet, sich doch an Herrn Zschierlich zu wenden, ob nicht dessen Obersteiger Mai die Aufsicht bei ihm mit übernehmen könne, was dieser auch zusagte. So forderte das Bergamt dann Inspektor Netto am 4. August 1876 noch einmal zu einem neuen Gutachten auf, und da Herr Reppel ja nur den Steigerdienst versehen solle, Herr Mai die Oberaufsicht führe und außerdem noch Schichtmeister Oehme die Grube mit beaufsichtige, könne man sich dies als genehmigungsfähig vorstellen... (40169, Nr. 95, Blatt 126ff) Was den letztgenannten anbetrifft, schrieb Netto am 23. August 1876 an das Bergamt, so beklage sich Oehme fortwährend, „daß er nicht imstande sei, Einfluß auf den Grubenbetrieb zu gewinnen oder Ordnung ins Rechnungswesen zu bringen, da seine Anordnungen durch Dazwischentreten des Besitzers gewöhnlich durchkreuzt würden... und er auch nie wisse, ob die ihm übergebenen Unterlagen der Wahrheit entsprächen.“ (40169, Nr. 95, Blatt 128ff) Man gewinnt langsam das Bild eines starrköpfigen Geizkragens... Was hingegen die Anstellung des Obersteigers Mai anbeträfe, so wolle er, Netto, dies gern befürworten, allein es sei wieder daran gescheitert, daß dieser einen Lohn von 5,- Mark pro Tag verlange, was Merkel aber nicht bezahlen wolle. In diesem Zusammenhang verwies Netto auf eine Verletzung des Bergarbeiters Karl Heinrich Schulze auf Riedels Fdgr. im Jahr 1873 und „daß die Unselbständigkeit des Steigers und fehlender Mut, dem Grubenbesitzer entgegenzutreten, schlimme Folgen haben kann.“ Daraufhin nun schrieb das Landesbergamt am 2. September 1876 an Herrn Merkel, man habe die Anstellung von Herrn Mai genehmigen wollen, aber diese sei ja, „wie zu unserer Kenntnis gelangt ist, von Ihrer Seite gescheitert, weil Sie das Geldopfer scheuen, welches die Anstellung eines tüchtigen, zuverlässigen und selbständigen Steigers erheischt.“ Bei weiterer Nichtbefolgung der Anweisungen drohte das Landesbergamt nun nicht mehr mit 15 Mark Strafe, sondern mit der Betriebseinstellung (40169, Nr. 95, Blatt 132ff). Nachdem Merkel daraufhin erneut über seine hohen Kosten bei der Grube und nun auch noch wegen „eingetretener Geschäftsstockung“ klagte, und nachdem auch Netto bestätigte, daß Reppel „die Zimmerung daselbst gut instandzusetzen gewußt hat“, ließ man sich endlich doch erweichen und genehmigte am 25. September 1876 die Anstellung Reppel's mit dem Prädikat ,Steigerdienst- Versorger' (40169, Nr. 95, Blatt 138). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem nun das geklärt war, machte
Herr Merkel neue Pläne und informierte Herrn Netto am 14. Februar 1878 darüber, daß er einen tiefen Stolln anlegen wolle, der 90 m
östlich der Förstelschenke an der Straße angesetzt und 200 m lang werden
solle und in der Friedrich Fundgrube 25 bis 30 m Tiefe einbringen
sollte. Nach einer Besichtigung der Örtlichkeiten informierte Netto
dann seinerseits das Landesbergamt darüber, und daß keine Einigung mit dem
Grundbesitzer, dem Gastwirt Goldhahn in der Förstelschenke,
zustande gekommen sei, weil dieser einen zu hohen Zins für die
Flächeinanspruchnahme durch das Mundloch und die Zuwegung dorthin fordere.
Wie zu erwarten, hielt man sich beim Bergamt aber heraus und verwies
darauf, daß dies eine privatrechtliche Einigung zwischen den Parteien sei,
die bestenfalls über die Amtshauptmannschaft erwirkt werden könne (40169, Nr. 95, Blatt 142ff).
Ob sie sich geeinigt zu haben, geht aus dem Akteninhalt nicht klar hervor, jedenfalls schrieb Netto in seinen Fahrjournalen vom Juni 1878 und August 1879, der Betrieb sei nur noch auf eine schwache Braunsteingewinnung beschränkt und in der Spalte bergpolizeiliche Bemerkungen fügte er hinzu, die Zimmerung im Schacht 1 müsse ungesäumt ausgewechselt werden (40169, Nr. 95, Blatt 150ff). Die Idee dieses tiefen Stollns aber wurde später noch umgesetzt: Unter dem Namen Fernand Stolln (oder Ferdinand Stolln ?) wurde er von seinen Nachfolgern in die Grube eingebracht. Merkel hingegen beantragte am 15. August 1880 die Fristsetzung der Grube, die vom Bergamt auch bis Schluß des Jahres 1881 genehmigt wurde. Am 7. April 1881 zeigte er dann dem Bergamt an, daß er die Friedrich Fundgrube nun doch für 1.500,- Mark und mit Wirkung ab 1. Januar laufenden Jahres an den Vitriolwerksbesitzer Gustav Zschierlich in Geyer verkauft habe (40169, Nr. 95, Blatt 153). Damit endete die eigenständige
Geschichte dieses Bergwerks, noch nicht aber die Geschichte des Bergbaus
am Emmler. Zur Fortsetzung schlage man nun weiter unten im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gelber Zweig
Fundgrube am Förstelgut bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26)
ist diese Grube ab 1796 und noch bis 1872 aufgeführt. Sie hat sowohl
Braunstein, als auch Eisenstein ausgebracht. Mit einem Gesamtausbringen
innerhalb dieses Zeitraumes von 1.255 Fudern (rund 1.070 t) Eisenstein und
10.233 Zentnern (knapp 512 t) Braunstein ist sie durchaus zu den
bedeutenden Eisen- und Manganerz- Bergwerken am Emmler im
19. Jahrhundert zu zählen.
Aufgenommen hat diese Grube der Bergarbeiter Carl August Weißflog, welcher am 28. November 1795 eine Fundgrube und das erste obere Maß auf Eisenstein „unter dem Nahmen Gelber Zweig im Raschauer Pfarrwald auf einem Stunde 6,4 streichenden und gegen Mitternacht fallenden Eisensteingange“ vor dem Bergamt Scheibenberg mutete (40014, Nr. 191, Blatt 8). Der Familienname Weißflog ist und schon mehrfach begegnet... Die Mutung wurde vom in Scheibenberg zu dieser Zeit amtierenden Bergmeister, Johann Carl Schütz, am 7. Januar 1796 auch bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 175). Vermutlich ein Verwandter, nämlich der Herr
Christian Friedrich Weißflog, mutete am 16. April 1796 auch „im
Freyen liegende Halden auf Herrn Meiers Grund und Boden im Tännig
befindlich“ (40014, Nr. 191, Blatt 12), um sie auf Resterze
auszuklauben. Derselbe legte am 19. September 1796 erneut auf Halden „auf Carl
Gottlob Meiers Grund und Boden“ Mutung ein (40014, Nr. 191, Blatt 22).
Wie schon weiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Fahrbögen des Scheibenberg'er Berggeschworenen Johann Samuel Körbach wird diese Grube das erste Mal im August 1796 genannt, wo er berichtete (40014, Nr. 193, Film 0048): Über das Grubengebäude Gelber
Zweig bey Raschau im Pfarrwald gelegen, „Allhier wird durch die Eigenlöhner auf einem Stunde 6 streichenden und unter einem Winkel gegen 50 Grad in Nord fallenden Eisenstein Lager bey 3 Ltr. unterm Tag der Bau verführet. Das Lager führt Hornstein und grauen Eisenstein.“ Anfangs des Folgejahres berichtete Herr Körbach an das Bergamt zu Scheibenberg (40014, Nr. 196, Film 0002): Gelber Zweig Fundgrube im
Raschauer Pfarrwald, „Allhier wird durch die Eigenlöhner der Bau bey 2½ Ltr. unterm Tag vermittelst Ortsbetrieb in Abend auf dem Stunde 6 streichenden und unter einem Winkel von 30 Grad Mitternacht fallenden Lager, welches 4 Ellen mächtig ist und aus Hornstein, Quarz und grauem Eisenstein bestehet, verführet.“ Zweieinhalb bis drei Lachter (rund 6 m) untertage ist nicht wirklich viel... Die nächste Eintragung in den Fahrbögen des Geschworenen stammt aus dem Quartal Crucis 1797 (40014, Nr. 196, Film 0050): Über Gelber Zweig, im Raschauer Communwald gelegen „Befande solches mit 3 Eigenlöhnern beleget, wurde durch solche auf dem Stunde 10 streichenden und in Abend neigenden 4 Ellen mächtigen Eisenstein Lager, welches aus Hornstein, Quarz, Braunstein und grauen Eisenstein bestand, ein Ort bey 2½ Lachter unter Tag in Nord betrieben.“ Im Quartal Reminiscere 1798 war Herr Körbach erneut vor Ort, hatte aber „bey diesem Grubengebäude nichts veränderliches befunden.“ (40014, Nr. 196, Film 0103) Man machte weiter, wie zuvor und daher hatte Herr Körbach auch Crucis 1799 „nichts veränderliches befunden.“ (40014, Nr. 199)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst Anfang des Jahres 1800 notierte der Geschworene
wieder einmal etwas ausführlicher (40014, Nr. 200, Film 0008):
Fahrbogen „Es wird der Bau von den Eigenlöhnern bey 2½ Ltr. untern Tag auf dem Stunde 6 streichenden und unter einem Wünkel gegen 30 Grad Nord fallenden Lager, so gegen 2 Ellen mächtig ist, und Hornstein, grauen Eisenstein führet, Stroßenaushieb in Ost verführet.“ Die Mächtigkeit der bebauten Erzlinse hatte sich halbiert. Sonst fand offenbar weiter nichts Berichtenswertes mehr statt. Erst ein weiteres Jahr darauf findet man wieder eine, wenngleich fast gleichlautende, Notiz (40014, Nr. 202, Film 0007): Das Eisenstein Gruben Gebäude Gelber Zweig im Raschauer Pfarrwald „Es wird von den Eigenlöhnern der Bau bey 2½ Ltr. Teufe unterm Tag auf dem sehr mächtigen Lager mittels Stroßenaushieb und Ortsbetrieb in Nord-Ost fortgestellt, bricht ab und zu in solchem Lager Eisenstein und Braunstein mit ein.“ Scheibenberg, den 28. Februar 1801 Johann Samuel Körbach, Refiergeschworener. Im Sommer 1801 hat Herr Körbach die Grube einmal „freytags No. 2te Woche Crucis 1801 unbelegt gefunden.“ Im Winterhalbjahr ging es aber offenbar wieder weiter. Die Eigenlöhner bauten demnach nun 2 Lachter untertage „förstenweiß über dem Versuchsort in Abend, das Lager führt Hornstein und einbrechenden Eisenstein, und ab und zu etwas Braunstein.“ (40014, Nr. 202, Film 0062) Außerdem enthält der Fahrbogen vom Quartal Luciae 1801 noch die folgende Anmerkung. „Da nun bey dem von Tage nieder 2 Ltr. verführten Bau ganß nahe ein Fahrweg von Raschau nach Langberg vorbeyführet, und bey Winters Zeit jemand zu schaden könnte kommen, sich die Fuhrläute nach Angeben des Lehnträgers Weißflog von oben gedachten Grubengebäude nicht hatten abweißen (lassen), da doch ein Fahrweg unter der Halde, ebenfalls von Raschau nach Langberg, gelegt ist, fahren könnten, so habe dem Lehnträger Weißflog dahin angewiesen: Wo die beiden Wege zusammenkommen, sowohl von Raschau aus als Langberg, bey ersterem Fahrweg, welcher ganz nahe bey dem von Tage nieder 2 Ltr. liegt und noch unter dem Fahrweg in Abend Bau verführet ist, zwey Schürfe aufzuwerfen, einen von Raschau aus und einen von Langberg aus, an dem Fahrweg, daß solcher nicht mehr kann gefahren werden, und auf denen, so unter der Halde vorbey geher, fahren müßen, habe schon den Lehnträger Weißflog in dem Quartal Trinitatis 1801 dahin angewiesen, ist aber nicht befolgt worden, will es also dienstgehorsamst anzeigen, (daß) der Lehnträger vom Bergamt dazu angehalten wird.“ Nun, bei kaum 5 m Überdeckung in die Firste einzuschlagen, ist weiß Gott nicht ganz ungefährlich und die Anweisung des Geschworenen, die Fahrwege abzusperren, ist nur allzu verständlich. Daß sich der Erzgebirger nicht unbedingt an solche hält ‒ weil er ja schon immer diesen Weg benutzt hat ‒ ist eine Charaktereigenschaft, die er (die meisten, die wir kennen, jedenfalls) bis heute behalten hat... Der hier wieder als Lehnträger der Grube Gelber
Zweig genannte Name
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1802 stellte Herr
Körbach dann wieder einmal fest, „wurde das Eisensteingrubengebäude
vom Eigenlöhner nicht betrieben.“ (40014, Nr. 202, Film 0065)
Im Frühjahr (Trinitatis) 1802 dagegen notierte er (40014, Nr. 202, Film 0082f): „Es wird der Bau vom Eigenlöhner von Tage nieder auf dem Stunde 6 streichenden Lager verführet. Solches Lager führt Hornstein, Braunstein und grauen Eisenstein.“ Man war also ‒ was bei der geringen Tiefenlage der hier bebauten Erzlinse nur verständlich ist ‒ auch hier in der trockenen Jahreszeit dazu übergegangen, sie im Tagebau abzubauen. Im Hochsommer des Jahres war dagegen wohl wieder keine Zeit für Bergbau und der Geschworene fand die Grube bei seiner Befahrung im Quartal Crucis 1802 unbelegt vor. Im Winter dagegen baute man wieder untertage ab (40014, Nr. 202, Film 0112) und es heißt im Fahrbogen auf Luciae 1802: „Es wird der Bau von Eigenlöhner bey 2 Ltr. untern Tag auf dem morgengangweiß streichenden und Nord fallenden, sehr mächtigen Eisenstein Lager, so aus Hornstein, Quarz, einbrechenden Eisenstein und Braunstein bestehet, mit Ortsbetrieb in Abend verführet.“ Mit der in Verhieb genommenen Lagerstätte scheint dieser Eigenlehner wohl mehr Glück als etliche seiner Nachbarn, die es auch versucht hatten, gehabt zu haben: Auch hier ist jetzt von einem ,sehr mächtigen Lager´ die Rede. Er hätte eigentlich ziemlich kontinuierlich abbauen können, doch war die Grube auch Reminiscere 1803 wieder nicht belegt. Im Sommer 1803 notierte der Geschworene in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 209, Film 0045): Gelberzweig Fundgrube im Raschauer
Pfarrwald, „Wurde von Eigenlöhnern vom Fundschacht weiter in Abend ein neuer Tageschacht abgesunken, um das Eisenstein Lager zu untersuchen, ob es etwa mit beßren einbrechenden Eisenstein allhier wäre, auszurichten.“ Sollte etwa das Lager in seinem bauwürdigsten Teil bereits erschöpft gewesen sein ? Offenbar doch noch nicht oder die Neuausrichtung war einfach von Erfolg gekrönt, denn Luciae 1803 heißt es dann im Fahrbogen Körbach's (40014, Nr. 209, Film 0056): „War der neu angelegte Tageschacht vom Fundschacht gegen 4 Ltr. in Abend in dem sehr mächtigen Eisenstein Lager gegen 3 Ltr. tief abgesunken, ...habe zum Erlaer Hammerwerck 15 Fuder Eisenstein vermeßen laßen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trinitatis 1804 hatte sich die Situation allerdings
schon wieder umgekehrt, denn Herr Körbach notierte, daß er die
Grube unbelegt vorfand und der Tageschacht zubruchgegangen sei. Die
Eigenlöhner hätten daher einen Ortsbetrieb (vielleicht nun von übertage
her ?) neu angesetzt, wo man das Lager 3 Ellen mächtig gefunden habe und „der
mehrste Bestandtheil war Hornstein, brach Braunstein und grauer Eisenstein
mit ein.“ (40014, Nr. 213, Film 0015)
Bei seiner nächsten Befahrung hat der Geschworene die Grube wieder „montags in der Frühschicht unbelegt“ befunden (40014, Nr. 213, Film 0026). Auch in der 8. Woche Crucus 1804 war die Grube nicht belegt (40014, Nr. 213, Film 0038). Bis zum Herbst 1806 fehlen danach jegliche Erwähnungen dieser Grube in den Fahrbögen der Berggeschworenen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst in der 3. Woche Luciae 1806 taucht sie wieder auf:
Der neue Berggeschworene Christian Friedrich Schmiedel berichtete
nun (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 82):
„Von dieser Grube (Friedrich Fundgrube in Langenberg) ohngefähr 50 Lachter weiter gegen Morgen liegt Gelber Zweig Fundgrube. Baue. „Auf diesem ebenfalls eigenlehnerweise betrieben werdenden Berggebäude wird in 5 Lachter Teufe des Tageschachtes, auf einem etliche 20 Grad gegen Mitternacht Abend fallenden Lager a.) ein Ort Stunde 4,6 gegen Morgen und b.) eines Stunde 11,2 gegen Mitternacht betrieben. Ersteres ist 3 Lachter, letzteres aber nur ¾ Lachter von dem Tageschachte erlängt. Vor beiden besteht vorgedachtes Lager aus Gneis, Hornstein, Braunstein und ockerigem gelben Eisenstein.“ Danach brachen die eigentlich regelmäßig quartalsweise erfolgenden Befahrungen durch die Geschworenen aber erneut ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 22. August 1808 mutete dann Carl August Weißflog
auf Herrn Querfurth's Grund und Boden (also auf Fluren des
Ritterguts Förstel) eine „alte gewesene Braunstein Grube“ unter der
Benennung Gelber Zweig mit der Feldgröße einer gevierten Fundgrube
neu. Eigentlich besaß Herr Weißflog doch schon eine Grube desselben
Namens ?
Die Mutung wurde ihm am 5. Januar 1809 dennoch vom Bergamt bestätigt. Das neue Grubenfeld lag demnach „an dem von Langenberg gegen Mittag aufsteigenden Gebirge“ und es sei eine „seit undenklichen Zeiten im Freien liegende Braunsteinzeche, deren Name nicht mehr bekannt ist.“ (40014, Nr. 211, Film 0046 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 248) Nanu... Woher kam dann dieser Name ? Der Geschworene Schmiedel besuchte daraufhin am 16. Januar 1809 den Standort und fand zu berichten (40014, Nr. 235, Blatt 106): (...) auf Gelben Zweig gefahren. „Diese Eigenlehnergrube ist mit 3 Mann belegt, durch welche bei 4¼ Lachter Teufe des Tageschachtes a.) ein Ort mit 2 Mann Stunde 6,5 gegen Morgen auf einem Lager getrieben wird, und nunmehr 5½ Lachter erlängt ist. Sodann wird b.) durch 1 Mann in eben diesem Lager ein weiteres Ort Stunde 9,1 gegen Mittag Morgen betrieben, welches aber erst ½ Lachter erlängt ist. Besagtes Lager besteht aus Gneis, braunem Hornstein, Quarz, etwas ockerigen braunen Eisenstein und Braunstein.“ Hat Herr Weißflog einen neuen Schacht geteuft oder den im Sommer 1804 verbrochenen gewältigt ? Am 6. Februar 1809 fand Herr Schmiedel bei seiner Anwesenheit in Langenberg natürlich noch nichts neues vor (40014, Nr. 235, Blatt 115).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carl's Glück
am Förstelgut bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurze Zeit darauf, am 10. November 1808 hatte auch
Carl Christian Edler von Querfurth, der Sohn von
Johann Heinrich Conrad Querfurth, eine gevierte
Fundgrube unter dem Namen Carl´s Glück „auf dem seinem zum
Rittergut Förstel gehörenden, ihm eigenthümlichen Grund und Boden“
gemutet. Diese erhielt er am 5. Januar 1809 bestätigt (40014,
Nr. 211, Film 0049 und 40014, Nr. 43, Blatt 250f). Zur Verleihung
ist ausnahmsweise einmal eine Croquis kleinen Maßstabs in der Akte
abgeheftet, welche uns eine Vorstellung von der Lage der dort bauenden
Gruben zueinander gibt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Grube hatte eigentlich keinen
langen Bestand und ist, wenn wir nichts übersehen haben, in den
Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) überhaupt
nicht aufgeführt. Dennoch soll sie an dieser Stelle ein eigenes Kapitel
erhalten, da der Besitzer dieser Grube ‒ zugleich ja auch Besitzer des
Rittergutes Förstel ‒ Anlaß zu vielen Beschwerden über die anderen, auf dem
Grund und Boden des Förstelgutes bauenden Gruben fand. Doch bleiben wir
zunächst beim Betrieb dieser Grube.
Am 6. Februar 1809 war Herr Schmiedel in Langenberg zugegen, konnte der kurzen Zeitspanne halber aber natürlich bei Carl's Glück noch nichts neues vorfinden (40014, Nr. 235, Blatt 115). Herr Schmiedel besuchte diese Grube erst wieder Luciae 1809, worüber er berichtete (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 213f): „Donnerstags, den 7.12.1809 bin ich auf Carls Glück zu Langeberg gefahren. Es ist diese Grube mit 2 Häuern belegt, durch welche bei 5 Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort in Quergestein Stunde 10,4 gegen NW nach einem vorliegenden Eisensteinlager getrieben wird. Es ist selbiges nunmehr 8¼ Lachter von dem Tageschachte erlängt.“ Eine weitere Befahrung erfolgte dann Reminiscere 1810 (40014, Nr. 245, Film 0009f). Man trieb das Ort in 5 Lachter Teufe „in gelbem Ocker“ Stunde 10,4 weiter, hatte es jetzt 12½ Lachter fortgestellt, „jedoch sind damit keine Eisenstein Anbrüche ausgerichtet worden.“ Auch Versuche durch Abteufen blieben ohne Erfolg, „da man immer in wenig Teufe auf das feste Gneisgebirge gekommen ist.“ Weil Schmiedel nun „den ferneren Betrieb des Ortes (...) nicht für rathsam“ hielt, so hat er „unter anhoffender Genehmigung des Königl. Bergamtes veranstaltet“, dieses Ort einzustellen und ein anderes Ort Stunde 10,4 gegen Südost zu treiben. „Zu dieser Erwartung hat man um so mehr Hoffnung, da auf den benachbarten Gruben, namentlich Gelber Zweig und Vier Brüder Fundgrube, als nach welcher Gegend dieses Ort getrieben werden soll, mit ziemlich glücklichem Erfolg auf Eisenstein gebauet wird.“ Nun ja, die Hoffnung stirbt zuletzt... Bis Februar 1810 hat man das empfohlene Ort auch aufgenommen und bereits 7 Lachter erlängt (40014, Nr. 245, Film 0020). Außerdem ist noch eine weitere Verleihung an den „Kaufmann“ Carl Christian Querfurth erfolgt: Am 5. Juli 1810 erhielt dieser eine gevierte Fundgrube unter dem Namen Mercur bestätigt, welche „in Langenberg, ohngefähr 120 Lachter vom Rittergute gegen Morgen an dem gegen Mittag ansteigenden Gebirge unterhalb der von Langenberg nach Schwarzbach gehenden Straße“ gelegen hat (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 255f). Danach findet man aber keine Erwähnungen dieser beiden Gruben in den Fahrbögen der Berggeschworenen mehr ‒ vielleicht die kürzeste Betriebszeit unter den hiesigen Gruben überhaupt...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Fahrbögen finden sich auch mehrfach Hinweise auf neue Schurfarbeiten, zu denen sich die Geschworenen aber kaum einmal konkreter äußern. Nur einer davon scheint sich (wenn wir uns die Croquis oben vor Augen halten) sehr wahrscheinlich wieder auf genau diese Flächen zu beziehen: Am 31. August 1815 nämlich notierte Herr Schmiedel in seinem Bericht für das Bergamt (40014, Nr. 254, Film 0072f): „Sodann habe ich noch einige in dieser Gegend nach Eisen und Braunstein betrieben werdende Schürfarbeiten besichtiget und in Rücksicht des den hier schon betriebenen 3 Gruben verliehenen gevierden Feldes, verschiedenes daselbst expediert.“ Zu dieser Zeit wurde u. a. Köhlers Hoffnung aufgenommen. Möglicherweise also hat sich Herr Schmiedel dazumal vor Ort umgeschaut, ob überhaupt und wenn ja, in welcher Größe, hier eine weitere Grube dazwischen paßt. In seinem Fahrbogen vom 6. April 1819 hat Herr Schmiedel dann schon einmal notiert (40014, Nr. 261, Film 0037): „Sodann habe ich im Raschauer Pfarrwalde im Umtriebe stehende Schurfarbeiten besehen, übrigens aber und besonders einige, von dem Herrn Prem. Lieutn. von Querfurth auf Förstel, wider dem Lehnträger Schubert von Friedrichs Fundgrube zu Langenberg, wegen eines, auf ersterem Grund und Boden neu angelegten Tageschachtes, geführte Beschwerden in Güte beseitiget.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl also ‒ zumindest kurzzeitig ‒
auf seinem Grund selbst Bergbautreibender, war Herr Carl Christian
Edler von Querfurth auf Förstel, nun nicht nur Sächs. Premier
Lieutnant (und später Rittmeister), sondern als Besitzer des Rittergutes
natürlich auch ,Oeconom', der auf den ausgedehnten Besitzungen des
Rittergutes selbstverständlich auch Land- und Forstwirtschaft betrieb.
Dies mußte zwangsläufig zu Differenzen mit den Eigenlehnern, die
ebenfalls auf demselben Grund und Boden tätig waren, führen. Diese
Streitereien füllen eine ganze Akte des Bergamtes Scheibenberg (40014, Nr. 260) und währten von der Übernahme des Gutes
von seinem Vater (nach dessen Tod 1817) bis zu seinem eigenen Ableben im
Jahr 1845.
Weil der Akteninhalt uns nun einen ganz anderen Blickwinkel auf den in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Emmler umgehenden Bergbau ermöglicht ‒ ganz unabhängig davon, wieviel Wahrheit im Einzelnen darinnen steckt oder auch nicht, werden wir im Folgenden ausführlich daraus zitieren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang des Jahres 1819 richtete der
Besitzer des Gutes seinen ersten Brief noch an den Berggeschworenen (40014, Nr. 260, Blatt 1ff):
präs. 23. April 1819 Se. Wohlgeboren Herrn Berggeschworenen Schmiedel in Scheibenberg. „Euer Wohlgeboren! ist sattsam bekannt, wie so sehr ich in meinen Waldungen, gegen alle landesherrliche und bergmännische Gesetze blos durch Mißbrauche der Raschauer und Langenberger Bergleute, bei dem Schürfen und Wühlen beschadet werde, auch habe sowohl der Herrn Bergmeister Schütze als dieselben mit wiederholt versprochen, diesen Unfuge Einhalt zu thun, diese Leute zur Ordnung und zur Entrichtung des gesetzlichen Grundzinses usw. strenge anzuhalten – allein ohne nur mir 1 Gr. zu entrichten, ohne mir nur ein Wort zu vergönnen, ja selbst ohne Ihr Vorwissen, hatte der Besitzer von Friedrichs Fundgrube mitten im Walde ein Loch geschlagen. Wenn ich nun nach der gemachten Berechnung, die ich durch jemand ohngefähr habe aufschreiben lassen, wie viele Schichten sie seit 9 Monaten gemacht, dazu jeder Holz noch sonst etwas haben anfahren lassen, und wie viel sie Ausbeute verladen, das in einer Woche 32 Centnern, so muß dieses nach Abzug der Bergamtskosten ein sehr bedeutender Gewinn sein, welches seiner Zeit alles zur Sprache kommen muß, desto ungehörender ist dieses Benehmen. Ich habe also Gewalt mit Gewalt vertrieben und dieses Loch zustürzen lassen, welches auch so lange geschehen wird, bis dieselben den Ort besichtigt haben, und diese Grube für nöthig erachten. Bis dahin aber will hiermit gegen alles Verfahren dieser Leute apelliren, und behalte mir vor, in einigen Tagen deshalb schriftlich an das wohllöbliche Bergamt zu Scheibenberg einzukommen. Womit Ihnen aber bin ich fest versichert, daß dieselben solche Ungebührnisse nicht gestatten, sondern gewiß mich als Grundeigenthümer nach den Gesetzen schützen werden. Den Vorfall aber denenselben anzuzeigen, hielt ich für meine Pflicht und bitte um einige gefällige (schwer leserlich?). Achtungsvoll Carl Edler von Querfurth, Rittmeister, Förstel, den 23. April 1819“ Die hier aufgeworfene Frage nach dem Grundzins als Entschädigung für den Nutzungsausfall für den Grundeigentümer zieht sich noch länger durch den Schriftverkehr. Das Bergamt sah eine solche Übereinkunft stets als eine privatrechtliche Vereinbarung an und sich selbst überhaupt nicht in der Pflicht, sich darum zu kümmern. Im Gegenteil: Das Vorrecht des landesherrlichen Bergbaus gegenüber dem Grundbesitz war auch im Bewußtsein der Lehnsträger verankert. Dies kann man nun so oder so handhaben ‒ offenbar aber zog hier die Mehrzahl der Grubenbetreiber es vor, auf eigene Faust einzuschlagen, anstatt sich wenigstens im Vorfeld doch einmal miteinander zu verständigen. Auf dem Aktenstück findet sich folgender Vermerk aus der Hand des Geschworenen: „Auf vorstehende Beschwerde wurde bey der am 26. April a. c. erfolgten Besichtigung des auf Friedrichs Fundgrube zu Langenberg angefangenen neuen Tageschachtes befunden, daß selbiger nur 10 Ltr. von dem Fundpuncte gegen Abend in jungem Holze angelegt und nur dadurch dem Grundbesitzer Schaden verursachte, weshalb denn dem Lehnträger gedachter Grube beschieden wurde, daß sein angefangener, erst 1½ Lachter tiefer Tageschacht wieder zuzufüllen und dagegen solchen 2 Lachter weiter gegen Abend, in einem alten, nicht mehr gangbaren Feld (schwer leserlich ?), woselbst dem Grundbesitzer kein Schaden geschieht, und von welcher Stelle derselbe (?) zufrieden war, angelegt und niedergebracht werden soll. Scheibenberg, den 26. April 1819, Schmiedel.“ Damit waren offenbar beide Seiten zufrieden und durch das umgehende, verständige Eingreifen des Geschworenen wurde die Mücke erschlagen, bevor sie sich zum Elefanten aufblähen konnte. Aber dabei blieb es leider von beiden Seiten nicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste Auftritt der Kombattanten folgte alsbald: Im Fahrbogen vom 15. November 1819 hatte Herr Schmiedel notiert (40014, Nr. 261, Film 0100f): „Sodann habe ich noch auf, von dem Herrn Prem. Lieutnant von Querfurth auf Förstel zu Langenberg, wider mehrere Eigenlehner daselbst, in Betreff des auf seinem Grund und Boden befindlichen Bergbaus und des dadurch entstehenden Schadens, geführte Beschwerde, diese Gegend besichtiget und hierüber besondere Anzeige bei Eu. Königl. Bergamte eingereicht.“ Diesmal informierte der Geschworene sicherheitshalber ,mit besonderer Anzeige' auch seine vorgesetzte Dienststelle. Hier der Wortlaut dieser Meldung (40014, Nr. 260, Blatt 3ff): präs. 20.11.1819 An Eu. Königl. Sächs. Wohllöbl. Bergamt zu Scheibenberg „Gehorsamste Anzeige. Als ich am nächstvergangenen Mondtage in der Gegend von Langenberg mehrere der dortigen Gruben befuhr, beschwerte sich der Herr Premier Lieutnant von Querfurth auf Förstel, über die dasigen, auf seinem Grund und Boden Bergbau treibenden Eigenlehner, daß selbige ihm in seiner Waldung viel Schaden verursachten, mehre Schächte als nöthig wären, niederbrächten, solche theils gar nicht, theils nicht hinlänglich verwahrten, welches für die vorbeygehenden Menschen sowohl als für das Vieh Gefahr bringen könne und deshalb auf sofortige Abstellung dieser Nachtheile angetragen haben, widrigenfalls aber höheren Ortes Beschwerde führen wolle. Wenn nun das Anliegen des obgedachten Herrn Grundbesitzers großentheils gegründet ist, ich auch bey jedesmaliger Befahrung der in dieser Gegend gelegenen Gruben, den Lehnträgern und Eigenlehnern zu wiederholtenmalen aufgegeben habe, ihre äußerst unregelmäßigen und gewissermaßen den Bergbau schändenten, bergmännischen Arbeiten regel- und vorschrifftenmäßiger zu betreiben, wodurch nicht nur die Förderung sich erleichtert, sondern auch die Wetter weit besser halten würden und eben dadurch die öftere Absinkung der, in wenig Entfernung, bisweilen nur 5, 8 bis 10 Lachter von einander abstehender, neuer Tageschächte, welche größtentheils nur zum Wetterwechsel dienen, vermieden werden könnte; so haben doch mehrere dieser Veranstaltungen und Vorstellungen wenig Eingang gefunden, vielmehr sind jene die mehrstenmale unausgeführt geblieben, auch benahm sich der Lehnträger von Gelber Zweig Karl August Weißflog (schwer leserlich ?) zu Langenberg, als ich ihm an nächstvergangnenen Mondtag wegen seiner drey, nahe aneinander stehenden Tageschächte und der aus selbigen bald mit fallender, bald mit steigender Sohle, vielen Krümmungen und wenig Höhe getriebenen Örter, meine Unzufriedenheit zu erkennen gab, äußerst auffallend und subordinationswidrig, so daß ich mich genöthigt sahe, Eu. Wohllöbl. Bergamt gehorsamst zu bitten, genannten Weisflog wegen seines Vergehens sowohl zu bestrafen, als auch demselben besonders, so wie außerdem noch die Eigenlehner von Friedrichs Fundgrube, Christbescherung, Schuberts Freundschafts und Riedels Fundgrube sämtlich zu Langenberg und Raschau bey Strafe zu bedeuten, ihren Bergbau künftighin regelmäßiger nach Vorschrift des Bergamts zu betreiben, die Schächte und Strecken, welche zum Theil nicht mit der geringsten Zimmerung versehen und öfters nur mit Lebensgefahr zu befahren sind, gehörig mit Zimmerung zu verwahren, neue Tageschächte aber nicht eher, als mit Vorwissen und Genehmigung des Bergamtes niederzubringen, die alten entbehrlichen hingegen nach Beschaffenheit der Umstände entweder einzufüllen, oder gut zu verbühnen, übrigens aber alles unnöthigen Schadens an den Grund und Boden des Herrn Grundbesitzers sich zu enthalten. So nöthig und zweckdienlich nun das vorstehende ist, ebenso dringend dürfte eine mehrer Ordnung und Einschärfung in Ansehung des ausgebrachten und verkauft werdenden Braunsteins sich nöthig machen, dieweil einige der Eigenlehner von obgedachten Gruben dieses Produckt verkaufen, ohne daß solches vorher gehörig verwogen worden, auch öfters nicht einmal solches beym Bergamte melden, vielmehr dem Verlauten nach, dasselbe heimlich von der Grube wegschaffen, wodurch offenbar das hohe landesweite Interesse, in Ansehung des deren zu entrichtenden Zwanzigsten und der Accise sehr beeinträchtigt wird. Um diesen Nachtheil möglichst zu verhüten, wollte ich ganz unmaßgeblich folgende Mittel in Vorschlag bringen, daß 1.) den Eigenlehnern und Lehnträgern der Braunsteinzechen aufs strengste und bey Strafe verboten würde, keinen Braunstein ohne vorhergegangene Verwiegung von mir dem Waagemeister zu verkaufen, 2.) die Braunsteinfässer mit einem gewissen schicklichen Zeichen, wie z. B. solches bey der Arsenik Verladung geschieht, durch den Waagemeister angebrennet würde, auch auf selbigen der Inhalt und das Gewicht von dem Waagemeister bemerkt, 3.) den Accis Offizianten in Langenberg, Schwarzbach, Raschau, Sachsenfeld und Wildenau, von Seiten der Accis Inspection zur Pflicht gemacht werden möchte, niemand eher einen Accis Zettel auf Braunstein zu ertheilen, als bis er eine Bescheinigung von dem Waagemeister vorzeigen kann, daß die angebliche Qualität Braunstein gehörig verwogen worden sey. Damit nun aber der Waagemeister sowohl, als die Eigenlehner der Braunsteinzechen und zwar ersterer wegen seiner übrigen Geschäffte auf die Verwiegung des Braunsteins sich gehörig einigten und letztere die nöthigen Fässer, Waage und Gewicht in Bereitschafft halten können, so dürften 4.) in jedem Quartal ein für allemal 2 bestimmte Verwiegetage, welche für die hiesige Refier am schicklichsten dienstags No. 6te und dienstags No. 12te Woche gehalten werden könnten, festgesetzt werden. Eu. Wohllöbl. Bergamte habe ich solches alles pflichtschuldigst anzeigen und die weitere Verfügung hierüber hoch- und denenselben überlassen sollen. Scheibenberg den 17. November 1819, Christian Friedrich Schmiedel, Geschworener.“ Wenn natürlich das ,hohe landesweite Interesse... an der Akzise' beeinträchtigt wird, dann werden auch heute noch die Behörden besonders fleißig. Das Sitzungsprotokoll des Bergamts zu Scheibenberg vom 27. November 1819 (40014, Nr. 260, Blatt 6ff) sagt dazu aus, daß man den Vorschlägen Schmiedel's, insbesondere, was die Unterbindung des illegalen Verkaufs des Braunsteins anbetraf, folgen werde. Es wurde nicht nur ein betreffendes ,Patent' aus- und allen hier persönlich angesprochenen Lehnträgern zugestellt; tatsächlich wurden später auch die ,Verwiegetage' eingeführt. Ferner wurde Herr Weisflog
für den 5. Januar 1820 zwecks Vernehmung ins Bergamt einbestellt. Der
erschien natürlich auch, stritt aber alles ab und bat um Straferlaß (40014, Nr. 260, Blatt 12f).
Da nun Aussage gegen Aussage stand, das Amt aber wohl ein Exempel
statuieren wollte, bekam er sie nicht erlassen, aber wenigstens auf 16
Groschen erniedrigt. Außerdem wurde am 7. Juli 1820
eine Lokalexpedition und Generalbefahrung der Eigenlöhnerzechen zu
Langenberg durchgeführt. Protokolle hierüber haben wir noch in den Akten
zu Friedrichs Fdgr. (allerdings unvollständig, 40169,
Nr. 95, Blatt 8ff) und in der
Ein Punkt blieb dabei ungeklärt: Wie soll die Entschädigung für den Grundeigentümer geregelt werden ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Herr Johann August Gebler die Funktion des Berggeschworenen in Scheibenberg 1823 übernommen hatte, bekam auch er es gleich im Folgejahr mit Herrn von Querfurth zu tun: In seinem Fahrbogen vom 20. Februar 1824 notierte er nach seiner Befahrung auf Gelber Zweig (40014, Nr. 271, Film 0010): „Desselben Tages auf Verlangen des Herrn Besitzers von dem Ritterguth Förstel wegen von demselben gegen einige Bergarbeiter erhobener Beschwerden und durch den Bergbau ihm auf seinem Grund und Boden erwachsende Nachtheile die vorläufig erforderlichen (...?) und Untersuchungen angestellt und mit gedachten Herrn Grundbesitzer einstweilige Rücksprache genommen und denselben wegen des vorgefallenen vor der Hand zu beruhigen gesucht.“ Ein paar Monate später, am 14. Mai des Jahres, hatte Herr Gebler erneut vor Ort zu tun und notierte darüber (40014, Nr. 271, Film 0010): „Desselben Tages habe ich einen auf dem Grund und Boden des Ritterguthes Förstel zu Entdeckung von Eisenstein angefangenen Schurf besichtigt und gefunden, daß solcher zu möglichster Schonung des Herrn Grundstückseigenthümers fast an der dortigen Straße ohnweit des Grubengebäudes Christbescherung angelegt worden. Über (unleserlich ?) Gegenstände habe ich (...?) auch mit dem Herrn Grundbesitzer Rücksprache genommen.“ Daß der Geschworene sich nicht mit dem Grundbesitzer zu verständigen suchte (was ihm von dessen Seite später vorgeworfen wurde), kann man so eigentlich nicht sagen... Auch kann man aus den Akten herauslesen, daß es gleichartige Probleme natürlich auch beim benachbarten Tännichthammer gegeben hat. Man kann aber aus folgender Notiz des Berggeschworenen in seinem Fahrbogen vom 26. Mai 1824 durchaus entnehmen, daß Herr Gebler pflichtgemäß auch auf die Sicherheit bei aufgegebenen Gruben bedacht gewesen ist (40014, Nr. 271, Film 0010): „Desselben Tages mich auf Veranlassung des Herrn Grundbesitzers von dem Hammerguth, Meyer, in den Tännicht begeben, um einige daselbst zur Zeit zum Stehen gekommene Schächte besichtigen zu können. Zur Verhütung von Unglücksfällen habe ich solche sogleich zu verbühnen und (?) zu verwahren, sogleich die Veranstaltungen getroffen und hat diese Arbeit (...) sogleich darauf statt gehabt.“ Wie dem auch sei, der nächste Akt vonseiten des Besitzers des Ritterguts Förstel ließ dennoch nicht lange auf sich warten. Am 20. November 1824 beschwerte sich Herr Carl von Querfurth erneut, und diesmal gleich beim Bergamt, über Friedrichs Fundgrube, daß deren Betreiber ihm seit nunmehr 11 Jahren keinen Grundzins (wie er doch etwa von Vater Abraham und Gnade Gottes Fundgrube auch gezahlt werde) entrichtet hätten (40014, Nr. 260, Blatt 14). Wieder mußte der Geschworene tätig werden und der setze am 11. Januar 1825 eine Anzeige an seine Dienststelle folgenden Inhalts auf (40014, Nr. 260, Blatt 16). Er habe sich erkundigt und die in Rede stehenden Schulden beträfen nicht (einen ja noch gar nicht festgelegten) Grundzins, sondern summierten sich auf 5 Thl. 16 Gr. – für Bauholz und Fuhrdienste. Der Abnehmer des Eisenerzes der Friedrich Fundgrube war Louis von Elterlein auf Pfeilhammer und dieser wurde vom Geschworenen veranlaßt, den Betrag von der nächsten Erzbezahlung einzubehalten. Fairerweise wurde die Eigenlehnerschaft in Raschau davon in Kenntnis gesetzt. In Bezug auf die wiederholte Beschwerde, die vielen Schächte hätten das Passieren der Gegend lebensgefährlich gemacht, habe er festgestellt, daß zwei Schächte verbühnt und der Fundschacht inzwischen größtentheils zugefüllt sei. Dem Eigenlehner wäre dennoch bei Wiederholung bergamtliche Strafe anzudrohen. Was eine Entschädigung bzw. einen Grundzins anbelangt, so habe er dem Grundbesitzer dargetan, daß dies eine privatrechtliche Übereinkunft sei, die nicht durch besonderes Gesetz geregelt werde, und daß er vom Bergamt lediglich eine Bestätigung des Vorliegens einer solchen erhalten könne. Gebler bot aber Vermittlung zwischen den Parteien an. Was schließlich noch „die Vernichtung von jungem Anfluge durch das Haldenstürzen“ anlange, so obliege auch die Wiederherstellung der benutzten Flächen nach der Aufgabe des Abbaus den Bergbautreibenden. Auf die Sache mit den Fuhrlöhnen wird später auch noch zurückgekommen. Angeblich nämlich sei es Vorrecht des Grundbesitzers, auch den Erztransport mit eigenen Gespannen anzubieten und nur, wenn ein anderer ‒ hier zum Beispiel Herr von Elterlein ‒ dies wesentlich günstiger selbst erledigen könne, müsse der Grundbesitzer zurücktreten. Herr von Querfurth habe nach diesen Vorstellungen und Erklärungen zunächst von einer Wiederholung der Beschwerde abgesehen. Aber nur ,zunächst'... Man muß Herrn von Querfurth auch zugestehen, daß nicht nur der Abbau selbst, sondern auch immer wieder neue Schurfversuche auf seinen Fluren erfolgt sind. In den Fahrbögen des Geschworenen Gebler heißt es nämlich nur zwei Tage später (40014, Nr. 273, Film 0005), er habe am 13. Januar 1825 „einen Schurf auf Eisenstein ohnweit Langenberg in der Nähe von Christbescherung Fdgr. anderweit besichtigt, auch erforderliche Rücksprache mit dem Herrn Grundbesitzer, dem Besitzer des Ritterguthes Förstel, in Betreff von Differenzen mit mehreren Eigenlöhnern genommen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Beschwerde folgte bereits
im April desselben Jahres und wieder war es ein mehrseitiges Schriftstück (40014, Nr. 260, Blatt 18ff):
An Eu. hoch- und wohllöbl. Königl. Sächs. Bergamt zu Scheibenberg „Schon seit 20 und mehr Jahren leidet das Guth Förstel durch die Bergrechte entnehmende Mißbräuche und (schwer leserlich ?) der Schürfer auf das Empfündlichste und durch mehrere an Eu. hoch- und wohllöbl. Bergamt seit dem 4. Januar 1820 eingereichte Klagen und Beschwerdte Schriften ist es genug und sattsam bekannt, wie dringend ich um eine Lokalbesichtigung bath, zu welcher ich der ruinirten Felder und Waldungen wegen, unpartheyische Oeconomie- und Forstverständige zuziehen wollte, allein leider ist dieses mein oft beschehenes Ersuchen bis jetzt noch mit keinem Erfolg gekrönt, leider mir nach so oftmaligen Ansuchen noch kein Grundzins entrichtet worden, leider haben sich meine eingereichten Klagen ohngeachtet, die Halden und ersoffenen Schächte immer noch mehr vermehret. In einem dieser Gesuchsschreiben
bat ich vorzüglich (?) daß die Zechen Inhaber angehalten werden
sollten, die so lange rückständigen Grundzinsen ungesäumt zu entrichten
und verlangte von Weispflogs Eisensteinzeche Christbescherung von Quartal
Reminsicere 1807 an quartaliter Auf alles dieses hat Eu. hoch- und wohllöbl. Bergamt lediglich verfüget, daß die Herren Berggeschworenen Schmiedel und später Herr Berggeschworener Gäbler, mit mir mündliche Rücksprache nehmen sollten, ich kann auch nichts anderes sagen, als daß sich beide alle Mühe gegeben, diese Eigenlöhner zur Ordnung, besonders zum Zubauen der vielen offenen Schächte, zu Waldung bey neuen Schächten schlagen, Enthaltung des Feuermachens in den Kauhen und zur Abtragung eines Grundzinses anzuhalten, allein der Starrsinn und Ungehorsam dieser Leuthe ist zu groß, und leider ist fast keiner dieser Befehle respectirt worden. Ja, Se. Hochwohlgeboren des Herrn Berg Commissionsraths von Zedtwitz haben selbst die unangenehme Erfahrung machen müßen, daß dieselben in meinem Beysein Schuberthen anbefohlen haben, Schächte zuzubauen, um ohne Meldung bey dem Grund Eigenthümer und der bewußte des Herrn Berggeschworenen keine neuen zu schlagen, dermaßen aber ist unterblieben und das zweite in Zeit von 10 Wochen darauf erfolgt, worüber ich auch zugleich Meldung an den Herrn Berggeschworenenen Schmiedel gethan, welcher über diesen Unfug, zumahl da Schuberth diesen Schacht geradezu, wie zur Turbation mitten in der dichtesten Waldjugend einige Lachter von seiner Zeche und 2 Lachter von einer alten Waldung angelegt, sehr entrüstet war, und befohlen, diesen zuzubauen, und in den Weg zu verlegen, wo ich noch die Schwäche hatte, da nun einmahl der Anflug verwüstet, diesen Schurf zu gestatten. Nun habe ich theils mündlich, theils schriftlich fortwährend um Revision meiner Beschwerden sowohl, als um Regulirung des mir zukommenden Grundzinses angehalten und besonders gegen Schuberth im Monat Octbr. 1824 abermahls eine Klageschrift eingereicht, worinnen ich angesucht, daß Eu. hoch- und wohllöbl. Bergamt Austrag meiner Sache fernerhin keinen Eisenstein vermeßen, auch daß einer daßelbe erlauben möchte, auch das Abfahren als auch die Zahlung des Eisensteins bei Herrn Louis von Elterlein in Großpöhla Aufschlag zu legen, da sich an diesem Menschen sonst durchaus nicht zu halten sey und meinem Anspruche wegen erhaltenen Hölzern und Fuhren an 5 Thl. 16 Gr. sowie theils wegen 21 jährigen rückständigen Grundzinsen an 80 bis 90 Gr. sonst gefärtet seyn würden. Auch habe ich dieserhalb bei Herrn Louis von Elterlein Intribition eingelegt, allein demohngeachtet hat hoch- und wohllöbl. Bergamt nicht allein annoch gegen 50 Fuder anderweitigen Eisenstein zur Abfuhr vermessen, ja dem Herrn Louis von Elterlein ansagen lassen, daß, da meine Anforderung noch nicht erwiesen, an diesen Schuberth keine Zahlung aufhalten können, es sey denn einige Thaler für von Schuberth zugestandenes Holz, worauf ich abermahls unterm Monat Decbr. v. J. ein Ersuchen in dieser Angelegenheit an dieselben ergehen lassen, mich über dieses Verfahren beschwerde, und geradezu erklärte, daß ich mich nun gezwungen fühle, mir selbst Hülfe zu nehmen und der anderweitigen Abfuhr des Eisensteins sowie des Frevels Gewalthand zu widersetzen. Allein mein Rechtsfreund belehrte mich, daß nach soviel wiederholten Anzeigen, Ersuchen und Beschwerde Schreiben ich mich lediglich an Eu. hoch- und wohllöbl. Bergamt meines Regreßes wegen halten solle, und daß mir dasjenige, was mir von einer hohen Commission nach Austrag meiner Sache und Taxation des beträchtlichen Schadens wird zugesprochen werden, mir durch dieselben wird ersetzt werden müssen, weshalb ich mich auch in diese harte Nothwendigkeit gefüget und nun, was hochdieselben zu bescheiden geruhen werden, erwarten will. Auch haben dieselben im Monat May v. J. dem Steiger Kräher aus Raschau einen Schurfzettel ertheilt, wovon derselbe auch sogleich nach schuldiger Waldung und Rücksprache mit mir, Gebrauch gemacht hat, aber auch leider mir schon ein sehr schönes Stück Feld auf ewige Zeiten verwüstet. Mich in diese Königl. Befehle fügen müßend, ersuche nun auch Eu. Hoch- und Wohllöbl. Bergamt, (?) daßelbe mir als Grund Eigenthümer an Grundzinß aussprechen und durch bergamtlichen Regreß (da ich mich in privat Unterhandlungen, durch welche nichts als Zeitverlust bezweckt wird, weder mit diesem, noch mit einem anderen Eigenlöhner einlaßen kann, und werde) zusichern, ihm aber auch zugleich angehalten, daß er die bei seiner Grube vorbey führende Fahrstraße einhalte, das von der Halde hereingelaufene Gestein so planiere, daß es nicht die Kommunikation auf dieser Fahrstrecke beschweren werden, den (?) entferne, sowie sich alles Feuer (?) in der Kaue enthalte, wo wenn dieser Unfug, den ich schon so oft verbothen und welcher mich schon auf andern nahen Zechen zweymahl in Schrecken und Feuersgefahr versetzte, auch Eu. Hoch- und Wohllöbl. Bergamte sowie den Herrn Geschworenen Anzeige deshalb gemnacht, nicht unterbleiben sollte, ich mich genöthigt sehe, mir selbst Hülfe, sie führe zu was sie wollte, zu verschaffen. Da nun diese Grube längst fündig und bereits an 30 bis 40 Fuder Eisenstein allein auf der Halde liegen, ohne was immer noch mit Kübel zu Tage gefördert wird, und auch letztlich unter dem Nahmen Oster Freude bestätiget worden ist, so muß doch wohl auch von diesem Tage das Schürfens oder doch vom Quartal Crucis 1824, der Grundzinß mir zustehen, daher ersuche Eu. Hoch- und Wohllöbl. Bergamt den Eigenlöhner Kräher nicht eher zu vermessen, bis er den Grundzins entrichthet, und glaube, daß ein Grundzins von 2 Thl. von Quartal Crucis (quartaliter gerechnet) nicht zuviel seyn wird, wenn er nicht mehr Haldensturz, als bis zeither und keine anderweitigen Schächte braucht, da meinem verstorbenen Herrn Vater nach langen Debatten von Gnade Gottes Maaßen und Fundgrube quartaliter ½ Waag Eisen und 12 Gr. Geld laut Bergamts Registratur zugesagt werden mußte, welche mir bei weitem den Schaden nicht zugefügt, da aber auch der Grund Eigenthümer die Abfuhr zusteht, wenn des Käufers Geschirr nicht selbst fahren, so ersuche ich Eu. Hoch- und Wohllöbl. Bergamt die Verfügung treffen zu wollen, daß jedesmahl bei dem Vermeßen des Eisensteins die Eigenlöhner angewiesen werden, mit mir zu contractieren, und ich werde besonders, um dadurch auf den nahen Feldern vielen Unfug vorzubeugen, der bei dem Abfahren deßelben (?) jedesmahl um das vorwüßlich möglichst billig bedungen Lohn, was andere nehmen, fahren. Ferner habe ich im Monat Novbr. 1824 den Herrn Berggeschworenen Gäbler privatim angezeigt, wie ein gewisser Benjamin Weisflog, der eines gewaltsamen Einbruchs wegen von der Bergarbeit abgelegt worden, und den ich, um größere (?) zu verhüten, als Familien Vater auf meinen Kalckofen neuerdings wieder in Arbeit nahm, die er aber, da er seine Schuldigkeit nicht that, wieder verlohr, sich gegen mehrere Menschen ausgelaßen hat, daß, wenn er von der Arbeit abgelegt würde, er mit seinem Schwiegersohn (einem gewissen Maurergesellen Ficker) gleich in das beste Feld nach Eisenstein schürfen würde, wo ihn niemand herausbringen sollte. So hat derselbe ferner geäußert, daß, wenn ich ihnen in der Treibung eines Stollens hinterlich wäre, sie hingingen und einen Schurfzettel holten, wo sie mir auf den schönsten Theil meines Feldes einen Schacht und Halde anlegen wollten. Um also dieser Turbation auszuweichen, muste ich mich endlich darein fügen, die Erlaubniß zur Anlegung dieses Stollns zu geben. Da aber theils der leichte Bau dieses Stollns, theils weil er unter einem Obst und Küchen Garten führt, mir sehr vielen Schaden für die Zukunft bedroht, so muß ich dringend ersuchen, diesen besonders unter bergamtliche Aufsicht zu stellen, damit ich nicht abermahls, was mir gewis äußerst unangenehm ist, Hochdieselben mit Beschwerdeklagen zur Last fallen muß, auch diese Eigenlöhner, da sie nun fündig und Eisenstein zu Tage gefördert haben, zur Abtretung des Grundzinßes zu ermahnen, und mir von Quartal Reminiscere an quartaliter 1 Th., 6 Gr. bergamtlich zuzusichern. Gleichergestalt bitte ich, auch den Steiger Kräher anzuhalten, den auständigen Grundzinß von der in meinen Pöckelguths Waldungen seit vielen Jahren habenden Flößzeche vom Quartal Trinitatis 1820 an, als wo ich Besitzer des Pöckelguths bin, was er nicht durch Quittung beweisen kann, bezahlt zu haben, und was die Bergamts Register erweisen, was seit dieser Zeit vermessen, und zwar, wie es überall gebräuchlich, per Fuder 2 Gr., welches auch die Raschauer Bergleute Schramm und Kraus unweigerlich an die Zwanziger am Fürstenberge seit langen Zeiten bis dato berichtigen, (?) jenem ofterwähnten, dicht an der von hier nach Mittweyda fahrenden Hauptstraße gelegenen ersteren Schürfen und unbedachten Schächten, befinden sich noch so manche, die mir die größte Gefahr drohen, besonders einer, nicht weit von der Ämter Straße auf Siegers und meiner Rainung mit nur einer Feldbreite von meinem Gehöfte an meiner Rainung mit dem sogenannten Dännigguthe, da ich besonders wegen tetzterem nie ohne Aufsicht Kinder und dann noch mit banger Furcht ihrer Erholung nachgehen laßen kann. Welche Stimmung dieses alles hervorbringen muß, zumahl durch diese Höhlung und Raubbaue doch so wenig der Fiscus gewinnt, ja die Eigenlöhner selbst sagen, daß sie kärgliches Brot dabey haben, und der wahre vaterländischer gewiß von jedem rechtlichen Patrioten hoch in Ehren gehaltene Bergbau verliert, darf ich aber so wenig schildern, als daß man bei meinem nun dringenden Ansuchen, wo ich mich fernerhin nicht durch Vertröstungen hinhalten laßen kann, es nicht um Gewinn eines kleinen Grundzinses und mir zustehenden Fuhrlöhnen angethan, sondern das goldene Sprichwort Suum ein que (?) aber so fest im Auge halte, als das drückende Gefühl nicht mehr ertragen kann, so frevelhaften Turbationes verschiedener dieser Eigenlöhner mich gegen alle Gesetze unterwerfen zu müßen. Warum hatts noch nie mit der Gnade Gottes ein Mißverständnis gegeben, welche alte Strich (?) Ja meine Wiesen zu Stolln (?) benutzt (?) Man hat Rücksprache mit mir genommen und ich habe, wo ich konnte, selbst mit Rücksprechung freudig zur Erleuchtung jedes Baues willig die Hand gebothen, ja Mittel und Wege angegeben, wo selbige mit leichten Kosten schnell befördert werden konnten; Und so erwarte um auch dann endlich einmahl meine gerechten Klagen nicht allein geneigtes Gehör finden mögen, sondern auch mir schleunigste Hülfe geschehe, und ich mich gern des Ausspruchs Eu. Hoch- und Wohllöbl. Bergamts unterwerfe, wenn Dieselben in der Sache zu entscheiden bedenklich finden sollten, da ich allerwegen Billigkeit und Recht voraussetzen kann. Übrigens bin ich zwar überzeugt, daß Eu. Hoch- und Wohllöbl. Bergamt nunmehr meinen rechten und ergebensten Bitten abhelflicher Maaßen geben wird, will jedoch blos eventualiter an ihre Königl. Majestät zu Sachsen meinen allergnädigsten Herrn wider Abschlagung meiner gehorsamsten Bitten allerunterthänigst appeliren und mit vollkommenster Hochachtung verharren. Haus Förstel, den 6.4.1825, Carl von Querfurth,
Uff, welch wortgewaltiger Sermon... Aber fassen wir´s kurz zusammen: Nach wie vor geht es dem Kläger also
Auch meines, nur ganz unmaßgeblichen Erachtens, sind das berechtigte Gründe für eine Beschwerde. Und daß die Bergleute auch gegenüber einem Herren von Adel ziemlich selbstbewußt auftraten und ‒ sagen wir´s mal auf Deutsch ‒ auch mal die große Klappe hatten, na, das geht natürlich gar nicht... Jedenfalls faßte man im Bergamt die Resolution, die erwünschte Lokalexpedition abzuhalten und bestellte darüber hinaus diejenigen Eigenlehner, die auf Grund und Boden des Förstelguts bauten, für den 20. Mai 1825 zwecks Verhörs in dieser Angelegenheit ins Bergamt ein (40014, Nr. 260, Blatt 27ff). Das waren zu jener Zeit vier Gruben, nämlich
und nicht zuletzt, wenngleich nicht auf Försteler, sondern auf der Flur des Pökelgutes, die Grube
Den Fahrbögen des Berggeschworenen Gebler zufolge wurde dieser vom Bergamt sofort ausgesandt, um sich ein Bild zu machen, was denn an der Beschwerde tatsächlich dran sei. Er notierte in seinen Fahrbögen dazu (40014, Nr. 273, Film 0024f): „Den 14ten April (1825) habe ich mich in den Raschauer, Langenberger und Schwarzbacher Reviertheil begeben und sämtliche daselbst befindliche Eisensteingruben in Ansehung von neuen abzusinkenden oder abgesunkener Schächte und der etwa hier oder da zu besorgen gewesener (?) begeben und die Anlage neuer Hilfsschächte zu Beförderung des Wetterwechsels besonders auf dem Grubengebäude Junger Johannes und Köhlers Fdgr. auf Raschauer Gebiet, Osterfreude Fdgr. Langenberg, Freundschaft, Gesegnete Anweisung, Großzeche, Fröhliche Zusammenkunft und Gabe Gottes im Tännicht nöthig befunden.“ Bey Friedrich Fdgr. zu Langenberg fand ich den ehemaligen alten Förderschacht ganz zugestürzt und völlig eingeebnet, einen zweyten verbühnt und eingeebnet und einen dritten zugebaut. Nur der jetzige zu dem dortigen Eisensteinbau führende Förderschacht ist gangbar und offen und ein zweyter, mit dem vorigen jedoch noch nicht in Verbindung stehender, ist mit einer Kaue versehen. (...)“ Auch am 11. Mai 1825 hat sich Herr Gebler (40014, Nr. 273, Film 0032) „nach Langenberg begeben, um mit dem dortigen Herr Besitzer des Ritterguthes Förstel einige nothwendige Rücksprache in Angelegenheiten des auf seinem Grund und Boden gangbaren Eigenlöhnerbergbaus zu nehmen.“ Selbstverständlich hat Herr Gebler dann auch „(...) der Generalbefahrung auf nachstehenden, auf des Ritterguthes Förstel Grund und Boden liegende Grubengebäude, als Osterfreude, Christbescherung, Gelbe Zweig und Friedrich Fdgr., ingleichen eines neu angefangenen, noch nicht bestätigten Versuchs Stöllnchens auf Eisenstein, so wie der Begehung deren Umgebürge über Tage und der Besichtigung der zu den genannten Gebäuden gehörigen Halden und Schächte beygewohnt.“ (40014, Nr. 273, Film 0034) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über diese, am 18. Mai 1825 stattgefundene
Lokalexpedition nicht allein, sondern auch über Betrieb und Zustand der
genannten Gruben, gibt die folgende Niederschrift ausführlich Auskunft,
die wir deshalb ebenfalls vollständig zitieren (40014, Nr. 260, Blatt 31ff).
Gegenwärtige waren dabei neben den o. g. Betroffenen und Rittmeister
von Querfurth, Bergmeister von Zedtwitz, Geschworener Gebler
und Bergamtsassessor Zeller.
Registratur auf dem Gebirge den 18. Mai 1825 „Es wurden die betreffenden Punkte, auf die der Rittmeister aufmerksam gemacht, in Augenschein genommen und mit den Eigenlöhnern die zur Ansprache gekommenen Zechen befahren. Anlangend hiernächst I. Den (...) zur Zeit allein bloser Versuch, noch nicht bestätigten und benannten Stolln, so ist derselbe am linken Ufer des Schwarzbachs gleich unterhalb des Ritterguths Förstel angesessen durch den herrschaftlichen Kalkbrenner Fickert und den Steiger Weisflog, Eigenlehner von Christbescherung gev. Fdgr. bereits circa 11 Lachter gegen Mittag in das sanft ansteigende Gebirge getrieben, hierbey auch schon nesterweise Brauneisenstein erobert worden, als worauf des Hauptabsehen des Unternehmens gerichtet gewesen. Das Bergamt fand diesen Stolln jedoch ganz passend gelegen, die ganz nahe vorliegenden Zechen Osterfreude gev. Fdgr. Christbescherung gev. Fdgr. Friedrich gev. Fdgr. und Gelber Zweig gev. Fdgr. damit zu lösen und die weniger benöthigte Wasserlösung, aber desto bedürftigere Wetterlösung zu verschaffen, damit aber den häufigen Absinken von Tageschächten lediglich letztern Zweck vorzubeugen und überhaupt hierbey mehrern und gründlicheren Aufschluß über das von den dasigen Eigenlöhnern zur Zeit in Abrede gestellte tiefere Niedersetzen und namentlich bis in die Stollnsohle der dort bebaut werdenden und vorkommenden Eisenstein und Braunstein Lagerstätte zu erlangen. Diese Aussichten veranlassten den Hrn. Rittmeister von Querfurth zu der Ausführung, sich mit den dermaligen Unternehmern gen. Stollnbetriebs wegen Abtretung desselben an ihn zur selbst eigenen Fortbringung oder wenigstens behufs eines gemeinschaftlichen Betriebes zu verständigen und resp. Vereinigen zu wollen und würde (?) auf ersterem Weg allen ferneren Differenzen qu. wahrscheinlich am gründlichsten und leichtesten vorzubeugen seyn. Im Übrigen beruhigt sich auch derselbe auf diesfallsige Vorstellungen des Bergamts, daß jener Stolln in dem jetzt ohnehin noch in der morgendlichen Seite liegen gelassenen Obst und Küchen Gartens, nach welchem selbiger eine mittagmorgendliche Richtung erst noch annehmen müßte, dort sicherlich 4 bis 5 Lachter Seigertiefe unter der Gebirgsoberfläche einbringe, daher nicht leicht ein Tagebruch entstehen wird, der ohnehin von den Unternehmern ohne Weiteres wieder Zuzufüllen sey. Bey II. Osterfreude gev. Fdgr. Befremdete es das Bergamt allerdings, daß der dasige Tageschacht unmittelbar an dem nach Mittweyda hinaus führenden Communicationsweg niedergebracht sey, inzwischen trug Hr. Rittmeister von Querfurth selbst sogleich vor, daß dies in Folge einer mit den Eigenlehnern dieser, am 8. April d. J. (...) erst bestätigt wordenden Grube getroffenen Übereinkunft geschehen, um den angrenzenden Feldgrundstück durch Anlegung eines Schachts in dessen Mitte und den nachherigen Haldensturz nicht noch ,ehr Schaden zuzufügen. Um solches auch, soweit uns immer möglich, für die Zukunft zu vermeiden, wies das Bergamt den von Eigenlöhner Steiger Kreher an, statt des 2ten Tageschachts, welchen derselbe wegen allerdings sehr merkbaren Wettermangels in seinen Grubenbauen bey circa 10 Lachter morgendlicher Entfernung von jetzigem Ziehschacht niederzubringen wünschte, zwar mit einem Schurfe allhier bis auf die, aus jenem Schachte gegen Morgen mit ziemlichen Ansteigen getriebenen Strecke niederzugehen, dann aber Wetterlotten oder dergleichen Röhren von etwa 4 Zoll im Durchmesser einzubauen, um selbige herum wieder völlig zuzustürzen und das etwa noch übrigbleibende wenige Gebirge auf der jetzigen Halde zu häufen, eine Ausführung, welche überaus wenig anlangen wird, da der vorhandene Tageschacht (...bei ?) der 1 Lachter hohen Halde nur 4½ Lachter tief ist, obgedachte Strecke aber wenigstens ½ Lachter bis unter die einzustoßenden Wettercanüle ansteigt, selbige mithin schwerlich über 3 Lachter lang zu werden brauchen. Es bezeugt auch Hr. Impetrant hierüber seine vollkommene Zufriedenheit, während auf der anderen Seite Steiger Kreher verspricht, diese Anordnung zu befolgen und in den nächsten Wochen ins Werk richten zu wollen. Die hier anfahrenden 2 Mann haben bis jetzt noch keinen ordentlichen Eisensteinbau etabliren können, indem sie gegenwärtig überall noch mit altem Mann umgeben sind, aus dem sie indeß doch schon eine nicht unerhebliche Quantität guten Brauneisensteins erobert haben. Zudem hoffen sie immer, bald ganze Mittel zu treffen. In Bezug auf III. Christbescherung gev. Fdgr. Ist zwar nicht zu verkennen, daß durch die dazugehörigen Halden, welche ohne Ausnahme in schönem jungen Holze liegen, theils schon mancher Schaden an selbigen verursacht worden, theils auch fernerhin durchaus nicht zu vermeiden ist, allein Hr. Impetrant macht hier keine Anstellungen, theils weil der vom Eigenlöhner, Steiger Weisflog doch einen gehörigen Plan verfolge und nach seinen Kräften noch mehrere Nachtheile rücksichtlich des Holzes und sonst vorzubringen bedacht sey, theils weil derselbe auf seinen alten Fundschacht sowie schon früher einen etwas mehr mittägig gelegenen alten Schacht durch hineinziehen der Halde, worauf auch bereits wieder junge Holzpflanzen zu sehen sind, eingeebnet habe. Von den noch offenen, auf 10 Lachter von einander entfernten und in der Stunde 6 stehenden zwey Tageschächten ist der abendliche blos des besseren Wetterwechsels und eines bey solchem noch vorhandenen kleinen Eisensteinmittels halber noch offen erhalten werdende 4 Lachter tief. Der morgendliche, zur Befahrung und Förderung benutzt werdende dagegen 5⅛ Lachter tief. Von diesem aus geht eine Strecke mit bedeutendem Ansteigen in den Stunden 2,3 und 6 gegen Mittag Abend und Abend 15 Lachter lang fort und bis an den dermaligen Bau. Dieser befindet sich auf einer der im Protokoll § 195 de anno 1820 beschriebenen Lagerstätten, welche hier ½ Lachter mächtig ist und Hornstein, Brauneisenstein und dergl. Ocker zur Ausfüllungsmasse hat. Obgleich Fahrende heut keinen Wettermangel hierselbst verspürten, so stellt sich selbiger jedoch bey wärmerer Witterung gar bald ein und nöthigt die Eigenlöhner, mehr in der Nähe des Ziehschachtes, und zwar bey ohngefähr 4 Lachter morgendlicher Entfernung von selbigem, sich anzulegen. Dies geschieht übrigens, wie Steiger Weisflog versichert, lediglich deshalb, damit er nicht nöthig habe, dem Herrn Grundbesitzer durch Absinkung eines neuen Tageschachtes an jenem Punkt Schaden zuzufügen, inmaaßen er an selbigen mit der Eisensteingewinnung sich nach den Wettern richte. Auf IV. Gelber Zweig gevierte Fdgr. Betreibt man bey 5 Lachter morgendlicher Entfernung vom östlichen Tageschacht von 4 Lachter Teufe ein Ort Stunde 11 gegen Mitternacht, vor welchem in der gestrigen Schicht außer minder gutem Brauneisenstein auch ½ Elle mächtiger Braunstein erbrochen worden ist, dessen Abbau man gegenwärtig beabsichtigt und womit 2 Mann beschäftigt sind. Auch bey dieser Zeche befindet sich, wie bey wohl allen dergleichen Gruben, die wegen Mangel an Stollen und regelmäßigen Grubenbetriebs sehr oft bey alldem noch wetternöthig sind, noch ein 2ter, bey etwa 10 Lachter abendlicher Länge niedergebrachter Tageschacht. Wenn nun auch Hr. Rittmeister von Querfurth wider diese beyden Schächte, die noch überdieß sowohl nach der Behauptung des conc. Eigenlöhners August Weisflog, als der bestimmenden Versicherung des Hrn. Geschworenen Geblers, stets zugedeckt sind, etwas mit Bestand nicht anzuführen vermag, so beschwert derselbe sich jedoch darüber, daß vor 4 – 5 Jahren bey dieser Zeche noch 5 Schächte offen gewesen, der eine inzwischen zwar von dem betreffenden Eigenlöhner zugefüllt worden wäre, nichtsdesto weniger aber ohnlängst eine neue Einsenkung allda stattgefunden habe und nur deshalb er gebeten haben wollte, deren Ausgleichung bergamtswegen anzuordnen. Es beträgt aber beredte Einsenkung etwa 3 Ellen im Durchmesser und deren Tiefe ohngefähr ebenso viel. Zwar können, wie dieß bey einem ähnlichen Falle auf Gnade Gottes gev. Fdgr. bey der im Jahr 1807 vorgewesenen commissarischen Revisionen ausgesprochen worden, die Grundbesitzer wohl eine Verbühnung oder Umzäunung der entstandenen Pinge, nicht aber gerade deren Einebnung verlangen, inzwischen soll dem Gesuche Hrn. Impetrantens, in Betracht der Geringfügigkeit des Gegenstandes und da auch der conc. Eigenlöhner sich dazu willig bezeigt, genüge geleistet werden. Dagegen ist dieß rücksichtlich mehrerer anderer kleiner Pingen in der Nähe herum, obschon auch über diese geäußert wird, daß ein Schaf beym hereinstürzen in selbige verunglücken könne, deshalb nicht zu ermöglichten, weil solche nicht im Felde von Gelber Zweig gev. Fdgr. liegen, vielmehr aus früheren Zeiten und von anderen hier ehedem gangbar gewesenen Zechen herrühren. Ganz anders hinwiederum verhält es sich auf V. Friedrichs gev. Fdgr. Wo man ziemlich ansehnliche Stücke Brauneisenstein gewinnt, außerdem dießfallsige Baue aber auch noch den Betrieb eines Ortes in Mittag Abend nach dem westlichen Tageschacht hin behufs besserer Wetterlösung beabsichtigt, und zwar in einer Teufe von 5 Lachter unterm Tage. Mit vollem Rechte führt Hr. Rittmeister von Querfurth über die auf dieser Grube bauenden Eigenlöhner, und zwar namentlich den Lehnträger Schubert bittere Klage und gegründete Beschwerde. Denn es giebt in deren Felde gegenwärtig außer zwey vor einiger Zeit zugestürzten Schächten 4 offene Tageschächte, welche innerhalb einer Länge von etwa 30 – 32 Lachter in dem Zeitraume von ein paar Jahren niedergebracht sind, und von welchen zur Zeit nur einer zu benutzen steht. Der 1te oder am weitesten gegen Abend gelegene Schacht liegt 3 Lachter von dem von Förstel nach Mittweyda führenden Communicationswege, ist früher 11 Lachter tief gewesen, gegenwärtig aber nur noch auf 6 Lachter Teufe offen. Die Zumachung desselben, so wie eines Tagesbruches unmittelbar in der Abendseite bemerkter Straße, die dadurch selbst gefährdet wird, hat Hr. Geschworener Gebler den conc. Eigenlöhnern zwar schon vor länger denn 1½ Quartalen aufgegeben, allein vergeblich. Auf dießfallsige Vorhaltung (?) entschuldigen sie ihre Unfolgsamkeit mit der Absicht, obgedachtes Ort nach diesem Schacht zu treiben, um besseren Wetterzug zu erlangen. Der 2te Schacht ist erst ganz neuerlich bey circa 3 Lachter morgendlicher Entfernung von jenem Communicationswege deshalb 3 Lachter tief abgesunken worden, weil wegen nicht gehörig unterhaltener Zimmerung der kaum 2 Lachter davon entfernte Fundschacht, über welchem die Kaue steht, zusammengegangen ist. Etwa 15 Lachter mehr morgendlich befindet sich der 3te Tageschacht, heute mit Schalbrettern, auf denen etwas Erdreich lag, leicht zugedeckt. Am morgendlichen Ende des Grubenfeldes 9 Lachter weiter von hier in Ost, stößt man auf den 4ten offenen Schacht, angeblich deshalb vor kurzem niedergebracht, um einen benachbarten Fundgrübner nicht in ihr Feld kommen zu lassen. Auch er war heute mit Schalbrettern zugelegt. Da nun sämtliche 4 Schächte an einer sehr gangbaren Straße und einem Fußsteige liegen, durch sie aber ein nicht unerheblicher Theil Waldboden der Holzbenutzung zur Zeit ganz entzogen und dem Herrn Grundbesitzer ohne allen und jeden zu billigenden Grund dadurch Schaden verursacht worden, auch Verunglückung von Menschen und Vieh gerade hier und besonders im Winter, zumal bey jenen sichtlich erst seit wenigen Tagen erfolgten Bedeckungen der Schachtmündungen, fast stündlich zu befürchten ist, überdieß aber auch der Lehnträger Schubert geradezu wider der unterm 27. November 1819 … ergangenen, ihm auch richtig behändigten bergamtlichen Anordnung, die alten entbehrlichen Schächte sofort entweder einzufüllen, oder gut zu verbühnen, ansonsten, falls sich hiermit säumselig oder sonst widerspenstig bezeigt werde, sich zu gewärtigen, daß solche Schächte auf der Contravenienten Kosten zugefüllt und verbühnt werden würden, gehandelt: So fand das Bergamt für ganz angemessen und nothwendig, dem conc. Eigenlöhner 1.) die Bezahlung der hiernach richtlich verwirkten Strafe von 5 Thl. – Gr. – Pf. an die Scheibenberger Bergknappschaftskasse zur dasigen (?) Session in No. 1te Woche künftigen Quartals Crucis, sowie 2.) die Zufüllung oberwähnter Tagebruchs an der abendlichen Seite des Mittweydaer Communicationsweges und die künftige und gehörige Verbühnung mit wenigstens 6 Zoll starken Hölzern samt deren Überstürzung des 3ten und 4ten Tageschachtes von Abend nach Morgen zu gerechnet, ohnfehlbar binnen dato und drey Tagen, (schwer leserlich ...bei Androhung von weiteren 5 Thl. Strafe?) zu bewirken, allen Ernstes aufzugeben, auch zu dem Ende den Hrn. Geschworenen Gebler zu veranlaßen, über die Befolgung dieser bergamtlichen Anordnungen zu wachen. Überhaupt aber fand das Bergamt bey sämtlichen sub. II. bis V. aufgeführten Zechen gar sehr zu (kritisieren?), A.) daß die dasigen Strecken mit bedeutendem, dem Wetterwechsel resp. sehr nachtheiligen und ganz hindernden Ansteigen, sowie auch die Baue selbst ohne die mindeste Regelmäßigkeit und ohne festen Plan betrieben sind, B.) daß die zum Ausbau benutzten Hölzer durchgehend halb gespalten, ohne Ausnahme aber, und ganz auffallend bey Friedrichs gev. Fdgr., wo ganz schwache Polzen zur Unterstützung des rolligen Deckengebirges angewendet sind, zu schwach bey dem vorhandenen, nicht unbedeutenden Drucke erscheinen, und C.) daß überall statt bergmännischer Fahrten gewöhnliche Leitern mit noch überdieß zum Theil sehr schwachen, runden Sprossen und dergleichen Schenkeln eingebaut sind. Zur Abstellung dieser schon früherhin oft gerügten Mängel erhielten die fraglichen Eigenlöhner die dießfalls nöthige bergamtliche Anordnung, der Hr. Geschworene Gebler aber die Veranlassung, auf deren Nachachtung ein wachsames Auge zu haben, und namentlich auch bey Aufnehmung einer neuen Grube schlechterdings auf Anschaffung und Einhängung ordentlicher Fahrten zu bestehen. Wie nun beym Schluß der heutigen Localexpedition Hr. Rittmeister von Querfurth noch um eine Abschrift gegenwärtiger Registratur gegen die diesfallsigen Gebühren gebeten, als hat derselbe auch gewünscht, daß die auf übermorgen, als dem 20. d. M. ... festgesetzten Verhörtermines behufs wo möglicher gänzlicher Beseitigung eingangs gedachter Differenzen wegen einer, morgenden Tages vorhabenden Reise nach Dresden und die Lausitz bis zu seiner im Monat Juni d. J. erfolgenden Rückkehr, von welcher er jedoch sodann das Bergamt noch in Kenntniß setzen wolle, aufgeschoben werden möchte: ein Gesuch, dem zu differieren das Bergamt unter diesen Umständen keinen Anstand mache, weshalb auch die conc. Lehnträger von der einstweiligen Aussetzung des auf übermorgen in dieser Sache anberaumten Verhörtermines (?) Kenntiß erhalten. So nachrichtlich
anhero bemerkt, wieder vorgelesen, genehmigt Diese Registratur wurde am 8. Juli 1825 ganz offiziell in Rittergut verlesen, damit auch wirklich jeder gleichen Bescheid bekam (40014, Nr. 273, Film 0046). Es geht doch nichts über Kommunikation... Bis auf Herrn Schubert auf der Friedrich Fundgrube (und einer mußte ja das schwarze Schaf sein) scheint doch bei den anderen vieren alles erst einmal in Güte geregelt worden zu sein. Bis auf die Sache mit dem Grundzins halt... Die Umsetzung der getroffenen Festlegungen hatte der Berggeschworene Gebler natürlich auch zu kontrollieren. So notierte er in seinem Fahrbogen vom 19. Mai 1825 (40014, Nr. 273, Film 0034), er habe sich an diesem Tage „(...) wiederum nach Langenberg begeben, um zu sehen, in wie weit von Seiten der dortigen Eigenlöhner, besonders zu Friedrich Fdgr. gehörigen, angefangen habe, den am gestrigen Tage erhaltenen bergamtlichen Anordnungen in Betreff des Verbühnens offener, nicht gangbarer Schächte, nachzukommen. Inzwischen fand ich die dortigen Eigenlöhner nicht gegenwärtig, obgleich der Anfang des Zubühnens der Sch#ächte in so weit begonnen, als der an der Straße liegende, gegenwärtig nicht gangbare, jedoch zu einer baldigen Verbindung mit dem ehemaligen Abbau bestimmte Schacht mit zwey Zoll starken und 3 Ellen langen Pfosten zugelegt und ohngefähr 10 Zoll hoch mit klaren Bergen überstürzt war.“ Eine Woche später, am 26. Mai 1825, war er erneut vor Ort und befand (40014, Nr. 273, Film 0035), „daß die dortigen Eigenlöhner (von Friedrich Fdgr.) die ihnen von Eu. Königl. Bergamte aufgegebene Verbühnung dreyer daselbst vorhandener, jetzo nicht gangbarer Schächte (wie oben beschrieben) verrichtet und dadurch diese Schächte wenigstens vor der Hand in nothdürftige Sicherheit gesetzt hatten...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für eine Weile blieb es ruhig in
Langenberg, nur über einen Bergmann Hubrig fand Herr Carl von
Querfurth 1827 wieder Grund zur Beschwerde (40014, Nr. 260, Blatt 38),
weil dieser auf seinen Feldern an der ,Kies Straße', die von Scheibenberg
nach Elterlein führe (den Straßennamen haben wir übrigens auch auf einem
Riß am Roten Hahn gefunden ?) einen
Schacht geteuft und ohne Abdeckung oder Umzäunung wieder liegen gelassen
habe: „Da nun solcher mehr einer Wolfsgrube als einem Grubenbau ähnelt
und mir direct und indirect täglich nachtheilig werden kann... so will ich
mich nicht
(nur) durch diese Anzeige auf jeden Fall sicher stellen, sondern
erlaube mir auch, hochgenanntes Bergamt gehorsamst zu bitten, genannten
Bergmann Hubrich allenthalben hierüber zu vernehmen und den Gesetzen gemäß
zu bestrafen...“
Das geht völlig in Ordnung, denn ‒ das hatte auch Geschworener Gebler ja so zum Ausdruck gebracht ‒ nach Einstellung des Bergbaus, und wenn´s nur ein Versuchsbau war, ist der Betreiber für die Wiederherstellung der Ordnung verantwortlich. In der Zwischenzeit fanden allerdings auch wieder eine ganze Reihe von Versuchsarbeiten und neuen Mutungen statt. Wir zitieren zusammengefaßt zunächst aus den Fahrbögen des Herrn Gebler für das Jahr 1826: „Desselben Tages (am 24.1.1826) bin ich ferner auf dem nicht weit von dieser Grube vom Dorfe (Langenberg) aus auf Entdeckung eines Eisensteinlagers angelegten Versuchsstolln gefahren, mit welchem zeither aber außer einigen einzelnen Stücken nichts fand, aber mittelst eines gegen Morgen angelegten Querschlages ein Trümchen Braunstein angefahren hat, weshalb die Grube des ehesten (?) bestätigt werden wird.“ (40014, Nr. 275, Film 0011) „Desselben Tages (am 28.2.1826) habe ich die Stelle besichtigt, wo man ohnweit des Grubengebäudes Osterfreude bey Langenberg mittelst eines kleinen, die Stelle eines Schachtes (anzielenden ?) Suchstollns ein Braunstein und Eisensteinlager angefahren hat und nunmehro eines Schachtes zur Förderung und zu dem erforderlichen Wetterwechsel bedarf.“ (40014, Nr. 275, Film 0021) „Dienstags, den 7ten März (1826) habe ich mich auf Köhlers Fdgr. bey Raschau begeben und wegen eingegangener Muthungen, welche auf das derselben benachbarte Feld gerichtet waren, das dieser Grube gehörige Feld vermessen.“ (40014, Nr. 275, Film 0022) „Desselben Tages (noch am 7.3.1826) habe ich zugleich noch mehrere der dortigen Eisensteingruben begangen und zugleich einen neuen Versuch im Tännicht, mit welchem man ein Eisensteinlager zwischen der Gesegneten Anweisung Fdgr. und Großzeche Fdgr. ersunken, so demnächsten bestätigt werden soll, ingleichen einen Schurf und Versuch bey Langenberg auf Braunstein, ingleichen einen alten Schurf und Versuch auf Braunstein ebenfalls daselbst, ersteren durch den Eigenthümer des Grund und Bodens selbst unternommen, letzteren auf des Ritterguthes Förstel Waldboden liegend und zum Wiederangriff bestimmt, besichtigt.“ (40014, Nr. 275, Film 0022) „Donnerstags, den 9ten März (1826) habe ich mich wiederum nach Langenberg zu begeben gehabt, um mit dem Herrn Rittmeister von Querfurth auf Förstel Rücksprache zu Beseitigung von Beschwerden zu nehmen, so von demselben gegen einige auf seinem Ritterguthsbezirke Versuche oder überhaupt Bergbau treibende Eigenlöhner, insonderheit gegen den Steiger Weißflog erhoben worden.“ (40014, Nr. 275, Film 0022) Oh, der Steiger Weißflog von Christbescherung Fdgr. schon wieder... Und Herr Gebler hatte noch mehr zu tun: „Desselben Tages (noch am 9.3.1826) habe ich das dem Grubengebäude Freundschaft Fdgr. im Tännicht und bey Förstel zugehörige Grubenfeld vermessen, da die genaue Bestimmung der Lage desselben wegen zweyer auf die nächste Umgebung dieser Grube eingegangenen Muthungen auf Braunsteinlager höchst nothwendig wurde.“ (40014, Nr. 275, Film 0022) Eine der hier gemuteten Gruben
taucht kurze Zeit später unter dem Namen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch das folgende Jahr 1827 blieb nicht
ohne Differenzen zwischen den Bergleuten und dem Grundbesitzer. Nachdem
Tauwetter und Niederschläge zu Problemen auf einigen der Gruben, sogar zum
Zusammenbruch eines Tageschachtes bei Friedrich Fdgr., geführt
hatten, planten die Betreiber von Osterfreude Fdgr. einen neuen
Tageschacht anzulegen, was sofort den Widerwillen des Herrn von
Querfurth hervorrief und mehrere Seiten in den Fahrbögen des
Geschworenen füllte: Am 6. April 1827 notierte Gebler (40014, Nr. 278, Film 0026f),
„habe ich mich wiederum nach Langenberg begeben und theils den Zustand
des bey Friedrich Fdgr. durch Thauwetter und Nässe entstandenen Tagebruchs
und was hier fernerweit zu thun, untersucht, theils die Stelle
besichtiget, wo der Eigenlöhner von Osterfreude Fdgr. in seinem ihm
verliehenen Felde einen neuen Schacht zu schlagen Willens ist, übrigens
aber wegen beabsichtigter gänzlicher Sicher- und Zufriedenstellung des
Herrn Besitzers und zu Verhütung von etwaigem Niedergehen einzelner
Stellen von der Oberfläche der Erde so wie zeitheriger Abbaue bis in die
Nähe des zeitherigen Tageschachtes völlig ausgestürzt hat, auch selbst
diesen noch ausstürzen will. Von alledem zu dem mehren Besten des Herrn
Besitzers, Rittmeister von Querfurth, unternommenen habe ich diesem zu
Vermeidung aller ferneren von ihm unaufhörlich und meist unbillig
erhobenen Beschwerden sogleich unendlich unterrichtet. Er erklärte
hierauf, er wolle sich – eine ganz unpassende Entgegnung – hinsichtlich
seines Entschlusses über die Anlage eines neuen Schachtes erklären, sobald
der obgedachte Eigenlöhner jenes Zustürzen des Schachtes vollbracht haben
würde. Wenn eine solche Beantwortung der ihm von mir gemachten
Bekanntmachung sich mit den für den Bergbau geltenden Verfassung und mit
den für solchen vorhandenen Gesetzen schon an sich nicht verträgt, so ist
solche hier noch viel unpassender deshalb, weil eben die Stelle, wo der
Herr Grundbesitzer den Bergbau eigenmächtig zu behandeln, ihn zu
erschweren oder ihn gar zu verhindern gedenkt, alten Bergbau enthält,
dessen Halden von ihm eingeebnet und zu Felde gemacht worden sind, wie
solches wenigstens eine glaubwürdige Person in Langenberg darthun und die
Personen, durch welche diese Arbeit verrichtet worden, (?)
behauptet.“
Das empfand man wohl im Bergamt genauso, kam schnell zu einer Entschließung und nur wenige Tage später hielt Herr Gebler fest (40014, Nr. 278, Film 0031): „Donnerstags, den 12ten April, Grüner Donnerstag. Nachmittags habe ich mich in Dienstgeschäften in Betreff der von dem Herrn Rittmeister von Querfurth auf Förstel gegen die Abfuhr des Eisensteins von Osterfreude Fdgr. zu Langenberg in das Hammerwerk Großpöhla erhobenen Beschwerde und daraufhin nach St. Annaberg begeben, um hierüber für den sogleich mit zur Stelle gebrachten Eigenlöhner die Erklärung des Herrn Bergcommissionsraths von Zedtwitz zu vernehmen.“ Außerdem hatte Carl Edler von Querfurth aber noch weitere Beschwerde vorzubringen, weswegen auch Herr Gebler am 20. April erneut vor Ort gewesen ist (40014, Nr. 278, Film 0033f): „Desselben Tages (am 20.4.1827) habe ich mich wiederum nach Langeberg begeben, theils die nach Angabe des Herrn Rittmeisters von Querfurth in dem Bezirk der Grube Neu Geschrey Fdgr. neuerlich entstandenen, seinem Benehmen nach, sehr erheblichen Schaden zu besichtigen, theils um zu untersuchen, ob man etwas von Seiten des Besitzers sowohl als der sich mit Muthung gemeldeten Eigenlöhner vor Eingang der darüber aberwerteten bergamtlichen Resolution, also ohne Erlaubnis dazu abzuwarten, Versuchsarbeiten gemacht habe. In Betreff des letzteren Umstandes fand ich für heut noch alles unverletzt. Was aber die bitteren Klagen des Herrn Grundbesitzers über den erstern Gegenstand anlangte, so ergab sich nachstehendes. 1) Etwa 3½ Ltr vom Mundloche der (?) hinan befand sich fast ganz am Rande des dortigen Rübsenfeldes eine schräge Vertiefung, 3½ Ellen lang, 2¾ Ellen weit an der einen Seite 10 Zoll und an der anderen 31 Zoll tief. Sodann zeigte sich 2) von dieser 7¾ Lachter das Feld hinauf in der Richtung nach dem Schacht zu in demselben Rübsenfelde eine runde trichterförmige Vertiefung, etwa 1 Ltr im Durchmesser und gegen 3 Ellen tief. Diese war unter allen die bedeutendste. Ferner wurde eine 3) in weniger Entfernung von dem Schachte, links von der angegebenen Richtung abwärts, in dem anliegenden Gras- und Baumgarten eine kleine runde Vertiefung gezeigt, 1 ½ Ellen lang, 1 Elle weit und 22 Zoll tief. Endlich lag 4) noch einige Schritte weiter herauf in demselben Garten noch unbedeutende Vertiefung, (?) nicht einmal der Rasen des Gartens verschwunden, sondern hatte sich nur gesetzt. Es befand sich dieselbe kaum 3 Ellen lang, 2½ Ellen breit und nicht einmal 1 Elle tief und ich würde solche gar nicht, ohne gegebene Erklärung, für eine Beschädigung angesehen haben. Von der letzteren behauptete der Lehnträger der Grube, Stgr. Weißflog, gradzu, es liege solche gar nicht auf seinen Bauen. Alle diese Vertiefungen können übrigens von zwey Mann in Zeit von 3 Stunden zugeworfen und eingeebnet werden, auch würde solches bereits geschehen seyn, wenn man nicht Seiten des Lehnträgers neue Beschwerde in Betreff der dortigen mehrern Beschädigung des Rübsens besorgt, hiernächst aber auch noch durch Wegnahme der Arbeiter dieser Grube durch den Herrn Grundbesitzer zum Betrieb seines Kalkbruches und Kalkofens, was diese gewöhnlich zu besorgen haben, verhindert worden wäre. Unterdessen wird der Lehnträger sofort für die Beseitigung dieser Mängel Sorge tragen. Hierbey habe ich noch zu bemerken, daß wenn hier und da in des Herrn Grundbesitzers Felde sich etwas senkt, was bey den bisherigen Thauwetter gar nicht zu vermeiden (?) ist, solches nicht allerorten den jetzt bauenden Eigenlöhnern zur Last geleget werden kann, inmaßen sich unter seines Feldes Oberfläche alter Bergbau befindet und sowohl von seinem Herrn Vater als von ihm Halden eingeebnet worden sind, was Stgr. Weißflog darthun zu können behauptet.“ Nun war es vielleicht auch nicht gerade die klügste Idee der Eigenlehner, ausgerechnet Bergarbeiter quasi ,im Nebenjob' auf ihrer Grube anzunehmen, die eigentlich beim Grundbesitzer als Kalkbrecher angestellt sind... Daß Witterungsunbilden Schäden verursachen ‒ namentlich auch in diesem so tagesnahen Bergbau ‒ war nichts Neues. Für deren Beseitigung haftete auch damals schon der Betreiber der fraglichen Grube. Ob sich der Gutsbesitzer also immer auf's Neue nun zu Recht oder zu Unrecht beschwerte, darüber bilde sich jeder Leser selbst ein Urteil.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber daneben gab es auch 1827 weitere
Erkundungsarbeiten auf den Fluren des Rittergutes Förstel, was einen
Landwirt zweifellos verdrießlich stimmen kann. So lesen wir im Fahrbogen
vom 18. April dieses Jahres (40014, Nr. 278, Film 0033),
daß Herr Gebler an diesem Tage
„jenseits Langenberg und des Ritterguthes Förstel auf des letzteren
Fluren eine Stelle an der sogenannten Kirchstraße besichtigt, wo sich
Eigenlöhner zu einem Versuch auf einem daselbst vorhandenen, schon vor
vielen Jahren einmal erschürften Eisensteinlager gemeldet und Muthung
eingelegt hatten, woselbst aber auch noch nach der von ihnen erfolgten
Muthung der Herr Besitzer des Ritterguthes einen Versuch machen zu wollen,
schriftlich erklärte, dieses Vorhaben auch schon früher, jedoch ohne alle
Muthung und wie sich in der Folge zeige, in der Meynung, als Grundbesitzer
ein Vorzugsrecht geltend machen zu können, mündlich genannt hatte. Auch
habe ich desselben Tages eine Anzeige über diesen Vorfall an Eu. Königl.
Bergamt gefertiget und an dasselbe übersendet.“
Der Herr von Querfurth wird erneut selbst als Bergbautreibender aktiv ? Aber dabei umgeht man doch bitte um Gottes Willen nicht das königlich sächsische Bergamt ! Letzteres entschied natürlich in einem solchen Fall auch gegen den Grundbesitzer und so reiste Herr Gebler kurz darauf erneut nach Langenberg, um die Sache zu klären (40014, Nr. 278, Film 0035): „Montags, den 23ten April habe ich mich nach gestern erfolgtem Eingang der Verordnung Eu. Königl. Bergamtes an mich in Betreff der mehrgedachten, zur Untersuchung auf Eisenstein bestimmten Stelle an der Kirchstraße bey Langenberg begeben, nachdem ich den Muthern, Weißflog und Consorten, auf deren Anfrage darüber bereits am heutigen Morgen die bergamtliche Erlaubnis bekannt gemacht hatte. Hier fand ich nun diese Stelle von beyden Partheyen zugleich in Angriff genommen. Einmal nämlich durch Bergarbeiter, welche durch erfolgte Anlegung von Seiten des Herrn Rittmeisters von Querfurth einen Schurf von etwa zwey oder drey Lachtern niedergebracht, zweytens durch diejenigen Eigenlöhner, welche diese Stelle zuerst gemuthet und gleichfalls, in geringer Entfernung von jenem, einen Versuchsschacht angefangen hatten. Den Inhalt der erhaltenen Verordnung machte ich den Anwesenden und für den abwesenden Herrn Rittmeister dessen seine Stelle vertretenden (Schwager ?), dem Herrn von Egidy´, bekannt, vermaß hierauf den Muthern das begehrte Feld verliehen mittelst Kompaß und Kette, gab den Arbeitern des Herrn Grundbesitzers das Aufhören mit ihren Arbeiten auf, ließ durch diese selbst ihren aufgelegten Rundbaum ausheben und ließ diesen nebst Seil und Kübel (?) in die Wohngebäude des Ritterguthes zur Aufbewahrung tragen.“ Am 27. April 1827 war der Geschworene noch einmal vor Ort (40014, Nr. 278, Film 0036), „in weiterer Verfolgung der dortigen Versuchsangelegenheiten auf Eisenstein und weiteren deshalb erfolgten bergamtlichen Auftrages wegen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schließlich wurde es Herrn von Querfurth aber wieder zu bunt und am 4. Juli 1832 wandte er sich wieder schriftlich an das Bergamt, wobei es erneut um den Grundzins auf Eisenstein, Braunstein und Flöße ging, den das Bergamt doch endlich einmal ermitteln solle und den ihm die Eigenlehner doch zu entrichten hätten (40014, Nr. 260, Blatt 40ff). Gleich auf dem ersten Blatt dieses Schreibens hat jemand mit Bleistift zur Frage, welcher Grundzinses ihm denn nun zustehe, am Rand notiert: „an und für sich nichts, denn beim Bergbau ist der Landesherr Grundeigenthümer, nicht der Grundbesitzer.“ Auch über die Grubenbetreiber fand Herr Carl von Querfurth zumeist nur schlechte Worte: Der Eigenlöhner Haustein betreibe „planlose Wühlerei“ und habe ihm wieder ein Stück Wald verwüstet, gleich neben dieser Grube hat abermals der Steiger Reppel einen Schacht geschlagen „und scheint sich den liebenswürdigen Bergbau Hausteins zum Vorbilde machen zu wollen.“ Nur verhaltenes Lob klingt aus diesem Satz heraus: „Soviel ich auch immer Nachtheil leide, so will ich doch für jetzt über die Eigenlöhner Weisflog auf gelbem Zweig, Schubert auf Friedrichs Fdgr., was den Betrieb anbelangt, keine fernere Beschwerde führen, da ich gewiß nicht querulire, allein ein Grundzinsabtrag muß doch endlich einmal ausgemittelt und mir zu Theil werden.“ Entschädigungszahlungen wollte hier jedenfalls kein einziger freiwillig leisten... Herr Gebler schrieb wieder eine lange Stellungnahme, doch irgendwie scheinen der neue Geschworene und der Gutsbesitzer nicht miteinander zu können... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl bei vielen schon aktiven Gruben
des Reviers schon ab der zweiten Hälfte der 1820er und noch anfangs der
1830er Jahre ein Preisverfall und Absatzmangel beim Braunstein beklagt
wurde, nahmen die Schürfversuche und Mutungen (auf beide Erze) keineswegs
ab, wobei auch Streitigkeiten zwischen den Schürfern und Mutern
untereinander natürlich
nicht zu vermeiden waren. So berichtete der Geschworene am 9. Januar 1834
in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 289, Film 0003),
er habe „eine Besichtigung
zweyer von verschiedenen Personen und Consortschaften auf Eisenstein und
Braunstein gemachter, einander aber nahe liegender Feldstellen in Ansehung
der von beyden deshalb erhobener Beschwerden und Klagen über
Beeinträchtigungen angestellt und die deshalb nöthig gewordenen
Untersuchungen und Erörterungen vorgenommen, sowie die dabey zur Sprache
kommenden Maaßverhältnisse mit Hülfe der Kette mir zu verschaffen
gesucht.“
Noch mehr verdeutlich die folgende Notiz im Fahrbogen die entstandene Situation (40014, Nr. 289, Film 0024): „Am 24ten April habe ich die zwischen Langenberg und dem Tännicht gelegenen Eigenlöhner Gruben dieses Reviertheils, aber besonders wegen der vielen daselbst aneinander gereihten, von Eigenlöhnern unternommenen Schurfversuchsarbeiten, zugleich auch noch besonders des Umstandes wegen, ob man auch überall die angefangenen Schurfschächte zur Verhüthung von Unglücksfällen gehörig verwahrt habe, besucht und, wie schon öfter, das bereits vor mehrern Jahren erlassene bergamtliche, sehr strenge Anbefohlniß wiederholend, eingeschärft und vor Strafe gewarnt.“ Nur wenige Tage später (am 2. Mai) war Herr Gebler erneut vor Ort und hat die „in einer vom Tännicht bis Langenberg fortlaufender Reihe umgehende, auf Braunstein unternommenen Versuchsarbeiten besehen und insonderheit gegen das nächtliche Offenlassen der Schürfe und Schächte nachdrückliche Ermahnungen und Warnungen ertheilt.“ (40014, Nr. 289, Film 0027) Tatsächlich sind im Jahr 1834 eine ganze Reihe neuer Gruben ins Leben gerufen oder wieder aufgenommen worden, nämlich ab Mai diesen Jahres (40014, Nr. 289, Film 0027):
Diesen folgten im August 1834 noch (40014, Nr. 289, Film 0043):
Aus der Erfahrung früherer Zeiten, daß man sich mit zu kleinen Grubenfeldern selbst das Leben schwer mache und die Erzlager hier höchst unregelmäßig in der Fläche verteilt sind, wurden nun ausnahmslos gevierte Fundgruben bzw. Maße gemutet. Das bewirkte natürlich umgekehrt aber auch eine größere Flächeninanspruchnahme und brachte keinesfalls mehr Freundschaft mit dem Grundbesitzer... Der erhob offenbar auch umgehend wieder Beschwerde hierüber und der Geschworene mußte sich am 4. Juni 1834 „wegen von dem Herrn Rittmeister von Querfurth bey Eu. Königl. Bergamte über angebliche Ungebührnisse der auf Försteler Gebiethe bauenden Eigenlöhner erhobenen Beschwerde auch auf die Besitzungen desselben begeben, auch Erkundigungen deshalb einzuziehen mich bemühet, übrigens mich nach der Zeit der Anherkunft des Herrn Grundbesitzers oder ob derselbe vielleicht schon jetzt anwesend sey, befragt, um mir von demselben die Stelle, weshalb er sich beklagt, zeigen zu lassen. Inzwischen wollte von dem allen niemand etwas wissen und so mußte ich mich unverrichteter Sache wieder entfernen, was auch bereits früher geschehen war.“ (40014, Nr. 289, Film 0031) Am 5. Dezember 1834 hat Herr Gebler dann aber erneut „mehrere Braunstein- und Eisensteingruben der Schwarzbacher und Langenberger Revierabtheilung, zum Theil wegen gesuchter Bestätigungen besucht.“ (40014, Nr. 289, Film 0064) Und nur einen Monat später, am 19. Januar 1835, hat Herr Gebler wieder notiert (40014, Nr. 289, Film 0070), an diesem Tage „habe ich wegen gesuchter Bestätigungen gemuthetes Grubenfeld betreffend, nicht minder wegen gesuchter Erlaubnis, schürfen zu dürfen, die nöthigen Besichtigungen und Untersuchungen bey Langenberg auf Grund und Boden des Ritterguths Förstel... unternommen.“ Am 28. Januar 1835 (40014, Nr. 289, Film 0071) hat der Geschworene „für diejenigen Schürfer, welche bey Langenberg schürfen wollen, nachdem von Eu. Königl. Bergamt denselben ein Schurfzettel ertheilet worden, zu Vermeidung unnöthiger Benachtheiligungen des Grundbesitzers die nöthigen Anweisungen an Ort und Stelle gegeben.“ Schon am 13. Februar 1835 hat der Geschworene das Revier wieder „wegen zu unternehmender Schürfarbeiten besichtigt.“ (40014, Nr. 289, Film 0075) Im Fahrbogen auf den 19. Februar steht dann zu lesen, er habe „in Betreff gesuchter Bestätigung eine Besichtigung auf des Ritterguthes Förstel Grund und Boden, ingleichen eine zweyte wegen einiger Bergarbeiter vorhabende Absicht auf Schürfen ebendaselbst abgehalten.“ (40014, Nr. 289, Film 0075)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwar hielt man seitens der Bergbehörde nach wie vor das alles für in Ordnung, denn Herr Gebler schrieb in seinem Fahrbogen vom 25. Februar 1835 (40014, Nr. 289, Film 0076) nieder, er habe sich an diesem Tage „nach Langenberg zu Beaugenscheinigung verschiedener Schurfverhältnisse... begeben, und gefunden, daß sich gegen die Ordnungsmäßigkeit des Betriebes etwas nicht einwenden lasse.“ Die Grundbesitzer aber sahen
das aus durchaus nachvollziehbaren Gründen ganz anders. Anfang des Jahres
1835 erhob der Besitzer des Hammerguts
Und: „Man schürft hier ohne Meldung beim Grundbesitzer, man setzt Haspeln auf und treibt allen Bergbau ohne Muthung und Verleihung, man verläßt den Bau, so daß der Grundbesitzer nicht möglich wird, auszumitteln, wer ihm den großen Nachtheil zugefügt...“ Dieses Schreiben ging nur einen Tag später, als dasjenige von Herrn Meyer im Bergamt ein. Er beschwerte sich jetzt auch, daß nicht einmal das Bergamt sich mit dem Grundbesitzer bespreche, wenn es neue Schächte zulasse, und führte an, es habe bei Herrn Geschworenen Schmiedel früher immer mündliche Rücksprache gegeben. Herr Gebler hingegen speise gemeinsam mit den Bergleuten in der Förstelschänke.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Aufforderung des Bergamtes folgend, stellte Herr Gebler am 16. April 1835 zunächst mal wieder zusammen, welche Gruben überhaupt zurzeit auf diesen Fluren umgängig seien (40014, Nr. 260, Blatt 62f) und allein auf Förstel'er Grund waren es demnach inzwischen sechs geworden (und ein neuer Schürfer): „Der Veranlassung E. Königl. Bergamtes gemäß zeige ich schuldigst hiermit die anjetzo auf dem Bezirke des Ritterguthes Förstel und auf dem des Hammerguthes Tännicht bey Schwarzbach theils Bergbau treibenden, theils schürfenden Eigenlöhner und Bergarbeiter an. A) Auf des Ritterguthes Förstel Grund und Boden
B) auf des Hammerguthes Tännicht Grund und Boden
Vor zehn Jahren waren auf Förstel'er Flur nur vier Gruben in Umgang. Die im Tännigwald hat damals keiner gezählt, vielleicht deshalb, weil der Besitzer des Tänniggutes, Herr Meyer, ja mit Meyers Hoffnung Fundgrube auf seinen Fluren selber mitmischte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Bergamt sah man sich durch die
erneute Beschwerde jedenfalls wieder veranlaßt, die Sache selbst in
Augenschein zu nehmen. Dem hatte natürlich auch der Berggeschworene
Gebler beizuwohnen (40014, Nr. 289,
Film 0084). Auch zu dieser Lokalexpedition gibt es wieder eine
ausführliche Niederschrift (40014, Nr. 260, Blatt 70ff) und
schau an: Jetzt endlich
einigte man sich auch auf eine Taxation der Entschädigung für die durch
den Bergbau in Anspruch genommenen Flächen...
Registriert auf dem Gebirge, den 28. April 1835 Gegenwärtig
„Nachdem von dem Rittmeister Edeler von Querfurth auf Förstel und Langenberg unter dem 19. März (...) dem Bergamte mehrere Beschwerdepuncte in Betreff des auf Försteler Wald und Feldboden gangbaren Eisenstein- und Braunstein Bergbaus in Schriften vorgetragen und um deren Abhülfe gebeten worden, so hat sich das Bergamt veranlaßt gesehen, zu deren Eruirung auf den heutigen Tag eine Localexpedition anzuberaumen, bey welcher, nachdem sich resp. auf beschehene Ladung ad marginem benannte Interessenten an Ort und Stelle eingefunden hatten, und nach geschehenem allgemeinen Vortrag der Sache, nachstehendes zu bemerken war. Wenn sich nun der Herr Rittmeister von Querfurth insbesondere darüber beschwerte, daß seiten der Bergbauenden wohl unnöthiger Weise eine zu große Anzahl von Tageschächten abgesunken und hierdurch von solchen ein größeres Terrain eingenommen und der Cultur entzogen werde, als zum Bergbau unbedingt erforderlich sey, ferner daß Seiten der Eigenlöhner nicht nur viele der verlaßenen Schächte ohne Bedeckung und sonst gehörige Verwahrung gelassen und auf diese Weise, so wie auch durch unnöthige Einebnung der verlassenen Schächte Gelegenheit zu Unglücksfällen gegeben und der Waldung nicht unbedeutender Schaden zugefügt, übrigens aber ihm als Grundbesitzer eine Entschädigung deshalb und wegen des Haldensturzes zur Zeit noch nicht geleistet worden sey, so war zwar Sache des Bergamtes zu entgegnen, daß die Beschaffenheit des dasigen Eisenstein- und Braunstein Bergbaus wegen der Statt findenden großen Wetternöthigkeit ein größere Anzahl von Schächten erfordere, als dieß sonst der Fall sey, daß jedoch auf thunlichste Verminderung und resp. Vermeidung derselben, schon deshalb Rücksicht genommen werden würde, um das zum Ausbau nöthige Schachtholz möglichst zu sparen, daß ferner auf zweckmäßige Verwahrung der gangbaren so wie auf die Einebnung der auflässigen Schächte, da solches bey deren geringer Teufe der Verbühnung vorzuziehen und gerade auch zu kostbar sey, thunlichst gesehen, namentlich aber darüber streng gewacht werden solle, daß ohne Vorwissen und nach erfolgter Besichtigung seiten des Refiergeschworenen zu ertheilende Genehmigung des Bergamtes kein neuer Schacht niedergebracht werde, hierbey auch das Interesse des Hrn. Grundbesitzers, so weit solches mit dem Grubenbetrieb nur irgend zu vereinigen sey, gewiß berücksichtiget werden würde. Zudem ward in Gegenwart des Hrn. Grundbesitzers den sämtlichen Eigenlöhnern eröffnet, daß das Bergamt beschlossen habe, durch den herrn Geschworenen Strödel (?) über den gesamten Langenberger, Försteler und Tännichter Eisen- und Braunstein Bergbau einen speciellen Markscheiderriß fertigen zu lassen, nicht allein, um über das bereits abgebaute und das noch frische Feld eine übersichtliche Nachweisung zu erlangen, sondern auch, namentlich um etwaigen Felddifferenzen thunlichst vorzubeugen und einen regelmäßigen und mithin auch haußhälterischen Streckung des Grubenfeldes zu ermöglichen. Wenn nun hiermit sämtliche Lehnträger, das Zweckmäßige dieser Veranstaltung (?) einsehend, völlig einverstanden waren und zu den dießfallsigen Kosten, antheilig nach der Größe des Grubenfeldes beytragen zu wollen, sich nicht weigerten, so spendete namentlich auch der Hr. Grundbesitzer diesem Vorhaben seinen Beyfall. Als man nun nach diesen Präliminarverhandlungen zur speciellen Besichtigung der von den einzelnen Gruben benutzt werdenden Tageräume, insbesondere behufs einer dießfallsigen Ausmittelung eines dem Grundbesitzer von den Eigenlöhnern zu (?) Entschädigung verschritt, so hatte sich zuvörderst auch das Bergamt dahin auszusprechen, daß diese Entschädigung nicht, wie auch in Antrag gebracht wurde, nach der Höhe der zu erzielenden Production der Gruben sich zu richten habe, sondern daß hierbey lediglich die Größe der von letzteren benutzt werdenden Tageräume und das hierdurch dem Grundbesitzer zugefügten Schadens (?) dienen könne. Anlangend zunächst I. Gelber Zweig gev. Fdgr. Welches Berggebäude an der abendllichen Seite des von Mittweida nach Förstel führenden Communicationsweges liegt, so war, da die zu solchem gehörigen zwey Tageschächte des Wetterwechsels wegen für unentbehrlich zu achten waren, etwas besonderes weiter nicht zu bemercken, als daß der Lehnträger Weisflog mit Genehmigung des Hrn. Rittmeisters von Querfurth sich zu einer vierteljährlich zu gewährenden Entschädigung kam man auf einen vierteljährlichen Satz von Entschädigungsleistung von – Thl. 6 Gr. – Pf. für die einhabenden Haldenräume verstand. Bey II. Friedrich gev. Fdgr. Welche sich an die morgendliche Markscheide der vorigen Grube anschlileßt, war dagegen nicht zu verkennen, daß seiten der Eigenlöhner ein größerer Raum zum Haldensturz, Holzplatz und Sturzplatz für den gewonnenen Eisenstein und Braunstein benutzt werde, als hierzu unbedingt nöthig wäre, obschon nur zwey offene gangbare Tageschächte wahrzunehmen waren, welche sich an der abendlichen Seite des Grubenfeldes befinden. Wenn nun schon diese beyden Schächte auch für die folge beyzubehalten seyn werden, so wurde doch dahin Veranstaltung getroffen und dem Lehnträger Korb aufgegeben, daß der vom oberen oder dem Wetterschachte noch einige Lachter gegen Morgen befindliche, zum Holz- und Sturzplatz benutztt werdende Raum, auf welchem sich auch eine Kaue zur Aufbewahrung des gewonnenen Braunsteins befindet, im Laufe jetzigen Quartals (?) geräumt und qu. Kaue auf den Haldenraum des oberen Wetterschachtes verlegt werde. Eben so wurde auch der Lehnträger Korb angewiesen, einen am morgendlichen Ende des Grubenfeldes befindlichen, seit mehreren Jahren mit Holz verbühnten ungangbaren Tageschacht, binnen eben dieser Frist zuzustürzen und einzuebnen, außerdem er zu erwarten habe, daß solches auf seine Kosten durch das Bergamt bewerkstelligt werde. Übrigens aber erbot sich Lehnträger Korb zu Leistung einer Entschädigung von vierteljährlich – Thl. 6 Gr. – Pf. an den Hrn. Grundbesitzer. III. Gott segne beständig gev. Fdgr. Ebenfalls in Försteler Waldung, und zwar weiter gegen Morgen gelegen, hält zwar ebenfalls des Wetterwechsels wegen zwey Tageschächte offen, es fand sich jedoch das Bergamt veranlaßt, den Lehnträger Bach dahin anzuweisen, daß der untere Tage- oder Fundschacht, welcher ohnedieß nur 4 Lachter Teufe hat, nachdem in solchem dauerhafte Wetterlutten eingelassen und bis an den Tag geführt worden, wiederum zugestürzt werde, wozu ebenfalls bis Schluß jetzigen Quartals Frist gegeben ward. In Betreff der an den Hrn. Grundbesitzer zu gewährenden Satz von – Thl. 4 Gr. – Pf. überein. Anlangend ferner IV. Ullricke gev. Fdgr. So war namentlich in Betreff des in der 3ten untern abendlichen Maaß nach Hausteins Hoffnung Fdgr., welche sich an die mittägliche Seite von Gott segne beständig gev. Fdgr anschließt, begonnenen Baues Seiten des Bergamtes auffällig wahrzuehmen, daß von dem Lehnträger Chrisiamnn Gotthold Weisflog, bey ca. 6 Lachter mittäglicher Entfernung vom Wetterschachte letztgedachter Grube ein 3 Lachter tiefer Tageschacht niedergebracht war, von welchem aus derselbe ins? qu. Maasener Feld gegen Mittag hin zu bauen gedachte. Wenn nun solches zu Vermeidung unnöthigen Holzausbaus, so wie zu mehrer Schonung des Grundbesitzers, zweckmäßiger von dem zu Gott segne beständig Fdgr. gehörigen Förderschachts aus erfolgen kann, so erhielt der Lehnträger Weisflog mit Zustimmung der Eigenlöhner nurgedachter Grube die Anweisung, in besagtem Schachte mit seinem Feldorte sich zu lagern, und selbiges so weit dieß ohne einen weiteren Wetterschacht nur irgend möglich seyn wird, gegen Mittag ins Feld zu treiben, übrigens aber den nun abgesunkenen Hausteins Hoffnung 3tes Maasens Tageschacht sofort und längstens bis Schluß jetzigen Quartals wieder zuzufüllen, wobey sich zugleich das Bergamtt genöthiget sah, dem Lehnträger Weisflog wegen etwa von solchem bezeigter Widersetzlichkeit für den Unterlassungsfall mit 5 Th. – Gr. – Pf. Strafe zu bedrohen. Übrigens sollte ernannter Weisflog wegen der zu Ullricke Fdgr. und Maaßen benutzten Tageräume einen vierteljährlilchen Abtrag von – Thl. 6 Gr. – Pf. an den Hrn. Grundbesitzer zu entrichten haben. In Betreff des Berggebäudes V. Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. War etwas weiteres hier nicht zu bemercken, der Hr. Rittmeister von Querfurth versicherte, sich wegen eines Abtrages mit Herrn Factor Haustein bereits privatim verglichen zu haben. Demnächst war noch in Ansehung nachbenannter Schürfe und zwar hinsichtlich VI. eines von Christian Friedrich Wilhelm Grund aus Grünstädtel, infolge einer auf Ullricke obere nächste Maaß eingelegte Muthung, geworfenen Schurfe zu bemercken, daß solcher Schurf, welcher nicht allein bereits eine Teufe von 5 Lachtern erlangt hat, sondern von welchem aus auch in dieser Teufe ein Versuchsort 4 Lachter gegen Mitternacht bis an das daselbst hereinkommende Braunsteinlager getrieben ist, und daher wohl die Grenze einer blosen Schurfarbeit bereits überschritten hat, in ungefähr 8 Lachtern nördlicher Entfernung vom Waldsaum, mitten im Kleefeld niedergebracht worden ist, obschon zu mehrer Schonung des Grundbesitzers dieser Bau weiter südlich hätte unternommen und dabey der Feldboden hätte vermieden werden können. Wie nun hierüber Hänel allen Ernstes constituirt und zugleich selbigen seine dießfallsigen Entschuldigungsgründe als unzureichend widerlegt wurden, so war zuvörderst demselben aufzugeben, das gemuthete Feld sich unverzüglich verleihen zu lassen, widrigenfalls aber den Bau aufzugeben und dann die geworfene Halde gehörig wieder einzuziehen, für den Fall des Fortbetriebes aber wurde auf den Antrag des Herrn Grundbesitzers für die Benutzung des sofort abgeschätzt wordenen Haldenraumes ein Abtragsquantum von quartaliter – Thl. 12 Gr. – Pf. festgestellt, welches gleich den obenbestimmten Entschädigungsquantum von Anfange jetzigen Jahres an zu leisten ist. Endlich hatte man noch VII. einen von Gottlieb Friedrich aus Langenberg und Cons. unterhalb Ullricke Fdgr. an dem von Förstel nach Tännich und Schwarzbach führenden Fahrwege geworfenen Schurf zu besichtigen. Da nun diese erst begonnen, von dem Hrn. Grundbesitzer aber zur Zeit behindert werdende Schurfarbeit ein günstiger Erfolg durchaus nicht abzusprechen war, so war gegen deren Fortstellung durchaus kein Bedenken, zumahl der Herr Rittmeister Querfurth von Seiten des Bergamtes darüber sicher gestellt wurde, daß dieser Schurf, sobald mit solchem das hier befindliche Lager unbauwürdig getroffen würde, von den Schürfern wiederum eingeebnet und der eingehabte, unbedeutende Raum in den vorigen Stand gesetzt werden sollte. Wie sich nun die resp. Herren Interessenten hiermit völlig einverstanden, auch resp. dem Veranstaltetem gebührend nachkommen zu wollen erklärten, also ist gegenwärtige Registratur geschlossen, nach Wiedervorlesen genehmigt und mitunterzeichnet worden.“ So nachrichtlich uts. Julius Bernhardt von Fromberg, Assessor Bergassessor von Fromberg wurde übrigens nach dem Tod seines Vorgängers, Herrn von Zedtwitz, im folgenden Jahr Bergmeister in Annaberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es geht doch: Nun hätte doch eigentlich
alles geregelt sein müssen. Sollte man denken.
Carl Edler von Querfurth hat in der Folgezeit jedenfalls seinen Wohnsitz auf dem Eisenhammer zu Schönheide genommen, das Pökelgut wieder verkauft und das Förstelgut an einen Herrn Diterich Adolph Hermann verpachtet. Dieser führte auch selbst gleich wieder Beschwerde über den Grubenbetrieb und so hatte sich Geschworener Gebler am 8. April 1836 nach Langenberg zu begeben, „insbesondere und daselbst wegen von Seiten des Ritterguths Förstel durch den dortigen Pächter, Herrn Inspektor Hermann, über der Eigenlöhner mit beladenen Wagen über des Guthes Felder unbefugt und unerlaubtes Fahren erhobene Beschwerde Verboth an die solches betreffenden Eigenlöhner gethan, welche unter der Erklärung, wie sie zeither einigemal wegen des gelegenen vielen Schnees bei dessen Aufthauen hierzu veranlaßt gewesen seyen, versprachen, daß dergleichen Ungebührnisse nicht wieder vorkommen sollten.“ (40014, Nr. 289, Film 0167f) Gutspächter Hermann beschwerte sich am 3. Januar 1838 erneut auch schriftlich beim Bergamt, es sei ihm nicht gelungen, den Grundzins einzubekommen und bat das Bergamt um Ermahnung der Lehnträger. Rückständig seien Haustein, Bach und Hänel (40014, Nr. 260, Blatt 77). Das Bergamt bestellte die Angesprochenen ein, wo sie sich bereit erklärten, die Außenstände auszugleichen. Ob er sie bekommen hat, weiß man nicht genau, denn Pächter Hermann ist schon am 1. Mai 1839 „wieder abgegangen.“ Der nächste Akt ging ausnahmsweise von den Grubenbesitzern Haustein und Weisflog aus: Die beschwerten sich am 26. Juni 1841 beim Bergamt über Herrn von Querfurth, daß der die Abfuhr gewonnenen Braunsteins und die Anfuhr von Grubenholz behindere (Da war doch noch was mit den Fuhrdienstleistungen...), sie hätten deswegen über Herrn Meyers Grund im Tännig fahren müssen, was dieser aber auch nicht dauerhaft bewillige, und baten daher das Bergamt, Herrn Rittmeister doch zu bewegen, Ihnen wieder einen Fahrweg zuzuweisen (40014, Nr. 260, Blatt 79f). Schon einen Tag darauf schrieb man von Scheibenberg an Herrn von Querfurth, er solle doch die Durchfahrt wieder zulassen, oder aber triftige Gründe vorbringen (40014, Nr. 260, Blatt 80). Eine Steilvorlage für Herrn von Querfurth... Es kommt wieder ein mehrseitiges Schreiben, in dem er alle schon bisher vorgebrachten Argumente (obwohl sie doch zwischenzeitlich durch behördliche Lokalexpedition entschieden gewesen sind) auf´s neue vorbringt, aber auch mit neuen Episoden ergänzt. Wortreich beschwerte er sich wieder über die „zweck- und planlose Wühlerei“ der Eigenlehner. Dabei neu ‒ und auch nicht unbegründet ‒ ist die Fragestellung: „Diese sämtlichen Eigenlöhner fahren auf gewerblichen Gruben an, wenn sie nun hier die Schichten richtig verfahren, welche Zeit verbleibt selbigen Eigenlöhnern Bergbau zu treiben? Und gestatten es die Berggesetze selbigen zu treiben, da man doch wohl wegen Gezähe, Pulver etc. einen Supcon (?) haben könnte?“ Allen Anordnungen des Bergamtes bei der Revision vom 28. April 1835 sei bisher „nur wenig Gehorsam geleistet worden“ und der Wortführer „Christian Gotthold Weisflog... ist einer meiner berüchtigsdten Holzdiebe in der Umgegend, dem längst schon das Fahrleder hätte sollen abgebunden werden.“ Dieser stehe wohl im Justizamt Grünhain deswegen vor Gericht. Herr von Querfurth beantragte daher neue Revision der Gruben, derer wohl 7 bis 8 sein mögen, und verwies noch darauf, daß beim Auflässigwerden der Gruben die Kosten für Verwahrung und Wiederherstellung ohne eine amtliche Entscheidung wohlmöglich dem Bergamt zufallen würden... Das letztere war natürlich ein besonders gutes Argument, das er sich für´s Ende seines Schreibens aufgehoben hatte. So wurde man auch in Scheibenberg wieder tätig und setzte eine neue Lokalexpedition an. Da der eigentlich amtierende Berggeschworene Theodor Haupt von hoher Stelle wieder zu anderen Aufgaben abgezogen war, wohnte der ihn in dieser Zeit vertretende Rezesschreiber Lippmann diesem Ortstermin bei (40014, Nr. 300, Film 0245).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier die Niederschrift (40014, Nr. 260, Blatt 101ff):
Protocollirt auf dem Gebirge den 20. September 1841 Gegenwärtige
„In Frage einer von mehreren Eigenlöhnern und Lehnträgern auf Ritterguths Förstler Grund und Boden gelegenen Braunstein- und Eisensteingruben ... unterm 26. Juni d. J. eingereichten Impleretion (?) betreffend die von dem Herrn Rittmeister Edler von Querfurth beschehenen Entziehung des nöthigen Fahrweges in der Abfuhr des gewonnenen Eisen- und Braunsteins so wie der Anfuhr der bei gedachten Gruben nöthigen Holzmaterialien und einer bergamtlichen Aufforderung gemäß, den auf Seiten gedachten Herrn Rittmeisters Edler von Querfurth erfolgten Erwiderung ... beschloß das Bergamt, an heutigem Tage auf fraglichem Gebirge eine Localbesichtigung abzuhalten, bei welcher, nachdem sich resp. auf beschehene Ladung die ad marginem bemerkten Interessenten an Ort und Stelle eingefunden hatten und nach geschehenen allgemeinen Vortrag der Sache, nachstehendes zu bemerken war. Anlangend I. Gnade Gottes gev. Fdgr. So sprach sich der Herr Rittmeister von Querfurth zuförderst dahingehend aus, daß er an dem Vergleich vom 6. April 1830 ... durchaus keine Veränderung beabsichtige, sondern von allem wünsche, daß ein damals unerledigt gebliebener Punct – Regulirung eines Grundzinses – wegen des auf seinem Grund und Boden geführten und zu Gnade Gottes Fdgr. gehörigen Kunstgrabens – heute bestimmt? werde. Herr Rittmeister Edler von Querfurth beansprucht in dieser Hinsicht an die Herren Nestler und Breitfeld als Besitzer der Grube vom Anfange des Jahres 1830 an einen jährlichen Grundzins von 8 Thl. – Gr. – Pf., allein sowohl der Herr Schichtmeister Schubert, als der Herr Schichtmeister Stemmler aus Erlhammer, welcher in angeblichem Auftrage für die Herren Nestler und Breitfeld bei der heutigen Expedition erschien, fanden diese Anforderung zu hoch und erklärten sich nun anheischig, vom Anfange des Jahres 1830 an, an den Herrn Rittmeister von Querfurth einen jährlichen Grundzins von Drey Thl. – Gr. – Pf. zu zahlen und den verfallenen Zins so bald als möglich zu berichtigen, womit sich auch (?) endlich der Grundbesitzer zufrieden zu seyn, erklärte. In Bezug auf II. den Julius Stolln, worauf sich des Herr Rittmeisters Gesuch... mit bezieht, so war hierüber folgendes zu bemerken. Wenn der Herr Grundbesitzer befürchtet, daß ihm durch diesen Stolln Tagebrüche erwachsen würden, ja dergleichen sich schon gezeigt hätten, so konnte eine dergleichen Befürchtung um so weniger in Abrede gestellt werden, als sich bei der heutigen Besichtigung herausstellte, daß auf fraglichem Stolln vor ohngefähr 14 Tagen auf dem gegen Morgen getriebenen zweiten Seitenflügel auf einer Länge von 32 Lachtern die Zimmerung theilweise herausgerissen worden ist. Steiger Gebler befragt, wer ihm hierzu Anweisung ertheilt, entgegnete hierauf, daß ihm diese von dem Herrn Factor Ernst Julius Richter zu Zwickau geworden sei, es nahm jedoch hierbei das Bergamt Veranlaßung, Steiger Geblern (?) ein Verfahren zu verweisen, worüber ihm vom Bergamte nicht die geringste Anweisung zugegangen sei und ihm, daß er dem Bergamte über ein dergleichen Ansinnen Anzeige erstattet habe. Wenn nun der Herr Rittmeister von Querfurth auch wegen des bis dahin erlittenen Schadens auf eine Entschädigung verzichtete, so behielt sich derselbe jedoch wegen der noch zu befürchtenden Tagesbrüche schlechterdings Schadenansprüche an die Eisen Compagnie zu Kainsdorf und zunächst an das Grubengebäude Wilkauer vereinigt Feld, so lange diese Grube bestehe, vor. Zu bemerken war noch, daß Seiten Wilkauer vereinigt Feld der heutigen Localexpedition nur der Steiger Gebler berichtete, da sich das Bergamt genöthigt gesehen hatte, dem Herrn Markscheider Strödel zu einer nöthigen Reise einen mehrtägigen Urlaub zu ertheilen. Bezüglich III. Gelber Zweig gev. Fdgr. So war hierüber etwas weiteres nicht zu bemerken, da der Lehnträger Carl August Weisflog sich darüber auswies, daß er die Entschädigungsleistung für die innehabenden Haldenräume (Protokoll vom 28. April 1835) bisher richtig bezahlt habe. Bei IV. Friedrich gev. Fdgr. Fand man noch heute die in der vorangegangenen Registratur ... nun gegebenen Schächte offen und gangbar, nicht aber, daß der vom oberen oder dem Wetterschachte wenige Lachter gegen Morgen befindliche zum Holz- und Sturzplatze benutzt werdende Raum völlig geräumt, weshalb der Lehnträger Korb angewiesen wurde, qu. Platz unverzüglich (?) bei Strafe zu räumen, da ihm, Korben, der Herr Grundbesitzer bei der heutigen Expedition einen anderweiten Platz an der mittäglichen Seite des Förderschachtes anwies. In Bezug auf den Grundzins behauptete Korb, daß er selbigen bis mit 1838 an den Pächter Hermann berichtigt habe und wurde daher demselben aufgegeben, nicht nur den rückständigen Grundzins, sondern auch den currenten bis mit Schluß 1841 an den Herrn Grundbesitzer zu berichtigen, zu seiner Zeit aber die diesfallsigen Quittungen beim Bergamte zu presentieren. V. Gott segne beständig gev. Fdgr. Ebenfalls in Försteler Waldung, hat an dermalen 2 gangbare Schächte, nämlich den Fundschacht und den von solchem 12 Lachter in nordöstlicher Entfernung gelegenen, gegen Ende des vorigen Jahres auf ca. 7 Lachter tief niedergebrachten Fahr- und Förderschacht. Das Bergamt fand sich hierbei nur veranlaßt, den Lehnträger Bach anzuweisen, die auf dem oberen, dermalen jedoch zugefüllten Förderschacht befindliche Schachtkaue wegzunehmen, selbige auf den Fundschacht zu setzen, den ganzen Raum zu räumen und denselben wiederum de Grundbesitzer zurückzugeben, widrigenfalls sich aber zu gewärtigen, daß das Bergamt solches auf seine Kosten werde herstellen lassen. In Bezug auf Abtrag des Grundzinses fand dasselbe statt, wie bei dem Lehnträger Korb und es wurde demselben eine gleiche Anweisung ertheilt. Auch hat der Lehnträger Bach vor einigen (?) Tagen einen Tagebau auf Gewinnung von Eisen- und Braunstein in großer Nähe des Fundschachtes angefangen, allein das Bergamt wies denselben an, binnen 4 Wochen wieder zuzustürzen, da qu. Bau nur als ganz unbergmännisch angesehen werden mußte. Anlangend hiernächst VI. Ullrike gev. Fdgr. wo sich nicht der Lehnträger Gotthold Weisflog, sondern nur der Mitgeselle Carl August Weigel anwesend befand, so behauptete letzterer, daß der Grundzins bis Schluß 1838 an den Pächter des Förstelguthes, Herrn Hermann, berichtigt sei, weshalb man nur resolvirte, den Lehnträger Weisflog anzuweisen, den rückständigen Grundzins neben den currenten Gebühren bis Schluß 1841 an den Herrn Grundbesitzer zu bezahlen und die diesfallsigen Quittungen zu seiner Zeit beim Bergamte zu presentiren. In betreff des Berggebäudes VII. Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. War etwas weiteres hier nicht zu bemerken, da der Herr Rittmeister von Querfurth versicherte, sich mit dem Herrn Factor Sublerent (?) Haustein bereits privatim berechnet zu haben. In Ansehung VIII. eines von Christian Friedrich Wilhelm Hänel geworfenen Schurfes, welchen Carl August Weisflog im Jahre 1837 übernommen hat (Anmerkung: nach dem Jahre 1835 unter dem Namen Ullrike erste obere Maas bestätigt), so versicherte letzterer, daß fraglicher Schacht bereits im Jahre 1838 wiederum zum Erliegen gekommen sei, sowie, daß er den bis dahin gefälligen Grundzins an den damaligen Pächter Herrn Hermann, richtig abgeführt habe. Obwohl nun letzteres zwar der Herr Grundbesitzer nicht in Zweifel zog, so wurde doch Weisflogen aufgegeben, die diesfallsige Quittung dem Bergamte bei der nächsten Session zu produciren, wie (?) die entstandene Pinge wieder einzuebnen und den daran liegenden kleinen Bruch zuzufüllen. Hinsichtlich des IX. von Gottlieb Friedrich aus Langenberg unterhalb Ullrike gev. Fdgr. geworfenen Schurfes war zu bemerken, daß selbiger bereits wieder zugefüllt und eingeebnet worden ist. Endlich und X. in Beziehung auf den von Herrn Carl Ludwig Haustein und Cons. ... auf Förstler Grund und Boden geforderten Weg, so erkannte der Herr Grundbesitzer bei der heutigen Localexpedition die Nothwendigkeit desselben an und erklärte sich auch bereitwillig, den gemeinschaftlichen (?) Weg ohngefähr von dem zu Gott segne beständig gev. Fdgr. gehörigen Fundschachte, d. i. 17 Schritte mittagabendlicher Entfernung von dem mitternachtabendlichen Lochstein von Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. herunter nach dem von Tännicht und Schwarzbach nach Förstel und Langenberg führenden Communicationswege, jedoch mit möglichster Schonung des Waldes und der Holzbestände führen und herstellen zu lassen, was Herr Factor Carl Ludwig Haustein und Consorten bestens respectirten. Beim Wiederverlassen bat der Herr Rittmeister von Querfurth noch: das Bergamt wolle im bergamtlichen Lehnbuche nachzuschlagen belieben, ob Carl August Weisflogs Ansuchen in Beziehung auf Ullrike erste obere Maaß (sub. VIII.) in Wahrheit beruhe, da er der Meinung sei, daß qu. Grube bis ins Jahr 1840 gangbar gewesen sei. Sei letzteres der Fall, so behalte er sich vor, daß Weisflog den (...) Grundzins mit quartaliter 12 Gr. nachträglich an ihn berichtige, nämlich auf die Zeit, in welcher mehrgedachte Grube in Betrieb gestanden habe. Vorgelesen, genehmigt, mitunterschrieben du zur Nachricht anher bemerkt von Friedrich Wilhelm Lange, Bergschreiber.“ Auch für den Betriebsgraben von Gnade Gottes Fundgrube wurden hiermit nun Entschädigungszahlungen vereinbart. Letzteren Wunsch hat das Bergamt auch erfüllt und die Eintragungen im Verleihbuch geprüft: Tatsächlich aber hatte Herr Weisflog Recht: Für die erste obere morgendliche Maaß nach Ullrike gev. Fdgr. hatte er die Bestätigung am 27. September 1837 erhalten und dieses Feld Luciae 1839 wieder losgesagt. Alles in Butter ? Nee, nee... Was machen diese Bergleute da aber auch schon wieder.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inzwischen gab es nicht nur kleine
Eigenlöhnerbetriebe. Mit der Konsolidation von Friedlich Vertrag
und Kästners Hoffnung sowie mit der Bildung des Wilkauer
gemeinschaftlichen Feldes aus Kästners Maßen und den früheren
Bauen der Großzeche im Osten sowie der Aufnahme des Julius
Stollns im Westen, wie der Juno Stolln auf den Fluren des
Rittergutes Förstel gelegen, nahm der Bergbau auch hier im Revier nun
einige industrielle Züge an. Den erstgenannten Stolln hatte man
allerdings 1842 schon wieder aufgegeben und es kam, wie es kommen mußte:
Natürlich ging der tagesnahe Teil zubruch. Bei Wilkauer vereinigt Feld
nahm man seine Pflichten als Bergbaubetreiber allerdings ernst und so
konnte Herr Lippmann am 21. April 1842 in seinem Fahrbericht
(40014, Nr. 321, Film 0033f)
mitteilen:
„Die durch das theilweise Zubruchgehen des Julius Stollns gemachten Tagesbrüche, wovon das Königl. Bergamt durch mündliche Relation in Kenntniß gesetzt wurde, sind nunmehr gehörig ausgestürzt und eingeebnet worden.“ Das hatte allerdings nicht viel geholfen und nach seiner Rückkehr in das Bergamt Scheibenberg mußte auch Geschworener Theodor Haupt in seinem Fahrbogen wieder festhalten: „Am 8. Februar 1843 habe ich mehrere, vom Julius Stolln herrührende Tagesbrüche besichtigt und die Grube Wilkauer vereingtes Feld befahren.“ (40014, Nr. 321, Film 0140) Bis zum 13. März 1843 hatte man die Pingen wieder zugestürzt (40014, Nr. 321, Film 0153f). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine neue Beschwerde des Herrn
Rittmeisters, jetzt schon ,a. D.' und nun an das Bergamt zu Annaberg, datiert
dann auf den 11. August 1843 (40014, Nr. 260, Blatt
111ff). Wir zitieren nur den
wesentlichen Auszug, weil sich ja so manches sonst wieder wiederholt:
„Wenn schon der in meiner Reihe von Jahren auf meinen hiesigen Besitzungen getriebene, so genannte Bergbau, außer einige Abträge an Bergamtsgeldern weder der Hohe Staats Fiscus je nicht einmahl denjenichen, die diesen Bergbau treiben, nur einigen Nutzen gewährt, mir aber äußerlichen Schaden verursacht – und nicht einmahl die (?) Groschen zu erlangen sind, welche als Grundzinß stipuliret (?) werden – so hat doch der so zwecklose Bergbau Wilkauer Vereind Feld, deßen Resultate ich gleich beim ersten Angriffe des unglücklichen Stollens und wiederholt profezeite – daß hier höchstens einzelne Braunsteine werden, niemahls aber bauwürdiger Eisenstein zu finden sein würde – meine gemachten Beschwerden aufs höchste gesteigert, da nicht nur daß nach Aufgabe des Stollens so gesetzwidrig die Hölzer heraus gerißen worden – wo freilich zu beklagen ist, daß eine solche Parthie so schönes Holz hier so nutzlos verwendet wurde – und dadurch auf dem Felde so viele Tagebrüche entstanden und fortgesetzt in jedem Frühjahr entstehen müßen – hat sich nun Steiger Graubner erlaubt, einen förmliche Bier- und Schnaps Schenke in dem Huthause zu etabliren, da doch nach den neuen Gesetzen dieses Zechenhaus, da die Grube gänzlich zum Erliegen gekommen ist, abgetragen werden sollte. Wenn nun an und von sich deren Winkelkneipen – zumahl sie der polizeilichen Aufsicht entzogen sind – größtentheils nur Aufenthalt von liederlichen Gesindel, entlaufener Dienstboten pp. gewähren, so ists mehrfach strafbahr, so ohne alle Concessiones ohne Abentrichtung in die Staats Cassen solche Etablissements zu gründen – ja, wenn ich nun auf mehrfache Beschwerdeklagen des hießigen Schankwirths Hrn. Goldhahn – Steiger Graubner warnen (?) ließ, sein unbefugtes Bier- und Schnapsschenken einzustellen, widrichenfalls ich gegen ihn Anzeige machen müßte – dises aber fruchtlos blieb, so sah ich mich genöthigt, Klage im Kreiß Amt Schwarzenberg zu führen, welche auch Steiger Graubner vorgeladen, seines gesetzwidriges Benehmen verwiesen, jedoch als nicht (?) Behörde keine weitere Verfügung treffen konnte, so hat Steiger Graubner auch hierauf nicht nur sein unbefugtes Bier- und Schnapsschenken nicht eingestellt, sondern gleichsam zum Hohne öffentlicher fortgesetzt und geäußert, er habe die Erlaubniß zum Schenken erhalten – sie müßte denn doch von dem Königl. Bergamte ertheilt worden sein – er würde fortschenken und wenn ich ihm wieder anklagte, so würde ich die Kosten haben. Demnach ergeht meine ergebene Anfrage und Antrag dahin – Hat das Königl. Bergamt Steiger Graubner Concession zum Bier- und Schnapsschenken ertheilt und auf welchem mir nicht bekannten gesetzlichen Grunde beruht diese Entscheidung? (...)“ Hierzu wurde der Steigerversorger Carl Gottlieb Graupner aus Schwarzbach ins Bergamt vorgeladen, von der Beschwerde in Kenntnis gesetzt, worauf derselbe zu vernehmen gab (40014, Nr. 260, Blatt 113), daß: „der Herr Geschworene Haupt bereits im vorigen Jahre ihm das unbefugte Bier- und Branntweinschenken so wie Gäste setzen untersagt habe. Diesem Verbot gemäß habe er auch seit zwei Jahren weder Bier noch Branntwein mehr geschenkt, doch wolle er gar nicht in Abrede stellen, daß er vor ohngefähr 14 Tagen sich 20 Kannen Bier aus Schwarzenberg, hauptsächlich zu seiner Labung, zugelegt habe. Ebenso wenig wolle er leugnen, daß vor ohngefähr 10 Tagen der Herr Pastor Uhlmann aus Schwarzenberg, der Herr Stadtrichter Müller aus Elterlein sowie der Herr (?) Schneider aus vorgenannten Orte ihn auf dem von ihm bewohnten, zu Wilkauer vereinigt Feld gehörigen Huthause besucht hätten und daß er an gedachte Herren Bier ausgeschenkt habe. Durchaus müßte er aber in Abrede stellen, daß er auch anderen Personen Bier ausgeschenkt habe und noch weniger sei es wahr, daß er auf dem Huthause liederlichem Gesindel, entlaufenen Dienstboten usw. einen Aufenthalt gewähre, obgleich dieß der Herr Rittmeister Edler von Querfurth mit angegeben habe. Eben so unwahr sei es fernerweit auch, geäußert zu haben, er habe die Erlaubnis zum Schenken erhalten...“ Eigentlich nichts Schlimmes, das Bergamt entband Graubner dennoch von der Steigerdienst- Versorger- Funktion.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der Zahlung der Grundzinse blieben
die Grubenbesitzer aber weiter rückständig. Wer teilt auch freiwillig das
mühsam erarbeitete Geld... Diesbezügliche Beschwerden, Anweisungen des
Bergamts an die Lehnträger, Streit um die Höhe der Zinse zogen sich auch
ferner hin.
1845 ist Carl Christian Edler von Querfurth verstorben. Das Rittergut Förstel wurde von den Erben am 24. Februar 1846 an Karl Friedrich Gustav Flemming, zuvor Besitzer des Erbgerichts in Walthersdorf, später Friedensrichter in Scheibenberg, verkauft (13888, Nr. 06). Ein Teil der Besitzungen scheint schon vorher veräußert worden zu sein, denn bereits in dem letzten Schreiben in dieser Akte vom 24. November 1845 geht es um die Aufteilung der zu entrichtenden Grundzinse an die neuen Besitzer eines „früher zu dem Ritterguthe Förstel gehörenden Grundstückes.“ Damit schließt die Akte ‒ entweder hat sich der neue Besitzer des Gutes nicht mehr für den Ertrag der landwirtschaftlichen Flächen und die Eintreibung von Grundzins von den Bergbauunternehmen (denn die gab es ja weiter) interessiert, oder die verbliebenen Grubenbesitzer wurden vernünftig, hatten mehr Einnahmen, konnten sich daher den Grundzins leichter absparen... wer weiß. Vielleicht bekommen wir´s noch heraus. 1889 erwarb dann der Leipziger Apotheker und Begründer eines Unternehmens für Herstellung und Vertrieb homöopathischer Arzneimittel, Dr. Carl Emil Willmar Schwabe, das Rittergut Förstel und richtete hier ein Genesungsheim ein (20706). Wir denken jedenfalls, daß dieser Exkurs in die damaligen Auswirkungen des Bergbaus auf die Grundeigentümer und die daraus notwendigerweise resultierenden Differenzen interessant und wert ist, an dieser Stelle eingefügt zu sein. Nachdem wir unsere montangeschichtliche Materialsammlung damit aber um einige Jahrzehnte ,überholt' haben, kehren wir nun wieder zurück ins Jahr 1809...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach diesem Vorgriff auf spätere Zeiten kehren wir
wieder zurück zur Gelber Zweig Fundgrube, welche vom
Berggeschworenen Schmiedel am 29. März 1809
das nächste Mal befahren worden ist. Mit drei Mann Belegung trieb man hier weiter das Ort in 4¼ Lachter Teufe in Stunde 5,1 gegen Südwest vor und hatte es jetzt bis auf
5¾ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 235, Blatt 129f). So fuhr man fort und
bis Trinitatis 1809 war noch nicht wieder bemerkenswertes vorgefallen
(40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 136).
Den nächsten Fahrbogen setzte Herr Schmiedel Crucis 1809 auf, in dem er über Gelber Zweig berichtete (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 181), die Grube war weiterhin mit 2 Mann belegt, und diese trieben in 4½ Lachter Teufe das Ort auf dem Stunde 6,2 streichenden, 30 Grad gegen Nord fallenden Lager gegen Osten fort, wobei man bei diesem aber nur bis 5¼ Lachter vorangekommen sei. Vielleicht, damit die Grube nicht erneut durch Planlosigkeit ins Freie falle, fand der Geschworene auch den Hinweis nötig: „Bei dieser Befahrung wurde dem Lehnträger aufgegeben, in Zukunft mehr Regelmäßigkeit bei dem Abbau des Lagers zu beachten.“ Das war wohl auch nötig, denn schon bei seiner nächsten Befahrung am 19. Oktober 1809 fand er die Grube wieder unbelegt vor (40014, Nr. 235, Blatt 196). Auch Trinitatis 1810 war die Grube nicht belegt (40014, Nr. 245, Film 0042). Am 13. August 1810 war aber dann wieder Grubenbetrieb umgängig, worüber der Geschworene in seinem Fahrbogen festhielt (40014, Nr. 245, Film 0087): „Gelber Zweig zu Langenberg betr. Auf dieser mit 2 Mann belegten Eigenlöhnergrube wird bei 4½ Lachtern Teufe des Fundschachtes ein Ort auf dem Stunde 3,3 streichenden, 25° gegen Mitternacht Abend fallenden, gelben Ocker, milden Gneis Quarz und bisweilen einbrechenden braunen ockerigen Eisenstein und Braunstein führenden Lager nach dem Streichen deßelben gegen Mitternacht Morgen betrieben, daßelbe ist jetzt 7¾ Lachter erlängt.“ Bei seiner nächsten Befahrung am 19. Oktober 1810 hat Herr Schmiedel wohl noch einmal neu gemessen, denn er gab die Streckenlänge diesmal nur mit 6¼ Lachtern an. Sonst lief der Betrieb aber wie zuvor weiter (40014, Nr. 245, Film 0111). Und auch von der Befahrung am 12. Februar 1811 gab es nicht viel Neues zu berichten: Man baue „ortweise“ das Lager ab, das Abbauort weise nun die Richtung Stunde 6,2 gegen Ost auf und war 6¾ Lachter erlängt (40014, Nr. 245, Film 0156). Ein Vortrieb von einem halben Lachter binnen vier Monaten klingt nicht gerade gewaltig, dürfte aber für Eigenlehnergruben dieser Zeit mit wenigen Arbeitern Belegschaft völlig normal gewesen sein... Daher fand der Geschworene auch in den nächsten Monaten auf dieser Grube „nichts Veränderliches“ vor. Erst nach seiner Befahrung am 26. August 1811 notierte er wieder etwas ausführlicher, der eine der zwei hier anfahrenden Mann treibe bei 4 Lachtern Teufe ein Ort im Streichen des Lagers Stunde 5,6 gegen Ost weiter, welches jetzt 5¼ Lachter erlängt war. Das Lager hier war ½ Lachter mächtig, fiel 10° gegen Nordwest und führte „gelben Ocker, Gneis, Quarz, ockerigen gelben Eisenstein und Braunstein.“ Der zweite trieb ein Ort Stunde 1,2 gegen Süd bei 4 Lachter Länge vom Tageschacht weiter, wo das Lager bis ¾ Lachter mächtig sei und ebenso braunen Hornstein und dichten Eisenstein führe, nur Braunstein wird hier nicht genannt (40014, Nr. 245, Film 0240). Bis Dezember 1811 hatte man bei diesem Betrieb immerhin doch 35 Fuder Eisenstein gefördert und am 3. Dezember im Beisein des Geschworenen vermessen (40014, Nr. 245, Film 0276). Bis auf die Maßangaben gleichlautend ist auch der Befahrungsbericht im Fahrbogen auf Reminiscere 1812 (40014, Nr. 250, Film 0003). (Die erste Woche dieses Quartals begann übrigens interessanterweise schon mit dem 30. Dezember 1811.) An eben diesem Tage befuhr Herr Schmiedel wieder die Grube Gelber Zweig und fand das erste Ort jetzt 6½ Lachter erlängt, das zweite Ort aber 4¾ Lachter fortgestellt. Bei seiner nächsten Befahrung am 25. März 1812 fand der Geschworene die Grube mit drei Mann belegt. Durch diese wurde in 6 Lachtern Teufe das Ort im Streichen des Lagers Stunde 7,6 gegen Ost „mit 1 Lachter Weitung“ betrieben und war jetzt 5¾ Lachter erlängt. Das Ort gegen Süd hatte man wohl aufgegeben oder zumindest nicht belegt. Das Lager war jedenfalls vor dem östlichen Streckenort ¾ bis 1 Lachter mächtig, fiel 20° gegen Nord und führte „gelben Ocker, milden Gneis, Quarz, ockerigen gelben Eisenstein, auch dichten Brauneisenstein“ (40014, Nr. 250, Film 0035).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder einmal scheint die Erzführung aber nicht weit
aushaltend gewesen zu sein. Am 11. Mai 1812 stellte Herr
Schmiedel fest, daß die Lehnträger in dem „sich ziemlich weit
verbreitenden Lager, um es zu untersuchen und abzubauen,“ einen neuen
Tageschacht absenkten, der jetzt gerade 4¾ Lachter Teufe erreicht hatte
(40014, Nr. 250, Film 0052). Am 13. Juli 1812 hatte man bei 5 Lachtern
Teufe wohl das Lager wieder getroffen und trieb aus dem neuen Tageschacht
ein Ort nach dem Lagerstreichen Stunde 5,5 gegen Nordost, welches „bei
1 Lachter Weitung“ 3⅜ Lachter fortgestellt war (40014, Nr. 250,
Film 0072). Wenn man gleich ,mit Weitung´ baute, muß man fündig
geworden sein... Am 20. Oktober fand Herr
Schmiedel dann das Ort vom Tageschacht in 4½ Lachter Teufe nach dem
Lagerstreichen auf Stunde 7,2 gegen Ost verschwenkt und auf 5¾ Lachter
fortgestellt (40014, Nr. 250, Film 0116).
Dann scheint aber schon wieder Schluß gewesen zu sein. Von seiner Befahrung am 11. Februar 1813 nämlich berichtete Herr Schmiedel, daß die zwei selbst anfahrenden Eigenlehner „auf der Sohle des 7 Lachter tiefen Fundschachtes das Lager angefahren haben und treiben ein Ort Stunde 8,3 gegen Morgen mit 1 Lachter Weitung, welches 11½ Lachter ausgelängt ist. Das Lager ist vor dem Ort ½ bis ¾ Lachter mächtig...“ (40014, Nr. 251, Film 0015) Haben sie nun den kaum erst ein Jahr zuvor abgesenkten Tageschacht weiter verteuft, oder gab es schon wieder einen neuen ,Fundschacht´ ? Bis zur nächsten Befahrung am 13. April hatte sich demgegenüber eigentlich nicht viel verändert: Man betrieb das Ort, jetzt in Richtung Stunde 8,3 gegen Ost, weiter. Die Mächtigkeit des Lagers wird jetzt nur noch mit ¼ bis ½ Lachter angegeben (40014, Nr. 251, Film 0036), und auch bei seinen nächsten Befahrungen fand der Geschworene nichts wesentlich neues vor, was ihm eine Eintragung im Fahrbogen wert gewesen wäre. Immerhin war die Grube über den ganzen Zeitraum in Umtrieb und durch die zwei Eigenlehner belegt. Bis zum Spätherbst hatten diese den Schacht offenbar weiter verteuft, denn bei seiner Befahrung am 5. November 1813 fand Herr Schmiedel dann ein Ort Stunde 10,6 gegen Süd auf der Sohle des jetzt 8½ Lachter tiefen Tageschachts belegt und schon 6¾ Lachter ausgelängt vor (40014, Nr. 251, Film 0112f). Auch dieses Ort wurde aber wieder liegengelassen, als die Erzführung nachließ und am 18. Januar 1814 fand der Geschworene schon wieder ein neues Ort ‒ nun wieder in 6½ Lachter Teufe des Tageschachts und „mit aufsteigender Sohle“ Stunde 1,5 gegen Süd gerichtet ‒ vor und dieses war 8 Lachter erlängt (40014, Nr. 252, Film 0008). Man scheint sich dann wieder auf die tiefere Sohle verlegt zu haben, denn von seiner Befahrung am 29. März 1814 berichtete Herr Schmiedel, es werde nun wieder bei 8 Lachter Teufe auf dem Lager ein Ort Stunde 7,1 gegen Ost betrieben, welches, bereits 6¾ Lachter erlängt war, sowie ein zweites Ort Stunde 9,6 gegen Nordwest, das jetzt gerade 4 Lachter lang gewesen ist (40014, Nr. 252, Film 0030). Über das Lager und dessen Erzführung heißt es im Fahrbericht: „Besagtes Lager streicht Std. 4,6 fällt ungefähr 10 Grad gegen Mitternacht Abend, ist ¼ bis ¾ Lachter mächtig und besteht vor dem ersten Orte aus gelbem Ocker, Gneus, Quarz, braunem Hornstein, ockerigen und dichten Brauneisenstein; vor letzterem Orte hingegen bricht noch überdies nesterweise Braunstein ein.“ Bei seiner nächsten Befahrung am 28. Juni 1814 hat der Geschworene wohl noch einmal die Lachterschnur angehalten, denn er gab die Teufe der Streckensohle im Tageschacht diesmal mit 7¾ Lachter an. Das Ort gegen Ost stand in Betrieb und war dem Streichen des Lagers folgend auf Stunde 5,6 (mehr nordöstlich) umgeschwenkt und 9 Lachter lang (40014, Nr. 252, Film 0056f). Ich kann kaum glauben, daß sich der Geschworene mehrfach ,vermessen´ haben sollte, deshalb müssen die Eigenlehner es sich im folgenden Quartal wohl schon wieder neu überlegt haben: Es heißt im Fahrbogen vom 27. September 1814 nämlich, die zwei anfahrenden Eigenlehner betrieben jetzt „bei 9 Lachter Teufe des Fundschachts“ zwei Orte im Streichen des Lagers, zum einen Stunde 8,6 gegen Ost, 6 Lachter vom Schacht, und zum zweiten Stunde 2,6 gegen Mittag, nunmehr 8¼ Lachter vom Schacht aus fortgestellt (40014, Nr. 252, Film 0082). „Vor ersterem bricht in mehrerwähntem Lager 6, 8 bis 12 Zoll mächtiger ockeriger und dichter Brauneisenstein, vor letzterem aber außer etwas unreinem, mit Quarz und Hornstein gemengtem Brauneisenstein, noch 4 bis 6 Zoll mächtiger Braunstein.“ Also, meines völlig unmaßgeblichen Erachtens hat das alles mit einem planvollen Abbau und Grubenbetrieb ziemlich wenig zu tun... Aber so ging es auch den Rest des Jahres weiter und bei seiner letzten Befahrung am 29. Dezember dieses Jahres fand Herr Schmiedel das eine Ort nun in der Richtung Stunde 7,5 gegen Ost 7¾ Lachter fortgebracht, das andere in Stunde 1,1 gegen Mittag umgeschwenkt, nunmehr 9 Lachter lang (40014, Nr. 252, Film 0105f). Und er fand noch erwähnenswert, daß (wie eigentlich in den vorhergegangenen Berichten auch): „Vor beiden Orten genanntes Lager außer ¼ Elle (≈13,3 cm) mächtigen Braunstein dieselben Bestandtheile (hat).“ Die letztgenannte Angabe stieg sogar noch weiter an: Bei seiner ersten Befahrung am 20. Februar 1815 nämlich (40014, Nr. 254, Film 0016) fand Herr Schmiedel die beiden Orte bei 9 Lachter Teufe des Fundschachts wieder in Betrieb und schrieb über das abgebaute Lager, es bestehe „aus gelbem Ocker, Gneus, Quarz, bisweilen einbrechendem dichten Brauneisenstein und ½ Elle (≈ 26,7 cm) mächtigen Braunstein.“ Das ist immerhin rund ein Viertelmeter Mächtigkeit und ein sehr ordentlicher Anbruch gewesen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ansonsten aber tat sich nun erstmal wieder eine Weile
nichts, der Grubenbetrieb schritt in gleicher Weise gemächlich fort und
Reminiscere und Trinitatis 1815 fand sich eigentlich keine Veränderung
vor. Am 15. August wäre eigentlich auch wieder eine Befahrung fällig
gewesen, aber diesmal heißt es im Fahrbogen nur, daß
Gelber Zweig und Reppels Fdgr. „wegen der durch das
anhaltende Regenwetter in den Fund- und Tageschächten aufgegangenen
Grundwasser nicht befahren werden“ konnten (40014, Nr. 254,
Film 0068).
Starkregen und Sommer- Hochwasser gab es auch früher schon... Allerdings fällt in dem Zusammenhang auch auf, daß in den Fahrbögen (abgesehen vom Wasserlösestolln der Grube Vater Abraham) bis 1815 wirklich noch nie etwas von einer Wasserhaltung zu lesen stand... Am 26. September 1815 notierte Herr Schmiedel dann, daß jetzt in 5 Lachter Teufe „des neuen Tageschachts“ ‒ wieder ein neuer ‒ ein 1 Lachter weites Ort im Streichen des Lagers Stunde 7,3 gegen Ost betrieben werde und 6 Lachter ausgelängt sei (40014, Nr. 254, Film 0081). Und nach seiner Befahrung am 6. Dezember 1815 heißt es im Fahrbogen, es wurde „zeither eine neuer Tageschacht niedergebracht und ist bei 5 Lachter Teufe das bereits schon bei den beiden vorhergehenden Gruben beschriebene Lager erreicht worden, auf welchem dermalen ein Ort gegen Mittag betrieben wird, welches jedoch erst 1 Lachter erlängt ist.“ (40014, Nr. 254, Film 0103f) Das Ort wurde bis zu seiner Befahrung am 19. Januar 1816 auf 4 Lachter (40014, Nr. 257, Film 0007), bis zum 13. Mai 1816 auf 5¾ Lachter „gegen Mittag“ (40014, Nr. 257, Film 0043f), bis zum 8. Juli 1816 „Stunde 5,3 (Angabe im Heftfalz unleserlich) gegen Morgen 6¾ Lachter“ (40014, Nr. 257, Film 0057f) und bis 24. Oktober 1816 Stunde 10,3 gegen Mittag 8 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 257, Film 0095). Sonst fand Herr Schmiedel nichts Erwähnenswertes vor. So ging es weiter fort und auch im Fahrbogen vom 10. März 1817 ist nur die Angabe neu, daß man bei 9 Lachter Erlängung nun „mit 1 Lachter Weitung“ baue (40014, Nr. 258, Film 0024). Erst von seiner Befahrung am 10. September 1817 berichtete Herr Schmiedel wieder einmal etwas neues, indem man sich nun wieder auf eine höhere Sohle in 4 Lachter Teufe verlegt habe und dort ein Ort auf dem Lager Stunde 11,1 gegen Mitternacht 6 Lachter ausgelängt habe (40014, Nr. 258, Film 0080).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner nächsten Befahrung am
12. Februar 1818 fand der Geschworene dann in 5 Lachter Teufe zwei Örter
im Streichen des Lagers, eines Stunde 6,5 gegen Ost 4¼ Lachter lang, und
ein zweites Stunde 5,3 gegen West, 3½ Lachter vom Fundschacht aus erlängt,
in Betrieb vor (40014, Nr. 259,
Film 0013). Bis zum
Verwiegetag am 9. Juni des Jahres waren hier 22 Zentner Braunstein
ausgebracht (40014, Nr. 259,
Film 0053f).
Dann scheint die Erzlinse wieder einmal abgebaut gewesen zu sein, denn am 1. September 1818 hatte Herr Schmiedel zu berichten, man habe jetzt bei 4 Lachtern Teufe „eines kürzlich abgesunkenen Tageschachts“ ein Ort Stunde 6,2 gegen Abend angeschlagen und 1¾ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 259, Film 0081). Wieder ein neuer Schacht... Bis zur Befahrung am 26. Oktober war das Ort in Stunde 7,0 verschwenkt und 4¼ Lachter lang geworden (40014, Nr. 259, Film 0099). Am 17. November 1818 war man auf Stunde 10,4 gegen Süd noch weiter verschwenkt und hatte das Ort 8¾ Lachter fortgebracht (40014, Nr. 259, Film 0105). Das Jahr darauf war man erneut umgeschwenkt und trieb jetzt ein Ort in die Gegenrichtung, Stunde 9,5 gegen Nordwest, und hatte es 2½ Lachter erlängt (40014, Nr. 261, Film 0020). Bis zur darauffolgenden Befahrung durch den Geschworenen am 5. Mai 1819 hatte man dieses Ort 4¾ Lachter fortgebracht (40014, Nr. 261, Film 0042). Am 22. September 1819 war in nun 5 Lachter Teufe ein neues Ort Stunde 7,2 gegen Abend angeschlagen und bereits 7½ Lachter erlängt (40014, Nr. 261, Film 0080f). Außerdem hatte Herr Schmiedel Grund zu der Veranstaltung: „Da der vorerwähnte Tageschacht in der Zimmerung sehr wandelbar befunden wurde, so wurde den Eigenlöhnern aufgegeben, solchen sofort in tüchtigen Standt zu setzen.“ Am 15. November 1819 war das Ort Stunde 7,0 gegen West 8 Lachter vom Schacht getrieben und ein zweites Ort Stunde 1,3 gegen Nord bis auf 5½ Lachter fortgebracht (40014, Nr. 261, Film 0099f). Erneut gab es auch Anlaß zu einer Veranstaltung: „In Erwägung, daß diese beyden Örter sehr unregelmäßig mit verschiedenen Krümmungen sowohl, als mit steigender und fallender Sohle betrieben werden, wodurch nicht nur die Förderung, als auch der Wetterwechsel sehr erschwert wird, so habe ich, wie auch schon zu wiederholten Malen geschehen, (,angewiesen' fehlt) die Strecken und Örter künftig regelmäßiger zu betreiben, wodurch die mehrentheils nur zum Wetterwechsel dienende Niederbringung nahe an einander stehender Tageschächte vermieden werden kann.“ Mit einem Vortrag aus dem Fahrbogen im Bergamt Annaberg ‒ der hier vom Geschworenen getroffenen Festlegung halber ‒ beginnt auch der Inhalt der zu dieser Grube vorliegenden Akten im Bestand des späteren Bergamtes zu Schwarzenberg (40169, Nr. 138, Blatt 1).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 18. Februar 1820 war Herr
Schmiedel wieder vor Ort (40014, Nr. 262,
Film 0014ff) und berichtete in seinem Fahrbogen
darüber:
b.) Gelber Zweig anlangend. „Dieße Grube ist mit 2 Häuern belegt, von welchen 1.) mit 1 Mann bey 4¼ Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort Stundte 11,1 gegen Mitternacht betrieben wird, welches zur Zeit 4½ Lachter erlängt ist und vor welchem das Lager aus gelbem und braunem Ocker, mildem Gneus, braunem Hornstein, Schwarzeisenstein und nierenweise einbrechendem Braunstein besteht. Sodann wird 2.) aus vorerwähnten Schachte bey 1 Lachter wenigerer, oder aber bey 3¼ Lachter Teufe, mit 1 Mann ein Versuchsort Stundte 3,3 gegen Abend betrieben, dessen Erlängung von dem östlichen Stoße des Tageschachtes dermalen 1 Lachter beträgt.“ Bis zu den Verweigetagen am 10. Februar hatte man hier 11 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0011), am 26. April 18 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0038), bis 20. Juni 10 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0059), am 16. August 1820 weitere 8 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0067) und bis zum 9. November 1820 nochmals 9 Zentner Braunstein ausgebracht (40014, Nr. 262, Film 0096). Ansonsten fand Herr Schmiedel über das Jahr aber keine bemerkenswerten Veränderungen im Grubenbetrieb vor. Stattdessen kam es nun infolge der
Beschwerde des Carl Edler von Querfurth auf Förstel zu der schon
bekannten
Unter Punkt 7 heißt es dann hier (40169, Nr. 138, Blatt 3f), ,Gelber Zweig Fdgr. betreffend': „Die auf Friedrich Fdgr. gegen Abend weiter zunächst folgende Eigenlehnerzeche, Gelber Zweig Fdgr., war mit 2 Mann belegt. Den eigentlichen, 4 Lachter tiefen Fundschacht oder sogenannten ersten Schacht hat der Eigenlehner, Karl August Weißflog, verlassen, dagegen schon vor längerer Zeit einen anderen oder zweyten Tageschacht 4¼ Lachter tief angelegt und von solchem aus a) Stunde 11,1 gegen Mitternacht ein Ort angehauen und dieses gegen 6 Lachter in dem 1 Lachter mächtigen, gelben und braunen Ocker, milden Gneus, braunen Hornstein, Schwarzeisenstein und nierenweis einbrechenden Braunstein führenden Lager, sodann b) bey 3¼ Lachter Teufe ein Versuchsort Stunde 3,3 gegen Abend 3¾ Lachter betrieben, vor welchem das Lager ziemlich gleiche Beschaffenheit hat. Ein für die Zukunft vorbehaltener Plan des Eigenlehners ist, von diesem letzteren Schacht aus gegen Morgen ein Ort nach dem erstern Tage- oder Fundschacht zu betreiben, um die daselbst stehengelassenen Eisensteinmittel abzubauen, welches gegenwärtig bey dem stockenden Wetterzuge nicht zu ermöglichen ist. Von dem Fundschachte 5 bis 6 Lachter in Mitternacht Morgen hat nun derselbe noch einen dritten Schacht angelegt, dessen Anlegung ihm schon früher von Herrn Geschworenen Schmiedel untersagt worden, mit der Weisung, stattdessen nur beregten Plan zuvörderts auszuführen. Herren Fahrende fanden denselben ganz zwecklos und setzten nun den Eigenlehner hierüber zur Rede, welcher die nicht befolgte bergamtliche Anordnung damit entschuldigen wollte, daß bey deren Ertheilung dieser Schacht schon auf 1 Lachter tief niedergebracht gewesen wäre. Unter nochmaliger ernstlicher Verweisung dieses Verfahrens wurde die § 10 des diesjährigen Haushaltsprotocolls mit mehrern zu ersehenden Verordnungen diesem Eigenlehner nochmals eingeschärft mit dem Bedenken, bey wieder vorkommenden Falle mit der gesetzten Strafe unausbleibend gegen ihn zu verfahren. Was nun diesen Schacht selbst noch betrifft, so ist er 3½ Lachter tief und von ihm aus a) ein Ort 5¼ Lachter erlängt, sodann b) gegen Abend ein Ort 2 Lachter betrieben, nachgehends wegen der damit angefahrenen Pressbaue wieder eingestellt worden, vor welchen Oertern das fragliche Lager dieselbe Beschaffenheit gehabt hat.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ungefähr in gleicher Weise schritt der
Betrieb auch im folgenden Jahr fort. Im Anschluß an den Verwiegetag am
6. Februar 1821 fuhr Herr Schmiedel auch auf Gelber Zweig an
und berichtete darüber (40014, Nr. 264,
Film 0015ff):
„Sodann habe ich nachstehende Gruben befahren, als (...)“ „Auf eben demselben Lager (wie bei Friedrichs Fundgrube) wird c) auf der benachbarten Grube Gelber Zweig in 5 Lachter Teufe des neuen Tageschachtes, 1.) ein Ort mit 1 Mann gegen Morgen sowie 2.) ein dergleichen, ebenfalls mit 1 Mann gegen Mittag Abend betrieben. Jenes ist 6 Lachter, dieses aber 8½ Lachter von besagtem Schachte fortgebracht und vor beyden hat das Lager die Mächtigkeit und Bestandtheile, wie auf der nächstvorher beschriebenen Grube.“ Wir gehen mal davon aus, daß der im Juli des Vorjahres ausgesprochenen, ernstlichen Verweisung und der angedrohten Strafe wegen, der Eigenlehner Weißflog seinen dritten Schacht wohl erst einmal liegengelassen hat und hier sein zweiter Schacht gemeint war, den er in der Zwischenzeit offenbar noch um einen ¾ Lachter verteuft hatte... Am 20. März 1821 hatte der Geschworene hier 12 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 264, Film 0029). Das erstgenannte Ort stand auch bei seiner nächsten Befahrung in Betrieb und war bis dahin 7¼ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 264, Film 0056f). Dabei hatte man bis zum Verwiegetag am 19. Juni erneut 14 Zentner Braunstein gewonnen (40014, Nr. 264, Film 0063). Danach scheint man sich in etwas größere Tiefe verlegt zu haben, denn von seiner nächsten Befahrung am 28. August 1821 berichtete Herr Schmiedel, es werden nun wieder zwei Örter, und zwar in 5¼ Lachter Teufe, betrieben; ein Ort gegen Morgen war 6 Lachter und das zweite Ort gegen Mittag Abend war 2¾ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 264, Film 0086ff). Dabei hatte man bis zum Verwiegetag am 7. November wieder 12 Zentner Braunstein ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0106).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahr 1822 fand der Geschworene
bei Gelber Zweig Fundgrube demgegenüber in seinen Fahrbögen keine Veränderungen
im Betrieb bemerkenswert (40014, Nr. 265,
Film 0031). Im Dezember 1822 wurde Herr
Schmiedel in seiner Funktion als Berggeschworener durch Johann
August Karl Gebler abgelöst. Der neue Geschworene befuhr diese Grube
erstmals am 30. April 1823 und notierte in seinem Fahrbogen hierüber (40014, Nr. 267,
Film 0039):
„Desselben Tages gefahren auf Gelber Zweig Fdgr. in Langenberg, belegt mit
Bey einer auf eine ähnliche Weise, wie bey der vorigen Grube (Christbescherung Fdgr.) statthabende Einrichtung, jedoch mit bessren Anbrüchen von Eisenstein und hiernächst auch mit Braunstein versehen, ist man, genau genommen, auf dem selben Lager, mit Gewinnung beyder in die Teufe von 8 Lachter, zugleich aber auch mit Betrieb eines zwischen den beyden vorhandenen, ohngefähr 10 Lachter von einander entfernten Schächten angelegten, zur Erlangung des nöthigen Wetterwechsels dienenden Orts beschäftigt. Die Anbrüche bestehen in 8, 10, 12 und noch mehr Zoll mächtigen, schwarzbraunen Eisenstein und in etwas erdartigen Braunstein.“ Bei seiner nächsten Befahrung am 29. August 1823 hatte sich die Belegung um einen Häuer verringert. Herr Gebler hob aber in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 267, Film 0058) hervor die: Braunsteingewinnung. Aus dem ohngefähr in der Mitte des Feldes liegenden, in St. 5,1 angelegten und 5 Lachter tiefen Schachtes betreibt man gegenwärtig ein Ort in die Richtung vom Mittag Abend, womit man zur Zeit ohngefähr 6 Lachter weit fortgerückt und bey dieser Länge bis an die vorige, mit dem nahegelegenen, alten Förderschachte zusammenhängende alte Baue gekommen ist und dabey etwas Braunstein gewonnen hat. Zu gleicher Zeit hat man gegen Morgen ein Ort angelegt, um mit demselben nach einer ohngefähr 10 Lachter nach der vorerwähnten Weltgegend entfernten, neuen, ohngefähr 6 Lachter tiefen, auf Eisenstein niedergebrachten, aber an Wettermangel leidenden Schacht durchschlägig zu machen.“ Diese Ausrichtungsbaue hielten wohl den eigentlichen Abbau erst einmal auf, denn an den Verwiegetagen ist die Grube in dieser Zeit nicht angeführt. Stattdessen gab es im letzten Quartal noch eine Befahrung durch den Geschworenen, über die es in dessen Fahrbogen heißt (40014, Nr. 267, Film 0083): „Montags, den 22ten Decembr. gefahren auf Gelber Zweig Fdgr. in Langenberg, belegt mit
Man hat zur Sommerzeit zwischen den beyden hier vorhandenen Schächten und zu Erlangung des zu (...?) aus angelegten Versuchsörtern und kleine Abbaue auf Braunstein und Eisenstein nöthigen Wetterwechsels im Lauf dieses Quartals ein Ort aus den beyden 5 und 6 Lachter tiefen Schächten 10 Lachter gegen Mittag getrieben und hat damit in den benachbarten vorhin erwähnten, gegen die genannte Weltgegend gelegenen Schacht erschlagen, mithin die beabsichtigte Verbindung erlangt, Wetterwechsel hergestellt und ist nunmehr in dem Stande, die daselbst stehen gebliebenen Arbeiten wieder in Angriff zu nehmen und Eisenstein zu gewinnen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach seiner ersten Befahrung im
folgenden Jahr am 20. Februar 1824 hielt Herr Gebler dann in seinem
Fahrbogen fest, die Belegung sei unverändert bei 2 Mann und (40014, Nr. 271, Film 0010):
„Zwischen den hier befindlichen, seit dem vorigen Quartal nunmehr durch Ortsbetrieb und erfolgten Durchschlag miteinander verbundenen, 5 bis 6 Ltr. tiefen Schächten, gewinnt man auf dem unmittelbar in beyder Umgebung vorhandenen Lager sowohl Brauneisenstein, als Braunstein auf hier gewöhnliche Weise, ohne daß sich hierüber etwas besonderes sagen läßt.“ Ähnlich lautet auch sein Fahrbericht vom 10. August 1824 (40014, Nr. 271, Film 0053): „Desselben Tages gefahren auf Gelber Zweig Fdgr. bey Langenberg, belegt mit
Wechselweise betreibt man die in dem Umkreise der beyden zu dieser Grube gehörigen Schächte liegenden Mittel von Brauneisenstein, welchen stellenweise etwas Braunstein beygemischt ist, mit Hülfe der von dem mitternächtlichen Schacht gegen Mittag Morgen und von dem mittäglichen Schachte gegen Abend zu gelegenen Örtern orts- und strossweise, ohne daß sich hierüber etwas besonderes sagen läßt.“ Herr Gebler befuhr die Grube nochmals am 18. November 1824, worüber er in seinem Fahrbogen notierte (40014, Nr. 271, Film 0068), man habe ein Lager von Braunstein angefahren, mit dessen Abbau man beschäftigt war. Der Eigenlöhner allerdings war krank und abwesend, daher auch der Eisensteinabbau nicht umgängig. In den Eisensteinbauen sei auch die Zimmerung zu erneuern. Mit Ausbringen ist die Gelber Zweig Fundgrube an den Verwiegetagen im ganzen Jahr 1824 nicht genannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 18. Mai des Folgejahres 1825 kam es
dann zu der oben schon ausführlich betrachteten Generalbefahrung auf den
Ländereien des Förstelgutes, über die Herr Gebler in seinem
Fahrbogen kurz notierte (40014, Nr. 273, Film
0034), an jenem Tage „habe
ich der Generalbefahrungen auf nachstehenden, auf des Ritterguthes Förstel
Grund und Boden liegende Grubengebäude, als
Osterfreude, Christbescherung, Gelber Zweig und Friedrich Fdgr., ingleichen eines neu angefangenen, noch nicht bestätigten Versuchs Stöllnchens auf Eisenstein, so wie der Begehung deren Umgebürge über Tage und der Besichtigung der zu den genannten Gebäuden gehörigen Halden und Schächte beygewohnt.“ Weitere Notizen über Befahrungen dieser Grube durch den Geschworenen fanden sich aus dem Jahr 1825 nicht. Auch an den Verwiegetagen ist die Grube wieder nicht genannt, obwohl sie laut den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22) in diesem Jahr die nicht unbedeutende Menge von 56 (Berg-) Zentnern (rund 2,9 metrische Tonnen) ausgebracht habe. Dieser nicht ganz uneinträgliche Grubenbetrieb muß auch im Folgejahr stattgefunden haben. Auch Reminiscere 1826 fand zwar keine Befahrung der Grube durch den Geschworenen statt, doch notierte Herr Gebler am 13. April 1826, er habe hier 15½ Fuder Eisenstein zu vermessen gehabt (40014, Nr. 275, Film 0030). Tatsächlich hat die Grube im Jahr 1826 neben insgesamt 42 Zentnern Braunstein auch 15½ Fuder Eisenstein ausgebracht (40166, Nr. 22). Schichtmeister Christian Traugott Trommler hatte am 14. März 1826 vor dem Bergamt eine Pochwerkstelle „an dem unteren Ende genannten Dorfes (Langenberg) bey der Brücke auf Christian August Weisflogs Grund... nebst einem Rade Waßer aus dem Langenberger Dorfbach und einem Waßerlauf“ gemutet und erhielt diese am 6. April des Jahres bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 52 sowie 40014, Nr. 43, Blatt 308f). Mit dem Grundeigentümer hatte der Schichtmeister einen jährlichen Zins von 16 Groschen für die Flächennutzung vereinbart.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Monat später berichtete der Geschworene (40014, Nr. 275, Film 0039): „Desselben Tages (am 24. April 1826) habe ich mich weiter hinunter nach Langenberg begeben, wo man von Seiten der Grube Gelber Zweig ein trockenes Pochwerk zu dem Pochen des Braunsteins zu erbauen angefangen und habe hierzu die nöthigen Rathschläge und Anweisungen zu Erbauung der Maschinentheile gegeben.“ Und nur zwei Tage später heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 275, Film 0040): „Desselben Tages (am 26. April 1826) habe ich mich auf die neue Pochwerksstelle bey Langenberg begeben, wo man bereits das 5½ Ellen hohe unterschlägige Pochwerksrad zu hängen beschäftigt war und habe hier zum (?) und Hineinbauen der Pochwerks Maschine selbst die ferner nörthigen Anweisungen ertheilt.“ Schau an: Das war nun wirklich kein kleines Vorhaben und weist darauf hin, daß stetig ein Ausbringen zu verzeichnen gewesen sein muß und gute Preise für den verkauften Braunstein erzielt werden konnten. Weitere Aufzeichnungen zu dieser Grube finden sich in den Fahrbögen des Jahres 1826 allerdings nicht mehr. Auch in den Fahrbögen des Jahres 1827 ist die Grube überhaupt nicht genannt, was allerdings verwunderlich ist, wenn die Eigner ein solches Vorhaben, wie den Bau eines Trockenpochwerks angehen (40014, Nr. 278). Was aus diesem Projekt geworden ist, können wir daher hier nicht berichten... Wahrscheinlich aber ist dieses Pochwerk erst später wirklich in Betrieb gegangen, denn wie wir in den Fahrbögen der Folgejahre oft lesen können, ist der Absatz an Braunstein drastisch eingebrochen und gute Preise waren nicht mehr zu erzielen. Schon in seinen Fahrbögen aus dem Jahr 1828 hatte der Geschworene mehrfach (z. B. am 2. Juni des Jahres) notiert, er habe sich „in die Langenberger Revier begeben und den Zustand mehrerer Brauneisenstein Gruben in Betracht des vorhandenen Braunsteins (?) untersucht, auch ein paar Versuche, so man mittelst Schürfen unternommen, besehen.“ (40014, Nr. 280, Film 0041) Am 3. September heißt es: „habe ich in Betreff des auf den Gruben der Langenberger Revier vorräthigen Braunsteins die nöthigen Untersuchungen angestellt.“ (40014, Nr. 280, Film 0066) Und am 10. Oktober 1828 hat er notiert: „habe ich in die Langenberger Revier zu Besichtigung der auf den dortigen Gruben vorhandenen Braunsteinvorräthe begeben.“ (40014, Nr. 280, Film 0075) Der Braunstein wurde lieber auf Halde gelegt, als zu nicht kostendeckenden Preisen verschleudert. Am 7. August 1829 schrieb Herr Gebler konkreter, er habe „die Schwarzbacher und Langenberger Reviertheil in Betreff der auf dasigen Gruben vorhandenen Braunsteinvorräthe besucht und gefunden, daß es dermalen immer noch sehr an dem nöthigen Absatze fehlt.“ (40014, Nr. 280, Film 0155) Dennoch weisen die Erzlieferungsextrakte (40166, Nr. 22 und 26) für diesen Zeitraum aus, daß die Grube Gelber Zweig 1826 außer Eisenstein auch 42 Zentner Braunstein gefördert hat. Die Jahresförderung an Braunstein stieg in den Folgejahren stetig an und erreichte 1830 mit 92 Zentnern einen vorläufigen Höhepunkt. Erst aus dem Fahrbogen vom 1. November 1828 erfahren wir, daß es die Grube überhaupt noch gibt, denn an diesem Tage hatte Herr Gebler hier „eine Feldstreitigkeit zwischen den Eigenlöhnern der beyden Gruben Friedrich Fdgr. und Gelber Zweig Fdgr beyderseits zu Langenberg nach vorgängiger mittelst Messung angestellter Untersuchung beyzulegen gesucht und die Lehnträger beschieden.“ (40014, Nr. 280, Film 0080) Aus dem Fahrbericht zur Friedrich Fundgrube vom 14. Mai 1829 (40014, Nr. 280, Film 0137) erfahren wir dann, daß man dort „zu gleicher Zeit (...) mit dem Grubengebäude Gelber Zweig durchschlägig geworden (ist) und hält nun mit diesem nach einer im vorigen Herbst angegebenen Richtungslinie Markscheide einander.“ Außerdem war Herr Gebler in diesem Jahr am 14. August auf Gelber Zweig Fdgr. zugegen, um eine Menge von 17 Fudern ausgebrachten Eisensteins zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0157). Irgendwas haben die zwei Eigenlöhner also auch in dieser Zeit gemacht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Sommer des Jahres 1830 war der Geschworene dann wieder zweimal vor Ort, um insgesamt 24 Fuder, 4 Tonnen Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0241 und 0265). Vom 13. Oktober 1830 gibt es auch wieder einmal einen Fahrbericht (40014, Nr. 280, Film 0265f), in dem es über den Grubenbetrieb heißt: „Aus dem Morgenstoße des Tageschachtes hat man ein Ort gegen Morgen getrieben und bey wenigen Lachtern Länge ein andres gegen Mittag angehauen, um mit demselben demjenigen entgegenzufahren und mit ihm durchschlägig zu werden, welches von dem ersteren Punkte aus ohngefähr 20 Ltr in einer unregelmäßig krummen, von Morgen gegen Mittag, gegen Abend und zuletzt Mitternacht in sich selbst zurücklaufenden und etwas ansteigenden Richtung dem oben erwähnten, neu angehauenen Orte entgegengetrieben und mit welchem man – eine leichtere Förderung damit bezweckend – nächsten Tage durchschlägig werden wird. Von der erstren Hauptrichtung aus finden sich sodann Örter nach verschiedenen Richtungen, in der Hauptsache aber gegen Morgen nach der mit Friedrich Fdgr. zu haltenden Markscheide getrieben, von welcher sich das eine nur etwa 2 bis 3 Ltr. entfernt befinden mag. Mit diesen Örtern hat man das hier befindliche Brauneisensteinlager verschiedentlich an- und durchfahren und stellenweise abgebaut, zugleich auch abwechselnd etwas Braunstein gewonnen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Jahr 1831 gibt es wieder keine
Fahrberichte des Geschworenen zu dieser Grube. Jedoch war Herr Gebler
in diesem Jahr zweimal hier, um insgesamt 36 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 281,
Film 0061 und 0067). Dies
war wieder etwas mehr, als im Vorjahr, im Vergleich zu den anderen Gruben
jedoch eine winzige Menge.
Auch im Jahr 1832 kamen, den Eintragungen des Geschworenen in den Fahrbögen zufolge, hier nur 14 Fuder Eisenstein zusammen (40014, Nr. 281, Film 0117). Die beiden Zahlen entsprechen hier übrigens genau den Angaben in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26). Zwar ist in den Fahrbögen auch in diesem Jahr mehrfach nur allgemein vermerkt, Herr Gebler habe „die Braunsteingruben der hiesigen Reviere in Betreff der Vorräthe von Braunstein besucht,“ (40014, Nr. 281, z. B. Film 0135) leider aber gab er nie an, ob er die Vorräte auch verwogen und welche Menge an Braunstein in derselben Zeit ausgebracht worden ist. Diese Förderung ist nur in den Erzlieferungsextrakten vermerkt und belief sich für die Grube Gelber Zweig im Jahr 1833 auf 76 Zentner (≈4 t). Außerdem änderten sich im Sommer 1832 aber die Besitzverhältnisse, indem einer der beiden Eigenlöhner teilweise ausschied, was folgender Eintragung im Fahrbogen vom 8. Juni 1832 zu entnehmen ist (40014, Nr. 281, Film 0125): An diesem Tag hat sich Herr Gebler nämlich „nach Langenberg begeben und bey dem Verkauf und Fertigung des Kaufaufsatzes über das zu dem Grubengebäude Gelber Zweig daselbst gehörige, den beyden Eigenlöhnern, Weißflog und Trommler, zeither gemeinschaftlich zuständige, von dem letzteren aber nunmehr auch in Ansehung der in Besitz gehabten Hälfte nunmehr an ersteren gänzlich überlassnen Braunsteinpochwerks auf Verlangen zugegen gewesen.“ Ach, schau mal an: Von dem Pochwerk war in den letzten Jahren seit dessen Bau nichts mehr zu hören... Ob der Herr Trommler hier nur seine Anteile am Pochwerk aufgab (so klingt der Text), oder ob er aus dem Grubenbesitz ganz ausschied, ist nicht ganz gewiß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste Fahrbogen des Geschworenen
datiert dann auf den 26. Februar 1833 (40014, Nr. 281,
Film 0169f). Zuvor hatte
Herr Gebler an diesem Tage aber anderes zu klären: Wie er schrieb,
hat er sich „nach Langenberg
und auf die Stelle des daselbst befindlichen Braunstein- Pochwerks in
Betreff der von dem Grundbesitzer und von verschiedenen dessen Nachbarn
gegen den Besitzer des Pochwerks erhobenen Beschwerden begeben, so
angeblich durch Hereintreten der Aufschlagewasser aus dem nahgelegenen
Schwarzbach in einen dabey befindlichen Brunnen verursachte Verunreinigung
des letzteren entstanden waren, habe alles deshalb erforderliche
besichtiget, übrigens aber die Partheyen beschieden.“
Nachdem dies erledigt war: „Desselben Tages (am 26.2.1833) bin ich gefahren... auf der Eigenlöhner Grube Gelber Zweig zu Langenberg, belegt mit 1 Eigenlöhner, 1 Knecht, ingleichen auf Friedlicher Vertrag... habe aber auf beyden wenig bemerkenswerthes, vielmehr alles noch in dem schon mehrmals beschriebenen Zustande angetroffen. Auf der ersteren Grube indessen, auf dem Gelben Zweig, hat sich der Braunstein schon seit einiger Zeit sehr selten gemacht und die jetzigen Anbrüche kommen nur einzeln in kleinen Streifen und Nestern vor.“ Da die bisher aufgeschlossenen Vorkommen nun offenbar weitgehend abgebaut waren, liest man im Fahrbogen vom Quartal Crucis 1833 dann wieder von neu angelegten Schächten beim Rittergut Förstel (40014, Nr. 281, Film 0218): „Desselben Tages (am 12.9.1833) habe ich diejenigen Stellen in dem Holze bey dem Ritterguth Förstel besichtigt, wo zwey neue Schächte, und zwar einer von Seiten der Grube Friedrich Fdgr. und der andere für das Grubengebäude Gelber Zweig, und zwar mit der möglichst geringsten Benachtheiligung des Hrn. Grundbesitzers angelegt worden sind.“ Mehr gab es für den Geschworenen, natürlich auch in Anbetracht der geringen Belegung und des dementsprechend wenig umfänglichen Betriebes, in diesem Jahr auf Gelber Zweig nicht zu tun... Auch im Folgejahr findet man nur eine einzige Notiz zu dieser Grube in den Fahrbögen (40014, Nr. 289, Film 0031): Am 4. Juni 1834 nämlich hatte sich Herr Gebler „auf das Langenberger Braunstein- Pochwerk (das sagt er hier zwar nicht ausdrücklich, aber es gab doch bei Langenberg nur das eine bei der Grube Gelber Zweig ?) begeben, woselbst man damit beschäftigt war, eine neue Welle einzuziehen, die man eines bessren Ganges wegen anstatt zeither dreyhebig nunmehr vierhebig eingerichtet hatte.“ Wie dieses Pochwerk ausgesehen haben
könnte, verrät uns ein 1850 für ein ähnliches Pochwerk zu Raschau
gezeichneter
Anscheinend war der Geschworene im Jahr 1835, des geringen Betriebes wegen, überhaupt nicht hier. Der nächste Eintrag zu Gelber Zweig Fundgrube datiert erst auf den 16. Juni 1836. Herr Gebler hatte an diesem Tag gerade einmal 5 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 289, Film 0186). Im gleichen Zeitraum hatte man hier aber ausweislich der Erzlieferungsextrakte auch eine Menge von 63 Zentnern (zirka 3,2 t) Braunstein gewonnen (40166, Nr. 22 und 26). Danach setzen die Erwähnungen dieser Grube aus und im Quartal Trinitatis 1838 enden auch die überlieferten Fahrbögen aus der Hand des Geschworenen Gebler.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab Reminiscere 1840 war Herr Theodor
Haupt als Berggeschworener in Scheibenberg bestellt. Der neue
Geschworene hat auch gleich am 10. Januar des Jahres alle gangbaren Gruben
des Reviers befahren und berichtete über diese (40014, Nr. 300,
Film 0016): „Auf Alter Gelber Zweig gev Fdgr. hat man die bei 3 Lachter Schachttiefe in SW. hora 4,4 schon 4 Lachter getriebene Strecke wieder verlaßen, weil man hiermit in alten Bau kam, und längt nun in derselben Sohle in SO hora 11 auf einem sehr hübschen Braunsteinlager aus.“ Oh, sie heißt jetzt ,Alter' Gelber Zweig... Am 7. April 1840 fand dann die auf das folgende Quartal erforderliche Befahrung durch den Geschworenen statt (40014, Nr. 300, Film 0042). Jetzt berichtete er, das Ort in 4 Lachter Saigerteufe und 1 Lachter südsüdöstlicher Entfernung vom Schacht werde weiter „in Mulm mit etwas Braunstein betrieben.“ Die nächste Befahrung durch Herrn Haupt erfolgte am 10. August 1840 (40014, Nr. 300, Film 0092f). Das ,Alter' im Grubennamen hat er jetzt in seinem Fahrbericht wieder weggelassen. Es heißt darin über den Betrieb: „Auf Gelber Zweig gev. Fdgr. hat der Lehnträger wiederum einen neuen Tageschacht niedergebracht und deren nun in diesem Felde 3, wovon der 2te 2 Lachter vom ersten in SW., der 3te 3 Lachter vom 2ten in West liegt. Der 3te Schacht ist 2 Lachter tief und von da aus eine Strecke 2 Lachter lang in Süd getrieben worden, womit schöne Anbrüche von Braunstein entdeckt worden sind.“ Noch eine weitere Befahrung führte Herr Haupt am 8. September durch, von der er berichtete (40014, Nr. 300, Film 0108f), während andere Gruben bereits unter Wettermangel litten habe man „Auf Gelber Zweig (...) in dem 3ten Tageschachte in 2 Lachter saigerer Teufe eine Strecke 1 Lachter lang in Süd in Mulm und sehr schönem Braunstein im Steigen aufgefahren, so daß man vor Ort nun noch 1 Lachter Gebirge ohngefähr über sich hat.“ Schon anhand der geringen Schachttiefen sieht man ja, daß hier quasi ,unter dem Rasen' abgebaut wurde...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Ende Crucis
1840 bis Mitte Reminiscere 1841 wurden Herrn Haupt wohl andere
Aufgaben übertragen. In dieser Zeit wurde er in seiner Funktion als
Geschworener des Bergamts Scheibenberg durch den Raschau'er Schichtmeister
Friedrich Wilhelm Schubert vertreten. Derselbe fand bei seiner
Befahrung am 28. November 1840 auch diese Grube
unbelegt: „Auf dem Rückwege habe ich bei Gelber Zweig gev. Fdgr.,
Friedrich gev. Fdgr., Gott segne beständig gev. Fdgr., Ullricke gev. Fdgr.
und Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. niemand in Arbeit getroffen.“
(40014, Nr. 300,
Film 0134f)
Und auch unter dem 17. Dezember diesen Jahres hielt er in seinem Fahrbogen fest, er habe an diesem Tage „bei Riedels gev. Fdgr., Friedrich und den übrigen Eigenlöhnergruben bei Langenberg abermals niemand in Arbeit getroffen.“ (40014, Nr. 300, Film 0140f) Auf Gelber Zweig hingegen ging wieder Betrieb um, worüber Herr Schubert berichtete: „Hierbei fand ich zu bemerken, daß der Neuschacht hora 3,4 gegen Südwest 5,9 Ltr. vom Fundschachte entfernt liegt.“ Mit demselben hatte man nur 1 Lachter tief ein 0,3 Lachter mächtiges Braunsteinlager gefunden und „dessen Ausgehendes mit einem steigenden Orte bis unter den Rasen abgebaut.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trinitatis 1841 war dann Herr Haupt
wieder in seinem Amt in Scheibenberg und hat die Gruben am 27. Juli 1841
wieder selbst befahren. Über diese heißt es im Fahrbogen unter diesem
Datum nur knapp
(40014, Nr. 300,
Film 0208): „Auf Gelber
Zweig hat man Wettermangels halber einen neuen kleinen Schacht einige
Lachter niedergebracht und dafür einen alten wieder ausgestürzt. Auf der
Verbindungsstrecke hat man etwas Braunstein angefahren, den man jetzt
abbaut.“
Auch der Fahrbericht vom 18. August 1841 ist nicht weniger knapp gehalten (40014, Nr. 300, Film 0224): „Auf Gelber Zweig fahren 1 – 2 Mann an, die von dem 2 Lachter saigeren Tageschächtchen aus vor einem 2 Lachter in Ost erlängten Orte einige Nester Braunstein abbauen.“ Im Herbst des Jahres wurde Herr Haupt erneut höheren Orts zu anderen Aufgaben abberufen, worauf die Funktion des Geschworenen diesmal durch den Rezesschreiber Lippmann aus Annaberg wahrgenommen wurde (40014, Nr. 300, Film 0230). Dieser letztere befuhr die Grube am 15. September 1841 und berichtete wenig ausführlicher (40014, Nr. 300, Film 0242): „Auf Gelber Zweig findet dermalen wegen schwachen Anbrüchen nur ein schwacher Betrieb statt. Man betreibt vom Fundschacht aus ein Ort in 2,2 Lachter Teufe hora 10,0 SO. in gelbem Mulm mit Schnüren und Nestern von Braunstein, was bis jetzt 3 Lacher erlängt ist.“ Außerdem werde der Fundschacht in neue Zimmerung gesetzt. Was soll man über den ,schwachen Betrieb' aber auch groß sagen... Bis zu seiner nächsten Befahrung am 11. November 1841 war das Streckenort auf 6 Lachter Länge fortgerückt. Der Braunstein breche hier aber nur noch „in höchst mäßiger Quantität nesterweise“ ein (40014, Nr. 300, Film 0261f). Von Interesse ist aber noch die folgende Bemerkung Lippmann's: „Das der Grube zugehörige und am unteren Ende von Langenberg liegende 3stemplige Trockenpochwerk ist in der letzteren Zeit durch bedeutende Reparaturen wieder in gangbaren Zustand gebracht, und zu diesem Behufe das Wehr und Fluther neu hergestellt, ein neues 6 Ellen hohes, 1½ Ellen weites, mit 32 Schaufeln versehenes unterschlägiges Pochrad an die noch brauchbare 4hiebige Pochwelle gebaut, 2 neue Pochsäulen gesetzt, 1 neuer Pochstempel eingezogen und verschiedene kleinere Ausbesserungen vorgenommen worden. Benutzt wird dasselbe nur allein zum Pochen des Braunsteins.“ Ach schau an ‒ das gab´s ja auch immer noch. Herr Lippmann war noch einmal am 8. Dezember 1841 vor Ort (40014, Nr. 300, Film 0268f). Die Verbindungsstrecke war bis dahin vermutlich durchschlägig geworden, denn die beiden Eigenlöhner hatten „das Abteufen des Förderschachts in Angriff genommen, und ihn auf nunmehr 2,7 Lachter verteuft.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über seine Grubenbefahrung am 9. März
1842 hielt Herr Lippmann dann in seinem Fahrbogen fest
(40014, Nr. 321,
Film 0016f):
„Auf Gelber Zweig gev. Fdgr. bei Langenberg hatten sich in dem bis ca. 2,5 Lachtern Teufe abgesunkenen neuen Förderschachte sowohl, als auch vor den aus demselben getriebenen Versuchsörtern die Braunsteinanbrüche theils ganz verloren, theils außerordentlich verringert, so daß der Eigenlöhner den Betrieb in diesem Theile seines Feldes aufgegeben und sich dafür in den vom sogenannten Wetterschacht in Mittag Morgen liegenden Theil seines Grubenfeldes eingelegt hat. Von diesem 3 Lachter tiefen Schacht aus wird jetzt ein Ort in der Richtung hora 9 SO. auf einem... Braunsteintrum von 3 – 5 Zoll Mächtigkeit getrieben, welches 5 Lachter... erlängt ist. Der verlassene Förderschacht ist zum größten Theile schon wieder mit den beim jetzigen Betriebe gefallenen Bergen ausgestürzt worden.“ Bei seiner nächsten Befahrung am 27. April 1842 fand Herr Lippmann dann schon wieder einen neu abgesunkenen Tageschacht und von diesem aus trieben die Eigenlöhner in 4 Lachter Teufe ein Ort gegen Morgen, das 4 Lachter weit auf einem 6 Zoll mächtigen Braunsteintrum ausgelängt war (40014, Nr. 321, Film 0032). Dabei kam offenbar auch etwas Ausbringen zustande, denn Herr Lippmann notierte zwei Monate später (40014, Nr. 321, Film 0048): „Am 21. Juni und 22. Juni inspizierte ich die Eigenlöhnergruben bei Langenberg, im Tännicht und bei Schwarzbach, unter den ich Köhlers, Ullricke, Bescheert Glück, Distlers Freundschaft und Meyers Hoffnung gev. Fdgr. unbelegt fand und vermaß sodann auf Gelber Zweig und Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. eine Parthie Braunstein.“ Über die zugleich vorgenommene Befahrung der Grube heißt es, bei Gelber Zweig haben die anfahrenden 2 Mann bei 4 Lachter Teufe vom neuen Tageschacht mit dem Feldort gegen Morgen, das schon 4 Lachter erlängt war, auf dem in Mittag einschießenden, 6 Zoll mächtigen Braunsteintrum um einen weiteren Lachter fortgestellt, sind dort aber (wieder mal) in alten Mann gekommen. Deshalb haben sie den Schacht um weitere 1½ Lachter abgeteuft und dort gegen Abend „in mittleren Braunsteinanbrüchen 3 Lachter bis vorliegenden alten Mann ausgelängt.“ Dort wurden nun mehrere, in 1½ Ellen Abstand von einander liegende Braunsteintrümer fallortweise gegen Süd abgebaut (40014, Nr. 321, Film 0049). Luciae 1842 kehrte Herr Haupt nach Scheibenberg zurück und befuhr diese Grube am 21. Dezember wieder selbst. In seinem Fahrbogen steht darüber zu lesen (40014, Nr. 321, Film 0121): „Auf Gelber Zweig gev. Fdgr. arbeiten 2 Mann, die in 5½ Lachter saigerer Tiefe des Tageschachtes in Süd 5 Lachter lang ortweise in Mulm aufgefahren und hiermit etwas hübschen Braunstein, der mit Hornstein zusammen vorkommt, ausgerichtet haben, den man mit einem Örtchen in West verfolgt. Auch in der oberen Sohle hat man etwas Braunstein aufgehauen, dem man abteufenweise nachgeht.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im nächsten Jahr 1843 war Herr Haupt
erstmals wieder am 20. März zugegen und
hat „die Markscheide zwischen zwei Braunsteingruben bei Langenberg
angegeben, sodann für Riedels und Gelber Zweig gev. Fdgr. Braunstein
verwogen.“ (40014, Nr. 321,
Film 0121) Zwei Tage später
sollte eine Befahrung stattfinden, allein die Grube
war „wegen vielen Bergen nicht fahrbar, da der Eigenlöhner durch einen
Schaden an der Hand verhindert worden ist, dieselben zu tage zu fördern.“
(40014, Nr. 321,
Film 0144f) Danach wurde
Herr Haupt erneut abgeordnet und wieder trat Herr Lippmann
an seine Stelle.
Der fand bei seiner Befahrung am 3. Mai 1843 aber nichts wirklich neues vor. Im Fahrbogen steht zu lesen, man verfolgte in 6 Lachtern Teufe und in nun 8 Lachtern südöstlicher Entfernung vom oberen neuen Schacht mehrere, in 1½ Ellen Entfernung voneinander lagernde Braunsteintrümer streichenderweise. Auch fänden sich mitunter Knollen von Brauneisenstein (40014, Nr. 321, Film 0173). Dann kam es in den Sommermonaten wieder zu den altbekannten Problemen und Herr Lippmann konnte am 13. Juni 1843 nur notieren, die Grube sei wegen Wettermangel nicht zu befahren und die Eigenlöhner befaßten sich mit dem Auskutten übertage (40014, Nr. 321, Film 0182). Auch am 21. September wurde die Grube aus demselben Grund noch nicht wieder betrieben (40014, Nr. 321, Film 0209). Erst am 22. November 1843 konnte Herr Lippmann wieder eine Befahrung durchführen, über die er in seinem Fahrbogen festhielt (40014, Nr. 321, Film 0224), es sei „vom Eigenlöhner in letzter Zeit nur wenig gethan worden.“ Man baute noch immer bei 5,5 Lachter Teufe mittelst der vom Neuschachte nach Mittag und Morgen getriebenen und 4 Lachter weit erlängten Feldörter den „nur sparsam im Mulm vorkommenden Braunstein“ ab. Herr Haupt kehrte Ende Dezember 1843 nach Scheibenberg zurück. Seine nächste Notiz zu dieser Grube unter dem 29. Februar 1844 (40014, Nr. 322, Film 0019) lautete aber nur kurz: „Auf Gelber Zweig gev. Fdgr. findet seit Anfang dieses Quartals in Folge eines Processes unter den Erben des früheren Lehnträgers gar kein Betrieb statt.“ Man weiß nicht so genau, worum sich die Erben vor Gericht stritten, denn der verstorbene Lehnträger, Carl August Weisflog, war doch eigentlich ,nur' Steiger und hatte gewiß keine großen Reichtümer zu vererben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Berggeschworene Haupt muß zu
jener Zeit auch andernorts ein gefragter Fachmann gewesen sein, denn schon
im April 1844 wurde er erneut mit anderen Aufgaben betraut. Diesmal wurde
er in seiner eigentlichen Funktion durch den Markscheider Friedrich
Eduard Neubert vertreten. Der letztere befuhr die Grube erstmals am
10. Mai 1844 und schrieb in seinem Fahrbogen darüber, sie sei zeither
nicht betrieben worden, solle aber nächstens wieder belegt werden
(40014, Nr. 322,
Film 0039). Außerdem heißt
es: „Hier fand ich die einzige offene, vom Tageschacht erst 1 Ltr. in
SO. hora 11,2 dann 2 Ltr. in NO. hora 5,1 und endlich 3 Ltr. in SO. hora
8,2 fortgetriebene Strecke vor Ort verbrochen. Bei Wiederbelegung der
Grube wird man diesen Bruch gewältigen und dann das Ort in der letztern
Richtung zu Aufsuchung von Braunsteinanbrüchen weiter fortstellen. Sonst
war etwas Bemerkenswerthes hier nicht wahrzunehmen.“
Wirklich wieder belegt hat man die Grube aber dann offenbar doch nicht. Herr Neubert machte in seiner Notiz vom 12. Juni 1844 (40014, Nr. 322, Film 0047f) allerdings einmal nicht die üblichen sommerlichen Wetterprobleme dafür verantwortlich: An diesem Tage nämlich „beabsichtigte ich, die übrigen im Tännicht und bei Langenberg liegenden Gruben, als Riedels, Reppels, Köhlers, Gelber Zweig, Friedrich, Gott segne beständig, Hausteins, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. zu befahren, sie waren jedoch sämmtlich außer Belegung, wovon bei den meisten die Unmöglichkeit, die Producte zu verwerthen, die Ursache sein mag.“ Oder das... Auch bei seiner Befahrung am 1. August 1844 fand Herr Neubert jedenfalls die Gelber Zweig Fdgr. unbelegt vor (40014, Nr. 322, Film 0056f) und seinem Fahrbogen aus der 10. bis 13. Woche Crucis (September) 1844 fügte er am Ende noch an (40014, Nr. 322, Film 0068): „Übrigens bemerke ich noch, daß ich in No. 10te und 11te Woche zu mehreren Malen die Gruben Distlers Freundschaft, Hausteins Hoffnung, Friedrich, Gelber Zweig, Köhlers und Reppels gev. Fdgr. bei Langenberg... besuchte, diese aber stets unbelegt fand.“ Das blieb auch den ganzen Winter 1844/1845 so: Auch bei seinen Befahrungen am 15. November, am 6. Dezember 1844 und am 15. Januar fand Herr Neubert die Grube Gelber Zweig unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0075, 0082 und 0092).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über seine Befahrung am 14. März 1845
heißt es dann im Fahrbogen, die Grube werde „blos durch den Lehnträger in
Betrieb gehalten“, welcher vor einem ansteigenden Orte arbeitete, das
in 3,4 Ltr. Teufe des Förderschachtes und 0,9 Ltr. von demselben angesetzt
und 0,7 Ltr. hora 11,4 in Süd fortgestellt war, um Braunsteinanbrüche
aufzusuchen. außerdem befand er die Zimmerung in dem nur noch 3,8 Ltr.
offenstehenden Tageschacht sehr wandelbar und müsse baldigst repariert
werden (40014, Nr. 322,
Film 0100). Weitere
Befahrungen erfolgten am 16. Mai und im September 1845, wobei aber nicht
bemerkenswertes oder die Grube unbelegt vorgefunden wurde (40014, Nr. 322,
Film 0115 und 0143). An
Ausbringen sind bis zum 6. Juni 1845 daher auch nur 6 Zentner Braunstein
zusammengekommen (40014, Nr. 322,
Film 0119).
Von seinen Befahrungen im Revier am 18. und 19. Dezember 1845 berichtete Herr Neubert dann über Gelber Zweig, daß „der Eigenlöhner beabsichtigt, nachdem er in neuerer Zeit nach verschiedenen Richtungen von dem Fundschachte aus Versuchsörter, mit welchen immer in sehr kurzer Länge in Preßbau geschlagen worden ist, getrieben hat, in 6 Ltr. Entfernung vom Schacht einen neuen abzusinken, da hier sich wahrscheinlich noch ein unabgebauter Theil des Grubenfeldes befindet.“ Der jetzige Tageschacht sollte dann als Wetterschacht dienen und der alte Wetterschacht ausgestürzt werden (40014, Nr. 322, Film 0160). Wahrscheinlich... Vielleicht wäre es ja sinnvoll, nachdem man von untertage her schon in alle Richtungen in alten Mann eingeschlagen hat, nicht nur 12 m daneben den nächsten Schacht abzusinken, sondern wirklich in frisches Feld zu gehen, wo noch keiner die oberen 10 Meter Boden durchwühlt hat ? Jedenfalls hat Herr Neubert dann am 12. und 13. Februar 1846 „unter Zuziehung des Grundbesitzers den Punkt besichtigt“, wo der neue Schacht geteuft werden soll und dessen Absinken „unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes gestattet, da dieser Punkt von dem zeitherigen Förderschacht (nur) 5,5 Lachter in SO entfernt und circa 1 Lachter über dessen Hängebank in einem wahrscheinlich noch unverritzten Theil des Grubenfeldes liegt (...) und auch von dem Grundbesitzer dagegen etwas nicht eingewendet wurde.“ (40014, Nr. 322, Film 0172f) Am 16. März hat Herr Neubert zwar keine Arbeiter vor Ort angetroffen, aber den neuen Schacht auf 1,3 Lachter Teufe ausgehoben. Auch am 14. April 1846 war die Grube nicht belegt, das Schachtabteufen aber dennoch weiter vorangeschritten und dasselbe nun 3 Lachter tief (40014, Nr. 322, Film 0180 und 0185). Von seiner Befahrung am 3. Juni 1846 heißt es im Fahrbogen, die Grube sei nur „periodisch mit 2 Mann belegt.“ Der neue Schacht war nun 4,2 Ltr. tief und dort ein Ort in Mulm nach NO. angehauen, wo man „Spuren von Braunstein“ fand (40014, Nr. 322, Film 0198f). Von den weiteren Befahrungen in diesem Jahr gab es nichts zu berichten oder die Grube war wieder nicht belegt (40014, Nr. 322, Film 0213 und 0218f). Erst am 21. Januar 1847 fand Herr Neubert dann die Grube wieder belegt und den neuen Tageschacht auf nun 5 Lachter Teufe niedergebracht (40014, Nr. 322, Film 0237). Mit dem Quartal Reminiscere 1847 enden dann leider die ausführlichen Überlieferungen in diesem Aktenbestand.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch in der Grubenakte
folgt leider eine ziemlich große zeitliche Lücke, denn nach dem Protokoll
zur Generalbefahrung vom Juli 1820 ist als nächstes Blatt das Protokoll
zur Umwandlung des Grubenfeldes nach den Maßgaben des Berggesetzes von
1851 abgeheftet, welche demnach am 13. Mai 1857 für die Gelber Zweig
Fdgr. formal erfolgt ist (40169, Nr. 138,
Blatt 5). Dem Protokoll zufolge
umfaßte das Grubenfeld 1.176 Quadratlachter oder nun neuerdings 2 Maßeinheiten. Es handelte sich folglich zuvor um eine
Den nächsten Akteninhalt bildet eine Anzeige des Lehnträgers Weißflog vom 13. Dezember 1858, daß er als Schichtmeister Hermann August Oehme für eine Bezahlung von 10 Neugroschen pro Woche, sowie einen Steiger David Wenzel als Steigerdienstversorger mit 5 Neugroschen Wochenlohn annehmen wolle (40169, Nr. 138, Blatt 6). Dies wurde auch quasi postwendend am 15. Dezember vom Bergamt in Schwarzenberg genehmigt (40169, Nr. 138, Blatt 10). Gleichzeitig bat Weißflog um den Erlaß einer ihm angedrohten Strafe, weil er den Betriebsplan auf die Periode 1858/1860 noch nicht eingereicht habe und verwies an den seine Position gerade erst übernehmenden Schichtmeister (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 6). Der letztere entschuldigte sich mit einem nicht nachgebrachten Grubenriß, weswegen vonseiten des Bergamtes dan Markscheider Reichel mit den nötigen Arbeiten beauftragt worden ist (40169, Nr. 138, Blatt 11f). Unter demselben Datum zeigte der Lehnträger auch noch an, daß er einen neuen Schacht zur Erleichterung von Förderung und Wetterwechsel benötige, welcher östlich vom bisherigen zu liegen kommen und etwa 12 Lachter tief werden solle. Für dessen Ausbau bat er um Holzzuweisung von 24 Stämmen und 30 Stangen. Die vorzeitige Holzzuweisung wurde jedoch vonseiten des Bergamtes abgelehnt, weil ja der Betriebsplan noch nicht vorläge (40169, Nr. 138, Blatt 8f). Auf das inzwischen abgelaufene Jahr 1858 der Betriebsperiode reichte der neue Schichtmeister Oehme eine Anzeige über den Grubenbetrieb (40169, Nr. 138, Blatt 12a) ein, in welcher unter I. Ausführungen zu lesen steht, man habe „1. auf dem bebauten Braunsteinlager in Quarzbrockenfels bei 8 Lachter Teufe uter der Hängebank (...) ein Fallort hora 6 Ost 18 Lachter weit getrieben und den anstehenden Braunstein und Eisenstein 3 Lachter hoch förstenweise abgebaut und 2. wurde der Schacht neu ausgezimmert.“ Die Leistungen wurden mit 6 Mann Belegung in Weilarbeit ausgeführt. Das Ausbringen im Jahr 1858 gab der Schichtmeister mit 76 Fudern Eisenstein, die für 171 Thaler (also 2½ Thaler pro Fuder) verkauft wurden, sowie mit 205 Zentnern Braunstein, die man für 170 Thaler, 25 Neugroschen (respektive für 25 Neugroschen den Zentner) verkauft habe, an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Welchen Schacht man neu ausgezimmert
hatte, ist nicht so richtig klar, denn Geschworener Tröger
berichtete nach seiner Grubenbefahrung am 10. Juni des nächsten Jahres
1859, der Ausbau im Tageschacht sei derart desolat, daß er nu mit
Lebensgefahr zu befahren sei und ordnete ein Befahrungsverbot für den
Schacht an (40169, Nr. 138, Blatt 13).
Die Belegschaft, welche nur aus einem Knecht und zwei Bergjungen bestand,
fand er übertage mit dem Aussieben von Haufwerk beschäftigt vor, welches
angeblich schon vor 14 Tagen ausgefördert worden sei. Natürlich folgte das
Bergamt dieser Anweisung des Geschworenen und drohte gleich noch eine
Strafe von 5 Thalern an, falls der Schacht nicht alsbald in Ordnung
gebracht werde. Ach ja ‒ und der Betriebsplan lag immer noch nicht vor (40169, Nr. 138, Blatt 14).
Am 13. Juli 1859 forderte das Bergamt erneut die Vorlage eines
Betriebsplan binnen vier Wochen, widrigenfalls man Geschworenen Tröger
mit der Erstellung eines solchen auf Kosten des Besitzers beauftragen
werde (40169, Nr. 138, Blatt 15).
Geschehen ist offenbar aber nichts, denn am 5. Februar 1860 reichte Schichtmeister Oehme für das verflossene Jahr 1859 einen ,Vacat- Schein' ein, da das Gebäude in diesem Zeitraum gar nicht in Betrieb gewesen sei (40169, Nr. 138, Blatt 17). Aber erst am 17. November 1860 forderte das Bergamt den Besitzer dann zur Betriebsaufnahme auf, da kein Fristhaltungsantrag gestellt worden sei (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 17). Daraufhin wiederum reichte der Schichtmeister eine Anzeige über den Grubenbetrieb im Jahr 1860 ein, in der es heißt, die Grube sei nur Luciae 1860 und zwar mit 1 Steiger, 1 Lehrhäuer und 4 Weilarbeitern belegt gewesen (40169, Nr. 138, Blatt 19). Man hatte den Schacht noch um einen auf nun 9 Lachter Teufe abgesunken und die oberen 2 Lachter neu ausgezimmert, womit nun wohl auch der Anweisung des Bergamtes aus dem Jahr 1859 Genüge getan war. Bei 4 und bei 9 Lachter Teufe hatte man Örter um 2 bzw. um 4 Lachter ausgelängt und dabei 44 Fuder, 2 Tonnen Eisenstein gefördert. Zusammen mit dem im Vorjahr ausgeschlagenen Vorrat von 31 Fudern hatte man 1860 75 Fuder für 150 Thaler, 24 Neugroschen, also für etwas über 2 Thaler das Fuder, verkaufen können. Am 8. Juni 1861 wandte sich dann der Grundbesitzer Friedrich Traugott Weißflog an das Bergamt und beschwerte sich, daß das auf seinem Grund befindliche, zur Grube gehörige Pochwerk schon längere Zeit außer Betrieb und derart zusammengebrochen sei, daß es nicht mehr benutzbar wäre (40169, Nr. 138, Blatt 20f). Das Bergamt reichte diese Anzeige an den Lehnträger am 12. Juni weiter und wies ihn darauf hin, daß er der ihm verliehenen Wasserrechte verlustig gehe, falls er die zur Benutzung nötigen Vorrichtungen eingehen lasse (40169, Nr. 138, Blatt 23). Daraufhin sprach Carl August Weißflog am 23. Juli 1861 im Bergamt vor und erklärte, er wolle das Pochwerk erneuern und bis Schluß des Jahres wieder in Gang setzen. Dem darüber aufgesetzten Protokoll zufolge wurde festgelegt, daß die Wasserrechte verfallen werden, sollte das Pochwerk nicht Anfang 1862 wieder in Betrieb stehen. Zugleich wurde festgelegt, daß ‒ sofern es wieder in Umgang stehe ‒ zukünftig ein Wasserzins von 2 Neugroschen, 5 Pfennigen pro Quartal an das Zehntenamt zu entrichten sei (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 24). Schon vorher hatte der Pochwerks- mit dem Grundbesitzer außerdem ausgehandelt, daß für die Flächeninanspruchnahme durch Aufschlaggraben und das 16 x 10 Ellen große Gebäude ein jährlicher Grundzins von 16 Groschen zu entrichten war (40169, Nr. 138, Blatt 54).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Praktisch zur gleichen Zeit aber, der Bestätigung des zuständigen Gerichtsamtes in Scheibenberg vom 15. November 1861 zufolge nämlich schon am 27. Mai 1861, hat der Lehnträger Weißflog die Grube an seinen Schwiegersohn, Friedrich August Bach, für 200 Thaler verkauft (40169, Nr. 138, Blatt 26). Tatsächlich ist der im Dezember 1861 für die Betriebsperiode 1861/1863 eingereichte Betriebsplan von dem neuen Besitzer unterzeichnet. Dieser sah vor, die Grube mit 3 Mann Belegung in Umgang zu erhalten und pro Jahr etwa 100 Fuder Eisenstein und 300 Zentner Braunstein auszubringen (40169, Nr. 138, Blatt 27ff). Wie üblich, hatte Geschworener Tröger den Plan zu begutachten, fand aber nichts zu kritisieren, so daß er am 11. Januar 1862 an das Oberbergamt gesandt wurde. Am 8. Februar 1862 wurde der Betriebsplan auch dort bestätigt (40169, Nr. 138, Blatt 34). Weiterer Akteninhalt betrifft noch eine von Weißflog nicht beglichene Rechnung über Markscheidergebühren (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 35ff). Die Angelegenheit zog sich bis zur gerichtlichen Pfändung von Hausgegenständen, deren Versteigerung letztlich aber nicht einmal die Gerichtskosten deckte... Daher fragte das Bergamt im Finanzministerium an, ob man die ausstehenden Gebühren, welche sich von ursprünglich einmal 4 Thalern, 14 Neugroschen, der Mahngebühren halber inzwischen auf 6 Thaler, 23 Neugroschen erhöht hatten, nicht abschreiben könne. Das wurde am 13. Februar 1863 in Dresden aber glatt abgelehnt; das Bergamt solle besser dem Steiger den Lohn pfänden (40169, Nr. 138, Blatt 50). Wie es am Ende ausging, haben wir noch nicht herausgefunden... Der neue Besitzer entfaltete dagegen zunächst wieder große Tatkraft: Wie der Anzeige von Schichtmeister Oehme auf das Jahr 1861 zu entnehmen ist (40169, Nr. 138, Blatt 33), hatte Herr Bach nebst dem Steiger
angelegt, durch welche in 4 Lachter Teufe ein Feldort hora 4,4 Südwest 20 Lachter fortgestellt, auf diesem bei 14 Lachter Entfernung vom Schacht ein Gesenk einen halben Lachter geteuft und in 8 Lachter Teufe und 10 Lachter südöstlich vom Schacht 2 Quadratlachter Lagerfläche förstenweise ausgehauen wurden. Dabei brachte man 88 Fuder Eisenstein und 312 Zentner Braunstein aus. Den Eisenstein konnte man für 144 Thaler, 5 Neugroschen, also für rund 1 Thaler, 19 Groschen das Fuder, verkaufen. Für den Braunstein erlöste man 223 Thaler, respektive im Schnitt etwas über 22 Groschen für den Zentner. An dieser Stelle findet man auch wieder den Verweis, daß das Fuder nun zu 17 Zentnern, also zu 850 kg Gewicht, gerechnet worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 26. April 1862 trug Geschworener
Tröger im Bergamt Schwarzenberg aus seinem Fahrbogen vor, daß der
Grubenbesitzer wegen des wieder einmal herrschenden Wettermangels einen
neuen Schacht 9 Lachter südlich und bis zur 4 Lachter- Sohle teufen wolle.
Auch seitens des Bergamtes gab es keine Einwände, das Schachtabteufen zu
genehmigen (40169, Nr. 138, Blatt 35).
Erst am 10. Januar 1863 nahm man nach erfolgter Bestätigung durch das Gerichtsamt im Bergamt Schwarzenberg zu Protokoll, daß der bisherige Besitzer, Friedrich August Bach, die Grube samt dem zugehörigen Pochwerk bereits am 21. Juli 1862 wieder verkauft hat, und zwar an den Obersteiger Gottlieb Friedrich Müller (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 49). Am 27. September 1862 hatte Herr Tröger erneut in Schwarzenberg vorzutragen, daß er den Fundschacht in so desolatem Zustand befunden habe, daß er nicht mehr fahrbar sei. Stattdessen benutze man nun den neuen, 5 Lachter tiefen Wetterschacht zur Fahrung, von dem aus man im Lagerstreichen bereits 26 Lachter nach Süd- und nach Nordost ausgelängt hatte (40169, Nr. 138, Blatt 38). Selbstverständlich folgte das Bergamt wieder der Anordnung Tröger's und sprach ein Fahrverbot bis zur völligen Wiederherstellung des Schachtes aus. In der Anzeige von Schichtmeister Oehme auf das Jahr 1862 sind die schon beschriebenen Ausführungen wiederzufinden; der neue Wetterschacht hat nach dem neuen Besitzer den Namen ,Müllerschacht' bekommen und auch das Pochwerk hatte man wieder aufgebaut (40169, Nr. 138, Blatt 48). Die Belegung umfaßte neben dem Steigerdienstversorger 3 Mann. Wieder hatte man auch 2 Quadratlachter Lagerfläche ausgehauen und diesmal dabei 55 Fuder Eisenstein sowie 340 Zentner Braunstein gefördert. Vom ersteren hatte man 25 Fuder für 50 Thaler, also das Fuder für glatt 2 Thaler, verkauft. Vom Braunstein wurden 110 Zentner für 91 Thaler, 20 Neugroschen, also den Zentner für genau 25 Groschen, verkaufen können; der Rest des geförderten Erzes verblieb im Vorrat. Auch dieser Besitzer hat die Grube nicht lange betrieben, denn Gottlieb Friedrich Müller ist im Jahr 1863 verstorben. Da wohl sein Nachlaß ungeregelt war, wurde ein Konkursverwalter vom Gerichtsamt eingesetzt. Wie man der Anzeige des Schichtmeisters Oehme auf das Jahr 1863 entnehmen kann, wurde auf Antrag des Konkursverwalters die Grube ab Luciae 1863 in Fristen gesetzt (40169, Nr. 138, Blatt 59). Bis dahin hatte man der Anweisung des Geschworenen vom September 1862 noch Folge geleistet, den alten Schacht auf 7 Lachter Teufe neu ausgezimmert und in 4 und in 7 Lachter Teufe Feldörter betrieben. Dabei wurden 40 Fuder Eisenstein gefördert und zu den aus dem Vorjahr noch vorhandenen 30 Fudern Vorrat geschlagen. Ferner hat man 65 Zentner Braunstein ausgebracht, so daß man nun 295 Zentner im Vorrat hatte. Von letzterem konnte man 155 Zentner für 118 Thaler, 25 Neugroschen (also für 23 Neugroschen den Zentner) absetzen, so daß noch 140 Zentner im Vorrat verblieben. Schließlich bestätigte das Gerichtsamt Schwarzenberg am 5. Oktober 1864, daß ein Johann Traugott Weißflog das Grubengebäude aus dem Nachlaß Müller's wieder übernommen habe (40169, Nr. 138, Blatt 64). Im Bergamtsprotokoll vom 1. April 1865 hierzu steht dann aber der Name Christian Traugott Weißflog (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 69). Ob dies vielleicht beides Schreibfehler waren und es sich eigentlich um den Grundbesitzer Friedrich Traugott Weißflog handelte, ist nicht ganz gewiß. Es erscheint uns aber wahrscheinlich, denn Herr Weißflog hat die Grube gleich anschließend wieder weiter verkauft, dabei aber das ehemalige Pochwerk, daß ja auf seinem Grund und Boden stand, ausgeschlossen. Offenbar ist der ungeklärten Besitzverhältnisse halber die Grube seit Luciae 1863 auch in Fristen geblieben, denn Schichtmeister Oehme reichte für das Jahr 1864 wieder einen Vacatschein beim Bergamt ein: Es war kein Betrieb umgegangen (40169, Nr. 138, Blatt 68). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue Besitzer der Gelber Zweig
Fundgrube war nun jedenfalls auch der Fabrikant Ernst Erdmann Zweigler
aus Wildenau. Wie wir schon wissen, war Herr Zweigler zwar Kaufmann, doch hinsichtlich
des Bergbaus keineswegs unerfahren; besaß er doch zuvor schon die
Zweigler's Fundgrube, westlich vom Knochen in Richtung Schwarzenberg
gelegen.
Für die nun 1864 erworbene Gelber Zweig Fundgrube zeigte Herr Zweigler am 9. Mai 1865 zunächst beim Bergamt an, daß Schichtmeister Oehme weiterhin in seiner Funktion bleiben solle und daß an Stelle des bisherigen Steigers nun Friedrich August Wolf von Meyers Hoffnung den Steigerdienst versorgen solle (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 68), was seitens des Bergamtes auch am 13. Mai genehmigt worden ist (40169, Nr. 138, Blatt 71). Wie seinerzeit schon üblich, erging nach dem Besitzwechsel nun seitens des Bergamtes die Aufforderung an den neuen Besitzer, einen Betriebsplan einzureichen. Aus dem Fahrbogen des Geschworenen Tröger vom 11. Juli 1865 erfährt man, daß man inzwischen 17 Lachter südwestlich vom Fundschacht bereits einen neuen Tageschacht 3½ Lachter niedergebracht und von diesem aus ein Ort hora 6 West 10 Lachter ausgelängt hatte. An die tieferen Baue gelangte man gerade nicht ‒ dort herrschte wieder einmal Mangel an frischen Wettern (40169, Nr. 138, Blatt 73). Am 29. Juli 1865 reichte Herr Zweigler seinen Betriebplan für 1865/1866 ein, demzufolge die Grube mit 3 Mann Belegung in Betrieb gehalten werden sollte und man pro Jahr 500 Zentner Braunstein und 100 Fuder Eisenstein auszubringen gedachte (40169, Nr. 138, Blatt 74). Herr Tröger hatte im Ergebnis seiner Prüfung am 7. August 1865 „dagegen nichts zu bemerken“ und daraufhin wurde der Plan am 16. August 1865 auch im Oberbergamt genehmigt (40169, Nr. 138, Blatt 78). Im Jahr 1865 hat Herr Zweigler auch
Antrag auf Zusammenlegung von Gelber Zweig Fundgrube und
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Anzeige zum Grubenbetrieb im Jahr
1865 des alten und neuen Schichtmeisters Oehme berichtet uns, daß
man in diesem Jahr den neuen Schacht noch auf 4,5 Lachter Teufe und auch
den 12 Lachter westlich gelegenen Müllerschacht um 7 auf nun 11,5
Lachter Teufe abgesenkt hatte. Parallel hatte man in 8 Lachter Teufe des
Fundschachtes und 6 Lachter östlich vom Schacht 2 Kubiklachter Lagermassen
ausgehauen, wobei man 36 Fuder Eisenstein ausgebracht hatte, aber im
Vorrat behalte; außerdem 391 Zentner Braunstein, welche man für 160 Thaler,
20 Neugroschen verkaufen konnte (40169, Nr. 138,
Blatt 80). Der Preis für den
Braunstein war offenbar von zuvor 23 Groschen auf nur noch rund 12½ Groschen für den Zentner sehr deutlich gefallen und Eisenstein war kaum
absetzbar. „Unter Berücksichtigung der
jetzigen Verhältnisse und des Mangels an Absatz“ genehmigte daher auch
am 27. Juni 1866 das Bergamt Schwarzenberg Zweigler's Antrag auf
Fristhaltung der ihm gehörigen Berggebäude
(40169, Nr. 138, Blatt 81).
Dennoch fand Geschworener Tröger die Grube bei einer Befahrung am 17. September 1866 mit 13 Mann belegt vor. Seinem Fahrbogen kann man entnehmen, daß man aus dem Müllerschacht heraus in 8 Lachter Teufe ein Ort hora 7 nach Nordwest 5 Lachter getrieben und dort Braunstein von 0,3 Lachter Mächtigkeit angetroffen hatte, welchen man nun mittels Fallort verfolgte. In derselben Tiefe hatte man ein zweites Ort hora 1 nach Südwesten angehauen und 10 Lachter erlängt. Dort hatte man ein „schönes Braunsteintrum von 0,15 Lachter Mächtigkeit“ angefahren, das man nun im Firstenbau hereingewann (40169, Nr. 138, Blatt 82). Ähnlich lautet auch die Anzeige des Schichtmeisters Oehme auf das Jahr 1866. Aus den schon von Tröger bemerkten Strecken heraus hatte man weitere Feldörter angehauen, außerdem auch in 11,5 Lachter Teufe eine Strecke hora 5 nach West im Lagerstreichen weiter erlängt. In derselben Richtung, aber in 8 Lachtern Teufe, hatte man ebenfalls inzwischen 18 Lachter ausgelängt; dort auch alles in allem 7 Kubiklachter Lagermasse ausgehauen, wobei man 1.443 Zentner Braunstein ausbringen konnte. Von dieser Förderung konnten 1.393 Zentner für 928 Thaler, 20 Neugroschen, also immerhin den Zentner wieder zu 20 Groschen, verkauft werden, der Rest verblieb im Vorrat. Nicht zuletzt hat der Müllerschacht eine neue Kaue bekommen (40169, Nr. 138, Blatt 83f). Um diese Arbeiten durchführen zu können, hatte Herr Zweigler bei Gelber Zweig Fdgr. angelegt:
respektive zusammen 15 Mann. Die folgende Jahresanzeige des Schichtmeisters nennt sogar eine Belegung von 16 Mann. Mit dieser Mannschaft hatte man im Jahr 1867 auch den Fundschacht wieder belegt, auf 3 Lachter Teufe neu ausgezimmert und in dieser Tiefe ein neues Feldort hora 12 Süd 6 Lachter weit getrieben. Im Müllerschacht standen Ortbetriebe in 4 Lachter, in 8 Lachter und in 9 Lachter Teufe in Umgang. Bei 8 Lachter Teufe hatte man ein Ort zunächst hora 4 Nordost 8 Lachter ausgelängt, dann hora 10,4 an der Grubenfeldgrenze zur Friedrich Fdgr. entlang 34 Lachter fortgestellt. Auf der obersten Sohle wurden dabei 3 Kubiklachter, in der mittleren 7,5 und auf der untersten 19,5 Kubiklachter Lagermassen ausgehauen, alles in allem also 30 Kubiklachter oder 216.000 m³ Gestein. Aus dieser Menge wurden 1.748 Zentner Braunstein gewonnen und samt des vom Vorjahr verbliebenen Vorrates verkauft (40169, Nr. 138, Blatt 85f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus der Anzeige des Schichtmeisters
Oehme auf das Jahr 1868 kann man schon dann erahnen, daß der ,Boom'
nicht ewig andauern wird. Herr Zweigler hat die Belegung wieder auf
12 Mann reduziert, durch welche die Feldörter vom Müllerschacht aus
weiter getrieben wurden; ferner auch 20 Lachter östlich vom
Müllerschacht ein neuer Schacht 8 Lachter tief niedergebracht worden
ist. Dieser sollte wohl Bewetterung und Förderung in den auf der 8
Lachter- und 9 Lachter- Sohle betriebenen Abbauen erleichtern, wo man in
diesem Jahr 11 Kubiklachter Lagermasse abgebaut hat. Auch hat man 24
Lachter westlich vom Müllerschacht „vom Tage nieder“ ‒ also im
Tagebau ‒ in der Ausbißlinie 8 Kubiklachter abgebaut, in Summe also
54.872 m³. Aus dieser Menge konnte man 1.751 Zentner Braunstein gewinnen,
von denen 1.721 Zentner für 1.147 Thaler, 10 Neugroschen (also wieder den
Zentner für 20 Groschen) verkauft wurden (40169, Nr. 138,
Blatt 87f).
Am 19. Juli 1869 ging dann ein Schreiben von E. E. Zweigler an das Landesbergamt in Freiberg ab, in dem er mitteilte, er habe „aus verschiedenen Gründen und mehrfachen Ursachen“ Herrn Oehme gekündigt und dessen Funktion solle nun ein Obersteiger Albrecht Hartmann übernehmen und zwar für alle drei ihm gehörigen Gruben, als Gelber Zweig, Riedels Fdgr. und Hausteins Hoffnung (40169, Nr. 138, Blatt 89). Nun war Anfang 1869 aber im Königreich Sachsen das erste Allgemeine Berggesetz in Kraft getreten, woraufhin man ihm aus dem Landesbergamt in Freiberg am 23. Juli beschied, daß schon seit dem Gesetz über den Regalbergbau 1851 den Besitzern die Art und Weise der Rechnungsführung freigestellt sei und es eines Schichtmeisters gar nicht mehr bedürfe ‒ stattdessen habe er dem Bergamt aber die technischen Beamten und Betriebsleiter zu benennen (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 89). Welch ein Glück für uns, daß Herr Zweigler noch Herrn Oehme bestellt hatte, dessen Jahresberichte uns über die zurückliegenden Jahre Auskunft über die Betriebsabläufe gegeben haben... Jedenfalls antwortete Herr Zweigler am 30. Juli 1869 nach Freiberg, es wäre ein Versehen und er wollte doch Herrn Hartmann mit der technischen Betriebsleitung beauftragen (40169, Nr. 138, Blatt 91), was man seitens des Bergamtes auch akzeptierte. In der Zwischenzeit meldete sich auch Herr Oehme in Freiberg, er könne leider kein Register für die Grube einlegen, da Zweigler ihm gekündigt habe. Zugleich beantragte er beim Bergamt, daß Zweigler doch die Kündigungsfrist von einem Jahr einhalten müsse (40169, Nr. 138, Blatt 92f). Aus denselben Gründen, wie oben schon erwähnt, verwies ihn das Bergamt aber an das Zivilgericht. Über den Betrieb im Jahr 1869 erfahren wir dagegen mangels einer ordentlichen Anzeige leider nichts aus der Grubenakte. Eine bergbehördliche Befahrung durch Berginspektor G. Netto von der nun zuständigen Berginspektion in Zwickau fand erst wieder am 26. Juli 1870 statt. Der Inspektor war von den technischen Zuständen bei Gelber Zweig Fdgr. gar nicht begeistert und setzte einen Zechenbucheintrag auf, dessen Abschrift sich in der Grubenakte findet (40169, Nr. 138, Blatt 95f). Demnach war die Auszimmerung des westlichen Schachtes reparaturbedürftig und der östliche Schacht wies weder einen Abschluß, noch eine Kaue auf. Außerdem notierte Herr Netto, daß „die Zugänge zu den belegten Bauen so eng und krüppelig sind, daß man buchstäblich auf dem Bauche durchkriechen kann, indem die Arbeiter im Productions Gedinge stehen und kein Steiger dieselben beaufsichtigt.“ Wo ist denn Obersteiger Hartmann abgeblieben ? Dieser Umstände halber war Herr Netto am 29. Oktober 1870 wieder da und notierte in seinem Fahrjournal (40169, Nr. 138, Blatt 97f): „Die unterm 26. Juli gerügten Umstände waren nothdürftig beseitigt, dagegen wurden auf sämtlichen Herrn Zweigler gehörigen Gruben die ,Vorschriften zur Vermeidung von Unglücksfällen' vermißt.“ Was in den folgenden Jahren auf der Grube noch geschehen ist, wissen wir leider nicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem Inhalt der Grubenakte zufolge hat
Herr Zweigler die ihm gehörigen Berggebäude in Langenberg
jedenfalls am 16. Oktober 1873 an den preußischen Kommerzienrat Hermann
Gruson verkauft (40169, Nr. 138, Rückseite
Blatt 98). Als Vertreter des Besitzers in
Sachsen wurde dem Bergamt in Freiberg am 16. Februar 1874 der
Generaldirektor Oscar Schrader in Obersachsenfeld benannt. Die
technische Leitung sollte der bei der Gruson'schen Hütte in Schwarzenberg
angestellte Grubenverwalter Carl Friedrich Fritzsche übernehmen (40169, Nr. 138,
Blatt 99f). Die Steigerfunktion
bei Gelber Zweig Fdgr. sollte der Zimmerling Heinrich Ludwig
Ficker übernehmen, dessen Anstellung als solchen das Bergamt am
7. April 1874 auch genehmigte (40169, Nr. 138,
Rückseite Blatt 100).
Wirklich wieder in Gang gekommen ist aber auch unter dem neuen Besitzer der Bergbau offenbar nicht ‒ jedenfalls weisen weder die Erzlieferungsextrakte, noch die Jahrbücher für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen ein Ausbringen auf. Auch im Akteninhalt findet sich nur noch die Anstellung von Franz Robert Pilz als neuer Grubenverwalter im Jahr 1877 (40169, Nr. 138, Blatt 101f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 19. Dezember 1877 hat Hermann
Gruson die von Ernst Erdmann Zweigler übernommenen
Grubengebäude Gelber Zweig, Hausteins Hoffnung und Gott segne
beständig Fdgr. wieder verkauft. Neuer Besitzer ist auch hier nun die
Societé anonymes des Mines et Usines Hof -
Plzen - Schwarzenberg mit Sitz in Brüssel. Am 22. Dezember 1877 nahm
man in Freiberg zu den Akten, daß Robert Pilz auch deren Vertreter
in Sachsen ist (40169, Nr. 138,
Blatt 103).
Wirklich geschehen ist auch jetzt in Langenberg aber nichts. Dem Inhalt der Grubenakte zufolge hat Grubenverwalter Carl Friedrich Fritzsche (auch der war noch derselbe) lediglich einen Wilhelm Beyer aus Hof als neuen Steiger benannt, dessen Anstellung als solchen das Bergamt in Freiberg am 26. Januar 1880 bestätigte (40169, Nr. 138, Blatt 105). Herr Beyer ist später Betriebsleiter auf der Kieszeche am Vitriolwerk bei Geyer geworden (40168, Nr. 591). Die anonyme Beteiligungs- Gesellschaft war inzwischen in Konkurs gegangen und firmierte danach unter dem neuen Namen AG für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Hof - Plzen - Schwarzenberg weiter. Nach dessen Abgang wurde von letzterer Ernst Emil Braune aus Sachsenfeld als neuer Bergverwalter benannt, was man am 16. Februar 1882 in Freiberg zu den Akten nahm (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 105). Der wiederum ist 1885 in Zwickau- Schedewitz ansässig. Nachdem Berginspektions- Assistent Tittel aus Anlaß eines Fristhaltungsantrages der AG für Bergbau und Hüttenbetrieb am 4. Mai 1885 die Grubenfelder besucht hatte, schrieb er nach Freiberg, daß dort „weder Schacht noch Stolln sichtbar (ist), nur sind auf dem Grubenfelde kleinere Bingen zu finden.“ Einer Fristhaltung stünden jedenfalls keine zuvor notwendigen Verwahrungs- und Sicherungsmaßnahmen entgegen (40169, Nr. 138, Blatt 106f). Bis 1888 wurde die Grube Gelber Zweig danach auch von der AG für Bergbau und Hüttenbetrieb nur in Fristen gehalten (40169, Nr. 138, Blatt 108ff). Befahrungen durch die Berginspektion fanden deshalb auch nicht statt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann hat auch diese AG die Grubenfelder
samt der Schwarzenberg'er Hütte erneut verkauft. Nunmehr versuchte sich
ein Kaufmann Paul Friedrich Helmuth Förster, der ausweislich seines
Briefpapiers in der Wichmannstraße in Berlin ein ,Laboratorium für
Erzanalysen' besaß, an einer Wiederaufnahme des Bergbaus. Die Firma in
Berlin hatte
er erst 1884 von seinem Vater übernommen. Außer den Gruben Gelber Zweig,
Hausteins Hoffnung und Riedels Fdgr. in Langenberg nannte er auch noch die
Gruben Pluto bei Untersachsenfeld, Frischglück bei
Globenstein, Eisenkammer in Reiboldsgrün, Glück Auf in
Schlettau, Glücksrad in Moschwitz und Stille Hoffnung bei
Cranzahl sein Eigen.
Wie üblich, forderte das Bergamt nach dem Besitzwechsel am 28. Dezember 1888 den neuen Besitzer zur Betriebsaufnahme und zur Benennung der verantwortlichen Leiter auf (40169, Nr. 138, Blatt 112). Am 13. Januar 1889 schrieb Herr Förster daraufhin nach Freiberg, daß der bisherige Bergverwalter Emil Braune in seiner Funktion bleiben solle und bat zugleich um weitere Betriebsfrist (40169, Nr. 138, Blatt 115). Letzteres wurde auch genehmigt. Nur wenige Tage darauf benannte Herr Förster dann aber einen Bergingenieur Adolf Albrecht Götting, Absolvent der Clausthal'er Bergakademie, als seinen zukünftigen Vertreter in Sachsen. Außerdem schrieb er: „Ich beabsichtige, auch den Betrieb der sächsischen Gruben aufzunehmen und zwar wenn irgend möglich und rentabel in größerem Maßstabe und will bei der jetzigen Knappheit an Erzen in Oberschlesien (dort) die Verwerthung... durchführen.“ Die königl.- sächs. Staatseisenbahn habe auf seine Anfrage nach Transportkapazitäten schon positiv beschieden, die königliche Eisenbahndirektion in Breslau dagegen Nachweise über Qualität und Quantum der Erze gefordert (40169, Nr. 138, Blatt 116). Die letztere fragte dann auch gleich selbst im königl.- sächs. Landesbergamt nach den Gestehungskosten der Eisenerze, woraufhin man aber am 16. August 1889 aus Freiberg nach Breslau antwortete, man könne dazu keine Auskunft geben und das, was an Angaben dazu vorläge, sei veraltet (40169, Nr. 138, Blatt 129ff). Allerdings stellte man einmal eine kleine ,Übersicht über die Betriebsverhältnisse der... dermalen Herrn Kaufmann Förster in Berlin eigenthümlich gehörenden Gruben in den Jahren 1870 - 1888' zusammen (40169, Nr. 138, Blatt 131ff). Demnach hatten unter den oben genannten Gruben in der angegebenen Zeitspanne nur noch wenige überhaupt ein Ausbringen:
Die anderen Gruben waren gar nicht in Betrieb oder lagen nur in Fristen. Auch für Gelber Zweig beantragte Grubenverwalter Götting am 1. Februar 1890 die Verlängerung der Fristhaltung (40169, Nr. 138, Blatt 134ff), was auch genehmigt worden ist. Schon ein Jahr darauf war Herr Götting wohl schon wieder ausgeschieden und der neue Grubenverwalter, ein Kaufmann Wilhelm Vogel in Schwarzenberg, hatte die Fristen nicht eingehalten und bekam nun am 14. Februar 1891 eine neue Aufforderung zur Betriebsaufnahme aus Freiberg. Am 18. Februar stellte dieser dann einen neuen Antrag auf Infristhaltung der Grube (40169, Nr. 138, Blatt 140ff). Auch diese wurde genehmigt. Die Sache wiederholte sich noch einmal zwei Jahre darauf. Diesmal aber teilte ein M. Kalb aus Schwarzenberg nach Freiberg mit, Herr Förster sei unlängst verschieden und seine Erben seien außerstande, den Betrieb aufzunehmen. Erneut wurde daraufhin die Betriebsfrist bis Ende 1893 genehmigt (40169, Nr. 138, Blatt 145ff). Als
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevor die Betriebsfrist ablief, hat
dann am 20. Januar 1893 der uns schon bekannte Gustav Zschierlich,
Farbenfabrikbesitzer in Geyer, das Grubenfeld erworben (40169, Nr. 138,
Blatt 150). Zur Fortsetzung der
Geschichte unter diesem Besitzer schlage man wieder weiter unten im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hausteins
Hoffnung Fundgrube zwischen Langenberg und Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26)
wird eine Grube dieses Namens ab 1827 und bis 1872 aufgeführt. Sie hat in
dieser Zeit 7.936 Zentner (rund 397 t) Braunstein, dagegen nur
gelegentlich auch Eisenstein (einmal 64 Fuder im Jahr 1864) ausgebracht.
Zunächst hatte der Schichtmeister aus Beierfeld, Carl Christian Haustein, am 10. September 1807 eine Fundgrube nebst der ersten unteren und sechs oberen Maßen „auf einem Stunde 2 streichenden und gegen Südost einfallenden Stehenden Gang auf Silber und alle Metalle... im Raschauer Communwald... am Silber Emmler Gebirge“ gemutet. Ob es sich dabei, der Voranstellung des Silbers wegen, aber schon um die spätere Eisenerzgrube handelte, ist eher unwahrscheinlich, und weitere Hinweise auf die Lage und den Betrieb dieser Grube gibt es an dieser Stelle nicht. Am 29. März 1826 mutete dann Factor Carl Ludwig Haustein zu Raschau – sicherlich ein Nachkomme des ersteren – eine gevierte Fundgrube nebst der ersten oberen und unteren Maß „an der Mittagsseite von Freundschaft Fundgrube“ und erhielt diese unter dem Namen Hausteins Hoffnung Fundgrube am 6. April 1826 auch bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 49 und 40014, Nr. 43, Blatt 307). Derselbe mutete am 11. Juli 1829 noch die zwei nächsten unteren Maße hinzu und erhielt sie nach Besichtigung durch den Berggeschworenen am 10. Februar 1830 vom Bergamt bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 82f, 40014, Nr. 43, Blatt 315 und 40169, Nr. 160, Blatt 1). Schließlich legten am 5. Dezember 1833 Christian Gottlob Weißflog zu Langenberg und Steiger Reppel Mutung auf die 3. obere gevierte Maß an der Abendseite der Fundgrube ein. Fast gleichzeitig legte auch Johann Gottlieb Bach aus Raschau Mutung auf eine neue Fundgrube unmittelbar daneben ein (40014, Nr. 270, Film 0123ff). Bei der Besichtigung durch den jetzt zuständigen Berggeschworenen Johann August Karl Gebler stellte dieser aber fest, daß die beantragten Grubenfelder „etwas übereinander greifen“. Der Geschworene empfahl eine Teilung der von beiden beantragten Fläche. Diesem Vorschlag wollten Weißflog und Reppel folgen, die andere Partei aber nicht. Bevor der Geschworene die Entscheidung hierzu dem königlichen Bergamt überlassen konnte, kam es aber doch zu einer Einigung, indem Bach und Konsorten keine Fundgrube mehr, sondern die angrenzende Maß übernehmen wollten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Eisenstein- und Braunsteinzeche
taucht
der Grubenname Hausteins Hoffnung danach natürlich auch in den Fahrbögen des
Berggeschworenen Gebler und zwar erstmals unter dem 6. Mai 1834 auf (40014, Nr. 289,
Film 0027). Der
Geschworene hielt nun fest, er habe an genanntem Tage „die Lage der Grubenfelder für
die Gruben
untersucht und soweit heute möglich, durch Schlagen von Pfählen vorläufig in Betreff des nachfolgenden Setzens von Lochsteinen zu Vermeidung künftiger, zeither so häufig vorgefallener Streitigkeiten zu bestimmen angefangen.“ Wohl nachdem die Absatzkrise für Braunstein abflaute, kam es in dieser Zeit zu einem wahren „Boom“ von Neuaufnahmen, darunter auch dieser Grube. Unvermeidlich kam es auch gleich zu den befürchteten Streitereien zwischen den Mutern und am 9. Juli 1834 war Herr Gebler schon erneut zugegen, um „wegen von dem Lehnträger bey Ulricke gev. Fdgr. erhobener Beschwerde eine nochmalige Untersuchung der Markscheide zwischen dieser Grube und Hausteins Hoffnung gev. Fdgr., ingleichen die Feldlegung für der letzteren Feld anzufangen.“ (40014, Nr. 289, Film 0038) Das war´s dann aber zunächst auch. Weitere Nennungen der Grube Hausteins Hoffnung finden sich in den Fahrbögen des Geschworenen aus dem Jahr 1834 nicht. Auch aus dem Jahr 1835 ist nur eine einzige Notiz zu dieser Grube in den Fahrbögen des Geschworenen zu finden: Dieser war am 11. Juni des Jahres hier „zu Besichtigung des gevierdten Feldes bey Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. samt 1ten und 2ten obern nächsten mittäglichen Maß“ und hat „die zur richtigen Setzung der Lochsteine vorgängig nothwendigen Untersuchungs- Messungen zu Prüfung der vorhandenen Pfähle vorgenommen und hierauf die erforderlichen Lochsteine gesetzt.“ (40014, Nr. 289, Film 0098) Danach setzen die Nennungen dieser Grube in den Fahrbögen von Herrn Gebler erneut aus und Trinitatis 1838 setzen auch die überlieferten Fahrbögen ganz aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab 1840 war als Berggeschworener in
Scheibenberg dann Herr Theodor Haupt bestellt. Der neue Geschworene
nahm seine Aufgaben ernst und hat gleich am 10. Januar 1840 alle gangbaren
Gruben des Reviers befahren. Über Hausteins Hoffnung hielt er in
seinem Fahrbogen von diesem Tage fest (40014,
Nr. 300, Film 0016): „Auf Hausteins Hoffnung gev Fdgr. hat man in ca. 10 Lachter nordöstlicher Entfernung vom alten Tageschacht einen neuen Schacht 6 Lachter saiger tief in Mulm niedergebracht und hiermit hübschen Nester von Braunstein angefahren, auf denen man eine Strecke in NO. hora 5 treibt, die bereits 1 Lachter erlängt ist.“ Zu diesem Schachtabteufen gab es am 22. Februar 1840 auch einen Fahrbogenvortrag durch den Geschworenen im Bergamt zu Annaberg (40169, Nr. 160, Rückseite Blatt 1). Ein zweites Mal war Herr Haupt schon am 30. März zugegen und notierte darüber (40014, Nr. 300, Film 0037f), an jenem Tag „habe ich Braunstein auf den Gruben des Tännichtwaldes und in Langenberg verwogen und die Grube Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. befahren. Hier ist vom neuen Tageschacht aus ein Ort 2 Lachter in NO. hora 5,4, dann 1 Lachter in Ost hora 1,4 getrieben und hiermit in den alten Bau, wahrscheinlich von Ulricke Fdgr. durchgeschlagen worden. Man betreibt daher jetzt ein Ort in O. hora 9,4, vor dem aber die Braunsteinanbrüche gering sind.“ Die nächste Befahrung der Grube fand dann am 7. April 1840 statt (40014, Nr. 300, Film 0042). Darüber wird im Fahrbogen berichtet, man habe nun ein neues Ort in 5½ Lachter Teufe nach Nord angehauen, vor dessen Ort kleine Braunsteinnester brechen. Dann schlug hier vielleicht schon wieder der so oft beklagte Wettermangel zu, denn schon am 19. Mai 1840 notierte Herr Haupt (40014, Nr. 300, Film 0060): „Auf Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. findet jetzt kein Betrieb statt.“ Das blieb wohl auch wieder den ganzen Sommer so, denn man liest am 10. August 1840, er habe an diesem Tage „die Eigenlöhner Gruben im Tännicht befahren. Von diesen sind mehrere gegenwärtig wegen Wettermangel nicht in Betrieb oder werden daselbst wenigstens nur die Halden ausgekuttet oder die früher geförderten Producte ausgeschlagen. Diese Gruben sind namentlich Meyers gev. Fdgr. Ullricke gev. Fdgr. Hausteins Hoffnung gev. Fdgr., Kästners neue Hoffnung gev. Fdgr.“ (40014, Nr. 300, Film 0091f) Dasselbe wiederholte sich am 8. September 1840, als Herr Haupt nur notierte: „Auf Meyers, Kästners, Distlers, Ullricke und Hausteins Fdgr. findet gegenwärtig wegen Wettermangels kein Betrieb statt.“ (40014, Nr. 300, Film 0107f) Dann hat Herr Haupt wohl für einige Zeit andere Aufgaben übertragen bekommen, denn von Crucis 1840 bis Mitte Reminiscere 1841 wurde er danach durch den Raschau'er Schichtmeister Friedrich Wilhelm Schubert in seiner Funktion als Geschworener vertreten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob man im Herbst 1840 noch etwas auf
Hausteins Hoffnung Fdgr. getan hat, weiß man nicht so genau, denn
im Fahrbogen vom 28. November 1840 notierte Herr Schubert, er habe
an diesem Tage „Auf dem Rückwege (...) bei Gelber Zweig gev.
Fdgr., Friedrich gev. Fdgr., Gott segne beständig gev. Fdgr., Ullricke gev.
Fdgr. und Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. niemand in Arbeit getroffen.“
(40014, Nr. 300, Film 0134f) Dennoch muß im Winter wieder Betrieb umgegangen sein, denn am 18. Februar 1841 hatte Herr Schubert hier 26 Zentner Braunstein zu verwiegen, wovon ‒ warum auch immer ‒ „10 Ctr. auf dem Huthaus von Wilkauer Feld deponiert wurden.“ (40014, Nr. 300, Film 0153) Ende Trinitatis 1841 war dann Herr Haupt wieder selbst in seiner Funktion in Scheibenberg tätig, wollte am 27. Juli des Jahres die Eigenlöhnergruben im Tännicht und Langenberg befahren und beklagte (40014, Nr. 300, Film 0208): „Auf den Gruben Hausteins Hoffnung und Gott segne beständig und Friedrich Fdgr. habe ich nicht fahren können, weil die daselbst anfahrenden Leute, ohngeachtet sie Tags vorher bestellt worden sind, nicht zugegen waren.“ Noch einmal war Herr Haupt am 19. August 1841 auf den Gruben im Tännicht und bei Langenberg zugegen und berichtete dieses Mal recht wohlwollend (40014, Nr. 300, Film 0224): „Die Nachbargrube (von Gott segne beständig) Hausteins Hoffnung zeichnet sich jetzt vor den meisten anderen Braunsteinzechen durch einen gewissen Grad von Ordnung aus, der zu Folge Schacht und Strecken den Verhältnissen anpaßend verzimmert und regelmäßiger als sonst üblich ist, betrieben sind. Der Schacht ist 6 Lachter tief. In 5 Lachter Teufe hat man früher eine Strecke in Ost getrieben, die aber größtentheils wiederum versetzt ist. 1 Lachter vom Schacht auf dieser Strecke hat man aber ein Steigort 2,6 Lachter in Süd auf Braunsteintrümern, die in Mulm brechen, und sodann wegen eingetretenen Wettermangels, auch um mehrere Braunsteinnester zu verfolgen, ein 2tes Steigörtchen in Ost bis an den Tag getrieben. Die Anbrüche sind aber nicht mehr bedeutend. Die Belegung der Grube besteht in 2 Mann.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurz darauf wurde Herr Haupt
bekanntlich erneut höheren Orts zu anderen Aufgaben abberufen, worauf die
Funktion des Geschworenen diesmal durch den Rezeßschreiber Lippmann
aus Annaberg wahrgenommen wurde (40014, Nr. 300,
Film 0230).
Letzterer hat die Gruben des Revierteils am 15. September 1841 befahren und berichtete in seinem Fahrbogen ziemlich knapp (40014, Nr. 300, Film 0244), auf Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. führen 2 Mann an, welche den Tageschacht weiter abzuteufen beschäftigt waren. Der Schacht war jetzt 6½ Lachter tief. Außerdem wurde bei 5½ Lachter Teufe hora 1,4 SO. ein Steigort in gelbem Mulm mit hübschen Braunsteinnieren betrieben, das nun 3 Lachter erlängt gewesen ist. Auch von seiner Befahrung am 8. Dezember 1841 hatte Herr Lippmann nicht allzuviel mehr zu berichten (40014, Nr. 300, Film 0269), als daß das Steigort in Umgang stehe, „vor welchem der Braunstein ziemlich häufig in bis kopfgroßen Nieren aus gelblich braunem Mulm“ ansteht. Den ausgebrachten Braunstein hat Herr Lippmann am 11. Februar verwogen und die Grube am 17. Februar 1842 wieder befahren (40014, Nr. 321, Film 0011 und 0015). Darüber liest man in seinem Fahrbogen, hier haben „die beiden Weilarbeiter den Förderschacht fernerweit 0,5 Lachter in schwarzem Mulm mit inneliegenden Hornsteinbrocken abgeteuft, so daß dessen Gesamtteufe nun 7 Lachter beträgt. Nächstdem wird in 5½ Lachter Teufe ein Steigort in Mittag Abend betrieben, wobei man etwas Braunstein, welcher nierenweis in Mulm hier vorkommt, gewinnt und aushält, freilich nur in geringer Quantität.“ Ganz so gering kann die ,Quantität' dann auch wieder nicht gewesen sein, denn er war schon am 11. März erneut zugegen, um den Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 321, Film 0021). Am 22. März erfolgte auch wieder eine Befahrung, über die Herr Lippmann berichtete (40014, Nr. 321, Film 0024), der Tageschacht sei nochmals um 1,5 Lachter auf nun 8 Lachter abgesenkt worden. Bei 6½ Lachtern Teufe ging der schwarze, scharf abgegrenzt, in gelben Mulm über und in 8 Lachter Teufe hat man darin hora 6 gegen Abend 1 Lachter ausgelängt und dabei eine (...) Mulmlage „mit inneliegenden Braunsteinnieren und Schmitzen durchfahren, auf der nun nach Süden und Norden ortweis ausgelängt wird.“ Bei seiner Befahrung am 27. April 1842 fand er die Grube schon unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0033) und unter dem 21. Juni 1842 heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 321, Film 0048), an diesem Tage „inspizierte ich die Eigenlöhnergruben bei Langenberg, im Tännicht und bei Schwarzbach, unter den ich Köhlers, Ullricke, Bestehend Glück, Distlers Freundschaft und Meyers Hoffnung gev. Fdgr. unbelegt fand und vermaß sodann auf Gelber Zweig und Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. eine Parthie Braunstein.“ Tags darauf hat Herr Lippmann dann aber Hausteins Hoffnung befahren und berichtete (40014, Nr. 321, Film 0050) darüber: „Bei Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. baut man in 8 Lachtern Teufe den in gelbem Mulm nur nieren- und knollenweise, aber ziemlich häufig vorkommenden Braunstein gegenwärtig gegen Mittag ortweis ab, stößt dabei aber manchmal auf schon abgebautes und wieder verstürztes Feld, was bei der sehr unregelmäßigen Abbauweise in diesen Braunsteinzechen nicht zu verwundern ist.“ Weitere Befahrungen dieser Grube aus dem Jahr 1842 sind in den Fahrbögen nicht vermerkt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem er Luciae 1842 nach
Scheibenberg zurückgekehrt war, nahm die Befahrungen im ersten Quartal
1843 wieder Theodor Haupt vor. Hausteins Hoffnung hat er am
28. März 1843 befahren und darüber notiert
(40014, Nr. 321,
Film 0158), man betreibe
nun in 7 Lachter Teufe eine Strecke 2 Lachter in West und sodann 3 Lachter
in Süd „in braunem Mulm mit Kugeln und Knollen von erdigem Braunstein.“
Anschließend wurde er aber erneut abgeordnet und Herr Lippmann
vertrat ihn auch in diesem Jahr. Letzterer hat die Grube am 3. Mai 1843
wieder befahren und befunden, man habe
die Strecke in 7 Lachter Teufe nun gegen Mittag 5 Lachter ausgelängt. „Hier
gewinnt man den in braunem Mulm kugel- und knollenweise, vergesellschaftet
mit Hornsteinknollen, vorkommenden Braunstein.“ (40014, Nr. 321,
Film 0174)
Auch hier trat dann in den Sommermonaten wieder der übliche Wettermangel auf, am 13. Juni 1843 hat Herr Lippmann hier „niemand angetroffen“ und nach seiner Befahrung des Reviers am 21. September notierte er, die Grube werde „wegen Wettermangel nicht betrieben.“ (40014, Nr. 321, Film 0182 und 0209) Erst am 15. November 1843 erfolgte eine weitere Befahrung, von der Herr Lippmann in seinem Fahrbogen festhielt. die Grube werde „mit 2 Mann in Betrieb gehalten,“ durch welche auf den unteren 3 Lachter des Fundschachtes der wandelbar gewordene Ausbau erneuert worden ist. Abgebaut wurde in der 5 Lachtersohle, wo man vor einem 4 Lachter gegen Mittag getriebenen Feldort „knollenweise, aber nicht eben sehr häufig vorkommenden Braunstein gewinnt.“ (40014, Nr. 321, Film 0219) Anschließend hat Herr Lippmann noch den vorhandenen Braunsteinvorrat zum Verkauf verwogen. Zu demselben Zweck war nach seiner Rückkehr nach Scheibenberg auch Herr Haupt am 11. Dezember 1843 noch einmal zugegen (40014, Nr. 321, Film 0230). Herr Haupt war bis zu seiner erneuten Abordnung im April 1844 aber nicht noch einmal auf dieser Grube. Ab Mai 1844 hat ihn in seiner Funktion als Geschworener in Scheibenberg dann diesmal der Markscheider Friedrich Eduard Neubert vertreten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der letztgenannte war am 7. Mai 1844
auf der Grube, fand aber nur einen Arbeiter, mit Ausschlagen beschäftigt,
vor
(40014, Nr. 322,
Film 0036f). „Wegen
Mangel an Absatz dieses Minerals ist die Grube nur dann und wann belegt,“
schrieb er zu diesem schwachen Betrieb. Ansonsten würden aber 2 Punkte in
Betrieb gehalten, beide in 6 Lachter Teufe und das eine 1½ Lachter
nördlich und das andere 4 Lachter südwestlich vom Tageschacht. Vor beiden
brachen Nester von Braunstein in Mulm. Ferner fand er noch „zu bemerken
(...), daß die Zimmerung im Tageschacht sehr wandelbar geworden ist und
baldigster Auswechslung bedarf.“ Den Mangel an Absatz findet man auch in seiner nächsten Notiz im Fahrbogen (40014, Nr. 322, Film 0047f) als Grund dafür, daß die Gruben unbelegt seien: Am 12. Juni 1844 „beabsichtigte ich, die übrigen im Tännicht und bei Langenberg liegenden Gruben, als Riedels, Reppels, Köhlers, Gelber Zweig, Friedrich, Gott segne beständig, Hausteins, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. zu befahren, sie waren jedoch sämmtlich außer Belegung, wovon bei den meisten die Unmöglichkeit, die Producte zu verwerthen, die Ursache sein mag.“ Einen Tag später war Herr Neubert noch einmal hier (und auf Riedels Fdgr.) und hat „Braunstein- Schaustuffen behufs deren Einsendung zur zollvereinsländischen Industrie- Ausstellung in Berlin ausgeschlagen.“ (40014, Nr. 322, Film 0050f) Die Ausstellung hat aber wohl nicht wirklich etwas genutzt, die Nachfrage blieb gering und so blieb auch Hausteins Hoffnung den Rest des Jahres 1844 unbelegt, was Herr Neubert unter anderem bei seinen Befahrungen am 1. August, am 15. November und am 6. Dezember (40014, Nr. 322, Film 0056f, 0075 und 0082) konstatieren mußte und seinem Fahrbogen von 10. bis 13. Woche Crucis (September) 1844 dazu anfügte: „Übrigens bemerke ich noch, daß ich in No. 10te und 11te Woche zu mehreren Malen die Gruben Distlers Freundschaft, Hausteins Hoffnung, Friedrich, Gelber Zweig, Köhlers und Reppels gev. Fdgr. bei Langenberg... besuchte, diese aber stets unbelegt fand.“ (40014, Nr. 322, Film 0068) Auch seinem Fahrbogen auf Reminiscere 1845 fügte er wieder an: „Noch bemerke ich, daß die Gruben Rother Stolln zu Schwarzbach und Hausteins Hoffnung, Gott segne beständig, Gelber Zweig und Riedels Fdgr. bei Langenberg, welche ich am 14. und 15. Januar mit besuchte, wiederum nicht belegt waren.“ (40014, Nr. 322, Film 0092)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie man es bei diesem Betrieb zustandegebracht hat, weiß man nicht, doch hatte Herr Neubert bei seiner Befahrung am 27. Mai 1845 hier dann 22 Zentner ausgebrachten Braunsteins zu verwiegen und „daselbst sowie auf Meiers Hoffnung, Friedlich Vertrag und Wilkauer vereinigt Feld Eisenstein und Braunsteinstufen behufs deren Einsendung zur Industrieausstellung in Dresden ausgeschlagen.“ (40014, Nr. 322, Film 0068) Über den Grubenbetrieb heißt es in diesem Fahrbogen: „Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. ist, wie alle übrigen Langenberger Braunsteingruben, nur periodisch belegt. Ich fand 2 Arbeiter vor, die bei 5,7 Ltr Teufe unter Tage und bei 3,5 Ltr. nordnordöstlicher Entfernung vom Tageschachte mit dem Abbau einer hora 1,0 streichenden, in W. fallenden und 0,3 bis 0,4 Ltr. mächtigen, Braunsteinknollen enthaltenden Mulmschicht beschäftigt waren.“ Es herrschte aber auch schon „sehr fühlbarer Wettermangel“ und man werde den Betrieb wohl bei noch wärmerer Witterung wieder einstellen müssen. Auch ist die Zimmerung im Tageschacht repariert worden. Bis zum 11. September hatten die Eigenlöhner hier eine bescheidene Menge von 6 Zentnern aufbereitet und zu verwiegen, während die Grube wegen fehlender Wetter nicht befahren werden konnte. Am 3. November waren noch einmal 18 Zentner zu verwiegen (40014, Nr. 322, Film 0138 und 0150). Von der Befahrung am 12. November 1845 heißt es, die Grube sei „nur zuweilen mit 2 bis 3 Mann belegt,“ welche in 6,8 Ltr. Teufe aus dem nördlichen Stoß des Tageschachtes heraus ein 0,1 bis 0,2 Ltr. mächtiges Braunsteintrum abgebauten. Bei den Befahrungen im Revier am 18. und 19. Dezember 1845, schrieb Herr Neubert, „besuchte ich übrigens noch die Gruben (...) Köhlers, Riedels, Friedrich, Hausteins und Rother Stolln, welche ich jedoch sämtlich nicht belegt fand.“ (40014, Nr. 322, Film 0159) Irgendwie hat man im Winter 1845/1846 aber doch weitergearbeitet und so hatte Herr Neubert am 24. Februar 1846 wieder 15 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 322, Film 0176).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während er dann am 16. März 1846 die Grube wieder einmal nicht belegt vorfand, heißt es im Fahrbericht vom 8. Mai des Jahres, sie sei „jüngst fast täglich mit 2 Mann belegt gewesen.“ Man hatte den Tageschacht bis auf 9,3 Ltr. abgesenkt, wo die Grenze zum Glimmerschiefer im östlichen kurzen Stoß erreicht wurde, die stark in NW. einschießt, dort ein Ort hora 4,6 SW. 4 Ltr. fortgebracht und dabei „Mulm, in welchem große Blöcke von sogenanntem Brockenfels inneliegen und Braunstein, auf dessen Gewinnung jetzt nur allein die Absicht gerichtet ist, knollenweise einbricht,“ durchfahren (40014, Nr. 322, Film 0180 und 0194f). Davon waren bis 3. Juni 1846 wieder 6 Zentner ausgebracht (40014, Nr. 322, Film 0198). Von seiner Befahrung am 24. Juni 1846 heißt es dann, man baute in 9,3 Ltr. Teufe und 2 Ltr. westlich vom Schacht auf dem sich hier in die Höhe ziehenden Mulmlager Braunsteinnester ab, „die jedoch von keinem großen Belang waren.“ (40014, Nr. 322, Film 0198) Im September mußte man den Betrieb wegen Wettermangels wieder einstellen (40014, Nr. 322, Film 0218f). Erst im November 1846 war die Grube wieder belegt, wobei Herr Neubert bei seiner Befahrung aber nichts verändertes vorfand (40014, Nr. 322, Film 0231). So ging es auch im folgenden Jahr weiter: Am 21. Januar 1847 war die Grube unbelegt und erst am 18. Februar konnte Herr Neubert wieder anfahren. Dabei fand er das Ort in 9,2 Ltr. Teufe und 2,7 Ltr. südwestlich vom Schacht ansteigend weitergetrieben und war nun hora 11,6 Süd 5,2 Ltr. erlängt. Bemerkenswert war für ihn jetzt noch: „Vor dem Ort bricht ziemlich viel Braunstein knollenweise ein.“ (40014, Nr. 322, Film 0237 und 0242) Damit endet die Aktenüberlieferung der Fahrbögen der Berggeschworenen. Auch in der Grubenakte besteht eine ziemliche zeitliche Lücke. Wie man erst etwas weiter hinten aus derselben erfährt, hatten die drei Bergarbeiter Christian Lobegott Riedel, Christian Friedrich Meinhold und Friedrich August Meinhold, im Jahr 1851 die Grube vom vorigen Besitzer Carl Christian Haustein erkauft und besaßen sie nun zu gleichen Teilen. Einen Gesellenvertrag gab es nicht (40169, Nr. 160, Blatt 21). Wahrscheinlich waren es auch dieselben drei Bergarbeiter, die die Grube in den folgenden Jahren in Weilarbeit selbst betrieben haben. Als nächstes findet man dann aber schon die Anzeige über den Grubenbetrieb auf das Jahr 1856, welche besagt, daß hier drei Weilarbeiter angelegt waren, durch die in diesem Jahr Örter im oberen Schacht bei 10 Lachter Teufe gegen Abend um 7 Lachter gegen Abend, im unteren bei 5 Lachter Teufe um 4 Lachter sowie bei 10 Lachter Teufe um 13 Lachter, ebenfalls gegen Abend, ausgelängt worden sind. Die gefallenen Berge seien teils in der Grube versetzt, teils ausgefördert worden. Dabei hatte man 128 Zentner Braunstein ausgebracht, der für 59 Thaler, 22 Neugroschen ‒ also der Zentner für nur 14 Groschen ‒ verkauft werden konnte (40169, Nr. 160, Blatt 2).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 23. Mai 1857 wurde die Umwandlung des Grubenfeldes von Hausteins Hoffnung nach den Maßgaben des Berggesetzes von 1851 in Annaberg protokolliert. Es umfaßte damals demnach 2.744 Quadratlachter Fläche oder 3 Maßeinheiten (40169, Nr. 160, Blatt 3). Für das Jahr 1857 liegt auch ein Betriebsplan vor, der am 6. Juni 1857 an Geschworenen Tröger zur Begutachtung gegangen ist. Die drei Weilarbeiter waren eigentlich auf Gottes Geschick am Graul angelegt. Das bebaute Lager hatte ein Streichen von hora 4 und fiel zirka 25° in Nordwest. Sämtliche Strecken standen in doppelter Türstockzimmerung. Man erwartete zwar 86 Thaler Einnahmen aus dem Erzverkauf, benötigte aber dennoch 56 Thaler Zubußen der Eigenlehner, damit am Ende eine ,schwarze Null' herauskam (40169, Nr. 160, Blatt 4f). Ferner zeigte der Bevollmächtigte der Gesellenschaft, Doppelhäuer Friedrich August Meinhold, am 31. August diesen Jahres in Annaberg an, daß sie Herrn Hermann August Oehme für ihre Grube als Schichtmeister einsetzen wollen und daß der Doppelhäuer Christian Lobegott Riedel den Steigerdienst versorgen solle. Danach befragt, sprach sich Geschworener Tröger aber gegen die Bestellung Riedel's zum Steiger aus, weil er zwar „ein lobenswerte Bergarbeiter, doch ohne Schulkenntnisse und schon 55 Jahre alt“ sei (40169, Nr. 160, Blatt 7ff). So genehmigte das Bergamt am 19. September 1857 zunächst nur die Verpflichtung von Oehme als Schichtmeister. Auch als Friedrich August Meinhold die Steigerfunktion selbst übernehmen wollte, lehnte dies das Bergamt am 27. Januar 1858 ab mit der Begründung, ein Steiger sollte die Bergschule besucht haben (40169, Nr. 160, Rückseite Blatt 11f). Herrn Oehme's erste Anzeige zum Grubenbetrieb im Jahr 1857 besagt, daß man mit gleichgebliebener Belegung in diesem Jahr in 10 Lachter Teufe und 10 Lachter westlich vom unteren Schachtes ein Feldort angehauen und hora 5 Südost 11 Lachter erlängt habe, wobei man den angetroffenen Braunstein strossenweise abgebaut hatte. Außerdem hatte man 3 Lachter des Schachtes sowie eine ebenso lange Strecke der Wetterstrecke neu ausgezimmert. Das Ausbringen lag im Jahr 1857 bei 180 Zentnern Braunstein, für die man einen Erlös von 144 Thalern erzielte, also gegenüber dem Vorjahr einen guten Preis von nun 24 Groschen pro Zentner (40169, Nr. 160, Blatt 14). Der neu bestellte Schichtmeister zeigte in diesem Jahr auch noch an, daß es keine Grubenrisse gäbe, woraufhin man seitens des Bergamtes Markscheider Reichelt mit der Anfertigung beauftragte (40169, Nr. 160, Blatt 13).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weil die Steigerfunktion noch immer nicht besetzt war, zeigte Geschworener Tröger dies am 5. August 1858 noch einmal an. Daraufhin wurde als Steigerdienst- Versorger für Hausteins Hoffnung August Friedrich Wolf von der Grube Meyers Hoffnung damit betraut. Für diese Tätigkeit erhielt er eine Vergütung von 5 Neugroschen pro Woche (40169, Nr. 160, Rückseite Blatt 14ff). Der Anzeige auf das Jahr 1858 kann man dann entnehmen, daß nun neben dem Steigerdienst- Versorger 4 Weilarbeiter angelegt waren. Man hat auch in diesem Jahr den Örterbetrieb fortgesetzt und das Feldort in 10 Lachtern Teufe des unteren Schachtes um weitere 6 Lachter auf nun 17 Lachter Länge fortgestellt. Außerdem hatte man in 5 Lachtern Teufe ein neues Feldort in Richtung hora 1 Nordost 9 Lachter weit getrieben und dort auf 1 Lachter Höhe Braunstein firstenweise abgebaut. Aus dem oberen Schacht heraus wurde in 10 Lachter Teufe ein weiteres Feldort in Richtung hora 9 Nordwest um 6 Lachter und an gleicher Stelle ein zweites hora 4 Südwest 11 Lachter weit ausgelängt. Auf dem letzteren hatte man 1,5 Lachter hohe Firstenbaue verführt. Auch ist der untere Schacht sowie weitere 3 Lachter Länge der Wetterstrecke neu ausgezimmert worden. Dabei wurden 366 Zentner Braunstein im Wert von 313 Thalern, 10 Neugroschen gefördert. Der Durchschnittspreis für den Zentner war folglich auf über 25 Groschen weiter angestiegen (40169, Nr. 160, Blatt 17). Diese guten Betriebsergebnisse hielten auch in den nächsten Jahren an. Aus der Anzeige auf 1859 erfährt man, daß nun auch ein Lehrhäuer fest auf der Grube angelegt war. Im unteren Schacht hatte man das Feldort hora 1 weiter betrieben und weitere 9 Lachter fortgestellt, im oberen Schacht das Feldort hora 4 um 6 Lachter fortgebracht. Dabei wurden insgesamt 4 Quadratlachter Lagerfläche ausgehauen, wobei 320 Zentner Braunstein ausgebracht werden konnten. Davon wurden 240 Zentner im Jahr 1859 verkauft, der Rest verblieb im Vorrat. Der mittlere Verkaufspreis lag bei etwas über 23 Groschen (40169, Nr. 160, Blatt 18f). Über den Grubenbetrieb im Jahr 1860 vermeldete Schichtmeister Oehme dann, daß man mit gleicher Belegung, wie im Vorjahr, aus dem unteren Schacht heraus in 5 Lachter Teufe und 20 Lachter vom Schacht entfernt das Braunsteinlager auf 4 Lachter Länge und 0,5 Lachter Höhe und ebendort in 10 Lachter Teufe und 4 Lachter südwestlich vom Schacht auf 3 Lachter Länge und 0,5 Lachter Höhe ausgehauen hatte, was nach unserer Rechnung also wieder 3,5 Quadratlachter Lagerfläche entspricht. Auch im oberen Schacht wurde der Örterbetrieb fortgesetzt und schließlich hatte man noch einen neuen „Waschkasten“ gefertigt. In diesem Jahr konnten dabei 330 Zentner Braunstein gefördert werden, von dem man 290 Zentner für 277 Thaler, 10 Neugroschen verkaufen konnte. Der durchschnittliche Preis für den Zentner war als auf nun über 28 Groschen weiter angestiegen (40169, Nr. 160, Blatt 20f). Der Vorrat summierte sich nun auf 80 Zentner aus 1859 zuzüglich 40 Zentnern aus diesem Jahr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf die Betriebsperiode 1861 bis 1863
wurde vom Bergamt ein Betriebsplan gefordert, den Schichtmeister Oehme
erstellte und den der Bevollmächtigte der Gesellenschacht Meinhold
unterzeichnete. Er sah im wesentlichen vor, ein Feldort in 8 Lachtern
Teufe zu betreiben. Und einer der Schächte hatte inzwischen den Namen
Friedrichschacht bekommen. Finanziell strebte man wieder ein ,schwarze
Null' an (40169, Nr. 160, Blatt 22ff).
Das ganze ging wie üblich zuerst wieder an den Geschworenen Tröger
zur Prüfung, der aber dazu nichts zu erinnern fand, und so wurde
der Plan auch in Freiberg am 8. Februar 1862 genehmigt (40169, Nr. 160,
Blatt 29).
Derweil war das erste Jahr des Betriebszeitraumes schon um und Schichtmeister Oehme reichte die nächste Anzeige auf das Jahr 1861 im Bergamt ein. Danach hatte man mit gleicher Belegung wie zuvor aus dem oberen Schacht in 10 Lachtern Teufe ein neues Feldort hora 6 Ost angelegt und auf inzwischen 16 Lachter ausgelängt. Außerdem hatte man in 8 Lachtern Teufe ein Feldort hora 12 Süd auf nun 22 Lachter fortgebracht und dort auf 13 Lachter Länge und 1 Lachter Höhe das Braunsteinlager abgebaut. Aus dieser ziemlich großen Lagerfläche von 13 Quadratlachtern hat man in diesem Jahr 240 Zentner Braunstein gewinnen und davon 200 Zentner für 166 Thaler, 20 Neugroschen (also den Zentner diesmal zu genau 25 Groschen) verkaufen können (40169, Nr. 160, Blatt 28). Es kamen hiernach noch einmal 40 Zentner Braunstein zum Vorrat, so daß dieser eigentlich schon auf 160 Zentner angewachsen sein müßte. Der Anzeige des Schichtmeisters auf das Jahr 1862 ist zu entnehmen, daß man mit gleichgebliebener Belegung am oberen Schacht in 8 Lachter Teufe und 14 Lachter vom Schacht entfernt firstenweise 17 Quadratlachter Lagerfläche ausgehauen hatte. Ferner hatte man nur 7 Lachter östlich vom Friedrichschacht einen neuen Schacht 3¾ Lachter tief bis auf das Lager abgesunken und verzimmert. Dort hatte man ein Feldort hora 12 Süd 5 Lachter und dann hora 4 Nordost weitere 2 Lachter getrieben. Das Ausbringen erreichte in diesem Jahr 268 Zentner Braunstein. Ob sich Herr Oehme an dieser Stelle verzählt hat, können wir nicht wissen, aber zu dieser Förderung addierte er nur 80 Zentner Vorrat, was also 348 davon ergab, wovon wiederum 308 Zentner verkauft worden sind (und wieder 40 übriggeblieben sein müssen). Für die verkaufte Menge erzielte man einen Gesamtpreis von 240 Thalern, 15 Neugroschen, respektive rund 23½ Groschen pro Zentner (40169, Nr. 160, Blatt 30). Der Anzeige des Schichtmeisters auf das nächste Jahr 1863 zufolge hatte man inzwischen einen neuen Schacht namens ,Augustschacht' geteuft und von diesem ausgehend in 3¾ Lachter Teufe und 11 Lachter südöstlich vom Schacht 15 Quadratlachter Feld abgebaut, wobei man wiederum 284 Zentner Braunstein ausgebracht hatte. Von diesem (und dem Vorrat aus dem Vorjahr) hat man 264 Zentner absetzen können (40169, Nr. 160, Blatt 31). Die Belegung umfaßte nun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die nächste Betriebsperiode von 1864 bis 1866 hatte Schichtmeister Oehme wieder einen Betriebsplan einzureichen. Der wurde wieder vom Bevollmächtigten der Gesellenschaft, Friedrich August Meinhold, abgezeichnet und ging am 17. September 1864 an Geschworenen Tröger zur Begutachtung, der aber am 24. September nur kurz und knapp vermerkte, er sei „mit... dem Betriebsplan einverstanden.“ So wurde der Plan auch am 19. Oktober vom Oberbergamt in Freiberg genehmigt, was man am 26. Oktober 1864 dem Bevollmächtigten der Gesellenschaft seitens des Bergamts Schwarzenberg mitteilte. Der Plan sah vor, binnen der drei Jahre zirka 1.000 Zentner Braunstein zu fördern und dafür Einnahmen in Höhe von insgesamt 883 Thalern, 10 Neugroschen (also 25 Groschen pro Zentner) zu erlösen. Bei einem 1864 bestehenden Kassenbestand in Höhe von rund 418 Thalern, erwarteten Einnahmen von zirka 278 Thalern und erwarteten Ausgaben von 293 Thalern pro Jahr verblieb am Ende dieses Betriebszeitraums ein Überschuß von 94 Thalern übrig (40169, Nr. 160, Blatt 32ff). So war der Plan. In seiner Jahresanzeige auf 1864 berichtete Schichtmeister Oehme dann, daß man weiter in 3¾ Lachter Teufe des Augustschachtes, nun aber 15 Lachter südöstlich von diesem, 18 Quadratlachter Lagerfläche ausgehauen, dabei aber nur 90 Zentner Braunstein ausgebracht habe (40169, Nr. 160, Blatt 37). Zusammen mit dem aus dem Vorjahr verbliebenen 60 Zentnern Vorrat hatte man diese sämtlich verkauft und dafür 115 Thaler Erlös (also nur 23 Groschen pro Zentner) erzielt. Über das Jahr 1865 berichtete Herr Oehme dem Bergamt, man baute noch immer am Augustschacht, nun aber wieder rückschreitend in nur noch 6 bis 9 Lachter Entfernung von diesem, das Lager ab. Obwohl man in diesem Jahr nur 8,5 Quadratlachter Fläche ausgehauen hatte, brachte man dabei 137 Zentner Braunstein aus, von dem 128 Zentner für 97 Thaler und 9 Neugroschen (im Schnitt knapp 23 Groschen pro Zentner) verkauft wurden. Außerdem hatte man auch 23 Fuder Eisenstein gefördert. Zusammen mit einem noch auf Vorrat liegenden Fuder wurde auch das Eisenerz für 52 Thaler verkauft (das Fuder folglich zu 2 Thaler, 5 Groschen). Neben dem Steigerdienstversorger waren nun 2 Doppelhäuer auf der Grube angelegt (40169, Nr. 160, Blatt 38). Für das Jahr 1866 hat der Schichtmeister dann aber ein „Frist- Register“ eingelegt. Da die Besitzer gar keine Fristhaltung beantragt hatten, fragte das Bergamt in Schwarzenberg nach und forderte sie am 25. August 1866 zur Betriebsfortsetzung auf (40169, Nr. 160, Blatt 39). Daraufhin wurde Herr Meinhold am 7. November in Schwarzenberg vorstellig und erklärte, die Grube sei nur im Quartal Trinitatis, und zwar wegen Wettermangel, außer Betrieb gewesen. Dasselbe bestätigte am 10. November 1866 dem Bergamt gegenüber auch Geschworener Tröger und teilte außerdem mit, „im Übrigen sey Hausteins Hoffnung in neuester Zeit an Zweigler verkauft worden.“ (40169, Nr. 160, Blatt 40) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch in Herrn Tröger's Fahrbogen
auf das Quartal Luciae kann man unter dem 8. Oktober 1866 lesen, daß die
Grube (und zwar schon am 30. September des Jahres) von den Vorbesitzern
für 110 Thaler an den Fabrikanten und „Handelsmann“ Ernst
Erdmann Zweigler in Wildenau verkauft worden ist. Über den Betrieb
unter dem neuen Besitzer berichtete Herr Tröger, man sinke einen
neuen Tageschacht ungefähr 18 Lachter hora 11 nordwestlich vom Fundschacht
ab, da der letztere dringend neu ausgezimmert werden müsse. Vom
Geschworenen wurde der neue Besitzer Zweigler hier sehr gelobt, indem er
über ihn im Fahrbogen vermerkte, daß dieser „lobenswerthen Eifer, seine
Grube in gutem Stande zu erhalten,“ an den Tag lege (40169, Nr. 160, Blatt 41).
Die Jahresanzeige von Schichtmeister Oehme auf das abgelaufene Jahr 1866 berichtet uns dann, daß man im ersten Halbjahr in 3¾ Lachter Teufe des Augustschachtes noch einmal 1,5 Quadratlachter Feld ausgehauen, außerdem Ortsbetriebe nach Südosten eingeleitete hatte. Nun wurde 19 Lachter nördlich vom Friedrichschacht der neue Tageschacht niedergebracht, wobei man 8 Lachter Glimmerschiefer und dann 7 Lachter Lagermasse durchsunken hatte. In 14 Lachter Teufe hatte man dann zwei Örter, nach Süd und hora 4,4 nach Nordost, angehauen und jeweils 4 Lachter erlängt. Dazu hatte Herr Zweigler zum Schluß des Quartals Luciae
und 1867 noch einen Grubenjungen auf der Grube angelegt. Ausgebracht hatte man in diesem Jahr 85 Zentner Braunstein, wovon 55 Zentner verkauft werden konnten (40169, Nr. 160, Blatt 45). Im Fahrbogen des Berggeschworenen liest man über seine Befahrung am 24. Juni 1867, daß man mit dem Ort hora 6,4 (oder 4,4?) nach Nordost bei 8 Lachter Erlängung Braunsteintrümer angefahren hat. Da wieder einmal Wettermangel herrschte, wurde zugleich der Fundschacht verteuft und mit der 14 Lachter- Sohle durchschlägig gemacht (40169, Nr. 160, Blatt 48). Schichtmeister Oehme berichtete ungefähr dasselbe über den Betrieb im Jahr 1867, außerdem habe man auch ein Gesenk auf der 14 Lachter- Sohle geteuft und noch 2 Lachter unter dieser Ortsbetrieb im Lager aufgenommen. Dabei konnte man 468 Zentner Braunstein fördern. Zusammen mit dem Vorrat von 39 Zentner aus den beiden Vorjahren waren das nun 507 Zentner, von denen 477 Zentner für 318 Thaler (also nur noch 20 Groschen der Zentner) verkauft werden konnten (40169, Nr. 160, Blatt 49). Der alte Wolfschacht war allerdings zu Bruch gegangen. Auch im folgenden Jahr 1868 setzte sich der Betrieb recht erfolgreich fort. Dem neuen Tageschacht hatte man in der Zwischenzeit den Namen Williamschacht gegeben. Von diesem aus hatte man in diesem Jahr in 10 Lachter Teufe und 9 bis 15 Lachter südwestlich vom Schacht 13 Kubiklachter Lagermasse ausgehauen, was schon eine beachtliche Menge gewesen ist. Außerdem wurden auch in 9 Lachter Teufe Örter getrieben. Dabei wurden diesmal 357 Zentner Braunstein ausgebracht, zusammen mit dem Vorrat aus dem Vorjahr hatte man also 387 Zentner zur Verfügung, und hat davon 359 Zentner für 239 Thaler, 10 Neugroschen verkauft; also wie im Vorjahr einen Preis von 20 Groschen pro Zentner erzielt (40169, Nr. 160, Blatt 52).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang des Jahres 1869 trat dann das
Allgemeine Berggesetz im Königreich Sachsen in Kraft. Die Kontrolle der
Bergbaubetriebe übernahmen nun anstelle der Geschworenen der Bergämter die
Berginspektionen, hier des Berginspektionsbezirks Schneeberg mit Sitz in
Zwickau. Von dort kam am 3. April 1869 Berginspektor Gustav Netto
nach Langenberg und berichtete in seinem Fahrjournal, man fahre gerade ein
Steigort zum oberen Schacht auf, um besseren Wetterzug zu erzielen. Ganz
im Gegensatz zu Tröger noch drei Jahre zuvor war er aber nicht ganz
so angetan vom Betrieb und fand auch gleich Veranlassung zu einem
Zechenbucheintrag, in dem er bemängelte, daß weder der obere Schacht, noch
der Williamschacht ordnungsgemäß verschlossen und abgedeckt waren;
auch die Gesenke untertage nicht (40169,
Nr. 160, Blatt 53f).
Auch zog sich der Besitzer aus der Betriebsleitung zurück und benannte gegenüber dem Bergamt den Obersteiger Albrecht Hartmann als neuen Betriebsleiter für die ihm gehörigen Gruben, was am 7. August 1869 auch seitens des Bergamtes zugelassen worden ist (40169, Nr. 160, Blatt 55f). Dem Fahrjournal von Inspektor Netto vom 29. Oktober 1870 ist dann zu entnehmen, daß „infolge anhaltenden Regenwetters“ die 14 Lachter- Sohle abgesoffen und nur die 8 Lachter- Sohle aus dem Ernstschacht (schon wieder ein neuer oder war das der ,obere Schacht' ?) zu befahren war (40169, Nr. 160, Blatt 57f). Am 29. Juli des Jahres 1871 wandte sich Zweigler dann mit der Beschwerde an das Landesbergamt in Freiberg, daß vonseiten Wilkauer vereinigt Feld (welche die frühere Ulricke Fundgrube 1862 übernommen hatten) an der Grenze zu seinem Grubenfeld ein neuer Schacht geteuft und Abbau betrieben werde und äußerte den Verdacht des Raubbaus zu seinem Nachteil (40169, Nr. 160, Blatt 59f). Am 17. August 1871 forderte man seitens des Bergamtes daher den Bergingenieur Carl Wilhelm Hering als Vertreter des Eigentümers (es war noch die Königin Marienhütte) zur Vorlage der Grubenrisse und zur Stellungnahme auf (40169, Nr. 160, Blatt 61f). Der gab daraufhin auch zu, daß es „wegen des theilweisen Mangels an Rainsteinen“ zur Feldüberschreitung gekommen sei und daß er nach Prüfung der Risse den Abbau sofort habe einstellen lassen. Zum Ausgleich bot er dem Besitzer der Nachbargrube die Übernahme des dort geteuften Schachtes (der auch Wolfschacht hieß) an und stellte ihm zur Disposition, als Entschädigung entweder eine pauschale Zahlung in Höhe von 30 Thalern oder die Übernahme des dort geförderten Braunsteins gegen Erstattung der Produktionskosten anzunehmen (40169, Nr. 160, Blatt 62). Das nun wiederum paßte Herrn Zweigler überhaupt nicht und er schrieb am 5. September an das Bergamt zurück, die Schuld für die Grenzüberfahrung liege ausschließlich bei Wilkauer vereinigt Feld und man hätte sich schließlich vor Beginn des Schachtabsinkens Gewißheit über die Lage der Grubenfeldgrenzen verschaffen müssen. Die angebotene Entschädigung lehnte er als „nicht geeignet“ ab, weil die Bauten schon längere Zeit betrieben worden seien und die 30 Thaler dem Wert des dort geförderten Braunsteins keinesfalls entsprächen. Das Bergamt solle doch bitte das Nötige verfügen (40169, Nr. 160, Blatt 63ff). Die Entscheidung des Bergamtes vom 9. September 1871 kam dann sicherlich für Herrn Zweigler unerwartet: Zwecks Einklagung einer angemessenen Entschädigung wurde er an das zuständige Handelsgericht verwiesen... (40169, Nr. 160, Blatt 66) Nach den Bergrechtsregelungen vor 1869 wäre tatsächlich das Bergamt für diese Sache zuständig gewesen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob dieser Vorgang dazu beigetragen hat,
daß sich Herr Zweigler entschieden hat, seine Bergwerke in
Langenberg wieder zu verkaufen, können wir nicht wissen. Jedenfalls hielt
man in einer Aktennotiz am 25. November 1873 im Bergamt fest, daß er alle
vier ihm gehörigen Gruben an Hermann Gruson verkauft habe
(40169, Nr. 160, Blatt 67).
Damit kamen nun auch bei Hausteins Hoffnung die Grusonwerke bei
Magdeburg als neuer Akteur ins Spiel.
Wie es weiter oben im Text (u. a.
bei der Grube Himmelfahrt in
Am 21. Mai 1875 war Berginspektor Netto zugegen und berichtete in seinem Fahrjournal, daß man gerade dabei war, den oberen sowie den Fundschacht zu verfüllen. Ob ansonsten überhaupt Betrieb umging, weiß man nicht so genau, denn der Inspektor bemängelte nur noch, daß der untere Schacht besser verschlossen oder aber ebenfalls ausgestürzt werden solle ‒ was nicht eben dafür spricht, daß dort noch Bergleute angefahren sind (40169, Nr. 160, Blatt 70f). Dann wiederholte sich auch hier die Geschichte: Nach dem vom Bergamt eingeholten Grundbuchauszug vom 20. Dezember 1877 hat H. Gruson auch diese Grube nun an die Societé anonyme des mines et usines de Hof - Pilsen - Schwarzenberg mit Sitz in Brüssel überlassen (40169, Nr. 160, Blatt 74). Wie üblich, wurden die neuen Besitzer vom Bergamt zur Benennung der verantwortlichen Personen aufgefordert, woraufhin auch hier mit Schrieben vom 31. März 1878 Bergverwalter Robert Pilz die Angelegenheiten übertragen wurden. Als Steiger wird ein Wilhelm Beyer aus Hof benannt, der dort zuvor schon auf anderen Eisensteingruben als solcher tätig gewesen ist, was vom Bergamt auch am 29. Dezember 1878 genehmigt wurde (40169, Nr. 160, Blatt 75f). Schließlich wird nach dem Weggang von Fritzsche nach Hof auch hier Ernst Emil Braune der Bevollmächtigte der Besitzer in Sachsen. Wirklich geschehen ist unter diesen Besitzern aber auch hier nichts ‒ im Gegenteil besteht in der Aktenüberlieferung eine längere Lücke. Erst am 30. April 1885 war Berginspektor G. Tittel (offenbar wegen eines Fristhaltungsantrages) wieder zugegen, fand aber bei Hausteins Hoffnung, wie auch bei Gelber Zweig „weder Schacht noch Stolln sichtbar, nur sind auf dem Grubenfelde kleinere Bingen zu finden.“ Einer Betriebsaussetzung stehe folglich nichts entgegen (40169, Nr. 160, Blatt 77f). Die wurde dann am 6. Juni 1885 zunächst bis Ende Crucis 1885 auch erteilt und danach insgesamt dreimal bis Ende 1888 verlängert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie es u. a. schon bei der
Außer der mehrfachen Verlängerung der Betriebsfrist und dem Wechsel des Bevollmächtigten (ab 1891 ein Kaufmann Wilhelm Vogel in Schwarzenberg) passierte allerdings danach nichts. Weil sie in Fristen lag, folglich kein Betrieb umging, gibt es auch keine Fahrbögen aus dieser Zeit. Einer Mitteilung des Landesbergamtes
an die Berginspektion Zwickau vom 20. Februar 1893 ist dann zu entnehmen, daß Paul Förster auch dieses Grubenfeld nun an Gustav
Zschierlich verkauft hat. Zur Fortsetzung der Geschichte unter diesem Besitzer
schlage man wieder weiter unten im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ulricke Fundgrube und Maßen zwischen
Langenberg und Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Grube ist in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere im Zeitraum von 1832 bis 1850 aufgeführt (40166, Nr. 22 und 26). In dieser Zeit hat sie ausschließlich Braunstein, und zwar die beachtliche Menge von 2.419½ Zentnern oder etwa 121 metrischen Tonnen ausgebracht. Zwischen 1835 und 1840 war außerdem eine erste obere Maß ‒ aber an einen anderen Lehnträger ‒ verliehen (40169, Nr. 301). Unter diesem Namen wurde die Grube jedenfalls am 11. Dezember 1831 durch den auf Stamm Asser angestellten Steiger Johann Gottfried Reppel gemutet (40014, Nr. 270, Film 0109). Allerdings hat es das Bergamt in Scheibenberg „bedenklich befunden, es Reppel in Lehn zu reichen,“ weil Stamm Asser zu dieser Zeit ja schon im Schneeberg’er Bergrevier gelegen hat. Nach seiner Besichtigung „des neu aufgenommenen Gebäudes Ulrike gev. Fundgrube“ am 19. November 1832 berichtete der Berggeschworene Johann August Karl Gebler, Reppel habe sich bewegen lassen, die Grube an den Bergarbeiter Christian Gotthold Weißflog aus Langenberg abzutreten, worüber der Geschworene am 28. Dezember 1832 noch einmal gesonderte Anzeige erstattete (40014, Nr. 270, Film 0112f). Daraufhin bestätigte das Bergamt dem letztgenannten am 29. Dezember 1832 die Grube (40014, Nr. 270, Film 0114 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 319 und 40169, Nr. 305, Blatt 1). Wie wir später noch erfahren werden, waren die beiden Familien Reppel und Weißflog verschwägert. Am 1. Dezember 1833 mutete der Besitzer Weißflog noch eine gevierte Maß sowie ein geviertes Lehn und eine Überschar von 28 Quadratlachtern Fläche zum Besten der Ulrike Fundgrube (40014, Nr. 270, Film 0140f). Nach Besichtigung durch den Geschworenen am 20. Januar 1835 erhielt Herr Weißflog das zusätzliche Feld auch am 24. Januar 1835 bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 323 und 40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 1).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als nächster legte dann
Christian Heinrich Wilhelm Hähnel und Konsortschaft aus Grünstädtel am
2. März 1835 Mutung auf eine Fundgrube neben der Ulricke Fundgrube
ein. Nach Besichtigung durch den Geschworenen Gebler am 1. April
1835 erhielt der Muter am 2. September 1835 aber nur eine gevierte Maß
nebst zwei gevierten Wehren unter dem Namen Ulricke obere morgentliche
nächste Maß bestätigt (40014, Nr. 270, Film 0151ff, 40014,
Nr. 43, Blatt 325 und 40169, Nr. 301, Blatt 1). In dem Fahrbericht des
Geschworenen wird die Lage übrigens mit „zu Langenberg am
Zeisiggesang“ beschrieben – eine
Die Konsortschaft mutete gleich am 24. November 1835 noch zwei weitere gevierte Wehre hinzu, die ihnen auch am 25. November bestätigt worden sind (40014, Nr. 270, Film 0163). Offenbar gab es auch innerhalb der Konsortschaft in der Zwischenzeit schon Änderungen, denn diese Mutung unterzeichnete Carl Friedrich Harnisch namens der Gesellen. Die Eigentümer der Ullricker Maße gaben allerdings bald wieder auf und am 16. Januar 1837 sagten sie die Wehre wieder los (40014, Nr. 43, Blatt 325). Die Lossagung wurde im Bergamt Annaberg am 18. Februar 1837 zu Protokoll genommen (40169, Nr. 301, Rückseite Blatt 1). Am 6. Juli desselben Jahres wurde dann auch die gevierte Maß durch Christian Gotthold Weißflog losgesagt (40169, Nr. 301, Blatt 2). Daraufhin legte Carl August Weißflog am 6. Juli 1837 „auf die von Eigenlöhner Hähnel losgesagte Ullricke obere morgentliche gev. Maß nebst zwei Wehren“ Mutung ein. Das Grubenfeld wurde ihm nach erneuter Besichtigung durch den Berggeschworenen am 27. September 1837 zugesprochen (40014, Nr. 270, Film 0200, 40014, Nr. 43, Blatt 334 und 40169, Nr. 301, Rückseite Blatt 2), obwohl auch Carl August Ley (oder Lein) Mutung auf die Maßen eingelegt hatte (40014, Nr. 270, Film 0205f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Fahrbögen des Berggeschworenen
Johann August Karl Gebler taucht die Grube nach all dem Hin und Her erst am
2. März 1837 erstmals auf (40014, Nr. 294,
Film 0023). Anlaß dafür war, wie
in dieser Zeit recht oft, eine Feldstreitigkeit mit der Nachbargrube
Hausteins Hoffnung. Der Geschworene hat sich an genanntem Tage
„auf Ulricke Fdgr. begeben, um hier zu untersuchen, in wie weit man
wohl den ergangenen bergamtlichen Anordnungen, der angebrachten
Feldverletzungs- Beschwerden bey dem Grubengebäude Hausteins Hoffnung Fdgr.
und dieser zum Nachtheil von Ulricke Fdgr. aus überschrittener Markscheide
betreffend, nachgekommen sey.“
Auch hinsichtlich des Grubenbetriebes fand der Geschworene einiges zu bemängeln. Als er am 19. April 1837 zugegen war, notierte er in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 294, Film 0031f): „Man hat hier den Fundschacht abzuteufen angefangen, ein Stück niedergebracht, dermalen aber noch ohne Zimmerung gelaßen. In dem daneben befindlichen, so übel beschaffnen Wetterschachte hat man zwar einige kleine Holzausbesserungsarbeiten vorgenommen, allwie der Schacht steht, ohngeachtet der den Eigenlehnern schon vor mehrern Wochen gegebenen diesfallsigen Ermahnungen und Anweisungen, aber noch in seiner ehedem (?) Gefahr drohende Gestalt da. Man hegt übrigens seitens der hiesigen Eigenlöhnerschaft noch immer die Meynung, es sey erforderlich, in der Entfernung von wenigen Lachtern vom Fundschachte gegen Mitternacht einen neuen Schacht in dem nahgelegenen Felde so anzulegen, um mit demselben die sich dorthin ziehenden Anbrüche unmittelbar treffen und eine Förder- und Commuications Strecke ersparen zu können. Kaum aber dürfte, wenn sich nicht zwischen dem Herrn Grundbesitzer und der Eigenlöhnerschaft sehr günstige Verhandlungen diesfalls einleiten laßen, dieses Entwurfs Ausführung und höchstens nur dann zu gestatten bleiben, wenn man sich Seiten des Ritterguts Förstel zur Annahme eines erhöhten jährlichen Abtrages bereitwillig erklären sollte.“ Auch der nächste Fahrbericht vom 25. Juli 1837 klingt nicht wirklich besser (40014, Nr. 294, Film 0052f): Herr Gebler ist nämlich „daselbst vor der Hand nicht gefahren, da ich schon in voriger Woche in Erfahrung gebracht, daß es so wenig hier als auf mehrern andern Gruben dieser Art rathsam sey, auch größtentheils ganz (unmöglich?) falle, in solche zu fahren, indem der Wettermangel, wie gewöhnlich hier zur Sommerzeit, dieses verhindere. Zudem sey – dies die Erklärung des Lehnträgers Weißflog – die Stelle, wo man vor einiger Zeit nach Hausteins Hoffnung hinüber gefahren sey, dermalen verbrochen, wozu noch käme, daß man den Fundschacht um noch einige Lachter niedergebracht, die vier letzten Lachter jedoch nicht in Zimmerung gesetzt habe, in solche sie zu setzen, aber auch gar nicht Willens sey, inmaßen der Lehnträger Gotthold Weißflog erklärte, die Zimmerungskosten auf diesen Schacht zu wenden, falle der Besitzerin zu schwer und der Schacht stehe in malen fest und sicher genug, ohne Zimmerung zu bedürfen. Daß unter dergleichen Vorkommnissen ich wohl Bedenken tragen müßte, eine Befahrung daselbst anjetzt zu unternehmen, wo ohne alle Noth Gesundheit und Leben offenbar auf das Spiel gesetzt würde, ist mir wohl nicht übel zu deuten.“ Dieser Bericht nennt uns als Lehnträger Herrn Gotthold Weißflog, zugleich aber ist hier von einer ,Besitzerin' die Rede. Naheliegend wäre ja, daß selbige mit Vornamen Ulricke hieß, doch eine solche haben wir nirgends finden können... Der schlechten Betriebsführung halber gab es hierüber am 29. Juli auch einen Fahrbogenvortrag durch den Geschworenen im Bergamt in Annaberg. Dort aber legte man zunächst nur fest, die Befahrung sowie einen Markscheiderzug wegen der vermeintlichen Feldüberschreitung auf Zeiten mit besserem Wetterzug zu vertagen (40169, Nr. 305, Blatt 2). Über ein Ausbringen ist in dieser Zeit in den Fahrbögen Gebler's nichts vermerkt. Wir wissen aber schon, daß der Geschworene nur die Eisensteinvermessung darin vermerkt hat, während er zwar jedes Jahr mehrfach die Braunsteinvorräte besichtigt ‒ und wohl auch verwogen hat ‒ darüber aber in seinen Fahrbögen nur allgemeine Notizen hinterlassen hat. Die überlieferten Fahrbögen setzen im Quartal Trinitatis 1838 leider erst einmal aus. Dem Inhalt der Grubenakte zufolge hat Herr Gebler aber am 2. September 1937 noch an das Bergamt mitgeteilt, daß sich der Fundschacht noch immer „in desolatem Zustand“ befände, woraufhin der Lehnträger nun von der Bergbehörde zur Instandsetzung aufgefordert wurde (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 3). Einen weiteren Fahrbogenvortrag zu Ullricke gevierte Fundgrube hielt am 24. November 1838 Obersteiger Schubert, der interimistisch mit der Wahrnehmung der Geschworenenfunktion betraut war, bis ein neuer bestimmt sei. Demnach hatte dieser die Grube nun auch befahren können, dabei aber die Türstockzimmerung im Abbau „in unzuverlässigem Zustand“ befunden und den Lehnträger umgehend zur Instandsetzung aufgefordert. Der Anweisung des Geschworenendienst- Versorgers folgte auch das Bergamt und fügte noch hinzu, der Lehnträger solle abgeworfene Abbaue durch Bergeversatz verschließen, um Ausbauholz einzusparen (40169, Nr. 305, Blatt 4).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spätestens ab Reminiscere 1840 war als
Berggeschworener in Scheibenberg dann Herr Theodor Haupt bestellt.
Er befuhr alle gangbaren Gruben seines Reviers gleich am 10. Januar dieses
Jahres und berichtete über diese in seinem Fahrbogen (40014,
Nr. 300, Film 0015f):
„Auf Ulricke gev Fdgr. betreibt man in 1 Lachter Entfernung vom Tageschachte eine Strecke in NO., welche bereits 2½ Lachter erlängt ist, um dem vorliegenden, früher getriebenen, mit sehr hübschen Anbrüchen gesegneten Braunsteinbau frischere Wetter zuzuführen und sodann wieder zu belegen. Ulricke 1te obere Maas ist von dem Lehnträger verlaßen worden.“ Bereits neben der Eintragung der Verleihung an Carl August Weißflog in den Akten des Bergamtes Scheibenberg vom 27. September 1837 ist vermerkt: „losgesagt im Quartal Reminiscere 1840“ (40014, Nr. 43, Blatt 325). Auch in der betreffenden Grubenakte des späteren Bergamtes Schwarzenberg ist am 8. Februar 1840 protokolliert, daß die Maßen losgesagt worden sind (40169, Nr. 301, Blatt 3). Das nächste Mal hat Herr Haupt dann am 16. März 1840 „die Gruben des Wilkauer gemeinschaftlichen Feldes sowie mehrere der Langenberger und Tännichtwalder Eigenlöhnergruben befahren.“ Über Ulricke Fundgrube berichtete er danach (40014, Nr. 300, Film 0030): „Auf Ullricke gev. Fdgr. gewinnt man nun wieder auf dem früheren Bau Braunstein, nachdem demselben mittelst einer vom Tageschachte in NW. getriebenen Strecke frische Wetter zugeführt worden sind.“ Dasselbe Programm absolvierte der Geschworene im Quartal Trinitatis 1840 am 19. Mai. Auch jetzt fiel sein Bericht zu dieser Grube allerdings recht knapp aus (40014, Nr. 300, Film 0060): „Auf Ullricke Fdgr. baut man in NO. vom Schachte Braunstein ab, der ziemlich mächtig hier ansteht, die dahin führende Strecke hat man außerdem frisch verholzt.“ Den Streckenausbau hielt der Eigenlöhner also offenbar nun in guter Ordnung. Vermutlich war dann wieder einmal der schon so oft beklagte Wettermangel der Grund dafür, daß Herr Haupt am 29. Mai 1840 für die Grube den Ansatzpunkt für „einen neuen Tageschacht angegeben“ hat (40014, Nr. 300, Film 0062f). Den abzusenken, hat man wohl dann doch zurückgestellt, denn unter dem 10. August 1840 notierte Herr Haupt in seinem Fahrbogen, an diesem Tage „habe ich die Eigenlöhner Gruben im Tännicht befahren. Von diesen sind mehrere gegenwärtig wegen Wettermangel nicht in Betrieb oder werden daselbst wenigstens nur die Halden ausgekuttet oder die früher geförderten Producte ausgeschlagen. Diese Gruben sind namentlich Meyers gev. Fdgr. Ullricke gev. Fdgr. Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. Kästners neue Hoffnung gev. Fdgr.“ (40014, Nr. 300, Film 0091f) Daran änderte sich vorläufig auch nichts, denn auch unter dem 8. September liest man: „Auf Meyers, Kästners, Distlers, Ullricke und Hausteins findet gegenwärtig wegen Wettermangels kein Betrieb statt.“ (40014, Nr. 300, Film 0107f)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus einer Registratur des Bergamtes
Scheibenberg vom 1. Oktober 1840 erfährt man dann endlich auch den Namen
der Besitzerin, die in der zurückliegenden Zeit hinter den Aktivitäten
gestanden hat: An diesem Tage nämlich erschien Frau Christine
Friedericke Reppel, geb. Ullmann aus Langenberg an
Bergamtsstelle und zeigte diesem an, daß sie mit ihren acht Kindern und
vier Geschwistern gemeinsam die Besitzerin der Grube sei (40169, Nr. 305, Blatt 5f).
Frau Reppel muß zu diesem Zeitpunkt schon in hohem Alter gewesen
sein, denn die Registratur
unterschrieb sie, wie vermerkt ist, „mit geführter Hand.“
Jedenfalls gab sie weiter an, daß sie die Grube ‒ wie es an dieser Stelle
auch heißt: „nachdem die früheren Besitzer die Lehn aufgelassen haben“
‒ nun gegen einen jährlichen Zins in Höhe von 6 Thalern „ordiren“
(verpachten) wolle an:
Vermutlich wollte sie durch die bergbehördliche Registratur der Verpachtung in erster Linie sicherstellen, daß die Pacht nach ihrem Tode auf ihre Kinder übergehen werde. Für die noch unmündigen Kinder unterzeichnete als Vormund der Bergschmied Karl Heinrich Arnold die Registratur mit. Die Kinder und Geschwister sind an dieser Stelle alle namentlich aufgeführt und die schon verheirateten Frauen hießen inzwischen Weigel und Weißflog, geb. Reppel, man kannte sich also. Unter allen aufgeführten Namen war aber keine einzige Ullricke ‒ es bleibt also das Geheimnis der ersten Muter, warum sie die Grube ausgerechnet so benannt haben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Crucis 1840 bis Mitte Reminiscere
1841 vertrat Schichtmeister Friedrich Wilhelm Schubert aus
Raschau den Geschworenen Haupt. Bevor sich die Nichtbelegung
dreimal wiederholte und die Grube dadurch wohlmöglich ins Freie fiel,
hatte man im Oktober die Grube wieder belegt. Herr Schubert
berichtete in seinem Fahrbogen unter dem 22. Oktober 1841 (40014,
Nr. 300, Film 0121):
„Endlich habe ich die Grube Ullricke gev. Fdgr. bei Langenberg befahren, wobey zu bemerken war, daß der Tageschacht 8 Ltr. saiger tief ist, der Ausbau desselben nur wenig bedarf, die Fahrten sind zu nahe an das Liegende gezogen und dadurch kein gehöriger Eintritt vorhanden, daß wer nicht sorgfältig vorsichtig hineinfährt, leicht fahrlos werden kann, dieses abzuhelfen und in guten Stand zu setzen, habe ich den anwesenden Eigenlöhnern aufgegeben. Vom Tageschache 6½ Ltr. in Nordwest entfernt gehet gegen West 1 Ltr. lang ein Querschlag ab, von welchem dann 1 Ltr. in Nord 0,6 Ltr. unter der Streckensohle nieder ein Versuchsörtchen auf dem dort vorhandenen gegen 6 Zoll mächtigen in Nord fallenden Braunsteinlagertrum als Abbau gegenwärtig mit 3 Mann betrieben wird.“ Herr Schubert hielt aber unter dem 28. November 1840 dann schon wieder in seinem Fahrbogen fest: „Auf dem Rückwege habe ich bei Gelber Zweig gev. Fdgr., Friedrich gev. Fdgr., Gott segne beständig gev. Fdgr., Ullricke gev. Fdgr. und Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. niemand in Arbeit getroffen.“ (40014, Nr. 300, Film 0134f) Ohne die Ulricke Fdgr. explizit zu nennen, heißt es noch einmal unter dem 17. Dezember 1840, er habe „bei Riedels gev. Fdgr., Friedrich und den übrigen Eigenlöhnergruben bei Langenberg abermals niemand in Arbeit getroffen.“ (40014, Nr. 300, Film 0141) Im Januar 1841 fand Herr Schubert die Grube aber doch wieder belegt und notierte unter dem 14. Januar über seine Befahrung, „daß vor dem Abbau theils ganz schlechte, theils gar keine Zimmerung angebracht ist. Da die leichtsinnige Bebauung dieser Grube die größte Gefahr drohet, so habe ich die Eigenlöhner angewiesen, nicht nur den Abbau, sondern auch den Tageschacht nebst der Fahrung in Ordnung und regelmäßige Zimmerung zu setzen und außerdem alle anderen Arbeiten einzustellen und die Unterstützung baldigst zu bewerkstelligen.“ (40014, Nr. 300, Film 0144f) Ah ja, das mit der Fahrung im Schacht hatte er schon im November des Vorjahres bemängelt und war offenbar noch nicht abgestellt... Weiter heißt es über den Betrieb: „Der Abbau ist bereits 13 Lachter nordwestlich entfernt und sind die letzten 6,5 Ltr. nach dem Streichen und Fallen des Braunsteinlagers aufgefahren und müßen die Berge nebst den gewonnenen Braunsteine in Ermangelung geeigneter Förderung in Bergtrögen gegen 7 Ltr. lang gedrückt werden und ist hierzu nicht die erforderliche Weite vorhanden, dennoch ist der Betrieb dieses Abbaus in der größten Unordnung. Um dieses zu beseitigen, dürfte wohl ein neuer Tageschacht vorzuschlagen sein... was die Eigenlöhnerschaft bestens acceptire und die Erlaubnis eines neuen Tageschachtes gebührend nachsuchen wolle. Diese Grube ist mit 3 Mann belegt.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Frühjahr 1841 war Herr Theodor Haupt dann wieder im Dienst in Scheibenberg. Inzwischen ist wohl auch die Erlaubnis für das neue Schachtabteufen erteilt worden und von seiner nächsten Befahrung bei Ulricke gev. Fdgr. berichtete Herr Haupt daher am 10. Mai 1841 (40014, Nr. 300, Film 0172), man habe „kürzlich einen neuen Schacht niederzubringen angefangen, circa 10 Lachter westlich vom alten auf dem Haldensturz und diesen bislang 1 Lachter tief abgesenkt.“ Seine nächste Befahrung auf den Eigenlöhnergruben im Tännicht und bei Langenberg führte der Geschworene am 27. Juli durch und hatte über diese Grube zu referieren, daß wie bei Distlers Freundschaft es auch hier an Wettern fehle. Der neue Tageschacht war inzwischen 8½ Lachter tief und sollte nun mit dem alten Schacht durch eine 9 Lachter lange Strecke verbunden werden. Es fehlten aber noch 1½ Lachter bis zum Durchschlag (40014, Nr. 300, Film 0144f). Als Herr Haupt am 19. August im Revier unterwegs war, notierte er über die hiesigen Gruben (40014, Nr. 300, Film 0223f), an jenem Tage „habe ich die Eigenlöhnergruben im Tännicht und Langenberg befahren, von diesen sind aber Ullricke gev. Fdgr und Distlers Freundschaft wegen Wettermangel jetzt gar nicht und Gott segne beständig gev. Fdgr. nur selten zu befahren.“ Wie schon bekannt, wurde Herr Haupt danach erneut mit anderen Aufgaben betraut und diesmal vertrat ihn als Geschworener der Rezesschreiber Lippmann aus Annaberg (40014, Nr. 300, Film 0230). Dem erging es aber nicht anders. Auch er notierte in seinem Fahrbogen unter dem 15. September 1841 (40014, Nr. 300, Film 0242f), „Gott segne beständig, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. waren wegen Wettermangels nicht zu befahren:“ Eine Grubenbefahrung konnte Herr Lippmann dann am 19. Oktober 1841 durchführen, worüber in seinem Fahrbogen zu lesen steht (40014, Nr. 300, Film 0256), man trieb nun von Fundschacht aus in 4 Lachter Teufe ein Fallort hora 6,0 W. nach dem neuen Tageschacht, um mit demselben zur Erlangung besseren Wetterwechsels durchschlägig zu werden. Das Ort war aber immer noch (wie am 7. Juli schon) 7½ Lachter lang und es fehlen noch 1½ bis zum Durchschlag. Der Vortrieb werde auch noch eine geraume Zeit dauern, weil die Wetter so schwach sind, daß nur selten und dann auch nur kurze Zeit von den Eigenlöhnern dort gearbeitet werden kann. Außerdem hatte man bei 1½ Lachter vom Fundschacht aus ortweise hora 12,0 N. ausgelängt, wo man hübschen Braunstein gewinnt, „welcher in ziemlicher Frequenz im Mulm nierenweis vorkommt.“ Zu bemängeln fand Herr Lippmann aber: „Da der in Mulm abgesunkene Fundschacht theilweise gar nicht, theilweise aber in so schlechter und verfaulter Zimmerung steht, daß ein Zusammengehen desselben stets zu erwarten ist, so mußte ich den von der Gesellenschaft anwesenden Eigenlöhnern darüber zur Rede stellen, ihn auf die Gefahr aufmerksam machen und denselben die baldigste Sicherstellung des Schachtes durch Einbau neuer Zimmerung anbefehlen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang des folgenden Jahres 1842
berichtete Herr Lippmann an das Bergamt
(40014, Nr. 321, Film 0002):
„Bei Ullricke gev. Fdgr. ist der sehr wünschenswerte Durchschlag des in
4 Lachter Teufe vom Fundschacht aus nach dem 8½ Lachter tiefen neuen
Tageschacht in der Richtung hora 6 W. betriebenen und bis jetzt 8 Lachter
weit erlängten Fallortes noch nicht erfolgt. Der Braunsteinbau der
Eigenlöhner befindet sich bei 4 Lachter Teufe in circa 8 Lachter
mitternächtlicher Entfernung vom Fundschacht. Es liegt der Braunstein hier
nieren- und schmitzenweise in schwarzem Mulm… und ist manchmal bis zu 15
Zoll mächtig.
Der Fundschacht ist hinsichtlich seines Ausbaus in etwas haltbareren Zustand gebracht worden, als er sich bei meiner letzten Befahrung befand.“ Weitere Befahrungen dieser Grube durch den Vertreter des Geschworenen fanden am 17. Februar und am 27. April 1842 statt (40014, Nr. 321, Film 0014 und 0033). Zum zweiten Termin konnte er festhalten, daß der Durchschlag des Fallortes endlich erfolgt sei und dadurch „ein recht frischer Wetterzug erzielt worden.“ Wetterschacht und Strecke müssen noch ausgezimmert werden. Außerdem war er am 11. März und am 27. April 1842 (40014, Nr. 321, Film 0021 und 0033) zugegen, um den ausgebrachten Braunstein zu verwiegen. Obwohl doch eigentlich der Wetterquerschlag vollbracht war, fand Herr Lippmann im Juni 1842 die Grube wieder einmal unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0048). Weitere Befahrungen fanden in diesem Jahr nicht mehr statt, denn am 20. August 1842 wurde im Bergamt zu Protokoll genommen, daß der Lehnträger die Fristsetzung der Grube beantragt habe (40169, Nr. 305, Blatt 7). Am 24. Mai des Folgejahres 1843 hielt man dann im Bergamt fest, daß die Grube ab Trinitatis dieses Jahres wieder gangbar sei (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 7).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits am 28. März 1843
gab es deshalb wieder eine Befahrung von Ulricke Fdgr. und diesmal wieder
durch den Geschworenen Theodor Haupt
(40014, Nr. 321, Film 0159).
Wahrscheinlich hatten die Anbrüche nachgelassen, denn dieser notierte in
seinem Fahrbogen, man habe inzwischen in 6 Lachtern Teufe eine Strecke 4
Lachter in NO, dann 7 Lachter in NW getrieben und abei auf den letzten 3
Lachtern „etwas Braunstein angefahren.“ Außerdem schrieb er: „Übrigens
ist ziemlich viel Unordnung auf dieser Grube, die der Lehnträger mit
seiner hilfsbedürftigen Lage entschuldigt.“
Was auch immer den Lehnträger in eine hilfsbedürftige Lage gebracht hat, erfahren wir hier nicht. Herr Haupt wurde im Frühjahr 1843 erneut abgeordnet und so vertrat in anschließend wieder Herr Lippmann. Derselbe hat am 3. Mai des Jahres hier den ausgebrachten Braunstein verwogen ‒ der abnehmenden Anbrüche ungeachtet, muß also etwas gefördert worden sein ‒ und hernach die Grube befahren. Dabei beklagte er erneut die Zustände auf dieser Grube (40014, Nr. 321, Film 0174f): „Bei Ullricke gev. Fdgr. ist es niemand zuzumuten, die etwaigen Baue durch den einzigen vorhandenen Tageschacht, der in Folge des von dem hinlänglich bekannten Lehnträger vernachlässigten Auswechslung aus der ursprünglichen (?) Form sich in eine (trapezförmige?) verschoben hat, zu befahren und kann ich daher auch über den dasigen Betrieb nichts vermelden.“ Jedenfalls scheint auch der Lehnträger die Gefahr erkannt zu haben und plante ‒ anstatt den alten Schacht aufwendig wieder herzurichten ‒ gleich einen neuen abzusinken, wie folgender Notiz zu entnehmen ist: „Daß der Lehnträger auf dem Felde des in Schwarzbach ansässigen Erdmann Friedrich Großer in nördlicher Entfernung vom alten Fundschacht einen neuen Hilfsschacht absinken will, wozu deshalb incl. des benöthigten Haldensturzes circa 4 Quadratlachter begehrt, ist dem Bergamt aus mündlicher Relation wissend und werde ich der gegebenen Resolution gemäß dem Eigenlöhner bescheiden.“ Offenbar hat auch das Bergamt dazu die Genehmigung erteilt und am 13. Juni 1843 hat Herr Lippmann dann dem Lehnträger „wegen des benöthigten neuen Schachtes die nothwendigen Angaben gemacht.“ (40014, Nr. 321, Film 0181) Die Sache ging der Betreiber auch zügig an und so fand Herr Lippmann bei seiner nächsten Befahrung am 18. Juli (40014, Nr. 321, Film 0192) den Schacht bereits 4 Lachter abgesenkt. Man verfolgte in dieser Teufe bereits wieder ein 3 – 6 Zoll mächtiges und nach Norden einfallendes Trum von sehr unreinem Braunstein mit einem Feldort. Davon war bereits am 20. Juli wieder ein Quantum zu verwiegen (40014, Nr. 321, Film 0193). Offenbar hatten sich also auch die Anbrüche am neuen Ansatzpunkt wieder gebessert. Unter dem 20. September 1843 heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 321, Film 0207), an jenem Tage „vermaß ich auf Ansuchen des Eigenlöhners... die verschiedenen Punkte (?) des zu dieser Zeche gehörigen Grubenfeldes und hatte hernach derselbe über die Lage und über die Grenzen respective Markscheiden (mit Hausteins Hoffnung und Gott segne beständig gev. Fdgr.) seines Grubenfeldes genaue Kenntniß.“ Möglicherweise lag der neue, glückliche Fundpunkt also nahe an den Grubenfeldgrenzen. Nachdem Herr Lippmann die Grube am 15. November unbelegt gefunden hatte, schaute er am 22. November 1843 erneut vorbei und berichtete diesmal (40014, Nr. 321, Film 0219 und 0224f), daß der Eigenlöhner bei 4 Lachter Teufe ein Feldort hora 11 N. betrieb, welches bereits 3,5 Lachter erlängt war. Hier kam der Braunstein knollenförmig im Mulm „in nicht unbedeutender Quantität“ vor. Die Überschar sagte Lehnträger Weißflog am 4. Januar 1844 aus dem Grubenfeld los (40169, Nr. 305, Blatt 8).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr Haupt kehrte zwar im
Dezember 1843 wieder in sein eigentliches Amt nach Scheibenberg zurück,
wurde aber schon im April des nächsten Jahres gleich wieder für andere
Aufgaben abgezogen. In der Zwischenzeit sind durch ihn keine Befahrungen
auf dieser Grube erfolgt. Ab Mai
1844 vertrat ihn dann diesmal der Markscheider Friedrich Eduard Neubert.
Derselbe hat diese Grube erstmals am 7. Mai 1844 befahren, worüber man
seinem Fahrbogen entnehmen kann
(40014, Nr. 322, Film 0037),
daß hier nur „unregelmäßig 2
Mann anfahren, welche ein in 4,9 Lachter Teufe des Tageschachtes
angesetztes Ort hora 11,3 Süd in Mulm mit kleinen Nestern von Braunstein
fortbringen und bereits 4,9 Lachter erlängt haben.“
Nach seiner nächsten Befahrung am 12. Juni 1844 notierte er (40014, Nr. 322, Film 0047f), an diesem Tage „beabsichtigte ich, die übrigen im Tännicht und bei Langenberg liegenden Gruben, als Riedels, Reppels, Köhlers, Gelber Zweig, Friedrich, Gott segne beständig, Hausteins, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. zu befahren, sie waren jedoch sämmtlich außer Belegung, wovon bei den meisten die Unmöglichkeit, die Producte zu verwerthen, die Ursache sein mag.“ Mit nur bescheidener Belegung schritt man hier jedoch trotzdem weiter voran. Seine nächste Befahrung führte Herr Neubert am 2. August 1844 durch und im Gegensatz zu vielen anderen Gruben des Reviers fand er auf Ullricke Fdgr. „einen Arbeiter vor, der mit Erlängung eines in 3 Ltr. Teufe aus dem Tageschacht 2 Ltr. hora 10,4 in SW. fortgebrachten Ortes beschäftigt war. Wegen Wettermangels kann daselbst vor der Hand in größerer Teufe nicht gearbeitet werden.“ (40014, Nr. 322, Film 0057) Auch bei seiner Befahrung am 6. September 1844 war die Grube (freilich nur) mit dem Lehnträger belegt, „der vor einem in 3 Ltr. Teufe aus dem Neuschacht in NW. mit circa 12 bis 16° Fallen fortgebrachten, 0,75 Ltr. hohen Orte arbeitete, das 4 Ltr. in Mulm erlängt war. Der Mulm enthielt sehr viel Braunsteinknollen und tritt hier als förmliches Lager auf... Den Wettermangel, der sehr fühlbar geworden war, hat man durch Einbau von Wetterlutten zum Theil beseitigt.“ (40014, Nr. 322, Film 0063f) So kam auch ein Ausbringen zustande und am 21. Oktober 1844 hatte Herr Neubert hier immerhin 7 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 322, Film 0071). Nachdem er am 15. November die Grube einmal unbelegt gefunden hatte, konnte Herr Neubert am 6. Dezember 1844 wieder anfahren und berichtete darüber (40014, Nr. 322, Film 0083): „Auf Ullricke gev Fdgr., (...) fand ich ein Ort in Betrieb, welches 0,9 Ltr. unter der Sohle der in 4,8 Ltr. Teufe aus dem Neuschachte erst in SO., dann in West getriebenen Strecke angesetzt ist, 0,5 Ltr. in Nord erlängt war und bis an den besagten Schacht zur Erreichung eines besseren Wetterwechsels und einer leichteren Förderung fortgebracht werden soll. Der Mulm vor dem Ort führt Nester von Braunstein.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung durch Herrn
Neubert erfolgte am 14. Januar 1845
(40014, Nr. 322, Film 0089),
wobei er aber „etwas
Abweichendes gegenüber voriger Relation nicht zu bemerken (hatte),
nur daß der Durchschlag der Strecke bis an den Schacht bewirkt worden ist“
und „Über den Flächeninhalt
der Halde, dessen Bestimmung ich zu Folge bergamtlicher Anweisung noch
vornehme, wird besondere Anzeige erstattet.“
Diese Anzeige findet man in der Grubenakte. Offenbar hatte der Besitzer des Rittergutes Förstel, auf dessen Grund die Grube lag, einige Flächen aus seinem Besitz abgetrennt und verkauft. Die neuen Besitzer der hier betroffenen Flächen waren die Herren Ficker aus Raschau und Groß aus Schwarzbach und diese wollten nun den ihnen für die Flächeninanspruchnahme durch den Bergbau zustehenden Zinsen wissen. Dazu hatte Markscheider Neubert nun am 25. Januar 1845 die Größe der Haldenfläche und deren Anteile auf beiden Grundstücken ermittelt (40169, Nr. 305, Blatt 9). In den Akten des Bergamtes Scheibenberg liest man unter dem 14. März dann, Herr Neubert habe „auf Ullricke gev. Fdgr. zwischen den Besitzern der beiden Grundstücke, auf welchen diese Grube liegt, und dem Lehnträger derselben wegen des Grundzinses eine Vereinigung, über die bereits Anzeige an das Königl. Bergamt erstattet worden, zu Stande gebracht.“ (40014, Nr. 322, Film 0100) Aus einem Fahrbogenvortrag in Annaberg am 22. März 1845 erfährt man auch, daß Herr Neubert einen Grundzins in Höhe von 1 Thaler pro Jahr bestimmt hatte, der an beide Eigentümer zur Hälfte gezahlt werden solle. Das Bergamt genehmigte diesen Vertrag (40169, Nr. 305, Blatt 10). Am 11. April 1845 fand wieder eine Befahrung statt. Im Fahrbogen steht darüber, daß hier 2 Mann anfahren und vor einem Orte arbeiten, das in 3 Ltr. Teufe von dem Schacht aus 6,5 Ltr. in SW. und Nord und mal söhlig, mal fallend getrieben war. Der Braunstein kam hier „als Knollen in sehr aufgelöstem Gestein“ vor. Von diesem waren auch noch 11 Zentner zu verwiegen (40014, Nr. 322, Film 0105f). Das Ausbringen war zwar nicht groß, doch relativ stetig, denn Herr Neubert war allein bis August 1845 noch viermal zugegen, um das Verwiegen von weiteren, insgesamt 38 Zentnern Braunstein für den Verkauf beizuwohnen (40014, Nr. 322, Film 0115, 0119f, 0127 und 0133). Am 6. Juni 1845 hielt er in seinem Fahrbogen noch fest, daß die Grube bereits wieder wegen Wettermangels nicht fahrbar sei und der Eigenlöhner daher beabsichtige, einen neuen Wetterschacht abzuteufen. Diesen Plan hat derselbe auch in Angriff genommen und bei seiner Befahrung am 5. September 1845 fand Herr Neubert den neuen Schacht 5,2 Lachter südöstlich vom unteren, zeitherigen Schacht angesetzt, bereits 5 Lachter niedergebracht und dort mit den vom vorherigen Schacht aus getriebenen Bauen durchschlägig gemacht (40014, Nr. 322, Film 0137f). Außerdem war ein Ort in 2,1 Ltr. Teufe aus dem neuen Schacht nach SW. und Süd bereits 5,4 Ltr. ausgelängt, wo man auf „schöne Braunsteinanbrüche“ gekommen sei. Ferner war ein zweites Ort aus dem älteren, unteren Schachte in 3 Ltr. Teufe nach NW. und SW. 4,2 Ltr. erlängt, wo bis 3 Zoll „große Braunsteinknollen in einer weißlich grauen und braunen, lettigen Masse ziemlich häufig“ einbrachen. Und davon waren auch wieder 12 Zentner ausgebracht und zum Verwiegen bereit. Auch am 14. Oktober und am 24. November hat Herr Neubert insgesamt noch einmal 30 Zentner Braunstein verwogen (40014, Nr. 322, Film 0146 und 0157). Die Gesamtförderung in diesem Jahr summierte sich demnach auf 91 Zentner. Über die Befahrung berichtete Herr Neubert am 21. September 1845 auch im Bergamt Annaberg (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 10). Allerdings hielt das Glück nicht an und am 12. November 1845 hielt Herr Neubert in seinem Fahrbogen fest, daß außer dem Eigenlöhner selbst „nur dann und wann ein weiterer Arbeiter“ anfährt. Das Ort in 2,1 Ltr. Teufe SW. war eingestellt, ebenso das Ort in 3 Ltr. Teufe des anderen Schachtes, weil vor beiden die Anbrüche ausgesetzt hatten. Dafür war ein neues Ort vom unteren Schacht aus in 3,5 Ltr. Teufe hora 12,4 Süd 3,2 Ltr. fortgebracht, vor dem man jedoch bislang nur Spuren von Braunstein gefunden hatte (40014, Nr. 322, Film 0151f). Von seiner Befahrung am 18. Dezember 1845 berichtete Herr Neubert, daß nun ein Ort in 2,1 Ltr. Teufe mit 1 Mann belegt, 5 Ltr. südwestlich vom obern Schacht angesetzt und 1,3 Ltr. in NW. fallend getrieben sei, aber auch hier nur spärliche Braunsteinanbrüche gefunden wurden (40014, Nr. 322, Film 0160f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ähnlich verlief auch das nächste Jahr.
Herr Neubert war viermal zugegen, um jeweils zwischen 6 Zentnern
und 18 Zentnern Braunstein zu verwiegen, insgesamt in diesem Jahr 51
Zentner (40014, Nr. 322, Film 0176,
0190, 0198 und 0216). Beide hier
errechneten Fördermengen liegen aber deutlich unter den Angaben in den
Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 26) von
151 Zentnern im Jahr 1845 und 131 Zentnern im Jahr 1846, weshalb wohl
nicht alle Verwiegetage auch in den Fahrbögen enthalten sind.
Zum Grubenbetrieb war im März 1846 zu erwähnen, daß das Ort in 2,1 Ltr. Teufe nach NW. nun 5 Ltr. erlängt war und damit „nicht sehr frequent einbrechende Braunsteinnester“ verfolgt wurden (40014, Nr. 322, Film 0179f). Auch im Mai baute man auf diesem Ort und 3 Lachter westlich vom Tageschacht Braunstein ab (40014, Nr. 322, Film 0194f). Seltsamerweise scheint man hier in diesem Sommer keine Wetterprobleme gehabt zu haben, obwohl auch diese beiden Schächte kaum 11 m auseinander lagen. Im Gegenteil verlegte man sich im Juni auf eine tiefere Sohle und baute nun in 3,5 Ltr. Teufe und 4,5 Ltr. nordwestlich vom oberen Tageschacht Braunstein ab, der hier in kleinen Knollen im Mulm vorkam (40014, Nr. 322, Film 0194f). Am 22. August 1846 war man noch eine Sohle tiefer und baute in 6 Ltr. Teufe und 1,5 Ltr. nördlich vom obern Tageschacht zwischen Mulm und Hornstein einbrechenden Braunstein ab (40014, Nr. 322, Film 0216). Schließlich hatten aber bei der Befahrung am 8. September 1845 die Braunsteinanbrüche überall ausgesetzt und nun begann man, den oberen Tageschacht weiter abzusinken, welcher inzwischen 7 Ltr. Teufe erreicht hatte (40014, Nr. 322, Film 0218). Eine letzte Befahrung durch Herrn Neubert, bei der er diese Grube allerdings unbelegt fand, ist vom 21. Januar 1847 dokumentiert (40014, Nr. 322, Film 0237). Wie schon mehrfach zu lesen war, setzt die Überlieferung der Fahrbögen der Berggeschworenen mit Reminiscere 1847 aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Fortsetzung der Geschichte ‒ wenn auch wieder einmal mit einer ziemlich großen zeitlichen Lücke ‒ findet man dann in den Grubenakten, welche später im Bergamt Schwarzenberg fortgeführt worden sind. Am 19. Juli 1855 nämlich erst nahm man im Bergamt zu Protokoll, daß der Eigentümer, nun aber ein Friedrich Wilhelm Neubert aus Raschau, die Grube für 200 Thaler an den Steiger Friedrich Fürchtegott Wendler aus Schwarzbach verkauft habe (40169, Nr. 305, Blatt 12). Der behielt sie aber nicht
lange, denn schon am 25. August 1855 wurde protokolliert, daß Christian
Friedrich Fikentscher aus Zwickau die Grube erkauft und mit seiner
kurz zuvor verliehenen Antonius Fundgrube und Maßen konsolidiert
habe (40169, Nr. 305, Blatt 13).
Damit begann auch bei diesem Grubenfeld ein neues Kapitel, auf das wir
weiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Großzeche
Fundgrube zwischen Langenberg und Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26)
wird diese Grube von 1804 bis 1836, allerdings mit langen Unterbrechungen,
aufgeführt. Sie hat fast ausschließlich Eisenstein ausgebracht, wobei sich
die Eisenerzförderung insgesamt auf rund 317,5 Fuder belief. Daneben ist
im Jahr 1825 einmalig ein Ausbringen von 3 Fudern Flößen ausgewiesen. Vielleicht
gab es ja in der Nähe zu den Kalksteinbrüchen im Tännigwald weitere kleine
Einlagerungen von Kalkstein im Schiefer.
Bei diesem Grubennamen könnte man nun vielleicht auf eine besonders große Zeche schließen, aber der Name geht vermutlich einfach auf die Familie Groß zurück. Eine Eintragung in der Liste alter Verleihungen des Bergamts Scheibenberg verweist darauf, daß diese Familie schon lange hier ansässig ist und auch schon früh im Bergbau engagiert war. Sie lautet: „Christoff Groß verliehen den 20 febr. 3 lehn in förstel auf Christian Heinrichs und (?) Erbgütern alß 2 lehn auf 2 posten und das dritte lehn auf 1 post, wo frey felt ist, in altem und ganzem felt, best. den 6. Marty“ und stammt aus dem Jahr 1667 (40014, Nr. 15, Film 0024, 1. Eintragung rechte Seite)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine weitere Eintragung in den Protokollen des Bergamts Scheibenberg besagt dann, daß die Herren Johann Gottlob Groß, Carl Lebegott Hahn, Christian Gottlob Groß und Christian August Groß aus Waschleithe am 19. Mai 1804 Mutung auf eine gevierte Fundgrube „auf Herrn Hennig Meyer sein Grund und Boden“ (also beim Tännighammer) eingelegt haben (40014, Nr. 211, Film 0011f). Diese wurde auch vom Bergamt am 4. Juli 1804 bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 233f). Zu den Besitzern des Tännichtgutes hatten wir bereits in unserer Einleitung die uns bekannt gewordenen Fakten zusammengestellt. Einen Hennig Meyer haben wir dabei nicht gefunden, vielmehr müßte sich das Tännichtgut zu eben dieser Zeit noch im Besitz von Carl Gottlob Meyer befunden haben. Nach dessen Tod im Jahr 1806 fiel es dann an seinen Sohn Erdmann Friedrich Meyer. Von seiner ersten amtlichen Befahrung der Grube im Quartal Crucis 1804 berichtete der damals amtierende Berggeschworene im Scheibenberg'er Bergamt, Johann Samuel Körbach, nur knapp, es werde „von den Eigenlöhnern der Fundschacht abgesunken, um das Lager auszurichten, bricht in solchem Hornstein und grauer Eisenstein mit ein, war gegen 5 Lachter tief.“ (40014, Nr. 213, Film 0031f) Im Quartal Luciae 1804 heißt es im Fahrbogen, der Versuchsortbetrieb in 5 Lachtern Teufe werde fortgestellt (40014, Nr. 213, Film 0052). Praktisch gleichlautend ist der Fahrbogen aus dem Quartal Reminiscere 1805 (40014, Nr. 232, Film 0008). Crucis 1805 heißt es dann schon kurz und knapp im Fahrbogen, daß die Groß gevierte Fundgrube „von den Eigenlöhnern nicht betrieben“ wurde (40014, Nr. 232, Film 0023) und auch Luciae 1805 fand der Geschworene Körbach die Grube unbelegt vor (40014, Nr. 232, Film 0039).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viel scheinen diese ersten Aufnehmer also nicht bewerkstelligt zu haben, denn die Grube fiel daraufhin natürlich wieder ins Freie zurück. In der nächsten Mutung dieses Feldes durch Christian Gottfried Hammerschmidt aus Raschau vom 1. Februar 1808 (40014, Nr. 211, Film 0041) heißt es daher auch: „auf die seit einigen Jahren im Freyen liegende im Tännigwalde bey Schwarzbach sich befindende Eisensteinzeche Groß gevierte Fundgrube.“ Herr Hammerschmidt erhielt am 7. April 1808 die beantragte Fundgrube unter dem Namen Groß gevierte Fundgrube bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 245). Von Interesse ist dabei außerdem, daß der Name Hammerschmidt u. a. im Grubenaufstand zur Generalbefahrung von 1807 auch als einer der Eigenlehner von Kästners Fundgrube genannt wird. Nach der Neuverleihung hatte natürlich auch der Berggeschworene, inzwischen der Herr Christian Friedrich Schmiedel, die Grube wieder regelmäßig zu begutachten. Dies erfolgte durch ihn erstmals im April 1808 und darüber hielt er in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 236, Blatt 33):Gros gevierte Fundgrube daselbst betr. „Es ist diese ebenfalls eigenlehnerweise betrieben werdende Grube mit 3 Mann, als 1 Doppelhäuer, 1 Knecht und 1 Jungen belegt. Bei 4 Lachter Teufe des Fundschachtes wird ein Ort auf einem Eisensteinlager Stunde 7,1 gegen Abend fortgebracht und hat auch bereits eine Länge von 2¾ Lachter erreicht. Allhier ist besagtes Lager ½ bis ¾ Lachter mächtig, und besteht aus mildem Gneis, Quarz, Hornstein, ockerigen gelben und braunen Eisenstein.“ „Nach beendigter Befahrung wurde auf diesen nur beschriebenen 3 Gruben der vorräthige Eisenstein besichtiget, dabei aber jedoch nichts zu erinnern befunden.“ Von seiner nächsten Befahrung am 20. Juni 1808 berichtete der Geschworene (40014, Nr. 236, Blatt 51): „Endlich wird bei Gros gev. Fdgr. im Tännigwalde ein neuer Tageschacht, theils zur Erlangung beßrer Wetter, theils auch, um das allhier aufsetzende Eisensteinlager zu untersuchen, (geteuft), war aber erst ½ Lachter tief. Belegt mit 3 Mann.“ Von der Befahrung im Quartal Luciae 1808 (am 17. November) heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 236, Blatt 93), der neue Tageschacht sei nun 2¾ Lachter niedergebracht, „um das Lager zu untersuchen und abzubauen.“ Man war also noch immer nicht wieder dran. Bei der ganzen Aufschließung sind aber dennoch 24 Fuder Eisenstein angefallen und am 13. Dezember 1808 vermessen worden (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 97). Reminiscere 1809 berichtet Herr Schmiedel in seinem Fahrbericht (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 103), die Grube sei mit 4 Mann belegt und durch diese „wird das mit dem 3¼ Lachter tiefen Tageschachte ersunkene Eisensteinlager durch fernerweites Abteufen abgebaut.“ Das Lager sei aber noch nicht ganz durchsunken und bestehe aus Gneis, roten Letten, Quarz, Hornstein sowie gelben und braunen Eisenstein. Im Februar 1809 notierte der Geschworene, man habe nun bei 3¾ Lachter Teufe ein Ort Stunde 11,3 gegen Süd und ein zweites Stunde 5,3 gegen Nordost angesetzt und 3¼ Lachter fortgebracht (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 118). Danach wird die Grube wieder eine Zeitlang in den Fahrbögen nicht mehr erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst sein Nachfolger im Amt des
Berggeschworenen in Scheibenberg, Herr Johann August Karl Gebler,
hielt in seinem Fahrbogen vom Quartal Reminiscere 1824 dann wieder zu
dieser Grube fest (40014,
Nr. 271, Film 0009):
„Montags, den 16ten Febr. die sogenannte Großzeche im Tännicht bey Schwarzbach freygefahren, die Lage der von den Muthern verlangten Feldes an 1 gev. Fdgr. und 1 gev. oberen Maaße untersucht und (...?) vermessen, zu genauer Bestimmung der Sache aber das Feld von Kästners Hoffnung gleichfalls ausgemessen und die Markscheide zwischen beyden nach Konspekt und Kette über Tage angebracht.“ Über seine Befahrung berichtete er am 28. Februar 1824 an das Bergamt. Die Mutung hatten Christian Heinrich Viehweg und Carl Lobegott Tröger am 23. November 1823 eingelegt und nun erhielten sie die Fundgrube unter dem früheren Namen am 7. April 1824 auch bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 7ff sowie 40014, Nr. 43, Blatt 298).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Sache ließ sich für die neuen Muter offenbar ganz gut an, denn schon am 27. April 1824 war hier ein ‒ in Anbetracht der kurzen Zeit sehr beachtliches ‒ Ausbringen von 74 Fudern Eisenstein zu verzeichnen (40014, Nr. 271, Film 0026). Allerdings taucht die Grube ‒ vielleicht der gleich noch beschriebenen Ausrichtungsarbeiten halber ‒ in diesem Jahr nicht noch einmal mit Ausbringen an den Verwiegetagen auf. Von seiner ersten, gewissermaßen regulären Grubenbefahrung am 19. Mai 1824 berichtete Herr Gebler, die Grube sei belegt mit
Aus dem in zwischen 6 Lachter tiefen Schacht werden bei 5 und 6 Lachter Teufe nach Osten und Westen und in verschiedene Richtungen Örter betrieben und der angefahrene Eisenstein abgebaut, der besonders in 6 Ltr. Teufe nach Westen „vorzüglich“ sei. Außerdem wurde bereits ein zweiter Schacht geteuft, der aber erst 3 Ltr. tief war, und der mit dem Ort in 6 Ltr. Teufe zum Durchschlag gebracht werden solle, um den Wetterwechsel zu verbessern (40014, Nr. 271, Film 0032).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 14. Januar des nächsten Jahres war
Herr Gebler wieder vor Ort und berichtete in seinem Fahrbogen (40014,
Nr. 273, Film 0006), daß hier drei Häuer
als Eigenlöhner tätig
und damit „beschäftigt (...), den zeitherigen Tageschacht, so
bey der großen Nässe des vorigen Sommers und Herbstes sehr beschädigt
worden, wiederum mittelst Zimmerung herzustellen, um zu dem vorhandenen
Eisensteinbauen zu gelangen. Der zunächst diesem abgesunken gewesenen,
aber durch Nässe ganz wieder zusammmengegangenen, zweyten Tageschacht ist
man ganz auszustürzen des Vorhabens.“ Der erforderlichen Gewältigung und Neuausrichtung halber hielt sich wohl auch die Förderung in Grenzen; immerhin aber gab es ein Ausbringen: Der Geschworene hatte am 11. April 1825 hier 10 Fuder und am 21. Juni noch einmal 7 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 273, Film 0023 und 0041). Dann schlugen aber wieder die Wetter um und nach seiner Befahrung am 15. Juli 1825 notierte Herr Gebler (40014, Nr. 273, Film 0048), er habe sich an diesem Tage „auf einige der übrigen Eisensteinzechen daselbst und in Langenberg begeben und gefunden, dass man auf der Großzeche Fdgr., ingleichen auf der Gesegneten Anweisung Fdgr. wegen ermangelnder Wetter, und auf Osterfreude wegen ermangelnden Grubenholzes die Arbeiten (?) einstellen mußte.“ Danach wird die Großzeche im Jahr 1825 nicht noch einmal in den Fahrbögen genannt. Auch im folgenden Jahr 1826 fand keine Grubenbefahrung durch den Geschworenen statt. Die Großzeche wird nur am 24. Mai (40014, Nr. 275, Film 0043), als Herr Gebler hier 11 Fuder Eisenstein zu vermessen hatte, und noch einmal am 5. Juni 1826 (40014, Nr. 275, Film 0045) genannt, als hier 15 Fuder zu vermessen waren. Danach scheint die Grube liegengeblieben zu sein, denn weitere Nennungen in den Fahrbögen gibt es über mehrere Jahre nicht. Fast zehn Jahre später erst wird sie wieder aufgenommen. Auf eine Mutung vom 4. Januar 1833 hin besichtigte Geschworener Gebler am 2. Dezember 1834 wieder die Örtlichkeiten. Am 8. Januar 1835 erhielt „die früher bebaut gewesene Großzeche“ diesmal der Herr Christian Gottlob Richter und Konsorten zu Raschau die Fundgrube auf Eisenstein und Braunstein bestätigt (40169, Nr. 100, Blatt 1, 40014, Nr. 270, Film 0131ff und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 321).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 16. Februar des Jahres 1835 wird sie erstmals nach dieser Pause auch wieder vom Berggeschworenen Gebler in seinen Fahrbögen genannt, als er bei Großzeche gevierte Fundgrube 49 Fuder Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 289, Film 0075). Am 28. Juli 1835 notierte er, daß er an diesem Tage „für das Grubengebäude Großzeche im Tännicht bey Schwarzbach 55 Fuder an dem zu dem Hammerwerk Großpöhla gehörigen Sturzplatz angefahrenen Eisenstein vermessen“ habe (40014, Nr. 289, Film 0107), weswegen wir vermuten dürfen, daß hinter der Wiederaufnahme nun die von Elterlein als Abnehmer des Erzes gestanden haben. Auf der Fundgrube war Herr Gebler noch einmal am 7. Dezember 1835, um weitere 15 Fuder zu vermessen (40014, Nr. 289, Film 0134). Der Betrieb währte vermutlich nur in geringem Umfange noch weiter bis 1838. Dann stellten die Eigenlöhner am 4. Januar 1839 einen Fristhaltungsantrag (40169, Nr. 100, Blatt 2). Weitere Angaben enthält die Grubenakte nicht; wir wissen aber, daß die Großzeche kurze Zeit darauf durch die Sächsische Eisencompagnie erworben wurde und zusammen mit Kästners Hoffnung zum Ausgangspunkt des Grubenfelderwerbs durch Wilkauer vereinigt Feld geworden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nur kurze Zeit nach Richter und
Konsortschaft muteten am 13. April 1835 außerdem August Friedrich Jahn
und seine (hier namentlich benannte) Konsortschaft, Carl Heinrich Krauß
und Christian Heinrich Viehweg, zwei gevierte untere Maßen und
erhielten sie am 2. September 1835 auch bestätigt (40169,
Nr. 101, Blatt 1, 40014, Nr. 270, Film 0151ff sowie 40014, Nr. 43,
Rückseite Blatt 324).
Einer Eintragung in seinen Fahrbögen von 1835 zufolge, hatte Herr Gebler am 3. September auf Großzeche 1te und 2te untere abendliche Maaß 17 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 289, Film 0116). Weitere Befahrungsberichte der Berggeschworenen gibt es aus dieser ganzen neuen Betriebsphase zu den beiden Gruben nicht. Wir wissen daher auch nichts darüber, was in dieser Zeit hier geschehen ist. Herr Jahn sagte die beiden Maße jedenfalls am 22. Juli 1837 schon wieder los (40169, Nr. 101, Blatt 2 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 324). Ein reichliches Jahr später, am 26. September 1838, wurde dann auf dessen Mutung hin dem Bergarbeiter Christian Heinrich Enderlein aus Raschau erneut eine untere gevierte Maß nach Großzeche bestätigt (40169, Nr. 101, Rückseite Blatt 2, 40014, Nr. 298, Blatt 2 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 335). Auch der hat sie aber nicht lange betrieben, denn am 7. Dezember 1839
wurde die Grube durch den Berggeschworenen Haupt wieder
freigefahren (40169, Nr. 101, Blatt 3).
Danach ging sie zusammen mit der Fundgrube im gemeinschaftlichen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der folgende, im Jahr 1875 von dem Markscheider H. M. Reichelt gefertigte, vom Markscheider-Assistent C. W. Weinhold für die bergamtliche Rissammlung kopierte und vom Rissarchivar beim Oberbergamt in Freiberg, F. K. Gretschel, bis 1893 vervollständigte Übersichtsriß (40040, L8310) zeigt uns die Lage der Grube in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bescheert Glück Fundgrube und die zu dieser Zeit noch gangbaren Baue. Nördlich unterhalb an der Straße von Langenberg nach Schwarzbach ist darauf auch schon das Huthaus von Wilkauer vereinigt Feld zu sehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Krauß
Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Familienname ist uns auch schon
an anderer Stelle in der Region begegnet. So kam es im Juni 1845 auf der
In den schon mehrfach genannten Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) ist eine Grube dieses Namens nur von 1804 bis 1808 aufgeführt. Die Grube hat nur Eisenstein (über den genannten Zeitraum insgesamt 204 Fuder), und nie Braunstein ausgebracht. Etwa auf dieselbe Zahl kommen wir auch anhand der Zehntenverzeichnisse der Hammerwerksinspektion (40022, Nr. 459).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
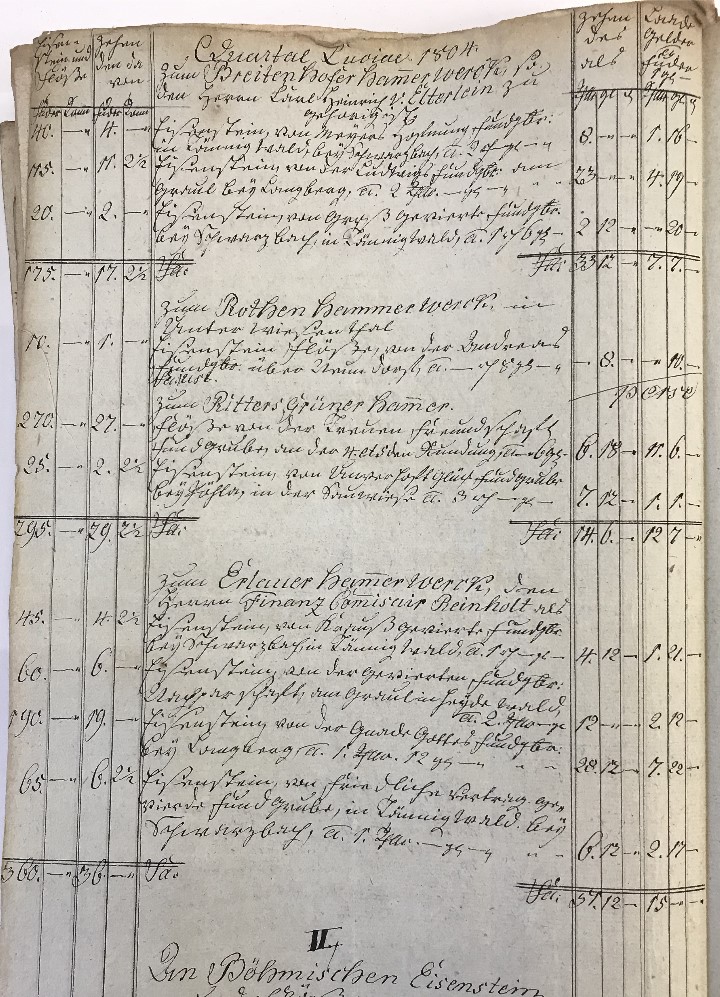 Zehntenverzeichnis des Bergamtes Scheibenberg für die Hammerwerksinspektion aus dem Quartal Luciae 1804: Als vierte Eintragung von unten ist hier erstmals die ,Krauß gevierte Fdgr. bey Schwarzbach im Tännigwald' vermerkt, von der in diesem Quartal 45 Fuder Eisenstein ausgebracht und an Hrn. Reiboldt auf dem Erla'er Hammer geliefert worden sind. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40022 (Hammerwerksinspektion Schneeberg), Nr. 459, Register Nummer 72.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits am 8. November 1793 hatte ein Herr Christian Friedrich Krauß eine Fundgrube nebst dem 1. und 2. unteren Maß auf einem flach streichenden Eisensteingang, „welcher im sogenannten Elterleiner Kirchenwald von dem alten Weg, so von der Hauptstraße von Scheibenberg nach Elterlein abgehet und nach Schwarzbach zugehet,“ vor dem Bergamt in Scheibenberg gemutet (40014, Nr. 153, Blatt 114). Auch der Herr Krauß hatte also Ende des 18. Jahrhunderts die Zeichen der Zeit erkannt und machte sich auf die Suche nach bauwürdigen Erzlagern, auch wenn diese Mutung wohl noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Eine weitere Mutung erfolgte durch den
Herrn Carl Gottlob Krauß ‒ bestimmt ein Verwandter ‒ am 28. Januar
1797 auf eine Fundgrube „auf Carl Gottlieb Meyers Grund am sogenannten
Töpferacker gelegen“ (40014, Nr. 191, Blatt 28). Diese Fundgrube wurde
ihm am 5. April 1797 auch bestätigt, erhielt dabei allerdings den Namen
Da sich der Muter anscheinend nicht mit dem Grundeigentümer einig geworden ist, hat es die Familie ‒ offenbar nun mit fachkundigem Beistand ‒ noch einmal versucht. Der Mutung ist nämlich diesmal zu entnehmen, daß Christian Ehregott Krauß Steiger auf der Mondenschein Fundgrube in Elterlein gewesen ist. Dieser nun legte am 18. August 1804 Mutung auf eine gevierte Fundgrube, und zwar wieder „im Tännigwalde auf Herrn Meyers Grund und Boden“ ein (40014, Nr. 211, Film 0012). Das Grubenfeld wurde ihm am 4. Oktober 1804 auch bergüblich verliehen. Luciae 1804 wurden bei Krauß gevierte Fundgrube schon einmal 45 Fuder Eisenstein vermessen und an das Erla'er Hammerwerk geliefert (40014, Nr. 213, Film 0056). In den Fahrbögen des Berggeschworenen Johann Samuel Körbach wird sie dagegen erstmals erst im Quartal Reminiscere 1805 erwähnt, wo es heißt, es werde in 5 Lachtern Teufe und 2 Lachter westlich vom Fundschacht weiter abgeteuft (40014, Nr. 232, Film 0004). Crucis 1805 ist die Grube wieder in den Fahrbögen des Geschworenen erwähnt, freilich nur mit der Bemerkung, sie werde zu diesem Zeitpunkt „von den Eigenlöhnern nicht betrieben.“ (40014, Nr. 232, Film 0024) Im Quartal Luciae 1805 steht dann geschrieben, die Grube werde nun „nicht mehr betrieben“ ‒ das klingt nach einem winzigen Unterschied, war aber zunächst das Ende (40014, Nr. 232, Film 0032f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine erneute Mutung erfolgte am 15. Juni 1806. Christian Ehregott Krauß beantragte nun eine gevierte Fundgrube „beim sogenannten Haßenguth im Tännigwald, Herrn Meyers Grund und Boden“ (40014, Nr. 211, Film 0025). Das Hasengut liegt am nördlichen Abhang des Schwarzbachtales, etwas unterhalb vom Tänniggut. Diese nun wurde ihm am 3. Juli 1806 auch unter dem Namen Krauß Fundgrube bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 238f). Zu diesem Zeitpunkt war bekanntlich bereits Christian Friedrich Schmiedel als Geschworener im Bergamt Scheibenberg tätig. Dieser berichtete von seinen Befahrungen in der 3. Woche Luciae 1806 über die Grube (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 81). Kraus gevierte Fdgr. zu Langenberg. Lage. „Diese Eigenlehner Zeche liegt an dem nämlichen Gebirge, von dem Dorfe Langeberg gegen Mitternacht Abend.“ Abbaue. „Auf diesem wird bei 7½ Lachter Teufe des Tageschachtes auf dem daselbst ersunkenen Eisensteinlager ein Ort Stunde 7,1 gegen Abend getrieben, welches zur Zeit 3¼ Lachter erlängt ist. Gedachtes Lager ist gegen 1½ Lachter mächtig, besteht aus gelbem ockerigen Eisenstein, Hornstein, Brauneisenstein, auch braunem Glaskopf, und hat etliche 30 Grad Neigung gegen Mitternacht.“ Im Quartal Trinitatis 1807 heißt es in Herrn Schmiedel's Fahrbericht (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 108): Kraus gevierte Fdgr. zu Schwarzbach. Belegung. „Dieses Grubengebäude ist mit 1 Versorger und 2 Knechten belegt.“ Gangbare Baue. „Durch diese wird 1.) 2 Lachter von dem Fundschachte gegen Mitternacht Morgen ein neuer Tageschacht, um das allhier aufsetzende Eisensteinlager zu durchsinken, niedergebracht und ist bereits 2¾ Lachter tief. Sodann wird 2.) in dieser Teufe ein Ort mit ¾ Lachter Höhe Stunde 3.2 gegen Mitternacht Morgen getrieben, welches bis jetzt eine Länge von 2 Lachter erreicht hat. Vor diesem Orte sowohl als auf der Sohle des Tagschachtes ist das Eisensteinlager wohl entdeckt, aber noch nicht durchsunken und das erstrige gelbe und braune Eisenstein, brach nur erst in sehr kurzen Nieren ein.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch über diese, eigentlich unbedeutende Grube findet man in den Oberbergamtsakten, der im Jahre 1807 abgehaltenen Generalbefahrung durch das Oberbergamt halber, den folgenden ausführlichen Aufstand (40001, Nr. 115, Blatt 81ff, Abschrift in 40169, Nr. 196, Blatt 1f): praes. am 22ten Juni 1807
Aufstand und Grubenbericht Lage. „Dieses Grubengebäude liegt am untern Ende des Dorfes Schwarzbach an dem von selbigem gegen Mitternacht Abend ansteigenden Gebirge, nahe bei dem, den Meierschen Erben zugehörenden sogenannten Hasenguthe.“ Aufkommen. „Erst seit dem Quartal Crucis 1806 wurde das in Frage befangene Grubengebäude von dem Steiger Kraus, auf Mondenschein Erzgrube (bei Elterlein), eigenlehnerweise aufgenommen.“ Alte verlassene Baue. „Um das allhier aufsetzende Eisensteinlager aufzusuchen und zu bebauen, wurde vorerst ein Tageschacht 7 Lachter niedergebracht, und mit diesem das gegen 1½ bis 2 Lachter mächtige, ohngefähr 35 Grad gegen Mitternacht Abend fallende Lager durchsunken, sodann auf selbigen ein Ort Stunde 7,6 nach dem Streichen des Lagers 2½ Lachter gegen Abend getrieben.“ Anmerkung des Verfassers: „Das hiesige Eisensteinlager besteht aus gelben und braunen ockerigen Eisenstein, Hornstein, braunem Glaskopf, derben Brauneisenstein und sehr (?) Glimmerschiefer.“ „Besagtes Lager führte allhier Hornstein, gelben und braunen ockerigen Eisenstein, auch etwas braunen Glaskopf.“ Jetzige Baue. „Aus vorbemerktem Schacht wird anjetzt bei 3 Lachter Teufe ein Ort Stunde 3,2 gegen Mitternacht Morgen fortgebracht, welches auf 2 Lachter erlängt ist. Da aber vor selbigem starker Wettermangel eintrat, so mußte man suchen, diesem Übel abzuhelfen und zwar dadurch, daß man 2 Lachter von diesem Schachte gegen Mitternacht Morgen einen 2ten Tageschacht 2 ½ Lachter tief senkte, und selbigen mit letztbeschriebenem Orte in Verbindung brachte, Durch dieße Ausführung ist denn auch (?) ein vollkommen guter Wetterwechsel hergestellt worden. Vor diesem Orte sowohl als auf der Sohle des neuen Tageschachtes, lag der Eisenstein nur in sehr kleinen Augen, Nieren in vorgedachten und hier noch nicht ganz durchsunkenen Lager vor.“ Ausbringen. „Bis mit Schluß Quartals Luciae 1806 waren bei diesem Gebäude 60 Fuder Eisenstein ausgebracht, welcher von Eu. Königl. Bergamte á Fuder – Thl. 20 Gr. – Pf. taxiret, und an das Ober Mittweidaer Hammerwerk verkauft, wofür eine Bezahlung von 50 Thl. – Gr. – Pf. erlangt ist.“ Zimmerung betreffend. „Die beiden Tageschächte sind mit leichter Bolzenschrotzimmerung versehen.“ Oeconomischer Zustand. „Die Quartalskosten betrugen im Quartal Luciae a. p. 34 Thl. 18 Gr. 10 Pf. Die Receßschuld war mit Schluß des Quartals Luciae a. p. auf 91 Thl. 15 Gr. – Pf. und die Grubenschuld auf – Thl. – Gr. – Pf. angewachsen.“ Gutachten. „Um das beschriebene Eisensteinlager mehr zu untersuchen, soll der 2te Tageschacht noch weiter niedergrbracht und sodann mit Örtern aufgefahren werden.“
Annaberg, den Monat Juni 1807,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem die Generalbefahrung erfolgt war, wurde noch Folgendes im Bergamt Scheibenberg dazu festgehalten (40001, Nr. 115, Blatt 83ff, Abschrift in 40169, Nr. 196, Blatt 3ff):
Registratur In Gegenwart Genero Hl. Dero Commisaris Herr Bergcommissionsrath von Herder, Herr Bergmeister Schütz, Herr Geschworener Schmiedel, auch Herr Geschworener Schmidt aus Annaberg, auf besondere hohe Verordnung Dero.Commissaris der heutigen Befahrung beigewohnt, und Herr Bergamtsprotokollist Schmidt, endlich auch der Lehnträger, Christian Ehregott Krauß. „Das Eisensteinlager, worauf Krauß gev. Fdgr. (baut), ist gerade da, wo diese Zeche liegt, von Tage nieder schon sehr abgebaut, man trifft eine kleine Halde und Pinge an der anderen, und alle rühren von Tageschächten her, die man, wenigstens dem Vorgeben nach, wegen eines hier sehr bald und in wenig Lachter Teufe unter (?) sehr auffallenden Platzesmangels dicht neben einen der (?) genöthigt gewesen ist. Durch eben diesen Platzmangel, aus dem ein Durchschlag in alte ganz leere Baue erfolgt war, hatte sich auch der dermalen hier bauende Eigenlehner, Steiger Krauß von Mondenschein bei Elterlein, genöthiget gesehen, die in dem von ihm über die Grube gefertigten Aufstande angegebenen Baue wieder zu verlaßen, und zwei Lachter von dem neuesten Tageschacht gegen Mitternacht Morgen abermals einen Schacht abzusinken. Dieser wurde bei der unter heutigem Data von Sr. Hochwohlgebohren. Herrn Bergcommissionsrath von Herder, als hohem Revisionscommissarius mit Zuziehung der in marginem bemerkten Personen und untergenannten Protokollist hier gehaltenen Befahrung zwei Lachter weit gefunden, zugleich aber auch bemerkt, daß man damit mittäglicher und mittagmorgendlicherseits in alten Mann gekommen sei, und blos einen Knauer von Eisenstein angetroffen habe. Für diesen höchst mangelmäßigen, und bei der vielen Schachtzimmerung auch einen ziemlich schwerköstigen Bau, war nach Dro. Commissar und allen Anwesenden Ermeßen, sofort keine Verbeßrung und Hülfe zu finden, auch bemerkte Dro. Commissar, daß ohne einen Riß über das dasige Eisensteinlager, und die darauf bereits abgebauten Puncte sowie ohne die Heranziehung eines tiefen Stollens gar kein regelmäßiger und wirklich bergmännischer Grubenbau hier veranstaltet werden können. Dieserhalb erhielt der Eigenlöhner Krauß die commissarische Anweisung, sich (wenn?) ihm dran gelegen sey, einen erträglichen Bau hier zu etablieren, mit dem wahrscheinlich auf einem und demselben Eisensteinlager bauenden Gruben Gnade Gottes und Christian Fdgr. zu vereinigen, und wie auch bey ersterer für rathsam erachtet worden wäre, nicht blos einen gemeinschaftlichen Riß über das Eisensteinlager und die darauf verführten Grubenbaue fertigen zu laßen, sondern auch ebenfalls gemeinschaftlich den tiefen Stamm Asser oder Catharinen Stolln nach Angabe des Markscheiders heran zu bringen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danach berichtete der Geschworene Schmiedel im Quartal Luciae 1807 erneut über die Grube (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 129): Kraus gevierte Fdgr. ebendaselbst anlangend. „Es ist dieses Eigenlehnergebäude mit 4 Mann belegt, durch welche bei 3 Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort Stunde 6,4 gegen Abend auf dem 1½ Lachter mächtigen und von den Vorfahren theils schon bebauten Lager betrieben wird, und bereits 2 Lachter erlängt ist. Genanntes Lager fällt einige 60 Grad gegen Mitternacht Abend und führet Quarz, Hornstein, gelben und ockerigen Brauneisenstein, etwas wenig Braunstein und braunen Glaskopf.“ Nun, die Anbrüche besserten sich doch. So konnte auch am 3. Dezember 1807 das Ausbringen durch den Geschworenen bestimmt werden und es sind (40014, Nr. 235, Blatt 137) „in meiner Gegenwart bei Kraus gevierte Fundgrube zu Schwarzbach 28 Fuder Eisenstein vermeßen und nach Bergamts Taxe pro Fuder – 20 Gr. – an das Erla'er Hammerwerk verkauft (...) worden.“ 20 Groschen ist freilich kein besonders guter Preis für das Fuder Eisenstein gewesen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1808 heißt es im Fahrbogen, man habe nun das Ort Stunde 6,1 gegen Ost „mit 1 Lachter Weitung fortgestellt und auf 3½ Lachter erlängt. Das Lager fällt hier 62° gegen Nordost und ist ½ bis ¾ Lachter mächtig.“ (40014, Nr. 236, Blatt 14) Mit diesem Ort hatte man also eine bauwürdige Linse angefahren und ging zum Weitungsbau über. Am 12. Mai konnten daraufhin bei Kraus Fdgr. 13 Fuder Eisenstein vermessen und das Fuder zu 20 Groschen an das Erla'er Hammerwerk verkauft werden (40014, Nr. 236, Blatt 41). Damit setzten die Erwähnungen der Grube in den Fahrbögen wieder aus. Auch in der Grubenakte (40169, Nr. 196) findet man keinen weiteren Inhalt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kästners
Hoffnung Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26)
ist eine Grube dieses Namens schon ab 1796 und durchgehend bis 1841
aufgeführt. Sie hat in dieser Zeit insgesamt 2.224 Fuder Eisenstein (zirka
1.890 t), nie aber auch Braunstein ausgebracht. Danach wurde sie mit der
Grube Friedlich Vertrag konsolidiert.
Bereits am 16. September 1796 hatte der Herr Christian Friedrich Kästner beim damals zuständigen Geschworenen des Bergamts Scheibenberg, Johann Samuel Körbach, Mutung auf eine Grube eingelegt, worüber dieser auch das Bergamt mit folgendem Schreiben informierte (40014, Nr. 193, Film 0053): Dienstschuldigste Anzeige „Solche Fundgrube soll Frisch Glück heißen, ist mit einem geworfenen Schurf in Hrn. Gottlieb Maurers (Meyers ?) im Tännigwald, von einer nach Schwarzbach gehenden Straße, von solcher gegen 50 Ltr. Entfernung, (im) von dasiger Straße in Ost und Süd aufsteigenden Gebirge ein Stunde 5 streichender und Süd fallender Eisensteingang ausgeschürft werden, soll die Fundgrube halb in Nord und halb in Süd gestrecket werden. Bittet der Muther um Bestätigung. (...), habe den Schurf und alte Halde am 28ten Sept. 1796 besichtiget. Johann Samuel Körbach, Refiergeschworener.“ Warum hier zunächst ein anderer Grubenname genannt ist, erklärte sich anhand anderer Akten des Bergamtes zu Scheibenberg, denn am 16. September 1796 mutete auch Herr Christian Heinrich Kästner eine Fundgrube „auf Gottlieb Meyers Grund und Boden“ auf Eisenstein (40014, Nr. 191, Blatt 23). Diese Mutung wurde vom amtierenden Bergmeister, Johann Carl Schütz, am 5. Oktober 1796 auch bestätigt und zwar nun unter dem Namen Kästners Hoffnung (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 185).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über die letztgenannte Grube berichtet der erste Fahrbericht des Geschworenen aus dem Quartal Trinitatis 1797 (40014, Nr. 196, Film 0032): Über Kästners Hoffnung Fundgrube
bey Schwarzbach, Allhier wird der Bau von den Eigenlöhnern bey 2 Ltr. unterm Tag auf einem Stunde 2 streichenden und Ost neigenden Eisenstein Lager verführt. War gegen ⅜ Ltr. mächtig, führet Hornstein und Quarz und grauen Eisenstein. Scheibenberg den 27ten May 1797 Johann Samuel Körbach, Berggeschworener Die nächste Eintragung in den Fahrbögen des Geschworenen entstammt dem Quartal Crucis 1797 und lautet (40014, Nr. 196, Film 0050): Über Kästners Hoffnung Fundgrube, im Tännigwald gelegen „Allhier wurde von dem Eigenlöhner der Bau bey 2 Lachter unterm Tag auf dem Stunde 2 streichenden und Ost fallenden Eisenstein Lager, welches gegen 20 Zoll mächtig war und aus Hornstein und grauem Eisenstein bestand, vermittelst Stroßenaushieb in Nord verführet.“ Und ein Dreivierteljahr später berichtete Herr Körbach nach Scheibenberg (40014, Nr. 196, Film 0117): Eisensteingebäude Kästners Hoffnung im Tännigwald, Trinitatis 1798 „Allhier wird von dem Eigenlöhner der Bau bey 4 Ltr. Teufe unter Tag mittelst Ortbetriebs auf einem Stunde 5 streichenden und Nord fallenden, gegen 1 Elle mächtigen, aus Hornstein, Quarz und Eisenstein führenden Lager in Abend betrieben.“ Scheibenberg, den 31. May 1798. In den Erzlieferungsextrakten ist die Grube unter dem Name Kästners Hoffnung in den vier Jahren von 1796 bis 1799 mit einem jährlichen Ausbringen zwischen 50 und 150 Fudern Eisenstein verzeichnet; danach klafft eine Lücke bis 1804. Auch die Vermerke in Herrn Körbach´s Fahrbögen setzten schon nach Trinitatis 1798 aus. Offenbar war die erschürfte Lagerstätte abgebaut oder die technischen Schwierigkeiten überstiegen die Möglichkeiten des Eigenlehners. Stattdessen legten nun Christian Gottfried Hammerschmidt aus Raschau und Consorten am 26. Mai 1803 Mutung auf „eine gevierte Fundgrube auf Hrn. Meyers in Tännig Grund und Boden auf Eisenstein und alle Minerale“ ein (40014, Nr. 191, Film 0106). Sie wurde am 7. Juli 1803 auch bestätigt und die Grube mit dem Namen Kästners neue Hoffnung belegt. Nanu...?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr Kästner gab aber auch noch nicht auf, suchte weiter und wurde erneut fündig. Am 22. Oktober 1803 legte auch er in der üblichen Form erneut Mutung ein (40014, Nr. 211, Film 0003): „Auf Ihro Fürstl. Durchlaucht zu Sachsen, allergnädigsten Berg Freyes muthe und begehere ich ein Wehr in Entfernung von 14 Lachter gegen Abend von Friedlich Vertrag Fundgrube auf (Hrn. ?) Meyers Grund und Boden im Tännigwald bey Schwarzbach auf Eisenstein und alle Metalle und Mineralien. Gemuthet in dem Wohllöbl. Bergamt Scheibenberg in No. 3te Woche des Quartals Luciae 1803.“ Daraufhin befuhr der Geschworene Körbach den Fundort im Sommer 1803 (40014, Nr. 209, Film 0037f): Kästners Neue Hoffnung gevierte
Fundgrube im Tänigwald. „Hatten die Eigenlöhner vom Fundschacht in Mitternacht einen neuen Tageschacht 3 Ltr. saiger tief abgesunken, aber vom Lager sein wahres Liegendes nicht erreicht, bricht in solchem Lager Hornstein, Quarz und grauer Eisenstein mit ein, wird der Schacht noch tiefer abgesunken.“ Dem Grubennamen nach zu urteilen, war die erste Erzlinse wohl tatsächlich 1799 ganz abgebaut gewesen und nun machte man sich Neue Hoffnung an einem anderen Ort. Luciae 1803 jedenfalls notierte Herr Körbach dann (40014, Nr. 209, Film 0053): „War der Tageschacht von Eigenlöhnern gegen 5 Ltr. tief in dem sehr mächtigen und noch nicht zu bestimmenden Eisenstein Lager abgesunken, bricht in solchem Lager Hornstein, Quarz und grauer Eisenstein, wird fernerweit nieder gebracht.“ Da sich Herr Hammerschmidt und seine Konsortschaft wohl keine Mühe gaben, Herr Kästner dagegen um so mehr, die neue Erzlinse aufzuschließen, bestätigte das Bergamt daraufhin Herrn Kästner auch das Gewinnungsrecht mit dem folgenden Schreiben vom 5. Januar 1804 (40014, Nr. 211, Film 0003 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 231): „Auf vorstehende und dem Bergarbeiter Christian Friedrich Kästner aus Raschau am 22. Oct. vor. J. eingelegte bergüblich erlängte, auch sonst zu Bergrecht beständige Muthung, ist von mir Endesunterzeichnendem Bergmeister nach vorgängig von dem Herrn Refier Geschworenen Körbach wegen Einbringung des gemutheten gevierten Feldes vorgenommene Besichtigung und hierüber beschehene Anzeige an ernannten Muther verliehen und bestätigt worden Ein geviertes Wehr bei der auf Hrn. Meyers Grund und Boden im Tännigwalde bei Schwarzbach gelegenen Friedlich Vertrag gevierten Fundgrube, welches an der westlichen langen Seite vorgenannter gevierten Fundgrube angestoßen und von der südwestlichen Ecke derselben mit 14 Ltr. Stunde 6 gegen Abend und ebenso viel Lachtern Std. 12 gegen Mitternacht ins Gevierte vermeßen werden soll. Auf Eisenstein auch alle anderen Metalle und verleihbaren Mineralien mit allen dem gevierten Felde zustehenden Rechten Befugnissen und Verbindlichkeiten bergüblichermaßen verliehen und bestätigt, Johann Carl Schütz, Bergmeister“ Nebenbei erfahren wir hieraus, daß auch dieser Eigenlehner selbst Bergarbeiter gewesen ist. Ab 1804 und noch bis 1841 ist danach ‒ wenn auch immer wieder mit Unterbrechungen ‒ doch recht kontinuierlich ein Ausbringen an Eisenstein verzeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner amtlichen Grubenbefahrung im Quartal Reminiscere
1804 berichtete der Geschworene Johann Samuel Körbach, es werde „von
den Eigenlöhnern bey 3 Lachter Teufe aus dem Schacht gegen Nord ein Ort
betrieben, das Lager führt Hornstein, Quarz und grauen Eisenstein.“ (40014,
Nr. 213, Film 0009)
Trinitatis 1804 fand Herr Körbach die Grube allerdings unbelegt vor (40014, Nr. 213, Film 0020) und Crucis 1804 wurde erst einmal der Bolzenschrotausbau im Tageschacht erneuert (40014, Nr. 213, Film 0032). Bis Luciae 1804 hat man den „Ort und Förstenaushieb in Ost“ fortgesetzt und dabei immerhin 40 Fuder Eisenstein ausgebracht, vermessen und an den Pfeilhammer in Pöhla geliefert (40014, Nr. 213, Film 0056 und 0057). Reminiscere 1805 wurde der Abbau „von den Eigenlöhnern nicht betrieben“ (40014, Nr. 232, Film 0007 und 0011) und auch Trinitatis 1805 (40014, Nr. 232, Film 0026) und Luciae 1805 (40014, Nr. 232, Film 0030) fand Herr Körbach die Grube unbelegt vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab 1806 löste dann Herr Christian Friedrich Schmiedel
Herrn Körbach in der Funktion als Berggeschworener im Bergamt zu
Scheibenberg ab. Dieser fand die Grube Reminiscere 1806 wieder belegt und
berichtete über seine Befahrung in Schwarzbach (40014, Nr. 235, Blatt 22):
„Kästners neue Hoffnung ebendaselbst. Belegung und gangbare Arbeiten. Dieses Gebäude ist mit 3 Mann, nehmlich 1 Versorger und 2 Knechten belegt, durch welche 1.) bei 4 Lachter Teufe des dasigen Tageschachtes ein Ort mit 2 Mann Stunde 6,0 auf einem 20 – 24 Zoll mächtigen, ohngefähr 40 Grad gegen Mitternacht Abend fallenden Eisensteinlager, so aus Gneis, Hornstein, Quarz und Eisenstein bestehet, getrieben wird. Dieses Ort ist bereits 3 Lachter gegen Morgen erlängt. Sodann wird 2.) in der nämlichen Teufe und auf diesem Lager ein Ort mit 1 Mann Stunde 1,1 fortgebracht, und ist bis jetzt 4½ Lachter vom Tageschacht aus, bei gleichen und wie bei sub 1.) bemerkten Bestandtheilen, erlängt worden.“ Seine nächste Befahrung dieser Grube erfolgte erst wieder im Quartal Trinitatis 1807, worüber Herr Schmiedel notierte (40014, Nr. 235, Blatt 99f): „No 4te Woche auf Kästners neue Hoffnung bei Schwarzbach gefahren. Auf dieser, durch den Eigenlehner Hammerschmidt und Cons. betrieben werdenden Grube wird bei 5 Lachter Teufe des dasigen Tageschachtes ein Ort Stunde 11,0 gegen Mitternacht auf einem daselbst ersunkenen, etliche 20 Grad gegen Mitternacht Abend fallenden Eisensteinlager fortgestellet und ist solches bereits 4 Lachter erlängt. Gedachtes Lager ist gegen ¾ Lachter mächtig und besteht aus Hornstein, ockerigen gelben und braunem Eisenstein.“ Wie man hier entnehmen kann, hatten die Lehnsträger der Grube gewechselt. Der eigentliche Namensgeber hingegen, Christian Friedrich Kästner, mutete am 6. Januar 1807 „auf Rittergutsbesitzers Meyers Erben Grund und Boden“ (Das Gut ist im Vorjahr ja an den Sohn Erdmann Friedrich Meyer gekommen.) erneut ein Wehr auf Eisenstein. Dieses Viertelmaß grenzte an das Grubenfeld von Kästners Neue Hoffnung Fundgrube an deren Südostseite. Es wurde ihm am 7. April 1808 als Kästners geviertes Wehr bergamtlicherseits bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 146).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der schon mehrfach erwähnten, im Revier erfolgten Generalbefahrung durch das Oberbergamt im Jahr 1807 halber gibt es auch zu dieser Grube folgenden ausführlichen Aufstand (40001, Nr. 115, Blatt 85ff, Abschrift in 40169, Nr. 186, Blatt 1f): praes. am 16ten Juni 1807
Aufstand und Grubenbericht Lage der Grube. „Diese Grube lieg ¼ Stunde unter dem Dorfe Schwarzbach, an dem gegen Mittag Morgen sanft ansteigenden Gebirge im Tännigwalde.“ Geschichte. „Seit mehrern Jahren wurde in diesem Gebirge, und namentlich in der Gegend des, den Erben des Hammerguthes Tännig zustehenden Waldes, Bergbau auf Eisenstein getrieben, und obschon das daselbst aufgethane Eisensteinlager sehr abgebauet ist, so befinden sich doch noch einige Gruben hier in Umtrieb.“ Aufkommen. „Die in Rede stehende Grube wurde von den beiden Eigenlehnern Hammerschmidt und Kästner im Quartal Crucis 1803 aufgenommen. Die sonst gangbar gewesenen Baue sind folgende:“ Anmerkung des Verfassers: „Der Tageschacht ist in sehr unschüßigem (?) Sande und Tongebirg (?) niedergebracht und das 2 Ellen mächtige Eisensteinlager besteht aus dichtem Brauneisenstein, auch ockerigen gelben und braunem Eisenstein.“ Alte verlassene Baue. „Bei 4 Lachter Teufe eines 5 Lachter tiefen Tageschachtes, mit welchem man ein gegen 2 Ellen mächtiges Eisensteinlager ersunken hatte, wurde 1) ein Ort Stunde 6,3 gegen Abend getrieben und 5 Lachter erlängt, sodann 2) in ebendieser Teufe ein zweites Ort Stunde 3,1 gegen Mittag 5 ½ Lachter fortgebracht, und hinter beiden 3) sowohl Stroßen, als Förstenstöße ausgehauen. Gedachtes Lager, welches ohngefähr 30 Grade nordwestl. Fallen hatte, führte Hornstein, Quarz, gelben und braunen ockerigen Eisenstein, auch zuweilen dichten Brauneisenstein.“ Jetzige Baue. „Anjetzo wird blos ein Ort aus bemerktem Schacht bei 3 ½ Lachter Teufe Stunde 11,1 mit 2 Mann gegen Mitternacht betrieben, welches auch 3 ¼ Lachter fortgebracht ist. Allhier ist das Lager 1 Elle mächtig, und führt obbeschriebene Bestandtheile.“ Ausbringen. „Das Ausbringen hat seit der Aufnahme dieses gebäudes bis mit Schluß Luciae a. p. bestanden in 175 Fuder Eisenstein, welchen nach Eu. Königl. Wohllöbl. Bergamts pro Fuder 1 Thl. – – taxiret, und an das Erlaer Hammerwerk verkauft worden sind, wofür den Eigenlehnern eine Einnahme von 175 Thalern – Gr. – Pf. zutheil geworden ist. Diese Grube ist übrigens belehnt mit 1 gevierten Fundgrube und belegt mit 3 Häuern.“ Oeconomische Umstände. „Mit Schluß Qu. Reminiscere a. p. belief sich die sämtliche Grubenschuld nur auf 37 Thl. 17 Gr. 2½ Pf., dahingegen der Receß bis auf 142 Thl. 4 Gr. 6 Pf. angewachsen war. Die Quartalskosten betrugen im Quatal Reminiscere a. c. 17 Thl. 7 Gr. – Pf.“ Absichten. „Um mehrgedachtes Eisensteinlager noch weiter zu untersuchen, soll in Zukunft mit einem oder mehrern Örtern eine gewisse Länge aufgefahren, um der Hoffnung und Wahrscheinlichkeit nach, einen neuen Abbau dadurch zu erlangen.“
Annaberg, Monat Juni 1807,
Der hier als (Mit-) Eigenlehner genannte Christian Gottfried Hammerschmidt mutete übrigens am 1. Februar 1808 auch die Groß Fundgrube neu (40014, Nr. 211, Film 0041), die später auch als Großzeche bezeichnet wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier noch die Passage aus der Oberbergamts- Registratur (40001, Nr. 115, Blatt 87ff, Abschrift in 40169, Nr. 186, Blatt 3f):
Commissarische Befahrungs- Registratur Gegenwärtige: Generosimus Dominus Commissarius Dero hochwohlgeborener Bergcommissionsrath von Herder, Herr Bergmeister Schütz, Berggeschworener Schmidt von Annaberg, so auch Generos. Dero Commissario zu dieser Befahrung gezogen worden Herr Geschworener Schmiedel, hierüber Actuar Scheuchler aus Freyberg und der Lehnträger Christian Gottfried Hammerschmidt. „Nachdem Generos. Deus Commissarius anheute benebst den ad marginem bemerkten Personen obenbezeichnetes Grubengebäude befahren, haben hochdieselben über die über die Beschaffenheit desselben nachfolgendes anhero zu protocolliren verordnet und ist diesfalls gegenwärtige Registratur abgefaßt worden. Man ist bey dem Betriebe dieses Gebäudes von den im Aufstande beschriebenen Bauen vor kurzem, wegen Wettermangels, wiederum abzugehen genöthiget worden, und hat daher 2 Lachter von dem vorigen Schachte in Mitternacht Morgen einen neuen Schacht, dermalen bis in 3 Lachter Teufe niedergebracht, aus welchem ein Örtchen Std. 10,2 2 ½ Lachter in Mitternacht fortgebracht ist, wo ein völlig aufgelöstem Gneis und Eisensteingebirge dermalen ansteht. Dieses Ort ist mit 2 Mann in Weilarbeit belegt, und wird in der Absicht betrieben, um mit solchem (?) in Alten Mann zu gelangen und die von den Vorfahren daselbst anstehen gelaßnen Eisensteinpfeiler anzufahren und abzubauen. Nächstdiesem Orte wird allhier in gleicher Sohle ein Ort Std. 7,2 in Mittag Morgen betrieben, mit welchem man in 2 Lachter Länge in den, der Wetter wegen vor kurzem verlaßnen Schacht durchschlägig ward, und woselbst man die annoch anstehend verlaßnen kleinen Eisensteinmittel abzubauen gedenkt. Generos. Deus Commissarius bemerkten hiernächst bey Befahrung obbeschriebener Grubenbaue, daß das hiesige weit verbreitete und mächtige Eisensteinlager, so viel sich dermalen wahrnehmen lasse, gegen Mittag Abend einschieße und erklärten hierbey, daß bey der allgemeinen Unbekanntschaft mit dem von den Vorfahren abgebauten Felde auf sothanem Lager, wo man dermalen blos auf gutes Glück die noch vorhandenen alten Pfeiler aufsuche, ein besonderer Plan, in Absicht der Regelmäßigkeit des Abbaus, nicht zu entwerfen sey.“
Unterzeichnet von Christian Friedrich Schmiedel und
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste reguläre Grubenbefahrung durch den Geschworenen
Schmiedel erfolgte danach im Quartal Luciae 1807, worüber er notierte
(40014, Nr. 235, Blatt 130):
„Kästners Hoffnung eben daselbst betreffend. Allhier wird bei 3½ Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort mit 2 Mann Stunde 7,6 gegen Morgen auf dem dasigen Eisensteinlager betrieben und ist zur Zeit 4½ Lachter fortgebracht. Genanntes Lager fällt 53 Grad gegen Mitternacht Abend, ist ½ Lachter mächtig und besteht aus braunem Hornstein, Quarz und braunem Eisenstein.“ Außerdem war Herr Schmiedel am 16. November 1807 zugegen, wobei „in meinem Beisein bei dem Berggebäude Kästners Hoffnung bei Schwarzbach 55 Fuder (...) vermeßen worden (sind).“ (40014, Nr. 235, Blatt 132f) Im Quartal Reminiscere 1808 berichtete der Geschworene über Kästners neue Hoffnung, die Grube sei weiterhin mit 2 Mann belegt und diese bauten weiter auf dem Lager in 3½ Lachtern Teufe mittels Ortsbetrieb Stunde 5,6 gegen Nordost Erz ab und dieses Ort war jetzt 2¼ Lachter erlängt (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 13f). Das hier ausgebrachte Erz war offenbar von mittlerer Qualität, denn am 4. März sind bei Kästners neue Hoffnung 60 Fuder Eisenstein vermessen und zum Preis von 1 Th. – Gr. – Pf. pro Fuder an das Pfeilhammerwerk zu Pöhla verkauft worden (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 20f). Bis zum 5. Mai hatte man schon wieder 25 Fuder gefördert, an diesem Tage vermessen und zum gleichen Preis nach Pöhla verkauft (40014 Nr. 236, Rückseite Blatt 39f). Bis zur nächsten Befahrung am 20. April 1808 war das Streckenort auf 3 Lachter Länge fortgebracht, ansonsten gab es für Herrn Schmiedel aber nicht viel neues zu berichten (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 32f). Am gleichen Tage befuhr der Geschworene auch die neue kleine Nachbargrube und notierte hierzu: „Kästners Wehr ebendaselbst betr. Diese ganz kürzlich bestätigte Eigenlehner Grube ist mit 2 Doppelhäuern belegt, durch welche bei 2 Lachter Teufe des Fundschachtes ein Ort auf dem bei letztbeschriebener Grube bebaut werdenden Eisensteinlager Std. 1,1 gegen Mitternacht Abend fortgestellt wird und welches auch hier die (selben?) Bestandtheile führet. Ermeldtes Ort ist jetzt 1½ Lachter erlängt.“ Im Juni 1808 fand der Geschworene bei Kästners Hoffnung den Schacht auf 4 Lachter vertieft vor und ein Streckenort von dort aus Stunde 10,3 gegen Südost mit 3 Mann belegt. Das Ort war erst einen Lachter lang und verfolgte ein Eisensteinlager, welches an dieser Stelle allerdings nur noch 1 Elle mächtig war (40014, Nr. 236, Blatt 51). Die Sache erwies sich wohl nicht als ergiebig und so verlegte man sich wieder auf die etwas höhere Sohle, wo Herr Schmiedel Luciae 1808 ein neues Streckenort Stunde 8,1 gegen Südost auf 3½ Lachter ausgelängt vorfand (40014, Nr. 236, Blatt 93f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses Ort war bis Reminiscere 1809 „bei 2¼ Lachter Weitung 4 Lachter erlängt.“ (40014, Nr. 236, Blatt 103f) In dem mittelsteil mit 40° bis 50° einfallenden Lager ging man also auch hier zum Weitungsbau über und verbreiterte die Strecke auf nunmehr rund 4,5 m Weite ‒ in Anbetracht des wenig standsicheren Gebirges ein beträchtliches Maß ! Bis zum 9. März 1809 konnten dabei wieder 17 Fuder Eisenstein gefördert werden und das Erz wurde bergamtlicherseits erneut auf „á Fuder 1 Thl. taxirt.“ (40014, Nr. 236, Blatt 125) Von seiner Befahrung Trinitatis 1809 berichtete Herr Schmiedel, das Abbauort sei nun auf 6 Lachter Länge fortgebracht, allerdings gab er aber nun eine Richtung von Stunde 11,6 in Süd dafür an. In der Gegenrichtung hatte man Stunde 9,6 gegen Nordwest ein zweites Ort im Streichen des Lagers angesetzt und auf 2¾ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 151). Bis zum 20. Juli sind dabei erneut 18 Fuder Eisenstein ausgefördert worden (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 165). Am 28. Juli 1809 befuhr auch Bergmeister Schütz gemeinsam mit Herrn Schmiedel die Grube, worüber man am folgenden Tage in Annaberg protokollierte (40169, Nr. 186, Blatt 5), die Grube sei zurzeit mit dem Steigerdienstversorger und 3 Knechten belegt. Durch diese sei „erst neuerlichst“ ein Tageschacht 20 Lachter südwestlich „vom Friedlich Vertrag'er Stollnmundloche“ (von einem Stolln war zuvor noch nicht die Rede...?) oder 12 Lachter westlich von den 1807 beschriebenen Bauen 3 Lachter tief abgesenkt worden. In dessen Tiefsten war ein Sitzort Stunde 5 gegen Morgen in Betrieb, mit welchem man versuche, die stehengelassenen Eisensteinpfeiler zu gewinnen, die man früher wegen Wettermangel aufgeben mußte. Es sei schon 7¾ Lachter erlängt, so daß nur noch ein halber Lachter aufzufahren sei. Das Ort stehe im „sogenannten Sandgebirge“, einer unteren Schicht des dasigen Eisensteinlagers, und es waren schon „einzelne Eisenstein Knauer“ mit eingebrochen. Anschließend plane man ein Ort gegen Abend zu treiben, wo noch ganzes Feld vorliege. Bei der Befahrung im September 1809 befand der Geschworene, man treibe nun ein neues Ort in nur 3 Lachtern Teufe des Tageschachtes in Stunde 3,3 gegen Nordost, welches jetzt 6½ Lachter erlängt war. Wohl den ständig wechselnden Ansatzpunkten halber, traf Her Schmiedel diesmal folgende Veranstaltung: „Bei dieser Grube habe ich dem Versorger aufgegeben, mehr Regelmäßigkeit bei dem Abbau des Eisensteinlagers zu beachten.“ (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 185f) Die letzte Befahrung in diesem Jahr fand am 22. November 1809 statt. Herr Schmiedel befand Kästners Hoffnung nach wie vor mit 3 Mann belegt. Diese trieben das Ort in 3 Lachtern Teufe Stunde 3,5 gegen Nordost bei nunmehr 7¼ Lachter Länge ab Schacht weiter. Das Lager vor Ort war nun ⅜ Lachter (rund 0,75 m) mächtig und es bestehe „aus gelbem Ocker, lockerem Gneis, Quarz, braunem Hornstein, gelben und braunen ockerigen Eisenstein.“ (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 204) Auch an dieser Stelle beachtete man nun den Eisenocker, den man eher schlecht als Eisenerz, mit seiner charakteristischen gelb- braunen Farbe wohl aber als mineralisches Farbpigment durchaus verwerten konnte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner ersten Befahrung im Folgejahr am 20. Februar 1810
fand Herr Schmiedel bei Kästners Hoffnung
wenig neues vor: Man betrieb weiter das Ort in 3 Lachtern Teufe auf
dem Lager, war auf Stunde 5,0 gegen Nordost wieder etwas abgeschwenkt und
hatte es auf 8¾ Lachter fortgebracht. Das Lager war mit ¼ bis ½ Lachter
nun wieder etwas mächtiger, streicht Std. 5,4 und fällt sehr flach mit 20°
gegen Nord ein (40014, Nr. 245, Film 0020).
Am 15. März 1810 mußte der Geschworene darauf aufmerksam machen, daß mit dem Ort bei 9 Lachtern Länge nunmehr „das östliche Ende des bei diesem sowie das westliche Ende des bei der benachbarten Grube Friedlich Vertrag in Lehn habenden Feldes erreicht“ war (40014, Nr. 245, Film 0031). Folgerichtig hatte Herr Schmiedel anzuweisen: „So habe ich, um allen Feldstreitigkeiten zuvorzukommen, den Lehnträger der (...) Grube, Steiger Kästner, hiervon Eröffnung gethan und ihn angewiesen, dieses Ort sogleich einzustellen und ein anderes von dem Tageschachte gegen Mitternacht zu treiben.“ Ach, das ist aber interessant: Herr Christian Gottfried Hammerschmidt und dessen Konsortschaft sind offenbar aus dem Feld gegangen und haben Herrn Christian Friedrich Kästner den Abbau auch auf der Fundgrube wieder überlassen... Höchstwahrscheinlich ist Steiger Kästner dieser bergbehördlichen Anweisung auch gefolgt, denn der Geschworene fand bei seiner nächsten Befahrung Trinitatis 1810 nichts bemerkenswertes zu berichten (40014, Nr. 245, Film 0043). Von seiner Befahrung am 27. Juni 1810 berichtete Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen dann (40014, Nr. 245, Film 0067): Belegung und Stollnortsbetrieb. „Dieses Eigenlehnergebäude ist mit 4 Mann, als 1 Versorger und 3 Knechten belegt, durch welche, um das daselbst gegen Mittag ansteigende Gebirge und das in selbigem aufsetzende Eisensteinlager näher als es zeither in Ermanglung eines Stollns möglich gewesen ist, zu untersuchen, ein Stolln in gedachtes Gebirge Stunde 12,2 gegen Mittag in lockerem Gneis und gelbem Ocker betrieben wird und welcher bereits 3½ Lachter von dem Mundloche erlängt ist. Vor dem Orte brechen anjetzo einzelne loße Stücke brauner Eisenstein ein.“ Oh, gute Idee. Auch dieser Eigenlehner ging nun mit gewisser Systematik an den Abbau heran und denkt hinsichtlich Aufschluß, Wasser- und Wetterlösung einmal über das nächste Quartal hinaus, nachdem es die Nachbargrube Friedlich Vertrag ab 1809 auch schon begonnen hat... Bei seiner nächsten Befahrung, die schon am 12. Juli des Jahres erfolgte, fand der Geschworene nichts bemerkenswert neues vor; außerdem wurden an diesem Tage aber 10 Fuder ausgebrachtes Eisenerz vermessen (40014, Nr. 245, Film 0073). Auch am 13. August 1810 war noch kein wesentlich anderer Stand erreicht (40014, Nr. 245, Film 0087). Den Vortrieb des doch so sinnvollen Stollens ließ man wohl auch weiter liegen, denn Herr Schmiedel berichtete am 10. September 1810, daß mit 3 Mann Belegschaft jetzt bei 3½ Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort Stunde 12,3 gegen Süd auf dem Lager betreibe, daß 4½ Lachter ausgelängt sei (40014, Nr. 245, Film 0094). Bis zur nächsten Befahrung am 6. November hatte man dieses Ort auf 5¼ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 245, Film 0115). Dabei hatte man wieder 26 Fuder Eisenstein ausgebracht und am 7. November 1810 vermessen (40014, Nr. 245, Film 0116). Von der Befahrung im Quartal Reminiscere 1811 am 13. Februar hatte Herr Schmiedel zu berichten, daß man nun ein neues Ort Stunde 6,3 gegen Ost angeschlagen und 4 Lachter erlängt sowie ein zweites Ort Stunde 11 gegen Nord angesetzt, aber erst ½ Lachter fortgebracht habe (40014, Nr. 245, Film 0157). Am 23. April 1811 befand der Geschworene die Grube mit 4 Mann belegt, welche das Ort in 4 Lachter Teufe nun Stunde 5,6 nach Nordost weiter betreiben. Es war noch immer 5¼ Lachter vom Tageschacht ausgelängt, hatte aber nun 1 Lachter Weitung erhalten (40014, Nr. 245, Film 0191), was ja nichts anderes heißt, als daß man hier wieder ein bauwürdige Erzlinse gefunden hatte. Daher gab es am 30. April auch wieder 10 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 245, Film 0192). Auch am 8. Juli 1811 wurden weitere 10 Fuder vermessen, ansonsten aber fand der Geschworene am selben Tag, sowie bei seiner nächsten Befahrung am 26. August 1811 nichts wesentlich verändertes auf der Grube vor (40014, Nr. 245, Film 0216 und 0240). Beim weiteren Vortrieb des kleinen Weitungsbaus sind bis 16. November 1811 wieder 40 Fuder Eisenstein ausgebracht worden (40014, Nr. 245, Film 0270).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei der nächsten Befahrung durch den Geschworenen am
23. Januar 1812 fand er Kästners Hoffnung Fundgrube wieder mit 4
Mann belegt, welche in nunmehr 4½ Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort
Stunde 10,3 nach Südost bei ¾ Lachter Weitung trieben und schon auf 8 Lachter
erlängt hatten (40014, Nr. 250, Film 0011). Bei gleicher Belegung fand
Herr Schmiedel am 23. April 1812 jenes Ort in 4½ Lachter Teufe bei nun
Stunde 11,3 mehr nach Süd und mit 1 Lachter Weitung 8½ Lachter ausgelängt.
Das abgebaute Lager war vor Ort bis zu ½ Lachter mächtig (40014, Nr. 250,
Film 0044). Bis zum 16. Juni des Jahres waren dabei wieder 30 Fuder
Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 250, Film 0062). Von der Befahrung
Luciae 1812 berichtete Herr Schmiedel, daß er auf
Kästners Hoffnung dem Vermessen weiterer 22 Fuder beigewohnt, sich
ansonsten aber nichts wesentliches verändert habe (40014, Nr. 250,
Film 0122).
Am 8. August erfolgte erneut eine gemeinsame Befahrung mit Bergmeister Schütz, worüber diesmal zu protokollieren war (40169, Nr. 186, Blatt 6), man habe wegen Wettermangel gar nicht anfahren können. Von den zwei Tageschächten aus wurden sonst aber Versuchsörter betrieben, das eine in 3½ Lachter Teufe nach Nordost sei 3½ Lachter ausgelängt; das andere in 5 Lachtern Teufe des zweiten Tageschachtes nach Nordost habe man bisher 4 Lachter fortgestellt, dort aber noch keinen Eisenstein ausgerichtet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 19. Februar 1813 notierte Herr
Schmiedel in seinem Fahrbogen, daß die Grube nun mit 5 Mann belegt
sei. Der fünfte Mann kümmere sich um die Zimmerung und das Ausschlagen des
Roherzes. Die anfahrende Mannschaft treibe in 5 Lachter Teufe (es wird
sukzessive immer tiefer) ein Ort im Streichen des Lagers nun in Stunde 5,3
gegen Ost. Das Ort besaß 1 Lachter Weitung und ¾ Lachter Höhe und stand
bei 6 Lachter vom Schacht. Dahinter wird ein Förstenstoß von ½ Lachter
Höhe nachgerissen (40014, Nr. 251, Film 0021). Die Linse südöstlich vom
Tageschacht reichte also noch weiter nach unten und wurde auch hier nun in
einer Art Firstenstoßbau ausgehauen. Der Eisenstein bräche aber „größtentheils
nur nierenweise ein,“ hielt der Geschworene noch fest.
Am 17. Mai 1813 fand der Geschworene bei 5 Lachter Teufe ein neues Ort im Streichen des Lagers Stunde 6,3 ‒ aber nun gegen West, respektive in die Gegenrichtung ‒ mit ebenfalls 1 Lachter Weitung und ¾ Lachter Höhe angesetzt und bereits 6 Lachter vom Schacht aus erlängt. Dahinter wird wieder ein Förstenstoß von ⅜ Lachter Höhe nachgenommen (40014, Nr. 251, Film 0049f). Dann scheint die angetroffene Erzlinse im Brockenfels aber doch erschöpft gewesen zu sein, denn am 29. Juli 1813 hielt Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen fest, es werde nun durch „die aus 5 Mann bestehende Consortschaft anjetzo und wie es scheint, in weniger abgebautem Felde, ein neuer Tageschacht abgesunken um das allhier aufsetzende, sich ziemlich weit verbreitende Eisensteinlager zu entblößen.“ Damit stand man 3¾ Lachter tief „in gelbem Ocker und mildem Gneis“, hatte das eigentliche Lager aber noch nicht erreicht (40014, Nr. 251, Film 0080). Der neue Tageschacht war vielleicht doch nicht am richtigen Punkt abgesenkt, denn am 18. Januar 1814 fand der Geschworene die Grube erst einmal unbelegt vor (40014, Nr. 252, Film 0009). Dennoch waren am 2. Juni 1814 hier noch 43 Fuder Eisenstein vorrätig und zu vermessen (40014, Nr. 252, Film 0053). Danach blieb die Grube wohl liegen, denn die nächste Befahrung ist erst am 30. März 1815 erfolgt (40014, Nr. 254, Film 0028f). Herr Schmiedel fand an diesem Tage Kästners Hoffnung wieder mit 4 Mann belegt, welche (wohl nun doch aus dem neuen Tageschacht heraus) 1.) in 5 Lachtern Teufe ein Ort im Streichen des Lagers Stunde 4,4 gegen Südwest 2 Lachter erlängt und 2.) in 7 Lachter Teufe ein zweites Ort beinahe in derselben Richtung 5 Lachter getrieben hatten. Dazu hielt Herr Schmiedel für nötig, die folgende ,Veranstaltung' zu treffen: „In Betracht, daß obgenannte beide Örter ziemlich in einerley Richtung und nur 2 Lachter unter einander getrieben werden, so habe ich unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: daß das sub 1.) beschriebene Ort sofort eingestellt, das zwischen beiden befindliche Eisensteinmittel aber förstenweise ausgehauen werden soll.“ Klingt vernünftig. Am 7. August 1815 waren dabei wieder 30 Fuder Eisenstein ausgebracht und zu vermessen (40014, Nr. 254, Film 0065). Am 15. August erfolgte wieder die quartalsweise Befahrung durch den Geschworenen, über die er notierte (40014, Nr. 254, Film 0067), man treibe nun in jeweils 6 Lachtern Teufe 1.) ein Ort im Streichen des Lagers Stunde 11,3 gegen Nord, welches 2 Lachter erlängt war, und 2.) ein zweites Ort Stunde 4,4 gegen Südwest, welches ½ Lachter erlängt war. Danach besteht eine zeitliche Lücke, in welcher die Grube wahrscheinlich erneut still lag. Die nächste Befahrung ist erst am 27. August 1816 dokumentiert (40014, Nr. 257, Film 0077). Jetzt waren nur noch 3 Mann hier angelegt, durch die aber wieder zwei gegenläufige Örter betrieben wurden, nämlich eines Stunde 7,3 gegen West, das 3½ Lachter fortgestellt war, und ein zweites Ort in Stunde 12,6 gegen Nord, welches 5 Lachter bis vor Ort erreichte. Die stets schwankenden Tiefen- und Richtungsangaben des Geschworenen kann man freilich auch so interpretieren, daß einfach das immer so bezeichnete ,Lager' gar keines gewesen ist, sondern nur völlig ,krumme' Linsen innerhalb des Quarzbrockenfelses verfolgt worden sind, die sich irgendwie hindurch wanden. Daß der Geschworene mit dem Lachtermaß hat umgehen können, darf man schon voraussetzen. Am 9. Oktober 1816 fand Herr Schmiedel Kästners Hoffnung Fundgrube erneut unbelegt (40014, Nr. 257, Film 0088). In seinen Fahrbögen aus dem Jahr 1817 taucht sie nicht mehr auf (vgl. 40014, Nr. 258).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst im Fahrbogen vom 2. März 1819
liest man, daß Kästners Hoffnung wieder belegt sei, und zwar mit 4
Mann. Es wurde in 4 Lachtern Teufe ein Ort Stunde 6,6 gegen Ost, 3 Lachter,
und ein zweites Ort Stunde 10,1 gegen Süd, 2¼ Lachter ausgelängt,
betrieben (40014, Nr. 261, Film 0019).
Dem Lehnbuch ist zu entnehmen, daß Carl Heinrich Riedel und Konsorten zu Raschau in der Person des von denselben hierzu beauftragten Geschworenen eine gevierte Fundgrube auf Herrn Weigel‘s Grund in Schwarzbach unter dem Namen Kästners neue Hoffnung am 26. März 1819 bestätigt worden ist (40014, Nr. 43, Blatt 286f). Bis zum 2. Juni 1819 hatten die neuen Betreiber wieder 20 Fuder Eisenstein gefördert (40014, Nr. 261, Film 0048). Danach brechen die Erwähnungen in den Fahrbögen aber erneut ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Erwähnung der Grube findet
man erst in den Fahrbögen des Nachfolgers von Herrn Schmiedel in
der Funktion des Berggeschworenen zu Scheibenberg, Johann August Karl
Gebler, vom 20. Februar 1823 (40014,
Nr. 267, Film 0021f).
Dieser notierte damals: „Desselben Tages habe ich mich ferner nach (?) im Freyen gelegene, aber von neuem gemuthete Eisensteingrube Kästners Hoffnung im Tännicht bei Schwarzbach begeben, und solche freygefahren, auch mehrere daselbst auf Eisenstein angelegte neue Schürfe, sämtlich im Tännicht gelegen, mit denen jedoch zur Zeit noch kein Eisensteinlager entblöst worden, besichtigt.“ Die Grube war also zwischendurch erneut gänzlich aufgegeben worden, nun aber wieder gemutet worden. Der Geschworene benutzte hier weiter den Namen Kästners Hoffnung. In der am 4. April 1823 im Lehnbuch eingetragenen Bestätigung an den Muter Carl August Schramm aus Unterscheibe über eine gevierte Fundgrube „im Tännigwalde auf Herrn Meyers Grund“ steht dagegen geschrieben „unter dem früheren Namen Kästners Neue Hoffnung“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 293, Abschrift in 40169, Nr. 186, Rückseite Blatt 6). Zwei Monate später gab es die erste Befahrung durch den neuen Geschworenen, über die er berichtete (40014, Nr. 267, Film 0029f): „1. April 1823 gefahren auf Kaestners Hoffnung in Schwarzbach. Dieses Gebäude ist belegt mit
Man hat auf demselben, als einem erst wieder entstandenen neuen Gebäude angefangen, durch Anlage eines Stollns (unleserlich...?) unmittelbar über dem Grubengebäude Friedlich Vertrag daselbst in das gegen Mittag Morgen vom Schwarzbach aus ansteigende Gebirge neuen Versuch auf Entdeckung der dort überall (?) Eisensteinlager zu machen, ist auch so glücklich gewesen, durch Erlangung einzelner Nieren einen kleineren Theil Eisenstein zu erlangen, so (…?) wird. Da man aber mit dem erwähnten Stöllchen ohngefähr 3½ Lachter fortgerückt gewesen, so ist, weil bey dermaliger Ermangelung hinlänglich starken Holzes, das (…?) erst nach erfolgter Holzabgabe vielleicht zu erlangen steht, das dazu indeß angewendete aber (?) wohl etwas zu schwache dem Drucke nicht genug zu widerstehen vermochte, man auch wahrscheinlich von Seiten der Eigenlöhner nicht genug Vorsicht bey dem Abtriebe angewandt, die angefangene Arbeit durch Zusammenbrechen (?) vernichtet worden, (…?)“ Kein glücklicher Neubeginn... Glücklicherweise scheint beim Zusammenbrechen des Stollns wenigstens niemand zu Schaden gekommen zu sein. Daß man auch hier nun begann, Stolln vom Talhang her in die vermuteten Lager zu treiben, ist angesichts der immer wieder beklagten schlechten Wetterverhältnisse unseres Erachtens eine sehr vernünftige Idee.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch im selben Monat erfolgte eine zweite Befahrung der Grube, über die Herr Gebler in seinem Fahrbogen berichtete (40014, Nr. 267, Film 0038): „29. April 1823 gefahren auf Kaestners Hoffnung im Tännicht bey Schwarzbach belegt mit
Man ist jetzt noch beschäftigt, durch Aufsuchen der zu Tage aussetzenden Trümer des hier vorhandenen Eisensteinlagers Eisenstein zu gewinnen und und durch Beräumung eine schickliche stelle auf denselben einen Platz zu Anlage eines (unleserlich ?) Stöllnchens, welchen man laut meines vorigen Fahrbogens mit der Anlage des ersten nicht glücklich gewesen, zu bilden. Inzwischen sind seither wiederum einige Fuder Eisenstein gewonnen worden.“ Das Ausbringen summierte sich bis zum 7. August 1823 auf 20 Fuder Eisenstein (40014, Nr. 267, Film 0055). Die nächste Befahrung durch den Berggeschworenen erfolgte am 11. September 1823 (40014, Nr. 267, Film 0064). Die Belegung hatte sich wieder um einen Steigerdienst- Versorger auf 3 Mann erhöht. Ansonsten heißt es im Fahrbogen nur über die „Eisensteingewinnung. Mittels Stollnanlage in das dort gegen Mittag ansteigende Gebirge, sowie auch durch Niederfahren und offenen Tagebau vor dessen Mundloch, gewinnt man auf eine ganz einfache Weise Eisenstein, ohne daß sich übrigens hierüber etwas merkwürdiges sagen läßt.“ Was zunächst als eine sehr kluge Idee erschien, wird nun wieder in ,ganz einfacher Weise' fortgeführt. Immerhin hatte man bis zum 23. September 1823 dabei wieder 15 Fuder Eisenstein gewonnen (40014, Nr. 267, Film 0068). Am 13. Oktober waren hier noch einmal 5 Fuder (40014, Nr. 267, Film 0070) und am 5. November 1823 gerade einmal 4 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 267, Film 0074). Die Fördermenge illustriert das Vorgesagte ebenfalls. Diese sehr einfache und doch nicht sehr planvolle Abbauführung hielt auch weiter an, obwohl man die Belegung sogar noch einmal verstärkt hatte. Über seine Befahrung am 11. November notierte Herr Gebler in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 267, Film 0075): „Deßelben Tages gefahren auf Kaestners Hoffnung daselbst, belegt mit
Eisensteingewinnung. Theils zur Untersuchung des vorliegenden, gegen Mittag Morgen ansteigenden Gebirges, theils zu Gewinnung der vorliegenden (...?) Nester von Eisenstein wird ein Fallort gegen Mittag getrieben, sowie man durch ein Stück Abbau vom Tage nieder die daselbst unmittelbar unter Tage gestreut liegenden Nester Eisenstein zu gewinnen hofft.“ Ja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt... Auch andere suchten offenbar unverdrossen weiter, denn an gleicher Stelle notierte der Geschworene noch: „Deßelben Tages einige von Eigenlöhnern zum Schurfe auf Eisenstein ausgesuchte Punkte theils hier im Tännicht, theils in Langenberg besichtigt.“ Das Ausbringen bis zum 18. Dezember des Jahres umfaßte dann noch einmal 11 Fuder Eisenstein (40014, Nr. 267, Film 0083). Auch am 11. Februar 1824 waren 20 Fuder (40014, Nr. 271, Film 0009) und bis zum 29. April erneut 15 Fuder durch den Geschworenen zu vermessen (40014, Nr. 271, Film 0027).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Grubenbefahrung durch Herrn
Gebler erfolgte dann am 14. Mai 1824, über die er in seinem
Fahrbogen berichtete
(40014, Nr. 271, Film 0031), der zu Entdeckung und Aufsuchung
von Eisenstein in der Stunde 11,6 angelegte Stolln (im letzten Fahrbogen
als ,Fallort' bezeichnet) sei nun 11 Lachter lang gegen Mittag
getrieben und dort „eine Anzahl nach allen Richtungen getriebene Örter,
mit denen bald größere, bald kleinere Nester Brauneisenstein angetroffen“
wurden, angehauen. Zur Erlangung von Wetterzug solle ein neuer Schacht
angelegt werden.
Bis zum 10. Juni des Jahres hatte man dabei wieder 14 Fuder Eisenstein gewinnen können (40014, Nr. 271, Film 0036). Anstelle des Wetterschachtes scheint man dann hier aber eine andere Lösung gewählt zu haben: Als Herr Gebler am 20. Juli 1824 wieder vor Ort war, hielt er in seinem Fahrbericht nämlich fest (40014, Nr. 271, Film 0047): „Um bey den jetzigen auf der Eisensteingrube dieses Reviers stehenden Wettern leichter mit der Gewinnung des Eisensteins fortfahren zu können, hat man hier angefangen, aus dem vor dem Mundloche befindlichen, vertieften Tageabbau noch weiter niederzugehen, ist auch so glücklich gewesen, vor der Hand etwas Eisenstein mit demselben zu entdecken und zu gewinnen.“ Man ging also einen bereits einige Zeit zuvor
begonnenen Tagebau wieder an ‒ was bei der geringen Tiefenlage der meisten bebauten
Nieren und Nester sicher auch vernünftig und weit weniger aufwendig
gewesen sein dürfte. Dasselbe hat wahrscheinlich nach 1866 auch
Wilkauer vereinigt Feld getan,
wenn wir uns die bis auf heutige Zeit verbliebenen
Weitere Befahrungen fanden in diesem Jahr nicht statt, auch mit Erzausbringen ist Kästners Hoffnung in den Fahrbögen aus dem Jahr 1824 nicht noch einmal aufgeführt. Die nächste Grubenbefahrung bei Kästners Hoffnung hatte Herr Gebler für den 20. Januar 1825 vorgesehen, fand „dasselbe aber, wie schon viele andre mal zuvor, nicht belegt, am wenigsten den höchst unordentlichen Versorger Hammerschmidt aus Raschau gegenwärtig gefunden.“ (40014, Nr. 273, Film 0009) Dennoch waren hier bis zum 9. Mai des Jahres immerhin 11 Fuder Eisenstein zum Vermessen zusammengekommen (40014, Nr. 273, Film 0032). Beim nächsten Befahrungstermin am 6. Mai 1825 war die Grube belegt und der Geschworene hielt dazu in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 273, Film 0035f): „Desselben Tages habe ich mich auf Kästners Hoffnung im Tännicht begeben und gefunden, daß der wegen seiner großen Unordnung bekannte dortige Eigenlöhner Hammerschmidt wiederum angefangen, einen von ihm schon vor 1½ Jahr nur zur Hälfte mit Genehmigung des dortigen Grundbesitzers angelegten und anfangs als 2 Ltr. Teufe bey einem Teufen ferner 10 und 8 Ltr. über das Kreutz im Waldboden und alte Stämme (?) niedergebrachte Länge, in welche er (?) verlohren gegangene und verfehlte Eisenstein (?) aufgesucht hat und noch aufsucht (...?) Tagebau noch weiter fortzusetzen anfängt, ohngedacht ich ihm solches schon vor geraumer Zeit (?) verbothen habe, der höchst willige und überaus nachgiebige Grundbesitzer Hr. Meyer aber über Hammerschmidts Benehmen schon mehrmals bitter Klage bey mir geführt hat, auch Vorhabens ist, deshalb besondere (?) Schrift bey Eu. Königl. Bergamte einzureichen. Da nun Hr. Meyer von Zeit zu Zeit durch mich etwas beruhigt worden, Hammerschmidt aber seine unzulässigen Baue unter Verbot ohngeachtet nicht einstellen will, so habe ich, was ich genannten Eigenlöhner, dem Urheber aller Unordnung bey dem Eisensteinbergbau im Tännicht, auch zeither angedroht, solches zur Kenntnis Eu. Königl. Bergamte hiermit bringen und demselben alles diesfallsige anietzo (...?) anheim zu stellen.“ Herr Gebler war offenbar bei dem Gedanken an diese Zeche auch beim Niederschreiben seines Fahrbogens noch erbost und seine Handschrift vielleicht deshalb besonders schlecht lesbar... Ganz klar ist die Sache aber dann doch nicht, denn ein Jahr zuvor war der Tagebau ja offenbar auch schon in Betrieb und da klang der Fahrbericht noch ganz anders. Der Geschworene trug am 28. Mai 1823 jedenfalls darüber auch in Annaberg vor (40169, Nr. 186, Blatt 7). Selbstverständlich folgte auch seitens des Bergamtes daraufhin eine Strafandrohung, wenn Herr Hammerschmidt den Tagebau weiter betreibe. Dem ungeachtet wurde Christian Gottfried Hammerschmidt am 7. Juli 1825 aber durch das Bergamt als „interimistischer Lehnträger“ angenommen (40169, Nr. 186, Rückseite Blatt 7). Der Grubenbetrieb jedenfalls ging ‒ ob nun ordentlich oder nicht ‒ mit geringem Umfang weiter und am 20. Juli 1825 waren wieder 13 Fuder ausgebracht und zu vermessen (40014, Nr. 273, Film 0049).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann schlugen im Sommer aber wieder die Wetter um und über seine Anwesenheit vor Ort am 19. September 1825 konnte Herr Gebler nur festhalten (40014, Nr. 273, Film 0062): „Desselben Tages habe ich mich fast auf alle Eisensteingruben, so bey Langenberg und im Tännicht liegen, begeben, habe solche aber fast durchgehends, meistens des im Sommer eintretende Wettermangels wegen, unbelegt gefunden. Auf Friedrich Fdgr. indessen und auf Kästners Hoffnung beschäftigte man sich mit Ausschlagen von Eisenstein. Auch hat an dem etwas matten Betriebe der gegenwärtige Mangel an Eisensteinabsatz seinen Antheil.“ Aha, und Absatzprobleme gab es auch noch... So hielt sich auch die Förderung im zweiten Halbjahr in Grenzen und bis zum 20. Oktober 1825 sind nur 13 Fuder Eisenstein noch einmal zusammengekommen (40014, Nr. 273, Film 0072). Auch weitere Befahrungen durch den Geschworenen gab es in diesem Jahr nicht mehr. Im darauffolgenden Jahr 1826 wird die Grube nur ein einziges Mal in den Fahrbögen des Herrn Gebler genannt, als er am 5. Juni des Jahres hier gerade einmal 5 Fuder Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 275, Film 0045). Im Jahr 1827 ist die Grube in den Fahrbögen überhaupt nicht genannt. Ob der Betrieb schon ganz geruht hat und die Grube in Fristen gehalten wurde, wissen wir noch nicht. Jedenfalls nahm man am 3. März 1827 in Annaberg zu Protokoll, daß der Lehnträger schon seit acht Quartalen die Quatembergelder nicht eingezahlt habe, woraufhin die Grube nun bergamtswegen aus dem Lehnbuch auszutun sei (40169, Nr. 186, Blatt 8).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die auf diesem Wege ins Freie gekommene Grube mutete nun Georg Friedrich Distler zu Raschau am 26. Juni 1827 die „in demselben Maße, wie solche zuletzt am 4. April 1823 dem vorigen Lehnträger Karl August Schramm bestätigt worden,“ und erhielt sie am 1. September des Jahres auch bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 67, 40014, Nr. 43, Blatt 312 und 40169, Nr. 186, Blatt 9). Trotz des neuen Besitzers war auch aus dem Jahr 1828 zunächst nichts anderes zu berichten: Herr Gebler war am 14. Oktober ein einziges Mal auf Kästner's Hoffnung Fundgrube, um hier ein Häufchen von gerade einmal 4 Fudern Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0076). Fahrberichte zum Grubenbetrieb gibt es dagegen wieder nicht, was in Anbetracht des so geringen Ausbringens in diesem Fall verständlich ist: Viel Betrieb kann hier auch 1828 nicht umgegangen sein. Auch im Jahr darauf ist die Grube nur zweimal in den Fahrbögen genannt, als der Geschworene im Sommer 1829 hier gewesen ist, um einmal 5 und einmal 6 Fuder ausgebrachten Eisensteins zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0139 und 0145). Zumindest das Ausbringen stieg dann im Jahr 1830 überraschend deutlich an: Herr Gebler war in jedem Quartal vor Ort und hatte hier insgesamt 78 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0194, 0206, 0241 und 0252). Bei seiner fünften Anwesenheit auf Kästners Hoffnung Fdgr. am 11. Oktober 1830 waren außer 9 Fudern Eisenstein außerdem auch 9 Fuder Flöße (also Kalkstein) ausgebracht (40014, Nr. 280, Film 0256). Da es auch aus diesem Jahr keine Berichte über Grubenbefahrungen gibt, erfahren wir leider nicht, wie es dazu gekommen ist. Aus dem folgenden Jahr 1831 gibt es überhaupt keine Erwähnungen der Grube in den Fahrbögen des Geschworenen. Stattdessen berichtet uns die Grubenakte, daß sich der frühere Lehnträger Hammerschmidt über den Geschworenen Gebler in Freiberg beschwert habe, worauf das Oberbergamt am 18. Juni 1831 das Bergamt in Annaberg zu Aufklärung aufforderte (40169, Nr. 186, Blatt 10f). Eine Registratur des Oberbergamtes vom 15. Juni sagt aus, daß Herr Hammerschmidt persönlich in Freiberg vorgesprochen hatte, weil, nachdem er 1824 Eisenstein an Louis von Elterlein auf dem Pfeilhammer geliefert und dessen Bezahlung verlangt habe, ihm eröffnet worden sei, daß man auf diesen Posten bereits 5 Thaler an Geschworenen Gebler gezahlt habe, weil er, Hammerschmidt, dem Bergamt Gebühren schuldig sei, die davon abentrichtet werden sollten. Wegen seiner „großen Armuth müsse er sich nun dringend wünschen, das Geld von Gebler zurück zu erhalten“ oder zumindest Aufklärung, welche Gebühren er dem Bergamt schulde. Wahrscheinlich war Herr Gebler der vorangegangenen Geschichten halber immer noch sauer und erst nach der dritten Aufforderung des Bergamtes äußerte er sich am 5. Januar 1832 schriftlich dazu (40169, Nr. 186, Blatt 15f): „Nachdem der aus der Scheibenberger Bergamts Refier, aber sowohl als aus den benachbarten Refieren, einer Menge unduldsamer Anordnungen und der Geringhaltigkeit seines Charakters wegen vom Bergbau zurückgehaltene und so gut wie entfernt gewesene, obgedachte Hammerschmidt bey meinem Antritte in die hiesige Refier zu anfange des Jahres 1823 sich als eine, seinem inneren Gehalte nach mir als eine ganz unbekannte Person, sich wieder einzuschicken gewußt hatte, war von ihm einige Quartale hindurch das Grubengebäude Kästners Hoffnung im Tännicht bey Schwarzbach, obwohl zu großer Beschwerde des höchst billigen und äußerst nachsichtsvollen Grundbesitzers, Herrn Meyer, betrieben und Eisenstein ausgebracht worden. In kurzer Zeit führte er indeßen, des erfolgenden Ausbringens und des Eisensteinverkaufs ohngeachtet, weder Bergamtsgebühren ab, noch hielt er in Bezahlung der Knappschaftskasse Ordnung...“ Diese Stellungnahme gab man am 8. März 1832 so nach Freiberg weiter, worauf am 17. März aus dem Oberbergamt angewiesen wurde, der Beschwerdeführer „sei abfällig zu bescheiden und zur Ruhe zu verweisen.“ (40169, Nr. 186, Blatt 21)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst vom 19. März 1832 gibt es auch wieder einen Fahrbericht, in dem es heißt,
die Grube sei mit dem Lehnträger selbst und einem Knecht belegt. Außerdem
schrieb Herr Gebler darin
(40014, Nr. 281, Film 0105):
„Um noch die jetzige Jahreszeit zu Herbeyschaffung von dem für die
Sommerzeit so nothwendigen Wetterzug zu benutzen, hat man angefangen,
ohnfern des ersten Schachtes einen zweyten niederzubringen, welcher
gegenwärtig 7 Ltr. tief ist. Der hier vorkommende Eisenstein ist von
mittelmäßiger Beschaffenheit.“
Von einem Ausbringen liest man dagegen in den Fahrbögen der Jahre 1831 und 1832 nichts. Tatsächlich weisen auch die Tabellen der Erzlieferungsextrakte sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22 und 26) eine Lücke in diesem Zeitraum aus. Eine wirkliche Verbesserung der Bewetterung der Grube hat man wohl nicht bewirkt, denn als der Geschworene die Grube am 4. Juni 1833 (40014, Nr. 281, Film 0197) befahren wollte, mußte er unverrichteterdinge umkehren: „Wegen Mangels an Wettern – ein Fall, der auf den hiesigen Gruben häufig vorkommt – war diese Grube nicht zu befahren. Inzwischen beschäftigte sich der Eigenlöhner damit, mit Hilfe eines kleinen auf wenige Lachter herangetriebenen Stöllchens den um den alten Tageschacht herum gelagerten Eisenstein auf die Teufe von 2 Ltr. unter Tage abzubauen.“ Wenigstens letzteres muß von gewissem Erfolg gekrönt gewesen sein, denn Herr Gebler hatte auf Kästners Hoffnung in diesem Jahr im August und November viermal den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen, dessen Menge zwischen 14 und 25 Fudern schwankte und sich auf insgesamt 80 Fuder im Jahr summierte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Sommer des Folgejahres 1834 hatte
der Geschworene hier Feldstreitigkeiten mit der Nachbargrube zu
bereinigen, worüber in seinem Fahrbogen vom 4. Juli des Jahres
(40014, Nr. 289, Film 0038)
zu lesen steht, er habe „zwischen
den Grubengebäuden Friedlicher Vertrag und Kästners Hoffnung gev. Fdgr.
die Markscheide bestimmt und einen Theil des erstgenannter Grube
zugehörigen Feldes gelegt und solche vorläufig durch Pfähle bestimmt.“ Die beabsichtigte Grubenbefahrung am 31. Juli 1834 unterblieb, denn Herr Gebler hat sich an diesem Tage „auf verschiedene der übrigen Eigenlöhnerzehen der dortigen Gegend begeben, dieselben aber theils unbelegt, theils ohne Anwesenheit der Eigenlöhner getroffen.“ Unter den dies betreffenden Gebäuden ist auch Kästners Hoffnung aufgeführt (40014, Nr. 289, Film 0042). Bestimmt war im Sommer wieder einmal der Mangel an Wettern in der Grube schuld... Die Befahrung wurde dann am 3. August 1834 wiederholt, allerdings war „bei den beyden zunächst liegenden Grubengebäuden Friedlicher Vertrag und Kästners Hoffnung (...) keine Veränderung wahrzunehmen.“ (40014, Nr. 289, Film 0048) Nun, das hilft uns leider wenig weiter... Das Ausbringen an Eisenstein nämlich war wieder angestiegen und summierte sich in diesem Jahr nun auf 90 Fuder. Die Feldstreitigkeiten des Vorjahres waren offenbar noch nicht beseitigt, denn am 12. März 1835 mußte sich Herr Gebler erneut „in den Tännicht begeben und mittelst Untersuchung der zwischen den Grubengebäuden Friedlicher Vertrag und Kästners Hoffnung bestehenden Markscheide die zwischen den beyden Eigenlöhnern besagter Gebäude obbeschwerte Differenzen und Beschwernisse zu beseitigen, was endlich nach gütlichem Zureden erfolgte, wobey ich zugleich das beyden zugehörige Feld in Bezug auf das baldige Setzen der so sehr erforderlichen Lochsteine vermessen und gelegt habe.“ (40014, Nr. 289, Film 0080) Mittels Kompaß und Lachterkette waren damals noch zwei weitere Tage nötig, bis das Vermessen der Grubenfelder beendet und die Lochsteine gesetzt waren (40014, Nr. 289, Film 0081 und 0082). Endgültig Ruhe zwischen den beiden brachte auch dies aber nicht, denn am 17. November 1835 war Herr Gebler erneut hier, „um auf Verlangen des hier bauenden und wegen durch seinen Nachbar, Stgr. (Walther?) vom Friedlichen Vertrag Fdgr. aus möglicher Verletzung der Markscheide besorgten Eigenlöhners Distler ohngefähre Untersuchung derselben vorzunehmen. Nachdem solches von mir geschehen, habe ich die Partheyen zurechtgewiesen und zu Verträglichkeit ermahnet, mit dem Bedenken, bey Fortdauer der Beschwerden die Lage der Sache Eu. Königl. Bergamte vorzutragen und demselben nach vorgängiger Untersuchung der Markscheide durch den Herrn Markscheider der Revier, die Entscheidung zu überlassen.“ (40014, Nr. 289, Film 0128)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kästners
Hoffnung erste obere Maß bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu gleicher Zeit wollten die
Eigenlöhner von Kästners Hoffnung Fundgrube ihr Grubenfeld offenbar erweitern, denn am 24. November
1835 war der Geschworene erneut hier und hat „eine Besichtigung wegen
zu dem Grubengebäude Kästners Hoffnung obere gevierdte mittägige Maaß
nebst Zubehör gemutheten Feldes abgehalten.“ (40014,
Nr. 289, Film 0130)
Nach dem Verleihbuch des Bergamtes Scheibenberg hat eine erste Befahrung durch Herrn Gebler aber bereits Anfang April 1835 stattgefunden, nachdem Carl Friedrich Harnisch und Carl Friedrich Schmiedel aus Raschau unter dem genannten Namen Mutung auf eine gevierte Maß und zwei gevierte Wehre nach Kästners Hoffnung Fundgrube eingelegt hatten (40014, Nr. 270, Film 0151ff). Da somit streitig war, wer denn zuerst und welches Feld genau gemutet habe, wurde noch am 2. September 1835 den letztgenannten eröffnet, daß das Grubenfeld noch nicht bestätigt werden könne und jeder Grubenbetrieb zu sistieren ist, bis ein Vergleich über die Feldgrenzen bewirkt sei (40169, Nr. 185, Blatt 1). Nachdem dann aber am 5. September 1835 beide Parteien im Bergamt Annaberg vorsprachen und eine Vereinbarung über die Grenzen der gemuteten Felder vorgebracht hatten, erhielten Harnisch und Schmiedel sie unter dem Namen Kaestners Hoffnung erste nächste gev. Maas nebst Zubehör im Umfang der ersten oberen gevierten Maß und zweier gevierter mittägiger Wehre noch am gleichen Tage auch bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 324 und 40169, Nr. 185, Blatt 2). Am 25. November 1835 haben sie dann die mittägigen Wehre aber schon wieder losgesagt und erhielten stattdessen die nächsten oberen morgentlichen Wehre bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 326 und 40169, Nr. 185, Blatt 3).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über den eigentlichen Betrieb auf den
oberen Maßen verrät uns die Grubenakte wenig; sie ist vielmehr mit einem
Streitfall zwischen den Gesellen und dem dazu ergangenen Schriftverkehr
angefüllt. Das ist aber auch ganz interessant, gibt es uns doch einen
Einblick in die bergbehördliche Rechtsprechung und erklärt vielleicht
besser, als unsere allgemeinen Ausführungen im Kapitel zum
Eigenlehnerbergbau, wie sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts
funktionierte.
Neben den beiden schon genannten Mutern waren inhalts der Akte nämlich noch ein Erdmann Weigel und ein Carl Gottlieb Klemm unter den Betreibern. Sie waren also zu viert und demgemäß hatten sie ihre Anteile in je 31¼ Kuxe untereinander aufgeteilt, wobei drei Freikuxe verblieben, die vermutlich in üblicher Weise der Knappschaft, dem Grundeigentümer und der Kirchgemeinde zugestanden waren. Nun beschwerte sich aber am 16. Januar 1836 die Frau Christiane Friedericke verw. Förster Perl gemeinsam mit Herrn Klemm beim Bergamt, daß sie ja eigentlich auf Anraten des ehemaligen Bergmanns Hammerschmidt alles erst initiiert habe, daß sie bisher keinen Gewährschein für den ihr zustehenden Anteil erhalten habe, obwohl sie doch 30 Thaler Verlag eingezahlt habe und weil sie selbst nicht mitarbeiten könne, auch noch den Lohn für einen Bergmann namens Weigel zahle (40169, Nr. 185, Blatt 4ff). Zugleich bat sie das Bergamt, doch einen zuverlässigen Grubenversorger und Steiger zu bestellen. Daraufhin wurde der Lehnträger Carl Friedrich Harnisch für den 2. März 1836 nach Annaberg einbestellt und befragt. Dem Protokoll darüber ist zu entnehmen, daß er Frau Perl nicht als mitbeteiligt ansah, sie habe vielmehr nur eine Absichtserklärung abgegeben. Die 30 Thaler Verlag hätten er und Miteigenlehner Schmiedel bei dem Bergmann Carl Friedrich Weißflog geliehen, nicht bei der Witwe. Herr Klemm habe seinen Gewährschein erhalten, derselbe zwar bis jetzt nur Fuhrleistungen zum Grubenbetrieb beigesteuert, wofür er ihm aber ordnungsgemäß 7 Thaler im Anschnitt angeschlagen habe. Was schließlich den alten Bergmann Hammerschmidt anlange, so wolle den niemand als Mitgesellen habe, er störe nur die Eintracht und könne wegen Armut und Gebrechlichkeit gar keinen Beitrag mehr leisten (40169, Nr. 185, Blatt 7f). Außerdem legte der Lehnträger eine Abrechnung über das erste Quartal vor, der zufolge jeder der vier Gesellen 19 Thaler, 2 Groschen, 1 Pfennig aufzubringen hatte. Ein Ausbringen gab es noch nicht (40169, Nr. 185, Blatt 9ff). Obwohl das alles eigentlich ziemlich klar erscheint, beraumte das Bergamt für den 7. April 1836 einen Verhandlungstermin an (40169, Nr. 185, Blatt 12). Wie damals üblich, brauchte die Witwe dafür einen ,curator'; daher war Advokat Abel Heinrich Seelich aus Annaberg als ihr Rechtsvertreter dabei anwesend. Auf dieser Verhandlung erklärte zunächst Herr Weißflog, daß er von den Eigenlehnern bereits 15 Thaler zurückerhalten habe und die zweite Hälfte in Kürze erwarte. Bezüglich der Mitbeteilligung von Frau Perl legte man bergamtswegen fest, daß ihr aufgrund ihrer Absichtserklärung ein Anteil zustehe. Dieser verfalle aber, wenn sie den fälligen Beitrag von 19 Thalern, 2 Groschen und 1 Pfennig nicht innerhalb der nächsten vier Wochen ausgleiche. (Aber eigentlich müßte der doch sinken, denn dann wären sie ja zu fünft und jeder Geselle hätte auch nur ein Fünftel der Kosten beizusteuern. Oder hat Erdmann Weigel tatsächlich Schichten für Frau Perl verfahren ?) Da Herr Klemm seinen Gewährschein ja habe, sei diese Angelegenheit eigentlich von selbst zur Erledigung gekommen. Auch ihm wurde aber auferlegt, binnen der nächsten vier Wochen seinen Beitrag, natürlich abzüglich der selbst erbrachten Leistungen im Wert von 7 Thalern, einzubringen. Was schließlich noch die Frage der Anlegung von Arbeitern oder Steigern anbetreffe, so sei dies Sache des Lehnträgers, ebenso wie deren Auslöhnung (40169, Nr. 185, Blatt 16ff). Tatsächlich legte Frau Perl dann am 5. Mai 1836 im Bergamt die Einzahlungsquittung ihres Beitrages vor und war damit Miteigenlehnerin der Grube (40169, Nr. 185, Rückseite Blatt 19).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein reichliches Jahr später scheint es
aber neue Differenzen unter den Gesellen gegeben zu haben, denn am 19.
September 1837 forderte das Bergamt die Gesellenschaft auf, einen neuen
Lehnträger zu wählen, weil der zeitherige, (hier steht jetzt Johann
Christian ?) Schmiedel, seinen Pflichten nicht ordentlich
nachkomme (40169, Nr. 185, Rückseite Blatt 21ff). Der letztere legte
selbst am 22. November 1837 schriftlich die Lehnträgerschaft nieder. Wenn
wir´s richtig gelesen haben, bestanden trotz eines gewissen Ausbringens
Probleme bei der Auszahlung von Schichtlöhnen.
Daher wurde vonseiten des Bergamtes für den 4. Januar 1838 ein neuer Verhandlungstermin angesetzt (40169, Nr. 185, Blatt 29). Dabei wurde Herr Schmiedel offiziell seiner Funktion als Lehnträger enthoben, behielt aber seine Anteile an der Grube. Als neuen Versorger bestellte das Bergamt ex officio ‒ offenbar, weil sich die Mitgesellen untereinander nicht einig wurden ‒ den Steiger Carl Heinrich Hartmann vom Frisch Glück Stolln und der wurde auch gleich beauftragt, die Registerführung in Ordnung zu bringen (40169, Nr. 185, Blatt 31f). Derselbe brachte am 25. Juli 1840 in Annaberg vor, daß Harnisch und Schmiedel schon seit Anfang 1838 keine Zubußen auf ihre Kuxanteile mehr entrichtet hätten und bat darum, sie als Miteigentümer auszutragen (40169, Nr. 185, Rückseite Blatt 34). Zu diesem Zeitpunkt hatte die Betriebsführung von Wilkauer vereinigt Feld bereits ein Angebot in Höhe von 45 Thalern, 12 Groschen für das Gebäude nebst Inventarium und vorrätigem Eisenstein gemacht. Weil man vonseiten der letzteren die
Frist aufkündigte, beschloß man dann am 30. November 1839 auch in
Annaberg, die Grube formal ins Freie fallen zu lassen. Damit war der Weg
frei und Kästners obere Maß ging an Wilkauer vereinigt Feld.
Zu dieser Gesellschaft weiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damit zurück zu Kästners Hoffnung Fundgrube: Auch Herr Distler hatte eine erste untere mitternächtliche Maß zu seiner Fundgrube hinzu gemutet. Herr Gebler war deshalb zur Ortsbesichtigung erneut am 7. Januar 1836 zugegen und nach dessen Bericht erhielt auch Herr Distler diese erste untere gevierte Maß am 27. Januar 1836 bestätigt (40014, Nr. 270, Film 0167, 40014, Nr. 43, Blatt 327 und 40169, Nr. 186, Rückseite Blatt 21). Wohl, um das vergrößerte Feld aufzuschließen, sollte dann ein neuer Schacht abgeteuft werden. Herr Gebler mußte sich daraufhin schon wieder in den Tännicht begeben, „um unter Zuziehung des Herrn Grundbesitzers die Besichtigung einer von den Eigenlöhnern zu Niederbringung eines neuen Schachtes ausgewählten Stelle zu unternehmen, wozu aber derselbe, da diese in weniger Entfernung von dem vorhandenen Hauptschachte und mitten in der dichtesten Jugend (jungen Holzes) und bey Ermanglung alles Haldensturzraumes befunden wurde, seine Einwilligung gänzlich verweigerte und dies um so mehr, da die Entfernung der erwähnten und gesuchten Stelle nur 19 Ltr. vom Hauptschachte beträgt, wovon, da man bereits von dem letzteren nur 4 Lachter gegen Morgen aufgefahren nur noch 15 Lachter höchstens zu durchörtern bleiben, was in der hier vorhandenen, zum größten Theil milden Gesteinsmasse nicht von großer Dauer seyn kann. Der Hauptbewegungsgrund, weshalb man Seiten der Eigenlöhner des projektirte Schachtabsinken nahe bey der Markscheide von Friedlicher Vertrag und schleunig daselbst ausführen zu dürfen sehnlich macht, liegt in der Besorgniß und Vermuthung, daß der Eigenlöhner von nur genannter benachbarter Grube in ihrem Felde bauen und viele von den daselbst vermutheten Anbrüchen vor der offenbaren Entdeckung dieses Unternehmens und ehe man daselbst mit offenem Durchschlage von Seiten des Nachbarfeldes, Kästners Hoffnung 1te obere mittägliche nächste Maaß nebst Zubehör den Beweiß führen könne, so viel wegzunehmen, als nur möglich sey. Bey der Leichtigkeit, mit der sich die hier vorkommenden Anbrüche meistens gewinnen lassen, wäre ein solches Unternehmen von Seiten des Eigenlöhners von Friedlicher Vertrag wenigstens möglich.“ (40014, Nr. 289, Film 0133f) Die Nachbarn trauten sich nicht von jetzt bis gleich über den Weg... Und daß die Grundbesitzer über immer neue Schächte nicht begeistert waren, wissen wir ja auch schon. Ganz nebenbei wurde auf Kästners Fundgrube aber auch Eisenstein gewonnen, wovon ausweislich der Fahrbögen des Geschworenen am 9. September 20 Fuder zum Vermessen bereit gelegen haben (40014, Nr. 289, Film 0116).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Erweiterung des Grubenfeldes um
eine ganze gevierte Maß scheint aber Erfolg und neue bauwürdige Vorkommen
gebracht zu haben, denn nachdem Geschworener Gebler im Jahr 1836
insgesamt sechsmal auf der Grube zugegen war, um den ausgebrachten
Eisenstein zu vermessen, hatte sich dessen Menge auf 159 Fuder summiert ‒
das größte Ausbringen dieser Grube seit acht Jahren. Ein kleiner Teil der
Förderung ging nun offenbar auch an neue Abnehmer, denn am 27. April 1836
hat der Geschworene hier eine eher kleine Menge von
6 Fudern vermessen, die aber „zu einem Versuche bey dem Hammerwerk
Unterblauenthal“ bestimmt gewesen ist
(40014, Nr. 289, Film 0173).
Im Jahr 1837 hat der Geschworene auf Kästners Hoffnung Fdgr. insgesamt ein Ausbringen von 102 Fudern Eisenstein vermessen. Hinzu kamen noch weitere 32 Fuder, 3 Tonnen von Kästners oberer ersten Maß. Die im Vorjahr schon befürchteten Feldstreitigkeiten traten dann auch wirklich ein. Herr Gebler berichtete am 17. März 1837 zunächst nach Scheibenberg, daß ihm Lehnträger Distler angezeigt habe, daß Steiger Vulturius von Friedlicher Vertrag anscheinend schon zum wiederholten Male Raubbau in seinem Feld verführe, woraufhin der Geschworene ‒ obwohl er ja eigentlich als solcher die Kontrolle selbst hätte vornehmen können ‒ den Steiger Friedrich Wilhelm Schubert von Beständige Einigkeit mit einer Vermessung beauftragt hatte. Der berichtete dann auch wirklich, daß die Nachbargrube geschätzt 100 Fuder auf der falschen Seite der Markscheide abgebaut habe. Gebler riet daraufhin Distler, selbst einen Querschlag zu treiben, die in Rede stehenden Baue anzufahren und den Nachbarn gewissermaßen auf frischer Tat zu ertappen; jedenfalls könne man bei Steiger Vulturius nicht von einem Versehen oder Unwissenheit ausgehen (40169, Nr. 186, Blatt 22ff). Bei dem daraufhin am 5. April 1837 in Scheibenberg angesetzten Vernehmungstermin stritt Carl August Vulturius aber alle Vorwürfe des Nachbarn ab. Das Bergamt wies daraufhin Markscheider Strödel an, die Verlochsteinung zu prüfen und die Risse nachzubringen (40169, Nr. 186, Rückseite Blatt 24). Am 6. Februar 1838 hat Herr Gebler auf der Fundgrube noch einmal 45 Fuder vermessen. Fahrberichte zum Grubenbetrieb gibt aus diesem Jahr nicht mehr (40014, Nr. 294). Danach ist Herr Gebler aber aus dem Dienst in Scheibenberg ausgeschieden. Ab 1840 nahm die Funktion als Berggeschworener in Scheibenberg dann Theodor Haupt wahr (40014, Nr. 300).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf den in Umgang stehenden Gruben
seines Reviers ist der neue Geschworene gleich zu Beginn des Quartals
Reminiscere 1840 am 10. Januar angefahren. Über diese Grube steht in
seinem Fahrbogen zu lesen (40014, Nr. 300,
Film 0015): „Auf Kästners neue Hoffnung Fdgr. ist man noch beschäftigt, die Strecken, die längere Zeit unter Waßer gestanden haben, wieder aufzusäubern. Höchst nothwendig ist es übrigens, von diesen beiden Gruben einen Markscheiderriß zu haben, um die Stärke der stehengelassenen Pfeiler kennen zu lernen, denn namentlich die 1te der beiden genannten Gruben (zur an dieser Stelle gemeinten, benachbarten Grube Friedlich Vertrag siehe unser folgendes Kapitel), welche einem unterirdischen Irrgarten zu vergleichen ist, macht wegen ihrer Haltbarkeit im Ganzen sehr bedenklich.“ Nachdem man alles wieder gangbar gemacht hatte, fand Herr Haupt bei seiner zweiten Befahrung am 16. März 1840 den Abbau wieder aufgenommen (40014, Nr. 300, Film 0029): „Auf der Nachbargrube Kästners Neue Hoffnung gev. Fdgr. ist seit einigen Wochen nur auf dem obern Bau Eisenstein gewonnen worden, der hier nicht allein eine bedeutende Mächtigkeit hat, sondern auch vorzüglich gut ist.“ Trinitatis 1840 war der Geschworene am 7. April auf der Grube und berichtete dann (40014, Nr. 300, Film 0042), man habe im Tiefsten die Aufgewältigung einer alten Strecke in SO. beendigt und vor dem ganzen Stoße ¼ Lachter mächtigen Brauneisenstein angetroffen, den man nun abbaue. Bevor im Sommer vielleicht wieder die Wetter matt werden oder im Herbst die Grube zum Ersaufen kommt, baute man dann dort auch bei der Befahrung am 19. Mai das Erz ab. Im Fahrbericht von diesem Tage heißt es dazu knapp (40014, Nr. 300, Film 0061): „Auf Kästners neue Hoffnung Fdgr. wird südöstlich vom Schacht der daselbst ¼ bis 0,4 Lachter mächtige und compackte Eisenstein im Tiefsten abgebaut.“ Dann war es aber wieder so weit. Unter dem 10. August 1840 notierte Herr Haupt in seinem Fahrbogen, er habe an diesem Tage „die Eigenlöhner Gruben im Tännicht befahren. Von diesen sind mehrere gegenwärtig wegen Wettermangel nicht in Betrieb oder werden daselbst wenigstens nur die Halden ausgekuttet oder die früher geförderten Producte ausgeschlagen. Diese Gruben sind namentlich Meyers gev. Fdgr. Ullricke gev. Fdgr. Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. Kästners neue Hoffnung gev. Fdgr.“ (40014, Nr. 300, Film 0091f) Und auch am 8. September heißt es: „Auf Meyers, Kästners, Distlers, Ullricke und Hausteins findet gegenwärtig wegen Wettermangels kein Betrieb statt.“ (40014, Nr. 300, Film 0107f) Von Luciae 1840 bis Mitte Reminiscere wurde Geschworener Haupt dann durch den Raschau'er Schichtmeister Friedrich Wilhelm Schubert vertreten. Auch Herr Schubert fand am 5. Oktober 1840 die Grube unbelegt (40014, Nr. 300, Film 0113). Dann muß es aber doch wieder Betrieb auf Kästners Hoffnung gegeben haben, denn am 5. Dezember 1840 hatte Herr Schubert hier wieder 45 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 300, Film 0137). Zwischendurch wurde Herr Distler, wie sein Nachbar auch, mit Patent vom 21. Oktober 1840 darüber informiert, daß Wilkauer vereinigt Feld nunmehr den Flügel des Arnimstollns in das Feld einbringe und daraufhin der vierte Pfennig der Vortriebskosten und nach dem Einkommen das Stollnneuntel fällig werde (40169, Nr. 186, Rückseite Blatt 25).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr 1841 wurden
Friedlich Vertrag und Kästners Hoffnung gevierte Fundgrube (letzere
allerdings ohne die oberen Maßen, denn die hatte ja die Grube Wilkauer
vereinigt Feld erworben) konsolidiert und in seinem Fahrbogen auf den
10. Mai 1841 nannte Herr Haupt beide Gruben schon in einem Atemzug (40014, Nr. 300, Film 0172f).
Zur weiteren Geschichte schlage man daher im folgenden Kapitel zur Grube
Friedlich Vertrag nach.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Friedlich
Vertrag Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere
ist die Grube dieses Namens von 1803 bis 1859 aufgeführt (40166, Nr. 22
und 26). Sie hat in dieser Zeit 7.295,4 Fuder Eisenstein (rund 6.200 t),
nur einmal im Jahr 1818 auch 70 Zentner Braunstein ausgebracht. Mit dieser
Förderung gehört sie zu den bedeutendsten Eisenerzgruben am Emmler.
Die Mutung dieser Grube erfolgte am 23. November 1802 durch den Bergarbeiter Carl August Weißflog und Consorten (40014, Nr. 191, Film 0100). Sie befand sich auf dem Grund und Boden des Tännigt Gutes, also zu dieser Zeit noch des Herrn Carl Gottlob Meyer. Am 10. Februar wurde sie unter dem Namen Friedlicher Vertrag bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 225). Dasselbe
liest man auch in dem
Derselbe Carl August Weißflog mutete zur gleichen Zeit noch eine weitere Fundgrube „auf Hrn. Richters Grund und Boden hinter Graul,“ wo er ein Eisenstein- Lager oder Flöz erschürft habe (40014, Nr. 191, Film 0101). Er bekam auch diese 10. Februar 1803 verliehen unter dem Namen Nachbarschaft Fdgr. im sogenannten Heydewalde bei Waschleithe. Die Lokalität liegt aber zu weit ab vom Emmler und deshalb verfolgen wir die Geschichte dieser Grube hier nicht weiter. Auch in den Fahrbögen des im Bergamtsrevier Scheibenberg damals zuständigen Berggeschworenen, Johann Samuel Körbach, taucht diese Grube Anfang des Jahres 1803 erstmals auf (40014, Nr. 209, Film 0017): Die Friedlicher Vertrag gevierte
Fundgrube bey Schwarzbach im Tännigwald, „Wird der Bau von Eigenlöhnern mit Absinken eines Tageschachtes verrichtet, war 4 Ltr. tief niedergebracht, bricht auf dem Eisenstein Lager Hornstein, Quarz und grauer Eisenstein mit ein, man hat zum Erlaer Hammer 10 Fuder Eisenstein in diesem Quartal vermeßen.“ Na, schau mal an: Der Standort war gut gewählt und schon beim Absenken des Schachtes hatte man gleich Ausbringen zu verzeichnen. Zehn Fuder sind nicht viel (etwa 8,5 t), aber immerhin: Das hilft wirtschaften ! Im nächsten Quartal Trinitatis 1803 heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 209, Film 0027): „Wird der Bau von Eigenlöhnern bey 3 Ltr. unterm Tag in dem sehr mächtigen Eisenstein Lager mittels Ortsbetriebs in Nord und Stroßenaushieb verführt, bricht in solchem Lager Hornstein und grauer Eisenstein mit ein.“ Selbst eine später derart ertragreiche Grube, wie diese, wurde anfangs offenbar nur durch ,Nebenerwerbs- Bergleute´ betrieben, denn kurz darauf im Sommer (Crucis) 1803 fand der Herr Körbach die Grube bei seiner regelmäßigen Befahrung unbelegt vor... Luciae 1803 notierte Herr Körbach nur, daß er „nichts veränderliches“ befunden habe (40014, Nr. 209, Film 0058) ‒ man baute also weiter untertage Eisenerz ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trinnitatis 1804 (40014, Nr. 213, Film 0021) und Crucis
1804 (40014, Nr. 213, Film 0032) fand der Geschworene die Grube unbelegt
vor. Da damit nun wieder zweimal hintereinander die Grube nicht belegt
gewesen ist, drohte der Freifall. Bei einer zweiten Befahrung im gleichen
Quartal war daher eine Mannschaft wieder angefahren und Herr Körbach
konnte festhalten, daß Ortsbetrieb bei 3 Lachter Teufe umgehe „in dem
sehr mächtigen Lager in Nord, (dieses) führt Hornstein, Quarz und
gegen 12 Zoll mächtig einbrechenden grauen Eisenstein.“ (40014,
Nr. 213, Film 0036)
Luciae 1804 heißt es in Körbach's Fahrbogen, man baue nun in 4 Lachtern Tiefe vom Schacht aus „mittels Ortbetrieb und Förstenaushieb in dem sehr mächtigen Lager, das noch nicht ausgerichtet ist.“ (40014, Nr. 213, Film 0051) Reminiscere 1805 trieb man vom Schacht aus nach West und Nord Versuchsorte vor (40014, Nr. 232, Film 0008). Und Crucis 1805 notierte der Geschworene, man sei auf den Örtern in 4 Lachtern Teufe vom Schacht aus in West und Nord mit Ortsbetrieb und Förstenaushieb befaßt, das Lager sei sehr mächtig und immer noch nicht ganz durchfahren, so daß man sein Streichen und Fallen noch nicht angeben könne (40014, Nr. 232, Film 0022f). Fast gleichlautend sind die Notizen Körbach's aus dem letzten Quartal 1805 (40014, Nr. 232, Film 0030, 0036 und 0038).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie wir schon wissen, schied Herr
Körbach 1806 aus seinem Dienst aus und wurde in der Funktion als
Berggeschworener in Scheibenberg durch Christian Friedrich Schmiedel
abgelöst. Der neue Bergbeamte berichtete Reminiscere1806 etwas
ausführlicher über die Grube (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 22):
Friedlich Vertrag Fundgrube (...) betreffend. Belegung und gangbare Baue. „Bei diesem, nur mit 2 Mann, nämlich 1 Häuer und 1 Knecht belegten Eigenlöhner Gebäude wird 1.) aus dem dasigen Tageschacht bei 3 Lachter Teufe deßelben ein Ort Stunde 2,0 gegen Mittag auf dem bei letztbeschriebenem Grubengebäude bemerkten Eisensteinlager betrieben, auch wurde selbiges 3 Lachter und 2.) in vorangegebener Teufe ein zweites Ort, jedoch Stunde 7,1 gegen Morgen fortgestellt, und vom Schacht aus 2 Lachter erlängt befunden. Nur genanntes Lager führt auch hier die nämlichen Bestandtheile, wie bei dem vorletzt beschriebenen Grubengebäude.“ Mit dem ,vorletzt beschriebene Grubengebäude' war die benachbarte Grube Kästners Hoffnung gemeint, welches Herr Schmiedel zuvor befahren hatte. In derselben Reihenfolge befuhr Schmiedel die Gruben auch Crucis 1806 und notierte diesmal (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 99 und Blatt 100): Friedlich Vertrag Fdgr. ebendaselbst betreffend. „Diese Grube liegt von der eben beschriebenen ohngefähr 50 Lachter weiter gegen Morgen und wird durch den Eigenlehner Steiger Weispflog und Consorten betrieben, durch welche Abbau eines Eisensteinlagers. das vorhin bei letzterer Grube beschriebene Eisensteinlager vom Tage nieder abgebauet wird, und auch die nämlichen Bestandtheile führet.“ Oh, man war also zwischendurch auch hier zum Tagebau übergegangen... Luciae 1806 baute man aber wieder untertage, wie der Geschworene in seinem Fahrbogen vom 3. November d. J. berichtete (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 129 und Blatt 130): „Auf Friedlich Vertrag Fdgr. bei Schwarzbach gefahren. Auf diesem mit 2 Häuern belegten Eigenlehnergebäude wird das mit einem 2¾ Lachter tiefen Tageschachte ersunkene, 45 Grad gegen Mitternacht Abend fallende Lager mittels eines Stunde 2,1 gegen Mitternacht betrieben werdenden und gegenwärtig 3¼ Lachter erlängten Ortes abgebaut. Nur bemerktes Lager ist ¾ Lachter mächtig und führt braunen Hornstein und braunen Eisenstein.“ Die Arbeit über das Jahr hat immerhin eine Förderung von 46 Fudern Eisenstein erbracht, die im Beisein des Herrn Schmiedel am 16. November 1806 vermessen worden sind (40014, Nr. 235, Blatt 132f). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch diese Grube war Gegenstand der Generalbefahrung im Jahre 1807 und so gibt es auch zu ihr folgenden ausführlichen Aufstand (40001, Nr. 115, Blatt 89ff): praes. am 16ten Juni 1807
Aufstand und Grubenbericht Lage der Grube. „Es liegt dieses Grubengebäude ¼ Stunde unter dem Dorfe Schwarzbach, an dem gegen Mittag Morgen sanft ansteigenden Gebirge im Tännigwalde.“ Geschichte. „Schon seit mehrern Jahren wurde auf diesem Gebirge Bergbau auf Eisenstein getrieben, so daß das in selbigem bei wenig Teufe aufsetzende Eisensteinlager um diese Gegend, theils durch nunmehr aufläßig gewordene, theils noch gangbare Gruben sehr bebaut worden ist.“ Aufkommen. „Im Quartal Reminiscere 1803 wurde diese Grube von dem Steiger Karl August Weißflog und Consorten aufgenommen und durch Weilarbeit betrieben.“ Alte verlaßne Baue. „Aus dem sonst gangbar gewesenen Tageschacht wurden 1) Bei 3 Lachter Teufe desselben ein Ort Stunde 2,0 gegen Mittag auf dem daselbst ersunkenen Eisensteinlager betrieben, auch 3 Lachter fortgebracht. Nicht minder wurde 2) in dieser Teufe ein zweites Ort Stunde 7,1 gegen Morgen 2 Lachter erlängt, und hinter beiden Örtern 3) sowohl Stroßen, als Försten nachgerissen. Endlich ist auch 4) mehrgedachtes Lager in der Gegend des Tageschachtes gleich vom Tage nieder abgebaut worden. Vorerwähntes Lager hatte gewöhnlich etwa 30 Grad Fallen gegen Mitternacht Abend, und bestand aus Hornstein, Quarz, gelben und ockerigem braunem Eisenstein.“ Jetziger Betrieb. „Durch die hier in Arbeit stehenden 2 Häuer wird einige Lachter von den vorbeschriebnen, anjetzo nicht mehr zu befahrenden Schachte, gegen Morgen ein neuer Tageschacht abgesunken, auch bereits schon 2 Lachter niedergebracht, und mit leichter Bolzenschrotzimmerung versehen worden.“ Einfügung des Verfassers: „Es wird hier auf dem Ausgehenden des 1½ Elle mächtigen Lagers gebaut, welches überhaupt aus Quarz, Hornstein und ockerigen Brauneisenstein besteht.“ „In dieser Teufe hat man zwar das Eisensteinlager erreicht, jedoch, um so viel man jetzt wahrnehmen kann, von den Vorfahren meistens abgebauet und nur einzelne kurze Eisensteinmittel anstehend verlassen worden, welche anjetzo abgebaut werden.“ Ausbringen. „Seit der Aufnahme dieses Gebäudes, nämlich vom Quart. Remin. 1803 bis Schluß Luciae a. p. sind 250 Fuder Eisenstein abgebaut und á Fuder 1 Thl. – Gr. – Pf. an das Auer und Erlaer Hammerwerk verkauft worden, welches den Eigenlehnern eine Einnahme von 250 Thalern gewähret hat. Es ist dieses Gebäude belehnt mit 1 gevierten Fundgrube und belegt mit 2 Häuern.“ Oeconomische Umstände. „An Grubenschulden sind mit Schluß Luciae a. p. vorhanden 35 Thl. 3 Gr. 5 Pf., an Receß bestand hingegen 331 Thl. 20 Gr. 7½ Pf. Die Quartalskosten beliefen sich in den beiden Quartalen Crucis und Luciae 1806 auf 98 Thl. – Gr. 2 Pf.“ Absichten. „Um das obbemerkte Eisensteinlager mehr zu untersuchen, soll besagter Tageschacht noch weiter niedergebracht, und sodann mit Örtern aufgefahren werden, um wo möglich ein ganzes und auf einige Zeit nachhaltendes Eisensteinmittel zu entblößen.“ Annaberg, Monat Juni
1807 Einen Auszug aus diesem Aufstand sowie dem folgenden Befahrungsprotokoll findet man in Abschrift in der Grubenakte (40014, Nr. 86, Blatt 1ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie wir schon wissen, wurden die
Befahrungen im Bergamt Scheibenberg ausgewertet und zur Generalbefahrung
noch Folgendes notiert (40001, Nr. 115, Blatt 91ff):
Commissarische
Befahrungs Registratur Gegenwärtig: Generos. Des. Commissar. Se. Hochwohlgeb. der Herr Bergcommissionsrath von Herder, Herr bergmeister Schütz, Geschworener Schmidt aus Annaberg, so bei Befahrung ebenso Geschworener Schmiedel, hierüber Actuar Scheuchler aus Freyberg und der Lehnträger Karl August Weißflog. „Von dem Eigenlehner Gebäude Kästners neue Hoffnung verfügten sich Deos Commissarius auf obbezeichnete Grube und geruhten zum Behufe der über die Befahrung sothanen Grubengebäudes aufzunehmender Registratur nachstehendes zu bemerken zu geben: Mit dem gegenwärtig 1 ½ Lachter tief niedergebrachten Tageschachte hat man, und zwar zuerst in mitternacht- abendlichem Stoße desselben, auf einen von den Vorfahren anstehen gelaßnen ganzen Eisensteinpfeiler getroffen, diesen nach gedachter Weltgegend verfolgt und bei 1 ½ Lachter Länge wiederum in einen Tagebruch geschlagen. Dagegen steht der gedachte Pfeiler dermalen gegen Mitternacht Morgen noch an und da deßen Ausbreitung und Dimension nicht zu bestimmen ist, so ist auch über den Abbau bei diesem Gebäude und deßen zu beobachtende Regelmäßigkeit aber, so wie bei Kästners neue Hoffnung ein hinkünftig zu befolgender Plan nicht zu etablieren. Generos. Deo. Commissarius waren inzwischen der Meinung, daß, wenn in dieser Gegend nicht so viel Holz stünde, als sich dermalen wirklich (?), dieses wichtige Eisensteinlager am zweckmäßigsten mittelst Steinbruchbau vom Tag nieder abzubauen sein würde.“ Unterzeichnet von den Geschworenen Karl Heinrich Schmidt und Christian Friedrich Schmiedel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung der Grube durch den Berggeschworenen erfolgte erst am 11. Februar 1808. Mit 2 Mann Belegschaft wurde zu diesem Zeitpunkt weiter das Ort Stunde 2,1 gegen Mitternacht betrieben, das nun auf 4¼ Lachter erlängt war. Hier vor Ort war das Lager ½ bis ¾ Lachter mächtig und fiel 50 Grad gegen Nordwest (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 13). Anfang Trinitatis 1808 hatte man das andere Streckenort Stunde 11,1 gegen Nord belegt, wo man nun 2¾ Lachter Länge aufgefahren hatte. Hervorhebenswert ist noch Schmiedel's Bemerkung in diesem Fahrbogen, daß das Lager „von den Vorfahren schon an verschiedenen Puncten abgebauet (ist), so daß man jetzt nur noch die von selbigen anstehen gelaßnen einzelnen Eisensteinmittel vollends aushauet.“ (40014, Nr. 236, Blatt 30) Obwohl man also eigentlich nur Restvorräte aus den Bauen der Alten hereingewann, brachte die Grube auch im abgelaufenen Quartal 25 Fuder Eisenstein aus, die am 20. Mai vermessen und zu 1 Th. pro Fuder an das Pfeilhammerwerk verkauft worden sind (40014, Nr. 236, Blatt 45). Am 20. Juni war der Geschworene erneut vor Ort und notierte, es seien nun zwei Doppelhäuer angelegt und man habe aus dem Schacht bei 3 Lachtern Teufe heraus nun ein Ort auf dem 20° gegen West fallenden Lager Stunde 1,1 gegen Süd angehauen, das auf 2 Lachter erlängt war. Das Lager war dort aber nur 1 Elle mächtig (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 50 und Blatt 51). Die nächste Befahrung erfolgte schon am 30. August 1808 und diesmal hielt der Geschworene für bemerkenswert, daß man zwei neue Örter bei 2¾ Lachter Teufe angeschlagen habe, eines Stunde 10,2 nach Südost (inzwischen 3 Lachter ausgelängt) und ein zweites Stunde 6,1 gegen Ost, ¾ Lachter erlängt. Hier war das Lager wieder 1 Lachter mächtig (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 71). Bis zum 25. Oktober hatte man erneut 30 Fuder Eisenstein ausgebracht und an diesem Tage vermessen lassen (40014, Nr. 236, Blatt 87). Von der Befahrung im Quartal Luciae 1808 wird berichtet, daß man ein neues Ort in Richtung Stunde 4,6 gegen Südwest betreibe, welches schon 4¼ Lachter erlängt sei (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 93).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses Ort betrieb man auch Reminiscere 1809 weiter und hatte damit nun 5½ Lachter Länge erreicht (40014, Nr. 236, Blatt 103). Bis zum 15. März 1809 hatte man erneut 30 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen, die vom Geschworenen „zu 1 Th pro Fuder taxirt“ worden sind (40014, Nr. 236, Blatt 126). Vom Quartal Trinitatis 1809 fand der Geschworene nichts bedeutsames zu berichten (40014, Nr. 236, Blatt 139). Im Juni 1809 dagegen notierte Herr Schmiedel, man treibe nun ein „Stollnort Stunde 2,2 gegen Süd in gebrächem Gneise nach einem vorliegenden Eisensteinlager (...), ist jetzt 6¼ Lachter fortgebracht, im letzten aufgefahrenen Lachter hat man sohlweise schon einige lose Stücke Eisenstein getroffen“ (40014, Nr. 236, Blatt 152). Das ist wirklich neu: Die erste der kleinen Eigenlehnergruben, die in langfristigerem Denken an zukünftige Wetter- und Wasserlösung denkt ‒ und vielleicht auch darauf hofft, daß man so in Tiefen gelangen könnte, wo die Alten der Grundwasser wegen noch nicht hingekommen sind... Am 14. Juli gab es für Herrn Schmiedel demgegenüber aber noch nicht wieder Neues zu berichten und am 20. Juli 1809 wurden bei Friedlich Vertrag Fdgr. 10 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 236, Blatt 163 und Rückseite Blatt 165). Weitaus ausführlicher ist dagegen der im Haushaltsprotokoll des Bergamtes vom 29. Juli 1809 wiedergegebene Bericht über eine oberbergamtliche Befahrung, die offenbar auch wieder stattgefunden hat (40014, Nr. 86, Blatt 6). Darin heißt es, daß derzeit 3 Mann angelegt seien, welche „unter gänzlicher Einstellung der in der commissarischen Befahrungsregistratur vom 7. September 1807 beschriebenen Baue seit vorigem Quartal einen Stolln herangeholt (haben), welcher bereits 8¾ Lachter gegen Mittag Morgen erlängt ist. Da man mit dem Stolln bey Erreichung des Eisensteinlagers in älteren Bau gerathen, welcher vorzüglich in der oberen festen Schicht des Lagers verführt worden ist, so ist man mit dem Stollnort von 7 Lachter Länge ½ Lachter niedergesprungen und ist dadurch, ohne vom Wasser behindert zu werden, in die unter der festen Schicht gelegene und nicht abgebaute Sandschicht gekommen. in welcher man nunmehr gegen Mittag Morgen, zugleich eines in der entgegengesetzten Richtung, beyde nämlich Stunde 9,3 nach dem Streichen... betreibt. Jedes Ort ist ¾ Lachter hoch und mit 1 Mann belegt. Die besagte Sandschicht des Eisensteinlagers liefert zwar nicht ganz so guten und reinen Eisenstein als die darüberliegende, feste Schicht, indessen besteht solche doch auch außer einem sandigen Eisenocker, Quarz und Hornstein, aus ziemlich vielem, dichten Brauneisenstein, der einen leichteren Gang im Hohofen macht und daher immer einen guten Absatz findet. Besagte Sandschicht ist ½ bis 1 Elle mächtig. Unter so benannten Umständen haben die fahrenden Beamten für den Fall, daß der hiesige Bau einen längeren Fortgang gewinnt, die Arbeiter angewiesen, die jetzt angenommene, tiefere Stollnsohle bis an den Tag hinauszubringen, das Hauptstollnort unverändert nach dem Streichen zu treiben und von solchem aus das Lager mittelst Flügelörtern und Pfeilerbau regulär abzubauen.“ Unterzeichnet ist diese Abschrift von ,Bergamts- Actuar' Scheuchler in Freiberg. Eine weitere Befahrung im Quartal Crucis durch den Geschworenen erfolgte am 21. September 1809, über die Herr Schmiedel notierte (40014, Nr. 236, Blatt 185f): Friedlich Vertrag Fundgrube daselbst. „Das Gebäude ist mit 3 Mann, als 2 Häuern und 1 Jungen, belegt, durch welche erstens das Stollnort auf einem Stunde 8,5 streichenden, 22 Grad gegen Nord fallenden Eisensteinlager nach dem Streichen desselben gegen Morgen betrieben wird, ist nunmehr 10¼ Lachter erlängt. Sodann wird 2½ Lachter vom Stollnort zurück ½ Lachter unter der Stollnsohle ein zweites Ort auf dem Lager in Stunde 6,5 gegen West betrieben, dieses ist jetzt 1½ Lachter vom Kreutze erlängt. Der Bergjunge ist für die Ausförderung mittelst Karrnlaufens zuständig.“ Anstatt das Stollnort zur Ausrichtung zukünftiger Baue weiter in das bekannte Lager voranzubringen, hat man schon wieder ein leicht zu erreichendes, gerade überfahrenes Lager in Verhieb genommen... Bei seinen Befahrungen im Oktober 1809 fand Herr Schmiedel gegenüber dem vorbeschriebenen Stand dann erstmal wieder keine wesentlichen Änderungen vor (40014, Nr. 236, Blatt 190 und 196). Am 22. November 1809 fand der Geschworene Friedlich Vertrag Fdgr. ebenfalls mit 3 Mann belegt, durch die das Stollnort gegen Ost jetzt 11 Lachter fortgebracht war. Von Interesse ist noch, daß man im Lager neben den üblichen Bestandteilen Quarz, braunem Hornstein, gelbem und braunem, teils „ockerigem“ Eisenstein, auch dichtem Brauneisenstein, nun auch hier auf gelben Ocker aufmerksam wurde. Am gleichen Tage wurde noch die Förderung des letzten Quartals von 17 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 236, Blatt 205).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung fiel erst in das
Quartal Trinnitatis 1810 (auf den 12. April). Die
Grube war nun mit 2 Mann belegt, diese trieben das Stollnort
„auf dem Stunde 4,1 streichenden, 20° gegen Nordwest
fallenden Eisensteinlager“ weiter und
standen nun bei 12¼ Lachter Länge vom Mundloch (40014, Nr. 245, Film 0043).
Über seine Befahrung, die am 27. Juni 1810 (wie auch bei der etwa 40 Lachter von dieser westlich entfernt gelegenen Nachbargrube Kästners Hoffnung) erfolgt ist, berichtete Herr Schmiedel (40014, Nr. 245, Film 0067): Friedlich Vertrag Fundgr. daselbst Abbau eines Eisensteinlagers. „Mit den bei dieser ebenfalls eigenlehnerweise betrieben werdenden Grube anfahrenden 2 Mann, als 1 Versorger und 1 Häuer, wird bei 4 Lachter Teufe eines Tageschachtes das allhier aufsetzende, Stunde 4,1 streichende, etliche und 20 Grad gegen Mitternacht Abend fallende Eisensteinlager mittelst eines nach dem Streichen deßelben angelegten, 1 Lachter weiten und bis jetzt 2¼ Lachter gegen Mitternacht Morgen erlängten Ortes abgebauet. Besagtes Lager ist ½ Lachter mächtig und bestehet aus gelbem Ocker, lockerem Gneis, Quarz, gelbem und braunem ockerigen Eisenstein, auch dichten Brauneisenstein.“ Auch am 6. November 1810 folgte nach der Befahrung bei Kästners Hoffnung wieder eine Befahrung hier (40014, Nr. 245, Film 0115). Diesmal berichtete der Geschworene, daß durch 2 Häuer auf der Sohle des 3 Lachter tiefen Tageschachtes (war das ein neuer, denn zuvor baute man doch schon in 4 Lachtern Teufe ?) ein Ort Stunde 8,5 gegen Ost auf demselben Lager getrieben werde, das jetzt 6⅞ erlängt sei. Viel hat man auf der Eigenlehnergrube bei der geringen Belegung natürlich nicht bewirken können, und so wurden bis zum 19. November 1810 hier nur 17 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen (40014, Nr. 245, Film 0121). Im Januar 1811 befand der Geschworene erneut, daß es hier keine mitteilenswerte Veränderungen gäbe (40014, Nr. 245, Film 0141). Am 13. Februar 1811 notierte er (wieder nach seiner Befahrung bei Kästners Hoffnung), daß man nun in 3½ Lachter Teufe ein Ort Stunde 4,4 gegen Nordost im Lagerstreichen treibe, welches bis dahin 8 Lachter ausgelängt war (40014, Nr. 245, Film 0157). Und am 23. April 1811 fand er in derselben Teufe schon wieder ein neues Ort angelegt, diesmal Stunde 5,3 gegen Nordost, welches auch schon wieder 3¾ Lachter weit ausgelängt gewesen ist (40014, Nr. 245, Film 0190). Einen Schachtsicherheitspfeiler beachtete man hier wohl nicht... Immerhin hat man bei diesem allem ‒ auch hier doch, ehrlich gesagt, ziemlich planlos erscheinenden „Gewühle“ ‒ bis zum 13. Mai 1811 auch 27 Fuder und bis zum 18. Juli des Jahres nochmals 18 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen (40014, Nr. 245, Film 0197 und 0221). Bei seiner Befahrung im Quartal Crucis am 26. August 1811 fand Herr Schmiedel die Grube mit 3 Mann belegt, welche nun ein Ort in immer noch 3½ Lachter Teufe auf dem Lager, aber nun Stunde 9,5 gegen Nordwest trieben und 3 Lachter erlängt hatten (40014, Nr. 245, Film 0240). Dieses Ort wurde auch gleich mit 1 Lachter Weitung aufgefahren, was wohl heißt, daß man wieder einmal einen vernünftigen Anbruch erwischt hatte... Auch am 24. Oktober 1811 waren noch 3 Mann hier angelegt. Der Fahrbogen des Geschworenen von diesem Tage (40014, Nr. 245, Film 0261) berichtet uns, daß nun ein Ort in 4 Lachter Teufe (also einen Meter tiefer, als bisher) im Streichen des Lagers Stunde 7,2 gegen West getrieben werde und auf 4 Lachter vom Schacht erlängt sei, und ein zweites Ort Stunde 8,1 gegen Ost war 2¾ Lachter erlängt. Abbautechnisch wird es einfach nicht besser... Sodann wurden aber noch 13 Fuder Eisenstein vermessen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So wurschtelte man zunächst auch weiter und so fand auch Herr
Schmiedel am 23. Januar 1812 nichts wesentlich neues über die
Friedlich Vertrag Fundgrube zu berichten (40014, Nr. 250, Film 0011f).
Auch bei seiner nächsten Befahrung am 24. Februar 1812 war sie noch mit 3
Mann belegt (40014, Nr. 250, Film 0023). Die Belegschaft trieb in 4
Lachter Teufe weiter ein Ort im Streichen des Lagers, nun Stunde 6,3 gegen
West, das jetzt 5¾ Lachter vom Schacht ausgelängt war, und das zweite
Ort, jetzt mit Stunde 5,5 gegen Ost, war 6½ Lachter erlängt. Sodann waren
wieder 28 Fuder ausgebrachter Eisenstein im Beisein des Geschworenen
zu vermessen.
Auch am 23. April 1812 waren auf Friedlich Vertrag 3 Mann angelegt (40014, Nr. 250, Film 0043f). Diese trieben in 4 Lachter Teufe das eine Ort Stunde 6,3 gegen West weiter, wo man jetzt bei 7 Lachter vom Schacht stand, und das zweite Ort mit Stunde 5,5 gegen Ost wird jetzt mit 6¼ Lachter (das ist aber eigentlich weniger, als zuvor ?) gemessen. Über das hier abgebaute Lager schrieb Herr Schmiedel, es falle 15° bis 20° gegen Nordwest; es sei vor beiden Orten ¼ bis ¾ Lachter mächtig und es bestehe „aus mildem Gneis, Quarz, braunem Hornstein, ockerigen gelben und braunen Eisenstein, auch dichtem Brauneisenstein.“ Mit wenigen Abweichungen klingen die Beschreibungen des Eisensteinlagers hier in der Gegend alle immer ähnlich. Am 13. Mai 1812 hatte man auch wieder 15 Fuder Eisenstein ausgeklaubt und konnte sie vermessen lassen (40014, Nr. 250, Film 0053). Am gleichen Tage notierte Herr Schmiedel noch: „Sodann habe ich noch einige auf dem sogenannten Silberemmlergebirge gangbare Schurfarbeiten besehen.“ Auch hier wurde also weiter gesucht... Das Schürfen nach besseren Aufschlüssen war auch unbestritten nötig, denn am 25. Juni 1812 hielt der Geschworene in seinem Fahrbogen über Friedlich Vertrag unter anderem fest (40014, Nr. 250, Film 0068): „Von den Eigenlehnern werden bei 3 Lachtern Teufe eines neuerlich abgesunkenen Tageschachtes, auf dem hier aufsetzenden, von den Vorfahren aber schon bebauten Eisensteinlager, die von selbigen hier und da anstehen gelassenen ganzen Mittel, sowohl först- als stroßenweise vollends abgebaut.“ Oh, Mann ‒ auch hier waren die Alten schon vorher da und haben nur noch die weniger brauchbaren Reste stehengelassen... Aus einem Befahrungsprotokoll vom 8. August 1812 wurde vom damaligen Obereinfahrer Carl Amandus Kühn im Bergamt zu Annaberg vorgetragen, zurzeit wären zwei Mann hier angelegt und es herrsche wieder Wettermangel, daher ein neuer Tageschacht geteuft werden solle. Auch scheine ihm das in Abbau stehende Lager „nur begrenzt und wird solches bald gänzlich verhauen sein“ (40014, Nr. 86, Blatt 7f). Am 6. Oktober 1812 steht in Schmiedel's Fahrbogen zu Friedlich Vertrag erneut zu lesen (40014, Nr. 250, Film 0108), es werde durch die anfahrenden 2 Mann in 3½ Lachtern Teufe des Tageschachtes ein Ort Stunde 6,3 gegen Ost, „woselbst noch einige, von den Vorfahren stehen gelassene, aus Gneis, Quarz, braunem Hornstein und etwas ockerigen, auch dichten Brauneisenstein bestehende ganze Mittel, getroffen worden sind,“ betrieben, das jetzt 2½ Lachter vom Schacht fortgestellt war. Bis zum 20. Oktober waren dabei gerade einmal noch 9 Fuder und am 17. November 1812 noch einmal 7 Fuder Ausbringen an Eisenstein zu verzeichnen (40014, Nr. 250, Film 0116 und 0122). Im Übrigen aber habe sich auf der Zeche seit Oktober nichts bemerkenswertes verändert, schrieb Herr Schmiedel. Aber die Eigenlehner blieben unverdrossen bei der Sache. Am 19. Februar 1813 heißt es im Fahrbogen, Friedlich Vertrag sei mit 2 Mann belegt, durch die bei 4 Lachtern Teufe „des vor kurzem abgesunkenen Tageschachtes auf dem daselbst ersunkenen Eisensteinlager“ zum einen ein Ort Stunde 2,2 gegen Nord, jetzt 5¼ Lachter ausgelängt, und ein zweites Stunde 11,6 gegen Mittag jetzt 2¾ Lachter weit, betrieben werde. Das hier angetroffene Eisensteinlager sei bis zu 1 Lachter mächtig und die Zusammensetzung gleiche dem vorigen, „jedoch stehen die Anbrüche vor ersterem Orte von besserer Beschaffenheit als vor letzterem an.“ (40014, Nr. 251, Film 0020f) Tatsächlich wurden bis zum 24. März 1813 wieder 29 Fuder ausgebracht und vermessen (40014, Nr. 251, Film 0031). So ging es weiter und Herr Schmiedel fand am 13. April und am 17. Mai 1813 alles wie zuvor vor (40014, Nr. 251, Film 0080). Am 29. Juli 1813 notierte er dann, daß man nun in 3 Lachtern Teufe des Tageschachtes das „von den Vorfahren in dieser Gegend schon mehrentheils abgebaute Eisensteinlager, da, wo selbige noch einige ganze Mittel anstehen gelassen haben, vollends abbauet.“ Ist das nun Pech ? Sie hatten schon wieder in alten Mann eingeschlagen... Damit fuhr man aber auch während der nächsten Befahrung durch den Geschworenen am 23. September 1813 fort und hat dabei immerhin bis zum 20. Oktober des Jahres wieder 20 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 251, Film 0099 und 0103).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch am 18. Januar 1814 stand die kleine Grube in
Betrieb und war nach wie vor mit 2 Mann belegt. Von dieser Befahrung
berichtete Herr Schmiedel, man baue jetzt in 5 Lachtern Teufe des
Tageschachts auf einem Ort Stunde 3,3 gegen Südwest, welches inzwischen 4½
Lachter lang sei (40014, Nr. 252, Film 0008).
Am 13. April fand er die Grube wieder einmal unbelegt (40014, Nr. 252, Film 0034). Trotz aller widrigen Verhältnisse waren am 28. Juni aber wieder 35 Fuder zu vermessen (40014, Nr. 252, Film 0053). Auch am 28. Juni 1814 waren auf Friedlich Vertrag 2 Mann angelegt. Das Ort in 5 Lachtern Teufe des Tageschachts war auf Stunde 3,3 gegen Südwest verschwenkt, dabei aber bei 1 Lachter Weitung nun schon 8¼ Lachter lang (40014, Nr. 252, Film 0056). Wenn man mit ,Weitung' fuhr, hatte man offenbar wieder eine bauwürdige Linse angefahren. Bei seiner Befahrung am 2. November 1814 befand Herr Schmiedel, daß die anfahrenden zwei Mann nun in 4 Lachtern Teufe des Tageschachts ein Ort „mit abfallender Sohle“ Stunde 6,7 gegen West auffuhren, das jetzt 4¼ Lachter erlängt sei (40014, Nr. 252, Film 0091f). Am 10. April 1815 war der Geschworene dann wieder vor Ort, um die dabei ausgebrachten 21 Fuder Eisenstein vermessen zu lassen (40014, Nr. 254, Film 0032). Die nächste „turnusmäßige“ Befahrung im Quartal Trinitatis 1815 am 8. Juni mußte allerdings ausfallen, denn die Grube „konnte wegen eingetretenem Wettermangel nicht befahren werden.“ (40014, Nr. 254, Film 0050) Man liest aber auch nie etwas von Bewetterung... In den selten mehr als 15 m unter der Oberfläche bauenden Gruben, die bislang sämtlich keine Wasser- und Wetterlösestolln besaßen, sondern stets wieder abgeworfen worden sind, wenn das gerade getroffene Erzmittel abgebaut war, konnte das ja auch nicht richtig funktionieren. Der auch später noch oft vermerkte Wettermangel in diesen Gruben war einfach durch schlechte Abbauführung selbst bewirkt. Das nächste Mal war der Geschworene am 20. Juli 1815 dort, konnte offenbar auch einfahren, ohne jedoch dabei etwas neues vorzufinden. Außerdem wurden an diesem Tage wieder 13 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 254, Film 0061). Von seiner Befahrung am 26. September 1815 berichtete Herr Schmiedel denn auch, es werde „anjetzo ein neuer Tageschacht niedergebracht“, und man habe ihn schon 3½ Lachter geteuft (40014, Nr. 254, Film 0081). Das hatte offenbar auch wieder den üblichen Erfolg, denn am 1. November 1815 notierte er, es werde nun „das allhier und auf mehreren in dieser Gegend gelegenen Gruben sehr bekannte, gemeiniglich bei 4 bis 5 Lachter Teufe unter Tage aufsetzende Eisensteinlager mittels eines aus dem Tageschachte Stunde 6,6 gegen Abend betrieben werdenden und zur Zeit 3 Lachter erlängten Ortes abgebaut.“ Auch wurden wieder 13 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 254, Film 0092). Bei der nächsten Befahrung am 6. Dezember 1815 fand der Geschworene dann auch ernsthafte technische Mängel zu beanstanden (40014, Nr. 254, Film 0092): Hier „wurde zwar seit meiner kürzlich hier gehaltenen Befahrung etwas veränderliches nicht befunden, jedoch aber dem Lehnträger aufgegeben, den bereits 4½ Lachter tiefen und ohne die mindeste Zimmerung versehenen Tageschacht zu Vermeidung aller besorglichen Brüche ohne Verzug sofort auszuzimmern.“ Neun Meter Tiefe ohne jeden Verbau ? Sehr mutig... Und das Einschreiten des Bergbeamten ist nur zu verständlich. Die Eigenlehner scheinen die Anweisung aber befolgt zu haben, denn bei der nächsten Befahrung am 26. Februar 1816 ist von dem Zustand des Schachtes keine Rede mehr im Fahrbogen. Stattdessen wird durch die anfahrenden 2 Mann nun in 5 Lachter Teufe ein Ort Stunde 8,2 gegen Abend bei 8¼ Lachter Erlängung und ein zweites Ort Stunde 6,3 gegen Morgen mit 5½ Lachter Erlängung betrieben (40014, Nr. 257, Film 0018). Ungefähr denselben Zustand fand der Geschworene auch bei seiner Befahrung am 6. Mai 1816 vor (40014, Nr. 257, Film 0039). Am 4. Juli 1816 waren dann wieder 27 Fuder Eisenstein ausgebracht und zu vermessen (40014, Nr. 257, Film 0056). Am 8. Juli 1816 fand Herr Schmiedel in 4½ Lachter Teufe (also rund einen Meter höher) nur noch ein Ort Stunde 7,4 gegen Abend in Betrieb und 4 Lachter erlängt (40014, Nr. 257, Film 0057). Bei seiner Befahrung am 9. Oktober 1816 hatte man in jetzt nur noch 4 Lachter Teufe mit Ort gegen Mittag Abend getrieben und bei 6 Lachter Erlängung doch schon wieder alten Mann angefahren (40014, Nr. 257, Film 0088). Es werden hier jetzt noch „einige von den Vorfahren stehen gelassene, aus Gneus, braunem Hornstein und nesterweise einbrechendem dichten Braunseisenstein bestehende Förstenmittel ausgehauen.“ Im Folgejahr besteht erneut eine Lücke in den Fahrbögen zur Friedlich Vertrag Fundgrube. Erst am 28. Juli 1817 hielt Herr Schmiedel fest, es seien dort wieder 28 Fuder Eisenstein zu vermessen gewesen (40014, Nr. 258, Film 0068) und am 10. September 1817 notierte er, daß neben Reppels Fundgrube auch Friedlich Vertrag „wegen Mangel an Eisenstein Abnahme“ unbelegt sei (40014, Nr. 258, Film 0081). Am 13. Oktober 1817 war die Grube aber wieder umgängig und es werde jetzt bei 4 Lachter Teufe ein Ort Stunde 10,6 gegen Mittag getrieben und sei 4 Lachter erlängt. Außerdem waren noch einmal 10 Fuder zu vermessen (40014, Nr. 258, Film 0088).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Ort fand Herr Schmiedel auch
bei seiner Befahrung am 8. Januar 1818 in Betrieb, es war in Richtung
Stunde 9,5 verschwenkt und jetzt 5½ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 259, Film 0002).
Im April dieses Jahres hatte man es bis auf 7½ Lachter Länge fortgestellt (40014, Nr. 259, Film 0032).
Dann scheint an diesem Punkt auch schon wieder Schluß gewesen zu sein, denn nach seiner nächsten Befahrung dieser Grube am 2. März 1819 hielt Herr Schmiedel fest, es werde ein neuer Tageschacht niedergebracht (40014, Nr. 261, Film 0019). Der Schacht war auf 4¼ Lachter Teufe abgesenkt und hatte bei 3¾ Lachtern das Lager erreicht. Außerdem hatte der Geschworene Anlaß zu folgender Veranstaltung: „Da dieser Tageschacht noch gar nicht mit Holz versehen ist, das milde Gestein aber ohne solchem nicht stehet, so wurde dem Lehnträger aufgegeben, selbigen ohne Anstandt mit der nöthigen Zimmerung zu verwahren.“ Die Eigenlehner hatten schon manchmal sehr viel Gottvertrauen bei ihrer Arbeit oder einfach nicht das nötige Kleingeld in der Portokasse, um Schachtholz zu kaufen... Dann wechselte der Lehnträger. In der Eintragung im Lehnbuch unter dem 26. Mai 1819 heißt es, daß dem Muter Karl August Vulturius zu Raschau, in der Person des von denselben hierzu beauftragten Geschworenen, die „seit ohngefähr 1½ Jahren im Freyen liegende gev. Fdgr. Friedlich Vertrag zu Schwarzbach auf des Begütherten Meiers Grund... an der östlichen Seite von Kästners Hoffnung... bestätigt und in Lehn gereicht“ worden ist (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 286). An der genannten Dauer, in der sie im Freien lag, kann etwas nicht stimmen, denn sie stand ja im März desselben Jahres noch in Umgang... Jedenfalls waren am 9. September 1819 auf Friedlich Vertrag 30 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 261, Film 0077) ‒ das war natürlich auch nicht die Menge, von der man reich wird. Man scheint auch wieder einen guten Anbruch angefahren zu haben, denn von der Befahrung am 22. September berichtete der Geschworene, daß man nun in 6 Lachter Teufe ein Ort „mit ¾ Lachter Weitung Stunde 3,6 gegen Morgen“ betrieb, das 4½ Lachter Länge erreicht hatte (40014, Nr. 261, Film 0081). Beim Verwiegetag am 10. Februar 1820 war Friedlich Vertrag nicht aufgeführt. Und am 11. April 1820 notierte Herr Schmiedel, er habe die Grube „wegen Mangel an Eisenstein Abnahme“ unbelegt befunden (40014, Nr. 262, Film 0032). Erst am 17. Oktober 1820 fand der Geschworene die Grube wieder mit zwei Mann belegt und in Umgang vor (40014, Nr. 262, Film 0088). Er notierte in seinem Fahrbogen, man betreibe in nunmehr 4 Lachter Teufe ein Ort „mit 1 Lachter Weitung gegen Morgen“ und hatte es bereits 7½ Lachter erlängt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim ersten Verwiegetag im neuen Jahr
am 6. Februar 1821 gab es auf Friedlich Vertrag noch nichts wieder
zu verwiegen, aber Herr Schmiedel befuhr die Grube am gleichen Tag
und berichtete darüber (40014, Nr. 264, Film 0015f):
„Sodann habe ich nachstehende Gruben befahren, als:“ a) Friedlich Vertrag bey Schwarzbach. „In 4½ Lachter Teufe des Fundschachtes, woselbst das allhier aufsetzende Lager ersunken worden, wird auf solchem mit 2 Mann ein Ort gegen Mittag Morgen getrieben, dessen Erlängung von besagtem Schacht 9 Lachter beträgt. Das Lager vor selbigem ist ¾ Lachter mächtig, fällt ohngefähr 15 Grad gegen Mitternacht und besteht aus gelbem Ocker, mildem Gneus, braunem Hornstein, ockerigen und dichten Brauneisenstein.“ So blieb es auch im ersten Quartal und bei seinen nächsten Befahrungen am 20. März des Jahres (40014, Nr. 264, Film 0030) sowie am 12. April 1821 (40014, Nr. 264, Film 0038) fand der Geschworene im Grubenbetrieb keine bemerkenswerte Veränderung vor. Dafür konnten hier am 30. April 50 Fuder Eisenstein vermessen werden (40014, Nr. 264, Film 0044). Danach scheint man sich aber auf ein neues Ort verlegt zu haben, denn der Geschworene berichtete von seiner Befahrung am 28. August 1821, es werde nun ein Ort in 4 Lachtern Teufe gegen Abend betrieben, welches 8 Lachter ausgelängt sei (40014, Nr. 264, Film 0086). Bei seiner nächsten Befahrung der Grube fand Herr Schmiedel dann schon wieder ein neues Ort, nun in 5 Lachter Teufe und Stunde 5,5 gegen Abend, in Betrieb vor, das bei ¾ Lachter Weitung 9⅜ Lachter erlängt worden ist (40014, Nr. 264, Film 0116f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 18. April 1822 war wieder
Befahrungstermin bei Friedlich Vertrag Fundgrube. Herr Schmiedel
notierte in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 265, Film 0040f),
man betreibe jetzt bei nur noch
3½ Lachter Teufe ein Ort Stunde 6,1 gegen Morgen, das 6 Lachter ausgelängt
war, sowie ein zweites Stunde 4,4 gegen Abend, welches 4½ Lachter lang
gewesen ist.
Bei der Befahrung am 8. Oktober 1822 fand der Geschworene in 4 Lachter Teufe ein Ort Stunde 5,5 gegen SW 6¼ Lachter ausgelängt vor (40014, Nr. 265, Film 0070). Im Dezember 1822 löste dann Herr Johann August Karl Gebler Herrn Schmiedel in seiner Funktion ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue Berggeschworene befuhr die Friedlich Vertrag Fundgrube das erste Mal am 1. April 1823 und notierte darüber (40014, Nr. 267, Film 0030): „Gleichen Tages gefahren auf Friedlicher Vertrag daselbst, belegt mit
Fand herum um einen 8 Lachter tiefen, in hinlänglicher Zimmerung stehenden Schacht mehrere bey 2 und 3 Lachter Entfernung von demselben von dem Eigenlöhner eine Anzahl Versuche durch Abteufen in mancherley Richtungen und in verschiedenen Sohlen unter Gewinnung von (?) beybrechenden Nestern (?) von braunem Eisenstein verführt, so daß der Schacht in der Mitte und höher liegt, auch das ganze von einem höhlerartigen Bau in mancherley Windungen und Richtungen gleicht, worauf dieses Verfahren noch einige Zeit bey einiger weiterer Ausbreitung und Erweiterung dieser Höhler das weitere Niederbringen des Schachtes von selbst zur Folge hat; der (?) Wetterwechsel aber wird diesen Bauen durch einen in der Nähe liegenden zweyten Schacht, der mit den obern Bauen in Verbindung steht, unterhalten. Die (unleserlich…?) in der Art des Betriebes und des Abbaus, die solche Bebauung der vielen Eisensteinzechen dieses Reviers aufstellen, kann in Ansehung des oft ganz auffallenden (?) gegen das gewöhnliche (?) Aufmerksamkeit und (?) aber nicht Mißbilligung erregen und man ist (?) genöthigt, nach nur einigermaßen erfolgter (?) der Umstände, die erwähnte Methode wie hier, zweckmäßig zu finden.“ Ein ,höhlerartige Bau in mancherley Windungen' ‒ die Vorstellung haben wir nach den hierüber gelesenen Beschreibungen in den Fahrbögen der Geschworenen von den Eigenlöhnerzechen dieser Zeit auch... Ob man das für zweckmäßig halten kann, ist eine andere Frage. Eine zweite Grubenbefahrung durch Herrn Gebler fand am 11. September 1823 statt (40014, Nr. 267, Film 0063f). Die Belegung hatte sich nicht verändert. Von Interesse erscheinen uns insbesondere seine Bemerkungen zur Wetterlösung in diesem Fahrbogen: „Da die gegenwärtige Sommerwitterung, welche in der Regel sämtliche bey Schwarzbach und Langenberg bauende Eisensteingruben hinsichtlich des erforderlichen Wetterzuges mehr und weniger nachtheilig wird, und mehrere davon oft viele Wochen lang gar nicht zum Betriebe kommen läßt, auch für dieses Gebäude höchst nachtheilige Folgen hervorgebracht hatte, so war der Eigenlöhner nicht im Stande, seine Eisensteinbaue, welche sich um den in der St. 2,5 angelegten und mit einem anderen, etwa 3 Lachter weiter gegen Abend davon gelagerten, zweyten in Verbindung stehenden Getriebe, einige Lachter vom Schachte entfernt und noch 3 Lachter tiefer als die Schachtsohle niedergebracht befinden, zu betreiben, ja nicht einmal zu befahren. Um diesem Übel etwas abzuhelfen, hatte derselbe in einer Entfernung von ohngefähr 8 Lachter vom Schacht einen offenen Graben und Tagebruch (...?) angefangen, diesen durch Forttreiben auf 5 Lachter Länge in die Nähe seiner Abbaue und deren Förste gebracht, in der Hoffnung, der Grube Wetter zuzuführen. Inzwischen zeigte sich die (...?) hier eintretende Schwierigkeit auch bey diesem kleinen und ganz unbedeutenden Baue, indem, da der Eigenlöhner bey ohngefähr 4 Lachter ein Trum Eisenstein angetroffen und denselben nach Mitternacht zu ohngefähr 1 Lachter ortweise nachgegangen war, auch hier die erforderlichen Wetter zu fehlen anfingen und eine Woche solcher Witterung schon einmal unverrichteter Sache abgehen müssen, ohne das angefahrene, kleine, aus schönem dichtem Brauneisenstein bestehende Lager besichtigen zu können. Heute unterdessen hatte sich der Wetterwechsel verbessert und daher war dieser Bau zu befahren.“ Noch einmal befuhr der Geschworene diese Grube am 11. November 1823 und berichtete knapp darüber (40014, Nr. 267, Film 0075): „Der Betrieb des im vorigen Quartal angefangenen kleinen Stöllchens und des damit erlangten Eisensteingewinnungsbaus hat man in diesem Quartale durch Ausbreiten nach beyden Weltgegenden, Mittag und Mitternacht, fortgesetzt, ohne bisher mit dem mittäglichen Orte in den Tageschacht zu erschlagen (einzuschlagen), was aber nach und nach geschehen wird.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über seine nächste Befahrung der Grube
im neuen Jahr heißt es im Fahrbogen (40014,
Nr. 271, Film 0004):
„Freytags, den 16ten Januar befahren das Grubengebäude Friedlich Vertrag im Tännicht bey Schwarzbach. Belegt mit
Um den Tageschacht mit den (...?) tiefer liegenden Abbauen in die nothwendige Verbindung zu bringen, hat man hier wiederum angefangen abzuteufen, hat den Schacht zur Zeit 1 Ltr. tief niedergebracht und mit demselben schönen Brauneisenstein angetroffen.“ Bei seiner Grubenbefahrung am 14. Mai 1824 fand Herr Gebler den neuen Tageschacht auf 11 Lachter verteuft und dort nach Nordost und Nordwest zwei parallel laufende Örter, von bisher erst wenigen Lachtern Länge, zur Untersuchung des Lagers getrieben vor, wobei man schönen dichten Brauneisenstein angetroffen habe (40014, Nr. 271, Film 0031). Hinsichtlich der anfahrenden Mannschaft hatte sich bis zur Befahrung am 20. Juli 1824 nichts verändert (40014, Nr. 271, Film 0047f). Allerdings beklagte man wieder Wettermangel: „Zur Fortsetzung der Eisensteingewinnung bey den erwähnten, jetzt eingetretenen Wettermangel, betreibt der Eigenlöhner, so oft sich dergleichen Schwierigkeiten entgegenstellen, theils das ohnweit des Schachtes in dem vorigen Jahr aus ähnlicher Ursache angelegte Röschenörtchen zu Erlangung mehrer Wetterwechsels, zugleich aber auch die mit demselben durch damalige Entdeckung von Eisenstein erlangten Eisensteinabbaue.“ Am 10. August des Jahres (40014, Nr. 271, Film 0053) waren „die Grubengebäude Friedlicher Vertrag im Tännicht und Christbescherung bey Langenberg wegen totalen Wettermangels nicht zu befahren.“ Trotz dieser Schwierigkeiten war ein nicht unbeträchtliches Ausbringen zu verzeichnen und zwar hatte Herr Gebler auf dieser Grube am 14. Oktober 35 Fuder und am 16. Oktober 1824 noch einmal 20 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 271, Film 0063). Am 2. November waren weitere 35 Fuder ausgebracht (40014, Nr. 271, Film 0065) und am 1. Dezember des Jahres standen erneut 35 Fuder Eisenstein zum Vermessen an (40014, Nr. 271, Film 0073).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang des Folgejahres konnte der
Geschworene die Grube erstmal gar nicht befahren,
weil das Tiefste „einige Ellen hoch“ abgesoffen war. Ansonsten
hielt Herr Gebler in seinem Fahrbogen vom 20. Januar 1825 zu dieser
Grube noch fest (40014,
Nr. 273, Film 0009): „Die
in der obern Teufe mittels eines am Abhange des Gebirges vom Tage herein
getriebenen kleinen Stollns und der von ihm aus nach dem Schachte zu
angelegten und demselben ganz nahe gebrachten Gewinnungsbaue sucht man
nunmehr mit dem Schachte zu Erlangung nöthiger Wetterlösung für diejenigen
Zeiten, wo es an solchen mangelt, durchschlägig zu machen.“ Bis zum 20. Juli 1825 waren diesmal nur 15 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 273, Film 0049). Auch weitere Befahrungen durch den Geschworenen fanden in diesem Jahr nicht statt. Auch im folgenden Jahr 1826 wird die Grube Friedlicher Vertrag nur ein einziges Mal in den Fahrbögen erwähnt und zwar am 2. Mai 1826, als Herr Gebler hier 25 Fuder Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 275, Film 0041). Am 5. Oktober 1827 hatte der Geschworene hier wieder 25 Fuder ausgebrachten Eisensteins zu vermessen (40014, Nr. 278, Film 0075). Befahrungsberichte zu Friedlich Vertrag Fdgr. aus diesem Jahr gibt es nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vielleicht hing es tatsächlich mit
der schon bei Friedrich Fundgrube erwähnten Entdeckung eines Blei-,
Zink- und Silbererz führenden
Vom 14. Mai 1829 gibt es dann wieder einen neuen Befahrungsbericht des Geschworenen (40014, Nr. 280, Film 0137f), worin es heißt, man betreibe Eisensteinabbau in 12 Lachtern Teufe „um den Tageschacht herum.“ Die Anbrüche bestünden aus ziemlich gutem Brauneisenstein, Mulm und Hornstein. Der Wetterwechsel werde über die ‒ nun offenbar durchschlägig gewordene ‒ Tagerösche erreicht, auf der ebenfalls Gewinnung von Eisenstein erfolgte. Für besseren Wetterwechsel und zu weiterer Untersuchung des Lagers hatte man außerdem angefangen, 9 Lachter vom zeitherigen nach Nordwest entfernt einen neuen Schacht abzusenken. Mit diesem Schacht war man bis zur zweiten Befahrung am 8. Juli 1829 auf 6 Lachter Teufe niedergekommen und suchte nun mit jenem „Communication zu erlangen.“ (40014, Nr. 280, Film 0149) Außerdem war Herr Gebler auch 1829 noch fünfmal vor Ort, um den hier ausgebrachten Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0145, 0159, 0175, 0179 und 0185). Dessen Menge belief sich in diesem Jahr auf insgesamt 185 Fuder, womit man die Förderung des Vorjahres noch einmal deutlich übertraf. Aus dem folgenden Jahr 1830 gibt es einen weiteren Fahrbericht vom 11. September (40014, Nr. 280, Film 0258), aus dem wir erfahren, daß die Grube zu diesem Zeitpunkt mit dem Lehnträger, einem Häuer sowie einem Grubenjungen, respektive mit 3 Mann belegt war und: „die hier befindlichen Eisensteinbaue befinden sich sämmtlich rund um den eigentlich 12 Ltr. tiefen zweyten oder unteren Tageschacht und von diesem aus nach dem oberen oder alten sich fortziehend und auch um diesen schon bey einer Teufe von 8 Ltr. gelagert und bestehen aus einer Menge nach allen Richtungen und Längen sich breitende, steigende und fallende Räume, in welchem die angetroffenen Nieren Eisenstein – sehr guter Beschaffenheit – hierzu die Veranlassung gegeben haben.“ Bei seiner Anwesenheit am 19. Oktober 1830 hat Herr Gebler „die Eigenlöhner abwesend gefunden.“ (40014, Nr. 280, Film 0267) Die haben vielleicht schon gefeiert. Nachdem der Geschworene in diesem Jahr an vier Tagen (40014, Nr. 280, Film 0235, 0259 und 0270) den ausgebrachten Eisenstein vermessen hatte, war eine Gesamtförderung von 207 Fudern in diesem Jahr zusammengekommen. Dies war nun für das kleine Revier und die winzige Belegschaft schon eine ziemlich bedeutende Menge.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem folgenden Jahr 1831 findet man
in den Fahrbögen des Berggeschworenen keine Einträge über
Grubenbefahrungen auf Friedlich Vertrag Fdgr. Herr Gebler
war jedoch insgesamt viermal hier, um den ausgebrachten Eisenstein zu
vermessen (40014,
Nr. 281, Film 0028, 0030, 0049 und 0067).
Die Gesamtförderung des Vorjahres wurde mit diesmal 241 Fudern erneut
übertroffen. Einen Fahrbericht gibt es erst wieder vom 19. März des Jahres 1832 (40014, Nr. 281, Film 0104f). Dem ist zu entnehmen, daß inzwischen auf der Grube 4 Mann angelegt waren. Weiter schrieb Herr Gebler darin: „Aus meinen früheren Beschreibungen ist bekannt, daß das Lager, das man hier abbaut, aus einer Menge größerer und kleinerer Nester besteht, welche nur durch schwache Verbindung aneinander gereiht hier vorkommen und so abgebaut werden, daß man sie nach dieser Anleitung kommunikal macht und sowohl nach Länge und Breite als nach Höhe und Teufe, jedoch ohne dabey Regelmäßigkeit in Acht nehmen zu können, miteinander in Verbindung bringt. Das Ganze nimmt also das Ansehen von einem Stück Bimsstein (...?) großem Format an. Von den beyden hier vorhandenen Schächten ist der eine 12, der andere 14 Ltr. tief. Die Baue, so um beyde herum gelagert sich befinden, sollen anjetzt mit einander durchschlägig gemacht werden, indem man von dem ersteren, nahe am Abhang des Gebirges und weiter gegen Morgen gelegenen ein Ort nach dem tieferen hin, also flachgangweise treibt. Der hier vorkommende Brauneisenstein ist vorzüglich gut und brauchbar.“ Außerdem war der Geschworene am 11. und 12. Mai 1832 hier, um insgesamt 187 Fuder zu vermessen (40014, Nr. 281, Film 0118). Im zweiten Halbjahr ging die Förderung offenbar stark zurück, denn bis zum 6. Dezember 1832 waren nur noch einmal 40 Fuder Eisenstein zum Vermessen bereit (40014, Nr. 281, Film 0158). Mit in Summe 227 Fudern war man aber immer noch in der Größenordnung der Vorjahre geblieben. Während die oben für das Jahr 1831 angegebene Zahl mit der Angabe in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) übereinstimmt, sind in dieser Quelle für 1832 nur 177 Fuder Ausbringen angeführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus dem Jahr 1833 gibt es nur einen
einzigen Fahrbogen, in dem diese Grube genannt ist (40014,
Nr. 281, Film 0170)
und worin es heißt: „Desselben Tages (am 26. Februar 1833) bin ich
gefahren auf der Eigenlöhner Grube Gelber Zweig zu Langenberg...
ingleichen auf Friedlicher Vertrag im Tännicht bey Schwarzbach, belegt mit
habe aber auf beyden wenig bemerkenswerthes, vielmehr alles noch in dem schon mehrmals beschriebenen Zustande angetroffen.“ Zur Grube Friedlicher Vertrag heißt es noch insbesondere: „Auf der zweyten, dem Friedlichen Vertrage, sind die Anbrüche von vorzüglicher Güte und liegt von denselben wiederum ein ansehnliches Quantum Eisenstein zum Verkauf und zum Vermessen bereit.“ Das ,ansehnliche Quantum' summierte sich, nachdem Herr Gebler dreimal zum Vermessen des Eisenstein auf der Grube gewesen ist, in diesem Jahr auf 137 Fuder. Im Sommer des folgenden Jahres kam es hier zu Feldstreitigkeiten mit der Nachbargrube, worüber man im Fahrbogen unter dem 4. Juli 1834 lesen kann (40014, Nr. 289, Film 0038), Herr Gebler habe an jenem Tage „zwischen den Grubengebäuden Friedlicher Vertrag und Kästners Hoffnung gev. Fdgr. die Markscheide bestimmt und einen Theil des erstgenannter Grube zugehörigen Feldes gelegt und solche vorläufig durch Pfähle bestimmt.“ Am 31. Juli wäre wieder eine Grubenbefahrung an der Reihe gewesen, die jedoch ausgefallen mußte: Herr Gebler hatte sich an diesem Tage „auf verschiedene der übrigen Eigenlöhnerzehen der dortigen Gegend begeben, dieselben aber theils unbelegt, theils ohne Anwesenheit der Eigenlöhner getroffen,“ darunter auch bei Friedlicher Vertrag (40014, Nr. 289, Film 0042). Noch einmal war der Geschworene am 3. August auf der Grube, konnte dabei aber „bei den beyden zunächst liegenden Grubengebäuden Friedlicher Vertrag und Kästners Hoffnung... keine Veränderung wahrnehmen.“ (40014, Nr. 289, Film 0048) Das verwundert uns nun ein wenig, denn der Geschworene war in diesem Jahr darüber hinaus noch zweimal zugegen, um dabei eine Gesamtförderung von 230 Fudern ausgebrachten Eisensteins zu vermessen, was nun tatsächlich für diese Grube wieder einen Spitzenwert darstellt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Feldstreitigkeiten waren allerdings
noch nicht ausgeräumt und so mußte sich der Geschworene am 12. März 1835 erneut
„in den Tännicht begeben und mittelst Untersuchung der zwischen den
Grubengebäuden Friedlicher Vertrag und Kästners Hoffnung bestehenden
Markscheide die zwischen den beyden Eigenlöhnern besagter Gebäude
obbeschwerte Differenzen und Beschwernisse zu beseitigen, was endlich nach
gütlichem Zureden erfolgte, wobey ich zugleich das beyden zugehörige Feld
in Bezug auf das baldige Setzen der so sehr erforderlichen Lochsteine
vermessen und gelegt habe.“ (40014,
Nr. 289, Film 0080)
Herr Gebler benötigte aber noch zwei weitere Tage, bis er dann am 10. April 1835 das Vermessen beendet und die Lochsteine gesetzt hatte (40014, Nr. 289, Film 0081 und 0082). Aha, das mußte ein Geschworener also auch selber tun... Und die Nachbarn kamen nicht zur Ruhe: Am 17. November 1835 ist Herr Gebler erneut „auf Kästners Hoffnung gefahren, um auf Verlangen des hier bauenden und wegen durch seinen Nachbar, Stgr. (Walther?) vom Friedlichen Vertrag Fdgr. aus möglichen Verletzung der Markscheide besorgten Eigenlöhners Distler ohngefähre Untersuchung derselben vorzunehmen. Nachdem solches von mir geschehen, habe ich die Partheyen zurechtgewiesen und zu Verträglichkeit ermahnet, mit dem Bedenken, bey Fortdauer der Beschwerden die Lage der Sache Eu. Königl. Bergamte vorzutragen und demselben nach vorgängiger Untersuchung der Markscheide durch den Herrn Markscheider der Revier, die Entscheidung zu überlassen.“ (40014, Nr. 289, Film 0128) Am 21. Juli 1835 hat der Geschworene außerdem wieder einen ganzen Tag benötigt, um die bis dahin ausgebrachte Menge von 153 Fudern Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 289, Film 0106). Fahrberichte zum Grubenbetrieb findet man in den Fahrbögen auch im Jahr 1835 leider wieder nicht. Stattdessen erfolgte noch einmal am 5. Dezember 1835 ein Fahrbogenvortrag in Annaberg, wobei Herr Gebler berichtete, es gäbe (schon wieder oder immer noch ?) Differenzen zwischen den Eigenlöhnern Distler von Kästners Hoffnung und Vulturius von Friedlich Vertrag Fdgr. wegen vermeintlichen Überbaus im Felde des jeweils anderen (40014, Nr. 86, Blatt 8f). Das Bergamt beauftragte daraufhin nun den Markscheider Friedrich August Strödel, einen Riß über die Gruben am Tännicht zu fertigen. Außerdem wies man Herrn Gebler an, er solle doch die Eigenlöhner veranlassen, den klaren Eisenstein, „der zeither auf Halde gestürzt wurde, zur Schmelzwürdigkeit zu bringen und an die Hammerherren zu verkaufen.“ Nicht anders verlief das Jahr 1836: Herr Gebler war nur zweimal auf der Grube zugegen, um insgesamt 163 Fuder des ausgebrachten Eisensteins zu vermessen (40014, Nr. 289, Film 0186 und 0229). Auch 1837 gibt es nur zwei Vermerke zu dieser Grube in den Fahrbögen des Geschworenen, der am 3. Mai und am 26. September den hier ausgebrachten Eisenstein vermessen hat, dessen Menge sich in diesem Jahr auf 202 Fuder summierte (40014, Nr. 294, Film 0036 und 0068). Der Streit um die Feldverletzungen untereinander hörte aber nicht auf und am 5. April 1837 kam es um eine solche vonseiten Friedlich Vertrag im Felde von Kästners Hoffnung erneut zu einem Fahrbogenvortrag in Annaberg (40014, Nr. 86, Blatt 9f). Das Bergamt legte daraufhin fest, Markscheider Strödel solle die Grubenfelder verlochsteinen und mit den verführten Bauen zu Risse bringen, woraufhin man dann erst fernerweite Entscheidung treffen könne.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wenn wir einmal die überlieferten
Zahlen zum Ausbringen der einzelnen Gruben untereinander vergleichen, dann
war Friedlicher Vertrag Fdgr. unter den zu dieser Zeit im Revier
umgängigen Eisensteingruben ‒ mit Ausnahme der Grube Vater Abraham zu
Oberscheibe ‒ diejenige mit der insgesamt höchsten und kontinuierlichsten
Förderung. Das Ausbringen in den zehn Jahren von 1828 bis 1837 fassen wir
einmal in einer kleinen Tabelle zusammen, wobei wir aber nur die Gruben
berücksichtigen, die über diesen ganzen Zeitraum in Betrieb gestanden
haben.
Eisensteinausbringen in Fudern:
Dabei ist aber noch zu beachten, daß ein Teil dieser Gruben daneben auch Braunstein gefördert hat (Vater Abraham allerdings nie).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie wir inzwischen wissen, ist Karl
August Gebler aus seiner Stellung beim Bergamt zu Scheibenberg in der
zweiten Hälfte des Jahres 1838 ausgeschieden.
Die Stelle des
Geschworenen war einige Zeit vakant und wurde dann ab 1840 mit Theodor
Haupt neu besetzt (40014, Nr. 300).
Die in Umgang stehenden Gruben seines Reviers hat Herr Haupt gleich am 10. Januar 1840 sämtlich befahren. Über diese hielt er in seinem Fahrbogen auf Reminiscere nur kurz und knapp fest (40014, Nr. 300, Film 0015): „Auf Friedlicher Vertrag gev. Fdgr. fahren 4 Mann an, welche an eben soviel Puncten Eisenstein abbauen, der überall aber immer nur in kurzen Mitteln ansteht.“ Außerdem hielt er aber sogleich für bemerkenswert: „Höchst nothwendig ist es übrigens, von diesen beiden Gruben einen Markscheiderriß zu haben, um die Stärke der stehengelassenen Pfeiler kennen zu lernen, denn namentlich die 1te der beiden genannten Gruben (Friedlich Vertrag), welche einem unterirdischen Irrgarten zu vergleichen ist, macht wegen ihrer Haltbarkeit im Ganzen sehr bedenklich.“ Mit der zweiten, hier angesprochenen und ähnlich ,bedenklichen' Grube ist Kästners neue Hoffnung gemeint. Trinitatis 1840 hat Herr Haupt die Grube am 7. April erneut befahren (40014, Nr. 300, Film 0042f) und berichtete über sie, es würden 2 Örter betrieben, eines hora 10 NW. bei 3 Lachter, das andere in O. bei 12 Lachter Entfernung vom Tageschachte, beide in 11½ Lachter Saigerteufe. Die Anbrüche allerdings seien nur gering. Am 19. Mai war der Geschworene erneut zugegen und hielt in seinem Fahrbogen nun fest (40014, Nr. 300, Film 0061): „Auf Friedlicher Vertrag gev. Fdgr. gewinnt man sowohl im Tiefsten in 11½ Lachter Teufe, als 4 Lachter höher zu beyden Seiten des Schachtes Brauneisenstein, der zwar mächtig genug, aber selten compackt ist.“ Während zu diesem Zeitpunkt auf anderen Gruben des Reviers der alljährliche Wettermangel den Betrieb schon wieder zum Erliegen gebracht hatte, konnte Herr Haupt über Friedlicher Vertrag nach seiner Befahrung am 10. August 1840 noch berichten (40014, Nr. 300, Film 0092): „Auf Friedlicher Vertrag gev. Fdgr. wird an 2 Puncten über der Grundstrecke Eisenstein gewonnen. Die Anbrüche sind namentlich vor dem östlich vom Tageschachte gelegenen Orte von guter Beschaffenheit. Westlich vom Schacht ist das Eisensteinmittel nicht bedeutend und wird förstweise aufgefahren.“ Die Betreiber steuerten den Grubenbetrieb hier wohl etwas vorausschauender, als auf anderen Gruben, denn auch bei seiner Befahrung am 8. September 1840 fand der Geschworene die Grube in Umgang (40014, Nr. 300, Film 0108f): „Auf Friedlicher Vertrag baut man ebenfalls wegen Wettermangel gegenwärtig in einer höheren Sohle, 8 Lachter saiger unter Tage an 2 Puncten in Ost und West vom Schachte einige kleine zuvor stehen gelassene Eisensteinnester ab.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie schon einige Male erwähnt, hat Herr
Haupt im Herbst diesen Jahres dann zeitweise wohl andere Aufgaben
gehabt, denn von Ende Crucis 1840 bis Mitte Reminiscere 1841 wurde er in
seiner Funktion als Geschworener durch den Raschau'er Schichtmeister
Friedrich Wilhelm Schubert vertreten.
Herr Schubert fand die Grube bei seiner ersten Befahrung am 5. Oktober 1840 unbelegt (40014, Nr. 300, Film 0113). Am 22. Oktober 1840 ging aber wieder Betrieb um und in seinem Fahrbogen steht unter diesem Datum recht ausführlich zu lesen (40014, Nr. 300, Film 0120), an diesem Tage „habe ich 1.) die Grube Friedlicher Vertrag gev. Fdgr. bei Schwarzbach befahren. Und zwar 11,5 Ltr. tief im Tageschacht, von welchem nördl. hora 11,2 ein Ort 4,2 Ltr. im Eisensteinlager fortgebracht und steht vor Ort schöner Brauneisenstein in Mulm von der Sohle bis zur Förste an, bei 1,1 Ltr. vom Orte zurück gehet in der Förste ein Örtchen hinaus, von welchem bei einigen Lachtern nördl. Entfernung beinahe nach allen Richtungen bald steigend, bald fallend Örter und Abbaue abgehen, woraus bisweilen leere Räume von 1 – 2 Lachter weit und lang vorkommen, und überall sieht man mitunter noch hübsche Nieren von Eisenstein anstehen. 2.) Vom Tageschacht gegen Süd geht ebenfalls ein Ort gegen 12 Ltr. lang ab, auf welchem nach mehrerley Richtungen, sowohl als auch in der Förste hinaus Abbaue abgehen, welche ebenso wie nördl. über und durcheinander getrieben, daß man diesen Bergbau für eine Durchhöhlerung des bedeuten Eisensteinlagers ansehen muß... Der Ausbau ist unbedeutend, weil der Abbau, wie bereits erwähnt, obgleich nicht regelmäßig, doch wohl über Pfeiler artig anzusehen scheint, nur der Tageschacht ist ohngefähr 6 Ltr. tief von Tage nieder in Wandruthen auf Tragestempeln stehend, in Holz, während jetzt außerdem nur in der Nähe des alten Tageschachtes gegen 10 – 15 Stück Stämpeln als Unterstützung anzutreffen gewesen. Betrieben wird diese Grube eigenlöhnerisch vom Vater mit 3 Söhnen.“ Das brachte offenkundig auch Ertrag, und am 27. November 1840 hatte Herr Schubert hier 40 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 300, Film 0133). Den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) zufolge belief sich die Gesamtförderung in diesem Jahr übrigens wieder auf 160 Fuder Eisenstein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inzwischen hatte die Sächsische
Eisencompagnie aus den im Freien liegenden, benachbarten Grubenfeldern von
Großzeche und Kästners Hoffnung Maßen (und dem Julius
Stolln bei Langenberg) das Wilkauer gemeinschaftliche Feld
gebildet und damit begonnen, den Arnim Stolln ins Feld zu treiben.
Auf Festlegung des Bergamtes hin wurde auf dessen Sohle auch ein Flügelort
in Richtung der Friedlich Vertrag'er Baue getrieben. Als Schichtmeister
hatte die Eisencompagnie für diese Grube Markscheider Strödel
engagiert und der erhielt am 21. Oktober 1840 vom
Am 24. Oktober 1840 trug Obersteiger Schubert auch noch einmal aus seinen Fahrbögen im Bergamt in Annaberg vor (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 10) und betonte, es sei sehr notwendig, die „im Ganzen sehr unregelmäßig geführten Grubenbaue zu Riß zu bringen,“ um den Eigenlöhnern Anweisung geben zu können, wo Pfeiler stehen zu lassen sind; da zuvor aber Markscheider Neubert bereits mit der Rissnachbringung beauftragt worden ist, erübrigten sich weitere Festlegung seitens des Bergamtes. Hinsichtlich der „Regulierung der Stollngebührnisse“ kam es dann am 7. Januar 1841 zu einer Bergamtssitzung, zu der die beiden Eigenlöhner von Friedlich Vertrag und Kästners Hoffnung, Carl August Vulturius und Georg Friedrich Distler, sowie Karl August Gebler als Steiger bei Wilkauer vereinigt Feld und Faktor Ernst Julius Richter als Bevollmächtigter der Eisencompagnie geladen waren. Der dazu abgelegten Registratur zufolge (40169, Nr. 86, Blatt 13ff), eröffnete Bergmeister von Fromberg den Anwesenden zunächst, daß nach Prüfung der Unterlagen der Arminstollnflügel bei Friedlich Vertrag 17,6 Lachter (≈35 m) Saigerteufe einbringe, mithin die Gebührnisse fällig werden. Hinsichtlich der Vortriebskosten hatte Markscheider Strödel als Schichtmeister bei Wilkauer vereinigt Feld zuvor bereits zusammengestellt, daß der Vortrieb des Flügelortes seit der fünften Woche des Quartals Luciae 1840, in der dasselbe über die Feldgrenze gekommen ist, 70 Thaler, 7 Groschen und 6 Pfennige gekostet habe. Inzwischen war das Flügelort bei 19 Lachter weiterer Erlängung in der 14. Woche Luciae 1840 mit der 11 Lachterstrecke bei Friedlich Vertrag durchschlägig geworden, folglich ist von dieser Grube als vierter Pfennig die Summe von 17 Thalern, 13 Groschen und 10 Pfennige zu den Kosten beizutragen (40169, Nr. 86, Blatt 12). Letzteres erkannten auch die beiden Lehnträger an. Hinsichtlich des Stollnneuntels, namentlich aber der Forderung der Eisencompagnie dieses in natura ‒ also in Form von Eisenstein ‒ erhalten zu wollen, verwiesen sie auf „zeitweise Behinderungen“ ihrer Betriebe durch Wettermangel und Wasserzutritte sowie geringen Absatz, so daß sie ihre Gruben derzeit nicht ganzjährig in Umgang halten könnten. Daher boten sie ein Geldäquivalent in Höhe von 1 Thaler, 6 Groschen pro neunter, ausgebrachter Tonne Eisenstein an. Dazu erklärte nun Herr Richter, er sei nicht bevollmächtigt, dies zu entscheiden, er werde aber Rücksprache halten. Was den ferneren Forttrieb des Stollnflügels anbetraf, so wurde an diesem Tage noch beschlossen, diesen nun in gerader Richtung Stunde 3 gegen Südost bis an den Kästners Hoffnung'er Tageschacht zu treiben. Was die offen gebliebene Frage nach dem Stollnneuntel anbelangte, so teilte Herr Richter dem Bergamt Annaberg am 13. Januar 1841 mit, das Direktorium in Planitz beharre auf der Zahlung des Neuntels in natura und wolle zukünftig auch selbst Abnehmer des bei den Nachbargruben geförderten Eisensteins sein, so daß das Argument zu geringen Absatzes nicht gelten könne (40169, Nr. 86, Blatt 17). Diesen Bescheid teilte man seitens des Bergamtes auch den beiden Eigenlöhnern am 18. Januar 1841 mit (40169, Nr. 86, Blatt 21). Bereits am 16. Januar des Jahres hat Herr Schubert, der immer noch den Geschorenen Haupt vertrat, dem Bergamt angezeigt, daß Vulturius das Vermessen des Eisensteins verweigere (40169, Nr. 86, Blatt 18f). Den Argumenten des Lehnträgers von Friedlich Vertrag, daß „der in Frost gekommene Eisenstein“ vom Pfeilhammer nicht abgenommen werde und daß es unverhältnismäßigen Aufwand bedeute, den durchgefrorenen Erzhaufen zu vermessen, folgte aber auch Schichtmeister Strödel seitens Wilkauer vereinigt Feld und erklärte sich bereit, das Vermessen auf einen Zeitpunkt geeigneter Witterung zu verschieben. Die erste Amtshandlung von Theodor Haupt nach seiner Rückkehr ins Bergamt Scheibenberg auf dieser Grube war dann, am 16. April 1841 den hier ausgebrachten Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 300, Film 0172f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schließlich wurde am 17. April 1841 in Annaberg die Konsolidation der beiden Gruben Friedlich Vertrag und Kästners Hoffnung bestätigt, nachdem Vulturius seinem Nachbarn Distler dessen Grubenfeld abgekauft hatte (40169, Nr. 86, Blatt 24). In einer zweiten Registratur des Bergamtes Annaberg vom gleichen Tage wird Carl August Vulturius daraufhin als „Lehnträger und alleiniger Besitzer von Kästners Neue Hoffnung samt Friedlicher Vertrag gevierte Fundgrube“ benannt (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 22). Dieser bestätigte darin, das Stollnneuntel auch für Kästners Hoffnung übernehmen zu wollen, auch schon bevor das Arnimstollnort am dortigen Tageschacht eingekommen sei. Strödel und Gebler akzeptierten diese Offerte nur allzu gern und boten ihrerseits an, das Stollnort jederzeit sofort in Belegung zu nehmen, sobald Vulturius es verlange. Auch Herr Haupt nannte beide Gruben in seinem Fahrbogen auf den 10. Mai 1841 nun in einem Atemzug (40014, Nr. 300, Film 0172f). Die Grube war zu diesem Zeitpunkt mit 5 Mann belegt, welche nun „im Felde von Friedlicher Vertrag auf einem oberen und einem unteren Bau westlich vom Schacht Eisenstein abbauen. Der Lehnträger wünscht nun, um in dem Felde des Beilehns einen vollkommeneren Bau einrichten zu können, einen neuen Schacht circa 24 Lachter vom Kästnerschen Schachte in Mittag niederzubringen, außerdem er die tiefe Strecke in gedachtem Felde und den dasigen Tageschacht vorzurichten hätte, was ihm vielleicht bald ebensoviel Arbeit verursacht, als der projektirte Schacht. Da später nun der Kästnersche Schacht dafür in Wegfall kommen könnte, da ferner mit dem neuen mehrere Tagebrüche ausgefüllt würden, und der Grundeigentümer, Hr. Meier, nichts gegen die Schachtanlage einzuwenden hat, der Lehnträger Vulturius übrigens einer der thätigsten Eigenlöhner ist, und aus seinem Schacht bereits über 3.000 Fuder Eisenstein herausgefördert hat, so dürfte aus diesen sowie aus mehreren anderen unerheblichen Gründen seiner Absicht kein Hindernis entgegenzustellen seyn.“ Der neue Lehnträger der vergrößerten Grube wird hier vom Geschworenen sehr gelobt. Zur Frage des neuen Tageschachtes trug Herr Haupt am 29. Mai 1841 auch in Annaberg vor (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 24). Man schaute sich wohl bei der großen Nachbargrube auch technische Neuerungen ab, denn Herr Haupt berichtete am 24. Mai 1841 (40014, Nr. 300, Film 0181): „Die Siebversuche mit dem Haldenklein, das man beim Durchwerfen des Eisensteins durch den Durchwurf auf mehreren Gruben des Tännichtwaldes erhält, gehen nicht allein auf dem Wilkauer Felde fort, sondern sind auch auf Friedlich Vertrag unternommen worden und mit Vortheil ausgefallen. Auf dem Wilkauer Feld baut man jetzt zu diesem Behufe eine Rüttelmaschine, welche aus zwei untereinanderliegenden Sieben besteht, wovon das obere den früher angewendeten Durchwurf vertreten soll.“ Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang, daß man seitens des Bergamtes schon früher einmal (am 5. Dezember 1835) veranlaßt hatte, auch den klaren Eisenstein aufzubereiten. Von seiner Befahrung der Grube am 27. Juli 1841 (40014, Nr. 300, Film 0207) hatte der Geschworene dann zu berichten, daß man auf Friedlicher Vertrag samt Kästners Hoffnung gev. Fdgr. den neuen Tageschacht 10 Ltr. tief niedergebracht und ordentlich ausgezimmert hatte. Dieser neue Schacht lag 128 Lachter vom Mundloch des Armin Stolln entfernt und etwas westlich vom Stolln, war mit diesem aber durch eine kurze Strecke verbunden. In der Verlängerung dieser Verbindungsstrecke nach Osten ist „der beste Eisenstein getroffen worden“ und wurde auch abgebaut. Außerdem ging auch auf der 7 Lachter- Sohle in der Nähe der Markscheide zum Kästner'schen Felde weiter Abbau um. Auch hierzu gab es am 31. Juli einen Fahrbogenvortrag im Bergamt Annaberg (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 25). So blieb es auch zunächst und von seiner nächsten Befahrung am 19. August 1841 hatte Herr Haupt zu berichten (40014, Nr. 300, Film 0226), daß durch 4 Mann auf der 11 Lachter- Strecke vom alten Tageschacht in West, wo die Anbrüche mittelmäßig sind, sowie auf der 7 Lachter- Strecke in 10 – 12 Lachter südwestlicher Entfernung von gedachtem Schacht, wo der Eisenstein ½ bis ¾ Lachter mächtig ist, abgebaut wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie schon zu lesen war, wurde Herr
Haupt Crucis 1841 erneut von höherem Orte zu anderen Aufgaben
abgeordnet. In der Folgezeit wurde er in seiner Funktion als
Berggeschworener in Scheibenberg durch den Rezeßschreiber Lippmann
aus Annaberg vertreten (40014, Nr. 300, Film 0230). Der letztere befuhr
die Gruben bei Langenberg und Schwarzbach am 15. September 1841 und hatte
danach über diese zu berichten (40014, Nr. 300, Film 0244), es waren drei
Baue in Umgang und mit 4 Mann belegt:
1.) in der 11 Lachter- Sohle ein Ort hora 3,0 SW. nach dem Felde von Kästners neue Hoffnung, mit dem aus den dortigen Bauen ein näherer und regelmäßigerer Förderweg nach dem Friedlich Vertrager Fund- und Förderschacht erlangt werden soll, welches jetzt 6 Lachter erlängt ist. 2.) In derselben Sohle verfolgte man im Friedlich Vertrager Felde dem Streichen nach hora 3,0 in SW. ein ¼ Lachter mächtiges... Eisensteinlager ortweise. Das Lager ist jetzt auf 2 Lachter LÄnge aufgeschlossen. Allerdings fehlte es noch immer an vernünftigen Rissen und so beklagte Herr Lippmann hier: „Eine bestimmte Bezeichnung dieses Punktes ist mir nicht möglich zu geben, denn bei dem schon von alter Zeit her ohne alle Regelmäßigkeit statt gefundenen Betrieb, wodurch eine bespiellose Verwirrung der hiesigen Baue entstanden ist, verliert man alle Orientierung.“ 3.) in der 7 Lachter- Sohle wurde in circa 12 Lachter südwestlicher Entfernung vom Förderschacht des Friedlich Vertrager Feldes ein mehr als ¼ Lachter mächtiges Eisensteinlager... förstweise abgebaut. Über diesen hatte Herr Lippman zu bemerken: „Dieser einzige regelmäßige Abbau in der ganzen Grube, wozu ohne allen Zweifel die Abbauweise der Nachbargrube Wilkauer vereinigt Feld das gute Beispiel gegeben, ist 4 Lachter lang und 2½ Lachter hoch.“ Übertage war außerdem 1 Mann stets mit dem Ausschlagen des gewonnenen Eisensteins und nach Befinden auch mit Sieben des durch den Durchwurf gefallenen Kleins beschäftigt. Seine nächste Befahrung führte Herr Lippmann am 18. Oktober durch (40014, Nr. 300, Film 0253f). Diesmal fand er nur zwei Baue in Umgang, nämlich ist das zuvor sub 1.) erwähnte Ort bei 5,3 Lachter Länge von der Hauptstrecke aus durchschlägig geworden und wendete sich dann hora 6,0 W, um damit „in kürzester Distanz mehrere über 1 Fuß mächtige Eisensteinnieren, welche sich aus den sich hier in die Höhe ziehenden Kästners Hoffnunger Bauen nach der tiefen Strecke hereinzufallen, zu überfahren und Abbau darauf zu beginnen.“ Dieses war jetzt 7,3 Lachter ausgelängt. 2.) ein in derselben Sohle 3½ Lachter vom Fundschacht in der Richtung 9,0 NW von der Hautstrecke abgehende Seitenort, welches den dortigen „mit großer Krümmung und Unregelmäßigkeit betriebenen Strecken“ zugeführt werden soll, um sie zu Karrenförderung benutzen zu können. Der Abbau selbst war dabei außer Betrieb. Man kann all diesem wohl entnehmen, daß der Lehnträger Vulturius der konsolidierten Grube tatsächlich um einen ordentlichen und einträglichen Betrieb bemüht gewesen und daß das Lob von Herrn Haupt (in dessen Fahrbericht vom 16. April 1841 oben) nicht unangebracht gewesen ist. Die erwähnten Ausrichtungsbaue waren bei der nächsten Befahrung der Grube durch Herrn Lippmann am 11. November 1841 fertig (40014, Nr. 300, Film 0262f). Daher war auch „der Abbau in der Nähe des Arnim Stollns (...) nach Fertigstellung des sub. 2.) erwähnten Zuführungsortes wieder in Betrieb, woselbst innerhalb einer Distanz von 1 Lachter vier unter 20 Grad in NW. fallende, hora 4,4 streichende Eisensteintrümer, jedes nur 6 – 8 Zoll mächtig, übereinanderliegen.“ Auch der Abbau auf der 7 Lachter- Sohle südwestlich von Friedlich Vertrager Fundschacht war wieder belegt. Hier fand man den Eisenstein 12 – 16 Zoll mächtig vor und der Abbau war inzwischen 2½ Lachter hoch und 5 Lachter lang geworden. Wohl aufgrund der bekannten, regelmäßig im Sommer beklagten Bewetterungsprobleme in den tiefen Sohlen war bei seiner Befahrung am 10. Dezember 1841 (40014, Nr. 300, Film 0262f) der Betrieb auf der oberen Sohle eingestellt. Stattdessen wurde in der Arnim Stollnsohle 2 Lachter vom Friedlich Vertrager neuen Tageschacht zurück hora 3,0 nach SW. mittels eines allerdings erst 1 Lachter erlängten Streichortes ein Eisensteinlager von 10 – 12 Zoll Mächtigkeit verfolgt. Mit dem Abbau in der Nähe des Arnimstollns war man auch in dieser Teufe bei 8 Lachter Erlängung in alten Mann gekommen und so wurden die zuvor überfahrenen Eisensteintrümer jetzt förstenweise abgebaut. Auch auf der 11 Lachter- Sohle wurde ein Eisensteintrum förstenweise abgebaut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang des Jahres 1842 war Herr
Lippmann wieder vor Ort und notierte in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 321, Film 0002f),
bei Friedlich Vertrag
samt Kästners Hoffnung „belegt mit 4 Mann, baut man in der Arnim
Stollnsohle
1.) ein in 2 Lachter Entfernung vom neuen Friedlich Vertrager Tageschacht hora 3 streichendes, unter 25 Grad in Mitternacht Abend fallendes Eisensteinlager, dermalen 12 bis 15 Zoll mächtig, in südwestlicher Richtung ab, gewinnt aber auch auf derselben Sohle 2.) auf der östlichen Seite gedachten Stollns mit förstenweisem Abbau mehrere in der Abbauweise übereinanderliegende 6 – 8 Zoll mächtige Eisensteintrümern... recht guten Eisenstein in nicht unbedeutender Quantität.“ Die ,nicht unbedeutende Quantität' war offenbar von einer solchen Größenordnung, daß Herr Lippmann in der Folgezeit bis Juni 1842 insgesamt fünfmal zugegen sein mußte, um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0003ff). Dabei erfahren wir auch, wen die konsolidierte Grube zu dieser Zeit mit Erz belieferte, nämlich:
Bei seiner Befahrung am 27. April 1842 war man „übertage mit dem Ausschlagen und mit dem Durchwerfen und Sieben des klaren Haufwerks beschäftigt.“ (40014, Nr. 321, Film 0033) Im Juni 1842 ging dann wieder Grubenbetrieb um, worüber Herr Lippmann zu berichten hatte (40014, Nr. 321, Film 0050f): „Auf Friedlich Vertrag... belegt mit 4 Mann, hat man einestheils vom Neuschacht aus in 9½ Lachtern Teufe ein Steigort auf einem 0,15 Lachter mächtigen Eisensteintrum 3 Lachter lang in Abend bis zum Durchschlag mit den Bauen von Kästners Hoffnung gev. Fdgr. getrieben, und baut nun hier das... Lager ab. Anderntheils treibt man im Friedlich Vertrager Felde auf der 7 Lachter unter Tage befindlichen oberen Sohle vom Fundschacht gegen Abend ein Feldort durch alten Mann und durch vorliegenden Bruch, wobei man recht guten Eisenstein in nicht unbedeutender Quantität auszuhalten Gelegenheit hat.“ Besonders das Herantreiben eines Flügelortes des Arnim Stollns durch die Grube Wilkauer vereinigt Feld machte sich nun hier bezahlt, denn die meisten anderen Eigenlöhnergruben des Reviers standen zu dieser Zeit, des alljährlichen Wettermangels im Sommerhalbjahr halber, schon wieder außer Belegung. Die guten Anbrüche hielten dagegen nicht aus, wie man aus dem Fahrbericht Lippmann's vom 23. September 1842 (40014, Nr. 321, Film 0082f) herauslesen kann. Es heißt darin, man suche zum einen von in der Gegend des neuen Tageschachts im Felde von Kästners Hoffnung 1 Lachter oberhalb der Stollnsohle mit einem Ort in NO. Eisenstein anzufahren, zum anderen in einem kleinen Gesenk unter der Arnimstollnsohle bei 21 Lachter nordöstlicher Entfernung vom Neuen Tageschacht und 3 Lachter neben dem Arminstolln nach West. An dem zweiten Punkt steht noch auf kurze Länge guter Eisenstein an, im Nordoststoß „ist er von den Vorfahren schon abgebaut.“ Außerdem wurde auf die Unterhaltung geachtet und der alte Tageschacht von Friedlicher Vertrag neu verholzt. Auch von seiner Befahrung der Eigenlöhnergruben im Tännicht am 27. Oktober berichtete Lippmann (40014, Nr. 321, Film 0094f), daß „die Mehrzahl wegen der Kartoffelernte gegenwärtig nicht in Betrieb gehalten wird“ und lobte: „Hier sind beständig 4 Mann in Arbeit. Zum einen wird das schon früher erwähnte Gesenk unter der Arnimstollnsohle dem Lager folgend flach abgesenkt und ist 1 Lachter niedergebracht, dort aber wegen Wasserzudrang sistiert worden.“ Stattdessen wurde nun vom Tiefsten aus einige Lachter in West ausgelängt. Außerdem hatte man ein Versuchsort 11 Lachter weiter südlich aus dem Arnimstolln heraus hora 8,4 NW. angeschlagen, aber nur anfangs Mulm durchfahren und bei 3 Lachter Länge den liegenden Glimmerschiefer erreicht. Das Glück hielt nicht an und man war weiter auf der Suche nach guten Anbrüchen... Dennoch gab es offenbar noch einiges Ausbringen und als Herr Haupt nach Scheibenberg zurückgekehrt war, hatte er hier gleich dreimal (am 2., 9. und 15. November 1842) den Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0096, 0100 und 0101). Der ersten der ab 1842 vonseiten des Oberbergamtes geforderten Anzeigen der Bergämter, Ausbeutschluß und Verlagserstattung betreffend, des Bergamtes Annaberg auf Luciae 1842 ist dann zu entnehmen, daß in diesem Quartal Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung mehr als 27 Neugroschen pro Kux Verlag erstattete, respektive 116 Thaler, 8 Neugroschen und 3 Pfennige auf alle 128 Kuxe (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 26). Man kann daraus nur schließen, daß sich die Fusion auch für den Betreiber gelohnt hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner nächsten Befahrung der Grube
am 22. Februar 1843 berichtete Herr Haupt dann (40014, Nr. 321, Film 0145),
man baute in der Sohle des oberen Baues vom alten Tageschacht an mehreren
Punkten Eisenstein ab, „der aber nirgends von bedeutender Mächtigkeit
ist.“ Danach wurde er wieder abgeordnet und Herr Lippmann mußte
ihn erneut vertreten.
Dieser befuhr die Grube am 1. und 4. Mai, sowie am 13. Juni 1843 und fand die Grube dabei jeweils unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0172, 0175 und 0181), was eigentlich hätte Konsequenzen haben können. Jedoch muß der Grubenbetrieb nicht ganz erfolglos weitergegangen sein, denn am 19. Juni und am 11. Oktober 1843 hatte auch Herr Lippmann hier wieder den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen, der diesmal an den Pfeilhammer gegangen ist (40014, Nr. 321, Film 0188 und 0212). Nach der Registereinlage auf Trinitatis 1843 teilte man aus Annaberg nach Freiberg mit, daß in diesem Quartal Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung wieder über 8 Neugroschen pro Kux Verlag erstatte, in Summe 34 Thaler, 18 Neugroschen und 4 Pfennige auf alle 128 Kuxe (40169, Nr. 86, Blatt 28f). Auch am 16. November 1843 fand der Vertreter des Geschworenen die Grube wieder unbelegt, diesmal aber hat er sie „über einen vom Arnim Stolln aus zugänglichen Eisensteinbau beaugenscheinigt.“ Dort hatte man das hier 12 bis 15 Zoll mächtige Lager schon auf 3 Lachter Länge und 1,8 Lachter hoch ausgehauen (40014, Nr. 321, Film 0220). Ab Ende Dezember 1843 war Herr Haupt dann zunächst wieder in seinem Amt in Scheibenberg. Seine nächste Befahrung dieser Grube fand am 29. Januar 1844 statt (40014, Nr. 322, Film 0004). Dem Fahrbogen ist zu entnehmen, daß auf Friedlicher Vertrag samt Kästners Hoffnung gev. Fdgr. 2 bis 3 Mann anfuhren, welche Eisenstein zu beiden Seiten des Armin Stollnflügels gewannen und zwar in 2 bis 3 Lachter Entfernung von dessen Ulme und 9 Lachter in NNO. vom neuen Schachte. Freilich waren „die Anbrüche (...) von mittlerer Beschaffenheit.“ Auch für Luciae 1843 konnte man nach Freiberg mitteilen, daß Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung in diesem Quartal noch einmal 4 Neugroschen pro Kux Verlag erstatte, in Summe waren es diesmal 16 Thaler, 28 Neugroschen und 4 Pfennige auf alle 128 Kuxe (40169, Nr. 86, Blatt 29). Am 1. März 1844 fand Herr Haupt beide konsolidierte Gruben in Belegung (40014, Nr. 322, Film 0020). Man baute „leidliche Anbrüche von Eisenstein“ ab, erstens an zwei Punkten im Feld von Friedlich Vertrag östlich vom Arnim Stolln und drittens in höherer Sohle im Feld von Kästners Hoffnung. Bis zum 19. April 1844 hatte man entweder wieder Vorrat angesammelt, oder die ständig wechselnden Abbaupunkte waren alle ausgeerzt, denn im Fahrbogen des Geschworenen steht unter diesem Datum zu lesen, man betreibe „vor der Hand nur einen einzigen Bau in der 7 Lachtersohle vom Friedlich Vertrager Tageschachte in südwestl. Richtung bei circa 9 Lachter Entfernung befindet, und wo recht hübsche Eisensteinnieren in Mulm einbrechen.“ (40014, Nr. 322, Film 0029) Dies war aber auch schon seine letzte Befahrung der Grube in diesem Jahr. Herr Haupt wurde schon wieder zu anderen Aufgaben abberufen und diesmal vertrat ihn der Markscheider Friedrich Eduard Schiefer in seinem Amt in Scheibenberg. Gleich nach seiner ersten Befahrung dieses Revierteils am 7. Mai 1844 notierte der Letztere in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 322, Film 0038): „Übrigens beabsichtigte ich, an diesem Tage noch die Gruben Köhlers, Distlers und Friedlich Vertrag gev. Fdgr. zu befahren, fand jedoch dieselben unbelegt.“ Hier war es aber nur ein kurzer Stillstand und bei seiner Befahrung am 10. Juni 1844 (40014, Nr. 322, Film 0044) fand Herr Neubert wieder „zwei Örter im Schlage, das eine in der 8 Lachtersohle des Friedlich Vertrager Tageschachtes in westl. Richtung 10,4 Lachter entfernt, dieses steht in altem Mann, welcher Eisenstein enthält. Das andere in der Arnim Stollnsohle von dem im Felde von Kästners Hoffnung niedergebrachten neuen Tageschacht 3 Lachter in NW. erlängt, und steht in braunem Mulm, in welchem kleine Nester von Eisenstein einbrechen.“ Unter dem 2. Juli 1844 hat Herr Neubert dann in seinem Fahrbogen vermerkt (40014, Nr. 322, Film 0050), es wurden hier „100 Fuder Eisenstein für das Eisenhüttenwerk Pfeilhammer vermessen und 12 Fuder, 2 Tonnen desgleichen als Stollnneuntel für Wilkauer vereinigt Feld gestürzt, wobei ich zugegen war.“ Ah, ja: Der erfolgreiche Betrieb bei dieser Grube stand natürlich damit in Zusammenhang, daß durch den Flügel des Armin Stollns, den Wilkauer vereinigt Feld herangetrieben hatte, die auf den anderen Gruben so häufigen Wetter- und Wasserhaltungsprobleme hier weitgehend beseitigt waren. Dafür war ‒ wie seit alten Zeiten üblich ‒ an den Betreiber des Stollens ein Neuntel des Gewinns zu zahlen, was hier in Form von Naturalien (einem Anteil am Ausbringen) geschah.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie seinem nächsten Fahrbericht zu
entnehmen ist, waren dagegen auf den benachbarten Gruben die üblichen sommerlichen Wetterprobleme wieder eingetreten.
Am 22. Juli 1844 notierte Herr Neubert einleitend: „Die Gruben
Riedels, Reppels, Köhlers und Meyers Hoffnung gev. Fdgr., über welche ich
den Weg nach erstbenannten Gruben nahm, fand ich unbelegt.“ Auf
Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung hingegen fuhren 3 Mann
an, welche vor denselben Örtern arbeiteten, wie bei der letzten Befahrung
am 10. Juni. Beide Örter sind um 2,5 Ltr. fortgestellt worden und beide
standen in altem Mann, wo man offenbar stehengelassene Reste aushieb (40014, Nr. 322, Film 0055).
Dem kontinuierlichen Betrieb im konsolidierten Grubenfeld ist es auch zu danken, daß der Geschworenendienstversorger hier am 9. und 23. August wieder ausgebrachten Eisenstein zu vermessen hatte. In seinen Notizen darüber hob er diesmal hervor (40014, Nr. 322, Film 0058 und 0059), es wurden (einmal 30 und einmal 62 Fuder) „klarer, vor dem Jahr 1841 geförderter Eisenstein vermessen, welcher nun an das Eisenhüttenwerk Erla verkauft worden ist.“ Wir erinnern uns: Im Jahr 1841 wurden hier Versuche mit dem Aussieben kleinkörnigen Haufwerks durchgeführt. Um das dabei gewonnene Konzentrat hat es sich sicherlich hier gehandelt. Auch für Crucis 1844 konnte Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung wieder über 10 Neugroschen pro Kux Verlag erstatten, in Summe waren es jetzt 41 Thaler, 21 Neugroschen und 4 Pfennige auf alle 128 Kuxe (40169, Nr. 86, Blatt 30). Einem Fahrbogenvortrag von Markscheider Neubert am 26. August 1844 in Annaberg ist zu entnehmen, daß er auf der Grube noch gegen 450 Fuder klaren Eisenstein vorrätig gefunden habe, welche zwischen 280 und 300 Fudern verkäuflichen Eisenstein ergeben könnten. Da sie noch aus der Zeit vor der Einbringung des Arnimstollns 1841 stammten, entfalle auf diese noch kein Neuntel (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 31f). Weil das Aussieben offenbar schon damals „mit Vortheil ausgefallen“ war, ordnete das Bergamt daraufhin am 31. August an, auch diese aufzubereiten. Bei seiner Befahrung vom 5. September 1844 (40014, Nr. 322, Film 0062) fand Herr Neubert, daß man nun „bei trockener Witterung mit Aussieben einer ziemlichen Menge vorräthigen Eisensteins beschäftigt“ war. Nächstdem wurden aber auch noch 3 Örter in Betrieb gehalten, eines in der 8 Lachtersohle in der Nähe der Markscheide zwischen Friedlich Vertrag und Kästners Hoffnung, ein zweites an eben jener Feldgrenze auf der 11 Lachtersohle und ein drittes auf der Armin Stollnsohle im Felde von Kästners Hoffnung, letzteres wurde „in altem Mann, welcher mitunter etwas Eisenstein enthält,“ fortgetrieben. Am 8. November 1844 (40014, Nr. 322, Film 0073f) hat Herr Neubert die Grube noch einmal befahren, „nachdem daselbst in meiner Gegenwart 63 Fuder klarer, vor dem Jahre 1841 geförderter Eisenstein für die Eisenhüttenwerke Großpöhla und Erla vermessen worden waren.“ Aktuell fuhren 2 Mann an, welche sich aber „hauptsächlich mit dem Aussieben von klarem Eisenstein beschäftigten“ und bei ungünstiger Witterung ein Ort in der 8 Lachtersohle „in einem alten, ziemlich umfänglichen Bruch im Friedlich Vertrager Felde fortgestellt haben, wobei etwas Eisenstein ausgehalten worden ist.“ Auch das erscheint zwar nur als ein ,Nachlesebergbau', aber das konsolidierte, vergrößerte Grubenfeld machte zumindest immer wieder das Auffinden solcher Reste und damit den ‒ verglichen mit den Nachbargruben ‒ sehr stetigen und doch einträglichen Betrieb möglich. So konnte man bei Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung auch für Luciae 1844 wieder mehr als 13 Neugroschen pro Kux oder in Summe 55 Thaler, 5 Neugroschen und 6 Pfennige auf alle 128 Kuxe Verlag erstatten erstatten (40169, Nr. 86, Blatt 33).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung der Grube durch Herrn Neubert erfolgte dann am 15. Januar 1845. Er notierte in seinem Fahrbogen darüber, daß 2 Mann 2 Örter im Friedlich Vertrag'er Feld betrieben. Das eine Ort war vor kurzem in seiner Sohle mit der Firste des Arminstollns durchschlägig geworden und 0,8 Ltr. darüber hinaus nach NW. erlängt. „Hier bricht recht schöner Eisenstein ein...“ Das zweite Ort in derselben Sohle befand sich 3 Ltr. südlich vom Arminstolln und stand in Mulm, der etwas mit Quarz vermengten Eisenstein führte (40014, Nr. 322, Film 0091). Am 7. März des Jahres war er wieder vor Ort und fand ein Ort in der 8 Lachtersohle beim Friedlich Vertrager Tageschacht nach NNO. in Umgang, wo man ein 0,2 Ltr. mächtiges Eisensteintrum verfolgte und das vorgenannte Ort, welches die Firste des Arminstollns überfahren hatte, nun 3 Lachter von diesem nach SW erlängt (40014, Nr. 322, Film 0098). Den Eisenstein hat Herr Neubert am 28. März 1845 zu 41 Fuder 1¼ Tonnen vermessen, wovon 30 Fuder an den Rothenhammer und 11 Fuder 1¼ Tonnen als Stollnneuntel an Wilkauer vereinigt Feld geliefert wurden (40014, Nr. 322, Film 0102). Auch bei seiner Befahrung am 2. Mai 1845 fand der Geschworenendienst- Versorger zwei Mann auf zwei Örtern in der Nähe des Arminstollns, deren Sohle mit dessen Förste in ziemlich gleichem Niveau liegt, angelegt. Dort bauten sie „recht hübsche Nester von Eisenstein“ ab (40014, Nr. 322, Film 0110). Außerdem war er am 27. Mai noch einmal hier und hat „Eisenstein und Braunsteinstufen behufs deren Einsendung zur Industrieausstellung in Dresden ausgeschlagen.“ (40014, Nr. 322, Film 0118) Am 13. Juni 1845 konnte Herr Neubert hier wieder 77 Fuder, 4¼ Tonnen vermessen, mit Einschluß von 8 Fudern, 3¼ Tonnen Stollnneuntel. Die Lieferung ging diesmal an das Hammerwerk Pfeilhammer (40014, Nr. 322, Film 0120f). Für Trinitatis 1845 belief sich die Ausbeut- und Verlagsdeliberation dann auf 3 Neugroschen pro Kux oder auf genau 15 Thaler in Summe (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 33). Von dem Haufwerk, das vor dem Einbringen des Stollnorts in die Grube 1841 gefördert worden ist, war immer noch etwas übrig und wurde nebenbei weiter aufbereitet. Daher waren am 15. Juli 1845 dann 62 Fuder, 1 Tonne mit Einschluß von 38 Fuder, 3 Tonnen, welche vor dem Einbringen des Arnim Stollnortes gewonnen worden sind, für das Eisenhüttenwerk Erla zu vermessen. Auf das Stollnneuntel entfielen davon nur 2 Fuder 4¾ Tonnen (40014, Nr. 322, Film 0126). Am folgenden Tag hat Herr Neubert auch eine Befahrung durchgeführt, worüber er in seinem Fahrbogen festhielt, es seien nun 3 Mann auf 3 Örtern angelegt, zum ersten ein Versuchsort in 6 Ltr. Teufe des Friedlich Vertrag'er Schachtes nach Süden, zum zweiten ein Steigort über dem Arnimstolln in einem Bruch, wo noch „recht hübsche Parthien von Eisenstein vorkommen.“ Und drittens ein Weitungsbau nahe am Kästners Hoffnung'er Tageschacht (40014, Nr. 322, Film 0126f). Außerdem liest man hier noch: „Übrigens habe ich diesmal auf Friedlich Vertrag pp. gev. Fdgr. alle nur halbwege noch zugänglichen Baue befahren, um mich wegen Aufstellung einer Taxe von diesem Grubengebäude, die ich nächstens dem Königl. Bergamte mittelst Anzeige überreichen werde, zu instruiren.“ Warum er das Bergwerk zu taxieren hatte und ob etwa ein Verkauf beabsichtigt war, schrieb er leider nicht auf. Bis zum 5. September 1845 waren wieder über 18 Fuder Eisenstein zum Vermessen bereit. Davon gingen 17 Fuder an den Rothenhammer und 1 Fuder, 1⅞ Tonne entfielen auf das Stollnneuntel. Außerdem hatte man wieder gegen 40 Fuder klaren Eisenstein aus den vorhandenen Halden ausgesiebt. Bei seiner anschließenden Befahrung fand er aber nichts besonders bemerkenswertes vor. Es waren weiter 2 Punkte mit 3 Mann belegt, einmal in 8 Ltr. Teufe am Friedlich Vertrag'er Schacht und das zweite 2 Lachter über der Firste des Arnimstollns (40014, Nr. 322, Film 0135f). Von seiner Befahrung am 13. November heißt es dann, es hätten überall die Anbrüche ausgesetzt. Zwei Mann trieben ein Versuchsort in der 12 Lachtersohle bei 9 Ltr. südwestlicher Entfernung vom Friedrich Vertrag'er Tageschacht in West und Südwest, das bereits 10,2 Ltr. erlängt war, aber noch keine Anbrüche getroffen habe (40014, Nr. 322, Film 0153f). So blieb es auch den Rest des Jahres auf dieser Grube, wie Herr Neubert über seine Befahrungen des Reviers am 18. und 19. Dezember 1845 berichtete (40014, Nr. 322, Film 0161). Das Versuchsort in der 12 Lachtersohle war jetzt 11,2 Ltr. erlängt, hatte bislang aber nur kleine Nester von Eisenstein angefahren. Bei der Ausbeut- und Verlagsdeliberation auf das Quartal Luciae 1845 belief sich der Verlag nur auf 1 Neugroschen, 4 Pfennige pro Kux oder auf genau 5 Thaler, 25 Neugroschen in Summe (40169, Nr. 86, Blatt 34).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 23. Januar 1846 hatte Herr
Neubert wieder den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen. Befahrungen
führte er diesmal am 16. und 17. März des Jahres durch
(40014, Nr. 322, Film 0169 und 0179).
Wie zuvor waren 3 Mann angelegt, und von diesen wurden in 6 und 7 Ltr.
Teufe des Friedlich Vertrag'er Schachtes und von diesem 4 Ltr. in SW. sowie
in 7 Ltr. Teufe des Kästners Hoffnung'er Schachtes „einige an Pfeilern
stehengelassen, nicht sehr bedeutende Eisensteinnester“ abgebaut.
Andere Anbrüche waren zurzeit nicht vorhanden. Außerdem schrieb er, es
wäre zweckmäßig, „wenn in der 12 Lachter- Streckensohle, welche fast
ebenso tief wie die Sohle des Armin Stollns liegt, der nordöstliche Theil
des Grubenfeldes durch Örter aufgeschlossen würde, da wahrscheinlich dort
noch Eisensteinmittel vorhanden sind, obschon daselbst in früherer Zeit
auch gebaut worden sein mag.“
Obwohl dies nur eine Empfehlung, und keine Anweisung war, gab es hierzu einen Fahrbogenvortrag auf der Bergamtssitzung am 4. April 1846. Dabei erklärte Markscheider Neubert noch einmal, daß man oberhalb der Stollnsohle nur noch Restpfeiler abbaue, aber in nordöstlicher Richtung noch wenig alte Baue vermute (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 34). Vonseiten des Bergamtes wurde Lehnträger Vulturius daher angewiesen, in der fast ebenso tief, wie der Arnimstolln liegenden 12 Lachtersohle ein Ort in diese Richtung vortreiben. Zugleich solle er, bis zu einem künftigen etwa zu etablierenden Abbau unterhalb der Stollnsohle im gegenwärtigen Baufeld alle Restpfeiler, auch „zu thunlichster Holzeinsparung“, so schnell wie möglich abbauen, um diese dann gänzlich zubruchgehen lassen zu können. Darüber hinaus gab es in diesem Jahr nur wenig zu berichten. Im April wurde die Zimmerung des Kästners Hoffnung'er Schachts ausgewechselt, im Juni wieder etwas Eisenstein gewonnen und auch im Juli war man wieder mit Zimmerungsarbeiten befaßt (40014, Nr. 322, Film 0191, 0202 und 0208). Bei seiner Befahrung am 8. September fand Herr Neubert die Grube gar einmal unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0218f). Dennoch war auch in diesem Halbjahr mehrfach seine Anwesenheit nötig, um das Vermessen des Eisensteins zu überwachen. Davon gingen 9 Fuder Stufferz und klarer Eisenstein „als Probe“ nach Erla und 77 Fuder an den Pfeilhammer, worauf 9 Fuder als Stollnneunntel entfielen (40014, Nr. 322, Film 0199 und 0201). Bis zum 11. Dezember wurden noch einmal 45 Fuder ausgebracht und vermessen (40014, Nr. 322, Film 0233). Im Quartal Luciae 1846 konnte nach der Ausbeut- und Verlagsdeliberation wieder ein etwas höherer Verlag, nämlich 9 Neugroschen pro Kux oder 37 Thaler, 15 Neugroschen in Summe abgerechnet werden (40169, Nr. 86, Blatt 36).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seine letzte Befahrung dieser Grube
führte Herr Neubert am 21. Januar 1847 durch. Ausgerechnet das Ort
auf der 12 Lachter- Streckensohle und 28 Ltr. vom Friedlich Vertrag'er
Schacht, das zu diesem Zeitpunkt in Mulm mit „einbrechendem Eisenstein
von leidlicher Beschaffenheit und Frequenz“ gestanden hat, ließ er
aber einstellen, weil er vermutete, daß es die Markscheide erreicht hatte (40014, Nr. 322, Film 0236f).
Am 30. Januar 1847 trug Markscheider Neubert dazu aus seinem Fahrbogen in Annaberg vor, daß Vulturius das Erkundungsort in der 12 Lachtersohle gegen Nordwest und Nordost angehauen habe und damit 8 Lachter fortgerückt sei (40169, Nr. 86, Rückseite Blatt 36). Außerdem werde ein Ort in derselben Sohle mit vielen Krümmungen gegen Südwest, West und Südost getrieben, das jetzt 28 Lachter Länge erreicht habe und nach seiner Auffassung die Markscheide zu Wilkauer vereinigt Feld erreicht habe, weswegen er dessen Einstellung angeordnet hatte. Dem stimmte man auf der Bergamtssitzung zu, allerdings sollte Herr Neubert vor weiterer Beschlußfassung die Risse nachbringen. Damit endet die Aktenüberlieferung zum Grubenbetrieb in den Fahrbögen der Berggeschworenen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im März 1849 hat Markscheider
Strödel als Schichtmeister von Wilkauer vereinigt Feld einen
vermeintlichen Überbau im Bereich der Großzechner Baue durch die
Nachbargrube angezeigt. Das Bergamt verbot daraufhin am 17. März des
Jahres natürlich erst einmal den Weiterbetrieb an dieser Stelle und
beauftragte den Geschworenen Troll, dies dem Eigenlöhner zu
übermitteln (40169, Nr. 86, Blatt 38).
Eine Rissnachbringung durch den Markscheider Neubert sollte die
Sache aufklären. Dabei stellte sich dann allerdings heraus, daß besagtes
Feldort noch 16 Lachter gegen West und 7 Lachter gegen Süd von der
Markscheide zurückstand. Das an Vulturius ausgesprochene Verbot
wurde daraufhin am 22. September 1849 wieder aufgehoben und die Kosten des
Markscheiderzuges mußte Wilkauer vereinigt Feld tragen (40169, Nr. 86, Blatt 39).
Vom Bergamt mit einer Besichtigung derselben beauftragt, fand Geschworener Troll am 11. Januar 1851 von den noch aus der Zeit vor der Einbringung des Arnimstollns 1841 stammenden Halden klaren Eisensteins nach immer eine solche Menge vor, daß man daraus noch etwa 80 Fuder verkaufsfähigen Eisenstein gewinnen könnte (40169, Nr. 86, Blatt 40). Danach gibt es eine zeitliche Lücke in der Aktenüberlieferung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Anzeige über den Grubenbetrieb auf
das Jahr 1856 zufolge hatte man in diesem Jahr bei Friedlich Vertrag
samt Kästners Hoffnung 7 Mann angelegt. Man hatte auf einem Firstenbau in der 7 Lachtersohle östlich des Friedlich Vertrag'er
Tageschachtes sowie in einem zweiten Firstenbau auf der 10 Lachtersohle
insgesamt 285 Fuder, 3 Tonnen Eisenstein gefördert, wovon 254 Fuder an den
Pfeilhammer verkauft, die restlichen 31 Fuder, 3 Tonnen aber als Neuntel
an Wilkauer vereinigt Feld gegangen sind
(40169, Nr. 86, Blatt 44).
Außerdem wurde beim Kästners Hoffnung'er Tageschacht in nur 5 Lachter Teufe
unter der Hängebank ein Ort weiter nach Westen getrieben. Anfallende Berge
wurden, soweit wie möglich, untertage für den Versatz der abgeworfenen
Baue verwendet.
Ab 1857 forderte das Bergamt dann Betriebspläne von den Bergwerksbetreibern ab. Dem ersten davon ist zu entnehmen, daß der Eisenstein von Friedlich Vertrag zu einem Preis von 1 Thaler, 10 Neugroschen pro Fuder verkauft wurde und daß man sich eine Förderung von etwa 100 Fudern in diesem Jahr erhoffte (40169, Nr. 86, Blatt 41f). Außerdem wurde am 29. April 1857 Hermann August Oehme bei dieser Grube als Schichtmeister angenommen und am 3. Juni 1857 vom Bergamt verpflichtet (40169, Nr. 86, Blatt 43 und 46). Dem Bergamtsprotokoll vom 30. Mai 1857 über die Umwandlung des Grubenfeldes nach den Maßgaben des Gesetzes über den Regalbergbau von 1851 zufolge (40169, Nr. 86, Blatt 45f) betrug die zur Grube gehörige Fläche jetzt 3.136 Quadratlachter oder 4 Maßeinheiten. Das waren 12.544 m² oder etwas über 12,5 ha. Der Anzeige über den Grubenbetrieb im Jahr 1857, die von nun an durch Schichtmeister Oehme erstellt wurden, ist zu entnehmen, daß in diesem Jahr 7 Mann auf Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung angelegt waren (40169, Nr. 86, Blatt 58ff). Man betrieb einen Firstenbau in 8 Lachter Teufe, sonst Örterbetrieb, und hatte dabei 437 Fuder 3 Tonnen Eisenstein gewonnen. Davon wurden 342 Fuder an den Pfeilhammer und nach Erla verkauft und 42 Fuder, 3 Tonnen als Neuntel an Wilkauer vereinigt Feld abgegeben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 10. Mai 1858 zeigte Faktor Ernst Julius Richter von der Eisencompagnie dem Bergamt Differenzen hinsichtlich des Eisensteinvermessens mit der Nachbargrube an (40169, Nr. 86, Blatt 47ff). Es kam zu einer Vorladung der Beteiligten nach Annaberg, bei der man sich auf feste Termine für die Durchführung (jeweils montags in der 6. und 13. Woche des Quartals) einigte. Außerdem war für den Zeitraum 1858/1860 wieder ein Betriebsplan zu erstellen. Nach diesem sah man vor, die Grube mit 6 Mann in Belegung zu halten und zwischen 320 und 400 Fuder Eisenstein zu fördern (40169, Nr. 86, Blatt 53ff). Der Plan wurde am 4. November 1858 auch vom Oberbergamt genehmigt (40169, Nr. 86, Blatt 59). Der Anzeige über den Grubenbetrieb im Jahr 1858 zufolge wurden in diesem Jahr mit 7 Mann Belegung sogar 558 Fuder Eisenstein ausgebracht, wovon wieder 496 Fuder für 1.184 Thaler verkauft, die übrigen 62 Fuder als Stollnneuntel an Wilkauer vereinigt Feld gegangen sind (40169, Nr. 86, Blatt 65f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Betrieb der Grube entwickelte sich
auch weiter sehr positiv. Nach einem Sitzungsprotokoll des Oberbergamtes
vom 13. August 1859 (in dem es um einen Rechnungsfehler in der
betreffenden Abrechnung ging) zahlte Friedlich Vertrag samt Kästners
Hoffnung allein im Quartal Trinitatis 1859 insgesamt 313 Thaler, 23
Neugroschen und 1 Pfennig Verlag zurück und zusätzlich noch 384 Thaler,
5 Neugroschen und 4 Pfennige Ausbeute (40169,
Nr. 86, Blatt 63). Herrn
Vulturius als Alleinbesitzer wird es gefreut haben... Dennoch
verkaufte er die Grube nun an die Besitzer von Wilkauer vereinigt Feld.
Das war sicher nicht unüberlegt, denn gerade jetzt war eine Blütezeit
erreicht und der Wert der Grube daher besonders hoch. Im Bergamt Annaberg wurde am 8.
Oktober 1859 die Konsolidation beider Gruben bestätigt (40169, Nr. 86, Blatt 64).
Zu ihrer weiteren Geschichte schlage man nun weiter unten im betreffenden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Meyers
Hoffnung gevierte Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorläufer von Meyers Hoffnung Fundgrube hat es wenigstens schon im Quartal Reminiscere 1744 gegeben. Im Verleihbuch des Bergamts Scheibenberg heißt es, „den 4. Martii ist Hrn. Johann Gottlieb Meyern, Erbrichter des Tännigt Hammerguths, auf seinem eigenen Grund und Boden, und zwar zum Zeitels Acker genandt, 1 Fundgrube, drauf der Gang St. 4¼ hält, auf Silber, alle Metalle und Mineralien verliehen und zum Zeißig Gesang genennet worden, vgl. Muthung sub No. 180.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 26) An gleicher Stelle fanden wir weitere Eintragungen aus dem Quartal Reminiscere 1746 und zwar: „Den 21. Januarii sind Christian Heinrich Schuberthen zu Raschau 2 Fundgruben in bereits altem Feld und Büngen auf Hrn. Gottlieb Meyers Grund und Boden auf Eisenstein, auch alle Metalle und Mineralien verliehen und zum geseegneten Jacob genennet worden, vgl. Muthung sub No. 200“ (40014, Nr. 43, Blatt 30). Am 9. Februar 1746 ist hier genanntem Herrn Schuberth „die obere nechste Maas nach der gesegneten Jacobs Fundgrube... noch verliehen worden“ und am 23. Februar außerdem „noch 4 Lehn auf 2 Posten auf Eisenstein, der gesegneten Jacobs Fundgrube und vorigem Felde zum Besten, wo er solche am thunlichsten befinden möchte.“ Aber auch die Familie von Elterlein, inzwischen auf dem Pfeilhammer in Pöhla ansässig, mischte hier mit. An gleicher Stelle liest man auch, daß „den 9. Fevbruarii Herrn Hannß Heinrich von Elterlein aufn Pfeilhammer 1 Fundgrube nebst des 1ten obern Maas auf Hrn. Gottlieb Meyers Erbguth in Tännicht auf Silber, Kupffer, Zinn, Eisenstein und alle Metalle und Mineralien verliehen und zur Hoffnung Gottes genennet worden (ist). Das Anhalten der Fundgrube soll in der alten Binge, welche itzo von neuem gewältigt worden, genommen und halb hinauf halb aber hinunter gestrecket werden, vgl. Muthung sub No. 202“ (40014, Nr. 43, Blatt 30). Am 20. April 1746 wurden Hans Heinrich von Elterlein hierzu noch weitere 8 Lehne auf 2 Posten verliehen (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 30). Letzterer blieb aber nicht lange hier im Feld, denn Reminiscere 1754 wurde unter diesem Grubennamen erneut eine Verleihung eingetragen: „Den 20. Martii ist von mir Samuel Enderlein, Bergmeister, 1 fundgrube und erste obere Maß auf Eisenstein, alle Metalle und Mineralien auf Hrn. Gottlieb Meyers in Tännicht Grund und Boden Christian Heinrich Reppeln, Bergarbeiter in Langenberg, verliehen und mit dem Nahmen Hoffnung Gottes benannt worden, wobey zu gedencken, daß das Anhalten im alten Schacht genommen werden soll.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 45)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Meyer’sche Erbgut mit dem Ostteil des Tännichtwaldes war also längst schon kein unberührtes Feld mehr, als dann die erste Mutung einer Fundgrube unter dem Namen der Hammergutsbesitzer im Quartal Trinitatis des Jahres 1797 erfolgt ist, worüber der nun dafür zuständige Geschworene im Scheibenberg'er Bergamt, Johann Samuel Körbach, sich notierte, er habe am 29. April 1797 „die neu gemuthete Eisensteinzeche Meyers Hoffnung Fundgrube im Tännigwald besichtiget und freygefahren...“ (40014, Nr. 196, Film 0027f) Seltsamerweise erfolgte diese Mutung am 28. Januar 1797 aber durch den Herrn Carl Gottlob Krauß auf eine Fundgrube „auf Carl Gottlieb Meyers Grund am sogenannten Töpferacker gelegen“ (40014, Nr. 191, Blatt 28). Diese Fundgrube wurde am 5. April 1797 auch bestätigt, erhielt dabei allerdings den Namen Meyers Hoffnung (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 188). Die Familie Krauß war aber auch mit eigenen
Am 9. Juni 1798 mutete dann Carl Gottlieb Meyer selbst „auf dem Tännig Guth“ die zweite und dritte obere Maß auf Meyers gevierter Fundgrube ‒ so wird sie jetzt genannt ‒ hinzu und erhielt diese auch am 4. Juli 1798 bestätigt (40014, Nr. 191, Blatt 40 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 19). Auch in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22 und 26) wurde Meyer's Hoffnung schon ab 1797 und noch bis 1871 aufgeführt. Die Grube hat sowohl Braunstein, als auch Eisenstein ausgebracht. Die Förderung an Braunstein summierte sich über den Betriebszeitraum auf insgesamt 6.735 Zentner (rund 337 t); an Eisenstein auf 4.793 Fuder bzw. rund 4.224 t.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurze Zeit nach der ersten Mutung durch Krauß berichtete der Berggeschworene, Johann Samuel Körbach, an das Bergamt in Scheibenberg (40014, Nr. 196, Film 0032): Über Meyers Fundgrube auf Eisenstein in Tännigwald bey Schwarzbach gelegen, „Allhier wurde bey 8 Ltr. saigerer Teufe unterm Tag ein Ort aus dem Schacht mit 4 Mann zu 3/3teln Belegung (als 3 für dem Ort und 1 zum fördern) auf dem Stunde 6,4 streichenden und stark in Mitternacht neigenden Lager in Abend betrieben, war von vorstehd. Schachtstoß 7¼ Ltr. betrieben, die Mächtigkeit des Eisenstein Lagers war noch nicht anzugeben, führte Hornstein, Quarz und grauen Eisenstein, fehlte schon sehr an Wettern.“ Ein Quartal später heißt es an gleicher Stelle (40014, Nr. 196, Film 0049): Meyers
gevierte Fundgrube im Tännigwald gelegen, „Dieses eigenlöhnerische Grubengebäude war mit 4 Mann beleget, wird der Bau bey 8 Ltr. saigrer Teufe unterm Tag auf dem Stunde 6,2 streichenden und stark in Nord neigenden Eisenstein Lager vermittelst Stroßenaushiebs von dem 8 Ltr. tiefen Tageschacht in Abend verführet, solches Lager führet Hornstein, Quarz und grauen Eisenstein und ist die Mächtigkeit noch nicht durchbrochen.“ Auch im nächsten Quartal war Herr Körbach pflichtgemäß wieder vor Ort und berichtete in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 196, Film 0062): Über Meyers Fungrube im Tännigwald gelegen, Luciae 1797 „ad. 1. Es wird bey diesem eigenlöhnerischen Grubengebäude ein Versuchsort aus dem 9 Ltr. tiefen Tageschacht auf dem (in) Morgen streichenden und stark in Nord fallenden Eisenstein Lager mit 3 Mann in Morgen betrieben, war vom Schacht 3 Ltr. erlengt. Solches Lager führet Hornstein und Quarz und grauen Eisenstein. 2. wird von ad. 1. gedachten Schacht bey 9 Ltr. Teufe westl. Entfernung 7 Ltr. vom Schacht mit 1 Mann überhauen auf dem Nord fallenden und Stunde 6,4 streichenden Lager. Die Mächtigkeit ist noch nicht zu bestimmen, weil solches noch nicht durchbrochen ist, führet Hornstein und grauen Eisenstein und Quarz.“ Aus dem gleichen Quartal findet man noch einen Vermerk in Körbach's Berichten an das Bergamt in Scheibenberg (40014, Nr. 196, Film 0069), er habe in der 5ten Woche Luciae 1797 sonnabends, „von Meyers Fundgr. bey Schwarzbach im Tännigwald 100 Fuder Eisenstein zum Rittersgrüner Hammerwerk vermessen lassen.“ Man hatte also bei Meyer´s Hoffnung nicht nur Versuchsbaue aufgefahren, sondern dabei durchaus schon etliche Tonnen verkaufsfähiges Eisenerz ausgebracht. Und hier ist auch der erste Abnehmer des Erzes genannt: Es waren die von Elterlein's auf dem Arnoldshammer bei Rittersgrün.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Eintragung in den Fahrbögen
Körbach's stammt schon aus dem Jahr 1798 und lautet (40014,
Nr. 196, Film 0116):
Fahrbogen
„Es wird bey 8 Ltr. Saigerteufe untern Tag von dessen Schacht 9 Ltr. westl. Endfernung mit 3 Mann auf dem Stunde 4 streichenden und in Nord fallenden, gegen 2 Ellen mächtigen Eisenstein Lager, so aus Hornstein und grauem Eisenstein bestehet, abgesunken, war 1¼ Ltr. tief niedergebracht mit 4 Ellen Länge.“ Im folgenden Quartal Crucis 1798 vermerkte der Geschworene nur kurz (40014, Nr. 196, Film 0131): „Allhier wurde das Versuchsort in Quergestein aus dem 2ten Tageschacht mit 2 Mann betrieben in der Stunde 11 gegen Süd in der Hoffnung, ein Eisenstein Lager anzufahren.“ Und auch im nächsten Fahrbogen gab es nur wenig Neues zu berichten (40014, Nr. 196, Film 0155): Meyers Fundgrube, Luciae 1798 „Es wird der untre Tageschacht mit 3 Mann, das Lager zu durchsinken, ferner niedergebracht, war 7 Lachter saiger tief und man hatte das Lager 3 Ellen durchschossen, führte grauen Eisenstein, Quarz und Hornstein.“ Reminiscere 1799 berichtete Herr Körbach (40014, Nr. 199, Film 0005f): „Befande den untern Tageschacht mit 3 Mann beleget, war in allem 7¼ Ltr. tief abgesunken bey 3 Ltr. saiger Teufe unterm Tag hat man das Stunde 6 streichende und in Süd fallende Eisenstein Lager ersunken, auf solchem ist der Schacht noch 4¼ Ltr. saiger niedergebracht und das Liegende Salband des Lagers noch nicht erreicht worden; solches Lager führet Hornstein, Quarz, einbrechenden Braunstein und grauen Eisenstein.“ Scheibenberg 26. Jan. 1799 Das hier ausgerichtete Lager nahm man auch sogleich in Verhieb, wie der Geschworene im folgenden Quartal Trinitatis 1799 notierte (40014, Nr. 199, Film 0021): Meyers Fundgrube im Tänigwald bey
Schwarzbach gelegen, „Es wurde der Bau im untern Tageschacht bey 5⅜ Ltr. Teufe auf dem Stunde 6,4 streichenden in Nord fallenden Lager mittelst Ortsbetriebes in Abend mit 3 Mann verführet. Das Lager führet Hornstein, Quarz und grauen Eisenstein.“ Noch ein Quartal später hatte man bereits einen dritten Schacht geteuft (40014, Nr. 199): „Es wird aus dem 3ten 9 Ltr. tiefen Tageschacht bey der Teufe ein Ort mit 3 Mann in Süd betrieben nach dem Fundschacht, mit gegengebrachten Ort in Verbindung zu bringen, Wetterwechsel zu verschaffen.“ 29. Julius 1799 Das Gegenort zu treffen, dürfte geklappt haben, denn Luciae desselben Jahres hielt Herr Körbach in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 199, Film 0067): „Allhier wurde der Bau bey 5¾ Ltr. Saigerteufe auf dem sehr mächtigen Eisenstein Lager in untern Tageschacht gegen Süd mit 3 Mann Förstenaushieb verführet, solches Lager führet Hornstein, Quarz und grauen Eisenstein.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf das Quartal Reminiscere 1800 notierte der
Geschworene nur, es sei bei Meyers gevierter Fundgrube
„nichts veränderliches ... vorgefallen.“ (40014, Nr. 200, Film 0019)
Ferner findet man in den Akten eine Mutung durch Carl Gottlieb Meyer, betreffend die erste bis dritte untere Maß zu Meyers Hoffnung gevierte Fundgrube, „auf dem Std. 6 streichenden in Nord fallenden Lager auf Eisenstein, auch alle Metalle und Mineralien,“ vom 13. Januar (40014, Nr. 191, Blatt 66). Das Schreiben ist allerdings falsch datiert (auf 1780). Die Bestätigung erfolgte am 30. oder 31. Januar 1800 (40014, Nr. 43, Blatt 213). Wieder ein Quartal später, in der 3. Woche Trinitatis 1800, heißt es dann fast gleichlautend (40014, Nr. 200, Film 0023f): „Allhier wird der Bau in unterm Tageschacht bey 7¼ Ltr. Teufe unterm Tag und bey 4 Ltr. westl. und nördl. Länge mittelst Ortsbetrieb mit 2 Mann betrieben. Solches Lager führt Hornstein und grauen Eisenstein und ist sehr mächtig.“ Man grub sich also mit dem Abbau weiter in die Tiefe und hatte inzwischen 7¼ Ltr. Teufe (rund 14,25 m) erreicht. Crucis 1800 begann man neben dem Abbau auch wieder mit Ausrichtungsarbeiten (40014, Nr. 200, Film 0035f): „Allhier wird der Bau bei 7¼ Ltr .Teufe im untern Tageschacht mit 2 Mann betrieben, wird ein Versuchsort in dem sehr mächtigen Lager in Abend betrieben, war vom Schacht 5½ Ltr. erlengt, wird in Stunde 8, das Lager führt grauen Eisenstein und Braunstein.“ Von seiner Befahrung im Quartal Luciae 1800 war zu berichten, daß man mit 2 Mann Belegung das „sehr mächtige Lager mit Hornstein, Quarz, Braunstein und grauem Eisenstein, im untern Tageschacht durch Ortsbetrieb und Förstenaushieb in Abend und Mitternacht“ abbaue (40014, Nr. 200, Film 0067). So verfuhr man auch weiterhin: Von der nächsten Befahrung berichtete Körbach (40014, Nr. 202, Film 0002): Meiers gevierte Fundgrube,
Eisensteinzeche im Tänigwald, „Wird der Bau im untern Tageschacht bey 8 Ltr. saiger Teufe auf dem sehr mächtigen Eisenstein Lager, so aus Hornstein und grauem Eisenstein bestehet, mittels Ortsbetriebs in Abend mit 2 Mann fortgestellt.“ Besagtes Ort befand der Geschworene Trinitatis 1801 auf 5⅞ Ltr. erlängt, sonst gab es nichts Neues zu berichten. Auch der Fahrbericht auf Crucis 1801 enthält nichts Neues, nur hatte man nun wieder „Strossenaushieb in West und Nord“ aufgenommen (40014, Nr. 202, Film 0034). Nach der Eintragung im Fahrbogen aus dem letzten Quartal 1801 wurde nun das Lager „bey 8 Ltr. Teufe in Abend 2 Ltr. westl. vom Schacht... im Überhauen abgebaut“. Außerdem wurde zugleich in 7 Ltr. Teufe ein Ort in Morgen betrieben, „das Lager zu untersuchen.“ (40014, Nr. 202, Film 0050) Reminiscere 1802 fand Herr Körbach nichts Neues zu berichten. Trinitatis 1802 hatte man den Abbau in 8 Lachtern Teufe bereits auf 17 Lachter Länge vom Schacht fortgeführt (40014, Nr. 202, Film 0081). Man baute „mittels Überhauen“ ‒ also in der Firste der Strecke ‒ das Lager ab, welches in Stunde 9 streiche und immer noch als „sehr mächtig“ beschrieben wird, aber das nun auch „mehrentheils Hornstein ist und grauer Eisenstein mit einbricht und Braunstein.“ Hm. Es waren eben doch keine aushaltenden ,Lager´, sondern nur Nester und Linsen im Quarzbrockenfels... Am 15. Juni 1802 zeigte Körbach dem Bergamt an, daß Herr Meyer von Herrn Kräher das Zufüllen seines alten Stollens verlange, was doch wider die Bergordnung sei, weswegen er die Angelegenheit dem Bergamt zu weiterer Resolution überlasse (40014, Nr. 191, Film 0097).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Außer, daß die Belegung auf nun 4 Mann leicht
angestiegen war, fand sich auch Crucis 1802 nichts wirklich Neues zu
berichten (40014, Nr. 202, Film 0096). Bis Luciae 1802 hatte man den
Firstenbau schon auf 3 Lachter Höhe ausgehauen (40014, Nr. 202, Film 0108).
An dieser Stelle hatte man jedenfalls eine größere Linse gefunden, denn auch Trinitatis 1803 noch „Wurde der Bau bey 8 Ltr. saiger Teufe untern Tag bey 5½ Ltr. westlicher Länge vom Tageschacht der Förstenbau mit 4 Mann zu 2/3tel Belegung in dem sehr mächtigen Eisenstein Lager betrieben.“ (40014, Nr. 209, Film 0028) Das ging so fort und Herr Körbach fand nur selten etwas „Veränderliches“ vor. Crucis 1803 etwa heißt es wieder, der Firstenbau habe schon 3 Lachter Höhe erreicht und man nehme nun wieder „Versuchsortbetrieb in Südwest und sodann Först- und Stroßenaushieb“ auf (40014, Nr. 209, Film 0052).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1804 wurde mit 3 Mann Belegung ausgehend
von einem zweiten Tageschacht bei 7 Lachter Teufe ein neues Versuchsort gegen
Süd getrieben, welches 2¼ Lachter erlängt gewesen ist. Körbach wies dazu
an, man solle vor der Aufnahme des Abbaus mit dem Ort noch fortgehen, weil
es noch sehr nah am Schacht stehe (40014, Nr. 213, Film 0008).
Außerdem hatte der Eigenlöhner Meyer 36 Lachter in Abend einen dritten Schacht anlegen lassen, um bis auf die vom zweiten Schacht bei 8 Lachter Teufe in Abend betriebene Strecke durchzuschlagen und dem dort verführten Bau bessere Wetter zu verschaffen. Dieser stand schon bei 3 Lachter Teufe, wo man aber zu viel Wasser erschroten hatte und deshalb nicht weiter absinken konnte. „Bei dem vielen Schnee und Regenwetter“ sei dieser dann noch im Quartal Luciae 1803 wieder zusammengebrochen. Im folgenden Quartal berichtete Herr Körbach, daß man nun vom zweiten Tageschacht aus ein neues Versuchsort in 7 Lachtern Teufe in Mittag betreibe (40014, Nr. 213, Film 0018). Bei seiner nächsten Befahrung noch im Quartal Trinitatis 1804 heißt es dann, das Ort werde weiter fortgestellt und zugleich habe man ein zweites Versuchsort nach Nordosten in 8 Lachtern Teufe aufgenommen (40014, Nr. 213, Film 0021). Das Eisensteinlager wird wie vorher beschrieben: Es sei „sehr mächtig“, führe Quarz, Hornstein und es breche Braunstein mit ein. Crucis 1804 heißt es dann im Fahrbogen, die Grube war nach wie vor mit 3 Mann belegt und vom zweiten Tageschacht in Morgen und Mittag werde erneut ein dritter Schacht angelegt, der aber erst gegen 1 Lachter tief war. Von diesem aus soll wieder ein Ort nach Mitternacht Abend auf den Bau durchgeschlagen werden, um diesem bessere Wetter zu verschaffen (40014, Nr. 213, Film 0032). Im letzten Quartal des Jahres 1804 berichtete der Geschworene, der neue Tageschacht sei nun 7 Lachter tief und von dort aus treibe man „Versuchsarbeit (...) in Ost und Süd in dem sehr mächtigen Lager“ (40014, Nr. 213, Film 0053). Außerdem liest man, daß Herr Körbach „von Meyers Fundgrube 40 Fuder Eisenstein zum Breitenhofer Hammer“ hat vermessen lassen (40014, Nr. 213, Film 0056). Es kam also durchaus etwas dabei heraus und das geförderte Erz ging diesmal nach Breitenbrunn...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob man den Durchschlag einer Wetterstrecke zwischen den
Tageschächten bewältigt hatte, erfährt man aus dem Fahrbogen Körbach's
auf Reminiscere 1805 nicht. Man befaßte sich weiter auf den Örtern vom
neuen Tageschacht mit „Förstenaushieb in dem sehr mächtigen Lager, so
Hornstein, Braunstein, Quarz und grauen Eisenstein führt“ (40014,
Nr. 232, Film 0002). Nun, solange die Belegschaft untertage noch atmen
konnte, ging das Ausbringen natürlich vor...
Bis Crucis 1805 hat sich daran wenig geändert, nur trieb man jetzt ein neues Versuchsort in 6 Lachtern Teufe gegen Osten. Dort scheint das Lager allerdings weniger bauwürdig gewesen zu sein, denn der Geschworene notierte dazu, das Lager führe hier „Hornstein, aufgelöste Eisenerde, bricht ab und zu etwas grauer Eisenstein mit ein.“ (40014, Nr. 232, Film 0022) Und Luciae 1805 heißt es dann, man treibe schon wieder ein neues Versuchsort, nun in 4 Lachtern Teufe nach Süden (40014, Nr. 232, Film 0036). Wie wir schon wissen, ist Johann Samuel Körbach dann 1806 aus seinem Dienst ausgeschieden. Der Bergamtsprotokollist Friedrich August Schmid, welcher ihm in der Funktion zunächst nachfolgte, aber wohl nicht für alle Gruben des Scheibenberg'er Reviers zuständig gewesen ist, besuchte Meyers gevierte Fundgrube 1806 nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Funktion des Berggeschworenen in Scheibenberg hat
1806 Herr Christian Friedrich Schmiedel übernommen. Der neue
Geschworene weilte in der 12. Woche Reminiscere 1806 auch in Schwarzbach
und hielt in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 235, Blatt 21f):
„Auf Meiers gevierde Fundgrube, Eigenlöhner Zeche bei Schwarzbach gefahren. Belegung und gangbare Baue. Dieses Eisenstein Gebäude ist dermalen mit 2 Mann, nämlich 1 Häuer oder Versorger und 1 Lehrhäuer belegt, durch welche bei 4½ Lachter Teufe des 2ten Tageschachts ein Ort Stunde 10,1 gegen Mittag in der Absicht betrieben wird, um das bei 4 Lachter Teufe des vom vorgenannten einige 50 Lachter gegen Mittag entfernten 1ten Tageschachtes ersunkenen, 1 Lachter mächtige, einige 30 Grad gegen Mitternacht einschießende Eisensteinlager anzufahren. Dieses Ort hat nunmehr eine Länge von 5 ⅛ Lachter vom obenerwähnten 2ten Tageschacht erhalten. Sodann wurde dem Versorger des Gebäudes die sehr fehlerhafte Zimmerung für die Zukunft untersagt, statt deren aber zweckmäßige und beßere und nach der demselben hierüber besonders gegebene Anweisung herzustellen, aufgegeben.“ Die Mängel im Ausbau hat man wohl abgestellt, denn sie wurden im nächsten Quartal nicht mehr erwähnt, da es in Schmiedel's nächstem Fahrbogen über Meiers gevierte Fundgrube heißt (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 47 und Blatt 48): Belegung und gangbare Baue. „Dieses Gebäude ist mit 2 Mann, als dem Versorger und 1 Lehrhäuer belegt, durch welche a.) bei 6 Lachter Teufe des 1ten Tageschachtes ein Ort mit 1 Mann Stunde 11 gegen Mitternacht in dem daselbst ersunkenen Eisen- und Braunstein führenden Lager so wie b.) in dieser Teufe ein anderweites Ort Stunde 8,4 gegen Abend, ebenfalls mit 1 Mann getrieben wird. Ersteres ist 3¾, letzteres aber 3 Lachter erlängt. Nur gedachtes Lager ist 1 bis 1¼ Lachter mächtig, fällt etliche 30 Grad gegen Mitternacht und besteht aus Gneis, kristallisirtem Quarz, braunen Eisenstein und Braunstein.“ Crucis 1806 war der Geschworene wohl nicht auf dieser Grube. Im letzten Quartal aber war Herr Schmiedel am 2. November wieder dort und berichtete hierüber (40014, Nr. 235, Blatt 125f): „Auf Meyers gevierte Fdgr. im Tännigwalde zu Schwarzbach gefahren. Dieses Eigenlehner Gebäude ist mit 2 Häuern belegt, durch welche bei 6 Lachter Teufe des Tageschachtes auf einem Eisensteinlager zwei Örter, nehmlich das eine Stunde 9,5 gegen Mitternacht Abend und das zweite Stunde 5,6 gegen Abend betrieben werden. Ersteres ist 7 Lachter, letzteres aber nur 4¾ Lachter erlängt. Gedachtes Lager ist hier 1¾ Lachter mächtig, fällt etliche und 60 Grad gegen Mitternacht und besteht aus drusigem, kristallisirtem Quarz, Hornstein, ockerigen Brauneisenstein und Braunstein, von welchem letzteren sich gegen 70 Centner in Vorrath, jedoch unverwogen bei der Hängebank befinden.“ Aha, man richtete nun das Interesse auch auf das Manganerz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über eine Befahrung der Grube durch den Bergmeister Schütz am 13. August des Jahres 1806 wurde im Bergamt festgehalten (40169, Nr. 244, Blatt 2ff): „Das Berggebäude Meyers gevierte Fundgrube wird von den Erben des unlängst verstorbenen Besitzers des Tännicht Hammerguthes zu Schwarzbach, Hrn. Meyer, auf Eisen und Braunstein betrieben, liegt nahe vor selbigem auf gegen Süd Ost ansteigenden Gebirge beym Tännicht Walde und ist mit 2 Mann belegt, durch welche in der Sohle eines 6 Lachter tiefen Tageschachtes zwey Örter, und zwar das eine nach dem Fallen des dasigen Lagers Std. 9,6 gegen NW., das andere aber nach dem Streichen desselben Std. 3 gegen Südwest getriebene werden. Ersteres ist 6 Lachter, letzteres hingegen 8 Lachter vom Tageschacht erlängt und bricht vor selbigen in dem aus derbem und drusigem Quarz und Hornstein bestehenden, mit Braunstein, gelben und ockerichten Brauneisenstein gemengten, mehrere Lachter mächtigem Lager dichter Braunstein in derben Nieren mit ein, welcher letzterer ausgehalten und an den Kaufmann Nikolai in Schneeberg pro Centner 12 Groschen verkauft wird. Seit dem Quartal Luciae 1797 bis jetzt sind von diesem Gebäude überhaupt 370 Ctr. Braunstein und 748 Fuder Eisenstein, letzterer á Fuder 2 Thl. ‒ Gr. ausgebracht und verkauft worden. Veranstaltungen haben der Hr. Bergmeister bey dieser Befahrung folgende: 1.) In Ansehung des zeither nach dem mit ohngefähr 15 bis 20 Graden gegen NW. gerichteten Fallen des Lagers getriebenen Ortes, daß solches hinführ nach dem steigen desselben Std. 3,6 gegen NO. fortgebracht und der damit ausgerichtet werdende Braun- und Eisenstein mittelst anzulegender regulärer Förstenbaue abgebaut, ingleichen 2.) bey der Gewinnung des Braunsteins in der Grube mehrere Sorgfalt als zeither angewendet und nicht so viel von diesem Fossil mit den Bergen über die Halde gestürzt, auch eine Klaubebühne bey der Grube eingerichtet und auf selbiger sowohl die zeither geförderten, auf der Halde ausgestürzten, als auch die künftig gefördert werdenden Berge möglichst rein ausgeklaubt werden sollen.“ nachr. Fr. A.
Schmid, Wir erfahren hieraus zum einen, wohin
Anfang des 19. Jahrhunderts denn eigentlich der Braunstein verhandelt
worden ist (zumindest vonseiten der Meyers Hoffnung Fundgrube), nämlich an einen Kaufmann Nikolai in Schneeberg.
Besagter Kaufmann Johann August Nikolai in Schneeberg war zu dieser
Zeit auch Senator im Stadtrat (30016, Nr. 1134).
Viel mehr haben wir über ihn aber bislang noch nicht in Erfahrung bringen
können. Wir erinnern uns aber in diesem Zusammenhang, daß 1717 Herr Flemming ein
Zum anderen lesen wir, daß Carl Gottlieb Meyer im Jahr 1806 verstorben ist. Der Besitzwechsel könnte ein Grund gewesen sein, daß der Bergmeister selbst nach Tännicht gekommen ist. Die hinterbliebenen Kinder waren offenbar noch nicht mündig:
und zeigten am 22. August 1806 gemeinsam dem Bergamt die Neubesetzung der Schichtmeisterfunktion an (40169, Nr. 244, Blatt 1): „Eu. Hochwohlgeb. haben (wir) hiermit anzuzeigen nicht ermangeln können, was maaßen der Stadtrichter Herr Ficker in Elderlein seine Function als zeither angestellt gewesener Schichtmeister auf unserem Grund und Boden des Tännicht Hammerguths bey Schwarzbach, so genannte Meyers Hoffnung geführte Fundgrube liegend sich resolvirt und beschlossen aufzugeben und niederzulegen. Da nun zu Besetzung dieser Stelle wiederum ein Mann nöthig ist, also haben wir den Schichtmeister Herr Gottlob Friedrich Müller in Großpöhla Eu. Wohllöbl. Bergamt in unmaßgeblichen Vorschlag zu bringen, solchen hochgeneigtest an- und nach übernommenen Gebäude in Pflichten zu nehmen, die wir übrigens mit der respectuorsesten Hochachtung allstets verharren.“ Über die geschraubte Schriftsprache unserer Altvorderen könnte ich mich immer wieder amüsieren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch Meyers Hoffnung Fundgrube
wurde im Jahre 1807 durch die Beamten des Oberbergamtes inspiziert und so
gibt es auch zu dieser Grube einen ausführlichen Aufstand aus ebendiesem
Jahr (40001, Nr. 115, Blatt 91ff, Abschrift in
40169, Nr. 244, Blatt 4ff), dagegen aber keine weiteren Fahrbögen des
Geschworenen Schmiedel:
praes. 4ten Juli 1807
Aufstand und Grubenbericht „1.) Sind bey diesem Gebäude 2 Schächte von Tag nieder 6 Lachter abgeteufet, worauf etwas Eisenstein, so lagerweise gebrochen, gewonnen, zu Tage ausgebracht und an das Hammerwerk zu Rittersgrün vermeßen und verkaufet worden. 2.) Ist bey den ersten Tageschacht, bey 6 Lachter Teufe ein Ort aufgefahren, und 20 Lachter in Quergestein gegen Morgen erlängt, so wie auch ein Ort im erwähnten Schacht und Teufe gegen Mittag aufgefahren, und 13 Lachter gegen Mittag in Quergestein, einbrechenden Horn (Hornstein) und Quarz fortgestellet, vor obgedachten Örtern aber, als auch im Schacht selbst ist sowohl von Eisenstein, als andren Metallen etwas nicht zu bemerken gewesen. 3. Beym zweyten Tagschacht ist nach 6 Lachter Teufe ein Ort gegen Abend aufgehauen und 3 Lachter in Quergestein erlängt, so wie auch ein Ort gegen Mitternacht aufgehauen und 4 Lachter in Quergestein fortgestellet worden. Bey Erlängung gedachter Örter aber sind 45 Fuder Eisenstein und 60 Ctr. Braunstein, so nierenweise eingebrochen, gewonnen und zu Tage ausgebracht worden, welches beydes sich bey der Grube noch unvermeßen und unverwogen befindet. 4.) Ist gedachtes Gebäude mit 1 gevierten Fdgr. und 3 gevierten Maaßen belehnt. 5.) der Receß beläuft bis mit Schluß des Quartals Reminiscere 1807 auf 485 Thl. 23 Gr. 6 Pf. 6.) Da von den, bey diesem Gebäude ausgebrachten Producten bis gegenwärtig noch keine Abnahme gewesen, so ist zeithero solches mit Frist verrechnet worden. Glück Auf. Gotthelf Friedrich Müller, Schichtmstr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der oben stehende Aufstand, welcher
allein durch den Schichtmeister erstellt worden ist, genügte offenbar dem
Oberbergamt nicht und so gibt es dazu noch folgende Ergänzung (40001,
Nr. 115, Blatt 94f):
Zur Erläuterung Des vorliegenden Aufstandes, welcher den hohen Ortes ertheilten Vorschriften nicht entspricht, aus diesem Grunde daher nicht anbefohlenermaaßen zu vereinnahmen (?) war, hat Subscriptus folgendes anhero zu bemerken: Anbricirtes Grubengebäude, so dem verstorbenen Besitzer des Tännig Hammerguthes zu Schwarzbach, Hermann Meyer, vor nicht langer Zeit erst aufgenommen worden, und auf Eisen und Braunstein betrieben wird, liegt südlich von dem Dorfe Schwarzbach und in kurzer Entfernung vor selbigem und dem Schwarzbach am Fuße des aus dasigem Thal ziemlich steil gegen Südost ansteigendem Gneusgebirge. Das auf diesem Gebäude bebaut werdende Eisensteinlager streicht St. 3,6 und fällt unter einem Winkel von 15-20° gegen NW: Es besteht selbiges aus mehrere Lachter mächtigem, dichten, nierenweise einbrechenden Braunstein, gelbem und ockerigen Brauneisenstein, Hornstein und derbem, auch drusigem Quarz. Über den ehemaligen Betrieb und die dabei zum Grunde gelegten Pläne läßt sich deshalb nichts sagen, weil zuvor (?) in den Förderstroßen gewöhnlich die abgebauten Puncte wiederum mit Bergen versetzt worden sind. Dermalen sind in der Sohle des 6 Lachter tiefen Tageschachtes zwei Örter, das eine nach dem Streichen des Lagers St. 9,6 gegen NW., das andere nach dem Streichen desselben St. 3,6 gegen SW. in Umtriebe. Ersteres ist sechs, letzteres acht Lachter vom Tageschacht erlängt und besteht das beschriebene Lager daselbst (?) aus den bereits namhaft gemachten Bestandtheilen. In Zimmerung steht blos der Tageschacht. Die Förderung erfolgt mittelst Karrenlaufens und Haspelzugs (?), sowie von Waßern bis jetzt nur wenig vor den Örtern, noch gar keine Hindernisse erwachsen sind. Dieses übrigens gegenwärtig von den Erben des Aufnehmers in Gemeinschaft betrieben werdende Gebäude ist völlig vergewerkt. Die Zubuße (?) ist im Qu. Rem. a. c. – Thl. 1 Gr. 17/25 Pf. gewesen. Da solches jetzt in Fristen gehalten wird, so hat sämtliche Quartalskosten nur 5 Thl. 20 Gr. – Pf. betragen. Der Receß besteht in 485 Thl. 25 Gr. 6 Pf. und seit dem Qu. Luc. 1802 sind 748 Fuder Eisen und 385 Ctr. Braunstein, dieser á Ctr. – Thl. 12 Gr. – Pf., jener á Fuder 2 Thl. – Gr. – Pf. ausgebracht und verkauft worden. Alle Aussichten und Betriebspläne beruhen bei gegenwärtiger Grube auf dem Abbau (?) des qu. Eisen und Braunsteinlagers. Dieses Lager, so bereits mehrere Lachter mächtig befunden worden, ist inzwischen zur Zeit noch zu wenig untersucht und erkannt, als daß diesfalls mit Zuverlässigkeit etwas festzustellen wäre, vielmehr dürfte vor der Hand lediglich ein regulärer Abbau desselben mittelst anzulegender Förstenbaue anzuordnen sein.“ Annaberg, im Monat
Juni 1807,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch diese Befahrung wurde im Bergamt zu
Scheibenberg ausgewertet und dazu Folgendes festgehalten (40001, Nr. 115,
Blatt 95ff, Abschrift in 40169, Nr. 244, Blatt 7ff):
Commissarische
Befahrungs Registratur Gegenwärtige: Generos. Deo. Commiss. Se. Hochwohlgeb. Herr Bergcommissionsrath von Herder, Herr Bergmeister Schütz, Geschworener Schmidt aus Annaberg, so auf commiss. Anordnung bei dieser Befahrung zugegen war Geschworener Schmiedel, hierüber Actuarius Scheuchler aus Freyberg, auch Herr Accis Einnehmer Müller aus Pöhla als Schichtmeister. Im Verfolge der (von) Generos. Deo. Commissario an dem heutigen Tage angeordneten Befahrungen mehrerer Grubengebäude im Scheibenberger Bergamts Revier haben hochdieselben sich mit den obbezeichneten Personen auch auf das Eigenlehner Gebäude Meiers Hoffnung gev. Fdgr. bey Schwarzbach begeben, und ist über die daselbst stattgefundene Befahrung vorliegende Registratur aufgenommen worden. Auf dem allhier bebaut werdenden Braun- und Eisensteinlager befinden sich dermalen 2 Örter im Umtriebe. Das eine dieser Örter wird aus dem sechs Lachter tiefen Tageschachte im Quergestein gegen Abend fortgebracht, ist 3 Lachter erlängt und wird das daselbst erreichte Lager mittelst eines Örtchens mit ansteigender Sohle gegen Mitternacht weiterverfolgt und abgebaut. Gedachtes Lager schießt allhier, so weit solches dermalen zu beurtheilen ist, in Mittag ein, ist gegenwärtig Orts mächtig und führt Quarz, Horn (Hornstein) und Braunstein als Bestandtheile, letzteren jedoch hauptsächlich nierenweise und in der Förste. Übrigens ist sothanes Ort mit 1 Mann belegt. Auf demselben Lager wird hiernächst annoch ein Ort mit 1 Mann in Abend betrieben. Es ist solches 5 Lachter fortgebracht und bricht vor selbigem der Braunstein ebenfalls nierenweise, doch in Verbindung mit Eisenocker. Dagegen ist auf bemerktem Lager zur Zeit von Eisenstein etwas bauwürdiges noch nicht erreicht worden und hofft man solchen nur erst bei mehrer Aufschließung des Lagers nach Abend zu erreichen. Gegenwärtig ist daher die nächste Absicht bei dem Betriebe ermalter Örter die Aufsuchung und Abbauung von Braunstein, entfernter aber annoch die Aussicht, allhier mittelst Lagerung mit einem Schachte in Abend und Niederbringung desselben einen nachhaltenden Bergbau auf Eisenstein zu etablieren. Generos. Deo. Commissarius haben in dieser Hinsicht den Grubenbesitzern (?) aufgegeben, bei Erreichung sothaner Eisensteinlager für regelmäßigen Abbau desselben um so mehr Sorge zu tragen, da dieser Grube, als der am äußersten Ende des dasigen Eisensteinbergbaus gelegene, noch viel frisches Feld vorliegen würde, welches einem regelmäßigeren Betrieb zulassen werde, als bei den übrigen Eisensteinzechen dieser Gegend möglich gewesen, in welchem Falle, nämlich wenn gedachtes Lager angefahren sein werde, das Bergamt für die nähere Begutachthung sothanen regelmäßigen Abbaus des nähere verfügen solle.“ Unterzeichnet von
Friedrich August Schmid und
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der hochamtlichen Generalbefahrung
findet sich eine neue Notiz über die Anwesenheit des Geschworenen
Schmiedel in seinen Fahrbögen erst wieder vom 11. Januar 1808 (40014,
Nr. 236, Rückseite Blatt 1). Darin ist festgehalten, es „Sind in meinem
Beysein bei Meyers gevierde Fundgrube zu Schwarzbach 90 Centner Braunstein
verwogen worden, übrigens aber war in Ansehung des Grubengebäudes gegen
meine letzten Befahrung keine Veränderung vorgefallen.“
Die Schreibweise des Namens wechselt übrigens in den Akten mehrfach: Mal heißt es ,Meyers' und mal ,Meiers'... Wir schreiben es hier gewöhnlich so ab, wie es auch der Geschworene notiert hat. Die Träger des Namens schrieben diesen selbst mit einem Ypsilon in der Mitte. Die nächste Befahrung durch den Geschworenen erfolgte am 11. April 1808. Der Lehrhäuer hatte wohl inzwischen ausgelernt, denn die Belegung wird nun mit zwei Doppelhäuern angegeben. Über den Abbau heißt es, man treibe in 6 Lachtern Teufe wieder ein neues Ort Stunde 7,0 gegen Ost, das auf 1½ Lachter erlängt sei. Dort war das Lager „über 1 Lachter mächtig, fällt 30° gegen Abend, streicht Std. 1,6 und besteht aus Gneis, derbem und krystallisirten Quarz und ½ bis ¾ Elle mächtigen Braunstein.“ Außerdem betreibe man auf demselben Lager ein zweites Ort Stunde 9,6 gegen Nordwest, welches schon 5½ Lachter fortgestellt war. Dort führe das Lager „etwas Braunstein, auch bisweilen nierenweise ockerigen gelben Eisenstein.“ (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 29) Bei seiner Befahrung in Crucis 1808 fand Herr Schmiedel das erstgenannte Ort mit einer Richtung Stunde 7,1 auf 2¼ Lachter fortgestellt, sonst aber nichts neues zu berichten (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 61). Und Luciae 1808 schließlich war das erste Ort, nun mit einer Richtungsangabe von Stunde 7,2, nach Ost 3¼ Lachter erlängt, das zweite hingegen mit der Richtungsangabe Stunde 10,0 gegen Südost auf 6 Lachter Länge fortgebracht (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 94). Das Lager streiche Stunde 1,6 und fiel 20° nach West bei 1 bis 1½ Lachter Mächtigkeit. Und man hatte auch wieder Ausbringen zu verzeichnen: „Sodann wurden annoch bei dieser Grube 20 Centner Braunstein verwogen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So ging der Betrieb auch im Folgejahr
weiter und von seiner Befahrung am 10. Januar 1809 fand Herr Schmiedel
über Meiers Fundgrube noch nichts bemerkenswertes zu
berichten (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 104).
Am 2. Februar 1809 war die Belegung auf 3 Mann zeitweise etwas angestiegen und man hatte schon wieder zwei neue Örter angesetzt: Es wurde nämlich „1.) ein Ort bei 6 Lachter Teufe Stunde 2,6 gegen Süd getrieben, das zurzeit 1⅛ Lachter erlängt ist. Sodann wird 2.) in derselben Teufe ein Ort Stunde 7,2 gegen Abend gefahren, dieses ist jetzt 3 Lachter lang.“ (40014, Nr. 236, Blatt 118). Von einem systematischen Abbau kann bei den im Brockenfels eingestreuten Erzlinsen auch hier kaum die Rede sein. Trinitatis 1809 hatten sich die Vortriebsrichtungen der beiden Örter weiter verschwenkt. Für das erste wird vom Geschworenen nun die Stunde 4,4 gegen Südwest und für das zweite Stunde 10,0 gegen Nordwest angegeben. Das erste hatte man auf 4 Lachter Länge fortgestellt, das zweite auf 6½ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 236, Blatt 136f). Das führte man so fort und bei seiner nächsten Befahrung am 14. Juli 1809 maß Herr Schmiedel für das erste Ort eine Richtung Stunde 3,5 gegen Südwest (dieses hatte nun 6 Lachter Länge erreicht), während man mit dem zweiten in die Richtung Stunde 10,2 noch weiter abgeschwenkt ist und nunmehr 7 Lachter Länge aufgefahren hatte (40014, Nr. 236, Blatt 163). Crucis 1809 hatte man diese Untersuchungsörter aufgegeben und „in mildem Gneise“ einen neuen Tageschacht 8 Lachter tief abgesunken (zuletzt war der dritte ja Luciae 1803 verbrochen). Von diesem aus fuhr man ein Ort „auf dem Stunde 4,3 streichenden und 30 Grad gegen Mitternacht Abend fallenden Lager Stunde 11,6 gegen Mittag", welches jetzt 2½ Lachter weit reichte, und ein zweites Ort Stunde 5,5 gegen Nordost, das aber erst ½ Lachter Länge erreicht hatte. Über das angefahrene Lager heißt es: „Besagtes Lager ist ½ bis ¾ Lachter mächtig, besteht aus gelbem Ocker, braunem Hornstein, mildem Gneis, gelben und braunem Eisenstein.“ (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 184f) Der hier neuerdings auch vorgefundene Eisenocker wird später als mineralisches Farbpigment noch von einigen Gruben der Region gezielt abgebaut. Bei seinen Befahrungen im Quartal Luciae 1809 fand Herr Schmiedel zunächst nichts neues vor (40014, Nr. 236, Blatt 196 und Rückseite Blatt 203). Am 29. Dezember 1809 war der Geschworene noch einmal vor Ort und berichtete, daß man nun auf der in 8 Lachtern Teufe vom (dritten) Tageschacht abgehenden Strecke Stunde 12,3 gegen Nord, bei 8 La Länge ein Überhauen betreibe, um diese mit einer 1½ Lachter höher vom Fundschacht herankommenden, alten Strecke durchschlägig zu machen und frische Wetter in den neuen Tageschacht zu bringen. Dieses Überhauen war 1 Lachter lang und inzwischen 1 Lachter über die Streckenfirste „in gelbem Ocker mit untergemengtem Quarz“ erhöht, es fehlte also noch etwa ½ Lachter Höhe. (40014, Nr. 236, Blatt 220f) Und es gab auch wieder Ausbringen zu verzeichnen: „Sodann wurden 33 Centner Braunstein vermessen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Befahrung am 12. April 1810 auf
Meiers Hoffnung notierte Herr Schmiedel, die Grube sei
weiterhin mit 2 Mann belegt, welche das Ort auf dem Lager in 8 Lachter
Teufe Stunde 5,5 gegen Nordost bei nun 11½ Lachtern Länge weitertreiben.
Hier bräche im Lager auch immer Braunstein mit ein (40014, Nr. 245, Film
0042f)
So lief es wieder ein paar Monate weiter und erst Crucis 1810 fand Herr Schmiedel wieder Grund für eine Notiz, denn nun baute man in nur noch 6 Lachtern Teufe „des alten Tageschachts“ auf einem Ort Stunde 2,1 gegen Süd, das nunmehr 6½ Lachter fortgebracht sei. Vor dem Ort sei das Lager „½ bis ¾ Lachter mächtig, fällt 20 Grad gegen Abend und besteht aus gelbem Ocker, Quarz, Braunstein und nierenweise einbrechendem ockerigen und dichten Brauneisenstein.“ (40014, Nr. 245, Film 0087) Bei der nächsten Befahrung am 31. Oktober 1810 war dieses Ort auf 7¼ Lachter Länge fortgestellt und es waren auch wieder 33 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 245, Film 0115) Am 6. Februar 1811 fand der Geschworene demgegenüber keine bemerkenswerte Veränderung vor, nur waren diesmal 20 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 245, Film 0153) Am 28. März des Jahres fand Herr Schmiedel drei Mann auf Meiers Hoffnung angelegt. Die trieben in 6 Lachter Teufe des Fund- oder Tageschachtes auf dem ein Ort Std 2,3 gegen Mittag weiter vor, allerdings war nach der Angabe Schmiedel's, es habe nun 7½ Lachter Länge, nur ein halber Lachter (≈ 0,5 m) hinzugekommen. Statt des weiteren Vortriebs wurde aber „hinter selbigem ein Förstenaushieb von ½ Lachtern Höhe nachgerißen.“ Über das hier abgebaute Lager heißt es, es streiche Stunde 3,7, falle 20° gegen Nordwest, ist 1½ bis 2 Lachter mächtig und „besteht aus gelbem Ocker, mildem Gneis, Quarz, braunem Hornstein, vielem Braunstein, auch nierenweise einbrechendem gelbem und braunem ockerigen Eisenstein.“ Sodann wurden auch wieder 25 Zentner Braunstein verwogen (40014, Nr. 245, Film 0178). Zwei Monate später war der Geschworene wieder auf der Grube, fand das Streckenort nunmehr 8¼ Lachter fortgestellt und hatte diesmal wieder 12 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 245, Film 0206). Bis zu seiner Befahrung am 26. August 1811 hatte man wohl schon wieder die Grubenfeldgrenzen erreicht und trieb nun ein neues Ort in 6 Lachtern Teufe Stunde 7,2 gegen West auf dem Lager vor, was auch schon 9⅛ Lachter erlängt war (40014, Nr. 245, Film 0239f). Die letzte Befahrung in diesem Jahr fand am 23. Dezember statt und nun fand Herr Schmiedel das Streckenort auf 9¾ Lachter ausgelängt und gab die Richtung dieser Strecke mit Stunde 7,5 gegen West an (40014, Nr. 245, Film 0286). Dabei hatte man bis zum 15. Januar 1812 wieder 50 Zentner Braunstein ausgebracht, die durch den Geschworenen zu verwiegen waren (40014, Nr. 250, Film 0010).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Abbau stand auch im Jahr 1812
kontinuierlich in Umgang. Am 25. März 1812 befand der Geschworene in immer
noch 6 Lachtern Teufe erneut ein neues Ort vor, und zwar in Stunde 10,2
gegen Mittag, dieses war schon wieder 6½ Lachter erlängt. Das Lager vor
diesem Ort war über 2 Lachter mächtig, fiel 15° gegen West und bestand „aus
mildem Gneis, krystallisirtem Quarz, braunem Hornstein, nesterweise
einbrechenden ockerigen braunen Eisenstein und 1 Elle mächtigen
Braunstein.“ (40014, Nr. 250, Film 0036)
Eine Dresdner Elle war 0,5336 m lang. Rund ein halber Meter mächtig Braunstein ‒ das war schon ein ordentlicher Anbruch... Am 4. Mai 1812 hatte Herr Schmiedel deshalb auch wieder 40 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 250, Film 0051). Die Erstreckung dieser Erzlinse war allerdings nicht aushaltend, denn bei der nächsten Befahrung am 25. Juni 1812 heißt es, das Streckenort sei nun 7¼ Lachter erlängt (also einen Dreiviertel Lachter oder rund 1,5 m weiter) und vor dem Ort bestehe das Lager „aus gelbem Ocker, Gneis, braunem Hornstein, nierenweise einbrechenden ockerigen gelben und braunen Eisenstein, auch Braunstein…“ Da man mit den Streckenörtern stets dem Lagerstreichen folgte, hatte dessen Richtung inzwischen auf Stunde 10,6 gewechselt (40014, Nr. 250, Film 0067f). Bei der nächsten Befahrung am 6. Oktober 1812 gab Herr Schmiedel bei einem Stand des Vortriebs von 8½ Lachter vom Tageschacht eine Richtung von Stunde 9,3 gegen Mittag Morgen an (40014, Nr. 250, Film 0108f). Bis zur letzten Befahrung in diesem Jahr, die wieder am 23. Dezember erfolgt ist, hatte man das Ort noch bis auf 9 Lachter Länge fortgestellt, sonst hatte sich aber im Grubenbetrieb nichts verändert (40014, Nr. 250, Film 0134). Meyers Hoffnung war eine gevierte ,Fundgrube´, sie war also mit einem Grubenfeld von 28 Lachtern im Quadrat verliehen. Da man vom Tageschacht aus schon Örter in verschiedene Richtungen je 9 bis 11 Lachter weit getrieben hatte, waren wohl auch mit diesem Ort nun wieder die Feldgrenzen erreicht. Daher heißt es im nächsten Fahrbogen des Geschworenen über seine Befahrung der Grube am 19. Februar 1813, es werde nun von den beiden hier angelegten Häuern in 6 Lachtern Teufe ein Versuchsort Stunde 1,2 gegen Nord in Quergestein getrieben, und sei schon 5¾ Lachter ausgelängt, um „das Grubenfeld, so nach dieser Weltgegend größtentheils noch unverritzt ist, aufzuschließen und neue Anbrüche auszurichten.“ (40014, Nr. 251, Film 0020) Dies hatte wohl auch Erfolg: Über seine Befahrung am 17. Mai 1813 notierte Herrr Schmiedel, man treibe jetzt in 7 Lachter Teufe „des neuen Tageschachtes“ ein Ort Stunde 11,2 gegen Nord auf einem Lager, welches jetzt 8¼ Lachter weit fortgebracht war (40014, Nr. 251, Film 0049). Wenn man wieder einen neuen Schacht angelegt hat, mußte man ja in dieser Richtung fündig geworden sein... Eben dieses Ort war, immer dem Lagerstreichen folgend, bei der nächsten Befahrung schon 14¾ Lachter lang geworden und in Stunde 2,5 gegen Nord umgeschwenkt (40014, Nr. 251, Film 0099). Wieder lief der Abbau einige Monate so fort, bis der Geschworene bei seiner Befahrung am 29. März 1814 auf einem Streckenort 2 m höher, nämlich bei 6 Lachter Teufe, und auf diesem 11 Lachter vom Schacht entfernt, ein Überhauen vorfand, das auch schon 2 Lachter Höhe über der Streckenfirste erreicht hatte. Dort aber hatte man in alte Baue eingeschlagen. Oh, die Alten sind auch dort schon gewesen... Daher traf Herr Schmiedel die folgende (40014, Nr. 252, Film 0029f) Veranstaltung. „Da nun mit diesem Überhauen wie schon gedacht, in alte Baue durchgeschlagen worden, folglich keine weitere Aussicht daselbst vorhanden ist, so habe ich unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: daß, um neue Anbrüche auszurichten, aus dem Fundschachte ein Ort gegen Mittag Abend, woselbst noch das meiste frische Feld vorliegt, getrieben werden soll. Sodann wurden auf dieser Grube 20 Centner Braunstein verwogen.“ Nun, Ausbringen gab es also noch. Der getroffenen Veranstaltung halber trug Herr Schmiedel aus seinem Fahrbogen am 2. April 1814 auch in Annaberg vor, wo seine Anordnung Genehmigung fand (40169, Nr. 244, Blatt 11). Am 2. August 1814 fuhr Herr Schmiedel wieder in Begleitung durch Bergmeister Schütz auf der Grube an, worüber am 6. August zu Protokoll genommen wurde, daß 9 Lachter südwestlich vom alten ein neuer Tageschacht bereits 7 Lachter niedergebracht sei, man von diesem aus mit einem Ort erneut in alten Mann, mit einem zweiten aber in „weißes Glimmerschiefer- und Thongebirge“ gekommen sei. Die Beamten ordneten daher an, den Schacht noch um 3 bis 4 Lachter zu verteufen (40169, Nr. 244, Blatt 12). Den bergbehördlichen Anweisungen ist der Lehnträger natürlich auch gefolgt und am 2. November 1814 notierte der Geschworene, man treibe nun bei 8 Lachter Teufe ein Ort im Quergestein Stunde 11,1 gegen Süd und habe 2¼ Lachter Länge erreicht, „um das Gebirge daselbst mehr aufzuschließen und das allhier aufsetzende, auf dieser Zeche sowohl, als auf benachbarten Zechen bebaute, wichtige Eisen- und Braunsteinlager mit Anbrüchen wieder neu auszurichten.“ (40014, Nr. 252, Film 0091) Dieses Versuchsort hatte aber offenbar nicht sofort den erwünschten Erfolg, denn über seine Befahrung am 12. Dezember hielt Herr Schmiedel fest, man habe bei 9½ Lachter Teufe das Lager ersunken (den Schacht also noch weiter verteuft). Auf dem Lager sei nun ein Ort Stunde 4,6 gegen Südwest auf 4¼ Lachter fortgestellt. Bemerkenswert fand er noch, daß (neben den üblichen Bestandteilen) überdies 12 Zoll (≈ 28,3 cm) mächtig Braunstein im Lager anstehe (40014, Nr. 252, Film 0100f). Bis zum 26. Januar des Folgejahres war das Streckenort auf 6¼ Lachter ausgelängt ‒ sonst hatte sich im Grubenbetrieb nichts verändert (40014, Nr. 254, Film 0010f). Anfang März 1815 waren auf dieser Grube auch wieder einmal 52 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 254, Film 0019). Bei seiner Befahrung der Grube am 14. März 1815 befand Herr Schmiedel dann, man treibe nun ein Ort „mit abfallender Sohle“ in derselben Richtung, wie das Ort zuvor, und habe dieses inzwischen auf 6⅞ Lachter ausgelängt. Der zweite Mann haute dahinter einen Förstenstoß von ⅜ Lachtern Höhe aus (40014, Nr. 254, Film 0023). Und am 8. Juni 1815 heißt es, das Ort sei nun nicht nur 7¼ Lachter lang geworden, sondern man treibe es inzwischen „mit ¾ Lachter Weitung“ weiter. Wo es die Mächtigkeit und Erzführung hergab, ging man also auch auf den kleinen Eigenlehnergruben vom reinen Örterbau zum Weitungsbau über, auch, wenn bei einem dreiviertel Lachter Streckenbreite nun nicht gleich gewaltige Kammern entstanden sind. Außerdem waren auch wieder 30 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 254, Film 0050). Am 15. August hatte man ein neues Ort bei 8 Lachtern Teufe angeschlagen, diesmal in Stunde 8,1 gegen West, und es inzwischen 4 Lachter fortgestellt. Auch dieses trieb man im Fallen des Lagers „mit abfallender Sohle“ vor (40014, Nr. 254, Film 0067). Wieder scheint aber die Erzführung wenig aushaltend gewesen zu sein, denn schon am 31. August 1815 befand der Geschworene, man habe schon wieder ein neues Versuchsort angehauen, wieder etwas höher bei 6 Lachter Teufe, und trieb es in Quergestein Stunde 11,3 gegen Nord „zur Aufschließung und Untersuchung des nach dieser Weltgegend noch ziemlich unbebauten Grubenfeldes.“ Zu diesem Zeitpunkt war man damit 3 Lachter vorangekommen (40014, Nr. 254, Film 0072). Herr Schmiedel hatte daran nichts zu bemängeln und traf lediglich die folgende Veranstaltung. „Obschon in Ansehung dieses Ortsbetriebes etwas weiter nicht zu erinnern war, so wurde aber doch dem die Aufsichtsführung aufhabende Häuer aufgegeben, auf einem 1 Lachter vom Ort zurück übersetzenden, 4 bis 6 Zoll mächtigen Spattrume, welches in der Abendseite Spuren von Braunstein und ockerigen Brauneisenstein führet, etwas auszulängen.“ Bei seinem Fahrbogenvortrag im Bergamt am 30. September 1815 erhielt auch diese Anordnung die Genehmigung (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 12).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst Luciae 1815 war der Geschworene
wieder auf dieser Grube anwesend, hatte dort am 9. November dem Vermessen
von 16 Fudern Eisenstein beigewohnt und am 6. Dezember des Jahres eine
Befahrung vorgenommen, über die er niederschrieb, man treibe schon wieder
ein neues Ort
bei 6 Lachter Teufe in Stunde 9,6 gegen
Süd, welches bereits 6¼ Lachter lang gewesen ist
(40014, Nr. 254, Film 0102).
Wieder fand Herr Schmiedel dabei aber nichts zu beanstanden und
traf nur die folgende
Veranstaltung. „Da 3 ½ Lachter von diesem Orte zurück in erwähntem Lager ¼ Elle mächtiger, meistens dichter Brauneisenstein wahrgenommen wurde, so habe ich unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: daß daselbst ein Ort aufgehauen und mit 1 Mann gegen Mittag Abend betrieben werden soll.“ Ob man dort einen guten Anbruch angetroffen hat, weiß man nicht. Herr Schmiedel versicherte sich aber auf der Sitzung am 30. Dezember 1815 wieder der Zustimmung des Bergamtes (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 13). Über seine nächste Befahrung am 26. Februar 1816 hielt der Geschworene lediglich fest, man sei mit besagtem Ort nun in Stunde 11,1 gegen Nord geschwenkt und es sei inzwischen 8 Lachter ausgelängt (40014, Nr. 257, Film 0016). Und am 8. Juli 1816 fand Herr Schmiedel auf eben diesem Streckenort, in 5 Lachter Entfernung vom Schacht ein Überhauen in Betrieb vor (40014, Nr. 257, Film 0057). Diesmal allerdings gab es Mängel beim Grubenbetrieb und Herr Schmiedel wies ‒ und diesmal ganz ohne die „anhoffende Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes“ ‒ direkt an: Veranstaltung. „Da der Fundschacht fast durchgängig, hauptsächlich aber in der obern Hälfte äußerst wandelbar ist, so habe ich angeordnet, daß selbiger unverzüglich in neue Polzenschroth Zimmerung gesetzt werden soll.“ Sicherheitshalber gab es auch hierzu aber am 21. Juli 1816 einen Fahrbogenvortrag im Bergamt, wo dieser Anordnung selbstverständlich beigepflichtet wurde (40169, Nr. 244, Blatt 14). Auch dies wurde sicherlich von den Lehnträgern befolgt, denn die Aufforderung wiederholte sich im nächsten Fahrbogen nicht. Über seine nächste Befahrung am 27. August 1816 hielt er nur fest, das Überhauen habe schon 3 Lachter Höhe über der Strecke erreicht und das Lager sei hier über 3 Lachter mächtig (40014, Nr. 257, Film 0076f). Fast gleichlautend (nur hatte das Überhauen inzwischen 3¼ Lachter Höhe erreicht) sind die Fahrberichte Schmiedel's vom 9. Oktober dieses Jahres (40014, Nr. 257, Film 0088) und vom 5. Februar 1817 (40014, Nr. 258, Film 0014). Bis zum 21. April 1817 hatte das Überhauen in 2⅛ Lachtern Höhe schon 1½ Lachter Länge erreicht, wobei die Mächtigkeit des Lagers aber immer mehr abnahm und zuletzt nur noch mit 1¼ Lachtern angegeben wurde (40014, Nr. 258, Film 0039). Das war für den Geschworenen Veranlassung, die folgende Veranstaltung zu treffen: „Da die Eisensteinanbrüche in dem so eben beschriebenen Überhauen ziemlich gering sind, einige Verbesserung derselben aber, wegen der darüber befindlichen Preßbaue nicht zu erwarten ist, so habe ich unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: daß in obbedachter 7 Lachter- Sohle von dem Fundschacht weg Stundte 11,0 gegen Mitternacht, als nach welcher Weltgegend noch das meiste ganze Feld vorlieget, daselbst auch, jedoch in weniger Teufe, viel Eisen- und Braunstein gebrochen hat, ein Versuchsort zu Wiederausrichtung dergleichen Anbrüche getrieben werden soll.“ Die Zustimmung des Bergamtes zu seiner Anordnung wurde auf der Bergamtssitzung am 26. April 1817 erteilt (40169, Nr. 244, Blatt 15). Ganz genau hielten sich die Lehnträger diesmal nicht an den Wortlaut der Anweisung und so fand Herr Schmiedel bei seiner nächsten Grubenbefahrung am 28. August 1817 bei 6 Lachter Teufe ein Ort Stunde 8,0 gegen Morgen auf 2 Lachter erlängt vor. Vor selbigem Ort war das Lager aber nur ¾ Lachter mächtig (40014, Nr. 258, Film 0077f). Am 4. November 1817 fand der Geschworene schon wieder ein neues Ort Stunde 10,6 gegen Mittag und bei nun wieder 7 Lachter Teufe vor. In dieser Richtung scheint man mehr Erfolg gehabt zu haben, zwar war auch hier das Lager nur ¾ Lachter mächtig, doch trieb man das inzwischen auf 1¼ Lachter erlängte Ort wieder mit ¾ Lachter Weitung vor (40014, Nr. 258, Film 0097). Die Erzführung im Lager war hier offenbar besser und man hieb dessen ganze Mächtigkeit aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner nächsten Befahrung am
12. Februar 1818 fand Herr Schmiedel auf eben diesem Ort und 4 Lachter vom Fundschacht entfernt ein Überhauen in Betrieb vor, das bereits
1¾ Lachter Höhe erreicht hatte (40014, Nr. 259,
Film 0012). Am 10. April des
Jahres heißt es im Fahrbogen, das Überhauen läge auf der Strecke in 7
Lachter Teufe des Fundschachtes und 4½ Lachter von selbigem gegen West und
sei jetzt 1⅞ Lachter hoch (40014, Nr. 259,
Film 0031).
Dann war dort aber die Erzlinse ausgehauen und am 30.Juli 1818 notierte Herr Schmiedel, man betreibe nun ein Ort Stunde 10,6 gegen Nord weiter und habe es schon 9½ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 259, Film 0069). Bis zum 4. September hatte man dabei wieder 53 Fuder Eisenerz ausgebracht (40014, Nr. 259, Film 0082). Dann drehte man aber erneut um: Von seiner Befahrung am 11. September berichtete der Geschworene, man treibe nun ein Ort Stunde 1,1 gegen Süd und habe dieses auch schon 3 Lachter erlängt (40014, Nr. 259, Film 0084). Am 20. Januar 1819 (40014, Nr. 261, Film 0005f) hatte man sich auf eine 1 Lachter höhere Sohle verlegt, und oberhalb des letzteren Streckenortes und 2½ Lachter vom Fundschacht nach Süden wurde „auf einem übersetzenden Stunde 11,1 streichenden und 40 Grad gegen West fallenden Lager“ ein Abteufen niedergebracht, womit man bereits 1 Lachter tief niedergekommen war (also eigentlich auf die untere Strecke durchgeschlagen haben müßte). Außerdem traf Herr Schmiedel noch die Veranstaltung: „Da die Förderung aus diesem Abteufen bis unter den Fundschacht sehr krüppelig und unzweckmäßig ist, so habe ich, um selbige mit weniger Kosten zu bewirken und einen regelmäßigeren Bau zu erlangen, unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet: Daß auf der Sohle des 7½ Lachter tiefen Fundschachtes durch das kaum 1¼ Lachter starke Mittel ein Ort Stunde 11,6 gegen Mittag nach jenem Abteufen getrieben, und wenn die Durchörterung geschehen ist, die Förderung sodann auf diesem Wege erfolgen, jenes Ort aber abgeworfen werden soll.“ Nach dem Fahrbogenvortrag bei der Bergamtssitzung am 30. Februar 1819 fand auch diese Anweisung des Geschworenen Zustimmung (40169, Nr. 244, Blatt 16). Dieses Ort fand der Geschworene am 2. März 1819 denn auch in 8 Lachter Teufe Stunde 11,5 gegen Nord angeschlagen und bei ¾ Lachter Weitung 4¾ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 261, Film 0018f). Schon am 6. April des Jahres aber war wieder ein neues Ort Stunde 8,3 gegen Ost aufgenommen und 3¼ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 261, Film 0036). Bis zum 11. November 1819 hatte man den Schacht noch einmal um einen Lachter auf nun 9 Lachter Teufe abgesenkt und von dort aus ein Ort mit ¾ Lachter Weitung Stunde 4,5 gegen Abend angesetzt, aber erst 1¼ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 261, Film 0098). Diese Eigenlehner- Schächte müssen doch mit ganzen ,Igeln' von Strecken umgeben gewesen sein...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 25. Januar 1820 ermittelte Herr
Schmiedel eine Richtung Stunde 1,6 gegen Mittag für dieses Ort (40014,
Nr. 262, Film 0008).
Viel vorangekommen war man aber noch nicht. Erst am 28. Februar des Jahres
fand der Geschworene das Ort auf 4
Lachter ausgelängt vor, wobei man weiter mit ¾ Lachter Weitung
fortschritt. Am 11. April hatte man aber schon wieder ein neues Ort angesetzt ‒ nun wieder in 7 Lachtern Teufe ‒ und dieses Ort Stunde 2,6 gegen Mitternacht mit 1 Lachter Weitung 4¾ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 262, Film 0031f). Bis zum 27. Juni hatte man es auf 6 Lachter ausgelängt (40014, Nr. 262, Film 0060f). Dabei wurden bis zum 5. Juli 9 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 262, Film 0063) und am 16. August 16 Zentner Braunstein verwogen (40014, Nr. 262, Film 0067f). Auch dort scheint die Erzlinse dann aber abgebaut gewesen zu sein, denn am 17. Oktober stellte Herr Schmiedel fest, daß man sich nun wieder in größere Teufe von 10 Lachtern unterm Tag verlegt hatte und dort ein Ort Stunde 9 gegen Nordwest angeschlagen und schon 3 Lachter vorgetrieben hatte (40014, Nr. 262, Film 0087f). Bis zum 27. November 1820 war es 4 Lachter erlängt und wurde nun Stunde 9,1 und mit 1 Lachter Weitung fortgestellt (40014, Nr. 262, Film 0105).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über seine nächste Befahrung der Grube
am 15. Februar 1821 notierte Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen
(40014, Nr. 264, Film 0019f):
Meyers Hoffnung bey Schwarzbach anlangend. „Mit 2 Häuern wird in 9 Lachter Teufe des Tageschachtes auf dem allhier aufsetzenden, Stundte 6,3 streichenden, ungefähr 10 Grad gegen Mitternacht fallenden Lager ein Ort gegen Morgen zu 2/3 betrieben, dessen Erlängung von erwähntem Schacht 6 Lachter beträgt und vor welchem das ⅞ Lachter mächtige Lager aus Gneus, drusigem Quarz, braunem Hornstein, dichtem Brauneisenstein und Braunstein besteht.“ Bis zum 16. April hatte man dabei 27 Fuder Eisenstein gewonnen (40014, Nr. 264, Film 0043) und zum Verwiegetag am 8. Mai 1821 standen außerdem 5 Zentner Braunstein zu Buche (40014, Nr. 264, Film 0048). Bei seiner nächsten Befahrung am 8. Juni des Jahres stellte der Geschworene fest, daß man nun wieder in 7 Lachter Teufe ein neues Ort gegen Mittag angeschlagen und bereits 2¾ Lachter ausgelängt hatte (40014, Nr. 264, Film 0060). Dabei sind bis zum 19. Juni wieder 26 Zentner Braunstein gefördert worden (40014, Nr. 264, Film 0063), außerdem waren am 9. Juli auch 16 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 264, Film 0068). Besagtes Ort war bei der Befahrung am 8. August auf 4⅛ Lachter Länge fortgebracht, allerdings war man, immer dem Streichen des Lagers folgend, wieder „gegen Morgen“ abgeschwenkt (40014, Nr. 264, Film 0078). Am 18. September 1821 standen dann erneut 20 Zentner Braunstein zum verwiegen an (40014, Nr. 264, Film 0093) und bis zum 7. November waren noch einmal 28 Zentner Braunstein ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0106). Die letzte Grubenbefahrung in diesem Jahr fand am 12. Dezember statt und nun heißt es im Fahrbericht, daß das Ort in 7 Lachter Teufe „Stunde 7,3 gegen Morgen“ nunmehr 7⅛ Lachter erlängt sei (40014, Nr. 264, Film 0116). Bei seiner nächsten Befahrung der Grube am 12. April 1822 befand Herr Schmiedel wieder ein neues Ort in 6 Lachter Teufe gegen Nordost angeschlagen und 5⅛ Lachter erlängt vor (40014, Nr. 265, Film 0038f). Auf den Ausbau des Tageschachtes hatte man zuletzt wohl weniger geachtet und so gab es Anlaß zu der Veranstaltung: „Da die Zimmerung in dem untern Theil des Fundschachtes sowohl, als auf der in 6 Lachter Teufe desselben befindlichen Streckensohle sehr wandelbar befunden wurde, so habe ich den Arbeitern aufgegeben, selbige sofort der ertheilten Anweisung gemäß zu repariren.“ Der Anweisung wurde gewiß auch vor dem weiteren Ortsbetrieb Folge geleistet, denn am 16. Juli 1822 fand der Geschworene das Ort noch gleich lang vor (40014, Nr. 265, Film 0053).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Dezember 1822 trat Herr Schmiedel dann in den Ruhestand und wurde von Johann August Karl Gebler in seiner Funktion abgelöst (40014, Nr. 265 und 267). Dieser befuhr die Gruben am Emmler am 1. April 1823 und berichtete anschließend über Meyers Fdgr. im Tännichtwalde. „Ist belegt mit
Höchst regelmäßig sucht man hier von dem einen (?) zu dieser Grube gehörenden Schachte dem Tiefsten bey 14 Lachtern Teufe unterm Tage, mittelst regelmäßigen Betriebes gegen Mitternacht die hier schon (?) nächste Umgebung (Herr Schmiedel hatte eine bessere Handschrift...?) bebaute Eisensteinlager auf und wurde gegenwärtig nur durch zusitzendes jetzt hereindringendes, bald aber hereinbrechendes Frühjahrswaßer etwas gehindert. Wegräumung der Hindernisse. Mit einem zweyten (?) gegen Mittag angelegten und 8 Lachter bereits erlängten Ort sucht man mit dem etwas höher liegenden (...) zweyten Schacht, der zur Bebauung eines Braunsteinlagers abgesunken wurde, baldigst durchschlägig zu werden, und so stünde auch hier wiederum gesetzmäßige Veranstaltung und vorliegende Pläne mit den natürlichen Verhältnissen im Gleichgewicht.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 13. Februar 1824 war Herr Gebler
wieder vor Ort und berichtete in seinem Fahrbogen darüber (40014,
Nr. 271, Film 0009), man
betreibe nun ein Ort in 7 Ltr. Teufe gegen Nordost und durch Aushauen von Förste und Stroße gewinnt man „die daselbst vorkommenden größeren und
kleineren Nieren von Brauneisenstein.“ Außerdem war der Durchschlag
zwischen den beiden zur Grube gehörigen Schächten und damit „Communication“
und Wetterbesserung inzwischen erreicht.
Der Starkregen im Juni 1824 führte auch hier zu Schwierigkeiten, wenn auch nicht so sehr, wie bei der naheliegenden Gabe Gottes Fundgrube (40014, Nr. 271, Film 0042f): „Sonnabends, den 26ten Juny habe ich mich nach dem Tännicht bey Schwarzbach begeben, um zu sehen, in welchem Zustande sich die daselbst befindlichen Eisensteingruben durch das erwähnte gestrige und vorgestrige heftige Regenwetter versetzt fänden mögten und gesehen, daß die beyden kleinen, zu der neuen Eisensteinzeche Gabe Gottes gehörigen Schächte meisten an Mangel an hinlänglichem Holze zusammengegangen waren. Auch befanden sich auf Meyers Fdgr. daselbst die Eisensteingewinnungsbaue unter Waßer, waren daher auch nicht zu befahren und bey der neuen Eisensteingrube Großzeche, wo für die dortigen beyden kleinen Schächte gleichfalls nicht zu befahren.“ Da man bei dieser Grube aber mit 14 Lachtern Schachtteufe bereits 1823 vergleichsweise tief vorgedrungen war, besaßen die Betreiber Alternativen. So liest man im Fahrbogen vom 10. August 1824 wieder (40014, Nr. 271, Film 0052): „Da wegen Waßeraufgang das Tiefste nicht zu befahren und zu belegen ist, der obere der beyden zeitherigen Schächte aber wandelbar zu werden angefangen hat, übrigens der Eisensteinbau von dem genannten Schachte in der Morgen Mitternacht Seite liegt, so hat man angefangen, einen neuen Schacht auf diese Baue zu sinken, ist mit demselben ohngefähr 3½ Ltr. niedergekommen und hat bey diesem Niedergehen auch einigen Eisenstein gewonnen.“ ,Einiger Eisenstein' hieß bis zum 13. August des Jahres immerhin schon wieder 15 Fuder Ausbringen (40014, Nr. 271, Film 0053). Die Arbeit setzte man auch im zweiten Halbjahr fort und von seiner Befahrung am 25. November 1824 konnte der Geschworene berichten (40014, Nr. 271, Film 0072): „Ganz in der Nähe und nur wenige Lachter von dem zeitherigen, gangbar gewesenen, aber schadhaft gewordenen obern Schachtes gegen Mitternacht hat man einen neuen angefangen und ist mit solchem gegen 5 Ltr. niedergekommen, hat auch einigen Eisenstein dabey gewonnen. Man gedenkt mit diesem Schacht vor der Hand noch einige Lachter bis zur Erreichung der von dem alten baufälligen Schacht nach der genannten Weltgegend herüber geführten Braunsteinbau, in der Folge aber noch etwas tiefer bis zu Erreichung des von dem untern Schachte sich herauf ziehenden Eisensteinlagers und so den Bauen des letzteren Schachtes entgegen zu gehen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erste Befahrung dieser Grube im Folgejahr durch den Geschworenen fand erst wieder am 15. Juli 1825 statt (40014, Nr. 273, Film 0048). Im Fahrbogen dazu heißt es, daß nach wie vor 2 Mann angelegt seien und über die vorerwähnten: Hülfsbaue. „Man hat anjetzt hier mit demjenigen Orte, welches man bey 8 Ltr. Teufe aus dem obern Schachte nach dem untern zur Erlangung von Communication und Wetterwechsel getrieben, durchgeschlagen, übrigens auch mittelst eines aus dem obern Schachte gegen Morgen angelegten Ortes ein im abgebauten alten Felde noch befindliches Stück derben schwarzbraunen Eisenstein angetroffen und von demselben bereits ein Quantum zu Tage gefördert.“ Der Plan wurde also erfolgreich umgesetzt und so hatte man hinreichend frische Wetter in der Grube, während die meisten anderen zu diesem Zeitpunkt ihren Betrieb schlechter Wetter halber einstellen mußten. Von seiner zweiten Befahrung am 2. November 1825 berichtete Herr Gebler über den eigentlichen Eisensteinabbau, dieser gehe jetzt bei 6 Ltr. Teufe und 2 Ltr. vom morgendlichen Schachtstoß gegen Nordost um (40014, Nr. 273, Film 0073). Die hier angefahrene „lagerartige Niere von Brauneisenstein, mit welchem zuweilen auch etwas Braunstein abwechselt, zeigte sich gegenwärtig von 2 bis 10 Zoll mächtig.“ Mehr gab es hierzu im Jahr 1825 nicht zu berichten. Auch mit Ausbringen ist die Grube in diesem Jahr weder in den Fahrbögen, noch in den Erzlieferungsextrakten genannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 24. Januar 1826 ist Herr Gebler erneut auf der Grube angefahren (40014, Nr. 275, Film 0010). Diesmal berichtete er: „Bey etwa 6 Ltr. Teufe unter Tage betreibt man einige Ltr. vom Schachte aus gegen Mittag Morgen einen Gewinnungsbau auf vorzüglich schönen Brauneisenstein und ist außerdem des Vorhabens, mittelst Anlage eines Ortes gegen Mittag Abend ein in der Nähe des abgeworfenen vorigen Schachtes vermuthetes kleines Lager von Braunstein aufzusuchen, in dem derselbe gegenwärtig außerordentlich gesucht ist und sehr wohl abgehet.“ Oh, man hatte also hier auch schon wieder einen neuen Schacht geteuft. Daß in jener Zeit der Absatz des Eisensteins nur dürftig gewesen ist, war auch schon in Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Gruben zu lesen. Dagegen war offenbar die Nachfrage nach dem Braunstein gewachsen. Bis April dieses Jahres hatte man davon wahrscheinlich aber noch nicht allzuviel gefördert, stattdessen waren am 13. April 1826 zunächst wieder 17 Fuder Eisenstein ausgebracht und zu vermessen (40014, Nr. 275, Film 0030). Am 28. April 1826 heißt es dann im Fahrbogen, Herr Gebler habe an diesem Tage „auf Meyers Hoffnung Fdgr. und Freundschaft Fdgr. im Tännicht und Friedrich Fdgr. bey Langenberg und Köhlers Fdgr. bey Raschau den vorhandenen Braunstein theils besichtigt, theils verwogen.“ Am 5. Juni des Jahres ist der Geschworene erneut zugegen gewesen und berichtete diesmal (40014, Nr. 275, Film 0044f), man habe nunmehr in 5 Lachter Teufe vom Schacht aus Strecken „theils nach Mittag Abend, theils nach Mittag Morgen getrieben“ und mit den von diesen „sich wiederum nach mehreren Richtungen abwendenden Örter theils ein Braunstein, theils ein Eisensteinlager angefahren und gewinnt nun nach vollkommen guter Verwahrung der großen, theils in altem Mann getriebenen Strecken mit zweckmäßiger und gehörig starker Zimmerung sowohl etwas Braunstein, als auch Eisenstein.“ Ach, schau an: Man war auf Meyers Hoffnung Fdgr. erneut in alten Mann gekommen. Von seiner Befahrung am 9. Oktober 1826 (40014, Nr. 275, Film 0079) war zu berichten, man baue jetzt wieder in 6 Lachter Teufe und habe nur 3 Lachter vom Schacht entfernt „ein vorzüglich reichen Nieren von schönem Brauneisenstein“ angefahren und auf diesem einen Firstenbau angelegt. Weitere Befahrungen durch den Geschworenen fanden in diesem Jahr hier nicht statt und auch an den Verwiegetagen ist die Grube nicht mehr erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im folgenden Jahr 1827 befuhr Herr Gebler Meyers Fundgrube erst wieder Ende Mai und berichtete über den Stand der Dinge (40014, Nr. 278, Film 0047): „Mittwochs, den 30ten May bin ich gefahren auf Meyers Fdgr. im Tännicht, belegt mit 2 Häuern.“ Eisensteinbaue. „Den zeitherigen Eisensteinbau bey 7½ Ltr Teufe unter Tage aus dem Schachte 5 Ltr. gegen Mittag Morgen, welcher wegen der unmittelbar daran anliegenden alten Abbaue mit großem Druck bedroht wird und deshalb vorzügliche Vorsicht und zweckmäßige Behandlung durch Zimmerung erfordert, wird man des letzteren Umstands wegen zwar nicht einzustellen nöthig haben, den vorhandenen Nieren aber um 1 bis 2 Lachter mehrer Höhe zweifelsohne angreifen und hiermit allem Ansehen nach zu Verminderung der Gefahr und der Beschwerden bey der Zimmerung recht wohl thun.“ Braunsteinbaue. „Den gegen Mittag Abend liegenden Braunsteinabbau betreibt man dermalen nicht, da man fernere Gelegenheit sucht, die darin vorhandenen Vorräthe zu verkaufen.“ Oh, der ,vorzüglich reiche Nieren von schönem Brauneisenstein' lag also zwischen altem Mann... Bis zum 31. August 1827 lagen hier 30 Fuder Eisenstein zum Vermessen bereit (40014, Nr. 278, Film 0069). Eine weitere Befahrung dieser Grube durch den Geschworenen fand in diesem Jahr noch am 2. Oktober statt, worüber im Fahrbericht zu lesen ist (40014, Nr. 278, Film 0074), „in 7 Ltr. Teufe und in der Entfernung von 3 bis 4 Ltr. gegen Morgen befindet sich zwischen ehemaligen alten Abbauen ein ansehnlicher Nieren Brauneisenstein, welchen man jetzt abbaut. Da sich hinter demselben Spuren von Braunstein zeigen, so wird man gelegentlich durch Fortgehen in dieser Richtung zu Gewinnung desselben zu gelangen suchen.“ Mehr war nicht zu berichten. Auch war diese Grube ja stets nur mit 2 Mann belegt, so daß es wenig verwunderlich ist, daß alle Arbeiten nur langsam voranschritten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 20. März 1828 hat Herr Gebler Meyers Fundgrube wieder befahren (40014, Nr. 280, Film 0024). Immerhin einmal in diesem Jahr, denn von allen anderen Gruben des Langenberg'er Reviers (mit Ausnahme von Gnade Gottes Fdgr.) gibt es aus diesem Jahr keinen einzigen Fahrbericht. Zu diesem Zeitpunkt hatte man von dem „zeitherigen, zeitweise stehenden Tageschacht aus“ in 6 Lachter Teufe ein Ort gegen Mittag getrieben und „6 Ltr vom Schacht ein Braunsteinlager, bei 4 Ltr. Entfernung aber ein Eisensteinlager oder vielmehr nur große, zwischen alten Mann stehen gebliebene Nester von beyden erlangt. Von jedem dieser beyden Produkte ist ein kleiner Vorrath zu Tage geschafft worden.“ Man schlug wieder einmal in alten Mann ein... Immerhin sind dabei 9 Fuder Eisenstein ausgebracht worden (40014, Nr. 280, Film 0083). Mehr war es in diesem Jahr nicht. Regelmäßige Befahrungen auf dieser Grube durch den Geschworenen erfolgten dann wieder im folgenden Jahr 1829. Wir zitieren aus dem Fahrbericht vom 6. Mai diesen Jahres (40014, Nr. 280, Film 0133): „In 7½ Ltr Teufe des Tageschachtes und aus demselben 6 bis 8 Ltr. gegen Mittag Morgen befindet sich ein Abbau, woselbst man sehr guten Brauneisenstein gewinnt, der durch Hereinhauen der ehemals hier von den alten Bebauern stehen gelassenen, in der Folge aber zum Theile niedergebrochenen Pfeiler und Bergfesten, gewissermaßen also in altem Manne geführt wird. Aus diesem Bau führt ein anderes Ort 4 Ltr. lang gegen Mitternacht Morgen, woselbst Braunstein ansteht, wovon man aber gegenwärtig keinen gewinnt, da anjetzt wegen gar zu sehr gesunkener Preise keiner abzusetzen ist. Etwa 16 Ltr. über Tage von dem vorgedachten Tageschachte herab gegen Mitternacht Abend hat man einen neuen Schacht abzusenken angefangen und hat derselbe bey 3 Ltr. Teufe vortrefflichen Brauneisenstein angetroffen, kann indessen wegen zudringender Wasser jetzt nicht weiter niederkommen, bis sich solche wiederum verzogen. Auch wird man eine kleine Rösche heranzubringen von ohngefähr 3 bis 4 Ltr. Teufe, diesen Bau etwas zu lösen, sich genöthigt sehen.“ Wie immer, waren hier zwei Häuer angelegt. Am 8. Juli 1829 notierte Herr Gebler in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 280, Film 0148f), der Abbau im alten Mann erfordere „wegen des starken Druckes viel Vorsicht bei Fahrung des Abbaus und Anlegen der Zimmerung, was aber vollkommen gut ausgeführt und besorgt wird.“ Den Braunsteinabbau dagegen läßt man „da wenig Nachfrage nach Braunstein gewesen,“ außer Betrieb stehen. Am 11. August 1829 war Herr Gebler noch einmal auf Meyer's Fundgrube und berichtete (40014, Nr. 280, Film 0156), daß er den bereits erwähnten, „an der vom Tännigt nach Langenberg führenden Straße angelegten 4½ Ltr tiefen neuen Schacht, auf dessen Sohle noch etwas Wasser stand“ befahren und in 4 Lachter Teufe ein Ort gegen Südwest, „zur fernerweiten Entdeckung von Eisenstein“ angehauen, vorgefunden habe. Dabei hatte man bis zum 28. Dezember 1829 immerhin wieder 14 Fuder Eisenerz ausgebracht und zum Vermessen bereitliegen (40014, Nr. 280, Film 0189).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Frühjahr 1830 betrieb man
vorrangig den Eisenerz- Abbau in 6½ Lachter Teufe, etwa 8 Lachter vom
Tagschacht gegen Mittag Morgen (40014, Nr. 280, Film 0232).
Das hiesige Lager sei allerdings sehr hornsteinreich und liefere nur
mittelmäßig guten Brauneisenstein. Der Braunsteinbau, in Richtung
Mitternacht Morgen und 7 Lachter vom Schacht entfernt, wird dagegen „wegen
der nicht sonderlichen Abnahme nicht stark belegt.“ Auch komme der
Braunstein hier nur in dünnen Streifen oder in irregulären kleinen Nestern
vor. Am 21. Juli 1830 notierte Herr Gebler über seine Befahrung, daß man „wegen des vielen Druckes und um dem Eisensteinbau besser beizukommen,“ schon wieder einen neuen Tagschacht abzusenken angefangen habe (40014, Nr. 280, Film 0244). Von seiner nächsten Befahrung am 18. August heißt es außerdem (40014, Nr. 280, Film 0249), der bisherige Tagschacht wird „ungemein wandelbar und läßt sich – wie alle diese Schächte, nur mit vielen Kosten wieder herstellen.“ Der neue Schacht, der näher am Abbau liegt, war inzwischen 3 Lachter tief. Als der Geschworene am 11. September 1830 wieder vor Ort war, hatte man den neuen Tageschacht weiter niedergebracht und bei 5 Lachter Teufe „sehr brauchbaren Eisenstein“ ersunken, wolle aber zunächst noch 1 bis 3 Lachter tiefer gehen (40014, Nr. 280, Film 0259). Schließlich steht über seine letzte Befahrung in diesem Jahr im Fahrbogen zu lesen (40014, Nr. 280, Film 0267), man habe jetzt doch bei 4 Lachter Teufe ein Ort gegen Südwest angehauen und den vorhandenen Eisenstein abzubauen angefangen. „Noch wenig war man dabey fortgerückt, hatte nierderzu dabey etwas Braunstein, zu gleicher Zeit aber auch alten Mann angetroffen. Es wird daher wahrscheinlich mit diesem Schachte noch ein paar Lachter niederzugehen seyn, um den alten Abbauen besser zu entweichen und um den vorhandenen alten Eisensteinlagerresten besser beyzukommen zu können.“ Die Alten waren aber auch schon überall und haben nur Reste übriggelassen... Vermerke zur ausgebrachten Eisensteinmenge gibt es in den Fahrbögen aus diesem Jahr nicht. Den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) zufolge waren es aber 18 Fuder Eisenerz und 37 Zentner Braunstein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Letzteres änderte sich auch im nächsten Jahr 1831 nicht: Herr Gebler war zwar am 18. Januar und am 14. Februar auf der Grube; jedoch findet man auch in diesem Jahr keinen einzigen Vermerk über den hier vermessenen Eisen- oder Braunstein. Die weiteren Fahrberichte des Geschworenen sind recht knapp abgefaßt, verraten uns aber, daß nach wie vor zwei Häuer hier angelegt gewesen sind. Im Januar 1831 heißt es etwa (40014, Nr. 281, Film 0006f): „Aus dem Tageschacht bei 4½ Ltr. Teufe hat man im Abendstoß hinausgehauen und Brauneisenstein angetroffen, in gleicher Teufe gegen Mitternacht teils dichten, teils erdigen Brauneisenstein, und wird nun beide Anbrüche abzuhauen anfangen.“ Und im Februar 1831 berichtete Herr Gebler in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 281, Film 0015), daß man gegen Mitternacht 2½ Lachter fortgerückt war und „einen Nieren schönen derben, sowie ockrigen Braunstein angetroffen (hatte), worauf man nun ebenfalls Gewinnungsarbeiten treibt.“ Im Jahr 1832 war der Geschworene am 19. März auf Meyers Fdgr. zugegen (40014, Nr. 281, Film 0104). Seinem diesmal wieder etwas ausführlicherem Fahrbericht ist zu entnehmen, daß man aus dem Schacht bei 4 Lachter Teufe nun nach Westen 2 bis 3 Lachter hinausgegangen war, dabei „Eisenstein und etwas Braunstein“ gewonnen habe, dann sich mit dem Ort wieder gegen Ost gewendet und weitere 2½ Lachter ausgelängt hatte, jedoch „mit stark fallender Sohle“, so daß der tiefste Punkt 3 Lachter tiefer zu liegen gekommen ist, und dort Eisenstein abbaute. Es handelte sich aber nur um ein schwaches Mittel, größtenteils in altem Mann. Man beabsichtigte nun, den Schacht auf diese Teufe absenken, um Kommunikation zu schaffen. Dann findet man auch den Vermerk, daß Herr Gebler am 29. Juni auf Meyers Fundgrube Eisenstein vermessen habe ‒ leider steht aber nicht dabei, wieviel denn eigentlich (40014, Nr. 281, Film 0130). Auch in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) ist für dieses Jahr kein Eisensteinausbringen, sondern nur eine Förderung von 20 Zentnern Braunstein ausgewiesen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem folgenden Jahr 1833 gibt es nur einen Fahrbericht des Geschworenen zu dieser Grube, in dem es heißt (40014, Nr. 281, Film 0197): „Bey 4 Ltr. Teufe unter Tage baut man den vom... Tageschacht gegen Mitternacht und nach Morgen zu sich herumziehenden Eisenstein und das dabey an Braunstein vorkommende ab, um in der Folge bey 3 Ltr. mehrer Teufe gleiche Unternehmungen fortzustellen. Die möglichste Vorsicht... in Betreff der erforderlichen sorgfältigen Verwahrung der... durch den Abbau entstehenden Räume durch Zimmerung... habe ich dem dasigen, als Versorger der Grube zu betrachtenden, fleißigen Häuer zur angelegentlichen Pflicht gemacht.“ Mit dem ,Versorger' ist derjenige der beiden nach wie vor hier angelegten Häuer gemeint, der die Aufgaben eines Steigers besorgte. Außerdem hatte Herr Gebler in diesem Jahr auch zweimal wieder ausgebrachten Eisenstein hier zu vermessen, dessen Gesamtmenge sich auf 54 Fuder summierte. Im darauffolgenden Winter gab es Probleme mit dem Tageschacht, wie dem Fahrbogen vom 22. Januar 1834 zu entnehmen ist (40014, Nr. 289, Film 0005f): „Der Eisensteinbau befindet sich an drey Seiten des überhaupt 8 Ltr. tiefen Tageschachtes dieser Grube in der Teufe zwischen 4 und 6 Ltr. (...) zugleich rund umgeben von alten Preßbauen. Dieß und zugleich wohl auch die schon lange Zeit angehaltene naße Wittrung mag die Veranlassung gegeben haben, daß sich der Schacht in dem mitternacht- morgendlichen Stoße etwas niedergesetzt, auch der Druck zwey Wandruthen – die indessen sehr schwach sind – zerknickt hat. Inzwischen wird bey hinlänglich angewendeter Vorsicht und unter Anwendung etwas stärkerer Wandruthen der Schacht erhalten und in gehörig guten Stand gesetzt werden können.“ Die Umsetzung der Reparatur zu prüfen, war Herr Gebler schon am 27. Januar 1834 erneut auf der Grube und berichtete anschließend (40014, Nr. 289, Film 0006f): „Hier habe ich den (...) vorhandenen Tageschacht, in dem ich denselben bey meiner letzten Befahrung in (...) sehr verletzer Zimmerung und (...) sehr bedenklichen Umständen angetroffen, von neuem untersucht und befunden, daß solcher nunmehro durch bessere und stärkere Wandruthen und zuverlässiger Einstriche verwahrt worden, worauf ich zu fernerweiter jedesmal zeitiger Vorsicht (...) die nöthigen Anweisungen gegeben habe.“ Am 27. Mai des Jahres hatte Herr Gebler hier 22 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 289, Film 0031). Als der Geschworene im Quartal Crucis 1834 Meyers Fundgrube befuhr, war festzustellen, daß man schon wieder einen neuen Schacht absenkte, diesmal zu „bessrer und bequemerer Erlangung von Braunstein.“ Mit diesem Schacht war man bis August 3½ Lachter tief niedergekommen und hatte dort „einen Nieren sehr guten Brauneisensteins angetroffen, den man abzubauen anfängt.“ (40014, Nr. 289, Film 0042 und 0048) Das war´s dann aber auch schon wieder im Jahr 1834 zum Grubenbetrieb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während der Grubenbetrieb
bei Meyers Fundgrube weiterlief, ereignete sich im Umfeld ein
wahrer „Boom“ von Neuaufnahmen, was dem Grundbesitzer ‒ seit 1806 ist Carl Gottlieb Meyers Sohn,
Erdmann Friedrich Meyer, selbst Besitzer des Hammergutes Tännicht ‒ ebensowenig wie
seinem Nachbarn, Carl Edler von Querfurt auf dem Rittergut
Bereits am 27. Februar 1835 hatte sich Herr Gebler dorthin begeben und darüber in seinem Fahrbogen festgehalten (40014, Nr. 289, Film 0077): „Am 27ten Februar habe ich wegen mehrerley von Seiten des Besitzers des Hammerguths Tännicht bey Schwarzbach über verschiedene von Eigenlöhnern und Schürfern begangene Ungebührnisse erhobene Beschwerden diesen Reviertheil durchgangen und untersucht und gefunden, daß sich auf einem Stück Waldboden von ohngefähr 20 Scheffel Inhalt wenigstens 20 alte und neue Schächte befinden, von denen mehrere offen stehen, andere zwar verbühnt, aber überaus schwach verbühnt, auch selbst die gangbaren nicht durchgehends erträglich verwahrt sind, ohngeachtet schon oftmals desfalls von mir strenge Anweisungen an sämtliche dort bauende Eigenlöhner, der großen, daraus entspringenden Gefahr wegen, ergangen und selbige unter Bedrohung mit der von Eu. Königl. Bergamte auf Vernachlässigungen dieser Art schon längst gesetzten Strafe von 5 Thl. für jeden einzelnen Fall, zu bessrer Ordnung (angedroht?) worden sind. Zwar habe ich mich auch diesmal nach Möglichkeit bemühet, diesen gefährlichen Unordnungen abzuhelfen, ob aber meine (?) und Bestrebungen von Nutzen gewesen seyen, wird sich erst nach einiger Tage Verlauf darthun.“ Schriftlich ging die folgende Beschwerde am 18. März 1835 beim Bergamt ein (40014, Nr. 292, Blatt 1f): An das wohllöbl. Bergamt Scheibenberg zu Annaberg „Durch den Bergbau auf Eisen- und Braunstein, welchen Eigenlöhner in meiner Erbwaldung treiben, leide ich schon seit vielen Jahren den empfindlichsten Schaden. Dermalen befinden sich daselbst 18 gangbare Zechen und 5 verlaßene Schächte ohne die Menge trichterförmiger Vertiefungen zu gedenken, die durch Schurfarbeitemn und ins Freie gefallene Gruben entstanden sind. Zu jeder dieser Zechen führt ein Weg und wenn Eisenstein gewonnen oder Grubenhölzer nöthig werden, nothwendig auch ein Fahrweg und hinlänglicher Raum zum Umkehren, wodurch meiner sonst so schönen Waldung der empfindlichste Eintrag geschieht, ohne noch den Umstand zu veranschlagen, daß ich mein Vieh ohne Gefahr nicht mehr einhüten laßen kann. Jetzt will sich ein Bergmann zu gleichen Behuf mitten in ein Stück Feld bei mir mit Bergbau einlegen. Nun weiß ich zwar wohl, daß nach den bergrechtlichen Bestimmungen den Bergleuten, wenn sie Schurfzettel erlangt und bergüblich gemuthet haben, der Eigenthümer des Grund und Bodens dieselben nicht stören darf, allein es ist eben so gesetzlich, daß der Grundbesitzer für alle Schäden, die ihm durch den Bergbau zugezogen werden, von den Gewerken oder Eigenlöhnern nach den ausgemittelten Beträgen entschädigt werden muß. Mir hat aber noch nie ein Bergmann eine derartige vergütung angeboten oder sich dafür geneigt erklärt, obschon viele 100 Fuder Eisenstein von den Gruben in meiner Waldung abgefahren worden sind. Meine Geduld ist aber auch rein zu Ende und deshalb bitte ich E. Wohllöbl. Bergamt gehorsamst, sobald als es die Witterung gestattet, eine Local Expedition bergamtswegen anzuberaumen, die Eigenlöhner, welche ich nicht benennen, wohl aber der Herr Reviergeschworene anzugeben wißen wird, dazu vorzuladen und obbeschriebenen Bergbau in meiner Waldung nicht nur in Augenschein zu nehmen, sondern auch die Entschädigung für mich, sowohl wegen der Vergangenheit, bei noch bemittelten gangbaren Gruben, als auch für die Zukunft nicht nur festzustellen, sondern mir auch in Weigerungsfällen dazu zu verhelfen. Vom Tage der Expedition erbitte ich mir wenige Nachricht, damit Verfaßer dises mit zugegen seyn kann und bin hochachtungsvoll. Hammerguth Tännicht, den 11. Mart. 1835 Erdmann Friedrich Meyer“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das zeitliche Aufeinandertreffen mit der ähnlich gelagerten Beschwerde des Herrn von Querfurth ist auffällig und vielleicht nicht nur durch die gleichartigen Probleme der Grundbesitzer mit den Eigenlöhnern verursacht. Wenn die beiden sich nicht sogar abgesprochen haben... Auch wenn der Besitzer des Hammergutes Tännicht nicht ‒ wie der Nachbar auf Förstel ‒ wenigstens von niederem Adel war, konnte man im Bergamt daraufhin jedenfalls nicht untätig bleiben, faßte einen Beschluß und setzte folgendes Antwortschreiben auf (40014, Nr. 292, Blatt 6f): „Auf von Endesbenannten Besitzer des Hammerguths Tännicht, Herr Erdmannn Friedrich Meyer, bei uns geführten Beschwerde, daß ihm von mehreren Eigenlehnern, welche auf seinem dasigen Grund und Boden Eisenstein- und Braunsteinbergbau treiben, bedeutenden Schaden in den Feldern und Waldungen zugefügt werde, ohne hierunter irgend eine Entschädigung zu erlangen, und auf deßen Gesuch um baldige Abhülfe solcher Beschwerden, sind wir entschloßen, dieserhalb auf fraglichem Gebirge eine Localbesichtigung und Abhaltung eines gütlichen Verhörs zwischen den Partheyen vorzunehmen, haben hierzu künftigen 28ten April 1835 terminlich anberaumt und werden demnach allerseits Endesbenannte resp. Eigenlehner und Schürfer hiermit citando bedeutet, gedachten Tages von nachmittags 2 Uhr an, ein jeder bei seiner Grube und vorzunehmenden Schurf unsere Ankunft zu erwarten, solche Expedition, womit wir bei der Herrn Meyers Wohnung zunächst gelegenen Grube den Anfang zu machen beabsichtigen und allwo Herr Meyer sich einzufinden befinden wird, hernach bei den anderen Gruben damit fortfahren werden, bei Vermeidung 5 Thl. individueller Strafe beizuwohnen, nach zu beschehendem Vortrag mit einander gütlich Verhör und Handlung zu pflegen und da möglich ein gütliches Abkommen zu treffen, in Entstehung deßelben aber weiteren bergamtlichen Bescheids sich zu versehen. Der Bothe ist zu lohnen.“ Annaberg mit Scheibenberg, den 13ten April 1835 Das Bergamt
daselbst, Dieser Ortstermin fiel hiernach auf denselben Tag, wie der in Bezug der Beschwerden des Herrn von Querfurth, war nur halt nachmittags ab zwei Uhr festgesetzt. Soviel Standesachtung war auch durch das Bergamt zu beachten... Außerdem in Kopie zugestellt wurde dieses Schreiben und damit herbeizitiert wurden die folgenden Bergbautreibenden und Schürfer (40014, Nr. 292, Rückseite Blatt 7ff): 1.) dem Eigenlehner Steiger Carl August Vulturius zu Raschau wegen Friedlich Vertrag 2.) dem Eigenlehner Georg Friedrich Distler wegen Kästners Hoffnung und Distlers Freundschaft 3.) dem Eigenlehner Christian Gottlob Richter zu Raschau wegen Großzeche 4.) dem Eigenlehner Christoph Heinrich Viehweg und Cons. zu Raschau wegen 2ten und 3ten Maaß nach Großzeche 5.) den Eigenlehnern Hanibal Friedrich Schmiedel und Carl Friedrich Harnisch zu Raschau wegen 1ter oberer Maaß nach Kästners Hoffnung 6.) den Eigenlehner Friedrich August Jahn zur Mittweida wegen Bescheert Glück 7.) den Schürfern Johann Gottlieb und Carl Friedrich Gebrüdern Merkel in Raschau wegen unter Friedlich Vertag zu treibenden Schurfarbeiten 8.) dem Schürfer Ludwig Weisflog in Langenberg wegen eines am Sudelhau oder der obern Heide bei Waschleithe aufzunehmenden Rösche und Untersuchung auf Eisenstein 9.) dem Schürfer Friedrich August Fischer und Cons. zu Grünstädtel wegen Schürfens in der Nähe des Herrn Meyers oberhalb von Großzeche zugehörigen Quell und Brunnen Waßers. 10.) dem Schürfer Christian Friedrich Enderlein in Raschau wegen eines Schurfes an der Straße von Tännicht nach Langenberg 11.) dem Schürfer Steiger Christian Gottlieb Kräher aus Raschau wegen eines unterhalb Bescheert Glück angefangenen Schurfes Während die Lehnträger in den Fahrbögen der Geschworenen äußerst selten namentlich genannt sind (nur in den Verleihungen) haben wir hier zugleich einmal eine Auflistung, wer denn zu dieser Zeit eigentlich Besitzer und Betreiber der Gruben gewesen ist. Nebenbei bemerkt, fällt uns hier wieder auf, daß man in diesem (und in vielen anderen) Schreiben seitens des Bergamtes den Begriff ,Eigenlehner' regelmäßig mit einem ,e' schreibt, also nicht ,Eigenlöhner', wie es dieselben gewöhnlich selbst und auch Herr Meyer hier tat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Protokoll zu diesem Ortstermin ist
wieder in einer schwer leserlichen Handschrift abgefaßt und unser
Transkript weist daher leider einige Lücken auf
(40014, Nr. 292, Blatt 10ff):
Protocollirt „Auf die von dem Besitzer des Hammerguths Tännicht bey Schwarzbach, Herrn Erdmann Friedrich Meyer, (...) geführte Beschwerde, daß ihm von mehrern in seiner Waldung und Feldern Eisen- und Braunstein Bergbau treibenden Eigenlöhnern und durch Schürfer zeither empfindlicher Schaden, ohne irgend eine Vergütung zu erhalten, zugefügt werde, und auf die von dem Herrn Revier Geschworenen Gebler beschehene Anzeige von betreffenden Eigenlöhnern und Schürfern, hat sich das Bergamt zu der hierunter auf heut anberaumten Besichtigung und Untersuchung solcher Beschwerden auf Abhaltung eines Verhörs zwischen den Partheyen in ernannten Herrn Meyers Hammergut Waldung begeben, woselbst derselbe, ingleichen Von den Eigenlehnern und Schürfern folgende 1) Carl Friedrich Weigel, welcher auf dem verlaßnen Grubengebäude Gabe Gottes Fdgr. Versuch und Schurfarbeit treibt. 2) Johann Gottlieb Merkel und Carl Heinrich Merkel, diese beide bey dem im Freyen liegenden Feld Fröhliche Zusammenkunft gev. Fgr. Versuchs Arbeit treiben. 3) der Eigenlehner und Steiger bey Friedlich Vertrag gev. Fdgr. Carl August Waltern 4) der Eigenlehner bey Kästners neue Hoffnung gev. Fdgr. George Friedrich Distler 5) Christian Gottlieb Richter, Lehnträger und (Miteigenlehner ?) bey Groszeche gev. Fdgr. 6) Carl Friedrich Schmiedel, Carl Friedrich Harnisch, Eigenlehner des gemutheten, jedoch noch nicht bestätigten Berggebäudes Kästners Hoffnung ober mittagige nächste Maße, 7) August Friedrich Jahn, Miteigenlehner der an die abendliche Seite der Groszeche anstoßenden 1. und 2. untern abendlichen Maaß, 8) der sub. 4. Genannte Distler, als Eigenlehner von Distlers Freundschaft gev. Fdgr. 9) Friedrich August Jahn, Eigenlehner von Bescheert Glück, 10) Christian Gottlieb Kräher, Schurfarbeiten an vorgenannten beyden Gruben, etwas das Gebirge herab in mitternachtmorgentlicher (Entfernung ?) 11) Friedrich August Fischer, welcher in dem Felde Groszeche erste obere nächstmittagliche Maaß zu, weit gegen Morgen an des Hrn. Grundbesitzers Brunnen und der mit Feldsteinen gemauerten Rohrwaßerleitung zu schürfen angefangen und damit Waßer in deßen Schurf gezogen, auch auf des Bergamtes Anordnung, Herr Markscheider August Friedrich Städter sich mit eingefunden. Nach gemachtem Vortrag der heutigen Expedition und nachdem alle (...?) sämtliche Eigenlehner und Schürfer ernstlich vernehmet worden, ihre großtheils (...?) und schlecht verwahrten Schächte sorgfältiger und täglich mittels aufzulegender Pfosten (?) zu verwahren, ihnen auch bekannt zu machen gewesen, daß man Seiten des Bergamtes zu Erlangung genauer Kenntnis von den vielen neben und unter einander liegenden Gruben Felde und zu Vermeidung der anjetzt so oft vorgekommenen Feldstreitigkeiten dem Herrn Markscheider Städter der Auftrag ertheilet habe, das Feld jeder Grube gehörig ausmeßen und über das Ganze einen Riß zu fertigen, wozu sämtliche Betheiligte nach Masgabe der von ihnen benutzten Flächenraumes ihren Beitrag zu den diesfallsigen Kosten zu entrichten haben, sämtliche Interessenten auch damit zu gleich waren, so wurde alsdann zu Besichtigung einer jeden der Eigenlehner und Schürfer zum Betrieb ihrer Gruben sich angemeßnen Flächenraums, Absenkung mehrer Schächte und Schurfarbeiten sowohl als Verhör und handlung geschritten, das Befinden daran und (...?) Art und Weise Grundbesitzer wegen der (?) Beschwerde, mit jedem der Eigenlehner und Schürfe ein Abkommen getroffen, worin folgendes bemerkt. ad 1. Fand das Bergamt tadelnd (?) und unzuläßig zu rügen, daß ernannter Schürfer Weigel bei den Schurfarbeiten in einer nächsten Entfernung voneinander bereits zwey (?) Schächte geschlagen, den zwischen beyden wieder angefangenen dritten ganz unzuläßig und einen von ihnen zwar (?) und am räthlichsten der mittlerer auf jeden Fall wieder zuzufüllen sey. Ob nun schon Weigel seinen neusten Schacht damit zu rechtfertigen sich bemühte, mit solchem unmittelbar Anbrüche treffen zu können, so ward ihm jedoch bedenklich gemacht, daß er jeden der beyden von diesem abliegenden Schächte Örter bis auf das angebliche Eisensteinmittel mit geringen Kosten (?) zu treiben seyn würden, sich auch die hier etwa gewonnen werdenden Eisensteine durch einen derselben bequem zu Tage fördern ließen, wodurch eben sowohl Holz für den Ausbau des 3ten Schachtes erspart, als dem Grundbesitzer ein Stück Boden für die Wald Cultur erhalten ward, daher es denn bey zweyen Schächten Verbleiben haben, was den jährlich diesfalls zu leistenden Grundzinß aber anbetrifft, die Bestimmung desselben soll vor der Hand bis zur Bestätigung der Grube ausgesetzt bleiben solle. Kein weg (...?) ad 2. zu den etwas weiter gegen Abend von hier von Johann Gottlieb Merkel und Cons. bey dem im Freyen liegenden Felde bey Fröliche Zusammenkunft Fdgr. unternommenen Schurfarbeiten und erhielten die Schürfer die Weisung, bei dem Ausstürzen der von ihnen herrührenden (?) Halde die nächst anliegenden Bingen und Vertiefungen mit einzufüllen, wegen zu leistenden Abtrags aber nach erfolgter Beseitigung oben sich findendens mit Hrn. Meyer zu vergleichen. ad 3. Begab man sich zu der gegen Abend, wo der nächst anliegenden mit der dortigen Markscheide haltenden Grube Friedlich Vertrag Fdgr. und missbilligten zuvorderst den von dem Eigenlehner Herrn Vulturius mit seinen sämtlichen Halden und Sturzplätzen eingenommenen großen Raum so wie besonders, das Vorhandenseyn dreyer Schächte und (?) maßen der gangbare Hauptschacht noch ein anderweiter gegen Abend gelegener, auch (?) ein dritter vom Hauptschacht aus mehrere Lachter gegen Mitternacht Morgen (...?) und verschiedene Lachter tief niedergebracht worden. Da man nun die vom anwesenden Eigenlehner diesfalls vorgebrachten Entschuldigungen, daß dieses alles ihm nöthig gewesen, nicht für genügend zu halten vermochte, so konnte demselben nur angedeutet werden, den alten obern Schacht ohne weiteres einzufüllen, zum Bedarf des Wetterzuges aber mit einer tüchtigen Pfosten- Wetterlotte zu versehen, übrigens aber und da desfalls mit dem Betrieb dieser mit sehr (vielem?) Glück auf Eisenstein bauenden Grube dem Grundbesitzer ein bedeutendes Stück Waldboden entzogen wurde, sah man im Jahr (?) angemessenen Grundzinß (?), welcher nach deshalb mit Hrn. Meyer gepflogener Verhandlung auf 2 Thl. – Gr bestimmt und quartaliter mit – Thl. 12 Gr. abzuführen beschloßen worden. Als man hierauf ad 4. zu Besichtigung der von hier aus weiter gegen Abend gelegenen, mit der vorigen aber auch ebenfalls Markscheide haltenden Grube Kästners Hoffnung gev. Fdgr. verschritt, woselbst sich zwey Schächte gangbar befinden, der ältere dritte am Waldrand aber nach des Eigenlehners Distler Versprechen des nächsten zugestürzt werden soll, fand sich weiter etwas nicht zu erinnern, im übrigen aber machte sich derselbe anbietlich, dem Hrn Grundbesitzer alljährlich einen Thaler an Grundzinß und zwar quartaliter – Thl. 6 Gr. zu bezahlen. ad 5. Bey Beaugenscheinigung der mit der vorigen gegen Abend hin gleichmäßig Markscheide haltenden gevierten Fundgrube Groszeche fand das Bergamt lediglich die zu (?) Umgebung den als Wetterschacht ohnfern des Hauptschachtes gegen Mittag hin befindliche zweyte Wetterschacht oder Lichtlochs zu tadeln, daher sei nöthig, den Eigenlehner (...?) zu veranlaßen, stärkere Säulen einzugraben oder noch lieber einen ganz (?) sogenannten Zeltbau zu Vermeidung aller Gefahr darüber zu stellen; Übrigens leistete des Lehnträgers Miteigenlehner Richter das Versprechen, von nun an dem Hrn. Grundbesitzer Hrn. Meyer einen Grundzinß von jährlilch einen Thaler in quartaliter ratio von – Thl. 6 Gr. zu entrichten, wobey (?) ließen sich auch beruhigen. ad 6. Kästners Hoffnung obere mittagige nächste Maas anlangend, so ist diese Grube zwar noch nicht bestätigt, jedoch von den Eigenlehnern, welche einen Versuchsbau getrieben haben, bereits auf Bestätigung angetragen worden, und haben dieselben sich verbindlich erklärt, vor der Hand und bis die Grube zu größeren Eisenstein (?) gelangt seyn wird, jährlich – Thl. 16 Groschen quartaliter mit – Thl. 4 Gr. an Hrn. Meyer abzustatten, womit derselbe auch zustimmt. ad 7. Da an der abendlichen Seite der Groszeche die 1te und 2te untere abendliche Maase nach der Groszeche Fdgr., welche von August Friedrich Jahn und Consorten betrieben wird, bey jetzt verfrühender Bestätigung derselben, zu liegen kommen wird, dermalen auch nur ein einziger Schacht daselbst im Gange sich befindet, ob man wohl einen zweyten des Wetterwechsels wegen des ehesten niederbringen zu müßen, für nothwendig erachtet, dagegen auch von dem Bergamte etwas nicht einzusprechen war, so erbot sich nun noch genannter Eigenlehner der hierunter allenthalben bedürfenden Flächenraumes wegen einen Grundzinß von jährlich – Thl. 16 Groschen in vierteljährlichen Raten mit – Thl. 4 Gr. an Hrn. Meyer abzustatten, welcher dieses acceptirte. ad 8. War bei Distlers Freundschaft Fdgr. zu bemerken, daß man zwar angefangen hatte, an der Zufüllung eines neben den Kranz des Hauptschachtes und zwar an der Abendseite vor einiger Zeit entstandene kleinen Tagebruchs zu arbeiten, daß man aber diese Arbeit noch nicht zu Ende gebracht, daher dem Eigenlehner entgegenbewand, solche Zufüllung des ehesten u bewerkstelligen, übrigens derselbe den von Hrn Meyer verlangten Grundzinß an jährlich einen Thaler in quartaliter mit – Thl. 6 Gr. von nun an abzuliefern angelobet. Was ad 9. Bescheert Glück anbetrifft, so war daselbst weiter nichts zu bemerken, als daß der Eigenlehner Friedrich August Jahn von nun dem Grundbesitzer Hrn. Meyer verlangten Grundzinß an jährlich – Thl. 16 Groschen entrichtet (?): ad 10. Wurde Itens dem Schürfer Steiger Kräher, dessen Schurf wie obbemerkt von der sub 9. bemerkten Grube Bescheert Glück das Gebirge herab in mitternachtmorgendlicher Richtung sich vorgefunden, bedeutet: Seinen bereits 6 Lr. tief in Lehm, Mulm und Gneus rollig ohne alle auch die geringste Holzverwahrung niedergebrachten Schacht (?) Verzug und längstens von heut und 14 Tagen gehörig in (?) zu setzen und zu verwahren. IItens Erhält der Schürfer Fischer obgedachter des Grundbesitzers Brunnen benachtheiligender Umstände halber die Weisung, seinen Schurf weiter gegen Abend in die Nähe der morgendlichen Markscheide von Groszeche 1te und 2te unter nächste abendliche Maaß zu legen, hiernach aber auch die Bedeutung, auf von des Grundbesitzers Verlangen zu dessen Sicherstellung wegen etwaiger Benachtheiligung an dessen Brunnenwasser eine Caution von 25 Thalern baar beim Bergamte zu erlegen und wurde übrigens demselben das bey von diesfallsigen Verhandlungen gegen das Bergamt bewiesenen unanständigen und (?) Betragens ernstlich zu (ermahnen?). Womit sich die Expedition geendigt und dieses alles wie es an Ort und Stelle in die Schreibtafel notirt, alsdann darauf anhero protocollirt, vorgelesen, solches von (…?) Herrn Bergamts Markscheider, resp. Markscheider Städter und denen Interessenten so weit letztere des Schreibens kundig mit unterschrieben worden, als August Christian
Mathesius, Bergschreiber und Protokollant, Während früher zumeist eingangs der Protokolle die Anwesenden verzeichnet sind, ist das Schreiben in diesem Falle von einer Reihe weiterer, bekannter Bergbeamter als Teilnehmer abgezeichnet: Carl August
Schalig, (Oberzehntner und Austheiler in Annaberg)
Gleich am 4. Mai 1835 hat der Geschworene „die Schwarzbacher und Langenberger Revierabtheilung, theils wegen Besichtigung der vorhandenen Braunsteinvorräthe, theils um das Benehmen und Verhalten der dortigen vielen Eigenlöhner zu beobachten, besucht.“ (40014, Nr. 289, Film 0086) Vertrauen ist gut ‒ Kontrolle bekanntlich besser. Auch am 8. Mai hat Herr Gebler erneut „eine Besichtigung im Tännicht abgehalten.“ (40014, Nr. 289, Film 0087) Und gleich am 1. Juni 1835 war er schon wieder „in Betreff der Braunstein- Vorräthe und wegen mancherley die Eigenlöhner betreffenden Verhältnisse“ im Langenberg'er und Schwarzbach'er Revier unterwegs (40014, Nr. 289, Film 0095). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevor wir zur Geschichte von Meyers Hoffnung Fundgrube zurückkehren, sei an dieser Stelle noch angefügt, daß Herr Meyer auch später auf seinen Grund und Boden achtete. Der Annaberg'er Rezeßschreiber Lippmann, der zu dieser Zeit den eigentlich amtierenden Berggeschworenen Theodor Haupt vertrat, hielt einige Jahre später über einen Streit um das Brunnenwasser des Hammerguts Tännicht in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 321, Film 0026): „Am 30. März 1842 befuhr ich zufolge der Meyerschen (Anzeige?) auf bergamtliche Directorialanordnung abermals Wilkauer vereinigtes Feld, und stellte namentlich in Bezug auf die Lage des südlichen in Glimmerschiefer stehenden Querschlages zu gedachten Hrn. Meyers Brunnenwasser die erforderlichen Beobachtungen und Erörterungen an, worüber ich dem Kgl. Bergamt jedoch besondere Anzeige erstatten werde.“ Diese Anzeige Lippmann's an das Bergamt haben
wir auch in den
„Dann beging ich das Tännicht und die Langenberger Gegend über Tage und bringe hierbei zur Kenntniß des Kgl. Bergamtes, daß der Besitzer des Tännichtguthes, Hr. Meyer, die Ausstürzung eines auf seinem Territorium liegenden alten offenen Schachtes dringend wünscht. Die von mir vorgenommene Besichtigung ließ die Billigkeit dieses Wunsches nicht verkennen, denn der fragliche alte, vielleicht 8 – 10 Lachter tiefe, offene Schacht liegt nur ohngefähr 5 Schritte zur Seite eines aus Schwarzbach nach Mittweida führenden Fahrweges, seine niedrige Halde ist nur auf der dem Wege abgekehrten Seite mit etwas jungem Holze bewachsen und ist solcher daher sowohl für Menschen, als für Vieh gefährlich genug. Ich hoffe, das Kgl. Bergamt wird mich autorisiren, die Zufüllung dieses alten Schachtes anordnen zu dürfen.“ Um welchen alten Schacht es sich hier eigentlich handelte, ob das Bergamt Herrn Lippmann zu den notwendigen Maßnahmen autorisierte und was danach geschehen ist, verraten uns zumindest die Fahrbögen leider nicht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herrn Erdmann Friedrich Meyer's
Fundgrube hat Herr Gebler in diesem Jahr erstmals am 28. Januar
1835 befahren, dabei aber nichts bemerkenswertes zu berichten gefunden (40014, Nr. 289, Film 0071f).
Ein zweites Mal ist Herr Gebler
am 17. November auf der Grube angefahren, worüber er notierte, daß der
Besitzer und Eigenlöhner nur einige Lachter von dem gangbaren Tageschacht
gegen Mitternacht einen neuen hat anfangen lassen und mit demselben schon
bei 2 Lachtern Teufe „vortrefflichen schwarzbraunen Eisenstein
angetroffen“ habe. Den eigentlichen Hauptabbau hat man dagegen stehen
gelassen (40014, Nr. 289, Film 0128).
Und am 4. Dezember dieses Jahres heißt es im Fahrbogen,
„die Mächtigkeit des ersunkenen Nierens ist sogar noch etwas
ansehnlicher geworden.“ (40014, Nr. 289, Film 0134) Auf der Bergamtssitzung am 5. Dezember
1835 hat der Geschworene darüber berichtet (40169,
Nr. 244, Blatt 17).
Bereits am 6. sowie am 12. Oktober 1835 waren davon insgesamt 40 Fuder ausgebracht und lagen zum Vermessen bereit (40014, Nr. 289, Film 0121). Außerdem hatte Herr Erdmann Friedrich Meyer am 10. November 1835 zu seiner Fundgrube die erste abendliche und die erste mitternächtliche gevierte Maß gemutet und am 3. Dezember 1835 noch eine nächste abendliche gevierte Maß. Nach Besichtigung durch den Geschworenen erhielt er diese am 7. Januar 1836 bestätigt (40169, Nr. 244, Blatt 18, 40014, Nr. 270, Film 0164 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 236). Im Jahr 1836 war Herr Gebler ebenfalls dreimal vor Ort, um den Eisenstein zu vermessen, dessen Menge sich in diesem Jahr auf 65 Fuder summiert hatte. Fahrberichte zum Grubenbetrieb gibt es dagegen nicht. Aber wir können wohl annehmen, daß diese Menge dem neuen Tageschacht und dem neuen Grubenfeld entstammte. Aus dem folgenden Jahr gibt es zu dieser Grube nur die eine Notiz in den Fahrbögen, daß Herr Gebler am 24. Mai des Jahres hier zugegen war, um 30 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 294, Film 0039). Mit Trinitatis 1838 enden diese Überlieferungen und erst ab Reminiscere 1840 wurde die Funktion des Berggeschworenen in Scheibenberg mit Theodor Haupt neu besetzt (40014, Nr. 300).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch hier ist der neue Geschworene
schon am 10. Januar 1840 angefahren. In seinem Fahrbogen hat er darüber
festgehalten (40014, Nr. 300, Film 0015): „Meyers gev. Fdgr wird jetzt mit 2 Mann betrieben, mittelst deren der Durchschlag zwischen beiden Schächten bewirkt und in 5½ Lachtern Teufe hierauf eine Strecke 3 Lachter in SO hora 7 getrieben worden ist, auf welcher durchgehends der Eisenstein ½ Lachter mächtig ansteht. Zugleich bricht hier Braunstein mit, der 0,1 bis ¼ Lachter mächtig ist.“ Auch auf der Bergamtssitzung am 22. Februar 1840 hat der Geschworene mitgeteilt, daß der Durchschlag zwischen beiden Schächten nun erreicht worden ist (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 18). Schon am 16. März 1840 war Herr Haupt erneut auf der Grube und notierte (40014, Nr. 300, Film 0030): „Auf Meyers gev. Fdgr. fahren 2 bis 5 Mann an, mittelst deren 1.) in 8 Lachter Teufe vom untern Schachte aus 2 Örter getrieben werden, das eine in West, das andere nach dem obern Schachte zu, vor welchem letzteren hübsche Anbrüche von Braunstein und Eisenstein anstehen. 2.) auf dem obern Bau vom obern Tageschachte aus in SO, wo die Eisensteine ½ Lachter und der Braunstein 0,1 bis 0,25 Lachter mächtig ist, die nur genannten Erze gewonnen werden.“ Wie schon sein Vorgänger, ist auch Herr Haupt vergleichsweise häufig auf Meyers Fundgrube gefahren ‒ gleich erneut am 7. April 1840. Nun berichtete er, daß zwei Mann die nach SO. gehende Strecke „in Mulm und sehr schönen Braunstein“ betrieben. Bei 3 Lachter war man dabei aber (wieder einmal) auf einen alten Bau gestoßen, den man für den alten Fundschacht hielt. Im Schachtstoß stünde aber noch Braunstein an, „indem die Alten denselben nicht geachtet“ und nur den Eisenstein gesucht hätten (40014, Nr. 300, Film 0043). Bei seiner nächsten Befahrung am 19. Mai 1840 fand er den Abbau eingestellt (40014, Nr. 300, Film 0061): „Auf Meyers gev. Fdgr. endlich findet jetzt kein Betrieb in der Grube statt und man beschäftigt sich blos mit Ausschlagen des gewonnenen Eisensteins.“ Den ausgebrachten Eisenstein hat Herr Haupt am 29. Mai auch vermessen. Im Sommer darauf gab es dann wie jedes Jahr die schon bekannten Probleme: Der Geschworene notierte unter dem 10. August 1840 in seinem Fahrbogen, an diesem Tage „habe ich die Eigenlöhner Gruben im Tännicht befahren. Von diesen sind mehrere gegenwärtig wegen Wettermangel nicht in Betrieb oder werden daselbst wenigstens nur die Halden ausgekuttet oder die früher geförderten Producte ausgeschlagen. Diese Gruben sind namentlich Meyers gev. Fdgr. Ullricke gev. Fdgr. Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. Kästners neue Hoffnung gev. Fdgr.“ (40014, Nr. 300, Film 0091f) Auch einen Monat später gab es noch nichts weiter zu berichten. Auch am 8. September 1840 hieß es nur, „auf Meyers, Kästners, Distlers, Ullricke und Hausteins Fdgr. findet gegenwärtig wegen Wettermangels kein Betrieb statt.“ (40014, Nr. 300, Film 0107f)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie wir schon wissen, vertrat dann von
Crucis 1840 bis Mitte Reminiscere 1841 der Raschau'er Schichtmeister
Friedrich Wilhelm Schubert den Geschworenen Haupt im Bergamt
Scheibenberg. Auch der fand die Grube Anfang Oktober 1840 aber noch
unbelegt (40014, Nr. 300,
Film 0113). Am 25. November ist Herr Schubert wieder hier angefahren (40014, Nr. 300, Film 0131f), wobei er zu berichten fand, daß der alte Tageschacht bis 9 Ltr. Saigerteufe abgeteuft und „in nöthigster Zimmerung gesetzt war.“ In dieser Tiefe war ein Ort auf einem Braunsteinlager gegen Süd in Betrieb und 3,2 Ltr. lang, welches mit dem neuen Schacht in Verbindung gebracht werden solle. Vom alten Schacht aus gegen West wurde ein Versuchsort auf einem dem Braunsteinlager aufliegenden und gegen 0,3 Ltr. mächtigen Eisensteinlager getrieben. Anfallende Berge sollen in den bei 4 Ltr. Teufe liegenden und entbehrlich gewordenen Abbau verstürzt werden, wo ohnehin die Zimmerung wandelbar geworden ist. Während hier lange Zeit stets zwei Häuer angelegt waren, war die Grube jetzt nur noch mit zwei Knechten und „bisweilen mit einigen Weilarbeitern belegt.“ Herr Schubert war danach noch zweimal, am 4. und am 16. Januar 1841 (40014, Nr. 300, Film 0142f und 0146) auf dieser Grube. Darüber berichtete er in seinen Fahrbögen, das Versuchsort auf dem Braunsteinlager gegen Ost war inzwischen 4 Lachter ausgelängt. Der Braunstein stand dort 0,4 Lachter mächtig an, aber da „anjetzt kein Absatz des Braunsteins ist und der Eigenlöhner über 60 Ctr. dergleichen in Vorrath hat, so habe mit Zufriedenheit des Eigenlöhners die Anordnung getroffen, das Braunsteinlager im Liegenden anstehen zu lassen.“ Dieses Ort sollte aber auf dem Hangenden fortgetrieben werden, um mit dem neuen Schacht durchschlägig zu werden. Zugleich sollte mit dem Ort gegen West auf dem Eisensteinlager dieses im Streichen aufgeschlossen und abgebaut werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trinitatis 1841 war Herr Haupt
wieder im Dienst in Scheibenberg und hat diese Grube am 24. Mai des Jahres
wieder befahren, worüber er in seinem Fahrbogen notierte (40014, Nr. 300,
Film 0181), man baue das
Eisensteinlager in 9 Lachter Teufe nordwestlich vom oberen Schacht ab und
der Brauneisenstein sei dort von guter Beschaffenheit und über 1 Lachter
mächtig.
Von seiner nächsten Befahrung am 27. Juli 1841 berichtete er (40014, Nr. 300, Film 0206f), auf Meyers Fdgr. sei der untere Schacht neu ausgezimmert und danach das Eisensteinlager nördlich vom oberen Schacht von der Strecke seitwärts weiter abgebaut worden. Wie zuvor sein Vertreter auch, beklagte er dann noch: „Schade, daß der Betrieb auf dieser Grube dem Wunsche des Lehnträgers zu Folge tagelöhnerartig ist, der hier so regelmäßig wie auf einer wohlhabenden Gewerken- Grube gehen könnte. Unter solchen Umständen können daher auch die hier anfahrenden Leute, ohnerachtet deren nur 2 sind, nicht controlirt werden und es ist leicht möglich, daß dieselben zu wenig leisten. Dazu kommt, daß der Lehnträger der Grube die Leute nicht im Lohne fortrücken laßen will und dieselben nur als Knechte bezahlt.“ Letzteres war natürlich eine besondere Ungerechtigkeit, denn die beiden Häuer leisteten im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigentlich keine schlechte Arbeit. Noch einmal war Herr Haupt dann am 19. August 1841 zugegen und hielt in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 300, Film 0225): „Auf Meyers Hoffnung gev. Fdgr. wird jetzt wenig gethan, weil die aus 2 Mann bestehende Mannschaft namentlich in der Feldwirthschaft verwendet wird, so daß in 1 Woche circa 2 Schichten nur verfahren werden. Dazu kommt, daß im unteren Bau die Wetter fehlen. Auf dem obern Bau in 5 Lachter Saigerteufe unter der Hängebank des obern Schachtes hat man eine Strecke 2,8 Lachter lang in Ost und hierauf 3 Lachter in ONO. In Mulm, sehr schönem Braunstein und etwas Eisenstein getrieben. Jedenfalls ist diese Grube eine der aussichtsvollsten im Tännichtwalde, wird aber bei dem jetzigen Betriebe niemals gedeihen, wo es vorgekommen ist, daß der Lehnträger die Bergleute mit Ablegen bedachte, weil sie sich deßen Willen zur Feldarbeit zu gehen, nicht sogleich fügen wollten, indem der Schacht an seinem kurzen Stoße zusammenzubrechen drohte.“ Auch der Tännichthammer war, wie Förstel auch, ja längst keine Eisenhammerwerk mehr, sondern ein Landgut. Obwohl diese beiden Männer also offenbar auf die Sicherheit ihres Bergwerkes bedacht waren und sich deshalb gegen den Willen des Gutsbesitzers Erdmann Meyer, der zugleich Lehnträger der Grube gewesen ist, gewehrt haben, beklagte Herr Haupt erneut: „Auf der einen Seite wirkt also die Unordentlichkeit der Leute, auf der andern der Widerwillen gegen Bergbau im Tännicht, wo alle Umstände günstig für den Eigenlöhnerbergbau sind, darauf hin, Ordnung und Regelmäßigkeit, wie sie auf dem Wilkauer Felde zu Stande gebracht worden ist, nicht aufkommen zu lassen.“ Diesen beiden einsamen Häuern hier würde ich jedenfalls keine Unordentlichkeit vorwerfen. Und auch der Vergleich mit dem vereinigten Felde hinkt: Die Belegschaft dort war zu dieser Zeit fast zehnmal so groß. Mit einem anderen wirtschaftlichen Hintergrund kann man natürlich auch anders arbeiten... Auch beim Bergamt sah man dies ähnlich und am 6. September 1841 schrieb man an den Lehnträger, man sehe sich veranlaßt, „Ihnen ernstlich zu bedeuten, dergleichen Handlungen zu unterlassen, wobei (es) sich so sehr um die nicht genug zu beachtende Sicherheit der anfahrenden Bergarbeiter handelt, und sich nicht wieder zu Schulden zu bringen.“ (40169, Nr. 244, Blatt 19).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie wir schon wissen, wurde Herr
Haupt Crucis 1841 erneut vonseiten höheren Amtes zu anderen Aufgaben
beordert. In der folgenden Zeit vertrat ihn in seiner Funktion als
Geschworener dann der Rezeßschreiber Lippmann aus Annaberg (40014, Nr. 300,
Film 0230). Der letztere befuhr die Gruben im Tännichtwald am 15. September des Jahres und berichtete über Meyers Hoffnung gev. Fdgr. (40014, Nr. 300, Film 0230), sie sei wie immer mit 2 Mann belegt, welche in der 5 Lachter- Sohle bei 4 Lachter Entfernung vom oberen Schacht ein Ort hora 8,4 SO. „in Mulm und Brockenquarz mit sehr reinem und in großen Nieren vorkommenden Braunstein, welchem zugleich auch etwas Brauneisenstein beigestellt ist,“ betrieben. Die Baue auf der 9 Lachter- Sohle waren dagegen wegen Wettermangels noch immer nicht zu befahren. Ferner ist der untere Schacht 10 Lachter nordöstlich vom oberen, in letzter Zeit auf den oberen 4 Lachter Teufe ganz neu verholzt worden. Bei seiner nächsten Befahrung am 18. Oktober fand Herr Lippmann den Abbau in der 5 Lachter- Sohle unverändert vor (40014, Nr. 300, Film 0254). Die 9 Lachter- Sohle hatte aber wieder Wetter und daher wurden hier vom oberen Schacht weg 3½ Lachter hora 12,0 nach Norden und 1 Lachter in die Gegenrichtung Örter getrieben, um hier den „putzenförmig in sehr zerrüttetem Quarz“ einbrechenden Eisenstein abzubauen. Das nächste Mal war Herr Lippmann am 11. November 1841 zugegen und berichtete nun in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 300, Film 0262f), es werde jetzt in der 9 Lachter- Sohle am oberen Schacht ein Ort hora 6,0 gegen Morgen zur Aufsuchung von Eisenstein getrieben, welches „in sehr quarzigem Braunstein“ stehe, aber schon bei 1 Lachter Länge den Mulm im Liegenden dieses Lagers erreicht hatte. Lippmann wies an, sich mit dem Ort nach Südosten zu wenden, um schneller das im Mulm liegende Eisensteinlager zu überfahren. Auch im unteren Schacht ging bei 10 Lachter Teufe wieder Betrieb um. Hier wurde ein ½ bis 1½ Elle mächtiges Eisensteinlager ortweise hora 11,4 nach NW. in dessen Fallen abgebaut und damit waren 3 Lachter Länge erreicht. Lippmann wies hier an, dem Lager im Streichen zu folgen, um eine regelmäßigere Bebauung einzurichten. Vom unteren Schacht nach Südosten war ein Ort auf den oberen Schacht zu bereits 6 Lachter ausgelängt und hier stehe ein „1 Lachter mächtiger Braunstein von vorzüglicher Reinheit an, da jedoch dem Eigenlöhner an der Gewinnung desselben weniger liegt, als an der von Eisenstein, so wird dermalen auch nichts an diesem Punkte gethan.“ Letzteres blieb auch zunächst so: Auch bei seiner nächsten Befahrung am 10. Dezember 1841 (40014, Nr. 300, Film 0272) fand Herr Lippmann den oberen Bau eingestellt und beide Arbeiter auf der 9 Lachter- Strecke vom unteren Tageschacht nach Norden auf dem dortigen Eisensteinbau angelegt, „wo sich das Lager 0,25 – 0,3 Lachter mächtig erweist.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erste Befahrung im neuen Jahr 1842
erfolgte am 13. Januar (40014, Nr. 321,
Film 0003). Herr
Lippmann fand aber nur zu berichten, man baue wie zeither auf der 10
Lachter- Sohle vom untern Tageschacht in Mitternacht auf mehreren, von 2 Zoll bis 0,2 Lachter mächtigen Eisensteintrümern. Am 9. März 1842 berichtete Herr Lippmann über Meyers Hoffnung Fdgr. (40014, Nr. 321, Film 0018f), hier sei man „durch die zugetretenen Frühjahrswasser aus den Bauen der 9 Lachterstrecke verjagt worden und beschränkt sich gegenwärtig auf den Betrieb eines in hora 6 vom obern Tageschacht in Morgen gehenden Ortes, mittelst welchem man ein in gelbem Mulm aufsetzendes, 0,1 Lachter mächtiges Eisensteintrum... bereits 3 Lachter verfolgt hat.“ Auch bei der Niederhaltung des Tauwassers in den Gruben würde ein Wasserlösestolln vom Talgrund aus sehr hilfreich sein. Aber noch gab es den auch bei dieser Grube nicht... Unweigerlich folgte, wie eigentlich fast jedes Jahr, im Sommerhalbjahr wieder Wettermangel und am 21. Juni 1842 notierte Herr Lippmann in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 321, Film 0048), an jenem Tage „inspizierte ich die Eigenlöhnergruben bei Langenberg, im Tännicht und bei Schwarzbach, unter den ich Köhlers, Ullricke, Bescheert Glück, Distlers Freundschaft und Meyers Hoffnung gev. Fdgr. unbelegt fand.“ Zuvor aber hat er am 19. Mai hier Braunstein verwogen (40014, Nr. 321, Film 0042). Auch danach muß es aber sporadischen Betrieb gegeben haben, denn am 19. August war hier Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0068). Nach dessen Rückkehr nach Scheibenberg war für Herrn Haupt in seinem Fahrbogen unter dem 22. September 1842 (40014, Nr. 321, Film 0082) dann zu erwähnen, „daß der Betrieb auf Meyers seit kurzem und zwar in der 6 Lachtersohle wieder begonnen hat, indem der Tiefbau wegen Wettermangel und Wasserzudrang noch unfahrbar ist.“ Man betrieb in dieser Sohle zwei Örter vom obern Tageschacht aus, zum einen in Süd „in Quarz mit Brauneisenstein durchzogen“ und ein zweites in NNW., „um den hier brechenden schönen Braunstein sowie zugleich etwas Eisenstein abzubauen.“ Im Herbst des Jahres hatten sich wieder Wetter eingestellt und auch die der Grube zusitzenden Wasser haben abgenommen. Von seiner Befahrung am 27. Oktober 1842 berichtete Herr Haupt (40014, Nr. 321, Film 0094), an diesem Tage „habe ich die Eigenlöhnergruben im Tännichtwalde befahren, von denen aber die Mehrzahl wegen der Kartoffelernte gegenwärtig nicht in Betrieb gehalten wird und selbst auf Meyers Hoffnung gev. Fdgr. findet nur ein periodisches Anfahren statt.“ Dabei betrieb man einerseits das Fallort auf der 6 Lachter Sohle in NNW. weiter, zum anderen trieb man in dem wieder zugänglichen Tiefbau in der 10 Lachter- Sohle 1½ Lachter östlich vom Tageschacht ein Ort hora 9 SO.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 22. Februar 1843 war der Geschworene
erneut zugegen und hielt nun in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 321, Film 0145),
daß die nach wie vor hier angelegten zwei Mann einerseits in der 6
Lachtersohle eine Strecke in ONO. gewältigten, „um den von den
Vorfahren verstürzten Eisenstein zu gewinnen.“ Außerdem betrieb man
eine Strecke in 9 Lachter Teufe in Süd, „in der Hoffnung, in 4 – 5 Lachter Entfernung Eisenstein damit anzufahren, den man in einem alten
Schachte gesehen haben will.“
Das klingt beim Lesen schon sehr nach ,Hoffnungsbau' und der immer wiederkehrenden Suche nach den von den Vorgängern unbeachteten Resten oder nach neuen Anbrüchen... Man hatte aber wieder Glück, denn nach seiner Befahrung am 28. März 1843 notierte Herr Haupt (40014, Nr. 321, Film 0159), man treib in 7 Lachter Teufe des obern Schachts bei 4 Lachter östlicher Entfernung eine Strecke hora 11 Süd in Braunstein, Quarz und Eisenstein, und ferner war in 9 Lachter Teufe ein neues Ort nach Ost in Mulm angehauen, „worin Braunsteinknollen liegen.“ Danach wurde Herr Haupt erneut abgeordnet und Herr Lippmann mußte ihn wieder vertreten. Letzterer fand die Grube bei seiner ersten Befahrung am 1. Mai 1843 ganz unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0172), schaute deshalb am 4. Mai wieder vorbei und fand den Abbau auf der oberen Sohle in Umgang (40014, Nr. 321, Film 0175). Die untere Sohle war wieder abgesoffen. Außerdem war noch bemerkenswert: „Zu erwähnen ist noch, daß der Eigenlöhner an seiner Schneidemühle ein kleines 3stempliges Pochwerk zum Braunsteinpochen anbauen will.“ Schau an. Bisher gab es ja nur ein einziges derartiges Pochwerk bei der Grube Gelber Zweig unterhalb von Langenberg. Bei seiner nächsten Befahrung am 13. Juni 1843 fand Herr Lippmann eigentlich alles beim alten geblieben vor (40014, Nr. 321, Film 0182). Die zwei Mann trieben in 7 Lachter Teufe am obern Schacht jetzt bei 7 Lachter Entfernung ein Ort hora 12 Süd in der „mit vielem Braunstein... gemengten Quarzbrekzie. Aufgegangene Wasser und der herrschende Wettermangel verhindern den Betrieb in der tiefen Sohle.“ Am 20. Juli war Herr Lippmann
dann wieder hier zugegen, um den ausgebrachten Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 321, Film 0194f).
Außerdem nahm er an diesem Tage die oben schon erwähnte
Ende Dezember 1843 kehrte Herr Haupt dann wieder nach Scheibenberg zurück. Am 6. Februar 1844 hat er Meyers Fdgr. wieder selbst befahren und fand sie wieder, wie meist, mit 2 Mann belegt (40014, Nr. 322, Film 0009). Sie gewannen auf zwei Örtern in 7 Lachter Teufe Eisenstein, das eine in Ost, das zweite Ort in Nord und beide waren 2 bis 3 Lachter vom Schacht ausgelängt. „Die Anbrüche sind schön, der Eisenstein aber so zerspaltet, daß sich weder ein Streichen, noch ein Fallen abnehmen läßt.“ Noch einmal war Herr Haupt am 1. März hier zugegen (40014, Nr. 322, Film 0019f), fand die Mannschaft aber damit beschäftigt vor, „einen kürzlich gemachten Tagebruch auf alten Bauen, wieder einzufüllen.“ Ende April wurde Herr Haupt dann schon wieder mit anderen Aufgaben betraut und für den Rest des Jahres 1844 vertrat ihn diesmal der Markscheider Friedrich Eduard Neubert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der letztgenannte befuhr diese Grube
erstmals am 7. Mai 1844 und berichtete in seinem Fahrbogen darüber (40014, Nr. 322, Film 0037f),
Meyers Hoffnung sei „vor der Hand nicht belegt, indem der
Eigenlöhner die Bergarbeiter jetzt zum Gewinnen von Kalksteinen verwendet;
soll aber nächstens wieder in Betrieb gesetzt werden.“
Ach ja, zum Tännichtgut gehörten ja
auch noch
Neben anderen betroffenen Gruben, wie etwa Köhlers Fdgr. bei Langenberg, hatte das Tauwasser auch auf Meyers Hoffnung in diesem Frühjahr wieder einmal zu Schäden geführt: „Hier ist der obere oder neue Schacht vom Tiefsten heraus bis auf 5,5 Lachter Teufe unter Tage zu Bruche gegangen und es steht zu erwarten, daß dieser Theil des Schachtes in der nächsten zeit noch vollends zusammen gehen wird, indem bei genannter Teufe hinter dem nördlichen langen Stoße der Bruch noch in die Höhe gegangen und die Zimmerung daselbst ohne allen Halt ist. Der Eigenlöhner beabsichtigt, diesen Schacht wieder gewältigen und neu ausbauen zu lassen, um das bei 5,5 Lachter Teufe aus demselben in südöstl. Richtung gegen 8 Lachter erlängte Ort... wieder in Belegung zu nehmen.“ Dies betreffend hatte Herr Neubert aber Befürchtungen, daß die Arbeiter dafür nicht die nötige Umsicht und Geschicklichkeit haben und daß zudem der erwachsende Kostenaufwand „ebenso hoch kommen dürfte, als wenn ein frischer Schachtbetrieb eingeleitet wird, so habe ich angerathen, bei der Ortung gedachten Ortes einen neuen Schacht niederzubringen und jenen zuzuschütten.“ Nun, bei der Art des Betriebes dieser Eigenlöhnerzechen ist das letztere ziemlich sicher die kostengünstigere Lösung gewesen. Beim Fahrbogenvortrag am 25. Mai 1844 fand die Anordnung jedenfalls „die volle Genehmigung des Bergamts.“ (40169, Nr. 244, Blatt 20) Auf dem Weg zu einer Befahrung des Roten Stollns bei Schwarzbach führte Herr Neubert's Weg dann am 10. Juni wieder hier vorbei und bei der Gelegenheit, so hielt er es in seinem Fahrbericht fest (40014, Nr. 322, Film 0045f), „bemerke ich, daß der Betrieb noch immer sistiert ist und daß der neue Schacht (...) nun vollends zu Bruche gegangen ist.“ Damit hatte sich eine Gewältigung wohl endgültig erledigt. Am 8. August 1844 war Herr Neubert jedenfalls wieder zugegen (40014, Nr. 322, Film 0057f), fand Meyers Hoffnung seit Anfang 4ter Woche Crucis wieder belegt, hat hier 39 Fuder Eisenstein vermessen, welche auf das Eisenhüttenwerk Erla verkauft wurden, und danach den neuen Tageschacht besichtigt, „welcher 5,6 Ltr. hora 8,0 SO von dem im vorigen Quartale zusammengegangenen Schachte abgesunken wird.“ Dieser neue Schacht war inzwischen 2,5 Ltr. saiger niedergebracht und ausgezimmert. In dieser Tiefe ist man „auf ziemlich große Blöcke von Brockenfels, in welchem Parthien von Brauneisenstein eingewachsen sind“, gekommen. Wie im Sommer üblich, waren die vom alten oder unteren Tageschacht aus noch zugänglichen Baue dagegen wegen Wettermangel nicht zu befahren. Bis zu seiner nächsten Befahrung am 5. September 1844 war der neue Schacht schon auf 6,1 Ltr. Teufe abgesunken. In dieser Tiefe hatte man ein Ort nach SO. angehauen, aber erst 0,3 Ltr. erlängt (40014, Nr. 322, Film 0062f). Im Herbst 1844 wurde auch die
unmittelbar benachbarte Grube
Zur Vermeidung späterer Feldstreitigkeiten aufgrund der nahen Lage der beiden Gruben hat dann Herr Neubert am 15. November 1844 noch „bei Meiers Hoffnung gev. Fdgr. auf dem südöstlichen Eckpunkte der Fundgrube Lochsteine setzen lassen und die Notizen zu der Besichtigungsanzeige gesammelt, welche behufs der Bestätigung des, von dem Bergarbeiter Carl Heinrich Lei an der südlichen Seite besagter Fundgrube gemutheten Grubenfeldes bereits an das Königl. Bergamt abgegeben worden ist.“ (40014, Nr. 322, Film 0075)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung bei Meyers
Hoffnung durch den Vertreter des Geschworenen erfolgte aber am
7. Oktober 1844. Darüber berichtete Herr Neubert in seinem
Fahrbogen (40014, Nr. 322, Film 0070),
mit dem oben schon erwähnten Ort
„hat man bei 1,5 Ltr. Erlängung in eine aus dem im vorigen Frühjahr
zusammengegangenen Schacht getriebene Strecke geschlagen und von dieser
bei 3 Ltr. Erlängung nordwestlicher Entfernung vom Durchschlagspunkte ein
zweites Ort in Betrieb genommen, welches ich bereits 0,5 Ltr. hora 12 Nord
erlängt fand. Mit diesem soll ein 12 bis 18 Zoll mächtiges Eisensteintrum
verfolgt werden.“
Bis zum 7. November 1844, als Herr Neubert hier dem Vermessen beiwohnte, hatte man dabei schon 12 Fuder Eisenstein gewonnen, „wovon 6 Fuder an das Eisenhüttenwerk Obermittweida und 6 Fuder an das Hammerwerk Erla verkauft worden sind.“ (40014, Nr. 322, Film 0073f) Seine letzte Befahrung im Jahr 1844 führte Herr Neubert hier am 5. Dezember durch, worüber im Fahrbogen zu lesen steht (40014, Nr. 322, Film 0080ff), die Grube sei jetzt mit 4 Mann in zwei Schichten belegt, „welche 4 Örter in Betrieb hielten sowie mit dem Ausbau eines neuerdings abgeteuften Schachtes beschäftig waren. Der Schacht ist 4,85 Ltr. östlich von dem südöstlichen Lochstein der Fundgrube von Meiers Hoffnung entfernt, liegt auf einer der zu derselben neugemutheten Maaßen, war 5,5 Ltr. tief und in Mulm niedergebracht, in welchem bei 5 Ltr. Teufe ein söhliges Eisensteintrum von 6 bis 10 Zoll Stärke liegt. Auf diesem Trum beabsichtigt man, gegen N. Abbau einzuleiten.“ Hier horcht man auf: Herr Meyer hat also nicht nur die langjährige Belegung verdoppelt, sondern auch noch (dem Text nach gleich mehrere) Maße hinzugenommen ? Vielleicht ja aus Sorge, daß die neue Konkurrenz in der Nachbarschaft ihm die besten Lager wegschnappen könnte... In der Bergamtsakte fanden wir die Bestätigung vom 23. April 1845 über die erste bis dritte obere und die dritte bis sechste untere Maß östlich und nördlich der Fundgrube; es waren also insgesamt sechs Maßen oder 18.816 m² Fläche, die zum bisherigen Feld hinzugenommen wurden (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 21). Vielleicht durch die Konsolidation von Friedlich Vertrag und Kästners Hoffnung 1841 und den Einzug von Wilkauer vereinigt Feld im Revier 1839 angeregt, erweiterte nun auch Herr Meyer sein Grubenfeld. Außerdem ist aber das schon am 7. Oktober erwähnte Ort weitergetrieben worden, dabei in alten Mann gekommen und deshalb sei man mit dessen Richtung seitlich abgewichen. Ein zweites Ort stand ebenfalls in der 6 Lachtersohle bei 2,5 Lachter südwestlicher Entfernung vom Neuschacht in Umgang. Ein drittes Ort war im südwestlichen Stoß des Neuschachtes nach SO. angesetzt und bis jetzt 2 Lachter erlängt. Das vierte Ort schließlich war bei 4,25 Ltr. Teufe des Neuschachtes hora 9,2 NW angesetzt und inzwischen 1,3 Lachter ausgelängt. Auch hier wurde ein 9 Zoll mächtiges Eisensteintrum abgebaut. Das klingt alles nach einer ziemlich erheblichen Umgestaltung und Modernisierung des Grubenbetriebes, wie sie vielleicht auch überfällig war, wollte man mit der Konkurrenz mithalten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner ersten Befahrung im nächsten
Frühjahr, am 7. März 1845, fand
Herr Neubert auf der Grube dann sogar 5 Mann angelegt, die „jedoch
täglich nur ½ Schicht verfahren, indem sie die übrige Tageszeit sich mit
Brechen von Kalkstein beschäftigen.“ Gangbar waren 3 Örter, davon zwei
bei 4,25 Ltr. Teufe und das dritte in der 6 Lachtersohle. Letzteres fand
er von dem im Quartal Crucis 1844 niedergebrachten sogenannten Neuschacht
aus 5,8 Ltr. hora 4,3 SW. erlängt, womit eine 0,2 Lachter mächtige, söhlig
liegende und viel Eisenstein führende Schicht des Mulms verfolgt wurde.
Das erste der anderen Örter stand 2 Ltr. vom Schacht hora 12,2 Süd und man
hatte damit ein 0,8 Ltr. mächtiges Eisensteintrum erreicht, welches bei
45° westlichem Fallen hora 10,2 fortzusetzen schien und neben schönem
Brauneisenstein etwas Pecheisenerz (Stilpnosiderit) und Quarzbrocken
führte. Das dritte in dieser Sohle liegende Ort war vom östlichen Stoß des
Neuschachtes 3,2 Ltr. hora 9,3 NW fortgetrieben und stand in Mulm, worin
Nester eines „etwas quarzigen Eisensteins“ lagen (40014, Nr. 322, Film 0098f).
Auch im April 1845 stellte Herr Neubert nur schwachen Betrieb fest, „weil der Eigenlöhner die Arbeiter hauptsächlich nur zum Gewinnen von Kalkstein benutzt hat.“ (40014, Nr. 322, Film 01050) Aber dennoch war bis zum 16. Mai 1845 eine Menge von 30 Zentnern Braunstein zum verwiegen bereit und darüber hinaus waren 28 Fuder Eisenstein zu vermessen, die nach Erla geliefert wurden (40014, Nr. 322, Film 0115). Am 27. Mai war Herr Neubert noch einmal hier und hat „auf Meiers Hoffnung, Friedlich Vertrag und Wilkauer vereinigt Feld Eisenstein und Braunsteinstufen behufs deren Einsendung zur Industrieausstellung in Dresden ausgeschlagen.“ (40014, Nr. 322, Film 0118) Am 6. Juni 1845 fand Herr Neubert Meyers Hoffnung „unregelmäßig mit 2 bis 5 Mann belegt.“ Es waren zwei Örter in Umgang, beide in 5,8 Ltr. Teufe, die aus dem obersten, in der Nähe von Gabe Gottes niedergehenden Schacht getrieben waren, das eine 4 Ltr. in N. und NW. erlängt, soll auf das vom mittleren Schacht in 6 Ltr. Teufe in SO. bereits 4 Ltr. getriebene Ort zwecks Wetterwechsel durchschlägig gemacht werden. Das zweite Ort war 2 Lachter hora 6,2 fortgestellt und diente der Untersuchung des östlichen Teils des Grubenfeldes (40014, Nr. 322, Film 0120f). Dabei hatte man bis zum 15. Juli des Jahres wieder 24 Fuder, 3 Tonnen Eisenstein ausgebracht und nach dem Vermessen nach Erla geliefert (40014, Nr. 322, Film 0126). Vor der nächsten Befahrung am 7. August waren erneut 10 Fuder zu vermessen, die diesmal nach Obermittweida gingen (40014, Nr. 322, Film 0130f). Über den Betrieb schrieb Herr Neubert in seinem Fahrbogen, es seien nun 4 Mann angelegt, die täglich zwei sechsstündige Schichten verfahren und drei Örter in Betrieb halten. Eines lag in bei 6 Ltr. Teufe des mittleren Schachtes und 6 Ltr. südwestlicher Entfernung nach Süd auf einem Eisensteinmittel, ein zweites am gleichen Ort in 4,3 Ltr. Teufe vom Schacht 6 Ltr. in S. und SO. entfernt und nach SO getrieben, wo zwar nur wenig Eisenstein enthalten war, das man aber nach dem oberen Schachte forttreiben will, um es mit dem Gegenort von diesem aus in 5,8 Ltr Teufe durchschlägig zu machen. Diese beiden Örter standen noch 9 Ltr. auseinander. Ferner hatte Herr Neubert „noch zu bemerken, daß man bei 57 Ltr. nordwestlicher Entfernung vom mittleren Schacht auf einer der neuerdings bestätigten Maaßen einen 4ten Schacht abgesunken hat, der jedoch wegen sehr schlechter Wetter nicht zu befahren war.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem stärkeren Betrieb stieg
natürlich auch das Ausbringen an und so war Herr Neubert in der
Folgezeit bis September 1845 noch viermal zugegen, um das Verwiegen von
insgesamt 277 Zentnern Braunstein sowie das Vermessen von weiteren 22
Fudern Eisenstein (wieder nach Erla) zu überwachen (40014, Nr. 322, Film 0133,
0136, 0138 und 0144) und am 25. November des Jahres
waren noch einmal 10 Fuder, 3 Tonnen ausgebracht (40014, Nr. 322, Film 0157). Dabei vermeinte Herr Neubert
auch in seinem Fahrbericht vom
13. November 1845 wieder, es gehe nur ein schwacher Betrieb um, da „die
meisten Arbeiter beim Kalkbrechen eingesetzt waren,“ nur zwei auf der
Grube. Diese waren auf zwei Örtern in 4,3 Ltr. Teufe des mittleren
Schachtes angelegt. Das südöstliche Ort war immer noch nicht mit dem obern
Schacht behufs Wetterwechsel durchschlägig gemacht worden, was Neubert
nun zu beschleunigen empfahl. Das andere südöstlich vom mittleren Schacht
hatte ein „recht hübsches Eisensteinmittel“ angefahren, das weiter
untersucht werden sollte (40014, Nr. 322, Film 0155).
Am 18. Dezember 1845 fand Herr Neubert wieder 7 Mann auf der Grube angelegt, von denen aber nur zwei täglich hier 2 Schichten verfahren, die übrigen 5 nur je ½ Schicht, weil sie die übrige Zeit mit Kalkbrechen beschäftigt waren. Der Durchschlag der Örter ist erfolgt und so war „ein frischer Wetterzug“ festzustellen. Auf der Ulme der Verbindungsstrecke bei 3 bis 4 Lachter vom obern Schacht wurden Eisensteintrümer abgebaut, außerdem waren zwei Örtern in derselben Teufe von 4,6 Ltr. sowie in 6 Ltr. Teufe des mittleren Schachtes zur Aufsuchung neuer Mittel in Belegung (40014, Nr. 322, Film 0161f). Bei der Ausbeut- und Verlagsdeliberation am 24. Januar 1846 (also beim Anschnitt) auf das Quartal Luciae 1845 errechnete sich der für das abgelaufene Quartal wiedererstatte Verlag zu 27 Neugroschen, 9 Pfennigen pro Kux oder (es gab ja nur einen Besitzer) zu 116 Thaler, 7 Groschen, 5 Pfennige insgesamt (40169, Nr. 244, Blatt 22). Herrn Meyer wird es gefreut und angespornt haben... Bei einem solchen Ergebnis hielt auch im folgenden Jahr der Betriebsumfang an und am 12. Februar 1846 fand Herr Neubert sogar 8 Mann Belegschaft auf der Grube vor (40014, Nr. 322, Film 0174f), welche 1.) 2,5 Ltr. vom obern Schacht entfernt auf der Kommunikationsstrecke zum mittleren Schacht „recht hübsche, in Mulm einbrechende Eisensteinnester“ abbauten, 2.) 6 Ltr. vom oberen Schacht das von dieser Strecke hora 1,2 SW aufgehauene Versuchsort inzwischen 1,5 Ltr. erlängt hatten, ferner 3.) hielt man ein Flügelort der gedachten Strecke bei 4,8 Lachter südöstlicher Entfernung vom Schacht in Belegung, welches nun 7,4 Ltr. in SO fortgebracht war und „wo hübscher Eisenstein in der Sohle einbricht“ 4.) Schließlich wurde in der 6 Lachtersohle bei 2,5 Ltr. nordwestlich vom Schacht „schöner reiner Brauneisenstein, der übrigens auch ziemlich frequent einbrach,“ gewonnen. 5.) Und endlich war noch ein Ort im Schlage, welches in 4 Ltr. Teufe aus dem unteren Schacht 8,2 Ltr. in SO erlängt war, und das mit den aus den mittleren Schächten getriebenen Bauen durchschlägig gemacht werden soll, um auch dem unteren Teil des Grubenfeldes bei dessen Aufschließung besseren Wetterwechsel zu verschaffen. Natürlich kam bei diesem Betrieb auch etwas heraus und so hat Herr Neubert außerdem gleich noch 126 Zentner Braunstein verwogen. Am 24. Februar 1846 waren dann auch wieder 28 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 322, Film 0176). Bei der Befahrung am 16. März waren nur noch 4 Mann angelegt und erst einmal mit Zimmerungsarbeiten befaßt, da man an mehreren Punkten Brüche befürchtete. Zuvor hatte man die schon beschriebenen Baue fortgestellt und dazu auch den oberen Schacht noch um 2,5 Ltr. vertieft (40014, Nr. 322, Film 0178f). Bis zur nächsten Befahrung am 23. April 1846 waren erneut 60 Zentner Braunstein zum Verwiegen bereit. Über den Grubenbetrieb schrieb Herr Neubert in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 322, Film 0190f), es waren bloß 2 Örter mit 2 Mann belegt, einmal auf der Kommunikationsstrecke 4 Ltr. nordwestlich vom oberen Schacht nach Nord sowie im Tiefsten des mittleren Schachtes, den man auf 9,2 Ltr. bis auf den Glimmerschiefer verteuft hatte. Letzteres wurde hora 7,0 West nach einem von dort etwa noch 5 Ltr. entfernten Bau, der vom unteren Schacht getrieben war, ausgelängt, um dort noch anstehenden Braunstein abzubauen. Bis zur nächsten Befahrung am 24. Juni 1846 war das tiefe Ort in 9,2 Ltr. Teufe des mittleren Schachtes bei 5,2 Ltr. Erlängung in die alten Baue eingeschlagen, wo man noch „hübsche Braunsteinnester“ angefahren hatte, die ein Mann der Belegschaft nun abbaute. Der zweite Mann baute in 5,8 Ltr. Teufe und zirka 4,5 Ltr. nördlich vom oberen Schacht Eisenstein ab (40014, Nr. 322, Film 0203f). Bis August des Jahres hatte man dabei wieder 50 Zentner Braunstein sowie 18 Fuder, 3 Tonnen Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 322, Film 0199 und 0217). Bei seinen Befahrungen am 16. November und am 10. Dezember 1846 fand Herr Neubert im wesentlichen denselben Betrieb vor, nur hatte man zuletzt auch das vom unteren Schacht gegen Südost getriebene Ort wieder belegt und damit bei nun 8 Ltr. Länge „ziemlich frischen Glimmerschiefer“ erreicht (40014, Nr. 322, Film 0232).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr Neubert hat Meyers
Hoffnung das letzte Mal am 18. und 19. Februar 1847 befahren, wobei er
die Grube mit 4 Mann belegt fand, die vor einem
Ort in 5 Ltr. Teufe des oberen Schachtes, jetzt 3,2 Ltr. in Mitternacht erlängt, und einem in 6,2 Ltr. Teufe des mittleren Schachtes, 2,7 Ltr.
nach Mitternacht Morgen erlängt, arbeiteten. Außerdem wurde der Abbau in 9
Ltr. Tiefe zwischen den beiden mittleren Schächten betrieben (40014, Nr. 322, Film 0241f).
Damit endet die Reihe der überlieferten Fahrbögen in diesem Aktenbestand. Auch in der Bergamtsakte zur Grube besteht eine zeitliche Lücke bis 1855, in der es wohl keine bemerkenswerten Ereignisse auf Meyers Hoffnung gegeben hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste überlieferte Akteninhalt besteht dann
aus Briefverkehr zwischen dem Bergamt Annaberg und dem Gerichtsamt in
Scheibenberg, eine Taxation des Bergwerkes betreffend
(40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 22ff),
aus dem wir erfahren, daß Erdmann Friedrich Meyer im Jahr 1855
verstorben ist. Wenn das Gericht die Wertschätzung des hinterlassenen
Vermögens übernimmt, so hat Herr Meyer wahrscheinlich keine mündigen
Erben hinterlassen. Nach einigem Hin und Her wurde jedenfalls der
Geschworene Tröger nach Schwarzbach entsandt und dieser berichtete
am 1. November des Jahres, der Wert des Bergwerks inklusive Inventar läge
nicht höher als 500 Thaler. Inzwischen war auch das Gesetz über den Regalbergbau von 1851 in Kraft und so gibt es statt der früheren Einlegeregistern nun „Anzeigen“ über den Grubenbetrieb im abgelaufenen Jahr. Die erste auf das Jahr 1855 hat Schichtmeister Karl August Voigt in Annaberg im Auftrag des neuen Besitzers Carl Louis Stengel erstellt (40169, Nr. 244, Blatt 29f). Das ging aber flott: Das Gut einschließlich des auf dessen Ländereien befindlichen Bergwerks hat also quasi im Handumdrehen einen neuen Besitzer bekommen. Wie man erst viel weiter im Akteninhalt herausfindet, hatte Herr Stengel offenbar die Tochter Emilie Thekla Meyer geheiratet. Der neue Besitzer entfaltete auch gleich neue Aktivität und die Anzeige besagt, daß er 1855 einen Lehrhäuer und 6 bis 9 Weilarbeiter auf der Grube angelegt hatte. Abbau ging zum einen in 9 Lachter, zum anderen in 6 Lachter Tiefe am mittleren Tageschacht um, wo man im Firstenbau das Lager aushieb. Dabei wurden 89 Fuder Eisenstein ausgebracht und für 120 Thaler, 24 Neugroschen verkauft sowie 30 Zentner Braunstein gefördert, für die man 14 Thaler erlöst hatte. Gemäß der neuen Bestimmungen im Berggesetz von 1851 ist am 30.5.1857 das Herrn Stengel bei Meyers Hoffnung insgesamt verliehene Grubenfeld auf 9.406 Quadratlachter (37.624 m²) oder 10 Maßeinheiten berechnet worden (40169, Nr. 244, Blatt 30f). Wenn wir richtig rechnen, dürfte es also nun neben einer gevierten Fundgrube knapp neun gevierte Maße umfaßt haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für das Jahr 1857 mußte Herr Stengel
auch das erste mal einen Betriebs- und Ökonomie- Plan beim Bergamt
einreichen (40169, Nr. 244, Blatt 31ff).
Daraus erfahren wir noch, daß die Weilarbeiter normalerweise auf der Grube
Gottes Geschick (am Graul) angelegt waren. Man hoffte auf ein Ausbringen
von 100 Fudern Eisenstein und 800 Zentnern Braunstein. Für den ersteren
wollte man einen Preis von 2 Thaler, 20 Neugroschen pro Fuder, für den
Braunstein von 1 Thaler pro Zentner erzielen, so daß man auf 1.066 Thaler
Einnahmen aus dem Erzverkauf käme. Demgegenüber stellte der Besitzer
erwartete Ausgaben von 846 Thalern, so daß er einen Überschuß von 220
Thalern erzielen würde. Bei einem solchen Betrag wurde man auch im
Zehntenamt aufmerksam und verlangte darauf 5 % Reinertragssteuer.
Daraufhin erwiderte aber Bergmeister von Fromberg, daß dies erst in
Frage stehe, wenn die Grube Ausbeute zahle; solange dagegen Rezeß weiter
auflaufe, bestehe ja kein Reingewinn. Den Kassenbestand könne der
Unternehmer dagegen frei wählen (40169, Nr. 244,
Rückseite Blatt 36). Die Sache
wiederholte sich noch einmal im Jahr 1858, wobei Herr Stengel aber
erneut die Unterstützung des Bergamts fand und ihm ein Kassenbestand von
1.000 Thalern zugestanden wurde (40169, Nr. 244,
Blatt 45f).
Außerdem wollte Herr Stengel ab 1857 den uns schon von anderen Gruben bekannten August Hermann Oehme als Schichtmeister und den Zimmerling August Friedrich Wolf als Steigerdienstversorger annehmen, was ihm das Bergamt auch genehmigte (40169, Nr. 244, Blatt 35ff). Dem Betriebsplan auf die Periode 1858 bis 1860 zufolge erhoffte sich der Besitzer mit 8 Mann Belegung eine Förderung von 100 Fudern Eisenstein und 600 Zentnern Braunstein pro Jahr (40169, Nr. 244, Blatt 39ff). Nach seinem Ökonomieplan erwartete er dafür insgesamt 3.229 Thaler Einnahmen und bei 2.402 Thalern Ausgaben einen Überschuß von 827 Thalern in den drei Jahren. Den benannte er aber nun sicherheitshalber in „Cassenbestand“ um. Zunächst war auf das Jahr 1857 wieder eine Anzeige fällig, aus der wir erfahren, daß in diesem Jahr hier angelegt waren:
Bereits im Vorjahr 1856 hatte man begonnen, einen neuen Stolln vom Tal her in das Grubenfeld einzubringen, diesen bis Ende 1856 auf 26 Lachter hora 10 Süd und im Jahr 1857 um weitere 60 Lachter auf nun 86 Lachter Länge fortgebracht. Er sollte der Untersuchung des Gebirges und der Ausrichtung von Erzlagern, aber auch der Wasserlösung für den Kalkbruch dienen (40169, Nr. 244, Blatt 44ff). Der Stolln erhielt den Namen Emilie Stolln und wir vermuten, daß Herr Stengel ihn nach seiner Gattin benannt hat. Ausgebracht hatte man in diesem Jahr 200 Fuder Eisenstein, davon 170 abgesetzt, sowie 1.025 Zentner (!!) Braunstein. Der Verkaufserlös summierte sich auf 1.377 Thaler und 10 Neugroschen, was den Ökonomieplan auf die kommenden drei Jahre sogar übertroffen hätte. Schichtmeister Oehme zeigte dann im Juni 1858 dem Bergamt an, daß es gar keine Grubenrisse von Meyers Hoffnung gäbe, woraufhin Markscheider Reichelt angewiesen wurde, solche zu fertigen (40169, Nr. 244, Blatt 38). Wir zeigen den Verlauf des Emilie Stollns in folgendem Ausschnitt aus dem ebenfalls durch Herrn Reichelt 1875 angelegten Übersichtsriß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Anzeige auf das Jahr 1858 entnimmt man dann, daß doch nur 3 Mann und 2 Weilarbeiter angelegt waren. Die Mannschaft hatte zum einen ein Feldort
auf dem Emilie Stolln 66 Lachter von dessen Mundloch hora 7 Ost
angeschlagen und 15 Lachter ausgelängt. Dort betrieb man einen 2 Lachter
hohen Firstenbau. Außerdem stand in 7 Lachter Teufe des Neuschachts ein
Ortsbetrieb nach Nordosten sowie in 9 Lachter Teufe ein Firstenbau auf
Braunstein in Umgang. Allerdings hat es mal wieder einen Starkregen oder
heftiges Tauwetter gegeben und die
„Wasserfluthen“ hatten bei 68
Lachter Stollnlänge einen Bruch verursacht, der gewältigt und neu
ausgezimmert werden mußte. Dabei hatte man wieder 193 Fuder Eisenstein
ausgebracht und zusammen mit den noch 30 Fudern Rest aus dem Vorjahr für
465 Thaler verkaufen können. Die Förderung an Braunstein erreichte dagegen
mit 465 Zentnern nicht einmal die Hälfte der Vorjahresmenge. Insgesamt
beliefen sich die Einnahmen aus dem Produktverkauf daher diesmal auch nur
auf 930 Thaler (40169, Nr. 244, Blatt 50f).
Für das Jahr 1859 berichtet uns die betreffende Anzeige über den Grubenbetrieb, daß man mit 4 Arbeitern 12 Lachter nordöstlich vom Meyerschacht nun einen Stengelschacht niedergebracht und damit bei 7,5 Lachter Teufe die Stollnsohle erreicht hatte. In diesem Niveau hatte man eine Strecke bis auf den Meyerschacht durchgefahren. Das Feldort bei 66 Lachter des Emilie Stollns hatte man noch bis 23 Lachter vom Stolln ausgelängt, dort aber wohl kein Erz mehr gefunden und es wieder zugesetzt. Das Ausbringen umfaßte 180 Fuder Eisenstein, wovon nur 30 Fuder für 90 Thaler (also das Fuder jetzt für 3 Thaler) verkauft wurden, und 320 Zentner Braunstein, von denen 140 Zentner für 128 Thaler, 10 Neugroschen verkauft worden sind (40169, Nr. 244, Blatt 51ff). Auf Luciae 1860 berechnete Schichtmeister Oehme bei einem Verkauf von 46 Fudern Eisenstein und 160 Zentnern Braunstein Einnahmen von 253 Thalern und bei Ausgaben für Gewinnung, Feldsteuer usw. in Höhe von 175 Thalern einen Überschuß von 79 Thalern (40169, Nr. 244, Blatt 54). Die könnte man als Gewinn entnehmen oder als Verlag verrechnen. Herr Oehme schlug am 26. Januar 1861 aber vor, den Rezeß abzubauen und Herrn Stengel die Summe als Verlag zu bewilligen, was man seitens des Bergamtes auch am 2. Februar genehmigte (40169, Nr. 244, Blatt 53). Der Anzeige auf 1860 zufolge hatte man in diesem Jahr mit 5 Mann Belegschaft bei 70 Lachter Stollnlänge einen Firstenau in Angriff genommen und auf 7 Lachter Länge 2 Lachter hoch abgebaut. Vom Stengelschacht in 5 Ltr. Teufe ausgehend hatte man ein Feldort hora 11 Süd 12 Lachter fortgestellt (40169, Nr. 244, Blatt 55). Dabei wurden 220 Fuder Eisenstein und 220 Zentner Braunstein gewonnen. Für Trinitatis 1861 errechnete Schichtmeister Oehme diesmal einen Verlag von 89 Thalern, 22 Groschen und 7 Pfennigen (40169, Nr. 244, Blatt 56) und für Crucis 1861 in Höhe von 37 Thalern, 16 Neugroschen und 5 Pfennigen (40169, Nr. 244, Blatt 59).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für den Zeitraum
1861 bis 1863 war wieder ein Betriebsplan einzureichen, in dem Herr
Stengel formulierte, er wolle die Belegung auf 6 Mann erhöhen und 100 Fuder Eisenstein und 500 Zentner Braunstein pro Jahr fördern. Dazu sah er
zwei Feldörter, vom Emilienstolln bei 40 und bei 70 Lachter Länge
ausgehend, nach Westen vor. Den erzielbaren Verkaufspreis bezifferte er
mit 25 Neugroschen pro Zentner Braunstein und mit 2 Thalern, 10
Neugroschen pro Fuder
Eisenstein. Seine Bilanz sah bei erwarteten 950 Thalern Einnahmen aber nur
eine „schwarze Null“ vor (40169, Nr. 244, Blatt 62ff).
Der Plan wurde vom Geschworenen Theodor William Tröger begutachtet
und für gut befunden, woraufhin Herr Stengel auch am 8. Februar
1862 die Genehmigung des Oberbergamtes dazu erhielt.
Der Anzeige auf 1861 zufolge ist die Belegung in diesem Jahr aber dann doch bei den 5 Mann geblieben (40169, Nr. 244, Blatt 68). In Umgang standen das geplante Feldort bei 70 Lachter des Emilienstollns und ein Streckenoert bei 8 Lachter Teufe des Meyerschachtes. Dabei wurden in diesem Jahr 319 Fuder Eisenstein und 120 Zentner Braunstein ausgebracht. Der Anzeige zum Grubenbetrieb im Jahr 1862 (40169, Nr. 244, Blatt 70) kann man dann entnehmen, daß die Belegung im Gegensatz zum Betriebsplan sogar wieder auf 2 Mann abgesunken ist. Das Feldort bei 70 Lachter Länge des Emilie Stollns hatte man um weitere 6 Lachter fortgebracht und hier Braunstein gewonnen. Bei 76 Lachter Länge hatte man ein zweites, diesmal nach Osten, angehauen, stand damit aber im Nebengestein. Auch den Abbau am Meyerschacht hatte man um 6 Lachter fortgestellt und hier Braun- und Eisenstein abgebaut, davon in diesem Jahr 75 Fuder und 150 Zentner ausgebracht. Da man davon nichts verkauft hatte, war der Vorrat an Eisenstein auf 225 Fuder angewachsen. Vom aufgelaufenen Vorrat an Braunstein hatte man dagegen 290 Zentner verkauft. Allerdings war auch ein bei 12 Lachter Länge auf dem Emilienstolln gefallener Bruch zu gewältigen. Zum Grubenbetrieb im Jahr 1863 sagt uns die betreffende Anzeige dann (40169, Nr. 244, Blatt 75), daß Herr Stengel 18 Lachter südöstlich vom Meyerschacht wieder einen neuen Tageschacht absenken ließ, den er Wolfschacht nannte. In 5 Lachtern Teufe hatte man damit wieder das Lager erreicht, ein Streichort hora 10,4 Nordwest um 11 Lachter ausgelängt und dort 3 Quadratlachter Fläche ausgehauen. Außerdem war man auch mit der Instandhaltung des Emilie Stollns beschäftigt. Von den ausgebrachten 171 Fudern Eisenstein hatte man 161 Fuder zu 2 Thalern, 15 Neugroschen verkaufen können. Braunstein hatte man diesmal nur 24 Zentner gefördert, diesen aber ‒ zusammen mit dem vom Vorjahr verbliebenen Vorrat ‒ komplett verkauft und einen Preis von 25 Neugroschen pro Zentner erzielen können. Nebenbei erfahren wir hier auch, daß das Fuder Eisenstein zu diesem Zeitpunkt zu 17½ Zentnern, also 875 Kilogramm, gerechnet worden ist. Auch, wenn der Betrieb also weniger umfänglich, als geplant, gewesen ist, war doch ein stetiges Ausbringen zu verzeichnen und so konnte auch Schichtmeister Oehme für Luciae 1863 wieder einen ansehnlichen Betrag von 121 Thalern, 5 Neugroschen und 4 Pfennige Verlag ermitteln (40169, Nr. 244, Blatt 72).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In seinem neuen
Betriebsplan für den Zeitraum 1864 bis 1866 sah Herr Stengel vor,
durchschnittlich 12 Quadratlachter Lagerfläche pro Jahr auszuhauen, wobei
er hoffte, 120 Fuder Eisenstein und 400 Zentner Braunstein pro Jahr
gewinnen zu können, was ihm am 5. Oktober 1864 auch vom Oberbergamt
genehmigt worden ist. Dabei ging er aber nicht mehr, wie drei Jahre zuvor
von 2 bis 6 Lachtern, sondern nur noch von 1 Lachter mittlerer Mächtigkeit
des Lagers aus (40169, Nr. 244, Blatt 76ff).
Die erste Anzeige in diesem Betriebszeitraum über das Jahr 1864 sagt, daß mit nur noch 2 Mann Feldörter in 5 Lachter Teufe am Meyerschacht und am Wolfschacht betrieben worden sind, außerdem eines in der Stollnsohle (40169, Nr. 244, Blatt 82). Man hatte dabei auch nur 10 Fuder Eisenstein und 20 Zentner Braunstein ausgebracht. Von dem auf 235 Fuder angewachsenen Eisenerzvorrat konnte man 100 Fuder für 2 Thaler, 25 Neugroschen pro Fuder verkaufen. 1865 ist Carl Louis Stengel dann aber verstorben. Das erfuhr man im Bergamt erst dadurch, daß Schichtmeister Oehme für dieses Jahr Fristregister eingelegt hatte (40169, Nr. 244, Blatt 87), was Rechnungsrevisor Laue in Marienberg dem Bergamt in Schwarzenberg anzeigte, weil ihm gar keine Fristhaltungsgenehmigung vorläge (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 83). Daraufhin forderte man aus Schwarzenberg die Erbin, Frau Emilie Thekla verw. Stengel, geb. Meyer, auf, entweder Fristhaltung zu beantragen, oder aber das Bergwerk bis zum 2. Januar 1866 wieder in Betrieb zu nehmen (40169, Nr. 244, Blatt 84). Da ein Fristhaltungsantrag der Besitzerin bis dahin nicht eingegangen ist, wurde Geschworener Tröger ausgesandt und dieser teilte dann am 27. Januar 1866 mit, daß wieder Betrieb umgehe (40169, Nr. 244, Blatt 85). Ausführlicher ist dann ein Fahrbogen über eine Grubenbefahrung durch Tröger am 1. Februar 1866, worin dieser berichtete, daß man 30 Lachter vom Mundloch des Emilienstollns einen neuen Schacht absenke, um sich die Förderung zu erleichtern und diesen 4 Lachter niedergebracht habe. Bis zum Durchschlag auf die Stollnsohle fehlten noch 3 Lachter (40169, Nr. 244, Blatt 88). Eine weitere Befahrung fand am 16. März statt, worüber man im Fahrbogen lesen kann, daß der Durchschlag zwischen Schacht und Stolln nun bewerkstelligt sei, man dabei auch ein Braunsteintrum gefunden habe, welches man nun untersuchte (40169, Nr. 244, Blatt 89). Auch bei seiner Befahrung am 21. August 1866 fand Herr Tröger dieses Untersuchungsort in Umgang vor (40169, Nr. 244, Blatt 90). Frau Thekla Stengel zeigte außerdem an, daß sie für die Betriebsleitung den vormals bei Riedels Fundgrube beschäftigten Steiger Friedrich August Hartmann (Name schlecht leserlich) anstellen wolle. Am 26. November war Geschworener Tröger noch einmal vor Ort, worüber in seinem Fahrbogen festgehalten ist, man verführe nun Abbau auf dem am neuen Tageschacht erschlossenen, 12 Zoll mächtigen Braunsteintrum in nördliche Richtung und habe dort auch eine Kaue nebst Scheidestube errichtet (40169, Nr. 244, Blatt 93). Die durch Schichtmeister Oehme erstellte Anzeige über den Betrieb im Jahr 1866 berichtet, was wir auch in den Fahrbögen des Geschworenen schon gelesen haben. Außerdem erfahren wir daraus aber noch, daß man 3 Kubiklachter Lagermasse ausgehauen und dabei nur 7 Fuder Eisenstein, jedoch 420 Zentner Braunstein ausgebracht hat, die sämtlich zum schon vorhandenen Vorrat gestürzt wurden (40169, Nr. 244, Blatt 94f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Frühjahr 1867
brachte dann erst einmal einen schweren Verbruch auf dem Emiliestolln mit
sich. Da der Bruch im Bereich der Unterfahrung der Straße zwischen
Schwarzbach und Förstel liegen müsse, zeigte dies der Friedensrichter zu
Scheibenberg, Heinrich Eduard Richter, dem Bergamt am 9. Mai 1867
an (40169, Nr. 244, Blatt 96).
Daraufhin wurde der Geschworene zur Begutachtung ausgesandt und Herr
Tröger berichtete unter dem 15. Mai des Jahres, die Ursache des
Verbruchs sei die Nässe während des Tauwetters gewesen, die auch auf anderen
Gruben im Revier zu Schäden geführt habe. Die Besitzerin ließe die
Belegschaft aber „Tag und Nacht arbeiten,“ weshalb schon 20 Lachter
vom Mundloch herein wieder gewältigt seien und noch etwa 10 Lachter bis
zur Straßenunterquerung fehlten. Der zuletzt erst geteufte Schacht lag nun
nur 3 Lachter südlich der Straße, was wohl auch die Sorge um die
Sicherheit der Straße ausgelöst hatte. Der Schacht war des Verbruchs im
Stolln wegen auf 4 Lachter über Stollnsohle ersoffen; weil hier aber keine
Abbaue lägen, hielt Herr Tröger vorläufig keine Sicherheitsauflagen
durch das Bergamt für erforderlich (40169, Nr. 244, Blatt 97ff).
Gleich am 13. Juni 1867 schaute Herr Tröger aber wieder nach und berichtete nach Schwarzenberg, daß die Stollngewältigung „so schwunghaft, wie möglich“ fortgestellt werde und man nur noch einige Lachter vor dem Kreuzungspunkt mit der Straße entfernt sei. Beim Schacht hatte sich einer der Schachtstöße um 12 Zoll niedergezogen, aber da er noch abgesoffen war, sei hier vorläufig keine Abhilfe möglich (40169, Nr. 244, Blatt 100). Nach seiner nächsten Befahrung am 23. Juli 1867 konnte Herr Tröger berichten, daß die Straßenquerung nun um 2 Lachter überfahren und der Schacht bald erreicht sei. Das im Stolln angestaute Wasser war bereits abgelaufen. Schließlich fand der Geschworene bei seiner Befahrung am 17. Oktober des Jahres alles wieder instandgesetzt und auch den Schacht neu ausgezimmert vor (40169, Nr. 244, Blatt 101, 102). Da fast den ganzen Sommer lang nur der Stolln auf insgesamt 37 Lachter Länge repariert wurde, hatte auch Schichtmeister Oehme in seiner Anzeige auf dieses Jahr natürlich kein Ausbringen abzurechnen (40169, Nr. 244, Blatt 104). Die Grube war Ende 1867 auch nur mit dem Steiger Hartmann und einem Grubenjungen belegt. Dann ging am 15. Februar 1868 auch noch dieser Steiger ab. Die Anstellung eines neuen erwies sich als gar nicht so einfach und so versorgte Steiger Wendler von Wilkauer vereinigt Feld vorläufig die Aufsicht auch auf Meyers Hoffnung mit, was ihm inhalts eines Schreibens der Besitzerin vom 1. August 1868 auf die erneute Aufforderung des Bergamtes hin, einen Steiger für ihre Grube zu benennen, aber von der Verwaltung der Königin Marienhütte nicht mehr genehmigt werde. Das Bergamt wies daher an, er solle es noch so lange tun, bis ein neuer bestimmt sei (40169, Nr. 244, Blatt 107). Schließlich teilte Thekla, verw. Stengel am 4. November 1868 dem Bergamt mit, da ein anderer nicht zu haben sei, wolle sie denn bei ihr anfahrenden Doppelhäuer Friedrich Weber aus Raschau als Steigerdienstversorger annehmen. Dies wurde auch genehmigt (40169, Nr. 244, Blatt 110f). Was wurde derweil auf der Grube getan ? Nach dem Sitzungsprotokoll zu einem Fahrbogenvortrag im Bergamt am 3. Oktober 1868 hatte Herr Tröger festgestellt, daß es noch keinen Durchschlag zwischen einem (ganz neuen ?) Schacht und dem Stolln gab, was er aber bei einem eventuell wieder eintretenden Verbruch des Stollns als Fluchtweg für die Arbeiter als unabdingbar betrachte. Dies sah man im Bergamt genauso und ordnete die Sistierung der betriebenen Abbaue bis zur Herstellung dieses Fluchtweges an (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 107). Am 10. November des Jahres konnte Herr Tröger dann berichten, daß dem Folge geleistet, dieser Durchschlag bewirkt worden sei und nun wieder ein Gesenk auf deinem Braunsteinlager vor dem Stollnort betrieben werde (40169, Nr. 244, Blatt 112f). Die Anzeige auf das Betriebsjahr 1868 zählt uns dann viele kurze Örter an verschiedenen Punkten im Grubengebäude auf, an denen man mit wieder 5 Mann Belegschaft inkl. Steigerdienst- Versorger Weber Erz abbaute. Dabei hatte man ein Ausbringen von 70 Fudern Eisenstein und 613 Zentnern Braunstein (!!) aufzuweisen. Der Eisenstein kam zum Vorrat, vom Braunstein wurden dagegen 321 Zentner für 214 Thaler (also für 20 Neugroschen der Zentner) verkauft (40169, Nr. 244, Blatt 113).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei den in den Erzlieferungsextrakten
angegebenen Fördermengen just aus der Zeit,
als Herr Stengel die Grube besaß und führte (40169, Nr. 1), haben wir
übrigens besonders auffällige Abweichungen, teils um eine Größenordnung,
gegenüber den in der Grubenakte festgehaltenen Angaben über die
tatsächliche Förderung gefunden, die wir in folgender Tabelle einmal
gegenüberstellen.
Daß es umgekehrt auch Übereinstimmungen zwischen diesen Quellen gibt, macht uns diese Unstimmigkeiten nicht leichter erklärlich. Zumindest scheinen uns einige Quartale oder ganze Jahre bei der Übertragung in die Erzlieferungsextrakte verlorengegangen zu sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang 1869 trat dann das Allgemeine
Berggesetz im Königreich Sachsen in Kraft, womit die Bergämter
aufgelöst und an ihrer Stelle Berginspektionen geschaffen wurden, die hier
regional zuständige in Zwickau. Auch bei Meyers Hoffnung traten
Änderungen ein: Schichtmeister Oehme quittierte seinen Dienst,
dessen Funktion nun ein Obersteiger Albrecht Hartmann übernehmen
solle (welcher zuvor unter Ernst Erdmann Zweigler bei Riedels
Fundgrube tätig war) und auch der Steiger wechselte: Als solchen benannte Frau Stengel
nun den Doppelhäuer Friedrich Eduard Riedel (40169, Nr. 244, Blatt 115f).
Anstelle der Geschworenen kam am 29. Juni 1869 erstmals Berginspektor Gustav Netto aus Zwickau auf die Grube. In seinem Fahrjournal (auch dies hatte man umbenannt) berichtete er, es seien 2 Mann und kein Steiger auf der Grube angelegt (40169, Nr. 244, Blatt 117f). Den eigentlich als Steiger vorgesehenen Riedel hatte Frau Stengel schon wieder entlassen, „weil er sich ihren Anordnungen nicht fügen wollte,“ hielt Netto dazu am 18. Juli 1869 fest (40169, Nr. 244, Blatt 120) und am 9. November 1869 teilte die Besitzerin dann mit, sie wolle den zeitherigen Steigerdienst- Versorger Christian Leberecht Schulz nun als solchen anstellen (40169, Nr. 244, Blatt 124). Jedenfalls hatte man bis zum Juni 1869 einen neuen Schacht 90 Lachter südöstlich vom Mundloch 7 Lachter tief niedergebracht. Der alte Schacht (bei 40 Lachter vom Mundloch) sei „etwas verzogen.“ Der Inspektor hielt deswegen aber keine besondere Anordnung für notwendig, da dieser ja nach dem Einbringen des neuen Schachtes abgeworfen werden könne (40169, Nr. 244, Blatt 117f). Allerdings trug Herr Netto dann am 13. Oktober 1869 ins Zechenbuch ein, daß dieser neue Schacht weder eine Kaue, noch einen verschließbaren Deckel besäße und solches umgehend einzurichten sei (40169, Nr. 244, Blatt 122f). Auch nach der nächsten Befahrung durch Inspektor Netto am 2. April 1870 fand dieser Grund zu Anordnungen: Er fand den neuen Schacht noch immer nicht auf den Stolln durchschlägig vor, stattdessen „kuttet man in 8 Lachter Teufe die Altung aus“ (klaubte also vermutlich aus altem Mann noch Braunstein heraus), wodurch aber dem Schacht „schon der Halt einigermaßen genommen war.“ (40169, Nr. 244, Blatt 129f) Natürlich untersagte Netto die weitere Kuttarbeit, forderte den Einbau von Wandruthen im Schacht und endlich die Auffahrung des Querschlags zum Stolln, weil „nach dem Zusammenbrechen des alten Schachts, welches in nicht langer Zeit erfolgen wird, der Fortbetrieb des Stollnorts unsicher gemacht und durch Wettermangel erschwert “ werde. Außerdem notierte der Inspektor noch: „Wie ich in Erfahrung gebracht habe, betreibt der als Schichtmeister bei dieser Grube angestellte, vormalige Obersteiger Hartmann dieselbe auf eigene Rechnung, indem er den gewonnenen Braunstein gegen eine Bezahlung von 15 Neugroschen pro Centner an die Besitzerin derselben abgibt, und ist daher nur darauf bedacht, Raubbau zu treiben, ohne auf die Sicherheit der Baue Rücksicht zu nehmen.“ Ein harsches Urteil. Aber auch später noch scheint die Besitzerin den Abbau lieber verpachtet zu haben, anstatt die Leitung tatsächlich selbst in die Hand zu nehmen. Deswegen wurde es auch nicht besser: Bei seiner nächsten Befahrung am 29. Oktober 1870 hielt Netto in seinem Fahrjournal fest, daß der Schacht trotz des Einbaus von vier Strängen Wandruten in einem „sehr bedenklichen Zustand“ sei, weil man das Auskutten fortgesetzt habe und verbot mit einem Zechenbucheintrag jegliche Weiterbenutzung des Schachtes (40169, Nr. 244, Blatt 131f). Am 18. März 1871 schließlich ordnete der Inspektor das Ausstürzen des neuen Schachtes und wegen Unsicherheit des alten Schachtes die Einstellung aller Baue an, die nicht unmittelbar mit dem Stolln in Verbindung standen (40169, Nr. 244, Blatt 133f). Dem widersprach aber die Besitzerin. Daraufhin wurde die nochmalige Reparatur des neuen Schachtes genehmigt, allerdings nur unter der Bedingung, daß Steiger Wendler von Wilkauer vereinigt Feld die Aufsicht führe. Am 9. November 1871 fand der Inspektor dann die Zimmerung im Schacht bis auf die untersten drei Ellen Höhe neu ausgezimmert vor. Dann sei „der Zimmerling fortgeschickt und diese Arbeit ein paar ganz unbefähigten Leuten überlassen“ worden, was den Inspektor Netto natürlich zu einem neuen Zechenbucheintrag veranlaßte, daß Betriebsleiter Hartmann den Zimmerling schleunigst wieder herbeiholen solle (40169, Nr. 244, Blatt 135ff). Bei seiner Befahrung am 30. März 1872 fand Netto dann endlich den Durchschlag des Emilienstollns auf den neuen Schacht in 9 Lachter Teufe bewirkt und den letzteren „leidlich“ wieder hergestellt vor (40169, Nr. 244, Blatt 139f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damit war aber auch
das Ende erreicht. In den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen in
Sachsen ist letztmalig 1871 ein Ausbringen von 430 Zentnern Braunstein bei
Meyers Hoffnung vermerkt.
Als Herr Netto am 12. Oktober 1873 wieder hier zugegen war, stellte er fest, daß nun auch Betriebsleiter Hartmann abgegangen war (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 140). Natürlich forderte das Landesbergamt in Freiberg nun die Besitzerin der Grube zur Benennung eines neuen Leiters auf. Erst am 7. März 1874 aber kam Frau Stengel dem nach mehrfacher Aufforderung und Fristsetzung nach, indem sie nun mitteilte, daß die Funktion der frühere Schichtmeister Hermann August Oehme wieder übernehmen solle (40169, Nr. 244, Blatt 148). Bei einer Befahrung am 22. April 1874 fand Inspektor Netto aber weder Steiger noch Betriebsleiter vor, stattdessen die Zimmerung im unteren Schacht „äußerst desolat“ und die Kaue offen vor (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 149). Natürlich konnte der Berginspektor nun nur noch die ordnungsgemäße Wiederherstellung oder das Verfüllen des Schachtes anordnen... Das Hin und Her ging aber weiter, ohne daß sich auf der Grube wirklich etwas tat. Frau Stengel zeigte dem Bergamt in Freiberg im Oktober 1875 an, die könne wegen Mangel an Arbeitern die Grube gegenwärtig nicht betreiben und erbat weiteren Aufschub für die Benennung eines Steigers (40169, Nr. 244, Rückseite Blatt 155). Inzwischen war Herr Netto am 23. November 1875 wieder hier und fand die Kaue „dem Einsturz nahe“ und den Schacht offen vor (40169, Nr. 244, Blatt 160). Schließlich sollte der frühere Steiger bei Friedrich Fundgrube, Friedrich August Korb, zurzeit auf Frisch Glück beschäftigt, die Steigerfunktion übernehmen, was das Landesbergamt auch billigte (40169, Nr. 244, Blatt 158). Herr Korb hat die Aufgabe auch übernommen und hat im Januar 1876 die Stellung angetreten. Bei seiner Anwesenheit im Januar 1876 bekräftigte Inspektor Netto auch ihm gegenüber die getroffenen Anordnungen. Außerdem fand der Inspektor nun auch den Stolln größtenteils verbrochen vor und ordnete dessen gründliches Aussetzen unterhalb der Straße an. Als er am 11. Februar wieder hier war, fand Netto Steiger Korb bei der Gewältigung des Stollns und präzisierte, daß ein 12 m breiter Streifen im Bereich der Straßenunterquerung in guten Stand gesetzt werden müsse. Es sei höchste Zeit dafür, denn 10 m oberhalb vom Mundloch ein Bruch bereits bis zu Tage gefallen war (40169, Nr. 244, Blatt 164ff). Bei seiner Befahrung im April 1877 fand Netto den Betrieb eingestellt, beide Schächte waren zugefüllt und der Stolln wegen Wettermangel nicht zugänglich (40169, Nr. 244, Blatt 167f). Am 3. März 1880 schließlich beantragte die Besitzerin wegen „fehlendem Absatz“ erstmals Fristhaltung für die Grube (40169, Nr. 244, Blatt 168). Weil sie „für die gewonnenen Producte keinen angemessenen Preis erhalten kann,“ wurde auch der nächste Antrag auf Fristhaltung für weitere zwei Jahre 1883 genehmigt. So ging es weiter ‒ die einzige Veränderung bestand darin, daß 1887 R. Fröbe aus Rittersgrün anstelle des ja schon bejahrten Oehme bei Meyers Hoffnung das Rechnungswesen wieder übernahm. Auch dessen erste dokumentierte Amtshandlung war das Einreichen eines erneuten Antrags auf Fristhaltung der Grube (40169, Nr. 244, Blatt 175).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diesmal aber ging
der Antrag nicht einfach durch, denn der Inspektor Neukirch von der
Berginspektion Zwickau hatte von seiner Befahrung am 24. März 1887
berichtet, daß nichts mehr zugänglich und auch der Stolln erneut
verbrochen sei (40169, Nr. 244,
Blatt 176ff).
Bis an die Straße hinauf habe sich über dem Stollnverlauf eine „tiefe
Furche“ gebildet und die Gefahr weiterer Brüche sei nicht
auszuschließen. Der Inspektor schlug dem Bergamt in Freiberg deshalb vor,
zur Sicherstellung der Straße von der Besitzerin eine Kaution in Höhe von
150,- Mark einzuforden. Das tat man nicht gleich, forderte aber Frau
Stengel zur Verfüllung der Pinge und zur Anzeige der von ihr zur
Sicherstellung der Straße vorgesehenen Maßnahmen auf.
Weil die Pinge offensichtlich war, fragte auch ein Dr. Gustav E. Stein seitens der Amtshauptmannschaft nach. Er habe außerdem den Steiger Korb befragt, welche Baue unter der Straße lägen, woraufhin dieser erklärte, er habe bei der Gewältigung noch ein Parallelort vorgefunden. Nun, die frühere Annahme, die Straße sei sicher, weil es dort keine Abbaue gäbe, war wohl nicht so ganz zutreffend.... Davon in Kenntnis gesetzt, forderte das Landesbergamt nun jedenfalls von Frau Stengel „eine gehörige Verwahrung“ des Stollns oder die Kaution, und vorher gebe es keine Verlängerung der Fristhaltung (40169, Nr. 244, Blatt 180ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Frau Stengel
nicht so richtig wußte (oder nicht wirklich wollte), was sie tun solle,
wurde vom Landesbergamt die Berginspektion in Zwickau beauftragt,
geeignete Maßnahmen festzulegen. Herr Neukirch verständigte sich
daraufhin mit Herrn Fröbe und es wurde entschieden, die Pinge vom
Tage nieder aufzugraben und dabei aufgefundene Hohlräume zu verfüllen
(40169, Nr. 244, Blatt 181ff).
So geschah es auch und am 1. Oktober 1887 zeigte Herr Fröbe an, daß
alles erledigt sei (40169, Nr. 244,
Blatt 190).
Daraufhin wurde auch der
vorausgegangene Antrag auf weitere Fristhaltung genehmigt.
Dabei blieb es nun. Herr Fröbe reichte regelmäßig Anträge auf Fristhaltung ein und nur die Begründung änderte sich, nun war „der Braunstein nicht verkäuflich.“ Dieser Schriftverkehr füllt fast den ganzen Rest der Akte, nur ab und zu mischt sich noch ein Fahrjournal darunter, in dem es aber jedesmal heißt, es sei alles verfüllt und „nichts zu erinnern.“ Sie schließt um 1900 mit dem Verkauf des Tännicht Gutes an den Zittau'er Bürgermeister Hermann Johannes Oertel. Als Besitzerin von Meyers Hoffnung Fundgrube wird auch im Band 2 dieser Akte (40169, Nr. 245) weiter die Frau Emilie Thekla genannt, nur steht nun als Familienname Oertel, geb. Stengel. Wie oben schon einmal zu lesen stand, haben wir letztlich in den Grubenakten von Wilkauer vereinigt Feld gefunden (40169, Nr. 143, Blatt 228), daß Carl Louis Stengel und seine Gattin Emilie Thekla Stengel, geb. Meyer eine Tochter hatten, der sie tatsächlich den Vornamen ihrer Mutter noch einmal gegeben haben. Diese Tochter Emilie Thekla geb. Stengel ehelichte später den damaligen Zittau'er Bürgermeister Hermann Johannes Oertel, während ihre Mutter am 4. April 1900 verstorben ist. Herr Oertel wiederum ist um 1917 verstorben. Seine Gattin Emilie Thekla Oertel, geb. Stengel folgte ihm 1932 nach (40024-12, Nr. 375). Tatsächlich gab es also zwei Damen desselben Vornamens unter den Besitzern des Tännichtgutes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch nach der Jahrhundertwende kam es
aber nicht mehr zu einer Wiederaufnahme des
Eisenstein- und Braunsteinabbaus. Die Besitzerin, Emilie
Thekla Oertel, versuchte zwar bis an ihr
Lebensende, die Grube Meyers Hoffnung in Fristen und sich damit ihr
Abbaurecht zu erhalten.
Aber nur der
In den folgenden zwei Jahren wurde von Herrn Dietrich am Gut eine Terrazzomühle errichtet und von dort aus ein neuer Förderstolln in Richtung des Kalkbruchs getrieben. Dieser Förderstolln lag westlich der Mühle noch 6 m untertage, weshalb hier ein kleiner Förderschacht angelegt wurde, dessen Haspel ebenfalls durch das Wasserrad angetrieben wurde. Bis Frühjahr 1908 hatte man den Stolln 186 m vorgetrieben und dort das Kalklager angefahren. Allerdings fand man den Kalkstein dort von grauer Farbe, was ihn zur Terrazzoherstellung ungeeignet machte. Im Tagebau soll er fast weiß gewesen sein. Bereits Ende 1908 beabsichtigte Herr Dietrich deshalb, das Marmorwerk wieder zu verkaufen (40024-12, Nr. 296, Rückseite Blatt 29). Bei einer Befahrung durch Berginspektor Spitzner von der Berginspektion III, welche für die gewerblichen Gruben zuständig war, fand dieser am 30. April 1910 den Abbau stillgelegt und die Marmormühle verpachtet. Die Wasserkraft wurde jetzt genutzt, um Blechteile für Grammophon- Schalltrichter zu polieren. Bereits bei einer Kontrolle des Förderstollns im Dezember 1914 wurden bei 80 m Stollnlänge Ausbauschäden und kleinere Verbrüche festgestellt. Der noch folgende Akteninhalt umfaßt dann hauptsächlich Verhandlungen über die Ausführung und Kostenübernahme für eine Sicherung des Stollns im Bereich der Unterquerung der Straße. Auf Festlegung der Bergbehörde hin übernahmen schließlich 1915/1916 Arbeiter des Herrn Heinrich Rudolf Sarfert gehörigen Marmorwerkes am Fürstenberg bei Waschleithe die Instandsetzung des Stollns an diesem Punkt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch im Frühjahr 1914 hatte Frau Oertel erneut um Verlängerung der Fristhaltung für Meyers Hoffnung nachgesucht, diesmal mit der Begründung, „die Vermarktung der zu erlangenden Erze sei so ungünstig, daß ein Betrieb nur mit Zubußen möglich“ sei (40169, Nr. 245, Blatt 40). Ende 1917 hat Frau Oertel die Dietrich'sche Mahlanlage von diesem gekauft und es 1918 an Sarfert verpachtet (40024-12, Nr. 374). Am 24. Oktober 1917 teilte Frau Oertel dann dem Bergamt mit, daß sie beabsichtige, den Betrieb zur Gewinnung des doch so wichtigen Manganerzes auch bei Meyers Hoffnung wieder aufzunehmen und dazu ein Flügelort vom Förderstolln aus treiben zu lassen (40169, Nr. 245, Blatt 44). Inzwischen waren auch die zehn Jahre, auf die der Kalksteinabbau an Herrn Dietrich verpachtet gewesen ist, abgelaufen. Nun pachtete 1918 ‒ kurz vor Ende des 1. Weltkrieges ‒ Herr Sarfert auch den Kalksteinabbau von Frau Oertel. Von ihm übernahm kurz darauf die Eisenerz AG zu Schwarzenberg, vertreten durch Bergdirektor H. Keiner in Breitenbrunn und zuvor zeitweise in den Besitz des Marmorwerks am Fürstenberg bei Waschleithe gekommen, den Pachtvertrag über die Abbaurechte (40024-12, Nr. 374). Der Pachtvertrag sah bis zum Jahr 1925 eine jährliche Pachtzahlung von 12.000,- Mark vor und wurde seitens der Eisenerz AG durch die Herren Windler und Hackenberger unterzeichnet. Das nun war höchst günstig für Frau Oertel, denn diese Gesellschaft übernahm die Aufwältigung und Instandsetzung des Förderstollens. Weil natürlich während des Weltkrieges viele Arbeiter zum Heeresdienst eingezogen waren, gab es aber kaum Bergarbeiter. Deshalb sollte der Obersteiger von Frisch Glück, Max Wilhelm Seifert, auch den Betrieb bei Meyers Hoffnung quasi gleich mit leiten (40169, Nr. 245, Blatt 61). Bei einer Befahrung durch die Berginspektion am 25. März 1918 fand man denn auch tatsächlich den Betrieb damit wieder begonnen, daß der Förderstolln gewältigt wurde, was bis dahin auf 54 m Länge vollbracht war. Im Fahrjournal heißt es noch, man sei „mit der Leistung der italienischen Kriegsgefangenen zufrieden.“ Fünf Kriegsgefangene waren zu dieser Zeit hier angelegt (40169, Nr. 245, Blatt 63). Trotz
nachdrücklicher Befürwortung seitens der sächsischen Bergbehörde lehnte allerdings
die Manganerzgesellschaft mbH in Berlin ‒ wie schon ein Jahr
Tatsächlich wurde erst einmal nur Kalkstein im Tagebau abgebaut sowie aus dem Tagebau heraus ein Tagesfallort angehauen, das bis auf den Förderstolln durchgeschlagen werden sollte. Im Sommer 1918 wurde der Freiberg'er Bergschüler Friedrich Kurt Artur Locke als Steiger angestellt. Bei der Befahrung durch die Berginspektion am 16. November 1918 war der Förderstolln dann bereits auf 136 m Länge gewältigt und das Fallort ebenfalls in Betrieb, wo der Kalkstein aber sehr zerklüftet gefunden wurde, so daß auch hier Firstverzug erforderlich war (40169, Nr. 245, Blatt 87). Nach dem Kriegsende waren bei Meyers Hoffnung und auf dem Kalkbruch zusammen 14 Mann und 3 Frauen beschäftigt, davon freilich 7 nur übertage. Bis zum 31. Juli 1919 hatte man den Förderstolln auf 177 m Länge gewältigt und das Fallort auf 65 m ausgelängt. Über den Stolln heißt es im Fahrbericht vom 12. Mai 1919, er „steht ganz in aufgeweichtem Gebirge, so daß es schwerfällt, die Zimmerung zu erhalten.“ Auch der Durchschlag auf das Fallort wurde bis zur Betriebseinstellung nicht hergestellt (40169, Nr. 245, Blatt 91ff). Zum Zeitpunkt einer Befahrung am 15. Juni 1920 hatte die Belegschaft bereits wieder auf 7 Männer und 2 Frauen abgenommen, welche durch die Eisenerz AG im Kalkbruch und bei der Verarbeitung des Kalksteins beschäftigt wurden (40169, Nr. 245, Blatt 96ff). Formal bestand parallel auch Meyers Hoffnung Fundgrube noch weiter, allerdings fand kein Betrieb, geschweige denn eine Erzgewinnung statt. Am 16. Dezember 1921 waren nur noch 2 Mann angelegt, die auf Streckenörtern vom Fallort aus Kalkstein abbauten (40169, Nr. 245, Blatt 105). 1922 wurde die Eisenerz AG dann noch durch die Schulz & Sackur AG in Berlin übernommen, die aber wenig Interesse am Bergbau im Erzgebirge hatte, zumal der hier gebrochene, stark dolomitische Kalk wenn überhaupt, dann nur zu kaum gewinnträchtigen Preisen als Düngekalk zu vermarkten war. Ansonsten aber füllen sich die dazu noch vorliegenden Akten in erster Linie mit dem Streit um die Kostenübernahme für die Verwahrung des Förderstollns unter der Straße nach der Betriebsaufgabe 1923... (40024-12, Nr. 374 und 375). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zugleich erging am 28. April 1922 aber an Frau Oertel seitens des nach dem Kriegsende wieder eingerichteten Oberbergamtes in Freiberg die Aufforderung, bei Meyers Hoffnung eine der Grubenfeldgröße entsprechende, gesetzliche Belegschaft anzunehmen, woraufhin Frau Oertel am 26. Mai des Jahres wieder Fristhaltung beantragte (40169, Nr. 245, Blatt 109ff). Dies wiederholte sich nun wieder einige Male, wobei Gutsverwalter Richard Conrad Böhme die Antragstellung im Namen der Besitzerin übernahm. Conrad Böhme legte zwischen 1928 und 1930 sogar selbst noch einmal eine neue Mutung auf Meyers Hoffnung Fdgr. ein, die jedoch abgewiesen wurde, weil das Feld zu diesem Zeitpunkt ja noch eine Besitzerin hatte (40027, Nr. 0715). Weil diese aber den Grubenbetrieb auch nicht wieder aufnahm und die Grube bis 1929 weiter in Fristen hielt, wurde ihr am 25. November 1929 das Bergbaurecht endgültig entzogen (40169, Nr. 245, Blatt 139ff). Bevor die Entziehung rechtskräftig wurde, fragte das Oberbergamt in Freiberg bei der Berginspektion nach, ob noch Verwahrungsmaßnahmen zu veranlassen seien. Aus Zwickau kam dazu nach einer Begehung im Januar 1930 Antwort, der Schacht am Förderstolln befände sich auf Privatgelände und sei abgesperrt. Der Stolln selbst war wahrscheinlich wieder komplett verbrochen und nicht mehr zugänglich. Im Baufeld befanden sich noch kleine Pingen über alten Kalkabbauen; man sehe aber keine Auflagen an die Besitzerin für erforderlich an (40169, Nr. 245, Blatt 151ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damit endete die Geschichte bei Meyers Hoffnung Fundgrube aber noch nicht ganz. Über das Grubenfeld holte sich am 17. August 1936 das Wirtschaftsministerium in Dresden bei der Lagerstättenforschungsstelle Auskunft ein (40030, Nr. 726, Blatt 1). Die letztere schrieb daraufhin am 20. Januar 1937 auf einer A4- Seite kurz zusammengefaßt das, was wir inzwischen auch über dessen Geschichte bis zum mit Wirkung vom 27. Juni 1930 erloschenen Bergbaurecht wissen. An dem Durchschlag dieses Schreibens (40030, Nr. 726, Blatt 3) findet man die handschriftliche Ergänzung: „Es empfiehlt sich, zur Abrundung dieses Grubenfeldes das kleinere Erzvorkommen hinzuzumuten.“ Ohnehin läge es inmitten des bereits staatlichen Grubenfeldes ,Greifenstein'. Das tat die Landesregierung daraufhin auch. Am 27. Februar 1937 forderte der Reichsstatthalter in Sachsen, vertreten durch das sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, das Oberbergamt auf, die Mutung des Grubenfelds von Meyers Hoffnung vorzunehmen. Die erfolgte dann auch am 9. März des Jahres durch die Bergwirtschaftsstelle zugunsten des Sächsischen Staates (40028, Nr. 762, Blatt 2ff und 40030, Nr. 726, Blatt 7). In der Begründung heißt es, „durch dieses Grubenfeld wird die streichende Fortsetzung des Langenberg'er Mangan- Mulm- Lagers gedeckt.“ Am 26. Mai 1937 wurde die Verleihungsurkunde darüber ausgestellt (Abschriften in 40028, Nr. 762, Blatt 14f und 40030, Nr. 726, Blatt 8f). Während aber in
dem umgebenden Grubenfeld ,Greifenstein' im folgenden Jahr 1938
durch die Lagerstättenforschungsstelle immerhin noch einige
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rother Stolln
und Rote Fundgrube
bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit unserer historischen
Wanderung sind wir nun wieder oben im Tal angelangt: Wie
„Mittwochs, den 7ten April habe ich mehrere Schurfarbeiten auf Eisenstein im Tännicht bey Schwarzbach, ingleichen diejenige Stelle weiter im Dorfe hinauf besichtiget, wo ein Stolln zu Lösung des gegen Mittag ansteigenden Gebirges und zwar zunächst und insonderheit zu Lösung einer 80 Ltr. das Gebirge hinan (...?) vorliegenden, ehemaligen Eisensteinzeche getrieben und unter dem Nahmen Rothe Zeche Erbstolln bestätigt werden soll.“ Der Bergamtsakte über
Mutungen und Bestätigungen haben wir hierzu außerdem entnehmen können, daß Herr
Gebler in Annaberg berichtet hat, daß besagter Stolln „in das hart an
der mitternachtmorgendlichen Seite des Dorfes Schwarzbach ansteigende Gebirge
auf des dasigen Erbrichters Beier Grund und Boden zu Lösung des in einiger
Entfernung vorliegenden alten Eisensteingebäudes Hoffnung, übrigens auch zu
Untersuchung des vorliegenden Gebirges überhaupt, ohngefähr in die Std. 4,4
gegen Mitternacht Morgen in das Feld getrieben werden soll.“ (40014,
Nr. 270, Blatt 15f und 40014, Nr. 43, Blatt 300) Der
Die Grube wurde dem Muter jedenfalls auch am 17. April 1824 in Scheibenberg bestätigt (40014, Nr. 270, Rückseite Blatt 16 und 40014, Nr. 43, Blatt 300) und von seiner ersten Befahrung derselben berichtete Herr Gebler in seinem Fahrbogen vom Mai 1824 (40014, Nr. 271, Film 0033): „Mittwochs den 26ten May bin ich auf dem Grubengebäude Rothe Zeche Erbstolln bey Schwarzbach gefahren, belegt mit
Außer einer 5 Ltr. langen Wassersaige ist der Stolln vom Mundloch aus 5 Ltr. lang in der St. 4,0 in das dort gegen Mitternacht Morgen ansteigende Gebirge nach den vorliegenden Eisensteinlager von schwarzem und rothen Eisenstein mittelst Ausbau (...?) aus doppelten Thürstöcken getrieben worden. Es scheint, diese Unternehmung könne einen vorzüglich glücklichen Erfolg haben, und eines schwunghaften und regelmäßigen Betriebes besonders werth zu sein.“ Weitere Befahrungen durch den Geschworenen sind in seinen Fahrbögen aus dem Jahr 1824 nicht enthalten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung
erfolgte dann am 20. Januar des Jahres 1825, worüber Herr Gebler in
seinem Fahrbogen notierte (40014,
Nr. 273, Film 0009):
„Desselben Tages habe ich mich in den obern Theil des Dorfes Schwarzbach und daselbst auf den Stolln Rothe Zeche begeben, belegt mit
Stollnbetrieb. „Man hat mit Forttrieb des zur Herbst und Winterzeit aus Mangel an dem nöthigen Stammholze unbelegt gebliebenen Stollns numehro nach Anfuhr desselben nur eben erst wieder den Anfang gemacht und wird man eifrig bemüht seyn, das anjetzt nur erst einige wenige Lachter in das gegen Morgen von Schwarzbach ansteigende Gebirge hinein getriebene Stollnort weiter fortzubringen, um mit demselben ein vorliegendes Lager von rothem Eisenstein, wovon sich bereits mehrere einzelne Stücke gefunden haben, anzufahren.“ Eine zweite Befahrung durch den Geschworenen fand im Jahr 1825 nicht statt ‒ offenbar fehlte es auch weiterhin an Grubenholz und so ging es nicht wirklich voran. Stattdessen haben wir in anderen Akten dann eine Lossagung durch Karl Gottlob Riedel vom 13. Juli 1829 über eben diesen Rothe Zeche Stolln gefunden (40014, Nr. 270, Blatt 81). Unter dem Namen „Rother Stolln am Rothen Bach bei Schwarzbach“ wurde der Stolln durch Georg Friedrich Distler am 6. Januar 1831 erneut gemutet, allerdings steht gleich neben der Eintragung in der Bergamtsakte die Notiz: „Daß sich Georg Friedrich Distler von obiger Mutung endlich bey mir losgesagt hat, wird andurch attestiert.“ (40014, Nr. 270, Blatt 101) Als nächste bekamen Karl Friedrich Kraft und August Löffler „den seit Anfange vergangene 1831ten Jahres in das Bergfreie gefallnen Rothe Zeche Stolln inklusive der gevierten Fundgrube“ bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 318).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 26. Oktober 1836 gab es noch eine weitere
Mutung ‒ und jetzt wirklich als Eisenerzgrube ‒ von Franz Anton Richter
aus Raschau unter dem früheren Grubennamen Rother Stolln (40014,
Nr. 298, Blatt 25). Dem Protokoll des
Bergamts Scheibenberg vom 4. Juli 1839 zufolge hatte Franz Anton Richter
zu diesem Zweck den Bergarbeiter Friedrich August Weber nach Scheibenberg
gesandt. Bergschreiber Friedrich Wilhelm Lange notierte, daß der besagte
Stolln „auf dem Schwarzbacher Erbgerichts Grund und Boden“ läge und „unter
seinem früheren Namen Rother Stolln“ als Erbstolln bestätigt werde (40169,
Nr. 272, Blatt 1). In der
Verleihungsakte heißt es außerdem, der Stolln setze „250 Schritt von den
Schwarzbächer Erbgerichtsgebäuden in Mittag Morgen“ an (40014,
Nr. 298, Blatt 25 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 340).
Wenn der Stolln einen früheren Namen hatte, gab es unzweifelhaft auch Vorgänger.
Aufgrund der ähnlichen Lageangabe vermuteten wir zunächst, daß dessen Vorgänger noch immer derselbe Johannis Reicher Seegen Gottes Stolln gewesen ist. Insbesondere die Angabe, daß auch dieser Stolln auch auf des Schwarzbach'er Erbgerichtes Grund läge, schien uns ein Indiz zu sein, daß es sich bei diesem noch um denselben Stolln handelte, wie den, der auf persönliches Engagement des damaligen Bergmeisters Michael Herrmann Enderlein in Scheibenberg schon einmal anno 1763 unter dem vorgenannten Namen gewältigt worden ist. Dem erste Fahrbogenvortrag im Bergamt Annaberg (mit welchem Scheibenberg ja inzwischen kombiniert war) vom 22. Februar 1840 zufolge hatte der Eigenlehner die Grube mit 5 Mann belegt. Das Stollnort werde in der Richtung Stunde 4 bis 4,4 in Nordost getrieben und sei bis jetzt 48 Lachter vom Mundloch erlängt. Ein paar und 40 Lachter war auch der Johannis reicher Seegen Gottes Stolln seinerzeit lang geworden. Die Richtungsangaben schwankten 1763/1764 dagegen zwischen hora 12,4 (stehend) und hora 11,4 (flach streichend), wiesen jedenfalls nahezu in nördliche Richtung. Der Raschau'er Schichtmeister (und im Zeitraum Luciae 1840 bis Anfang Reminiscere 1841 Vertreter des Scheibenberg'er Berggeschworenen Theodor Haupt), Friedrich Wilhelm Schubert, hinterließ uns in seinem Fahrbogen vom 10. November 1840 die folgende Skizze über Lage und Verlauf des Rothen Stollns bei Schwarzbach (40014, Nr. 300, Film 0125f). Natürlich finden wir darin die schon genannte, nordöstliche Hauptrichtung des Stollnverlaufs wieder. Es muß sich folglich doch um einen zweiten Stolln gehandelt haben, der weiter unten im Tal des Roten Bachs angesetzt war und daher mit anderer Richtung unter den Richterberg führte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was bis 1767 dagegen noch niemand aufgeschrieben hat, wird jetzt in dem Fahrbogen vom Februar 1840 näher beschrieben: Der Stolln nämlich stehe „auf den ersten 34 Lachtern in rothem, mit Hornstein- Trümern durchzogenem Mulm, auf der folgenden Länge in ziemlich festem Glimmerschiefer, welcher in Mitternacht Morgen (Nordosten) unter einem starken Neigungswinkel aufsteigt. Der Hauptzweck bei diesem Grubenbetriebe geht dahin, ein in Nordost vorliegendes altes Gebäude zu lösen, welches ehedem in ziemlicher Eisensteinförderung gestanden haben soll.“ (40169, Nr. 272, Blatt 1, Rückseite und Blatt 2) Dieser alte Fundschacht ist auch in der Skizze von Schichtmeister Schubert (rechts oben) zu finden. Herr Schubert berichtete in seinem Fahrbogen unter dem 10. November 1840 außerdem, an diesem Tage „habe ich den Rothen Stolln bei Schwarzbach befahren, wobei zu bemerken, daß der Stolln vom Mundloche hinein in Eisensteinmulm, worunter bisweilen einzelne Eisenstein Wändchen (?) vorgekommen, 33 Lachter aufgefahren, dann aber 17,5 Ltr. in Glimmerschiefer fortgebracht und zwar weil anstatt hora 3,4 hora 5,3 aufgefahren worden; deswegen muß nunmehr wiederum nördlich noch gegen 35 Ltr. hora 3,1 bis unter den vorliegenden alten Tageschacht das Stollnort erlängt werden. Daß der Eigenlöhnerschaft mittelst genanntem Auffahren in Quergestein, obgleich nicht fest, doch kostspieliger als in Mulm, auch der Plan zur Wiedererlangung des Eisensteinmulmlagers, worinnen der Eisenstein zu treffen gehofft wird, in einer zu großen Entfernung vorliegt, dahero suchte ich denselben anzurathen, bei etwa 28 bis 30 Ltr. östlicher Entfernung vom Stollnmundloch hora 10,4 gegen West querschlagsweise den bekannten Eisensteinmulm zu durchfahren, um das früher von Vorfahren bebaute Eisensteinlager baldigst und hoffentlich bauwürdig auszurichten. Allein wie ich vernommen, begreift die Eigenlöhnerschaft nicht, daß es hiermit möglich, viel früher und mit ungleich geringerem Aufwand zum Ziele zu gelangen. Zum Beweiß und Rechtfertigung meines Vorschlages habe ich eine kleine Zeichnung hiervon beigefügt.“ (40014, Nr. 300, Film 0124f) Das ist die Zeichnung oben. Weiter heißt es hier noch: „Die Stollnzimmerung ist größten Theils wandelbar und beinahe so enge, daß kein gewöhnlicher Karrn mehr durch gehet. Betrieben wird dieser Stolln nur, wenn die Eigenlöhner nichts anderes zu verrichten haben und werden demnach späth zu ihrem Zwecke gelangen, weil die Unterhaltung umso mehr fordert.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Fahrbericht des Annaberg'er Reviergeschworenen Schiefer und des Herrn (hier ist er als ,Obersteiger' benannt) Schubert vom 21. November 1840 wird nur kurz darauf die geologische Situation noch einmal beschrieben und hier heißt es jetzt, der Stolln stehe auf 33 Lachter vom Mundloch in eisenschüssigem Mulm, dann 17,5 Lachter in Glimmerschiefer und das Stollnort sei von dem angezielten alten Fundschacht noch 35 Lachter entfernt. Weil die Beamten vermuteten, daß der Fundschacht gar nicht bis in die Tiefe, welche der Stolln dort einbringe, sondern nur bis in das Eisensteinlager geteuft sei, empfahlen sie (wie schon zuvor Herr Schubert auch) der Eigenlöhnerschaft, besser von der Gesteinsgrenze ausgehend in deren Streichen einen neuen Stollnflügel zu treiben. (40169, Nr. 272, Blatt 3) Daß die Eigenlöhner den Stolln nur in Weilarbeit und „wenn (sie) nichts anderes zu verrichten haben,“ betrieben, geht auch aus der nächsten Nennung der Grube in den Fahrbögen des Herrn Schubert hervor: Er fand sie am 16. Januar 1841 nämlich unbelegt (40014, Nr. 300, Film 0145). Nachdem er am 19. Januar 1841 wieder vorbeigeschaut hatte, notierte er in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 300, Film 0146), der Stolln sei vom Mundloche hinein zusammengedrückt worden und: „Obgleich die Zimmerung bei bemerkten Gruben nicht in gutem Stand gewesen, so ist die große Nässe (und das?) Tauwetter als Ursache dieser Brüche anzusehen und wurden die Eigenlöhner angewiesen, dauerhafte Zimmerung herzustellen.“ Besser ist das... Am 5. April 1841 war Berggeschworener Theodor Haupt wieder selbst vor Ort und hielt über seine Befahrung an diesem Tage fest (40014, Nr. 300, Film 0164f): „Man hat seit kurzem für denselben einen neuen Tageschacht abzusinken angefangen, um die Förderung abzukürzen, frische Wetter vor das Stollnort zu bringen und hauptsächlich, um das Mulmgebirge zu untersuchen. Hauptsächlich dürfte der Schachtbetrieb aber deshalb zu befürworten sein, weil der Stolln auf seine ganze Länge in höchst desolatem Zustande ist und täglich zusammenzubrechen droht.“ Na ja, was will man bei dieser Art des Grubenbetriebes auch anderes erwarten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab 8. Juli 1841 wurde als
„Mitgeselle“
Friedrich August Jahn aus Mittweida angenommen.
Herr Jahn ist uns schon als Eigenlöhner der Grube Beschert Glück
bei Schwarzbach und Miteigenlehner von 1. und 2. unteren abendlichen Maß
bei Kästners Hoffnung, ebenfalls bei Schwarzbach gelegen, bekannt.
Eine weitere Befahrung durch den Berggeschworenen Haupt erfolgte am 13. August 1841 (40014, Nr. 300, Film 0219f). Im Fahrbogenvortrag vom 28. August 1841 in Annaberg wurde darüber berichtet, man teufe jetzt 70 Lachter vom Mundloch entfernt einen neuen Schacht und habe bereits 5 Lachter abgesunken. Dieser stehe auf den oberen 2,5 Lachtern „in ganz aufgelöstem Glimmerschiefer, wie er gewöhnlich im Tännichter Mulmgebirge mit vorkommt. Darunter befindet sich ein 1 Fuß mächtiges (rund 30 cm) Lager von Braunstein, welches 15° bis 20° in NO. einschießt. Da dieser Braunstein aber sehr geringhaltig ist, so ist er bis jetzt noch nicht gesucht worden. Unter diesem Lager ist man auf gewöhnlichen Glimmerschiefer gekommen.“ (40169, Nr. 272, Blatt 4b) Weil Herr Haupt dann aber erneut von höherer Stelle mit anderen Aufgaben betraut worden ist, übernahm diesmal der Rezeßschreiber Lippmann aus Annaberg daraufhin dessen Aufgaben als Geschworener (40014, Nr. 300, Film 0230). Dieser hat hier am 15. September dieses Jahres erneut eine Befahrung durchgeführt und berichtete in seinem Fahrbogen, die Grube sei mit 4Mann belegt, welche gerade einen in 8 Lachter Entfernung vom Mundloch auf dem Stolln entstandenen Bruch von 2 Ellen Länge aufgewältigten (40014, Nr. 300, Film 0245). Weiter liest man: „Nach Hinwegräumung dieses Hindernisses und der sich nöthig machenden Auswechslung der Zimmerung an verschiedenen Punkten des circa 70 Lachter in Morgen erlängten Stollns soll der 5¼ Lachter tiefe und durchaus in Zimmerung stehende, saigere Tageschacht bis zum Durchschlag mit dem Stolln fernerweit abgeteuft werden.“ Ein zweites Mal ist Her Lippmann am 10. Dezember 1841 auf der Grube gefahren, fand dabei den Schacht nun 6½ Lachter tief abgesunken und dessen Zimmerung bis 5¾ Lachter Teufe nachgezogen. Es fehlten aber noch 3½ Lachter Teufe bis zum Durchschlag auf den Stolln. Auf dem Stolln hatte man auf 10 Lachter Länge die Zimmerung ausgewechselt, aber bei 36 Lachter vom Mundloch hat es schon wieder einen ½ Lachter langen Bruch gegeben (40014, Nr. 300, Film 0273).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr Lippmann
war schon am 13. Januar 1842 erneut zugegen
(40014, Nr. 321, Film 0003)
und fand nun den Schacht
„fortwährend in ziemlich aufgelöstem eisenschüssigem Glimmerschiefer“
bis auf 7 Lachter abgeteuft und den Ausbau nachgezogen.
Bei seiner nächsten Befahrung am 12. April 1842 (40014, Nr. 321, Film 0027f) aber war „keiner der Eigenlöhner anwesend und die Grube daher nicht zu befahren.“ Auch am 27. April des Jahres fand er die Grube unbelegt vor (40014, Nr. 321, Film 0033). Am 21. Juni und 22. Juni 1842 inspizierte Herr Lippmann wieder die Eigenlöhnergruben bei Langenberg, im Tännicht und bei Schwarzbach und notierte diesmal in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 321, Film 0051): „Auf Rother Stolln fahren abwechselnd 3 Mann an, durch welche das Schachtabteufen bis ziemlich 9 Lachter Teufe fortwährend in eisenschüssigem, gebrächem Glimmerschiefer niedergebracht worden ist; auch hat man das in hora 2,2 NO. stehende Stollnort fernerweit um 3 Lachter erlängt, so daß dasselbe nunmehr bis zu (Zahl fehlt) Lachter ins Feld gerückt ist; es steht gleichfalls in gedachtem Glimmerschiefer.“ Das nächste Mal war der Vertreter des Geschworenen am 8. September 1842 vor Ort (40014, Nr. 321, Film 0076f) und stellte fest, die Grube werde nur „dann und wann mit 2 – 3 Mann betrieben.“ Da im Schachtabteufen Wettermangel herrschte, wurde durch diese das Stollnort hora 1,4 in N. weiter getrieben und der Durchschlag auf den Schacht „steht täglich zu erwarten.“ Nach seiner Rückkehr nach Scheibenberg hat Geschworener Theodor Haupt die Befahrung am 21. Dezember 1842 wieder selbst vorgenommen und in seinem Fahrbogen darüber festgehalten (40014, Nr. 321, Film 0120): „Auf Rother Stolln geht der Betrieb etwas schwunghafter, seitdem man mit dem Tagschachte in den Stolln durchgeschlagen hat... Der Schacht ist 10 Lachter tief. Das mit dem Schacht durchsunkene Lager von braunsteinigem Eisenstein läßt man vorerst unberücksichtigt, um den Hauptplan, mit dem Stollnorte in NO. nach einer vorliegenden Binge vorzudringen, keinen Abbruch zu thun. Hierzu hat man über den Schacht hinaus hora 3,6 NO. inzwischen 2¼ Lachter ausgelängt.“ Die Reviergeschworenen Schiefer und Haupt trugen ihren Bericht am 31. Dezember 1842 auch in Annaberg vor. Der Durchschlag mit dem Schacht auf den Stolln sei „sehr gut gelungen.“ Von dort aus wolle man nun in Stunde 3,6 gegen NO weiter auf den alten Bau zu auffahren (40169, Nr. 272, Rückseite Blatt 5).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach seiner Befahrung am 2. März 1843 (40014, Nr. 321, Film 0149) berichtete Herr Haupt in seinem Fahrbogen an das Bergamt Scheibenberg, das Stollnort hora 3 NO. sei mit 2 bis 3 Mann belegt und jetzt 6,3 Lachter über den Tageschacht hinaus erlängt. Bei 5,1 Lachter hatte man dabei ein 0,1 Lachter mächtiges Lager aus Hornstein und Roteisenstein in quarzigem Schiefer angefahren, das mit 15° Einfallen nach Nordost dem Fallen des Anstehenden folge und das mit einem Ort hora 9 SO untersucht werden solle. Am 1. April 1843 wird über diese Befahrung gleichlautend auch wieder in Annaberg berichtet (40169, Nr. 272, Rückseite Blatt 6). Danach wurde Herr Haupt erneut abgeordnet und Herr Lippmann mußte ihn wieder vertreten. Letzterer fand bei seiner Befahrung am 4. Mai 1843 das Stollnort 11 Lachter über den Tageschacht hinaus erlängt und bemerkte in seinem Fahrbogen noch (40014, Nr. 321, Film 0175f), der Stolln „steht abwechselnd in aufgelöstem Glimmerschiefer, rothem Mulm und rothem Hornstein und erschrotet man damit viel Wasser, die, der Meinung der Eigenlöhner zufolge, von einer vorliegenden alten Zeche kommen sollen. Einen vor kurzem auf der Stollntour und bis an den Tag sich erstreckenden Bruch hat man vollständig wieder gewältigt und verstürzt.“ Am 13. Juni 1843 fand Herr Lippmann die Grube wieder einmal unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0182). Am 14. September hingegen war sie wieder in Betrieb und das Stollnort jetzt 14 Lachter vom Tageschacht aus fortgestellt. „Bis zu den vorliegenden, in früherer Zeit auf Eisenstein verführten, jetzt ziemlich unzugänglichen Grubenbauen hat man noch ohngefähr 10 Lachter aufzufahren.“ Von Dezember 1843 bis April 1844 war Herr Haupt dann wieder in seinem Amt in Scheibenberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Folgejahr führte
Herr Haupt am 1. März 1844 hier wieder selbst eine Befahrung durch.
In seinem Fahrbogen heißt es darüber
(40014, Nr. 322, Film 0020), vor dem hora 3 NO
gehenden Stollnort „hat es einen Bruch gemacht und ist trotz aller
Anstrengung nicht wieder aufzugewältigen gewesen, indem das Gebirge in
einem ganz zu Thon aufgelöstem Glimmerschiefer besteht, das neuerdings
viele Wasser zuführte und den Betrieb sehr erschwerte.
Höchstwahrscheinlich kommen die Wasser aus den circa 18½ Lachter vom
Tageschacht in NO. vorliegenden alten Bauen und es geht nun die Absicht
der Gesellen dahin, den alten Tageschacht zu gewältigen.“ Dieser
Tageschacht soll 8 bis 9 Lachter tief sein und das Stollnort käme dort
noch 3 Lachter tiefer ein.
Am 30. März 1844 wurde dasselbe auch im Bergamt vorgetragen. Die Bergbeamten hielten es für kostengünstiger, gleich einen neuen Schacht zu teufen (40169, Nr. 272, Rückseite Blatt 7). Eine zweite Befahrung durch Herrn Haupt fand am 23. April 1844 statt, worüber man in seinem Fahrbogen lesen kann (40014, Nr. 322, Film 0030f), daß auf dem Roten Stolln 2 bis 4 Mann anfuhren, welche nun ‒ wie vom Bergamt empfohlen ‒ mit der Absinkung und Auszimmerung eines neuen Tageschachtes beschäftigt waren. Dieser wird 20,4 Lachter nordwestlich von dem bereits vorhandenen Tageschacht oder 3,2 Lachter südwestlich von dem angeblichen alten Schacht saiger niedergebracht und war bereits 2,5 Lachter tief. Man durchsank bis jetzt nur aufgelösten Glimmerschiefer mit „einigen sehr eisenschüssigen Schichten.“ Der Stolln war wegen des aufgestauten Wassers nicht zu befahren, soll aber vor dem Bruch 15 Lachter vom Tageschacht erlängt gewesen sein, so daß noch 5,4 Lachter bis unter den neuen Tageschacht fehlten. Allerdings muß auch die Stollnzimmerung erneuert werden. Ende April wurde Herr Haupt, wie schon mehrfach erwähnt, dann erneut mit anderen Aufgaben betraut und während seiner Abwesenheit vertrat ihn in seiner Funktion als Geschworener in Scheibenberg der Markscheider Friedrich Eduard Neubert. Derselbe trug in seinem Fahrbogen ein (40014, Nr. 322, Film 0045): „Am 10. Juni 1844 revidirte ich den Betrieb auf Friedlicher Vertrag, Wilkauer vereinigt Feld und Roten Stolln (...) Von diesem habe ich zu referiren, daß man den neuen Tageschacht nun bis 3,5 Lachter Teufe abgesunken hat und daß die zudringenden Wasser den Betrieb sehr hindern.“ Danach war Herr Neubert noch dreimal (am 2. August, am 5. September und am 5. Dezember 1844) zugegen, fand die Grube aber jedesmal unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0057, 0062f und 0080). Und seinem Fahrbogen auf Reminiscere 1845 fügte er wieder an (40014, Nr. 322, Film 0092): „Noch bemerke ich, daß die Gruben Rother Stolln zu Schwarzbach und Hausteins Hoffnung, Gott segne beständig, Gelber Zweig und Riedels Fdgr. bei Langenberg, welche ich am 14. und 15. Januar mit besuchte, wiederum nicht belegt waren.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 11. April 1845 kam es dann wieder zu einer Befahrung, über die Herr Neubert in seinem Fahrbogen festhielt, die Grube sei „nur dann und wann mit 2 bis 3 Mann belegt, deren Arbeit in dem Absinken des neuen Schachtes besteht,“ womit man nun 4,5 Ltr. Teufe erreicht hatte (40014, Nr. 322, Film 0104). Außerdem hat er die Eigenlöhner „ernstlich angehalten,“ die Auswechslung der wandelbaren Zimmerung auf den ersten 15 Ltr. Länge des Stollns „nunmehr sofort vorzunehmen, da hier mehrere zu Tage ausgehende Brüche entstanden sind und der Grundbesitzer sich dieserhalb beim Königl. Bergamt beschweren will.“ Darüber haben der Berggeschworene Schiefer und Markscheider Neubert am 26. April auch in Annaberg vorgetragen, daß die Stollnzimmerung unbedingt erneuert werden müsse und bei Nichtbefolgung dieser schon mündlich erteilten Anweisung eine Ordnungsstrafe angemessen sei (40169, Nr. 272, Rückseite Blatt 8). Vor Ort geschah aber wieder nichts und so bemerkte Herr Neubert auch im September 1845 in seinem Fahrbogen, „daß ich in diesem Quartale zu mehrern Malen die nicht in Fristen stehenden Gruben (...) Köhlers, Gelber Zweig, Distlers, Rother Stolln besucht, aber stets unbelegt gefunden habe.“ (40014, Nr. 322, Film 0143) Und auch unter dem 18. und 19. Dezember des Jahres liest man, an diesen Tagen „besuchte ich übrigens noch die Gruben (...) Köhlers, Riedels, Friedrich, Hausteins und Rother Stolln, welche ich jedoch sämtlich nicht belegt fand.“ (40014, Nr. 322, Film 0159) Vermutlich lag die Nichtbelegung bei dieser Grube aber daran, daß in diesem Jahr 1845 der Lehnträger der Grube, Friedrich August Jahn aus Mittweida, verstorben ist. Daraufhin nahm dessen Geselle, der ursprüngliche Muter Franz Anton Richter aus Raschau, seinen langjährigen Arbeiter, den eigentlich auf Gottes Geschick anfahrenden Doppelhäuer Friedrich August Weber als Mitgesellen an (40169, Nr. 272, Rückseite Blatt 9). Der letztere führte den Betrieb noch bis zum 1. Oktober 1849. Am 23. Februar 1846 kam wieder eine Befahrung zustande, über die Herr Neubert in seinem Fahrbericht festhielt, daß die Grube „nur selten belegt ist.“ Aber man hatte nun endlich „Anstalt getroffen, den Stolln vom Mundloch herein frisch auszubauen“ und die entstandenen Brüche zu gewältigen, womit man freilich erst 6 Ltr. vom Mundloch herein fortgeschritten war (40014, Nr. 322, Film 0176). Bei seiner Befahrung am 16. März 1846 war die Grube schon wieder unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0178). Bis zum 7. Mai hatte man dann doch die Stollnzimmerung auf 16 Lachter Länge vom Mundloch herein erneuert (40014, Nr. 322, Film 0193). Am 24. September 1846 fand Herr Neubert die Grube aber erneut ohne Belegung vor (40014, Nr. 322, Film 0219f). Die Überlieferung des Aktenbestandes der Fahrbögen endet leider im Quartal Reminiscere 1847. Bis dahin sind keine weiteren Befahrungen dieser Grube durch den Geschworenendienst- Versorger Markscheider Neubert mehr erfolgt. Die weitere Geschichte müssen wir anderen Akten entnehmen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Doppelhäuer Friedrich August Weber führte den Betrieb noch bis zum 1. Oktober 1849. Dann gaben die Erben Jahn's, die Witwe Friederike Wilhelmine Jahn und ein Schmiedemeister August Friedrich Schreyer (Nachname allerdings schwer leserlich), das Bergbaurecht auf und sagten ihre noch 25 Kuxe an der Grube los. Die anderen 100 Kuxe lagen offenbar beim Mitgesellen Franz Anton Richter, der sie erst am 16. Juni 1852 ins Freie gab (40169, Nr. 272, Blatt 18). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf den damit ins Freie gefallenen Rothen Stolln legte dann Herr Eduard Wilhelm Breitfeld, ab 1859 alleiniger Besitzer der Eisenhüttengesellschaft Nestler & Breitfeld in Erla, noch einmal Mutung ein und erhielt am 8. Oktober 1856 eine gevierte Fundgrube nebst fünf gevierten Maßen unter dem Namen Rote Fundgrube bestätigt (40169, Nr. 1459, Blatt 1). Gemäß dem Umwandlungsprotokoll vom 18. Juli 1857 umfaßte dieses Grubenfeld 12.740 Quadratlachter oder 13 Maßeinheiten nach den Regelungen des Berggesetzes von 1851 (40169, Nr. 1459, Blatt 2).
Etwa zeitgleich
wurde auch Herr
Ob Herr
Breitfeld eigentlich überhaupt etwas Praktisches in diesem Feld
unternommen hat, verraten uns die Grubenakten nicht. Seine Aktivitäten im
Revier beschränkten sich damals wohl nur auf den
Bereits am 2. August 1852 wurde beim Bergamt das Zubruchgehen des Stollns und dadurch entstandene Tagesbrüche angezeigt und daraufhin zunächst der letzte dort bekannte Eigner Weber zur Verfüllung aufgefordert (40169, Nr. 272, Blatt 19ff). Der fühlte sich natürlich nicht mehr zuständig und so wiederholte der amtierende Erbrichter Christian Fürchtegott Beyer in Schwarzbach seine Anzeige an das Bergamt am 29. September 1853. Das Bergamt wiederum forderte dann am 8. September 1855 Herrn Breitfeld zur Verfüllung der Tagesbrüche auf. Da dieser hier aber bis dahin selbst noch gar nichts Bergmännisches getan hatte, fühlte auch der sich aus verständlichen Gründen nicht zuständig und so hat Herr Beyer am 22. November 1855 erneut an das Bergamt geschrieben, daß noch immer keine Verwahrung erfolgt sei. Damit endet aber der Inhalt dieser Grubenakte und ob überhaupt und falls ja, wer denn die Tagesbrüche verfüllt hat, erfährt man hier nicht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das wieder ins Freie gegebene Feld der Roten Grube erhielt dann am 23. März 1859 zunächst der Obersteiger August Friedrich Unger aus Sosa namens eines neuen Muters, nämlich des uns an vielen Orten schon untergekommenen Kaufmanns Eduard Dreverhoff aus Zwickau bestätigt (40169, Nr. 1459, Blatt 8). Der hatte ‒ wie wir das von ihm schon kennen ‒ überhaupt nicht die Absicht, den Bergbau selbst wieder aufzunehmen. Sein Schichtmeister Weiß aus Sosa beantragte vielmehr am 12. Oktober 1859 Fristhaltung, weil „die Besitzverhältnisse ungeklärt“ seien (40169, Nr. 1459, Blatt 8A). Herr Dreverhoff wollte auch dieses Grubenfeld nämlich an die Sächsische Eisenhütten- und Bergbau Gesellschaft verkaufen ‒ die wollten es aber nicht... Die Fristhaltung wurde auch genehmigt, aber dann sagte Dreverhoff am 11. November 1859 das Feld wieder los (40169, Nr. 1459, Blatt 9f). Daraufhin schlug man seitens Wilkauer vereinigt Feld zu und holte sich nicht nur das losgesagte Feld von Rote Grube, sondern gleich noch das ganze obere Schwarzbachtal nordöstlich des bisherigen Grubenfeldes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für den südwestlichen Teil
des Langenberg'er Reviers haben wir weiter
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein tatsächliches Ausbringen an Erz ist
für den Rothen Stolln bzw. die Rote Grube nirgends dokumentiert.
Lediglich in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) und nur für
das Jahr 1847 ist eine einzige Eintragung enthalten, nach der vom
Rothen Stolln in diesem Jahr 1 Fuder Eisenerz geliefert worden sei. Wenn
also auch kein
erfolgreiches, so doch ein interessantes Puzzleteil der Montangeschichte, das
uns das oftmals unglaubliche Gottvertrauen illustriert, mit dem die
Bergarbeiter und später finanzkräftige Grubenbesitzer auch geringsten Hoffnungen
nachgegangen sind...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der 1842 auf den
Stolln niedergebrachte und „nahe
am Communicationswege von Schwarzbach nach Mittweida“ gelegene
Schacht ist 1863 offenbar erneut zu Bruch gegangen, was der Gendarm Friedrich
Anton Kugler (Familienname aber schwer leserlich) aus Grünhain am 14. April
bei der Amtshauptmannschaft in Annaberg zur Anzeige brachte. Von dort
wandte man sich an das Bergamt in Schwarzenberg und forderte „zur
Ergreifung sicherheitspolizeilicher Vorkehrungen“ auf
(40169, Nr. 1459, Blatt 11f).
Obwohl auch die das Grubenfeld inzwischen wieder aufgegeben hatte, war aufgrund des letzten Besitzwechsels nun die Grube Wilkauer vereinigt Feld für die Verwahrung zuständig, was nach Prüfung der Sachlage auch Markscheider Reichelt bestätigte. Geschworener Theodor William Tröger wurde also ausgesandt, sich ein Bild zu machen und der berichtete dann unter dem 22. April 1863, er habe keine Brüche im Verlauf des früheren Stollns gefunden, doch sei der Tageschacht zusammengebrochen, wodurch sich eine kleine Pinge von 3 Ellen Tiefe gebildet habe. Er habe bereits den Steiger von Wilkauer vereinigt Feld angewiesen, die Pinge mit Haldenbergen aufzufüllen (40169, Nr. 1459, Rückseite Blatt 13). Die ganze Sache wiederholte sich noch einmal im nächsten Jahr: Am 29. Februar 1864 wies die Amtshauptmannschaft das Bergamt auf eine erneute Einsenkung hin. Herr Tröger mußte wieder hin und teilte am 30. April in Schwarzenberg an, daß alles wieder verfüllt sei (40169, Nr. 1459, Blatt 17f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viel später und in den
Grubenakten zu Wilkauer vereinigt Feld haben wir dann noch
gefunden, daß Herr Oertel, inzwischen der Besitzer des
Tännichtgutes, dem Bergamt in Freiberg erneut die Existenz eines offenen
Schachtes auf seinem Grund und Boden angezeigt und dessen Verwahrung
beantragt hatte. Die Berginspektion Zwickau wurde daher beauftragt, sich
ein Bild zu machen, und Bergassessor Schwartz berichtete nach
seiner Befahrung vom 18. Juni 1914 nach Freiberg, besagter Schacht liege
auf dem Quadrat f5 der Verleihkarte am Rothen Bach, inmitten einer Halde,
sei wenigstens 10 m tief, besäße „völlig glatte Stöße“ und sei
tatsächlich gänzlich unverwahrt. Der Grundbesitzer verlange also
berechtigt die Verwahrung, habe sich aber bereit erklärt, die
Schachtöffnung bis dahin mit einer Einfriedung zu versehen
(40169, Nr. 144, Blatt 93).
Es ist immer wieder erstaunlich, wie vergesslich Behörden sein können, und die letzte Lossagung ist ja jetzt auch erst 65 Jahre her. Weil es sich hier um „ganz alten Bergbau“ handele, dessen Betreiber bei der Bergbehörde „nicht mehr bekannt“ war, überließ man in Freiberg diese Angelegenheit der Amtshauptmannschaft Annaberg als örtlicher Polizeibehörde zur weiteren Entschließung... (40169, Nr. 144, Blatt 94) Möglicherweise handelt es sich bei
diesem jetzt aber um einen anderen Schacht, als den von Rother Stolln,
den auch wir bei unseren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Gruben
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26)
und in anderen Quellen sind außer den oben bereits ausführlicher
beschriebenen Gruben noch zahlreiche weitere Gruben zumindest namentlich angeführt,
unter anderem:
auf Raschau'er Flur:
bei Langenberg:
bei Schwarzbach:
Eher selten lassen die knappen Bemerkungen zur Lage der in diesen Quellen aufgeführten Gruben deren genaue Verortung zu. Es kann also durchaus sein, daß wir noch so einige weitere übersehen haben, die ebenfalls zu beiden Seiten des Emmlers in Umgang gestanden haben. In der Region gab es noch etliche weitere Eisenerzgruben das Pöhlwassertal bis über Rittersgrün hinauf. So befanden sich zwischen Raschau und Pöhla etwa noch die Gruben St. Johannes, Überschaar und Engelsburg. Aber auch an der Nord- und Nordwestseite des Schwarzbachtals waren noch weitere Eisensteinzechen im Umgang, etwa Christian Fundgrube, Grüner Zweig, Vertrau auf Gott oder Ludwigs Fundgrube und auch bei Stamm Asser am Graul gewann man zeitweise Eisenerz mit. Zum Abbau vor dem 18. Jahrhundert fehlen verläßliche Quellen auch hier leider weitgehend. Zu einigen der hier aufgeführten Gruben wollen wir im Folgenden aber noch einige „Fundstücke“ aus den Bergamtsakten zusammenstellen. Dabei konzentrieren wir uns aber ‒ schon des Umfangs halber ‒ auf die Gruben im Schwarzbachtal. Der Bergbau am Südhang des Emmlers zum Tal der Großen Mittweida bei Raschau hin wird Gegenstand eines weiteren Beitrags sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
St. Sewald Stolln zu Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für diese Grube ist in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22) für die Jahre 1693, 1696 und 1699 ein Ausbringen von insgesamt 328 Fudern Eisenstein genannt. Wenn wir die im Folgenden in Grubenaufständen aus der Zeit ab 1690 quartalsweise aufgeführten Fördermengen addieren, kommen wir aber (wie es uns schon bei Vater Abraham zu Oberscheibe aufgefallen ist) auf ein deutlich höheres Ausbringen (bis Reminiscere 1698 kommen wir auf 1.947 Fuder). Wo diese Grube genau gelegen hat, wissen wir allerdings noch nicht, denn die einzige Ortsangabe in den Aufständen ist ,zu Raschau'.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Auflistung von Grubenaufständen aus
der Zeit ab 1680 wird sie erstmals im Quartal Trinitatis 1690 genannt (40014, Nr. 12, Film 0073, Mitte rechts).
Dort heißt es:
„Sebalt Stolln zur Raschau haben die lehnträger 15 Lachter fürs Stollnort und 5 Lachter ins Lichtloch ufgefahren, ist noch biß an die anbrüche eine (?) Strecke zu treiben und ist bergkost aufgangen 66 th 5 gr – pf hierzu voriger receß 81 th 16 gr – pf giebt 148 th 1 gr – pf Abraham Bock S. M. Nicol Deubner St.“ Da sich der Receß bereits mehr als verdoppelt hat, muß die Grube wenigstens ein Quartal eher aufgenommen worden sein; in der Liste haben wir sie vorher aber noch nicht gefunden. Da man einen Stolln vortrieb, ist anzunehmen, daß dieser in einem Tal ansetzte ‒ aber ob es das Mittweida- Tal gewesen ist (wo der Ort Raschau ja eigentlich liegt), oder ob es doch das Schwarzbach- Tal war (über das sich die Raschau'er Gemeindefluren ja noch bis zur Heyde vor Waschleithe erstreckten), das geht hieraus leider nicht hervor. Jedenfalls beabsichtigte man mit dem Stolln, bekannte Eisensteinvorkommen in größerer Tiefe anzufahren und vom Wasser zu lösen, um sie weiter abbauen zu können. Für Crucis 1690 ist die Belegung mit dem Steiger und drei Arbeitern beziffert. Diese trieben den Stolln weiter vor (40014, Nr. 12, Film 0074, Mitte rechts). Über die Arbeiten im letzten Quartal Luciae dieses Jahres steht geschrieben (40014, Nr. 12, Film 0076, Mitte rechts): „St. Sebalt Stolln zur Raschau hat der Steiger und 3 arbeiter diß 4tel 14 Lachter ufn Stolln aufgefahren, ist nun in allem 72 Lachter getrieben, uf bevorstehende Eisenflöze, ist aufgegangen... 295 th 1 gr.“ Binnen eines Jahres hatte man das Stollnort also bis auf die beachtliche Länge von rund 144 m ins Gebirge vorangebracht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über Reminiscere 1691 wurde festgehalten (40014, Nr. 12, Film 0078, links oben):
„haben 4 gewerken und arbeiter 20 Lachter (?) fürs Stollnort
ufgefahren ist nun von Mundloch 92 Lachter bis für Ort, sind noch nicht in die
Eisenstein gebaut, ist aufgangen berg kost 72 th 15 gr 3 pf...“
Der Gesamtrezeß hatte sich binnen des ersten Betriebsjahres schon auf eine Summe von über 367 Thalern summiert. Wer die vier bauenden Gewerken gewesen sind, wird leider nicht gesagt. Nicol Deubner wird aber jetzt als Schichtmeister benannt und die Funktion des Steigers übernahm ein Johann Richter. Trinitatis 1691 liest man dann (40014, Nr. 12, Film 0079, links unten), es ist „diß 4tel ist durch Steiger und 2 arbeiter 10 Lachter fürs Stollnort aufgefahren, auch ein zweiter Schacht 9½ (Lachter) gesunken, ist also dieser Stolln 102 Lachter von Mundloch biß für Ort.“ Wie schon bei der Grube Vater Abraham einmal zu lesen stand, tagte am 11. September 1691 eine hohe Kommission in Schwarzenberg (40014, Nr. 12, Film 0079ff). Für diesen Anlaß wurden etwas ausführlichere Aufstände erstellt. Darin heißt es über diese, zu jener Zeit ja umgängige Eisensteinzeche: Aufstände und berichte
bey der Churf. Sächs. Hohen bergk Commission „St. Sebalt Stolln zur Raschau haben für 2 (Jahren?) etzliche im (Lehn?) daselbst in dorff angefangen und biß dato 102 lachter lang ins felt getrieben, auch 9½ lachter in zweiten schacht, alles uf bevorstehende alte sehr waßernötige Zechen, biß dahin die anbrüche der Vorfahren weggehauen sind, zu treiben, ist Trin. receß 395 th 12 gr 7 pf Nicol Deubner S. M.“ Crucis 1691 wurde das Stollnort mit drei Bergarbeitern um weitere 12 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 12, Film 0082, rechts unten). Noch aber „hoffen (die Lehnträger?) anbrüche zu erlangen.“ Nicol Deubner wird jetzt als Steiger und Lehnträger, auch Schichtmeister“ benannt; er hatte also in Personalunion die Betriebsüberwachung wie die technische und kaufmännische Leitung inne.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luciae 1691 hat sich ein Schreibfehler
eingeschlichen, denn (sie ist an derselben Stelle in der Reihenfolge der Gruben,
wie in den vorangegangenen Quartalen aufgeführt, es muß also auch dieselbe Grube
gewesen sein) hier schrieb der neue Bergschreiber „St. Oßwalt Stolln
zur Raschau“. Der Stolln wurde stetig weiter getrieben, hatte jetzt 128
Lachter Länge erreicht und über drei Lichtlöcher Wetterzug vor Ort (40014, Nr. 12, Film 0084, links unten).
Man war „aber noch nicht in die
anbrüche kommen.“
Auch Reminiscere 1692 schrieb der Bergschreiber wieder St. Oßwalt Stolln. Der Stolln war mit dem Steiger und drei Arbeitern belegt und ist wieder um 9 Lachter erlängt worden. Zudem hatte er ein viertes Lichtloch erhalten (40014, Nr. 12, Film 0085, Mitte rechts). Man hatte die angezielten, von den Alten verlassenen Baue aber noch immer nicht unterfahren und hoffte, „durch Gottes Hülf bald an die anbrüche zu gelangen...“ Trinitatis 1692 wurde dann auch der Schreibfehler bemerkt und es steht im Aufstand (40014, Nr. 12, Film 0087, dritte Eintragung von links unten): „St. Das ,Oß' ist tatsächlich im Original gestrichen und durch ein ,Se' ersetzt. Wir hatten schon an uns gezweifelt, ob wir die alte Schrift noch richtig lesen können. Die Sache war es uns aber auch einmal wert, in einschlägigen Listen nachzuschlagen, ob es denn einen Heiligen namens Sankt Sewald eigentlich gegeben hat und wer das gewesen ist. Man findet bei der Suche tatsächlich einen Oswald von Worcester, der im 10. Jahrhundert Erzbischof zu York in England gewesen ist. Es erscheint uns aber sehr unwahrscheinlich, daß dieser Namenspatron eines erzgebirgischen Stollens gewesen sein könnte. Einen Sewald oder Sebald gibt es unter den katholischen Heiligen nach unserer Kenntnis nicht. Warum das ,St.' vorangestellt wurde, bleibt also unklar... Besser leserliche, saubere Abschriften dieser Aufstände existieren übrigens auch in den Akten des Freiberg'er Oberbergamtes. In der Abschrift besagten Quartals Trinitatis 1692 hat man den Grubennamen gleich richtig geschrieben (40001, Nr. 160, Film 0063).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Laufe dieses Jahres hat wahrscheinlich auch die Stelle des Bergschreibers in Scheibenberg jemand anderes eingenommen, denn das Schriftbild änderte sich nun und die Texte wurden etwas ausführlicher. Crucis 1692 heißt es im Aufstand (40014, Nr. 12, Film 0090, links unten sowie 40001, Nr. 160, Film 0069): St. Sewald Stolln zur Raschau „Ist dieses Quartal mit 1 Steiger undt 3 Arbeitern belegt (?) welche 15 Lachter fürn Stollnort aufgefahren undt ist dieser Stolln, so durch 4 Lichtlöcher getrieben unter welchen das erste 4½ Lachter, das andere 8½ Lachter, das dritte 9½ Lachter undt dann das vierte 12 Lachter Tiefe hat, (?) undt nunmehro vom Mundloche bis für Ort 169 Lachter, sind 65 th 10 gr 9 pf Bergk Kost aufgangen, hierzu alter Receß... Summa 770 th 4 gr 11 pf. Nicol Teubner, Schichtmstr. Hanß Richter, Steiger.“ Der Aufstand vom letzten Quartal 1692 besagt dann (40014, Nr. 12, Film 0094, links oben sowie 40001, Nr. 160, Film 0075): „Dieser Stolln ist dieses Quartal mit 1 Steiger undt 3 Arbeitern belegt gewesen, welche 5 Lachtern vorn Stolln Ort aufgefahren, einen Schacht von 6 Lachtern gesunken undt von der Stolln Firste 3 Lachter über sich gebrochen haben, undt ist dieser Stolln durch vier Lichtlöcher, das erste 4½ Lachter, das andere 8½ Lachter, das dritte 9½ Lachter undt dann das vierte 12 Lachter tief nunmehro vom Mundloche bis für Ort 174 Lachter ins feldt getrieben und Bergk Kost aufgangen 48 th 3 gr 3 pf hierzu voriger Receß... Summa 818 th 8 gr 2 pf.“ 174 Lachter sind rund 348 m. Dafür haben die Alten bis hierhin (nur) rund drei Jahre gebraucht, was im Vergleich zu anderen Stollnauffahrungen durchaus eine nicht zu unterschätzende Leistung ist. Aber bis jetzt wurde kein einziger Zentner Erz gefördert und das Unternehmen hat bereits über 818 Thaler gekostet !
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1693 scheint man nicht nur die
Baue der Altvorderen erreicht, sondern auch glücklich unverritzte Anbrüche
ausgerichtet zu haben, denn im Aufstand ist erstmals eine Förderung von 35
Fudern Eisenstein genannt (40014, Nr. 12, Film 0095, links oben).
Außerdem legte man noch ein fünftes Lichtloch an. Bis hierhin hatte dieses
Unternehmen nun über 875 Thaler Rezeß verursacht.
Trinitatis 1693 hatte man den Stolln noch um 1½ Lachter erlängt und auch das fünfte Lichtloch mit dem Stollnort in 14 Lachter Teufe zum Durchschlag gebracht (40014, Nr. 12, Film 0102). Das angefahrene Eisenstein- Vorkommen war offenbar sehr ergiebig, denn in diesem Quartal wurden außerdem 140 Fuder (!!) davon zutage gefördert und gleich vermessen. Bei 94 Thalern Quartalskosten reichten die Einnahmen aus dem Erzverkauf aber noch nicht aus, um die aufgelaufene Grubenschuld abzubauen; vielmehr stieg der Rezeß weiter auf nun rund 862 Thaler an. Auch Crucis 1693 brachte man 90 Fuder Eisenstein aus, ohne daß aber aus dem Aufstand näher hervorginge, wo und wie der Abbau angelegt war und welchen Verlauf das Lager hatte. Der Stolln besaß inzwischen eine Gesamtlänge von 174 Lachtern vom Mundloch bis vor Ort (40014, Nr. 12, Film 0106 sowie 40001, Nr. 160, Film 0081). Luciae 1693 wird dann sogar ein beachtliches Ausbringen von 200 Fudern genannt, die allerdings zunächst „im Steinbette in Vorrath (liegenblieben und) wo möglich kommendes Quartal vermessen werden sollen.“ (40014, Nr. 12, Film 0110 sowie 40001, Nr. 160, Film 0085f) Summieren wir die vier Zahlen aus diesem Jahr, kommen wir auf 465 Fuder, während in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22) nur eine Zahl von 161 Fudern Jahresförderung genannt ist. Mit über 981 Thalern hatte jetzt aber auch der Rezeß seinen Höchststand erreicht. Aber der Aufwand für die Neuausrichtung dieser Lagerstätte hatte sich offenkundig gelohnt: Dank eines recht kontinuierlichen Ausbringens in den Folgejahren wurde ein allmählicher Abbau dieser Grubenschuld möglich. Da man auch Reminiscere 1694 ein Ausbringen von 205 Fudern (40014, Nr. 12, Film 0114 sowie 40001, Nr. 160, Film 0091) und Trinitatis 1694 von weiteren 200 Fudern (40014, Nr. 12, Film 0117 sowie 40001, Nr. 160, Film 0096) vorzuweisen hatte, wobei man parallel zur Gewinnung und Förderung nur das Stollnort um weitere 10 Lachter fortgestellt, also wenig sonstige Betriebskosten hatte, war der Rezeß bis Mitte des Jahres bereits um rund 130 Thaler auf nun 858 Thaler gesunken. Im zweiten Halbjahr 1694 hat man ein
fünftes Lichtloch 16 Lachter tief bis auf den Stolln abgesunken und das
Stollnort um weitere 3 Lachter ausgelängt, so daß letzteres nun bei 190 Lachtern
Gesamtlänge vom Mundloch aus stand (40014, Nr. 12, Film 0121
und 0124 sowie 40001, Nr. 160, Film 0100 und 0104). Außerdem wurden wieder 305
Fuder Eisenstein gewonnen, so daß wir auf eine Gesamtförderung von 710 Fudern im
Jahr 1694 kommen. In den Erzlieferungsextrakten
(40166, Nr. 22) ist für dieses Jahr
überhaupt kein Ausbringen angegeben. Ferner
kamen noch 7 Fuder Erz hinzu, welche „Hr. Hähnel aufs halbe 9tel gestürzt
hat.“ Hier ist offenbar vom Stolln- Neuntel die Rede, dieser Herr Hähnel
besaß offenbar eine benachbarte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Jahr 1695 setzte sich genauso erfolgreich
fort: Reminiscere wurde der Stolln um weitere 2 Lachter fortgebracht und ‒ da
von anderen Abbauen keine Rede ist ‒ offenbar beim Vortrieb weitere 190 Fuder
Eisenstein ausgebracht. Auch der Herr Hähnel lieferte wieder weitere
6 Fuder als ,Neuntel' hinzu (40014, Nr. 12, Film 0128 sowie 40001, Nr. 160, Film 0107).
Trinitatis und Crucis 1695 wurde der Stolln um weitere 12½ Lachter ausgelängt und das erzielte Ausbringen auf Vorrat gestürzt (40014, Nr. 12, Film 0133
und 0138 sowie 40001, Nr. 160, Film 0112 und 0116f). Luciae 1695 wurden dann 263 Fuder Eisenstein vermessen, eingeschlossen 8 Fuder,
„so Christian Bock zum 9tel gestürzt hat.“ (40014,
Nr. 12, Film 0143 sowie 40001, Nr. 160, Film 0124) Der hier genannte
Name Christian Bock ist uns auch schon als
Der Stollen hatte jetzt eine Gesamtlänge von 209½ Lachtern (rund 419 m) erreicht. Die Grubenschuld ist auf 733 Thaler, 20 Groschen und 11 Pfennige weiter gesunken. Väter dieses Erfolgs blieben auch weiterhin Nicol Teubner als Schichtmeister und Johann (oder Hanß) Richter als Steiger. Reminiscere 1696 hat man dann auch ein Flügelort „nach Hrn. Hänels (und andern...?) Gebäude zu“ angeschlagen, für das dieser ja eigentlich schon ein Jahr lang ein Neuntel entrichtete. Es war aber zunächst erst 3 Lachter ausgelängt (40014, Nr. 12, Film 0147). Auch das Stollnort selbst hat man um einen Lachter fortgestellt und dabei wieder 190 Fuder Eisenstein gefördert. Bis Ende Luciae 1695 wurde das Stollnort noch um 1 Lachter weiter, das Flügelort aber um 6½ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 12, Film 00154, 0157 und 0161). Dabei brachte man Trinitatis 168 Fuder und Crucis 100 Fuder Eisenstein aus. Letztere wanderten aber zunächst in den Vorrat und wurden ‒ einschließlich weiterer 5 Fuder aus dem Stollnneuntel ‒ Luciae 1695 zu 127 Fudern Ausbringen vermessen. Für das ganze Jahr ergibt sich folglich ein Ausbringen von 485 Fudern Eisenerz. Der Rezeß war auf noch 538 Thaler, 16 Groschen und 12 Pfennige abgebaut. Im nächsten Jahr 1697 sank das Aubringen dann spürbar ab. Waren Reminiscere noch 130 Fuder zu vermessen (40014, Nr. 12, Film 0166 sowie 40001, Nr. 160, Film 0128), so waren es Trinitatis nur 27 Fuder (40014, Nr. 12, Film 0171 sowie 40001, Nr. 160, Film 0133) und Crucis 1697 heißt es im Aufstand (40014, Nr. 12, Film 0175f sowie 40001, Nr. 160, Film 0138): „Ist dieses Quartal aus Holzmangel nur etwas weniges gearbeitet worden, sindermahlen Eisenstein, dessen noch bis 30 Fuder im Vorrath liegen, keine Abnahme ist...“ Auch das Flügelort nach Herrn Hähnel's Grube hat man nur Reminiscere betrieben und gerade einmal um 1½ Lachter fortgebracht. Trinitatis 1697 war mit noch reichlich 454 Thalern der Rezeß auf seinem Tiefstand, seitdem stiegen die Schulden wieder an. Zwar hatte man Luciae 1697 das Stollnort wieder aufgenommen und noch einmal um ½ Lachter erlängt, wobei nunmehr insgesamt 45 Fuder Eisenstein auf Vorrat ausgefördert waren (insgesamt 1697 also 202 Fuder), doch war der Rezeß wieder auf 506 Thaler, 5 Groschen und 5 Pfennige angestiegen (40014, Nr. 12, Film 0180).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die letzte Eintragung zu dieser Grube in der
Liste der Grubenaufstände in dieser Akte entstammt dem Quartal Reminiscere 1698.
Hier liest man nun, das Flügelort habe man um weitere 3 Lachter ausugelängt und
(zusammen mit dem Vorrat aus dem Vorjahr) 130 Fuder Eisenstein vermessen, dazu noch 11 Fuder von Christian Bock und 7 Fuder
von Hrn. Hänel als Stollnneuntel erhalten (40014, Nr. 12,
Film 0183, unten links
sowie 40001, Nr. 160, Film 0148).
Abzüglich der vorgenannten 45 Fuder hat man also im ersten Quartal des Jahres 85
Fuder Eisenstein gefördert. Der Rezeß war auf nun 427 Thaler, ‒ Gr., 11 Pf. wieder abgesunken.
Zu bemerken ist noch, daß der bisherige Steiger Anfang 1698 durch Herrn Hanß Friedrich Merckel in seiner Funktion auf der Grube abgelöst worden ist. Während die Aktenüberlieferung im Bestand des Bergamts Scheibenberg an dieser Stelle endet, haben wir noch eine Fortsetzung in den Abschriften der Grubenaufstände im Oberbergamt gefunden. Auf das Quartal Trinitatis 1698 ist darin für den St. Sewaldt Stolln vermerkt, man habe das Flügelort nach Herrn Hänel's Grube um 1 Lachter fortgebracht (40001, Nr. 160, Film 0153f). Außerdem wurden 40 Fuder Eisenstein selbst gefördert und auch Herr Hänel hat wieder 4 Fuder Neuntel abgeliefert. Der Rezeß betrug noch reichlich 416 Thaler. Auch im folgenden Quartal hat man den Stollnflügel „nach Hrn. Hänels undt andern Gebäudten zu“ um weitere 1½ Lachter ausgelängt, dabei wieder 50 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen (40001, Nr. 160, Film 0159). Bergkosten und Einnahmen aus dem Erzverkauf hielten sich etwa die Waage. Luciae 1698 hatte man das Flügelort nochmals um 2 Lachter fortgestellt (40001, Nr. 160, Film 0164f). Das Ausbringen summierte sich auf 50 Fuder zuzüglich weiteren 5 Fudern Stollnneuntel von Lehnträger Christian Bock für die Nachbargrube 25 Lehne. Der Rezeß lag weiter bei zirka 423 Thalern. Aus dem Jahr 1699 fehlen auch in der Oberbergamtsakte jegliche Grubenaufstände, doch ist der St. Sewaldt Stolln dann Reminiscere 1700 wieder aufgeführt (40001, Nr. 160, Film 0171). Auch in diesem Quartal hat man hier wieder 50 Fuder Eisenstein gefördert, dazu noch 3 Fuder als Neuntel von Christian Bock erhalten. Der Rezeß sank auf nunmehr reichlich 391 Thaler stetig weiter ab. So ging der Betrieb auch Trinitatis 1700 vonstatten: Erneut wurden 50 Fuder selbst gefördert und weitere 6 Fuder Stollnneuntel von der Nachbargrube angenommen (40001, Nr. 160, Film 0177). Die Einnahmen hatten die Kosten wieder um rund 10 Thaler überstiegen, so daß der Rezeß weiter abgetragen werden konnte. Bei weiteren 55 Fudern Förderung im Quartal Crucis 1700 überstiegen die Einnahmen wieder die Kosten um diesmal rund 8 Thaler (40001, Nr. 160, Film 0183). Die Aufstände von Luciae 1700 fehlen auch in der Oberbergamtskopie. Reminiscere 1701 hatte man wieder 55 Fuder Eisenstein gefördert und vermessen, ferner noch 17 Fuder Stollnneuntel erhalten. Der Rezeß ist stetig weiter auf nun noch 336 Thaler, 9 Groschen, 3½ Pfennige abgesunken (40001, Nr. 160, Film 0190). Trinitatis 1701 gab es nichts anderes zu berichten. Die Förderung summierte sich diesmal auf 45 Fuder (40001, Nr. 160, Film 0196). Nur kam mit einem neuen Schriftbild auch wieder eine neue Schreibweise: Der neue Bergschreiber in Freiberg schrieb den Grubennamen nun St. Sebald Stolln. Crucis 1701 wurden 35 Fuder Eisenstein gewonnen und 6 Fuder kamen als Stollnneuntel dazu (40001, Nr. 160, Film 0201). Luciae 1701 wurden 50 Fuder gefördert. Der Rezeß war inzwischen auf 363 Thaler angewachsen (40001, Nr. 160, Film 0207). Aus diesem Quartal existiert noch ein zweiter Aufstand mit anderem Schriftbild, nach welchem man außerdem 8 Fuder Stollnneuntel erhalten hatte (40001, Nr. 160, Film 0211). Außerdem unterscheiden sich diese beiden in der Höhe des aufgelaufenen Rezesses, der in dieser Fassung nur mit 308 Thalern angegeben wird. Danach setzen die Aktenüberlieferungen zu dieser Grube aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 Lehne (ab 1696: 25 Lehne) zu Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine solche Grube wird in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22) nicht genannt. Wenn wir die in den Grubenaufständen aus der Zeit ab 1695 (40014, Nr. 12) quartalsweise aufgeführten Fördermengen addieren, kommen wir für den kurzen Zeitraum von drei Jahren dennoch auf ein nicht unbeträchtliches Ausbringen (bis Reminiscere 1698) von 610 Fudern Eisenstein. Wo diese Grube genau
gelegen hat, wissen wir freilich nicht sicher zu sagen, denn ‒ wie beim
Sewald Stolln ‒ ist die einzige Ortsangabe in den Aufständen ,zu
Raschau'. Sicher aber
hat sie unweit vom Sewald Stolln gelegen, denn der im Folgenden als
Lehnträger genannte Christian Bock entrichtete Luciae 1695 als
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der schon mehrfach zitierten Auflistung
alter Grubenaufstände haben wir Reminiscere 1695 erstmals die Eintragung
folgender Grube gefunden (40014, Nr. 12, Film 0128, rechts unten sowie 40001, Nr. 160, Film 0108):
In 17 lehn uff der Raschauer. „In dieser Gruben wirdt vor itzo 12 Lachter tief gebauet undt stehen die Anbrüche theils 1 Lachter, theils auch nur ½ Lachter, auch mächtiger an, fallen ab und zu. Dieses Quartal sindt 70 Fuder Eisenstein vermessen worden und liegen auch annoch bis 100 Fuder in Steinbette in Vorrath, welche künftig vermessen und in Einnahme gebracht werden sollen. Bergk Kosten sind aufgangen 58 Thaler, 16 Gr. bleibt nach Abzug der Einnahme und Churf. Intraden Vorrath Summa 4 Th 5 gr – pf. Rezeß Abraham Bock, Schichtmeister, Christian Bock, Lehnträger.“ Nun, dieser Beginn kann nur ein glücklicher genannt werden: Gleich im ersten Quartal nach Betriebsaufnahme ein beachtliches Ausbringen von 70 Fudern und nach Steuern eine eher geringfügige Grubenschuld von reichlich 4 Thalern ! Aber der Name Abraham Bock ist uns ja auch als Berggeschworener zu Scheibenberg bekannt ‒ der Mann war unzweifelhaft ein Fachmann und wußte, worauf er sich einließ. Hinsichtlich des Grubenbetriebes sind die Eintragungen aus den folgenden Quartalen fast wortgleich. Trinitatis 1695 heißt es darüber hinaus nur (40014, Nr. 12, Film 0133, links sowie 40001, Nr. 160, Film 0112): „Dieses Quartal sindt 80 Fuder Eisenstein vermessen worden, und liegen auch annoch bis 50 Fuder in Steinbette in Vorrath, welche künftig vermessen und in Einnahme gebracht werden sollen.“ Crucis 1695 liest man (40014, Nr. 12, Film 0138, rechts unten sowie 40001, Nr. 160, Film 0117): „Dieser Schacht ist von der Hängebank 12 Lachter tief und stehen die Anbrüche vor itzo 1 Lachter bisweilen auch mächtiger und schmäler an, fallen ab undt zu. Es liegen anietzo über 100 Fuder Eisenstein in Steinbette in Vorrath, welche künftig vermessen und in Einnahme gebracht werden sollen. Dieses Quartal ist die Zeche in Fristen gehalten worden mit 1 th 4 gr.“ Also hatte man einen Schacht abgesenkt und von diesem ausgehend den Abbau ausgerichtet. Die Anbrüche fallen zwar nur ,ab undt zu', aber wenn man davon jedes Quartal 50 Fuder gewinnen kann, können sie nicht schlecht gewesen sein. Allerdings stieg auch der Rezeß auf reichlich 12 Thaler an. Luciae 1695 ließ der Lehnträger die Grube ebenfalls überwiegend in Fristen, hatte aber inzwischen auch 190 Fuder Eisenstein im Vorrat liegen (40014, Nr. 12, Film 0143 sowie 40001, Nr. 160, Film 0124). Im ganzen Jahr 1695 wurden folglich 150 Fuder vermessen und verkauft. Von diesem Vorrat hat man dann im Quartal Reminiscere 1696 einen Teil von 180 Fudern vermessen, die Förderung aber fortgesetzt, so daß schon wieder 50 Fuder im Vorrat waren. Die Grubenschulden hatten sich auf reichlich 34 Thaler erhöht (40014, Nr. 12, Film 0147). So führte man den Betrieb auch in den folgenden Quartalen fort und sammelte das Ausbringen erstmal auf Halde. Luciae 1696 hat man dann davon wieder 80 Fuder vermessen lassen und behielt weitere 90 Fuder auf Vorrat (40014, Nr. 12, Film 0162). Die Erzlieferung im Jahr 1696 summierte sich also auf 260 Fuder. Der Rezeß stieg in dieser Zeit auf 43 Thaler, 9 Groschen und 3 Pfennige. Außerdem hatte der Lehnträger nachgemutet und ab Luciae 1696 wird die Grube unter der Bezeichnung 25 Lehn auf der Raschauer (Flur) geführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1697 hatte man einen Erzvorrat
von 205 Fudern angehäuft (40014, Nr. 12, Film 0167
sowie 40001, Nr. 160, Film 0128). Trinitatis wurden davon 75 Fuder vermessen und verkauft, zugleich blieben
130 Fuder im Vorrat (40014, Nr. 12, Film 0171
sowie 40001, Nr. 160, Film 0133). Crucis 1697 heißt es, man habe 130 Fuder Erzvorrat
und „solange der nicht vermessen ist, die Arbeit eingestellt.“ Die Grube
wurde aber dessen ungeachtet in Fristen gehalten (40014, Nr. 12, Film 0176,
Mitte links sowie
40001, Nr. 160, Film 0139).
Bis Luciae 1697 hatte man offenbar wieder ein paar Schichten gearbeitet und inzwischen 170 Fuder Vorrat aufzuweisen, davon aber nichts weiter verkauft (40014, Nr. 12, Film 0180, Mitte rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0144). Der Rezeß war bedingt durch die Fristhaltung nur wenig auf reichlich 46 Thaler zum Schluß des Quartals angestiegen. Im Quartal Reminiscere 1698 wurden vom inzwischen angesammelten Vorrat 200 Fuder vermessen, wobei man aber immer noch 20 Fuder übrig und auf Vorrat behielt (40014, Nr. 12, Film 0183, Mitte rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0148f). Durch den Erzverkauf war die Grubenschuld leicht auf reichlich 43 Thaler gesunken. Während die Aktenüberlieferung im Bestand des Bergamts Scheibenberg an dieser Stelle endet, haben wir noch eine Fortsetzung in den Abschriften der Grubenaufstände im Oberbergamt gefunden. Auf das Quartal Trinitatis 1698 ist darin für diese Grube vermerkt, daß man noch 40 Fuder Eisensteinvorrat „im Steinbette“ zu liegen habe (40001, Nr. 160, Film 0154). Das war doppelt so viel, als noch im letzten Quartal; also muß man zumindest zeitweise gefördert haben. Jedoch heißt es weiter: „Sonsten ist die Zeche dieses Quartal unbelegt gewesen, aber in Fristen gehalten worden.“ Der Rezeß ist dabei auf nun noch etwas über 41 Thaler sogar weiter abgesunken. So lief der Betrieb auch Crucis 1698, wobei man diesmal 44 Fuder Eisenstein ausgebracht und vermessen hatte (40001, Nr. 160, Film 0159f). Der Rezeß stieg durch Bergkosten und „churfürstl. Intraden“ wieder auf reichlich 47 Thaler an. Bis Schluß Luciae 1698 hatte man hier erneut 100 Fuder ausgebracht, die aber noch unvermessen auf Vorrat lagen (40001, Nr. 160, Film 0165). Weil es „aus Holtz Mangel keine Abnahme darzu“ gab, wurde die Grube nun wieder in Fristen gesetzt. Wie oben schon erwähnt, besteht auch in der Oberbergamtskopie der Grubenaufstände eine Lücke im Jahr 1699. Von Reminiscere 1700 heißt es dann wieder, man habe 110 Fuder Eisenstein vermessen und noch weitere 60 Fuder auf Vorrat liegen (40001, Nr. 160, Film 0171f). Der Betrieb scheint also ganz erfreulich fortgeschritten zu sein, doch ist dabei auch der Rezeß auf nun über 81 Thaler angestiegen. Im folgenden Quartal wurden weitere 50 Fuder ausgebracht und vermessen (40001, Nr. 160, Film 0177). Auch Crucis 1700 konnten 65 Fuder gefördert werden. Anders, als beim Sewaldt Stolln überstiegen hier aber die Kosten die Einnahmen aus dem Erzverkauf, so daß der Rezeß langsam weiter anstieg (40001, Nr. 160, Film 0183). Wie bereits bemerkt, besteht mit dem Quartal Luciae 1700 eine Lücke in der Aktenüberlieferung. Reminiscere 1701 wurden hier aber wieder 50 Fuder Eisenstein gefördert und vermessen (40001, Nr. 160, Film 0190). Trotz der steigen Einnahmen stieg bei dieser Grube der Rezeß weiter auf nun 115 Thaler, 20 Groschen, 5 Pfennige an. Trinitatis 1701 scheint die Grube nur zeitweise belegt gewesen zu sein, denn der Vorrat stieg zwar um 10 Fuder an, doch der Rezeß sank auf 104 Thaler ab. Auch klagte man, daß „keine Abnahme seyn will.“ (40001, Nr. 160, Film 0196) Anstelle von Abraham Bock zeichnete diesen Aufstand nun Johann Pauly Bock als Schichtmeister ab. Ähnlich lautet der Aufstand auf Crucis 1701 (40001, Nr. 160, Film 0201): Nach wie vor baute man hier in 12 Lachtern Tiefe ab und hatte nun insgesamt 100 Fuder noch unvermessen im Steinbette liegen. Obwohl man somit keinen Eisenstein verkauft hatte, sank der Rezeß auf 87 Thaler weiter ab. Luciae 1701 schließlich hatte man dann 120 Fuder vermessen und also verkauft (40001, Nr. 160, Film 0207). Dennoch war der Rezeß nun wieder auf 109 Thaler angewachsen. Auch zu dieser Grube (ei beim St. Sebald Stolln) gibt es aus diesem Quartal eine zweite Fassung des Aufstands mit anderem Schriftbild (40001, Nr. 160, Film 0211). Nach dieser waren es nur 115 Fuder und der Rezeß betrug 101 Thaler. Damit enden auch die Erwähnungen dieser Grube in der Sammlung von Aufständen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Fahrbögen des Vize- Obereinfahrers
Ehrhardt Haustein aus dem Zeitraum von 1727 bis 1739 haben wir aber noch eine
Erwähnung einer Sieben Lehn Fundgrube im Quartal Crucis 1737 gefunden (40001, Nr. 2527, Rückseite Blatt 178).
Ob dies allerdings noch dieselbe Grube ist, ist mehr als fraglich, da die Ortsbezeichnung
reichlich vage ist. Jedenfalls lautete sein Fahrbericht wie folgt:
„Auf königl. Bergambts
Refier Scheibenberg. Hier ist von Tage auf ein Eisen Stein Gang 10 Lachter abgesunken, so dann mit einem Ort gegen Abend auf 14 Lachter aufgefahren worden, und zwar nach vorliegenden Gängen; jetzo bricht vor Ort zuweilen etwas von Eisen Stein mit ein, wovon das Fuder vor 20 Gr. verkaufft wird, ingleichen ist ein Stolln nach dießem Gebäude, so 16 Lachter Täuffe ein bringt, getrieben, allda arbeiten 1 Steiger, 1 Junge, (als) Eigenlöhner.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
96 Lehne zu Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jetzt übertreibt´s aber einer: 96 Lehen ‒ das ist fast so viel Grubenfeld, wie es Vater Abraham auf dem Höhepunkt seiner Betriebszeit innehatte. Dabei wird auch diese Grube in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22) gar nicht genannt. Wenn wir die in den Grubenaufständen aus der Zeit ab 1696 (40014, Nr. 12) quartalsweise aufgeführten Fördermengen addieren, kommen wir für den kurzen Zeitraum von zwei Jahren aber immerhin auf ein Ausbringen (bis einschließlich Reminiscere 1698) von 250 Fudern Eisenstein. Wo diese Grube allerdings genau gelegen hat, wissen wir auch hier nicht zu sagen, denn ‒ wie bei den beiden vorangegangen ‒ ist die einzige Ortsangabe in den Aufständen ,zu Raschau'.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Bezeichnung erscheint in der schon oft zitierten Liste alter Grubenaufstände erstmals Reminiscere 1696 (und gleich nach vorstehenden 17 bzw. 25 Lehnen), wo es über sie heißt (40014, Nr. 12, Film 0147, rechts unten): In 96 lehn zur Raschau. „Dieses Gebäude ist zu 3tel belegt undt wirdt biß auf das Flötz 11 Lachter seiger tief gebauet, der Eisenstein stehet ½ Lachter mächtig an, haben diesen Quartal 84 Fuder mit gewonnen und vermessen, dabey sindt Bergk Kosten aufgangen 58 Thl. 12 Gr. – Pf. verbleibt nebst den Churf. Intraden von der Einnahme abgezogen Summa 17 Th – Gr 7 Pf. Johann Augustin Enderlein, Schichtmstr., Hanß Merckel, Steiger“ Oh ‒ schon wieder ein sehr
bekannter Familienname: Die Enderlein's waren zeitweise Bergmeister in
Scheibenberg. Hans Merckel war 1692 noch Steiger auf den Langenberg'er
Auch hier kann man die Wahl des gemuteten Feldes nur als eine glückliche bezeichnen, denn gleich im ersten Quartal wurde Eisenstein ausgebracht und verkauft, so daß sich der auflaufende Rezeß ziemlich in Grenzen hielt. Fast exakt den gleichen Wortlaut hat die Eintragung auf das folgende Quartal (40014, Nr. 12, Film 0154, links ganz unten). Wieder wurden 84 Fuder Eisenstein gewonnen und vermessen, wodurch sich auch der Rezeß auf noch reichlich 17 Thaler verminderte. Während aber Johann Augustin Enderlein weiter als Schichtmeister fungierte, wird nun statt des Steigers nun Samuel Enderlein als Lehnträger aufgeführt. Dieselbe Personal- Konfiguration gab es, nebenbei bemerkt, auch auf der Grube Segen Gottes zu Pöhla... Crucis 1696 wurde nicht mehr in Dritteln belegt und „ein Ort, Wetter in die Gebäude zu bringen, getrieben worden, allwo der Eisenstein Ellen mächtig in den Anbrüchen ansteht.“ (40014, Nr. 12, Film 0158, links oben) Eine Förderung wurde zwar nicht genannt, doch haben sich bei Bergkosten von etwa 10 Thalern im Quartal (also nicht sehr umfänglichem Betrieb) die Grubenschulden auf nur noch 7 Thaler, 2 Pfennige weiter vermindert. Außerdem tritt nun als
Lehnträger ein Herr Johann Friedrich Hänel auf und da klingelt´s bei uns
doch wieder: Hatte nicht ein Herr Hänel Eisensteine als
Luciae 1696 heißt es dann im Aufstand, es „stehet der Eisenstein, so nach Gedinge gewonnen und gefördert wird, Ellen mächtig an.“ (40014, Nr. 12, Film 0162, links Mitte) Außerdem wurden 30 Fuder davon vermessen, man kommt also im ersten Betriebsjahr auf ein Gesamtausbringen von 198 Fudern Eisenerz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Aufstand für Reminiscere 1697 erfährt
man (40014, Nr. 12, Film 0167, links Mitte
sowie 40001, Nr. 160, Film 0128):
„Dieses Gebäude ist nur mit 1 Häuer und 1 Jungen belegt und sind dieses
Quartal 10 Fuder Eisenstein gefördert und vermessen worden.“
Diese Eintragung ist im Original durchgestrichen, jedoch findet sich darunter diese Ergänzung: „Nota. Diese 96 Lehen dürfen nicht ausgestrichen werden, sondern bleiben und werden fortgeführet.“ Okay. Tatsächlich aber wurde die Grube den ganzen Rest des Jahres 1697 unbelegt und in Fristen gehalten (40014, Nr. 12, Film 0171, 0176 und 0180 sowie 40001, Nr. 160, Film 0133f, 0139 und 0144). Die letzte Eintragung in dieser Akte zu dieser Grube betrifft das Quartal Reminiscere 1698. Hier heißt es nun wieder (40014, Nr. 12, Film 0183, unten rechts sowie 40001, Nr. 160, Film 0149): „Dieses Orts wird 12 Lachter tief gebaut, stehet der Eisenstein Ellen mächtig an, haben dessen dieses Quartal 52 Fuder mit gefördert und vermessen.“ Mit reichlich 23 Thalern hielt sich der Gesamtrezeß noch immer in Grenzen. Anstelle des vorherigen Lehnträgers Hänel wird nun aber ein Christoph Schramm als Steiger genannt. Während die Aktenüberlieferung im Bestand des Bergamts Scheibenberg an dieser Stelle endet, haben wir noch eine Fortsetzung in den Abschriften der Grubenaufstände im Oberbergamt gefunden. Auf das Quartal Trinitatis 1698 ist darin für diese Grube vermerkt, man baue nach wie vor in 12 Lachtern Teufe und fahre mit Örtern auf dem Eisensteinlager fort, wobei man diesmal 43 Fuder ausgebracht und vermessen habe (40001, Nr. 160, Film 0154). Der Rezeß war auf 30 Thaler, 9 Groschen, 7¾ Pfennige wieder angestiegen. Crucis 1698 ist die Zeche unbelegt gewesen, jedoch in Fristen gehalten worden (40001, Nr. 160, Film 0160). Da keine Bergkosten anfielen, ist der Rezeß dabei auf rund 29 Thaler leicht gesunken. Nach Luciae 1698 ist diese Zeche auch in der Oberbergamtskopie der Grubenaufstände nicht mehr aufgeführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoffnung Stolln bei Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wird eine Hoffnung Fundgrube im Zeitraum von 1793 bis 1796 genannt (40166, Nr. 22 und 26), wahrscheinlich handelte es sich bei dieser aber nicht um diesen Hoffnung Stolln zu Raschau. Der „in dem Dorfe Raschau gelegene und in das Silber Emmler Gebirge gegen Mitternacht Abend getriebene und verbrochene Stolln“ ist auf eine Mutung vom 30. September hin am 17. Oktober 1795 an den Hammerwerksbesitzer Carl Heinrich von Elterlein „nach beschehenen Freifahren (...) mit allen Stollngerechtigkeiten unter dem Namen Hoffnung auf Eisenstein, auch alle andern Metalle, verliehen und bestätigt worden.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 173)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem Fahrbogen des Berggeschworenen Johann Samuel Körbach (40014, Nr. 193, Film 0034) vom 6. Januar 1796 zu urteilen, handelte es sich bei diesem nicht um eine Eisenerzgrube. Dieser nämlich hielt fest: Über den Hoffnungs Stolln bei
Raschau „Befande solchen Stolln mit 3 Mann beleget und wird das Stollnort in Quergestein gegen Nord betrieben, war von seinem Mundloch 23 Ltr erlenget und wendet in Stunde 11, wird fernerseits in das Silber Aemmler Gebirge in der Hoffnung betrieben, in solchem edle von Erz einbrechende Gänge zu überfahren.“ Hier ist nicht von Eisenerz oder Braunstein die Rede, sondern von ,edlen Erzen´, deshalb verfolgen wir ihre Geschichte an dieser Stelle nicht weiter. Und wenn er von Raschau her (von Süden) in das Emmler Gebirge getrieben wurde, kann er auch nichts mit der Hoffnung Fundgrube bei Schwarzbach zu tun haben. Der Stolln wurde aber noch wenigstens ein weiteres Mal von Körbach befahren, und zwar im Quartal Trinitatis 1796, worüber er berichtete (40014, Nr. 193, Film 0041f): „Befande das Stollnort mit 2 Mann beleget, war vom Mundloch 27 Ltr. erlenget, wendet in Stunde 11,4 wird fernerweit gegen Nordost in Quärgestein betrieben, das Gebürge aufzuschließen und bauwürdige Gänge zu überfahren.“ Auch diese Grube war jedenfalls ‒ wie der Name dieser und zahlreicher anderer Gruben der Region ja schon ausdrückt ‒ ein reiner Hoffnungsbau.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catharinaer oder Kirchenstolln in
Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über die Ursprünge dieser Grubenanlage haben wir
noch nicht näher recherchiert. Möglicherweise geht er aber auch schon auf
das 16. Jahrhundert
„St. Catharina Fundgrube, so in der Raschau gelegen. Allda ist von tage 13 Lachter biß auf den hier angetriebenen Stollen, so auch 13 Lachter Tiefe einbringt, abgebauet, ietzo wirdt ein Ort in liegenden auf ein übersetzenden gang 2 lachter gegen abent getrieben, der gang ab und zu fallend 1 quer hand mächtig bestehet von einer bräunen gilbe und blaulichtem besteg, ferner weit noch ein ort auf ein Stehenden gang gegen mittag getrieben, in diesen quartal ist an zubuß 1 Thl. 4 Gr. angeschlagen worden. Allda arbeiten 1 Steiger, 5 Häuer, 1 Knecht.“ Eigentlich lag ja auch die Katharina Fundgrube am Graul noch auf Raschau'er Flur, wenn auch später im Schneeberg'ischen Bergamtsrevier. Daß man dort aber zu diesem Zeitpunkt erst in 13 Lachter Teufe baute, erscheint uns kaum wahrscheinlich. Aber auch die hier benannte Richtung der getrieben Strecken, gegen Abend und gegen Mittag, paßt nicht so richtig zu der des Kirchenstollns, der nämlich gegen Norden, also gegen Mitternacht getrieben worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Fahrbögen der im Scheibenberg'er Bergamtsrevier zuständigen Geschworenen ist dann jedenfalls zu entnehmen, daß dieser, tatsächlich hinter der Raschau'er Allerheiligen Kirche am Nordhang des Tals der großen Mittweida ansetzende und nordwärts in den Emmlerrücken hinein vorgetriebene Stolln ab Crucis 1795 wieder gewältigt worden ist. Wer dies veranlaßt hat, welche Gewerkschaft hier dahinterstand und welche Pläne die Gewerken damit verfolgten, ergab sich erst aus späteren Unterlagen. Jedenfalls war dieser Stolln 1795 schon lange da, auf eine erstaunliche Länge in den Berg getrieben und längst wieder verbrochen. Der Geschworene Johann Samuel Körbach hielt dann in seinem Fahrbogen vom 30. Dezember 1795 fest, der Stolln sei nun wieder mit 2 Knechten und 2 Jungen belegt, man sei aber „mit Gewältigung des 2ten Lichtlochs oder Tageschachtes nicht tiefer als 17 Ltr. niedergekommen, so dann der von Stolln herauf gehenden Waßern halber und also dieses Lichtloch verlaßen müßen. 3. hat man in dieses Quartal Luciae a. c. No. 5te Woche das 1te Lichtloch in Angriff genommen, mit Gewältigung ist 15 Ltr. tief niedergekommen, bis auf die vom Stolln herauf gehenden Waßer und solches ebenfalls verlaßen müßen. Da es nun nicht möglich ist, die Stollnsohle zu erlangen, so muß man die Gewältigung vom Stolln Mundloch herein in Abend in Angriff nehmen...“ Dabei bezweifelte Herr Körbach schon, ob es überhaupt möglich sei, „den Stolln (wieder) in Umtrieb zu setzen.“ (40014, Nr. 193, Film 0028) Dennoch wurde die Gewältigung unverdrossen fortgesetzt und im Juli 1796 war die Stollnsaige auf 19 Lachter Länge aufgewältigt (40014, Nr. 193, Film 0046) und Luciae 1796 fand Herr Körbach bereits (40014, Nr. 193, Film 0069), „daß der Stolln von seinem Mundloch aus 217 Ltr. sehr brav hergestellt war, meistentheils stehendergangweiß gewältiget, wendet in Stunde 1,4 gegen Nord. Man hat vom Stollnmundloch herein in Nord bey 108 Lachter Entfernung ein vom Tag 13 Lachter saiger tiefen Schacht erlangt, ferner von solchem in gedachter Richtung, vom 1ten Schacht bey 94 Ltr. Entfernung kommt wieder ein Schacht, 19½ Ltr. saiger tief bis Stollnsohle herein, beyde Schächte stehen mit dem Stolln etwas in der Morgenseite und sind in Quärgestein abgesunken worden. Von letztem ist die Gewältigung 15 Lachter ferner in Mitternacht geschehen, wird durch gedachte 5 Mann fernerweit vermittelst Thürstockzimmerung und Förstengetriebe unternommen.“ Bis Reminiscere 1797 war der Stolln auf 235 Lachter Länge gewältigt (40014, Nr. 196, Film 0004) und Trinitatis 1797 hatte man mit 6 Mann Belegung mit der Gewältigung 249 Lachter Länge erreicht (40014, Nr. 196, Film 0027). Dabei war allerdings auch „doppelte Thürstockzimmerung“ erforderlich. Bis Crucis 1797 hatte man den Stolln „auf 258⅝ Lachter Länge (rund 516,6 m) in fahrbaren Zustand gesetzet.“ (40014, Nr. 196, Film 0038) Und so ging es weiter: Luciae 1797 fuhr man beim 2. Lichtloch noch einen Umbruch auf und bis zu Körbach's Befahrung im Quartal Reminiscere 1798 waren dann schon „281¾ Lachter fahrbar hergestellt.“ Bis Trinitatis 1798 waren es schon 298¼ Lachter, bis Crucis 312 Lachter und Luciae 1798 hatte man dann 337 Lachter Stollnlänge (rund 674 m !!) aufgewältigt, allerdings lag hier der Stolln „noch gänzlich zu Bruch.“ (40014, Nr. 196, Film 0117, 0138 und 0166) Wohlgemerkt: Man wältigte ab 1795 diesen alten Stolln auf. Der war also lange zuvor von den Alten auf diese Weite in den Emmlerrücken hinein vorgetrieben worden. Wozu eigentlich ? Der Geschworene vermerkte nie etwas über irgendeine angetroffene, bauwürdige oder wenigstens der näheren Untersuchung werte Gangstruktur, geschweige denn über ein Ausbringen an brauchbaren Rohstoffen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1799 vermerkte Herr
Körbach dann, es seien nun schon 358 Lachter gewältigt und: „Man
wird noch gegen 8 Lachter bis zum 3ten Lichtloch zu gewältigen
haben.“ (40014, Nr. 199, Film 0019) Ein solches gab es also auch
schon. Darüber notierte der Geschworene Trinitatis 1799:
„Befande den Stolln unbelegt, war vom Markscheidekreuz 89¾ Lachter in Mitternacht gewältigt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat man das übertage angelegte 3te Lichtloch erreicht. 2. haben die Vorsteher in diesem Qu. Trinitatis 3te Woche den Anfang mit 6 Mann zu Aufgewältigung des 3ten Lichtloch unternommen, war mit 4 Ellen Länge und 1 Elle 22 Zoll Weithe von Tag 10 Ltr. saiger tief aufgewältiget.“ Luciae 1799 berichtete er in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 199, Film 0060): Fahrbogen „Bey solchem Stolln war das 3te Lichtloch von tag 35 Ltr. saiger tief mit 3 Ellen und 18 Zoll Länge und 1 Elle 16 Zoll Weitghe mehrentheils in ganzem Gestein bis Stollnsohle zum Zug und fahrbar hergestellt, kommt aber dem dem Stolln 1¾ Lachter vom Stolln in der Abendseite herein. Wird der Stolln fernerweit in Stunde 3 in Nord mit dem Steiger, 5 Arbeitern zu 2/3tel aufgewältiget, liegt ganz zu Bruch.“ Wir sind ja schon rund 716 weit und fast schon unter dem Emmlerweg und das 3. Lichtloch hatte deshalb auch schon rund 70 m Tiefe ! Crucis 1800 war man dann 58 Ltr. nördlich vom 3. Lichtloch „vor anstehendes Ort“ gelangt. Bis dorthin war der Stolln folglich 416 Lachter oder zirka 832 m lang !! (40014, Nr. 200, Film 0037) Dort hatten die Alten einen Stunde 3 streichenden Gang angefahren, der Letten und Gneis führte und „auf solchem kommen … Waßer förstenweiß heran, daß beynahe die Menschen nicht für Ort arbeiten können.“ Es sollte nun ein Markscheidezug gemacht werden um zu entscheiden, in welche Richtung das Ort weiterzutreiben sei. Luciae 1800 hatte man deshalb mit einem Umbruch begonnen und dabei 6 Ltr. vom Hauptstolln entfernt erneut einen Gang angefahren, der Hornstein und aufgelösten Gneis führte, Stunde 3,5 streicht und mit 30 Grad westl. recht flach fällt. Er war16 Zoll mächtig und brachte auch Wasser... (40014, Nr. 200, Film 0068) Reminiscere 1801 berichtete Herr Körbach dann (40014, Nr. 202, Film 0013): „Befand das Stollnflügelort bey 424 Lachter nördl. Länge vom Stollnmundloch herein mit 4 Mann zu 3/3teln belegt, war vom Stolln 15 Ltr. in Nordost erlengt und wurde in Quergestein Stunde 3,5 fernerweit betrieben. Hat müßen wegen Wettermangel, vom 3ten Lichtloch gegen 60 Ltr. zugemachtes Tragwerk nach dem Ort zu gemacht werden.“ Letzteres ist relativ einfach zu verstehen: Da es noch keine Lüfter und Sonderbewetterung gegeben hat, wurde das Laufwerk über der Wassersaige abgedichtet, so daß unterhalb ein „Wetterkanal“ entstand, in welchem das abfließende Wasser einen Sog erzeugte und Abwetter vor Ort abzogen. Oberhalb des Laufwerks strömten dann frische Wetter bis vor Ort nach. Die Lösung war bestimmt nicht sonderlich effektiv, half aber sehr beim Überleben... Auch Crucis 1801 fand der Geschworene den Stolln belegt und man betrieb den neuen Stollnflügel weiter, „den (?) Flachgang anzufahren.“ Aha: Welchen Flachen Gang ? Das ist neu... Reminiscere 1802 heißt es dann (40014, Nr. 202, Film 0066), das Flügelort vom Hauptstolln nach Nordost bei 54 Ltr. Entfernung vom 3. Lichtloch oder 452 Ltr. vom Mundloch war auf 31 Ltr. ausgelängt, stehe in sehr festem Hornstein und Gneis Gebirge, sei einstweilen aber eingestellt. Stattdessen hat man „das Flügelort bei 54 Ltr. vom 3ten Lichtloch in Abend, das von den Alten betrieben ist und zu Bruch lag, aufzugewältigen unternommen“, dieses war vom Hauptstolln aus bereits auf 12 Ltr. fahrbar und sollte weiter aufgewältigt werden, „um zu erfahren, ob von den Alten hier ein Kies Bau verlassen worden ist.“ Also hatten die Alten an dieser Stelle auch schon einen Umbruch begonnen, allerdings in die Gegenrichtung. Bis Crucis 1802 waren 38 Lachter Länge dieses östlichen Flügels gewältigt. Bis Reminiscere 1803 waren dann soger schon 471 Lachter Stollnlänge ab Mundloch fahrbar hergestellt (40014, Nr. 209, Film 0019). Crucis 1803 mußte man dann aber erst einmal die Zimmerung des 3. Lichtlochs auswechseln; wie Herr Körbach vermerkte, wollte der alte Bolzenschrot schon „zusammenbrechen, wahr höchst nöthig, in ganze Schrothzimmerung zu setzen.“ Die Gewältigung ging danach aber unverdrossen weiter...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1804 lobte Herr Körbach, daß nun
auch das oben genannte Flügelort bereits auf „52 Lachter
(Länge vom Hauptstolln aus) sehr brav hergestellt“ sei (40014,
Nr. 213, Film 0009).
Trinitatis 1804 wurde die Aufwältigung fortgesetzt. Dabei wurde nun ein in Stunde 9 streichendes und Süd fallendes, übersetzendes Eisensteinlager gefunden, wo „von Vorfahren das Stollnflügelort in Wünkel Creutz durch getrieben worden und ist die Mächtigkeit nicht zu bestimmen, führt Gneis, Quarz, rothe Letten und etwas aufgelöste Eisenerde.“ (40014, Nr. 213, Film 0020) Alles nicht wirklich verwertbares... So kam es schließlich wohl auch, daß die Sache abgebrochen wurde und Crucis 1804 fand Herr Körbach den Stolln unbelegt. Er traf sich mit dem Schichtmeister, der aber auch noch „auf weitere Resolution von der Gewerkschaft“ wartete (40014, Nr. 213, Film 0032). Daran änderte sich auch bis Luciae 1804 (40014, Nr. 213, Film 0054), in Reminiscere 1805 (40014, Nr. 232, Film 0004) in Trinitatis 1805 (40014, Nr. 232, Film 0015) und in Crucis 1805 nichts (40014, Nr. 232, Film 0028). Damit lag die Grube nun eigentlich schon ein volles Jahr in Fristen... Auch Luciae 1805 fand der Geschworene keine neue Situation vor (40014, Nr. 232, Film 0030). Seine Nachfolger im Amte, Friedrich August Schmid und Christian Friedrich Schmiedel, fanden ab 1806 jedenfalls keine Veranlassung mehr, diesem Stolln noch einen Besuch abzustatten (vgl. 40014, Nr. 233, 235, 236 und 245). Nur eine Formalie mußte am Ende noch erfolgen: Dazu ist Herr Schmiedel am 14. Juni 1808 „auf den Kirchen Stolln zu Raschau, weil (durch) die Gewerkschaft deßelben die Frist aufgekündigt worden ist, gefahren, und war jedoch selbiger zum 1ten Mal unbelegt.“ (40014, Nr. 236, Blatt 50f) Am 20. Juni 1808 „wurde die Freifahrung des zeither von der Gewerkschaft des Arsenikwerkes zu Geyer in Lehn gehabten Kirchen Stollns zu Raschau fortgesetzt und war jedoch derselbe zum 2ten Mal ebenfalls unbelegt.“ (40014, Nr. 236, Blatt 50f) Ach schau an: Jetzt erfahren wir ganz zum Schluß doch noch, wer denn die gleichermaßen langwierige, teure und dennoch ergebnislos gebliebene Aufwältigung des alten Stollns veranlaßt und finanziert hat... Eigentlich hätte Herr Schmiedel die Grube dreimal hintereinander unbelegt vorfinden müssen, um sie endgültig ins Bergfreie zurückfallen lassen zu können, aber eine dritte Eintragung hierzu haben wir in seinen Fahrbögen nicht gefunden. Es war wohl auch nicht mehr so wichtig... Eine Erwähnung des Stollns fanden wir noch aus dem Jahr 1810, als Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen auf Crucis des Jahres vermerkte, er sei am 14. August in Raschau zugegen gewesen, weil „einige Einwohner zu Raschau das Röhrwaßer des im freien liegenden Kirchenstollns gemuthet“ hätten (40014, Nr. 245, Film 0087). Tja ‒ die Zeichen der Zeit änderten sich und das Betriebs- und Brauchwasser war für die neue klein- und mittelständische Industrie wichtiger geworden, als das Silber...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach einer Grubenbefahrung am 28. April
1818 notierte Herr Schmiedel noch, er habe „in der Gegend
zwischen Schwarzbach und Langenberg einige Schurfarbeiten besehen, bey
welcher Gelegenheit ich denn auch wahrnahm, daß der Müller Meister Freytag
zu Raschau die, auf seinem Grund und Boden in der Nähe des dritten
Lichtlochs des Kirchenstollns liegenden alten Berghalden, theils einebnen,
theils wegschaffen lies, weshalb ich dem, in Gemäßheit der bereits früher
und neuerlich unterm 16.9.1809 ergangenen, allerhöchsten und hohen
Vorschriften, gedachten Grundbesitzer die eigenmächtig unternommene
Einebnung und Wegschaffung dieser Berghalden vor der Hand und so lange
nicht das deshalb Nöthige von dem Bergamte verfüget worden, sofort
untersaget habe.“ (40014, Nr. 259, Film 0037)
Bergmännische Arbeiten erfolgten hier seitdem nicht mehr. Herr Schmiedel hielt erst am 30. Mai 1821 wieder in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 264, Film 0057): „Zufolge bergamtlicher Anordnung haben die Besitzer der aus dem Kirchenstolln zu Raschau herauskommenden Wasser eine bedeutende Reparatur bey dem Mundloche sowie der Wassersaige bewerkstelligt. Solche wurde bey heutiger Besichtigung als gut und tüchtig befunden, so erfolgte nunmehr, auf der sämtlichen Interessenten Ansuchen, die gehörige und richtige Abtheilung besagter Stollnwaßer und wurde über diese Expedition besondere Anzeige bei Eu. wohllöbl. Bergamte eingereicht.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karl Stolln bei
Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob der Karl Stolln etwas mit Carls Glück bei Förstel zu tun hatte, oder aber ganz wo anders gelegen hat, ist uns noch nicht bekannt. Auffällig ist daneben, daß der Karl Stolln just dann aufgenommen wurde, nachdem der Kirchenstolln liegen geblieben ist. Der Berggeschworene Christian Friedrich Schmiedel berichtete jedenfalls in seinem Fahrbogen auf das Quartal Luciae 1807 darüber (40014, Nr. 235, Rückseite Blatt 131): Karl Stolln nebst Fdgr. bei Raschau betreffend. „Dieses zwar gemuthete, jedoch noch nicht bestätigte Fdgr. liegt bei dem Dorfe Raschau auf dem sogenannten Silber Emmler Gebirge und ist mit zwei Lehrhäuern belegt, durch welche auf einem unbenannten Stehenden Gang ein Tageschacht niedergebracht wird, und nunmehro eine Teufe von 3 Lachtern erreicht hat. Der Gang auf der Sohle desselben sowohl, als an den beiden Stößen ist 8 bis 12 Zoll mächtig und hat blaue Letten, Gneis, Quarz, Schwer- und Kalkspath zur Ausfüllungsmasse.“ Ähnlich, wie der Kirchenstolln auch, war hier jedenfalls nicht Eisen- und Manganerz Ziel der Unternehmung, was sicher auch der Verweis auf das „sogenannte Silber- Emmler- Gebirge“ unterstrich. Auch Reminiscere 1808 wird der Stolln ‒ eigentlich ist bislang nur von einem Tageschacht die Rede ‒ von Herrn Schmiedel begutachtet und darüber festgehalten (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 2f): Karl Stolln nebst Sophien Fundgrube, ebenfalls zu Raschau, anlangend. „Durch 2 Mann wird auf diesem von einigen Eigenlehnern neuerlich aufgenommenen Berggebäude auf dem Sophie stehenden Gangen ein Tageschacht niedergebracht, welcher nunmehr eine Teufe von 3¼ Lachter erreicht hat. Der Gang auf der Sohle desselben sowohl als an dem südlichen Stoß hat 6 bis 9 Zoll, an dem nördlichen Stoß aber 8 bis 12 Zoll Mächtigkeit und führt blauen Letten, aufgelösten Gneis, Quarz, Schwer- und Kalkspath.“ Na immerhin haben nun auch der untersuchte Gang und die Fundgrube einen schönen Namen erhalten. Freilich ging es nur schleppend voran. Auch wenn gerade Winter herrschte, so hatte man doch den Tageschacht binnen des abgelaufenen Quartals gerade einmal um einen halben Meter verteuft. Bis zur nächsten Befahrung am 1. März 1808 war der Tageschacht wieder nur einen halben Meter weiter abgesenkt (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 18). Weitere Erwähnungen in den Fahrbögen der Berggeschworenen gibt es nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antonius Stolln bei
Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stattdessen taucht 1810 mit dem
Antonius Stolln zu Raschau noch ein neuer Name auf. Er wurde von dem Steiger Christian Gottlob
Neuberth am 7. Januar dieses Jahres gemutet und vor der Verleihung
durch den Geschworenen
Schmiedel besichtigt, worüber letzterer am 12. Februar an das Bergamt
berichtete (40169, Nr. 19, Blatt 1ff), daß
dieser Stolln „seit etlichen 30 Jahren im Freyen“ gelegen habe und
selbst der frühere Name ihm nicht mehr bekannt sei. Das zugemauerte
Mundloch fand Herr Schmiedel „ungefähr 200 Lachter vom
Kirchenstolln gegen Morgen“ auf Karl Gottlob Neuberths Grund
und Boden und „40 Lachter vom Dorfbach gegen Mitternacht am Fuße des
nach dieser Weltgegend sanft ansteigenden, sogenannten Silber Emmler
Gebirges angesetzt.“ Etwas weiter heißt es noch, daß in etwa 40
Lachter abendlicher Entfernung auch der „außerordentlich freundlich
beschaffene Sophia Stehende liegt, wo sich vor einigen Jahren einige
Eigenlehner eingelegt und einen Schacht geteuft haben.“ Da wir
ziemlich sicher wissen, wo der Kirchenstolln ansetzte, geben uns
diese Angaben diesmal genauere Hinweise, nicht nur, wo der Antonius
Stolln, sondern auch, wo der Karl Stolln nebst Sophia Fundgrube
gelegen haben müßten.
In seiner Anzeige vom 12. Februar 1810 berichtete der Geschworene dann weiter, daß er „Personen“ befragt habe (die anscheinend mehr über diesen Stolln wußten) und diese ihm daraufhin erzählt hätten, der Stolln sei auf einem stehenden Gang 30 Lachter gegen Mitternacht getrieben und bei 20 Lachter ein „sehr freundlicher“ Spatgang überfahren worden, auf dem man weitere 25 bis 30 Lachter gegen Abend ausgelängt habe. Namentlich der 4 bis 6 Zoll mächtige Spatgang habe Schwärze geführt, welche bis zu 5 Loth Silber im Zentner enthalten haben soll. Wohl aus diesem Grund fand auch Herr Schmiedel es sehr angeraten, diesen Stolln wieder aufzunehmen und das „sehr hoffnungsvolle Gebirge“ in größerer Teufe aufzuschließen. Ein Vermerk über die stattgefundene Verleihung fehlt zwar in der Grubenakte, doch wird diese erfolgt sein, wie man in den Fahrbögen Herrn Schmiedel's auf Reminiscere 1810 darüber lesen kann (40014, Nr. 245, Film 0031): Am 16. März 1810 habe er „den seit mehreren Jahren im Freien gelegenen, neuerlich aber unter dem Namen Antonius Stolln zu Raschau wieder gemutheten und ganz kürzlich bestätigten Stolln befahren, ein von den Vorfahren stehendgangweise gegen Mitternacht in das sogenannte Silberemmlergebirge getrieben“, diesen Stolln mit 3 Mann belegt befunden, welche freilich erst einmal das verbrochene Mundloch wieder aufgewältigen. Trinitatis 1810 notierte der Berggeschworene dann über den Antonius Stolln (40014, Nr. 245, Film 0049), daß die 3 Mann Belegschaft nun den „einigermaßen zu Bruche liegenden tiefen Stolln“ wieder aufgewältigen und damit bei 16 Lachtern Länge vom Mundloch angekommen waren. Ferner heißt es im Fahrbogen: „Der Gang, der dermalen an der Förste sichtbar ist, besteht bei 6 bis 8 Zoll Mächtigkeit aus blauen Letten, Gneis, Quarz und Kalkspath.“ Auch bei diesem Unternehmen ging es offenbar nicht um Eisen- und Manganerz, sondern um edlere Metalle... Herr Schmiedel fand aber noch die folgende Veranstaltung vonnöten: „Da dieser Stolln in der bereits aufgewältigten Länge und, wie es scheint, auch fernerhin genugsame Weitung hat, so habe ich, um eine wohlfeile Förderung zu bekommen, angeordnet, daß sofort die zeitherige Karrnförderung mit einem 4 Kübel á 2.500 Kubikzoll faßenden, großen Hunte vertauscht werden soll.“ Deswegen findet man hierzu auch einen Fahrbogenauszug in der Grubenakte, nach welchem man im Bergamt Annaberg diese Anweisung des Geschworenen am 23. Mai 1810 bestätigte (40169, Nr. 19, Blatt 5). Und außerdem notierte er noch: „Nach beendigter Befahrung habe ich noch einige auf Mittweidaer Fluren gangbare Schurfarbeiten besehen.“ Im Fahrbogen vom 29. Juni 1810 ‒ nur unwesentlich später ‒ lesen wir dann (40014, Nr. 245, Film 0069): „Antonius Stolln zu Raschau betr. Belegung. Dieses Berggebäude ist mit 3 Mann, als 1 Versorger, 1 Häuer und 1 Jungen belegt, durch welche Aufwältigung eines alten Stollns. nebst einigen Mitgewerken, welche den Beitrag ihrer quartaligen Zubuße selbst abarbeiten, der in das Silberemmlergebirge auf einem stehenden Gang gegen Mitternacht getriebene, vorjetzo einigermaßen zu Bruche liegende tiefe Stolln wiederum, in der Absicht, aufgewältigt wird, um bei weiterem Forttrieb deßelben hauptsächlich die vorliegenden, auf dem Berggebäude St. Catharina im Schneeberger Bergamts Refier als edel bekannten und bebauten Flachengänge, nämlich Gottes Seegen machet reich und St. Katharina Flacher, zu überfahren...“ Hier stimmt etwas nicht: Wenn dieser Antonius Stolln ,gegen Mitternacht in das sogenannte Silberemmlergebirge' getrieben war, dann muß dieser Stolln an dessen Südseite gelegen haben. Hier ist aber nun vom ,Schneeberger Bergamtsrefier' die Rede und der Katharina Flache im Schneeberger Revier durchzieht gewiß nicht den Emmler, sondern den Ostabhang des Graul, also den nördlichen Gegenhang des Schwarzbachtals, dort, wo es zum Roten Hahn hinaufgeht und die Gruben St. Katharina und Stamm Asser gebaut haben. Vielleicht hat es also zwei Stolln unter diesem Namen gegeben ? Ja, hat es, denn an dieser Stelle fällt uns doch ein, daß der Kirchenstolln ja auch Catharinaer Stolln genannt worden ist ‒ um diesen also ging es hier...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die zu diesem Stolln vorhandene
Grubenakte verrät uns zum Fortgang der Geschichte, daß man mit der
Gewältigung des Hauptstollnortes, welches zuletzt auf einem
Morgengangweise streichenden Gang nach Nordosten getrieben war, bis Januar
1811 bei 52 Lachter Entfernung vom Mundloch ganzes Ort vorgefunden hatte.
Neun Lachter von diesem zurück war auf einem stehenden Gang ein Flügelort
nach Nord angehauen, das aber noch mit Bergen versetzt war
(40169, Nr. 19, Blatt 6). Bis
zur nächsten Befahrung durch Herrn Schmiedel am 30. März 1811 war
auch das Flügelort geräumt und man stand auch mit diesem bei 30½ Lachter
Entfernung vom Streckenkreuz vor der Ortsbrust. Weil der Gang dort zwar 6
Zoll mächtig war, aber nur Letten, Quarz und Hornstein führte, hatte man
das Hauptstollnort wieder aufgenommen (40169,
Nr. 19, Blatt 8). Bis zur
Befahrung durch den Geschworenen am 23. November 1811 hatte man es um 4¼ Lachter fortgestellt und hier den Gang mit 10 bis 14 Zoll Mächtigkeit
gefunden und aus Letten, Quarz, Schwefelkies und „silbergehalt
versprechender Schwärze“ bestehend gefunden
(40169, Nr. 19, Blatt 9).
Bis zur amtlichen Grubenbefahrung durch das Bergamt Scheibenberg Reminiscere 1812 hatte man auch Proben davon untersucht und tatsächlich einen, wenn auch nicht sehr hohen Gehalt von 1 bis ½ Loth Silber darin gefunden. Der Hauptstolln hatte inzwischen eine Länge von 62 Lachtern erreicht, doch fehlten nach Risseinsicht noch wenigstens 120 Lachter bis zum Überfahren des Katharina und des Gottes Segen macht reich Flachen (40169, Nr. 19, Blatt 10). Die nächste in der Akte dokumentierte Befahrung durch Bergmeister von Zedtwitz und Geschworenen Schmiedel ist erst am 7. Oktober 1819 erfolgt. Die Grube war jetzt mit 1 Steiger und 1 Häuer belegt und das Hauptstollnort inzwischen 159⅛ Lachter ausgelängt (40169, Nr. 19, Blatt 13). Am 21. November 1820 stellte dann der Grubenvorstand, nämlich Schichtmeister Christian Gottlob Neuberth und Steiger Carl August Vulturius, Antrag auf Vorschuß für den weiteren Stollnforttrieb. Wie man hieraus erfährt, war zumindest ein Teil der Kuxe vergewerkt, doch gingen im Jahr nur 256 Thaler an Zubußen ein. Der Vortrieb war verdingt, und zwar zu 8 bis 10 Thaler der Lachter (40169, Nr. 19, Blatt 15ff). Der Vorschuß in Höhe von 150 Thaler für das Jahr 1821 wurde auch gnädigst bewilligt und aus der Schurfgelderkasse des Bergamts gezahlt, welcher ‒ freilich nur im Falle des Erfolgs ‒ durch eine Restitution in Höhe von 1 Thaler pro Mark ausgebrachten Silbers und 1 Groschen, 6 Pfennigen pro Thaler Einnahmen aus Kobalterzverkauf zurückzuzahlen war (40169, Nr. 19, Blatt 19ff). Bis Februar 1822 hatte man mit dieser Unterstützung den Stolln auf 1785/16 Lachter Länge (zirka 356,6 m) fortgebracht. Für das Jahr 1822 beantragte der Grubenvorstand wieder einen Zuschuß in Höhe von 100 Thalern, welcher aufgrund der immer noch ungebrochenen Hoffnung, auf Silberanbrüche zu stoßen, auch wieder gewährt worden ist (40169, Nr. 19, Blatt 22f und Blatt 26ff). Bis zur Befahrung durch Geschworenen Schmiedel im März 1822 hatte man den Stolln dann schon auf 18213/16 Lachter Länge (zirka 365,6 m) fortgebracht (40169, Nr. 19, Blatt 24). Auch für das Jahr 1824 gab es noch einmal 100 Thaler Zuschuß. Ende diesen Jahres hatte der Stolln 2153/16 Lachter (zirka 430,4 m) und bis Ende 1825 eine Länge von 2199/16 Lachter (zirka 439,1 m) erreicht (40169, Nr. 19, Blatt 35). Dann berichtete der inzwischen zuständige Geschworene Gebler am 13. Juli 1826 im Bergamt Annaberg, daß am 29. Mai 1826 Raschau eine „ganz außerordentliche Fluth“ betroffen habe, wodurch nicht nur das Mundloch ganz mit Sand und Geröll verschüttet, sondern auch der Stolln auf 30 Lachter Länge vom Mundloch herein bis zu einem ¾ Lachter hoch verschlammt worden ist und für den Moment außer Betrieb gesetzt werden mußte (40169, Nr. 19, Blatt 37). Man rappelte sich aber noch einmal auf. Bis Ende 1826 hatte man alles in Ordnung gebracht und das Stollnort noch bis auf 22211/16 Lachter Länge (zirka 445,4 m) oder um 3⅛ Lachter ausgelängt (40169, Nr. 19, Blatt 39). Im ganzen Jahr 1827 waren es dann nur noch 15/8 Lachter Vortrieb (40169, Nr. 19, Blatt 42) und für die folgenden Jahre 1828 und 1829 berichtete der Schichtmeister, daß man wegen „Mangel an Kräften“ nur die wandelbar gewordene Zimmerung in Stand gehalten habe (40169, Nr. 19, Blatt 44ff). Da nur noch 47½ der 128 Kuxe vergewerkt waren und die Zubußen einfach für mehr nicht ausreichten, sagte schließlich der Schichtmeister die Grube los, was man am 31. März 1832 in Annaberg protokollierte (40169, Nr. 19, Rückseite Blatt 48).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach 22 Jahren, wenn auch schwachem,
doch kontinuierlichem Betrieb und nachdem der Stolln vom vorherigen Stand
um weitere mehr als 340 m ‒ freilich auch, ohne bauwürdige Anbrüche
anzutreffen ‒ aufgefahren worden ist, endete damit die Geschichte dieser
Grube, doch tauchte im Jahr 1851 ihr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junger Johannes und Junge Gesellschaft Fundgrube bei Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Grube namens Junge Gesellschaft wird in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22 und 26) im Zeitraum von 1828 bis 1837 aufgeführt. Nach den Angaben in diesen Quellen wurden hier in dieser Zeit knapp 18,5 t Braunstein und knapp 100 t Eisenstein ausgebracht. Laut der zur Grube gehörigen Bergamtsakte wurde sie von Carl Heinrich Wendler zu Raschau und Konsortschaft am 10. Februar 1828 gemutet und diesem am 8. Juli 1828 auf Eisen- und Braunstein bestätigt (40169, Nr. 176, Blatt 1, Abschrift in 40014, Nr. 270, Blatt 69ff). Der Bestätigung zufolge lag das Grubenfeld „im Raschauer Pfarrwald 30 Schritte östlich von dem Raschau führenden Wege und 120 Schritte nördlich von der Emmlerstraße.“ Auch auf der folgenden Croquis aus späterer Zeit ist oben am Emmlerweg, an dessen Nordseite und unterhalb der Emmlerhöhe, ein Tageschacht mit diesem Namen bezeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der obige Grundriß zeigt aber auch, daß
das Gelände unterhalb der Emmlerhöhe schon 1839 von zahlreichen Halden und
Pingen geprägt gewesen ist.
In den Protokollen über Mutungen und Verleihungen des Bergamtes Scheibenberg haben wir einige Vorläufer der Jungen Gesellschaft finden können: Bereits am 21. März 1781 erhielt Schichtmeister Christian Friedrich Teubner zum besten von Hannß Heinrich von Elterlein einen Stolln samt einer Fundgrube und (einer ?) obern, auch ersten, anderen unteren Maaß auf Eisenstein „auf Esche's Feld zu Raschau, genannt solche Johannis. Ferner ist zu bemerken, daß nach dem dieser gemuthete Gang sich nach angestelltem Bau als ein Flöz eingerichtet, auch der Hr. Schichtmeister Teubner heut, den 30. Juny 1781 allhier zu St. Annaberg bey gewöhnlicher Bergamts Session solches Feld anderweit als gevierdtes Feld bestätigt und zwar eine gevierte Fundgrube also gestrecken, daß der neue Tageschacht im Mittel der gev. Fundgrube stehet, nebst einer gev. Maaß gegen SE. und einer gev. Maaß gegen ME.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 88) Am 1. September 1787 erhielt Christian Friedrich Teubner erneut eine Fundgrube verliehen „auf einem Stunde 12,6 streichenden und gegen Morgen fallenden, 6 bis 8 Zoll mächtigen Eisensteingang, welcher auf Raschauer Fluren auf Carl Gottlob Esches Grund und Boden aufsetzt und bey der Bestätigung Junger St. Johannis benannt worden. Das Anhalten der Fdgr. soll in einem Tageschacht, welcher ohngefähr 40 Ltr. von dem Mundloche des zu diesem schon ehedem eigenlöhnerweise getriebenen Gebäude gehörigen Stollns gegen SO. entfernt liegt, genommen werden.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 105) Mit ähnlicher Ortsangabe – auf Esche’s Grund – mutete nur zwei Jahre später, am 11. Oktober 1789, Carl Heinrich von Elterlein wieder eine gevierte Fundgrube auf Eisenstein, auch alle anderen Metalle und Mineralien, „auf einem Stunde 1,4 streichenden gegen O. fallenden Eisensteinlager, welches auf Raschauer Fluren und zwar auf Carl Eschens und Benjamin Fickers Grund und Boden aufsetzt, (und ist am 28. November) unter dem Namen Junger St. Johannes bergüblicherweise bestätigt und verliehen worden.“ (40014, Nr. 43, Blatt 130) Hierzu erhielt er am 7. Januar 1790 noch „den bisher im Freyen gelegenen Jungen St. Johannis Stolln auf Johann Heinrich Weigels Erbgüthern zu Raschau angesetzet...“ verliehen (40014, Nr. 43, Blatt 132f). Am 8. April 1824 mutete dann Carl August Herrmann und Konsortschaft eine Fundgrube unter dem Namen Junger Johannes und der Fahrbericht des Berggeschworenen Johann August Karl Gebler dazu sagt aus, daß diese erneut in derselben Gegend gelegen hat. In dem Fahrbericht heißt es nämlich, sie läge „im Raschauer Pfarrwalde unmittelbar da, wo der von Langenberg nach Raschau führende Kirchweg und der eben dahin von dem Grubengebäude St. Katharina herankommende Anfahrweg am Saume des Pfarrwaldes (...) nahe bey der Silber Emmler Straße und zwar ganz in der Nähe der von genannter Straße berührten oberen Halde des ehemaligen Kirchenstollns zusammenführen,“ womit wohl dessen drittes Lichtloch gemeint war (40014, Nr. 270, Blatt 29ff). Das hilft uns wesentlich besser, die Grube zu lokalisieren, weil wir nicht wissen, wo Carl Esche’s und Benjamin Ficker’s Grund seinerzeit gelegen hat. Fahrberichte zum Grubenbetrieb aus diesen ersten Betriebsphasen gibt es leider nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine erneute Verleihung wurde dann am
3. Juli 1828 im Lehnbuch des Bergamts Scheibenberg eingetragen, diesmal
zugunsten des Muters Karl Heinrich Wendler und Konsorten aus
Raschau. Die Lage auf einem im Raschau'er Pfarrwalde erschürften
Eisenstein- und Braunsteinlager wird „an dem südlichen Ende desselben
(Waldes) und zwar links an dem von Langenberg durch denselben nach
Raschau führenden Wege, 30 Schritte von demselben östlich und von dem
Puncte, wo solcher Weg in die Emmler Straße einmündet, 140 Schritte
nordöstlich“ angegeben (40014, Nr. 43, Blatt
313).
In den Fahrbögen des zu dieser Zeit amtierenden Berggeschworenen in Scheibenberg, Johann August Karl Gebler, wird die Grube Junge Gesellschaft am 28. November 1831 erstmals aufgeführt, als dieser hier 18 Fuder Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 281, Film 0074). In den drei Jahren zuvor hat die Grube, den Erzlieferungsextrakten zufolge, ausschließlich Braunstein gefördert. Im folgenden Jahr 1832 war der Geschworene am 24. Juli und am 5. Oktober hier zugegen, um insgesamt 33 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 281, Film 0134 und 0149). Beide Zahlen weichen von den Angaben in den Erzlieferungsextrakten ab, indem dort für 1831 eine Menge von 13 Fudern, für 1832 dagegen von 52 Fudern genannt ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die jetzigen Eigner dieser Grube hatten
offenkundig in der Erwartung reicher Ausbeute größere Pläne. Herr Gebler notierte nämlich am
1. März 1833 in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 281, Film 0171f),
er habe sich an diesem Tag „in dem Dorfe Mittweyda ohnfern des
Pökelguthes diejenige, an dem linken Ufer des Mittweydaer Wassers
gelegene, völlig wüste und unkultivierte Stelle besichtigt, welche man
seitens der Eigenlöhner von Junge Gesellschaft im Raschauer Communwalde
gemuthet und zu Erbauung eines benutzbaren Braunstein- Pochwerks bestimmt
hat.“
Die ersten Anbrüche müssen also sehr vielversprechend gewesen sein. Da Herr Gebler bereits mehrfach Streit mit dem Grundbesitzer, Herrn Carl Edler von Querfurth auf Förstel hinter sich hatte und dieser zu jener Zeit auch das Pökelgut besaß, wies er aber auch gleich darauf hin: „Da nun vorallererst die Unternehmer mit dem Grundbesitzer, dem Herrn Rittmeister von Querfurth wegen Überlassung des angegebenen Platzes und besonders in Betreff des Preises dafür sich zu vernehmen haben, solches aber wegen immerwährender Abwesenheit desselben und seines in der Entfernung liegenden Wohnplatzes halber zur Zeit noch nicht geschehen können, so stehen vorerst die Resultate dieser Verhandlungen zu erwarten.“ Ja, Herr von Querfurth war ja inzwischen auf den Schönheider Hammer an der Zwickauer Mulde umgezogen und hatte das Pokelgut verpachtet. Vielleicht, weil es ihm in Anbetracht des ausgedehnten Reviers, das er zu betreuen hatte, zu aufwendig wurde, auf jede einzelne Grube zu fahren, um dort vielerorts nur ein paar Zentner Braunstein zu verwiegen, schrieb er außerdem noch nieder: „Übrigens finde ich mich zu dem Wunsche veranlaßt, es möge die hier beabsichtigte Erbauung des gedachten Pochwerks deshalb zu Stande kommen, weil dasselbe zugleich fortdauernd für Wiegen und Auflegen des gewonnenen und zum Verkauf bestimmten Braunsteins, seiner sehr glücklichen Lage wegen, die überaus wohl bestens Gelegenheit darböthe, auch in Bezug auf mehrere andere Eigenlöhnergruben der dasigen Reviere, besonders auch der zur Abfuhr so sehr bequemen Fahrwege äußerst willkommen, den Abnehmern und Fuhrleuten gefunden werden würde. Im Fall nur die Erbauung dieses Pochwerkes zu Stande kommen sollte, dürfte die Bestätigung der fraglichen Stelle vielleicht von der Bedingung mit abhängig zu machen seyn: daß in demselben ein Behältnis zur Vollbringung des Wiegens, ingleichen zur Auflagerung des gewogenen (?) anzubauen seyn sollte, wogegen aber von Seiten eines königl. Bergamtes für die Anschaffung einer Waage nebst Gewichten Sorge zu tragen seyn möchte.“ Herr Gebler trug die Angelegenheit auch bei der Bergamtssitzung am 30. März 1833 in Annaberg vor. Vorausschauend meinte man dort aber, man wolle die diesfallsigen Anträge des Eigenlöhners abwarten und dann Weiteres entscheiden (40169, Nr. 176, Blatt 2). Das war aber dann auch schon wieder die einzige Erwähnung dieser Grube in den Fahrbögen von Herrn Gebler im Jahr 1833... Ob es zum Bau eines Pochwerkes wirklich gekommen ist, darf bezweifelt werden. Die Sache mit der zentral gelegenen Braunsteinwaage fand dagegen etliche Jahre später noch einmal Erwähnung: Der Annaberg'er Rezeßschreiber Lippmann, welcher dazumal den eigentlich amtierenden Berggeschworenen Haupt vertrat, nämlich hielt in seinem Fahrbogen nach seiner Befahrung von Riedels Fdgr. am 22. Juni 1842 fest (40014, Nr. 321, Film 0048f): „Ich muß hierbei bemerken, daß sämmtliche auf Braunstein bauende Eigenlöhner es schmerzlich bedauern, auf die vom Königl. Bergamte schon vor längerer Zeit für die Refier projectirte Anlage einer Braunsteinverkaufsanstalt nicht eingegangen zu seyn, und daß sie es durchgängig als eine Wohlthat anerkennen würden, wenn das Kgl. Bergamt sich gemüßigt sähe, diesen Plan wieder aufzufassen und zu realisiren.“ Die Sache war demnach wohl am Widerstand der einzelnen Eigenlöhner gescheitert... Das spätere Bedauern half aber nichts ‒ zur Einrichtung einer solchen Waage- und ,Verkaufsanstalt' ist es nie gekommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Jahr 1834 gibt es wieder nur drei
Erwähnungen der Junge Gesellschaft Fundgrube in den Fahrbögen des Herrn Gebler über
seine Anwesenheit dort, um jeweils zwischen 12 und 24 Fuder ausgebrachten Eisensteins,
in Summe über das gesamte Jahr 1834 diesmal 36 Fuder, 2 Tonnen, zu
vermessen (40014, Nr. 289, Film 0007, 0033 und 0066).
Grubenbefahrungen sind auch in diesem Jahr nicht dokumentiert.
Auch im Jahr 1835 war der Geschworene nur ein einziges Mal auf dieser Grube, um am 6. April hier 16 Fuder, 3 Tonnen Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 289, Film 0082). In den nachfolgenden Jahren bis Trinitatis 1838 ist sie in seinen Fahrbögen nicht mehr erwähnt. Am 4. Januar 1838 sagte der Lehnträger Wendler die Grube wieder los (40169, Nr. 176, Blatt 3 und 40014, Nr. 43, Blatt 313). Der Raschau'er Obersteiger Schubert meldete dann im Juli 1838, daß auf der Grube noch 8 Fuder Eisenstein vorrätig lägen, was auf der Bergamtssitzung am 5. Juli in Annaberg protokolliert worden ist (40169, Nr. 176, Rückseite Blatt 5). Das Bergamt beauftragte daraufhin den Obersteiger mit dem Verkauf. Die Einnahme solle er bis auf Weiteres „ad depositum“ bringen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur selben Zeit gab es aber noch eine weitere Grube gleichen
Namens in Raschau ‒ der Täufer scheint ein beliebter Namenspatron unter
den Raschau'er Bergleuten gewesen zu sein. Über diese Grube sind wir
allerdings erst in Zusammenhang mit Recherchen zu einem anderen
„Vom königl. Justizamte Grünhain war ein von August Friedrich Liebegott Scherfig in Raschau unterm 9ten März d. J. an die hohe Kreisdirektion zu Zwickau gerichtetes (...) Gesuch zur Begutachtung (zugefertigt) worden, worinnen ernannter Scherfig um Concession zu Anlegung einer Steingutfabrik in seinem Wohnorte und ein Privilegium auf 12 Jahre nachgesucht hatte, indem derselbe die bei seinem Eisensteinbergbau in Scheibenberger Bergamtsrefier zu gewinnende, angeblich thonartige Erde dazu zu benutzen beabsichtige. Erhaltenem Auftrag zu Folge hatte nun Herr Geschworener Gebler die nöthige Erörterung an Ort und Stelle vorgenommen und dem Bergamte Relation darüber abgestattet, wonach sich denn ergeben hat, daß der Schurf, in welchem Scherfig die fragliche Erde gefunden hat, auf des Grundbesitzers und Gasthof Eigenthümers Karl Heinrich Escher in Raschau Feldern, ohngefähr 200 Lr. hinter dessen Haus (...) gegen Mittag das Gebirge hinauf, ein wenig rechts von dem, von letzterer Behausung dorthin führenden Feldwege liegt. Scherfig hat daselbst zu Erschürfung von Eisenstein ein Schächtchen von 4 Lr. niedergebracht und daselbst bei 2½ Lachter und 3 Lachter Teufe in dem aufgelösten Gesteine zwei bis drei, ohngefähr in Stunde 6 streichende, gegen Mittag oder Mittag Morgen fallende, etwa 2 Zoll mächtige Streifen weißer, jedoch etwas unreiner, insonderheit mehr und weniger mit Eisenocker gemengter Erde getroffen, welche sich nicht in zusammenhängender Masse, sondern nur als Reihe einer Anzahl nicht zusammenhängender Nester gewinnen lassen und für nichts anderes als für Porzellanerde zu erkennen gewesen ist, wie auch mit übergebene Proben dem Bergamte dargetan. Es scheint dies ein ähnliches Zusammenvorkommen der Porzellanerde mit Eisenstein, wie in Brünlaßholze bei Scheibenberg und bei Elterlein zu sein; indem sich auch hier in den nahe dabei liegenden, alten Halden von einer früheren Eisensteinzeche Stücke von vorzüglich gutem, schwarzbraunem Eisenstein vorfinden. Von dieser vorkommenden weißen Erde dürfte aber, so lange sich solche sich nicht mächtiger und überhaupt reiner zeigt, ein vortheilhafter Gebrauch nicht zu machen sein, doch soll mündlicher Tradition zu Folge von diesem Puncte bei noch etwa 5 Lr. mehrer Teufe ein mehrer Fuß mächtiges Lager sich befinden und bei dem früheren Eisensteinbergbau daselbst bekannt worden sein. Alle diese Umstände sowohl, als daß die Porzellanerde von allem und jedem Privatverkehr evimirt und zum Besten für die Porzellanfabrik zu Meißen vom hohen Staatsfiskus sich vorbehalten sei, sind dem ernannten Justizamte mitgetheilt, sowie auch Scherfig dessen belehrt worden und wird man auch nicht verfehlen, dann, wann durch Scherfig oder sonst das erwähnte Porzellanerdelager bauwürdig ausgerichtet werden sollte, die Administration der Meißner Porzellanfabrik davon in Kenntnis zu setzen.“ Wie man hier liest, lag diese Grube allerdings am südlichen Hang des Mittweidatales ‒ ,gegen Mittag (also nach Süden) das Gebirge hinauf', also der bisher betrachteten Grube Junger Johannes genau gegenüber... Bevor man eine Entscheidung fällen wollte, verlangte man seitens des Finanzministeriums zu Dresden aber unter dem 5. Juli 1836, das Gutachten solle „vermehrt“ werden, insbesondere „mit Rücksicht auf die nach der Verfügung vom 20. Juni d. J. wegen der Regalität der Porzellanerde überhaupt anzunehmenden Prinzipien“ – womit ein langes Gutachten von Johann Carl Freiesleben in Bezug auf staatliche Vorbehalte über Lagerstätten der Porzellanerde in Zusammenhang mit einem ähnlichen Gesuch eines Herrn Leyhe aus Pirna gemeint war (40001, Nr. 2971, Blatt 19ff). Daraufhin berichteten Bergmeister Julius Bernhard von Fromberg, Geschworener Friedrich Wilhelm Schiefer und August Chrisian Matthesius aus Annaberg schließlich unter dem 20. Oktober 1836 noch einmal ausführlicher nach Freiberg (40001, Nr. 2971, Blatt 38ff). In diesem Bericht heißt es, der Schacht war Wettermangels halber längere Zeit nicht belegt, konnte aber dann am 6. Oktober durch Bergmeister Fromberg und Geschworenen Gebler befahren werden, auch habe man über früher dort umgegangen Bergbau nachgeforscht, „worüber aber in den bergamtlichen Akten keine Nachweisung aufzufinden ist“, und besagter Schacht des Eigenlehners Scherfig läge 700 Schritt südlich der Raschau'er Kirche. Irgendetwas scheint man aber doch in den Bergamtsakten gefunden zu haben, denn einige Zeilen weiter liest man dann: „Mit besagtem Schachte hat man im Tiefsten alte Zimmerung getroffen und befindet man sich ziemlich in der Sohle des zu dem früheren dasigen Eisensteinbergbau gehörig gewesenen Stollns, fol.15 Junger Johannes Stolln genannt...“ Man habe den Eigenlehner angewiesen, aus dem Schacht heraus ein Versuchsort in Richtung des vermuteten Erdelagers zu treiben. Wenn sich die Erde als brauchbar und das Vorkommen als nachhaltig erweise, so könne man zwar dessen Gebrauch Scherfig unter Verweis auf die bisherigen Mandate des Fürstenhauses über das Verbot privaten Verkaufs der Porzellanerde nicht freigeben, doch wagte man vorzuschlagen, die Meißen'er Porzellanmanufaktur könne das Material ja aufkaufen, wodurch auch Scherfig „einiger Absatz gesichert werde“. Nachdem seinerseits das Oberbergamt diese Stellungnahme am 9. November 1836 nach Dresden gesandt hatte, beschied das Königliche Finanzministerium am 12. April 1837, nachdem die beigegebenen Proben auch in Meißen untersucht worden waren, da sich das Material „für die Manufaktur als unbrauchbar erwiesen habe, werde von deren Seiten eine Anspruch gegenüber dem Grubenbesitzer nicht gemacht“ ‒ diesem wurde also auch die Verwendung des Tons solange freigestellt, „als nicht eine reinere und constante Weißerden Lagerstätte an dem fraglichen Puncte ausgerichtet werde,“ was dann gegebenenfalls natürlich wieder anher anzuzeigen sei (40001, Nr. 2971, Blatt 56). Weiteren Schriftverkehr fanden wir dazu bisher nicht, weswegen wohl ziemlich sicher davon auszugehen ist, daß es nie zu einer Steingutfabrik in Raschau gekommen ist, weil das Vorkommen einfach nicht bauwürdig gewesen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach einer Lücke von sechs Quartalen in den überlieferten Fahrbögen wurde dann bekanntlich Reminiscere 1840 Herr Theodor Haupt mit der Funktion des Berggeschworenen in Scheibenberg betraut (40014, Nr. 300). Derselbe war bis zum Herbst 1840 aber noch nicht auf der Junge Gesellschaft Fdgr. Wie schon mehrfach zu lesen war, wurde er danach zunächst für ein reichliches Vierteljahr mit anderen Aufgaben versehen. In dieser Zeit nahm der Crandorf'er Schichtmeister Friedrich Wilhelm Schubert die Funktion des Geschworenen wahr. Letzterer nun war am 5. Oktober 1840 erneut hier und „refitirte (revidierte) den Eisenstein (Vorrat...?) bei Junge Gesellschaft gev. Fdgr im ehemaligen Pfarrwalde zu Raschau, hiervon ist zu (bemerken...?), daß das Auskutten dieser Eisensteine kaum die Kosten trägt, demnach zur Deckung des hieraus gewesenen Ersatzes und resp. Kosten nicht viel heraus zu kommen schien.“ (40014, Nr. 300, Film 0113f) Bis dahin ist offenbar ein Verkauf nicht zustande gekommen. Einem weiteren Bergamtsprotokoll zufolge hat dann der Steiger Carl August Gebler (der vormalige Geschworene Gebler hatte in der Zwischenzeit die Stellung gewechselt) von Wilkauer vereinigt Feld angezeigt, er habe nunmehr veranlaßt, den noch vorrätigen Eisenstein auf Wendler's Kosten auskutten zu lassen, allein die Kosten überstiegen den Nutzen: Nach 10 Schichten habe man gerade einmal 1 Fuder brauchbaren Eisensteins gewonnen. Er werde die Menge verkaufen, diese Arbeit aber wieder einstellen (40169, Nr. 146, Blatt 6). Befahrungen dieser Grube durch die Geschworenen sind danach nicht mehr dokumentiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zehn Jahre später, am 17. Dezember
1851, wurde dann dem Bergarbeiter Christian Ludwig Kautzsch aus
Raschau unter dem früheren Namen erneut eine gevierte Fundgrube „auf
Löffler's Erbgut“ auf Eisen- und Braunstein bestätigt (40169, Nr. 176, Blatt 7).
Ein Herr Kautzsch war im gleichen Jahr am
Bereits aus dem Jahr 1850 stammt auch ein Entwurf für ein Braunsteinpochwerk „zu Raschau.“ Wir wissen zwar nicht genau, ob dieses nun doch an dem schon 1833 durch die Junge Gesellschaft Fdgr. gemuteten Platz errichtet werden sollte, vermuten aber, daß die Pläne aus dem Jahr 1833 noch nicht vom Tisch waren und nun vielleicht doch umgesetzt werden sollten. Viel geschehen sein dürfte danach aber hier eher doch nicht, denn Herr Kautzsch sagte die Grube nur zwei Jahre später, am 5. Dezember 1853, wieder los (40169, Nr. 176, Rückseite Blatt 7). Einnahmen hatte er wohl auch nicht davon, denn er bat zugleich mit der Lossagung um den Erlaß noch ausstehender Bergamtsgebühren in Höhe von 12 Thalern, 13 Groschen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damit war aber immer noch nicht Schluß. Am 12. Januar 1856 nämlich wurde dem Beauftragten von Eduard Breitfeld, zu dieser Zeit Besitzer der Erla'er Eisenhütte, dem Crandorf'er Schichtmeister Schubert und Konsorten „auf dem Pfarrlehngut zu Raschau“ noch einmal ein Grubenfeld unter dem alten Namen bestätigt (40169, Nr. 176, Blatt 9). Der finanzkräftige neue Besitzer wollte aber nicht kleckern, sondern richtig klotzen, und hatte daher nicht nur eine Fundgrube, sondern zu dieser gleich noch das 1. bis 15. Maß dazu gemutet. Wahrscheinlich aber hat auch jetzt eine nähere Untersuchung ergeben, daß hier nicht wirklich mehr etwas zu holen war, denn nur anderthalb Jahre später, am 23. Juli 1857, sagte Herr Schubert im Auftrag von Breitfeld alles wieder los (40169, Nr. 176, Blatt 12). Wie das nun schon üblich war, wurde daraufhin Berggeschworener Lippmann mit einer Schlußbefahrung beauftragt. Dieser berichtete am 15. August 1857 in Annaberg, der noch vorhandene, 14,5 Lachter tiefe Schacht und das von diesem aus 12,5 Lachter hora 9 ausgelängte Fallort stünden in guter Zimmerung, so daß „in nächster Zeit die Entstehung von Tagesbrüchen nicht zu befürchten“ sei (40169, Nr. 176, Rückseite Blatt 15). Herr Breitfeld wurde daher vom Bergamt nur mit dem Verbühnen des Schachtes beauftragt (40169, Nr. 176, Blatt 17). Ob der Schacht später verbrochen oder doch ausgestürzt worden ist, geht aus dem Akteninhalt nicht mehr hervor. An fraglicher Position ist heute jedenfalls nichts mehr davon zu sehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freunds Glück
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Grube dieses Namens haben wir in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 1) nicht finden können. Auch ausweislich der unter diesem Namen vorhandenen Grubenakte (40169, Nr. 81) währte der Betrieb hier allerdings auch nur von 1851 bis 1852. Unter diesem Namen wurde am 23. Juni 1851 eine gevierte Fundgrube durch den Bergarbeiter August Friedrich Herrmann aus Raschau gemutet (40169, Nr. 81, Blatt 1). Sie lag auf Ludwig Weber's Grund im Pfarrwald und ganze 150 Schritte von Riedels Fundgrube nach Südwesten entfernt. Der Bestätigung der Verleihung vom 4. Oktober 1851 kann man noch entnehmen, daß es bereits einen Fundschacht gegeben hat (40169, Nr. 81, Rückseite Blatt 1). Bereits am 27. März des Folgejahres nahm man dann aber in Annaberg die Lossagung der Grube durch den Alleinbesitzer zu Protokoll (40169, Nr. 81, Blatt 2). Inzwischen war das Gesetz über den Regalbergbau von 1851 in Kraft und so wurde die Lossagung auch in der Presse bekanntgemacht, damit eventuelle Gläubiger ihre Ansprüche rechtzeitig geltend machen können. Um den Wert der Grube zu bestimmen, wurde der Berggeschworene Troll aus Annaberg entsandt, um ihr Inventar zu taxieren. Der teilte daraufhin am 10. April 1852 an das Bergamt mit, er habe den Schacht verbrochen vorgefunden ‒ was wohl auch die schnelle Aufgabe des Besitzers erklärte. Das wenige Inventar der Grube hatte man untertage aufbewahrt und war nun verschüttet. Übertage hatte man ‒ das habe ihm jedenfalls der Bergmann Herrmann versichert ‒ den Rundbaum samt Seil und Kübel gestohlen, so daß überhaupt nur noch das Schachtgeviert und die Haspelstützen vorhanden waren, die er auf einen Wert von 5 Groschen schätzte. Die letzte Amtshandlung des Geschworenen war noch, dem Besitzer das ordentliche Verfüllen des Schachtes anzuordnen (40169, Nr. 81, Blatt 9). Das war schon die ganze Geschichte dieses Bergbauversuches. Der Standort ist später durch den Betrieb bei Riedels Fundgrube überfahren worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grüner Zweig am Adelsberg bei
Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Grube dieses Namens gibt es zwar in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 1), jedoch ist die Zuordnung unklar, da es eine gleichnamige Grube etwas früher auch am Graul im schneebergischen Bergamtsrevier gegeben hat. Ausweislich der beiden unter diesem Namen vorhandenen Grubenakten (40169, Nr. 113 und Nr. 870) wurde diejenige am Graul bereits 1820 aufgenommen, die andere erst 1857. Die Akte zu dieser zweiten Grube ist mit dem Zusatz „am Adelsberg“ bei Raschau versehen, so daß wir sicher sein können, daß es sich bei dieser um diejenige handelt, welche den Verleihkarten zufolge am westlichen Rand des Grubenfeldes von Gelber Zweig gelegen hat. Dieses Grubenfeld wurde den Schuhmachern Traugott Friedrich Merkel und August Lehmann sowie dem Bergarbeiter August Friedrich Weigel 1857 unter dem Namen Grüner Zweig Fundgrube verliehen (40169, Nr. 870). Dabei kamen die Muter gleich in Kollision mit dem an Herrn Fikentscher zugunsten seiner Ullricke Fundgruben und Maßen verliehenen Feld, was aber durch einen Flächenaustausch geregelt werden konnte. Dem Inhalt der Grubenakte zufolge hatten die Muter wenigstens einen Schurfschacht niedergebracht, denn bevor die Akte geschlossen wurde, galt es, diesen wieder zu verwahren. Viel mehr aber ist offenbar nicht geschehen, denn schon zwei Jahre später wurde das Feld wieder losgesagt. An dieser Stelle ist man nicht fündig geworden... Nichtsdestoweniger hat dann im Jahr 1917 Gustav Zschierlich unter diesem Namen noch einmal Grubenfeld gemutet, seine Mutung aber wieder zurückgezogen (40024-14, Nr. 513).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junge St. Katharina Stolln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Grube haben wir in den Erzlieferungsextrakten aus dieser Zeit (40166, Nr. 1) nur einmal im Jahr 1860, mit einem sehr bescheidenen Ausbringen von reichlich 27 Zentnern Braunstein sowie 14 Fudern Eisenstein, erwähnt gefunden. Der Stolln ist aber vermutlich schon vor 1851 angehauen worden, denn einer ‒ allerdings schlecht leserlichen Registratur des Bergamts Johanngeorgenstadt zufolge (Da dieser Stolln schon unterhalb des Knochens und westlich des Mönchssteigs ansetzte, und da das alte Schwarzenberg'er Bergrevier ab 1772 teils dem Schneeberg'er, teils dem Johanngeorgenstädter Bergamt zugeschlagenen war, war das letztere hier zeitweise zuständig) ‒ haben die damaligen Gesellen, nämlich Friedrich August Oeser und Christian Ludwig Weißflog in Langenberg, August (...?) Hänel aus Raschau und Friedrich August (Troll ?), ebenda, die Grube am 24. November 1851 (wohl nach dem Ableben des erstgenannten) bereits wieder losgesagt (40169, Nr. 1103, Blatt 1).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusammen mit seinen anderen
Weil das nun Vorschrift geworden ist, reichte Herr Breitfeld für die Betriebsperiode von 1855 bis 1857 einen Betriebsplan für den Stolln beim Bergamt ein (40169, Nr. 1103, Blatt 3f). Dem zufolge war der Stolln zu diesem Zeitpunkt bereits 80 Lachter weit „in Glimmerschiefer, theils in zersetztem Kalkstein und Mulm“ vorgetrieben, allerdings auf 25 Lachter Länge vom Mundloch herein bis an den 6 Lachter tiefen Tageschacht verbrochen. Der sollte nun gewältigt und dann „zur Aufschließung muthmaßlich vorliegender Eisensteinlager“ weiter nach Südosten getrieben, auch zur Aufsuchung der Lager einige neue Schächte geteuft werden. Dazu wurden neben dem Steiger zwei Häuer und ein Knecht angelegt. Bei seiner Prüfung des Betriebsplans stellte dann der Geschworene Julius Lippmann aber fest, daß die Anlage neuer Schächte unzulässig sei, weil die Belehnung ja nur in einem Stolln ohne Fundgrube bestanden hat (40169, Nr. 1103, Blatt 5). Derselbe berichtete in seinem Fahrbogen vom 17. Februar 1857 (40169, Nr. 1103, Rückseite Blatt 6) über den umgehenden Betrieb, daß man die Gewältigung des Stollnortes bei 55 Lachter vom Mundloch wegen des „schwierigen Betriebs in der guhrigen, lettig- schiefrigen Gebirgsmasse“ verlassen und stattdessen nun 30 Lachter nordöstlich vom Tageschacht auf eine „in Spuren vertretenen Kalksteinablagerung“ ein Flügelort nach Südost angeschlagen hatte. Dasselbe liest man auch in dem überarbeiteten Betriebsplan des Schichtmeisters Schubert (40169, Nr. 1103, Blatt 6B). Der Vortrieb erfolge allerdings nur in Weilarbeit und sei zu 11 Thaler der Lachter verdingt. So wurde der Betriebsplan dann auch genehmigt. Dasselbe liest man dann auch in der für das Betriebsjahr 1856 vom Schichtmeister erstellten Anzeige, nach der in diesem Jahr nebst dem Steiger 3 Doppelhäuer und ein Weilarbeiter auf dem Stolln angelegt waren (40169, Nr. 1103, Blatt 9A). Das Stollnort stehe am Schluß des Betriebsjahres bei 60 Lachter vom Tageschacht, sonst aber gab es nichts bemerkenswertes zu vermelden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über seine nächste Befahrung trug
Geschworener Lippmann am 7. Oktober 1857 in Schwarzenberg dann vor, daß
die Grube schon seit Beginn Luciae 1857 unbelegt sei. Auch das angehauene
Flügelort habe man nach nur 1 Lachter Erlängung sistiert (40169, Nr. 1103, Blatt
9C).
Da keine Betriebsaussetzung beantragt war, wurde Herr Breitfeld natürlich zur Wiederaufnahme aufgefordert. Daraufhin teilte Schichtmeister Schubert in dessen Auftrag am 20. Oktober 1857 aber mit, der Besitzer habe neues Feld gemutet und nach Abräumung der Feldfrüchte sollen nun doch Versuchsschächte geteuft werden, um „dem Stollnvortrieb eine zweckmäßige Richtung zu geben.“ Hiermit ersuchte er nun schnell noch die Genehmigung für diese Planänderung (40169, Nr. 1103, Blatt 11). Zunächst einmal wurde daraufhin am 24. Oktober die Sistierung des Betriebes bis Ende des Jahres 1857 genehmigt. Dann erfolgte am 11. November 1857 auch die Bestätigung von 20.806 Quadratlachtern oder 21 Maßeinheiten Grubenfeld zum Besten von Junge Katharina Stolln an Herrn Breitfeld (40169, Nr. 1103, Blatt 12ff). Über den Betrieb im Jahre 1857 berichtete Herr Schubert in seiner Jahresanzeige dann (40169, Nr. 1103, Blatt 16), man habe das Stollnflügelort hora 9,6 Südost noch auf 5,3 Lachter ausgelängt. Einen ersten Tageschacht hatte man 130 Lachter südöstlich vom Stollnlichtloch angesetzt und 14,95 Lachter niedergebracht; in 14 Lachter Teufe dann eine Feldstrecke 11,4 Lachter weit getrieben, hier aber „nur unbedeutende Braunsteintrümer“ angefahren. Daraufhin hatte man mit dem Abteufen eines zweiten Tageschachts, 90 Lachter südöstlich vom Stollnlichtloch, Ende des Jahres begonnen. Ein Ausbringen war nicht zu verzeichnen, sämtliche Kosten trug der Alleinbesitzer. Herr Lippmann befuhr die Grube wieder am 28. Mai 1858 und fand diesen neuen Schacht 12 Lachter niedergebracht, wobei man in 6 Lachtern Teufe die „Mulm- und Wackenablagerung mit nieren- und trümerweise inneliegenden Braunstein und Brauneisenstein, Eisenkiesel, Hornstein und Quarz“ erreicht hatte (40169, Nr. 1103, Blatt 15). Schichtmeister Schubert berichtete in seiner Anzeige auf das Betriebsjahr 1858 (40169, Nr. 1103, Blatt 17), der zweite Schacht sei auf 13 Lachter Teufe gebracht und bei 10 Lachter Teufe eine Strecke nach Südost 4 Lachter weit getrieben worden. Vom ersten Schacht aus hatte man in 12 Lachtern Teufe noch eine Strecke nach Nordost 11 Lachter, davon die ersten 7 Lachter in Glimmerschiefer, dann in „Brauneisensteinablagerungen“ getrieben. Unter der Rubrik ,Bemerkenswerte Ereignisse' ist außerdem vermerkt, daß der Betrieb im Sommer „wegen Wettermangel“ eingestellt werden mußte. Seiner Anzeige auf das Betriebsjahr 1859 (40169, Nr. 1103, Blatt 20) können wir noch entnehmen, daß man bis Reminiscere 1859 die Feldstrecke vom zweiten Tageschacht aus noch in Richtung des ersten auf nun 21 Lachter Länge gebracht, dabei auch etwas Braunstein und Eisenstein gefördert, aber noch nicht verkauft habe. Dabei dürfte es sich um die für 1860 in den Erzlieferungsextrakten angegebene Menge gehandelt haben. Dann sagte Herr Schubert am 19. Mai 1859 das Grubenfeld aber doch wieder los (40169, Nr. 1103, Blatt 18f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine spätere Fortsetzung fand die
Geschichte des Stollns noch ab dem Jahr 1894, nachdem Gustav
Zschierlich die Felder von Gnade Gottes vereinigt Feld und
Gott segne beständig erst konsolidiert, dann aber wieder geteilt und
aus dem wieder abgetrennten Feldteil die Gewerkschaft St. Katharina
gebildet hatte. Von dieser
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeisiggesang
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei diesem Namen sind wir uns nicht ganz sicher, wo
wir ihn räumlich einordnen sollen und ob es sich dabei überhaupt um ein
Bergwerk handelte. Der Name taucht jedenfalls ‒ und
da ziemlich eindeutig als eine Grube, nämlich mit einem Ausbringen an
Eisenstein ‒ erstmals in der Auflistung des Bergmeisters Merten Rauch
über den eingenommenen Zehnten auf Eisenstein aus dem Jahr
Der Name ist uns das nächste Mal im Jahre 1654 im
Das nächste Mal fanden wir den Namen „Zeißig
Gesang“
in der
In den Verleihbüchern des Bergamts Scheibenberg fanden wir den Namen dann erneut als eine Grubenbezeichnung und zwar im Quartal Reminiscere 1744. Hier heißt es, „den 4. Martii ist Hrn. Johann Gottlieb Meyern, Erbrichter des Tännigt Hammerguths, auf seinem eigenen Grund und Boden, und zwar zum Zeitels Acker genandt, 1 Fundgrube, drauf der Gang St. 42/8 hält, auf Silber, alle Metalle und Mineralien verliehen und zum Zeißig Gesang genennet worden, vgl. Muthung sub No. 180.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 26) Dann erwähnte im Jahr 1825 ‒ also
weitere fast
100 Jahre später ‒ aber auch Carl Edler von Querfurth auf Förstel in
einer seiner Beschwerden beim Bergamt diesen
Als Ortsbezeichnung taucht dieser Name schließlich auch 1835 noch einmal bei Ulrike erste obere morgentliche gevierte Maß „samt Zubehör am Zeisiggesang bei Langenberg“ auf (40169, Nr. 301). Hier ist nun ziemlich sicher wieder eine Lokalität gemeint und dieser ,Zeisiggesang' lag ebenfalls näher bei Langenberg, denn im Tännicht, sicherlich nämlich nahe bei Ulricke Fundgrube. Eine Grubenakte unter diesem Namen haben wir bislang jedenfalls nicht finden können. Auch in den Erzlieferungsextrakten der Bergreviere (40166, Nr. 22 und 26) ist ein solcher Grubenname nicht aufgeführt. Mehr haben wir hierzu noch nicht ermitteln können...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Langenberger Sieben Lehne
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Grube haben wir in den Erzlieferungsextrakten aus
dieser Zeit (40166, Nr. 22) nur
einmal im Jahr 1692 mit einem sehr bescheidenen Ausbringen von 13½ Fudern
Eisenstein erwähnt gefunden. Eine zumindest zeitlich
und der auch hier fallenden Namen halber ganz gut passende
Die Grube ist jedenfalls in der Auflistung von Grubenaufständen (40014, Nr. 12) aus jener Zeit aufgeführt, und zwar erstmals im Quartal Trinitatis 1692, wo es heißt (40014, Nr. 12, Film 0087, rechts oben): „Am Langenberg in 7 lehnen uf 4 posten hat d Steiger mit 1 arbeiter 15 fud Eisenstein vermessen aufgangen 5 th 5 gr 4 pf hierzu receß (?) verbleiben nach abzug der Churf. Intraden... Summa 17 th 16 gr – pf Abraham Bock, S. M. Hans Merckel St.” Da der Rezeß in diesem Quartal hiernach nur um reichlich 5 Thaler angewachsen ist, insgesamt aber bereits bei 17 Thalern lag, muß diese Grube eigentlich bereits früher in Betrieb gegangen sein ‒ in den Auflistungen der vorangegangenen Quartale haben wir sie aber nicht gefunden. Auch hat man in diesem Quartal ja schon Eisenstein ,vermessen lassen', der natürlich zuvor gefördert und ausgeklaubt worden sein muß. Von diesen Aufständen gibt es Kopien in den Oberbergamtsakten. Wenn darin auch nicht alle Quartale enthalten sind, so haben wir doch diese finden können (40001, Nr. 160, Film 0063).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleich im nächsten Aufstand liest man dann (40014, Nr. 12, Film 0090, rechts oben sowie 40001, Nr. 160, Film 0069): Am Langenberg in 7 Lehn uf 4 Posten „Ist der Schacht 10½ (Lachter) tief undt trafen die anbrüche bisweilen ¾ achter mächtig, fallen ab undt zu, ist dieses Quartal nicht belegt gewesen, wird in Frist erhalten mit 10 gr. 9 pf. hierzu voriger Receß 17 th 16 gr - pf... Summa 18 th 5 gr 9 pf. Abraham Bock, Schichtmstr.“ Im letzten Quartal 1692 war die Grube wieder belegt (40014, Nr. 12, Film 0094, links unten sowie 40001, Nr. 160, Film 0075): „Dieser Schacht ist von der Hängebank 10 Lachter tief undt dieses Quartal mit 1 Steiger undt 6 Arbeiter belegt gewesen, fuhren die Eisenstein meistentheils in alten Wüsten (?) sindt Bergkost aufgangen 24 th – gr – pf undt vorhin Receß... Summa 42 th 5 gr 9 pf. Abraham Bock, Schichtmstr. Hans Merckel Steiger“ Das klingt, als baute man hier von den Vorfahren stehengelassene Eisensteinmittel in verlassenen Bauen ab. Danach wird diese Grube in der Auflistung von Aufständen nicht mehr erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
St. Johannis und Mariae Verkündigung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruben dieser Namen haben wir nicht in den Erzlieferungsextrakten gefunden, sondern nur im Verleihbuch des Bergamts Scheibenberg, so daß davon auszugehen ist, daß beide keinen längeren Bestand und wirtschaftlichen Erfolg hatten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Verleihbuch ist im Quartal
Reminiscere 1750 eingetragen: „Den 4. Martii ist Johann Friedrich Riedeln aus
Raschau verliehen worden zwey Lehn auf 1 Pos. aufm Guth Förstel auf Braunstein
und alle Metalle und Mineralien und heißt die Zeche St. Johannis.“
(40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 33) Obwohl der heilige
Johannes in der ganzen Umgegend mehrfach zum Schutzpatron des Bergwerkes gewählt
worden ist, macht der Zusatz ,aufm Guth Förstel‘ eindeutig klar, daß
diese hier bei Langenberg gelegen hat.
Wie lange Johann Friedrich Riedel hier gebaut hat, wissen wir nicht, denn aus dieser Zeit sind keine Fahrbögen überliefert. Lange war es jedenfalls nicht, denn nur sechs Jahre später findet man eine neue Verleihung unter diesem Grubennamen mit derselben Ortsangabe: „26. Junii sind von mir, dem Bergmeister, Johann Christian Weißflog 2 Lehne auf Braunstein aufn Guth Förstel verliehen und zum St. Johannis genennet worden.“ (40014, Nr. 43, Blatt 48) An gleichem Ort findet sich auch die Eintragung der Verleihung des zweiten Grubennamens aus dieser Kapitelüberschrift: „23. Junii ist von mir, Samuel Enderlein, Bergmeister, Gottlieb Heinrich Weißflog in Langenberg zwey Lehne auf Braunstein an der Viehtrift auf Guth Förstel verliehen und Mariä Verkündigung genannt worden.“ (40014, Nr. 43, Blatt 48) Auch wenn die Ortsangabe ,an der Viehtrift auf Guth Förstel‘ etwas genauer als sonst ist, hilft uns dies nicht viel weiter. Auch Grubenakten haben wir hierzu noch nicht aufgefunden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Christian Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruben dieses Namens gibt es mehrfach in der Region. Bekannt ist etwa der Christianus Stolln auf dem Allerheiligen Gangzug am Knochen. Ein Christian Stolln und Fdgr. zu Langenberg wird aber auch schon Reminiscere und Luciae 1765 mit einem Ausbringen von 45 Fudern Eisenerz in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere genannt (40166, Nr. 22 und 26). Unter dem Namen Christian Fundgrube wird sie ebenda erneut von 1794 bis 1805 aufgeführt, wobei sich das gesamte Ausbringen an Eisenerz in diesem zweiten Zeitraum auf 504 Fuder (rund 430 t) summierte. Die Grube wurde (wiedermals) aufgenommen durch August Benjamin von Elterleins Erben zu Rittersgrün, welche nach Mutung vom 28. August 1793 die Grube anscheinend von deren Vorbesitzer übernahmen. In der Bestätigung vom 23. September des Jahres (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 161f) heißt es nämlich, daß „Herrn August Benjamin von Elterleins Erben, welchen von Christian Friedrich Korb das Recht vorstehender Muthung unter Abstattung des Handschlags cedirt worden ist, eine Fundgrube Christian genannt und drey obere Maßen auf einem morgengangweise streichenden Eisensteinlager, welches auf Herrn Querfurths zu Förstel Grund und Boden aufsetzt, älteren und begründeten Rechten jedoch unbeschadet, bergüblichermaßen bestätigt und verliehen worden (ist). Das Mittel soll in dem auf obgedachten Grund und Boden, das Holz genannt, geworfenen Schurf gelegt... werden.“ Am 29. Oktober 1793 haben die Besitzer beim Bergamt in Scheibenberg ferner Mutung auf „einen tiefen Stolln zum Besten des Berggebäudes Christian Fundgrube bey Langenberg auf Herrn Querfurths Grund und Boden befindlich, der Hahn genannt“ eingelegt haben (40014, Nr. 153, Blatt 112), welchen sie am 2. Januar 1794 bestätigt erhielten (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 163). Dieselben muteten am 22. Dezember 1793 noch eine untere und die vierte und fünfte obere Maß hinzu. Herr von Querfurth war damals im Besitz des Ritterguts Förstel bei Langenberg, dessen Fluren weit über das Schwarzbachtal hinaus bis an die Hayde bei Waschleithe reichten. Die Ortsangabe ,Hahn' verweist hier auf den nordwestlichen Gegenhang des Schwarzbachtals, wo die Straße in Richtung Waschleithe hinüber führt. Diese Gegend wird noch heute der ,Rote Hahn' genannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Christian Fundgrube „bei Langberg“ (später bezeichnete er sie genauer mit „am Grauler Gebürge“) wird auch von dem Ende des 18. Jahrhunderts im Bergamt Scheibenberg zuständigen Reviergeschworenen, Johann Samuel Körbach, Anfang 1794 erstmals genannt (40014, Nr. 185, Film 0087), allerdings notierte er am 15. Februar 1794 nur lapidar hierzu: „Christian Fundgr, Eisensteinzeche bey Langberg,
ingl. In seinem Bericht vom Mai 1794 zu den Befahrungen im folgenden Quartal hielt Herr Körbach dann fest (40014, Nr. 185, Film 0097f): Über Christian Fundgrube Berg- und Grubengebäude bey Langberg am Grauler Gebürge gelegen, in diesem Quartal No. 5te Woche, „Befande solches mit dem Steiger und 4 Mann beleget, durch solche wird mit 3 Mann ein Ort 5 Lachter unterm Tag aus dem Schacht in Mitternacht auf dem Stunde 10 streichenden, in Abend fallenden Eisenstein Lager betrieben, dieses Lager ist gegen 4 Ellen mächtig, führet rothbraunen Eisenstein in aufgelöster Eisen Erde, bey 7 Ltr. untern Tag wird ein Ort in Mittag mit 2 Mann betrieben auf dem gedachten Lager und bestehet ebenfalls aus gemelten Bestandtheilen.“ Nach der Angabe Körbach´s, daß die Christian Fundgrube „am Grauler Gebürge“ gelegen habe, kann sie keinesfalls mit dem am Gegenhang des Schwarzbachtals zum Knochen hin auf dem Allerheiligen Gangzug vorgetriebenen Christianus Stolln identisch sein. Auch 1795 hat der Geschworene pflichtgemäß die Grube wieder besichtigt und darüber festgehalten (40014, Nr. 193, Film 0013): Christian Fundgrube bey Langberg
gelegen „Ad 1. Befande solches mit dem Steiger, 2 Häuern, 1 Knecht und 1 Jungen beleget, durch solche Ad 2. Würd ein Ort mit 3 Mann zu 3/3tel Belegung bey 7 Ltr. Teufe untern Tag von dem westl. Schachtstoß gegen Abend in Quärgestein betrieben, die Absicht mit Betrieb diesem Versuchsort gehet dahin, etwa noch einen unbekanden, fürliegenden Eisensteingang mit solchem zu überfahren; weil man über Tage am dasigen Gebürge rothe Eisenstein Lager noch gewahr wird.“ Scheibenberg, 8. April 1795 Johann Samuel Körbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Quartal Reminiscere 1796 befand Herr
Körbach (40014, Nr. 193, Film 0038) „das Stollnort mit 3 Mann
beleget, wahr in allem vom Stollnmundloch 19 Ltr. in Nord erlenget, der
Gang bestund aus 12 bis 18 Zoll aufgelöste Eisenerde und Gneis mit etwas
einbrechenden rothbraunen Eisenstein.“
Der Betrieb ging auch im nächsten Quartal recht munter weiter, wie der Geschworene auch im Quartal Trinitatis 1796 festhielt (40014, Nr. 193, Film 0041f): „Befande solches mit 1 Steiger, 2 Doppelhäuer, 2 Knächte und 1 Jungen beleget, in Summa 6 Mann, durch solche wird das Stollnort in Abend und Mitternacht mit 2 Mann zu 2/3tel Belegung auf dem hoch flach streichenden Gange betrieben, war vom Mundloch in allem 24¼ Ltr. betrieben, wendet in Stunde 12,2 der Gang bestund aus 8 bis 10 Zoll aufgelöstem Gneis und Eisenerde. In 15 Ltr. Länge vom Mundloch herein hat man mit Betrieb des Stollnorts in der Förste etwas Eisenstein erbrochen, wird durch den Steiger und 3 Mann überhauen. Der Gang war 16 bis 18 Zoll mächtig führt Quarz, Gneis und rothbraunen Eisenstein, war gegen ½ Ltr. hoch mit 2 Ltr. Länge ausgehauen, schöne, aber nur alswann durchfallende Eisenstein Lager (unleserliche Passage ?) welche in dasigem Gebürge immer nicht lange sich mit Eisenstein bewiesen.“ Hier klingen in Körbach's Worten erste Zweifel am Aushalten des verfolgten Gangs an... Dessen ungeachtet wurde fleißig an der Ausrichtung weitergearbeitet und am 22. August 1796 konnte der Geschworene dann schon konstatieren, man habe nicht nur das Stollnort auf inzwischen 29 Lachter Länge nach Norden fortgebracht, sondern auch einen Tageschacht 4 Lachter tief bis auf den Stolln abgesunken. Der kaum 20 Zoll mächtige Gang bestehe aber nur aus „aufgelöster Eisenerde und Quarz.“ Vom Tagschacht 9½ Ltr. nach Nord war ein schon 1 Ltr. hoher Firstenbau aufgehauen, dort „bricht ab und zu rothbrauner Eisenstein mit ein in aufgelöster Eisenerde und Quarz.“ Die Mächtigkeit des Gangs war hier mit gegen 24 Zoll nur unwesentlich größer. Am 25. Nov. 1796 fand Herr Körbach zu berichten, daß das Stollnort jetzt 34½ Ltr. fortgebracht sei, der Gang wende sich in Stunde 12,4 und war vor dem Stollnort 8 – 12 Zoll mächtig. Er führte nach wie vor aufgelöste Eisenerde und Quarz und nur ab und zu ließe sich etwas Eisenstein finden. Das Überhauen 16 Ltr. (war es nicht ein Quartal zuvor bloß 9½ Ltr. von diesem entfernt?) nördlich des Lichtlochs war inzwischen gegen 2 Ltr. über die Stollnfirste ausgehauen, der Gang sei hier nun bis zu ½ Lachter mächtig und führe rotbraunen Eisenstein. Mitte 1797 dann berichtete Herr Körbach in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 196, Film 0024): Eisensteinzeche Christian
Fundgrube bey Langberg gelegen, „ad 1. Befand solche montags mit dem Steiger, 3 Häuern, 1 Lehrhäuer, ferner 4 Knechten und 1 Jungen beleget, in summa 10 Mann. ad 2. Wurde das Stollnort mit 4 Mann zu 4/3tel (ist das ein Schreibfehler ?!) Belegung auf dem flachen Gang in Nord betrieben, war in allem vom Mundloch 51 Lachter erlengt, der Gang bestand aus 3 bis 5 Zoll Mächtigkeit führte aufgelöste Eisenerde und Quarz, wird solcher Stolln fernerweit betrieben. Man hat mit Betrieb des Stollnorts bey 46½ Ltr. Entfernung vom Stolln Mundloch herein in dem vom Tag 11½ Ltr. saiger tief herein gebrachten Schacht den Durchschlag gemacht, 3. wird das Überhauen in 16 Ltr. Entfernung von dem 1ten, 4 Ltr. tiefen Lichtloch in Nord, in dem 3 Ltr. über die Stollnförste in die Höhe gebrachten Überhauen der Förstenbau durch 4 Mann zu 2/3teln Belegung auf dem flachen Gang in Mitternacht fortgestellt, Der Gang ist gegen 2 Ellen mächtig, führet aufgelöste Eisenerde, Quarz und braunroten Eisenstein.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner Befahrung im folgenden Quartal Crucis 1797
berichtete der Geschworene am 22. Juli, mit 3 Mann in drei Dritteln habe
man das Stollnort auf nun 22⅛ Ltr. ab dem 11½ Ltr. tiefen Tageschacht
weiter erlängt, wo sich der Gang nun in Stunde 1 gegen Nord wende und 16
Zoll mächtig sei, ferner werde auch das Überhauen mit 3 Mann weiter
betrieben. Dieses war nun 3½ Ltr. in die Höhe gebracht, der Gang hier aber
nur noch 12 Zoll mächtig. Die zuletzt hier angetroffene Erzlinse scheint
also durchfahren und ausgehauen worden zu sein.
Auch im folgenden Quartal Luciae 1797 war Herr Körbach pflichtgemäß wieder vor Ort und berichtete darüber an das Bergamt Scheibenberg (40014, Nr. 196, Film 0061f): Über Christians Fundgrube bey Langberg „ad 1. war beleget mit 1 Steiger, und 3 Häuern, 2 Knächte und 1 Jungen, in summa 7 Mann, Durch solche (wurde...) 2tens wurde das Stollnort mit 3 Mann zu 3/3tel Belegung in Abend betrieben, in Quärgestein, zu überfahren eines fürliegenden Eisenstein Lagers, war vom 2ten Schacht 22¾ Lachter erlengt, wendet in Stunde 8,4 in Abend, wird fernerweit in verdingter Arbeit, das Lachter Länge mit ⅞ Ltr. Höhe excl. Bergförderung für 3 Thl. – Gr. – Pf. betrieben, 3tens wird noch ein Förstenstoß aus dem Überhauen in 16 Ltr. Entfernung vom 1ten, 4 Ltr. tiefen Lichtloch gegen Nord mit 3 Mann zu 3/3tel Belegung, obgedachter Förstenstoß von ½ Ltr. Höhe in Nord ausgehauen. Der Gang war 18 Zoll mächtig, führet aufgelöste Eisenerde und etwas einbrechenden rothbraunen Eisenstein.“ Wieder ein halbes Jahr später liest man dann im Fahrbogen (40014, Nr. 196, Film 0116): Christian Fundgrube bey Langberg, Trinitatis 1798 „Allhier wird das Stollnort auf dem Stunde 2 streichenden und gegen 60 Grad in Abend fallenden Gange, welcher gegen 18 Zoll mächtig ist und aus aufgelöstem Gneiß und rothen Letten bestehet, mit 3 Mann zu 3/3tel in Nord betrieben, 2tens der Querschlag, welcher vom Obern Tageschacht in 16 Ltr. nordl. Entfernung in Abend betrieben wurde, ist eingestellt, war 27½ Ltr. vom Hauptstolln erlenget und hat mit solchem Betriebe nichts von Eisenstein Gängen überfahren und sodann das Stollnort wieder in Umtrieb gesetzet worden.“ Nun, wirkliche Erfolge blieben offenbar aus. dennoch führte man die Untersuchung unverdrossen fort und auf Reminiscere 1799 hatte Herr Körbach zu berichten, man habe jetzt einen Querschlag auf einem beim 1. Lichtloch übersetzenden, Stunde 4,4 streichenden und in Abend fallenden Gang in Richtung Westen angeschlagen und „der Gang ist sehr mächtig und noch nicht ganz ausgerichtet, haben für Ort in Hornstein ein 3 bis 4 Zoll mächtiges und aus rothbraunem Eisenstein bestehendes Trum erbrochen, wird solches Ort fernerweit in obgedachter Richtung betrieben.“ (40014, Nr. 199, Film 0017) Also, wenn ich lese, der Gang sei „sehr mächtig“, enthalte aber ein nur 4 Zoll (rund 10 cm) mächtiges Trum mit Eisenerz ‒ da haben doch die alten Geologen wohl wieder einmal eine Lage Quarzbrockenfels mit einem Gang verwechselt... Immerhin aber ließ sich dabei wieder etwas Eisenstein gewinnen, denn die Eigner, August Benjamin von Elterleins hinterbliebene Erben, zögerten nicht, den Formalien nachzukommen und reichten am 27. Februar 1799 die Mutung vor dem Bergamt ein, „der Christian Fundgrube zu Langenberg zum Besten (auf) einen Gang oder Flötz, welches mit Betrieb eines Querschlages ohnweit vom 1. Lichtloch auf der Stollnsohle befindlich ist...“ (40014, Nr. 191, Blatt 47) Trinitatis 1799 heißt es in Körbach's Fahrbogen (40014, Nr. 199, Film 0021), der Querschlag sei nun 13 Lachter vom Hauptstolln fortgebracht, das Lager aber immer noch nicht ganz durchbrochen und „Dieser Gang hat sich von Stunde 4 bis 10 in West-Nord gewendet und ist noch nicht gewiß zu bestimmen, ob es wird Gang bleiben oder Flöz werden. Habe von solchem 20 Fuder Eisenstein meßen laßen.“ 27. April 1799 Luciae 1799 notierte Körbach dann, man baue in der Stollnsohle 15½ Ltr. nordwestlich vom 1. Lichtloch ab, sei schon 2 Lachter in die Tiefe gegangen und immer noch sei das Lager sehr mächtig, führe aber nur „ab und zu einbrechender rothbrauner Eisenstein.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ähnliches war auch Reminiscere 1800 zu berichten: Man
baue nun „im Abteufen bei 1 Ltr. Teufe unter der Stollnsohle einen
Stroßenstoß von oben nieder auf einem 6 Zoll mächtigen... Trum nach
Norden“ und trieb „2. ein Versuchsort vom 1. Lichtloch bei 13
Lachter nordwestl. Länge mit ansteigender Sohle auf einem anderen
gleichartigen trum nach Südost.“ (40014, Nr. 200, Film 0004)
Der Fahrbogen vom Quartal Crucis 1800 berichtet uns, man baute jetzt „in dem sehr mächtigen Rothen Horn Lager“ in Stunde 7 gegen Abend 3 Ltr. unter Stollnsohle und es werde „fernerweit fortgesteltt, in der Hoffnung, wieder Eisenstein auszurichten.“ Oh, die Hoffnung stirbt zuletzt... Und die Geduld der Gewerken ist hervorhebenswert, denn außer oben erwähnten 20 Fudern Eisenstein steht in den Fahrbögen seitdem nichts mehr von Ausbringen. Luciae 1800 trieb man ein neues Versuchsort oberhalb der Stollnsohle und „brach für solchen Ort Hornstein und etwas rothbrauner Eisenstein mit ein.“ (40014, Nr. 200, Film 0056) Dasselbe berichtet Herr Körbach auch noch einmal in seinem Fahrbogen auf das Quartal Reminiscere 1801 (40014, Nr. 202, Film 0007). Danach setzten seine Berichte über diese Grube aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Protokollen des Bergamtes über eingelegte Mutungen
ist dann zu entnehmen, daß von Elterleins Erben aus dem Feld
gegangen und im Jahr 1803 eine neue Gesellenschaft die Grube übernommen hat.
Sie setzte sich zusammen aus Johann Gottlieb Fischer und Consorten,
als Christian Gottlieb Trommler und Johann Gottlieb Reppel.
Die letzten beiden Namen sind uns mit eigenen Schürfversuchen schon
begegnet... Jedenfalls legte Herr Fischer namens der Genannten am
19. Dezember 1803 (nach der anderen Akte bereits am 31. August 1803)
Mutung auf ein geviertes Feld an der „im Freyen liegenden Christian
Fundgrube nebst dazu gehörigem tiefen Stolln auf des Herrn Stadtrichters
Querfurth Grund und Boden unter Langeberg“ ein und sagten gleichzeitig
„die bestädigte streichende Fundgrube“ gleichen Namens los (40014,
Nr. 191, Film 0112 sowie Nr. 211, Film 0004).
Am 6. Oktober erhielten sie die Verleihung bestätigt (40014, Nr. 191, Film 0112).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reminiscere 1804 berichtete der Geschworene Körbach
dann über die Grube, man baue „mittels Ortsbetrieb und Strossenaushieb
in dem sehr mächtigen Lager, (dieses)
führt Hornstein, Quarz und rothbraunen einbrechenden Eisenstein.“
(40014, Nr. 213, Film 0002).
Trinitatis 1804 war zu berichten, man habe nun 11 bis 12 Lachter westlich vom Lichtloch einen neuen Tageschacht angelegt und bislang 5 Lachter abgesunken. Er sollte auf den Eisensteinbau über dem Stolln durchgeschlagen werden, wegen zweckmäßigerer Förderung und um dem Stolln mehr Wetter zu verschaffen (40014, Nr. 213, Film 0026). Crucis 1804 war der neue Tageschacht 7 Lachter tief geworden. Anstatt aber den Durchschlag herzustellen, war man nun damit befaßt, auf Versuchsörtern nach West und Nord mit Strossen- und Firstaushieb das Lager abzubauen (40014, Nr. 213, Film 0037). So fuhr man auch Luciae 1804 (40014, Nr. 213, Film 0053) und Reminiscere 1805 fort (40014, Nr. 232, Film 0004). Auch Crucis 1805 fand der Geschworene nichts bemerkenswertes, neues zu berichten (40014, Nr. 232, Film 0025). Ein etwas ausführlicherer Bericht stammt dann wieder aus der Feder des Bergamtsprotokollisten Friedrich August Schmid, welcher ja nach dem Ausscheiden Körbach's aus seinem Dienst die Funktion des Geschworenen für einen Teil des Reviers übernahm. Er notierte über seine Befahrungen in der 9. bis 13. Woche des Quartals Reminiscere 1806 (40014, Nr. 233, Film 0009f). 1. Christianus gev. Fdgr. am Förstel „Genanntes Grubengebäude liegt am Abhange des sanft gegen NW. ansteigenden Gneisgebirges. Es ist durch einen 5 Lachter Saigerteufe einbringenden Stolln gelöst und wird gegenwärtig von drei Eigenlöhnern betrieben. Diese verführen auf einem Std. 10,4 streichenden Eisensteinlager, deßen Bestandtheile bei der vor der hand noch nicht genau anzugebenden Mächtigkeit Quarz, rother Hornstein, dichter Rotheisenstein nebst dann und wann einbrechendem rothem Glaskopf constituiren, gegenwärtig folgende Baue: a) bei 10 Lachter Länge von dem 5 Lachter Teufe einbringenden Förder- und Fahrschachte gegen Süd befindet sich ein Überhauen von 2 Lachtern Höhe. Das erwähnte Eisensteinlager war hier ½ Lachter mächtig, verflächte sich 35° gegen Ost und bestand aus dichtem Rotheisenstein, Hornstein und Quarz. b) Ein zweites Überhauen zwei Lachter weiter gegen Süd, folglich in 12 Lachter Länge vom ermeldten Schachte. Hier war jenes Lager ¾ Lachter mächtig und faßte neben den ad a.) genannten Bestandtheilen auch rothen Glaskopf. c) Ein ¼ Lachter erlängter Stroßenbau in 13 Lachter nördlicher Entfernung von dem oft genannten Schachte. Das erw. Lager fand ich hier ¼ Lachter mächtig, aus Quarz, rothem Hornstein und dichtem Rotheisenstein bestehend.“ Trinitatis 1806 fiel sein Bericht wieder recht knapp aus und lautete: „Im abgewichenen oder nunmehr zu Ende gehenden Qu. Trin. sind die Eigenlöhner dieses Gebäudes mit Fortstellung der bereits mehrmals beschriebenen Baue beschäftigt gewesen...“ (40014, Nr. 233, Film 0032). Danach bricht die Folge der Erwähnungen dieser Grube in den Fahrberichten der Berggeschworenen ab (vgl. etwa 40014, die Nr. 235, 236 und 245). Wie wir inzwischen wissen, ist sie 1806 endgültig in das Bergamt zu Schneeberg überwiesen worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bergmännische Brüderschaft Stolln
bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei diesem Stolln handelte es sich um eine auflässige Grube am Nordhang des Schwarzbachtals auf dem Grund des Ritterguts Förstel. Sie wurde den betreffenden Akten des Bergamtes zu Scheibenberg zufolge in der 12. Woche des Quartals Crucis 1796 durch Carl Heinrich von Elterlein gemutet und die Mutung umfaßte den „zeither im Freien liegenden Brüderschaft Stolln“ nebst einer Fundgrube. Der Stolln war „auf Herrn Querfurths Grund und Boden bei Langenberg in das gegen Mitternacht Abend ansteigende Gebirge“ zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Lachter vorgetrieben. Die Mutung erfolgte „auf Silber und alle Metalle“ und wurde am 24. Januar 1797 unter dem Namen Bergmännische Brüderschafts Stolln bestätigt (40014, Nr. 191, Blatt 26, Abschriften in 40014, Nr. 270, Blatt 26 und in 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 187). In den Fahrbögen des Berggeschworenen Körbach findet sich dazu eine Eintragung vom Januar 1797, nach der der Stolln zu diesem Zeitpunkt bereits auf 75 Lachter erlängt war und „in Stunde 11 Abend in Quergestein getrieben (werde), um in dasigem Gebirge Eisensteingänge zu überfahren“ (40014, Nr. 196, Film 0003). Man hatte also noch keine gefunden und suchte noch danach... Ebendort heißt es von der Befahrung im Quartal Trinitatis 1797, der Stolln sei nun schon auf 81 Lachter ausgelängt und man fuhr „Stunde 11,6 in Nord auf einem rothen Horn mit vermengtem Quarz und etwas grauen Eisenstein bestehenden Lager, deßen Mächtigkeit noch nicht zu bestimmen ist.“ (40014, Nr. 196, Film 0025)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gottreich Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wird die Gottreich Fundgrube nur einmalig im Jahr 1803 mit einem Ausbringen von 70 Fudern Eisenstein genannt (40166, Nr. 22 und 26). Bei der Wahl des Grubennamens war wohl eher der Wunsch der Vater des Gedankens... Reich hat Gott hier jedenfalls niemanden gemacht und ob die Arbeit untertage etwas mit Gottes Reich zu tun hat, darf man auch bezweifeln. Die Aufnahme dieser Grube erfolgte nach Mutung durch den Bergarbeiter Christian Gottreich Weißflog (ach, da kommt der Grubenname her!) vom 13. Dezember 1802, worin es heißt, sie läge „auf Herrn Quärfurths Grund in Langberg“ (also beim Förstelgut) und er beantrage eine Fundgrube „auf Eisenstein und Mineralien“ ‒ hier fehlt im Originaltext die allerdings nicht unwesentliche Bemerkung, ob er denn auf ,alle Mineralien' (also auch auf die Edelmetalle) gemutet habe ‒ und „das Streichen des Ganges soll bei der Bestätigung angegeben werden.“ (40014, Nr. 191, Film 0099) Die Bestätigung wurde am 10. Februar 1803 ausgestellt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 225). Der Berggeschworene Körbach hielt zu dieser Grube in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 209, Film 0018): Gottreich Fundgrube bey Langberg, „War von den Eigenlöhnern der Fundschacht auf dem Eisenstein Lager gegen 2 Lachter tief abgesunken, bricht in solchem Lager Hornstein, aufgelöste Eisen Erde und grauer Eisenstein mit ein, wird solcher Schacht noch tiefer abgesunken, das Lager im Fallen auszurichten.“ Ein zweites Mal befuhr Herr Körbach die Grube im Sommer 1803 und notierte darüber (40014, Nr. 209, Film 0051): Die gevierte Gottreich Fundgrube
bey Langberg „Wird der Bau bey 3 Ltr. untern Tag in dem sehr mächtigen Eisenstein Lager von Eigenlöhnern mittels Ortsbetriebes und Stroßenaushieb in Morgen betrieben, das Lager ist noch nicht ausgerichtet, führt Hornstein, einbrechenden grauen Eisenstein und Braunstein.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon Trinitatis 1804 fand der Geschworene die Grube
aber „dienstags in der Frühschicht unbelegt“ vor (40014, Nr. 213,
Film 0018). Auch Crucis 1804 war die Gottreich Fundgrube nicht
belegt (40014, Nr. 213, Film 0038). Dasselbe wiederholte sich Luciae 1804
(40014, Nr. 213, Film 0052).
Infolge der dreimaligen Nichtbelegung hätte die Grube bereits ins Bergfreie fallen können. Aber Reminiscere 1805 notierte Herr Körbach erneut, daß die Gottreich Fundgrube „von den Eigenlehnern nicht betrieben“ werde (40014, Nr. 232, Film 0010). Auch dies wiederholte sich noch einmal Trinitatis 1805 (40014, Nr. 232, Film 0014). Danach bricht die Folge der Erwähnungen dieser Grube in den Fahrbögen der Berggeschworenen ab (vgl. 40014, Nr. 232, 233, 235 und 236).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viertels gevierte Fundgrube
und Viertels Glück Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wird Viertels Fundgrube einmalig im Jahr 1804 mit einem Ausbringen von 20 Fudern Eisenstein genannt (40166, Nr. 22 und 26). Unter dem zweiten Namen erscheint sie in diesen Quellen noch ein zweites Mal im Jahr 1827 mit einem Ausbringen von 31 Zentnern Braunstein. Die beiden Bergarbeiter Traugott Friedrich Viertel und Karl Gottlieb Viertel muteten am 22. August 1803 eine gevierte Fundgrube „auf Herrn Querfurths Grund und Boden am Förstel bey Langberg“ und erhielten sie am 6. Oktober 1803 als Viertels gevierte Fundgrube verliehen (40014, Nr. 191, Film 0111 und 40014, Nr. 43, Blatt 230). Der Berggeschworene Körbach hielt zu dieser Grube in einem seiner Fahrbogen fest (40014, Nr. 209, Film 0056): Eigenlöhnergebäude Viertels
gevierte Fundgrube bey Langberg, „War der Tageschacht von Eigenlöhnern 3½ Ltr. saiger tief auf dem sehr mächtigen Eisenstein Lager abgesunken und das Liegende Salband von solchem noch nicht erreicht, bricht in solchem Lager Hornstein, Quarz und grauer Eisenstein.“ Überall ,sehr mächtige Eisensteinlager´ und dann kam doch nicht wirklich was dabei heraus...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trinitatis 1804 berichtete Herr
Körbach dann in seinem Fahrbogen, daß von den Eigenlöhnern ein neuer
Tageschacht, 20 Lachter in Morgen vom Fundschacht, abgesunken werde, in
der Hoffnung, das Eisensteinlager dort besser auszurichten
(40014, Nr. 213, Film 0017).
Schon Crucis 1804 aber fand der Geschworene die Grube wieder unbelegt vor (40014, Nr. 213, Film 0038). Damit war auch hier erstmal wieder Schluß...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Herr Viertel hat offenbar
nebenbei auch Kalkstein abgebaut. In den Fahrbögen des Scheibenberg'er
Berggeschworenen Johann August Karl Gebler aus dem Jahr 1823 fanden
wir nämlich die Eintragung (40014, Nr. 267,
Film 0052):
„Freytags, den 18. July habe ich auf Viertels Flößzeche im Förstelwald ohnweit Langenberg 10 Fuder Flöße vermessen.“ Nach der Ortsangabe ,im
Förstelwald' zu urteilen, kann es sich nicht um die zur gleichen Zeit
umgängigen Kalksteinabbaue im Pökelwald bei Raschau oder um die Kalkbrüche
am Tännichtgut
gehandelt haben. Wir
vermuten vielmehr, daß hier von den alten Flößbrüchen am Nordhang des
Schwarzbachtals nordwestlich unterhalb des Ritterguts Förstel gehandelt
hat, die der Rittergutsbesitzer, Karl Edler von Querfurth, zu
dieser Zeit vermutlich an besagten Herrn Viertel verpachtet hatte.
Daß das Rittergut Förstel 1824 jedenfalls noch einen Kalkbrennofen
betrieb, haben wir auch schon an anderer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine erneute Verleihung unter dem alten Namen ist unter dem 3. April 1822 im Lehnbuch eingetragen. Carl Heinrich Viertel und Konsorten, Bergarbeiter zu Raschau, erhielten „eine gevierte Fundgrube bei dem Dorfe Langenberg im Raschauer Pfarrwalde auf einem in 5 Ltr. unterm Tage ersunkenen Eisen- und Braunsteinlager unter dem Namen Viertels gevierte Fundgrube“ bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 290). Gleich darunter ist vermerkt: „Losgesagt Crucis 1824“ – viel scheint also auch jetzt nicht geschehen zu sein... Dennoch taucht sie, wie eingangs vermerkt, unter dem Namen Viertels Glück im Jahr 1827 noch einmal mit einem Ausbringen in den Erzlieferungsextrakten auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vier Brüder Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unter diesem Namen wurde die Grube, mit einer gevierten Fundgrube „und die darzu gehörigen Maßen auf Eisenstein auf Herrn Querfurths Grund und Boden“ am 17. November 1808 gemutet (40014, Nr. 211, Film 0054). Als Lehnträger agierte Herr Gottlob Fischer, als Consorten werden benannt: Johann Gottlieb Reppel in Langenberg, Gottlieb Trommler in Schwarzbach und nochmals Gottlob Fischer aus Mittweida. Na, zumindest die Namen Trommler und Reppel sind uns doch auch an anderen Stellen schon begegnet... Die Eintragung des Grubenfelds unter dem Namen Vier Brüder Fundgrube wurde am 5. Januar 1809 vom Bergamt bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 251). Unter demselben Datum ist auch noch eine Verleihung einer Richters Fundgrube an den Bergarbeiter Christian Friedrich Richter aus Raschau, auf einem ersunkenen Eisensteinlager, „ungefähr ½ Stunde von dem Dorfe Langenberg gegen Mittag im Raschauer Pfarrwald gelegen,“ verzeichnet. Mehr als dies haben wir über diese Grube aber noch nicht herausgefunden (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 249). In der betreffenden Akte ist ausnahmsweise folgende kleine Croquis
abgeheftet, die uns Aufschluß über die Lage dieses und der zur gleichen
Zeit nahebeiliegenden, verliehenen Felder. Aufgrund
dieser Lageangabe kann sie nicht mit dem Schurfversuch von
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab Reminiscere 1809 findet die Vier Brüder Fundgrube
dann auch in den Fahrbögen des Berggeschworenen
Christian Friedrich Schmiedel Erwähnung, wo es heißt (40014, Nr. 236,
Blatt 106f).
Vier Brüder Fundgrube daselbst (bei Langenberg) betr. „Mit den allhier in Arbeit stehenden 4 Doppelhäuern wird, um das allhier aufsetzende Eisen- und Braunstein führende Lager zu untersuchen, ein Tageschacht niedergebracht, welcher auch bereits 3¼ Lachter tief ist, wobei man auf der Sohle deßelben einige in gebrächem Gneise inneliegende loose Stücke braunen Eisenstein getroffen hat.“ Am 17. Juni 1809 konnte der Berggeschworene hier schon die ersten 16 Fuder Eisenstein vermessen lassen (40014, Nr. 236, Rückseite Blatt 153). Am 19. Oktober des Jahres fand Herr Schmiedel allerdings auch Vier Brüder unbelegt vor (40014, Nr. 236, Blatt 196). Vom 7. Dezember 1809 stammt dann folgender, wieder etwas ausführlicherer Fahrbericht des Geschworenen (40014, Nr. 236, Blatt 214f): Vier Brüder Fundgrube ebendaselbst betreffend. „Diese Eigenlehnergrube ist mit 4 Mann, als 1 Versorger, 2 Häuern und 1 Knecht belegt, durch welche ein neuer Tageschacht abgesunken wird und selbiger nunmehr 4 Lachter in Quergestein saiger niedergebracht ist, wobei man in dem jetzigen Tiefsten auf das Hangende des allhier aufsetzenden Eisensteinlagers gekommen ist und selbiges, so viel sich dermalen abnehmen läßt, aus gelbem Ocker, Quarz, Braunstein und ockerigen braunem Eisenstein besteht.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste Fahrbericht Schmiedel's datiert bereits 26.1.1810 (40014, Nr. 245, Film 0010). Demnach war die Vier Brüder Fundgrube nun mit 5 Mann belegt, durch die in 5 Lachter Teufe auf dem 5 Lachter langen, Stunde 2 gegen Nord getriebenen Querschlag angefahrenen Eisensteinlager ein Ort Stunde 7,0 gegen Osten, welches jetzt 1½ Lachter erlängt ist, und ein zweites in derselben Richtung gegen Westen, jetzt ½ Lachter lang, betrieben wurde. Das Lager selbst war ¾ Lachter mächtig und führte hier „gelben Ocker, milden Gneis, Quarz, ockerigen gelben und braunen Eisenstein, auch dichten Brauneisenstein.“ Am 30. März 1810 wurden bei der Grube erneut 18 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 245, Film 0035).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der uns schon bekannte Steiger Carl August Weißflog
mutete dann am 14. Juni 1812 „auf Herrn Stadtrichter Querfurths Grund und
Boden eine gevierte Fdgr. und eine Maaß die schon gangbar gewesen Vier
Gesellen Grube nicht ohnweit von Friedrich Fundgrube“ (40014,
Nr. 211, Film 0101)
Offenbar waren also die vier Betreiber der Vier Brüder Fundgrube schon wieder aus dem Feld gegangen und der Name war schon wieder vergessen oder ist ungenau überliefert worden. ,Unweit von Friedrich Fundgrube´ hat jedenfalls auch die Vier Brüder Fundgrube gelegen.... Danach taucht die Vier Brüder Fundgrube in jüngeren Akten nicht wieder auf. Herrn
Weißflog wurde das Grubenfeld am 23. Dezember 1812 mit einer nächsten unteren Maß unter dem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fröhliche Zusammenkunft
Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zuvor noch muteten am 6. Januar 1810 „unterhalb des Dorfes Langenberg an dem vom Dorfbach gegen Mittag ansteigenden Gebirge (...) auf dem Karl Friedrich Weber in Langenberg gehörigen Grund und Boden“ Christian Friedrich Richter und Consorten, nämlich Christian Friedrich Hilbert, Christian Friedrich Riedel, Christian Gottlieb Haustein und Carl Friedrich Merkel, sämtlich Bergarbeiter aus Raschau, ingleichen der Steiger Carl August Weißflog aus Langenberg, eine gevierte Fundgrube unter dem Namen Fröhliche Zusammenkunft (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 256). Wer unseren Beitrag bis hierher gelesen hat, wird auch denken, die Liste der Gewerken klingt wie ein Who is Who der hier ansässigen Bergarbeiter... Bekannte Namen sind auch hier wieder dabei. Man ersieht daraus auch, daß Bergarbeiter in dieser Zeit keine ganz armen Leute gewesen sind, sonst hätten sie sich immer neue Versuche mit neuen Gruben nicht leisten können, auch wenn diese Gruben nur in Weilarbeit von den Eigenlehnern im Nebenerwerb betrieben worden sind. Die Grube wurde jedenfalls am 5. Juli 1810 vom Bergamt und zwar „an jeden zu gleichen Theilen“ bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 257).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Betrieb nahmen die Muter gleich auf und so findet
sich schon am 2. Februar 1810 folgende erste Eintragung in den Fahrbögen
des Berggeschworenen Christian Friedrich Schmiedel (40014, Nr. 245,
Film 0020f):
Fröliche (er schrieb es wirklich so, Herr Duden wurde ja erst 1829 geboren) Zusammenkunft Fundgrube ebendaselbst (in Langenberg). „Auf dieser Eigenlehnergrube fahren 4 Mann, als 1 Versorger, 2 Häuer und 1 Knecht an, diese betreiben in 6 Lachter Teufe ein Ort Stunde 3,3 auf dem Lager nach Nordost, jetzt 2 Lachter, und ein Ort Stunde 4,1 gegen SW, erst 1¼ Lachter erlängt. Das Lager streicht Std 3,3, ist ¾ bis 1 Lachter mächtig, fällt 20° gegen Nord und besteht aus lockerem Gneis, Quarz, braunem Hornstein, ockerigen braunen Eisenstein, auch dichtem Brauneisenstein.“ Am 10.4.1810 heißt es im Fahrbericht zur Frölichen Zusammenkunft bei Langenberg (40014, Nr. 245, Film 0042), die Zeche sei mit 5 Mann belegt, welche nun in 8 Lachtern Teufe vom Tageschacht ein Ort Stunde 10,1 auf dem Eisensteinlager gegen Mittag betrieben, das bei 1 Lachter Weitung bereits 10¾ Lachter erlängt war. Das Lager war hier ½ bis ¾ Lachter mächtig, fiel 20° gegen West und bestand aus gelbem Ocker, Gneis, Quarz, braunem Hornstein und einbrechendem gelben ockerigen Eisenstein, auch etwas dichtem Brauneisenstein. Am 19. Oktober 1810 fand der Geschworene die Grube aber gleich einmal unbelegt (40014, Nr. 245, Film 0111). Über seine Anwesenheit auf der Grube am 12. Februar 1811 berichtete Herr Schmiedel dann (40014, Nr. 245, Film 0155f): „Bei dieser Eisensteingrube konnten die Baue wegen des durch das eingefallene Thauwetter sehr schadhaft gewordene, 8 Lachter tiefen Fund- oder Tageschachtes nicht befahren werden, daher denn auch dem Lehnträger dieser Grube aufgegeben worden, selbigen sobald wie möglich wieder in guten haltbaren Standt zu setzen.“ Der Schacht war doch kaum ein Jahr alt ‒ wurde hier etwa schon beim Abteufen morsches Holz verbaut ? Auch fand der Geschworene Veranlassung zu folgender Veranstaltung: „Da bei Besichtigung des auf der Halde vorräthig sich befindenden Eisensteins sich hervorthat, daß derselbe sehr unrein mit vielen Gneis und Hornstein vermengt gefördert war; so wurde dem Lehnträger dieser Grube aufgegeben, diese Quantität Eisenstein sofort auszukutten und von Bergen möglichst zu reinigen, künftighin aber gleich in der Grube bei der Gewinnung darauf zu sehen, daß selbiger möglichste rein ausgehalten wird.“ Sonst wird das Zeug nämlich vom Bergamt neu taxiert... Wir gehen mal davon aus, daß beides zur Zufriedenheit des Geschworenen erfolgt ist, da er auf seine Anweisungen im nächsten Fahrbogen nicht wieder zurückkommt. Stattdessen liest man, daß das Ort in 8 Lachter Teufe nun Stunde 1,2 gegen Süd weiter getrieben werde (40014, Nr. 245, Film 0174). Am 20. August 1811 berichtete Herr Schmiedel (40014, Nr. 245, Film 0236), daß, „nachdem dort die Wetter sehr stehend geworden (wie solches in diesem Gebirge bei wenig Teufe sehr oft der Fall ist), von diesem weg 16 Lachter weiter gegen Mittag ein neuer Tageschacht bis auf die von ersterem gegen Mittag getriebene Strecke niedergebracht wird, um nicht nur frische Wetter auf die 9 Lachter unter Tage befindlichen Eisensteinbaue zu bringen, sondern auch leichtere Förderung von selbigen zu bekommen.“ Dieser neue Tageschacht war bereits 6 Lachter tief. Bis zum 6. November 1811 hatte der zweite Schacht bei 9½ Lachter Teufe das Hangende des Lagers erreicht (40014, Nr. 245, Film 0268).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 4. Februar 1812 hatte man dann bei
11¼ Lachter Teufe des Tageschachtes das Lager durchsunken und nun auf der
Sohle des neuen Tageschachtes ein Ort Stunde 7,6 gegen West, jetzt 6 ¾
Lachter erlängt, und ein zweites Ort Stunde 12,5 gegen Süd angeschlagen,
letzteres aber erst 2 Lachter fortgebracht (40014, Nr. 250, Film 0018).
Bei seiner Befahrung am 23. April 1812 fand Herr Schmiedel die
Grube mit 5 Mann belegt. Das Ort Stunde 8,2 gegen West war inzwischen bei
1 Lachter Weitung 7½ Lachter ausgelängt und das zweite in Richtung Stunde
1,1 gegen Süd 3¼ Lachter lang geworden. Auch werde hinter diesem Ort ein
Förstenstoß nachgerissen (40014, Nr. 250, Film 0044).
Am 13. Juli 1812 fand der Geschworene die Grube wieder unbelegt, diesmal aber, weil „die Wetter in dem neuen Tageschacht äußerst stehend waren.“ (40014, Nr. 250, Film 0072) Hm ‒ zu welchem Zweck doch gleich hatten die eben erst diesen zweiten Tageschacht geteuft ? Vielleicht hätte man es ja mal mit einem Durchhieb in die anderen Baue versuchen können ? Das Ausbringen im Quartal Crucis 1812 belief sich infolge der ‒ nennen wir es einmal „diskontinuierlichen“ ‒ Belegung auch nur auf gerade einmal 15 Fuder Eisenstein (40014, Nr. 250, Film 0116). Am 14. November fand Herr Schmiedel die Zeche erneut unbelegt (40014, Nr. 250, Film 0122). Danach taucht sie in seinen Fahrbögen nicht mehr auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst sein Nachfolger im Amt des
Berggeschworenen zu Scheibenberg, Herr Johann August Karl Gebler,
hatte „auf beschehene Mutung durch Christian Gottlob Richter und Cons.
zu Raschau an der Morgenseite von Friedlicher Vertrag das durch Absinken
eines kleinen Schurfes von einigen Lachtern entblößte Eisensteinlager“
wieder zu besichtigen. Demnach hatte besagter Christian Gottlob Richter
(vielleicht der Sohn von Christian Friedrich Richter ?) am
29. September 1823 erneut eine gevierte Fundgrube unter dem alten Namen
Fröhliche Zusammenkunft gemutet und erhielt diese auch am 7. Januar
1825 vom Bergamt bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 301b, 40014, Nr.
270, Blatt 24 sowie 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 301).
Der Geschworene fand die Grube bei seiner Befahrung am 14. Januar 1825 auch mit 4 Häuern, die sämtlich selbst Eigenlöhner gewesen sind, belegt vor (40014, Nr. 273, Film 0006). Über den Betrieb heißt es: „Aus dem hier befindlichen 9 Ltr. tiefen Tageschachte hat man ein Ort einige Lachter gegen Morgen getrieben und daselbst ein Eisensteinlager von dichtem Brauneisenstein angefahren, auch davon ein Quantum zu Tage gefördert.“ Das ,Quantum' war im Vergleich zu anderen Gruben recht ansehnlich: Herr Gebler hatte bereits am 9. Februar 1825 hier 25 Fuder und am 1. März sogar 48 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 273, Film 0015 und 0017). Ganz so erfolgreich war man in der Folgezeit dann aber nicht mehr. Von seiner nächsten Befahrung am 3. März 1825 heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 273, Film 0018): „Der hier vorhandene Tageschacht ist in der St. 4,5 niedergebracht und 10 Ltr. tief. Aus dem mittagabendlichen Stoße desselben hat man ein Ort nach genannter Weltgegend 2½ Ltr. lang auf dem mit dem Schachte angetroffenen Lager von Brauneisenstein, so etwas mit Braunstein vermischt ist, sodann aber nach der Markscheide mit dem Grubengebäude Friedlicher Vertrag Fdgr. in der Stunde 12,0 gleichfalls 2½ Ltr. fortgetrieben und bey diesem Betriebe eine Quantität des (?) Eisensteins gewonnen.“ Bis zum 11. November des Jahres belief sich die geförderte Menge Eisenstein dann nur noch auf 19 Fuder (40014, Nr. 273, Film 0075). Im darauffolgenden Jahr 1826 wird die Grube nur ein einziges Mal in den Fahrbögen des Herrn Gebler erwähnt, als er am 2. Mai des Jahres hier 54 Fuder Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 275, Film 0041). Auch 1827 fanden keine bergamtlichen Befahrungen statt und die Grube wird nur zweimal, am 15. Juni und am 11. Dezember 1827 in den Fahrbögen genannt, als hier 30 bzw. 43 Fuder Eisenstein zu vermessen gewesen sind (40014, Nr. 278, Film 0050 und 0089).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr 1828 ist die Grube
Fröhliche Zusammenkunft nur ein einziges Mal in den Fahrberichten des
Geschworenen Gebler erwähnt, als er am 8. Mai hier 37 Fuder
ausgebrachten Eisensteins zu vermessen hatte (40014, Nr.
280, Film 0033).
Auch 1829 war der Geschworene zwar dreimal hier, um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0131, 0179 und 0189), hat uns aber keine Fahrberichte aus dieser Zeit hinterlassen. Immerhin erfahren wir daraus, daß die Grube das ganze Jahr in Betrieb gestanden und immerhin 64 Fuder Brauneisenstein ausgebracht hat. Umgekehrt verhält es sich im Jahr 1830: Hier ist kein Ausbringen in den Fahrbögen festgehalten. Herr Gebler ist stattdessen am 9. Februar 1830 auf der Grube gewesen, um „auf Anordnung Eu. Königl. Bergamtes auf Fröhliche Zusammenkunft gev. Fdgr im Tännicht gefahren, eine zwischen den Eigenlöhnern auf dieser und dem Besitzer von Friedlicher Vertrag daselbst entstandene Feldstreitigkeit in Augenschein zu nehmen.“ (40014, Nr. 280, Film 0199f) Gerade erst hatte er am 13. Februar „die wegen der am 9ten d. Mon. bey Fröhliche Zusammenkunft abgehaltene Beaugenscheinigungs- Befahrung erforderliche Anzeige gefertigt“ (40014, Nr. 280, Film 0200), da mußte er schon wieder hin, denn nun hatte man bei Fröhliche Zusammenkunft festgestellt, daß es einen offenen Durchschlag vom Fundschacht von Friedlicher Vertrag gab. „Bin daselbst gefahren und habe die zwischen beyden streitig gewordene Markscheide vorläufig bestimmt und die zur Berichtigung dieses Gegenstandes nöthigen Zeichen in der Grube angebracht,“ heißt es im Fahrbogen (40014, Nr. 280, Film 0205). Damit war es aber nicht getan. Am 21. Juli 1830 war Herr Gebler vor Ort und hat „den bei Fröhliche Zusammenkunft ohnlängst vom Tage nieder zusammengegangenen Tageschacht besichtigt.“ Zum Wiederangriff werde man wohl einen neuen absenken müssen (40014, Nr. 280, Film 0244). Einen Monat später hat sich der Geschworene die Sache noch einmal angeschaut, aber wohl noch keine neuen Aktivitäten festgestellt (40014, Nr. 280, Film 0249) und als er am 19. Oktober 1830 wieder zugegen gewesen ist, hat er „auf Fröhliche Zusammenkunft die Eigenlöhner abwesend gefunden.“ (40014, Nr. 280, Film 0267) Nun, bei alldem kann in diesem Jahr ja auch ein Ausbringen gar nicht zustandegekommen sein...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das nächste Mal ist diese Grube
tatsächlich erst wieder am 7. Januar 1832 in den Fahrbögen des
Geschworenen Gebler erwähnt. An diesem Tage war er zugegen, um 27
Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr.
281, Film 0083).
Vom 19. März 1832 gibt es wieder einen Fahrbericht, dem zu entnehmen ist, daß die Grube wie schon zuvor mit 4 Eigenlöhnern belegt war (40014, Nr. 281, Film 0104). Weiter heißt es darin: „1) Bey 4 Ltr. Teufe hat man sich aus dem Schachte gegen Morgen gewendet und hat von da aus in einer krummen Linie herum gegen Abend einen Eisensteinabbau angelegt. Indessen kommt der Eisenstein auf den verschiedenen größeren und kleineren Nieren nicht mächtig vor. Nächstdem hat man 2) in weniger Entfernung vom Schachte gegen Mitternachtmorgen einen kleinen Stolln in das daselbst ansteigende Gebirge anzulegen angefangen, um den dort ziemlich nahe unter Tage vorhandenen Eisenstein abzubauen. Man ist damit zur Zeit auf die Länge von ohngefähr 5½ Ltr. gekommen.“ Am 17. Juli 1832 waren hier 58 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 281, Film 0133). Weitere Erwähnungen der Grube gibt es in den Fahrbögen dieses Jahres nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr 1833 war Herr
Gebler dreimal auf Fröhliche Zusammenkunft Fundgrube zugegen, um den ausgebrachten
Eisenstein zu vermessen. Die Mengen schwankten dabei zwischen 20 und
36 Fudern und summierten sich bis zum 20. Oktober auf 80 Fuder, 5 Tonnen (40014, Nr.
281, Film 0178, 0216 und 0227).
Obwohl die Fördermenge gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich angestiegen war, gab es über den Grubenbetrieb ansonsten wohl wenig bemerkenswertes zu berichten. Vielmehr schrieb der Geschworene nach seiner Befahrung am 4. Juni diesen Jahres nieder (40014, Nr. 281, Film 0197): „Dem jetzigen Anscheine nach ist das auf der Grube vorhanden gewesene Lager ziemlich abgebaut und man beschäftigt sich anjetzo damit, den Überrest desselben in den beyden ersten Lachtern unter Tage vollends wegzunehmen, wird aber noch Versuche in einigen Lachtern mehrer Teufe vornehmen. Da, wo das Lager in der Nähe des Tageschachtes beynahe ganz zutage aussetzet, nimmt man auch diesen übrigen Theil noch weg.“ Danach setzen die Nennungen dieser Grube in den Fahrbögen aus. Im Lehnbuch des Bergamtes Scheibenberg findet sich gleich neben der Eintragung der Verleihung vom 7. Januar 1825 der Vermerk: „losgesagt Reminiscere 1836“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 301).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Christbescherung Fundgrube bei
Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie oben schon zu lesen stand, hatte Steiger Carl August Weißflog am 14. Juni 1812 „auf Herrn Stadtrichter Querfurths Grund und Boden eine gevierte Fdgr. und eine Maaß, die schon gangbar gewesene Vier Gesellen Grube, nicht ohnweit von Friedrich Fundgrube“ gemutet (40014, Nr. 211, Film 0101 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 265f). Am 23. Dezember 1812 wurde Herrn Weißflog das Grubenfeld samt der ersten unteren Maß unter dem Namen Christbescherung Fundgrube bestätigt. Es lag, wie Friedrich Fundgrube und Karl's Glück auch, unweit südlich oberhalb des Förstelgutes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner ersten Befahrung der neuen Grube am 11. Februar 1813 (40014, Nr. 251, Film 0015) berichtete der Berggeschworene Christian Friedrich Schmiedel, die Grube sei mit 2 Mann belegt und man treibe in 8 Lachter Teufe des Fundschachtes ein Ort im Streichen des Lagers, welches 4¾ Lachter erlängt gewesen ist. Die Lagermächtigkeit reiche von ½ bis 1¼ Lachter und es bestehe aus „gelbem Ocker, mildem Gneis, Quarz, braunem Hornstein, etwas Braunstein und sowohl gelbem als braunem ockerigen, auch dichten Brauneisenstein.“ Bis zur nächsten Befahrung am 13. April 1813 hatte man besagtes Streckenort bereits auf 11 Lachter ausgelängt (40014, Nr. 251, Film 0036). Am 29. Juli des Jahres fand Herr Schmiedel in 7½ Lachtern Teufe ein neues Ort im Streichen des Lagers Stunde 8,1 gegen Ost angeschlagen, welches mit 1 Lachter Weitung auch schon 7¾ Lachter fortgebracht worden ist (40014, Nr. 251, Film 0080). Bis 5. November 1813 hatte dieses Ort bei einer Richtung von nun Stunde 6,3 gegen Ost 9 Lachter Länge erreicht (40014, Nr. 251, Film 0112). Bei diesem Ortbetrieb hatte man bis Luciae 1813 eine ganz beachtliche Menge von 70 Fuder Eisenstein gewonnen (40014, Nr. 251, Film 0113). Am 26. Januar hatte der Geschworene weitere 12 Fuder und am 18. März 1814 noch einmal 18 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 252, Film 0012 und 0028).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Fahrbogen des Geschworenen vom
6. Mai 1814 geht dann hervor, daß man diese Abbaustrecke, nun auch wieder
mit 1 Lachter Weitung, bereits 11 Lachter weit getrieben habe. Man folgte
weiter dem Lagerstreichen und war dabei in Richtung Stunde 5,5 nach
Nordost umgeschwenkt (40014, Nr. 252,
Film 0043f).
Am 27. September des Jahres fand Herr Schmiedel ein neues Streckenort einen halben Lachter tiefer und Stunde 5,5 gegen Ost in Betrieb. Es war bei 1¼ Lachter Weitung auch schon wieder 6 Lachter vorgetrieben (40014, Nr. 252, Film 0082). Dieses gab man aber bald wieder auf und verlegte sich auf das Gegenort Stunde 11,1 gegen Süd. Bis zum 29. Dezember 1814 war dieses Ort dann auch wieder bis 7⅞ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 252, Film 0105). Dennoch scheint die Erzführung hier wieder nachgelassen zu haben, denn am 10. Januar 1815 waren nur 13 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 254, Film 0011). Im Fahrbogen auf Reminiscere 1815 berichtete Herr Schmiedel am 20. Februar dann, das Ort sei in Stunde 7,0 verschwenkt und inzwischen 9¼ Lachter weit getrieben (40014, Nr. 254, Film 0015f). Nach wie vor fuhren zwei Mann auf Christbescherung Fdgr. an. Fast gleichlautend ist auch sein Bericht vom 17. Mai 1815: Mit Stunde 7,3 war die Strecke ungefähr in ihrer vorherigen Richtung geblieben und nun 10⅛ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 254, Film 0042). Bis zur nächsten Befahrung am 15. August 1815 war sie auf 12 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 254, Film 0067). Auch das Ausbringen war wieder deutlich angestiegen: Am 29. November 1815 konnte Herr Schmiedel dem Vermessen von 60 Fudern Eisenstein beiwohnen (40014, Nr. 254, Film 0100). Dann aber scheinen erneut die Grenzen der Bauwürdigkeit dieser Erzlinse erreicht gewesen zu sein: Von seiner Befahrung am 6. Dezember 1815 berichtete der Geschworene, daß man nun in nur noch 6 Lachtern Teufe ein neues Ort Stunde 1,5 gegen Nord angeschlagen und 7 Lachter getrieben habe (40014, Nr. 254, Film 0104). Diese Strecke war bis zum 26. Februar in die Stunde 2,2 umgeschwenkt und nun 9 Lachter lang geworden (40014, Nr. 257, Film 0018). Der Erfolg scheint sich auch in dieser Sohle in Grenzen gehalten zu haben, denn am 13. Mai 1816 fand Herr Schmiedel dann den Tageschacht auf 9 Lachter Tiefe abgesenkt und dort ein Ort im Streichen des Lagers Stunde 4,6 gegen West angeschlagen, dieses aber auch schon wieder 13 Lachter fortgebracht, vor (40014, Nr. 257, Film 0043). Wie das schon von anderen Gruben bekannt ist, begann nun ein „Stochern“ auf der Suche nach neuen Erzanbrüchen. Am 24. Oktober 1816 war in 8 Lachtern Tiefe schon wieder ein neues Ort Stunde 8,6 gegen Ost angesetzt und 9½ Lachter vorgetrieben (40014, Nr. 257, Film 0095).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Fahrbogen vom 5. Februar 1817 heißt
es, es stehe nun ein Ort in 8 Lachtern Teufe in Stunde 2,2 gegen Süd in
Betrieb und sei bei 1 Lachter Weitung 11 Lachter fortgebracht (40014, Nr. 258, Film 0014).
Ob dies schon wieder ein neues Ort ist, oder die vorherige Strecke so weit
abgeknickt ist, geht aus den knappen Beschreibungen nicht hervor.
In jedem Falle ist das Streckenort, das Herr Schmiedel am 21. April 1817 in Betrieb vorfand, ein neues: Es verlief in einer Richtung von Stunde 5,6 gegen West und war bei 1 Lachter Weitung bereits 8¾ Lachter getrieben (40014, Nr. 258, Film 0040). Bis zum 4. Juni des Jahres war dabei auch wieder ein Ausbringen von 30 Fudern Eisenstein zu verzeichnen (40014, Nr. 258, Film 0053). Auch Crucis 1817 lief der Betrieb vergleichsweise kontinuierlich mit zwei Mann Belegung weiter: Das letztgenannte Ort hatte bis zum 10. September 1817 bei einer Richtung von Stunde 5,5 gegen Abend eine Länge von 12½ Lachter erreicht (40014, Nr. 258, Film 0080). Bis zum 11. November wurden dabei wieder 57 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 258, Film 0101f). Luciae 1817 drehte man dann aber doch wieder um und schlug nun eine Ort Stunde 4,3 gegen Morgen an. Bis 3. Dezember war dieses schon wieder 8 Lachter ausgelängt (40014, Nr. 258, Film 0104). Bis zur nächsten Befahrung durch den Geschworenen am 12. Februar 1818 hatte man dieses Ort 9½ Lachter erlängt (40014, Nr. 259, Film 0013f). Herr Schmiedel notierte in seinem Fahrbogen noch: „Das Lager ist hier ⅝ Lachter mächtig, fällt 10 Grad gegen Abend und besteht aus mildem Gneus, Quarz, braunem Hornstein, ockerigen und dichten Brauneisenstein, auch Spuren von Braunstein.“ Am 10. April 1818 fand Herr Schmiedel die Grube unbelegt vor (40014, Nr. 259, Film 0031). Bis zum Verwiegetag am 28. Mai des Jahres waren bei Christbescherung 25 Fuder Eisenstein ausgebracht, sonst aber fand der Geschworene keine bemerkenswerte Änderung im Grubenbetrieb (40014, Nr. 259, Film 0050). Bei seiner nächsten Befahrung am 26. August 1818 war das Ort in der Richtung Stunde 5,0 gegen Ost auf 11½ Lachter ausgelängt und dahinter wurde eine ¼ Lachter hohe Strosse nachgerissen (40014, Nr. 259, Film 0078). Bis zur letzten Befahrung in diesem Jahr hatte man dieses Ort, nun in Stunde 6,6 verschwenkt, 13½ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 259, Film 0105). Auch im Folgejahr ging der Betrieb auf diesem Ort weiter und es waren (nun wieder in der Richtung Stunde 6,0 gegen Ost) 21 Lachter Streckenlänge erreicht (40014, Nr. 261, Film 0019f). Außerdem hatte man ein Ort in die Gegenrichtung, Stunde 1,3 gegen Süd auch schon 14½ Lachter ausgelängt. Auch bei dieser Grube fand Herr Schmiedel aber zu bemerken: „Da wegen der Unregelmäßigkeit des Lagers die Örter theils mit ansteigender, theils mit abfallender Sohle befunden wurden, so wurde dem Lehnträger aufgegeben, solches hinführo möglichst zu vermeiden und sowohl der Wetter, als der Förderung wegen auf regelmäßigeren Bau, der gegebenen Anweisung gemäß, zu achten.“ Beim Verwiegetag am 10. Mai waren hier 40 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 261, Film 0043). Ob dies seine ,gegebene Anweisung' gewesen ist, ist hier nicht festgehalten; aber am 29. Juni 1819 notierte Herr Schmiedel dann, es sei nun, der Erlangung frischer Wetter halber, ein neuer Tageschacht abgesunken worden und man habe bereits den Durchschlag auf die in 7 Lachter Teufe vom Fundschacht aus betriebenen Baue gemacht (40014, Nr. 261, Film 0061f). Wohl des zwischenzeitlich erfolgten Schachtabsenkens wegen sind in diesem Quartal nur 18 Fuder Eisenstein ausgebracht worden (40014, Nr. 261, Film 0077). Bei seiner Befahrung am 22. September 1819 fand der Geschworene dann zwei neue Ortbetriebe in 7 Lachtern Teufe des neuen Schachtes in Umgang vor, eines Stunde 1,3 gegen Nord war bereits 9 Lachter weit getrieben, und ein zweites Ort Stunde 8,4 gegen Ost 11 Lachter erlängt (40014, Nr. 261, Film 0080). Das erste hat man danach offenbar wieder aufgegeben, das zweite aber, nun in Stunde 6,1 bis zum 11. November auf 13 Lachter Länge fortgebracht (40014, Nr. 261, Film 0098). Am Verwiegetag am 21. Dezember 1819 wurde diesmal hier kein Eisenstein, dagegen aber wurden 13 Zentner Braunstein verwogen (40014, Nr. 261, Film 0113).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erste Befahrung der Grube im
nächsten Jahr durch den Geschworenen fand am 18. Februar 1820 statt,
worüber Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen berichtete
(40014, Nr. 262, Film 0014ff):
„Freytags, den 18. Februar 1820, bin ich auf mehrern bey Langenberg gelegenen Gruben, wovon erstere sechse auf einem und demselben Lager bauen, gefahren, und ist hierüber folgendes zu bemerken gewesen: (...)“ d.) Christbescherung Fundgrube anlangend. „Diese ebenfalls Eigenlehnerweise betrieben werdende Zeche ist mit 1 Versorger und 1 Knecht belegt, durch welche in 4¼ Lachter Teufe des neuen Tageschachtes ein Ort Stundte 11,6 gegen Mitternacht zu 2/3 betrieben wird, dessen Erlängung 9⅛ Lachter beträgt. Das daselbst ⅞ Lachter mächtige, von oben herein von den Vorfahren schon einigermaßen abgebaute Lager besteht aus gelbem Ocker, Gneus, Quarz, braunem Hornstein und dichtem Brauneisenstein, welcher auch unter der Sohle dieses Ortes sich niederzuziehen scheint.“ Man unterfuhr also in rund 8,5 m Teufe auch hier die Baue der Altvorderen... Immerhin war hier noch etwas zu holen und bis zum Verwiegetag am 26. April 1820 hatte man 36 Fuder Eisenstein gewonnen (40014, Nr. 262, Film 0038). Am 9. November 1820 war wieder ein Verwiegetag und wo Herr Schmiedel einmal da war, befuhr er auch einige der umliegenden Gruben. Über Christbescherung Fundgrube war zu berichten, daß ein Ort in 5 Lachter Teufe gegen Morgen inzwischen 13 Lachter erlängt gewesen ist (40014, Nr. 262, Film 0096). Man hatte sich also in die Gegenrichtung im Lagerstreichen verlegt. Dabei wurden am letzten Verwiegetag in diesem Jahr am 9. Dezember noch einmal 10 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 262, Film 0110).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner Befahrung der Grube am
6. Februar 1821 berichtete der Geschworene (40014, Nr. 264,
Film 0016):
d) Christbescherung zu Langenberg. „Dieses Grubengebäude ist mit 2 Mann (...) belegt, durch welche in 5 Lachter Teufe des Tageschachtes folgende Baue betrieben werden: 1.) Durch 1 Mann wird auf mehrgedachtem Lager ein Ort gegen Morgen betrieben, dessen Erlängung 14 Lachter beträgt, sowie 2.) mit 1 Mann ein zweytes Ort gegen Mittag belegt und 6 Lachter von besagtem Schachte fortgebracht ist. Vor ersterem ist das Lager ½ Lachter, vor letzterem aber gegen 1 Lachter mächtig und besteht aus gelbem Ocker, Gneus, Quarz, braunem Hornstein, dichtem Brauneisenstein und etwas Braunstein.“ Während man also das erste um einen Lachter fortgestellt hatte, ist das als zweites genannte schon wieder ein neues Streckenort... Dabei hatte man bis zum 15. Februar auch wieder 9 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0019f) und auch am 8. Mai waren auf Christbescherung Fundgrube 31 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 264, Film 0048). Die nächste Befahrung durch Herrn Schmiedel erfolgte am 29. Mai, worüber er in seinem Fahrbogen festhielt (40014, Nr. 264, Film 0056): „Dieses Berggebäude ist mit 2 Mann belegt, durch welche in 5 Lachter Teufe des Tage- oder Förderschachtes auf dem allhier aufsetzenden Eisensteinlager ein Ort gegen Mittag zu 2/3 betrieben wird, dessen Erlängung von obgedachten Schachte 8½ Lachter beträgt. Besagtes Alger ist vor selbigem ½ Lachter mächtig, fällt ungefähr 10 Grad gegen Mitternacht und besteht aus gelbem Ocker, mildem Gneus, Quarz, braunem Hornstein, ockerigen und dichten Brauneisenstein, auch Braunstein.“ Nun ging der Abbau also auf dem zweiten Streckenort um. Nebenbei gewann man auch ein wenig Braunstein mit: Beim Verwiegetag am 19. Juni 1821 hatte der Geschworene hier 6 Zentner zu vermessen (40014, Nr. 264, Film 0063). Außerdem waren bis zum 23. Juli 1821 auch wieder 19 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0072). Im Quartal Luciae scheint man weiter verteuft und dort ein neues Ort gegen Südost angeschlagen zu haben, denn von seiner Befahrung am 12. Dezember 1821 berichtete der Geschworene, es werde nun ein ¾ Lachter weites Ort in 6 Lachter Teufe betrieben und sei schon 8 Lachter erlängt (40014, Nr. 264, Film 0116ff). Aus dem Jahr 1822 fehlen Befahrungsberichte zu dieser Grube ganz (40014, Nr. 265). Ende 1822 löste dann Herr Johann August Karl Gebler den bisherigen Berggeschworenen in Scheibenberg Christian Friedrich Schmiedel in seiner Funktion ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue Geschworene fand die Grube
Christbescherung Anfang des Jahres 1823 wieder belegt vor und
berichtete über seine Befahrung
(40014, Nr. 267, Film 0038):
„Mittwochs, den 30ten d. M. (April) gefahren auf Christbescherung Fdgr. in Langenberg, belegt mit
Auf einem der hier häufig vorhandenen und in der Richtung von Morgengängen aneinander gereihten, größeren und kleineren Eisensteinlagern angelegt und mit 2 ohngefähr 8 Lachter von einander entfernten, dem einen den nöthigen Wetterwechsel zuführenden, nur 5 Lachter tiefen Schächten, ist man hier noch mit Versuchsarbeiten mittels Durchörterung des jetzt noch ziemlich armen Lagers damit beschäftigt; außer der Gewinnung des in sehr kleinen Nestern, meistens nur als Sand und (?), nur hier und da in derben Stücken vorkommenden Brauneisensteins (...?) Anlage eines regelmäßigen Abbaus zu entdecken.“ Ganz so arm scheint das bebaute Lager in der Folgezeit denn doch nicht gewesen zu sein, denn am 22. Mai 1823 hatte Herr Gebler hier 29 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 267, Film 0042). Die nächste Befahrung fand am 29. August statt, über die Herr Gebler in seinem Fahrbogen hinsichtlich des Abbaus festhielt (40014, Nr. 267, Film 0058): Eisensteingewinnung. „Aus zweyen beyderseits in der Stunde 6,0 angelegten, 6 Lachter tiefen, 10 Lachter voneinander entfernten Schächten, die sich in Betreff des Wettermangels mittels Communication unterstützen, gewinnt man anjetzt durch Ortsbetrieb aus dem oberen Schachte gegen Abend auf dem hier angetroffenen, ⅛ bis ¼ Lachter mächtigen Eisensteinlager braunen Eisenstein, während man zuvor das Lager in einer mehrere Lachter von dem Schachte entfernten, krummen und sich selbst zurücklaufenden Ovallinie (...?) durchfahren und untersucht hat.“ Auch bei seiner Befahrung am 22. Dezember 1823 hatte sich demgegenüber wenig geändert. Es heißt im Fahrbogen (40014, Nr. 267, Film 0084): „Man betreibt hier immer noch, wie in dem vorigen Quartale, die zwischen den beyden vorhandenen Schächten, 10 Lachter von einander entfernt, durch Um- und Durchfahrung des vorhandenen Lagers die ehemaligen Baue, indem man die mittels Ortsbetriebes angetroffenen, bald größeren, bald kleineren, ärmeren und reicheren Nieren (...?) abbaut und ihnen, was nöthig ist, weiter nachgeht.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem folgenden Jahr 1824 fehlt
ein Befahrungsbericht zu dieser Grube in den Fahrbögen von Herrn Gebler,
jedoch ist die Grube mehrfach an den Verwiegetagen genannt. Am 5. Juni
hatte derselbe hier 22 Fuder
(40014, Nr. 271, Film 0036),
am 11. August 15 Fuder
(40014, Nr. 271, Film 0053) und
am 4. November 1824 noch einmal 23 Fuder Eisenstein zu vermessen
(40014, Nr. 271, Film 0065). Grubenbetrieb
hat folglich stetig stattgefunden. Auch im Folgejahr 1825 fand offenbar nur eine Befahrung dieser Grube, und zwar im Sommer statt, worüber es allerdings heißt (40014, Nr. 273, Film 0048): „Desselben Tages (am 15.7.1825) habe ich mich auf einige der übrigen Eisensteinzechen daselbst und in Langenberg begeben und gefunden, dass man auf der Großzeche Fdgr., ingleichen auf der Gesegneten Anweisung Fdgr. wegen ermangelnder Wetter, und auf Osterfreude wegen ermangelnden Grubenholzes die Arbeiten (?) einstellen musste. Auf Christbescherung und auf Friedrich Fdgr. war man mit Ausscheiden der (?) gewonnenen Eisensteine beschäftigt, um selbige (?) vermessen zu lassen.“ Den Fahrbögen zufolge sind dennoch bis zum 26. Mai 40 Fuder (40014, Nr. 273, Film 0035) und bis zum 11. November 1825 weitere 32 Fuder ausgebracht und vermessen worden (40014, Nr. 273, Film 0075). Danach gibt es keine Erwähnungen der Grube Christbescherung in den Fahrbögen mehr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(St.) Michaelis Fundgrube bei
Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Grube diesen Namens bei Langenberg haben wir bislang nur in der Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) in den Jahren 1815 und 1816 gefunden. In diesem kurzen Zeitraum wurden demnach hier 55 Fuder Eisenstein gefördert. In den Fahrbögen der Geschworenen taucht diese Grube nicht auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Köhlers Hoffnung und Köhlers
gevierte Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese beiden Gruben sind im Zeitraum ab 1815 mit zwei größeren zeitlichen Lücken in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) aufgeführt. In der ersten Phase bis 1834 hat Köhlers Hoffnung Eisen- und Braunstein gefördert, in der zweiten Phase von 1842 bis 1850 wurde nur noch Eisenstein ausgebracht. Die Gesamtfördermenge summierte sich auf 1.413 t Braunstein und rund 402 t Eisenstein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Berggeschworene Schmiedel
hat die Grube Köhlers Hoffnung Fundgrube am 4. Oktober 1815 erstmals befahren und darüber in seinem
Fahrbogen festgehalten (40014, Nr. 254,
Film 0084):
„Auf dieser mit 4 Mann belegten Eigenlöhnergrube wird ein neuer Tageschacht niedergebracht, um das allhier aufsetzende, in mehreren Gruben in dieser Gegend bebaut werdende Eisen- und Braunsteinlager zu untersuchen und abzubauen. Es ist derselbe zur Zeit 5 Lachter tief und man hat in dieser Teufe bereits das Dach des aus gelbem Ocker, Gneus mit etwas untergemengtem Braunstein bestehenden Lagers erreicht.“ Aus der am folgenden Tag im Verleihbuch des Bergamtes Scheibenberg erfolgten Eintragung geht hervor, daß Christian Friedrich Köhler, Faktor des Vitriolwerks Silberhoffnung zu Beierfeld, am 28. August 1815 Mutung eingelegt hatte und nun „auf dem Rittergute Förstel bey Langenberg gehörigen Grund (…) an dem nach Mittag ansteigenden Gebirge“ eine gevierte Fundgrube nebst einem gevierten Maß und zwei gevierten Wehren auf Eisen- und Braunstein, aber auch alle anderen verleihbaren Metalle und Mineralien, unter dem Namen Köhlers Hoffnung Fdgr. bestätigt worden sind (40014, Nr. 43, Blatt 272). Eine weitere Befahrung erfolgte am 6. Dezember 1815, über die im Fahrbogen auf das Quartal Luciae des Jahres festgehalten ist (40014, Nr. 254, Film 0103): „Auf eben diesem Lager (wie bei Friedrichs Fundgrube) wird auf der benachbarten Köhlers Hoffnung Fundgrube bei 5 Lachtern Teufe des Fundschachtes ein Ort bey 1 Lachter Weitung Stunde 5,5 gegen Mittag Abend mit 4 Mann betrieben. Das vor selbigem beinahe horizontal liegende Lager führt hier nur schmale Trümer von 1 bis 2 Zoll mächtigen Braunstein, übrigens aber blos gelben und braunen Ocker. Erlängt ist dieses Ort von dem Fundschacht 4¾ Lachter.“ In Anbetracht des beschriebenen Lageraufbaus scheint die Erzführung nicht weit ausgehalten zu haben, denn bei seiner nächsten Befahrung am 13. Mai 1816 fand Herr Schmiedel ein neues Streckenort in derselben Tiefe, nun aber Stunde 2,3 gegen Nord, in Betrieb vor. Auch dieses hatte man bereits wieder 5½ Lachter „auf dem allhier aus verschiedenen Trümern von resp. 3, 4, 5, 6 Zoll Mächtigkeit bestehenden, milden Gneus, Quarz und Braunstein führenden Lager“ ausgelängt (40014, Nr. 257, Film 0044). Danach taucht Köhlers Hoffnung Fundgrube in den Akten erstmal für einige Zeit nicht mehr auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann folgte eine neue Verleihung an denselben
Muter Christian Friedrich Köhler, und (wahrscheinlich auch noch
dieselben) Konsorten, jedoch nur noch über eine gevierte Fundgrube unter
dem Namen Köhlers Fdgr., „auf dem mit dem Kunstschacht in 4
Lachter Teufe ersunkenen Eisensteinlager“ am 6. Juli 1820 (40169,
Nr. 194, Blatt 1). Die Grube lag wohl in den zurückliegenden vier Jahren
im Freien, wurde nun neu aufgenommen und mit einem neuen Schacht
aufgeschlossen. Daß hier ,Kunstschacht'
steht, ist sicher nur ein Schreibfehler, denn im folgenden Protokoll ist
wieder von einem ,Fundschacht' die Rede. Auch in der Eintragung im
Lehnbuch steht richtig ,Fundschacht‘ geschrieben (40014,
Nr. 43, Blatt 282). Der
letzteren ist noch zu entnehmen, daß sie wie ihre Vorgängerin „ohnweit
dem Dorfe Langenberg auf dem daselbst gegen Mittag ansteigenden Gebirge
auf Carl Friedrich Weigels in Raschau Grund auf dem in dieser Gegend
bekannten, (...) Eisensteinlager“ gelegen hat.
Aufgrund von
Beschwerden des Grundbesitzers, Carl Edler von Querfurth auf
Förstel, über die Flächeninanspruchnahme der auf seinen Fluren bauenden
Eigenlöhner kam es bekanntlich gleich am 7. Juli 1820 zu einer
II. Köhlers Fundgrube betreffend. „Die erst in gestriger Bergamtssitzung bestätigte Eigenlehnerzeche Köhlers gev. Fdgr. liegt gegen 65 Lachter von Reppels Fdgr. in Morgen im Raschauer Communwalde, ist von dem 7 Lachter tiefen Fundschacht gegen Mittag ein Ort ohngefähr 1 Lachter auf dem hora 5,4 streichenden, gegen Mitternacht fallenden, milden Gneus, braunen Hornstein, ockrigen und dichten Brauneisenstein und Schwarzeisenstein mit untergemengtem Braunstein führenden, 1½ Lachter mächtigen Lager betrieben, wobey jedoch zu bemerken, daß dieser Eisenstein von keiner besonderen Güte ist.“ Weitere Nachrichten über den Betrieb bei Köhlers Fundgrube aus dem Jahr 1820 haben wir noch nicht gefunden. Auch in den Fahrbögen des Geschworenen steht über Köhlers gevierte Fundgrube am 10. November 1820 nur (40014, Nr. 262, Film 0099), daß Herr Schmiedel die Grube an diesem Tage unbelegt vorfand.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Winterhalbjahr 1821 stand die Grube
aber wieder in Betrieb. Von seiner Befahrung am 6. Februar 1821 berichtete der
Geschworene (40014, Nr. 264, Film 0016ff):
e.) Köhlers Fundgrube ebenfalls zu Langenberg. „Mit den allhier anfahrenden 3 Mann (...) wird auf dem in 9 Lachter Teufe des Fundschachtes ersunkenen Lager ein Ort Stundte 11,6 gegen Mittag zu 2/3 betrieben, dessen Erlängung 7¾ Lachter beträgt und vor welchem das ½ Lachter mächtige Lager aus Gneus, drusigem Quarz, braunem Hornstein und dichten Brauneisenstein bestehet, jedoch ist auch seit voriger Woche ½ Elle mächtiger Braunstein erbrochen worden.“ Gegenüber der letzten Beschreibung 5 Jahre zuvor hatte man den Schacht offenbar fast auf die doppelte Teufe weiter abgesunken, oder aber gleich einen neuen geteuft, denn es ist ja wieder von einem ,Fundschacht' die Rede. Außerdem fand Herr Schmiedel Grund zu der Veranstaltung: „Da die Zimmerung auf dieser Grube, besonders vor dem soeben beschriebenen Orte von zu schwachem Holze, sowie auch sehr fehlerhaft befunden wurde, so daß solche dem sich äußernden Drucke nicht genugsam widersteht, so wurde dem Versorger aufgegeben, selbige sofort der gegebenen Anweisung gemäß zu verbessern und besonders, stärkeres Holz dazu zu nehmen.“ Hierzu gab es am 24. Februar 1821 auch einen Fahrbogenvortrag im Bergamt zu Annaberg, wobei dieses Herrn Schmiedel's Veranlassung bestätigte, jedoch nur mit einer Verwarnung und nicht mit einer Strafandrohung an den Eigenlöhner belegte (40169, Nr. 194, Blatt 2). Bis zum Verwiegetag am 20. März 1821 hatte man dabei 42 Zentner Braunstein ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0029). Dasselbe Ort wurde auch im folgenden Quartal betrieben und im Fahrbericht vom 12. April heißt es, es werde nun „mit 1 Lachter Weitung“ Stunde 11,2 gegen Mittag betrieben und sei 8¼ Lachter erlängt (40014, Nr. 264, Film 0038). Erneut bemängelte der Geschworene aber den Grubenausbau und traf folgende Veranstaltung: „Da die Zimmerung auf obbeschriebener Strecke sowohl, als auch in dem Fundschachte, sehr wandelbar und von zu schwachen Holze gefertiget, befunden wurde, so daß solche dem sich äußernden Drucke nicht genugsam widersteht, so wurde den Eigenlöhnern aufgegeben, solche ohne Anstand der ertheilten Anweisung gemäß zu verbessern.“ Auch darüber trug Herr Schmiedel am 28. April 1821 im Bergamt zu Annaberg vor, wobei dieses auch diesmal die Veranlassung des Geschworenen genehmigte (40169, Nr. 194, Rückseite Blatt 2). Bis zum Verwiegetag am 16. April 1821 hatte man auf Köhlers Fundgrube wieder 20 Zentner Braunstein ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0038) und am 30. April waren außerdem 8 Fuder, 2 Tonnen Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 264, Film 0044). So schritt der Betrieb fort und am 19. Juni 1821 hatte man erneut 26 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 264, Film 0063) und bis zum 7. August waren noch einmal 22 Zentner ausgebracht (40014, Nr. 264, Film 0077). Die nächste Grubenbefahrung durch den Geschworenen erfolgte am 28. August 1821. Darüber war zu berichten (40014, Nr. 264, Film 0086ff): „Dienstags den 28sten August (1821) bin ich auf mehrern der zu Schwarzbach und Langenberg gelegenen Gruben gefahren, wovon nachstehendes zu bemerken gewesen. (...)“ f.) Köhlers Fundgrube daselbst betr. „Dieses Berggebäude ist mit 4 Mann, als 1 Versorger, 1 Häuer und 2 Knechten belegt, welche folgendermaßen beschäftigt werden: In 6½ Lachter Teufe des neuen Tageschachtes wird auf dem daselbst Stundte 5,7 streichenden und etliche 20 Grad gegen Mitternacht fallenden, 1 Lachter mächtigen, aus mildem Gneus, Quarz, braunem Hornstein, dichten Braun- und Schwarzeisenstein bestehenden Lager ein Ort mit 2 Mann gegen Morgen, sowie mit ebenfalls 2 Mann ein dergleichen gegen Abend zu 2/3 betrieben und beträgt die Erlängung des ersteren 9 Lachter, die des letzteren aber 4¼ Lachter von dem Tageschachte. Sodann wurden auf dieser Grube in meiner Gegenwart 7 Fuder, 3 Tonnen (...) Eisenstein vermessen.“ Anscheinend sank das Ausbringen aber nun wieder ab, denn bis zum Verwiegetag am 18. September 1821 hatte man nur noch 12 Zentner Braunstein gefördert und ein Ausbringen an Eisenstein wird nicht mehr erwähnt (40014, Nr. 264, Film 0093).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Verwiegetag am 5. Februar 1822 ist
Köhlers Fundgrube mit einem Ausbringen von 50 Zentnern Braunstein
aufgeführt (40014, Nr. 265, Film 0014).
Am gleichen Tag befuhr der Geschworene auch diese Grube wieder, fand hier
4 Mann angelegt, durch die in 7½ Lachter Teufe zum einen ein Ort Stunde 11,6 gegen Süd betrieben wurde, das
8 Lachter Länge aufwies, sowie
ein zweites Ort Stunde 6,6 gegen West, welches erst 3¼ Lachter erlängt war (40014, Nr. 265, Film 0015).
Auch beim zweiten Verwiegetag am 20. März 1822 ist Köhlers Fundgrube
mit einem Ausbringen von 25 Zentnern Braunstein genannt (40014, Nr. 265, Film 0029).
Über seine nächste Befahrung der Grube am 5. August 1822 notierte Herr Schmiedel, man betreibe weiter zwei Örter in 8 Lachter Teufe; dasjenige gegen Süd hatte 9 Lachter Länge erreicht und das andere gegen West war 6½ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 265, Film 0058). Am 7. August folgte wieder ein Verwiegetag und erneut ist diese Grube mit einem Ausbringen von 30 Zentnern Braunstein aufgeführt. Im Dezember des Jahres 1822 wurde Herr Schmiedel dann in seiner Funktion als Geschworener in Scheibenberg durch Johann August Karl Gebler abgelöst. In seinen Fahrbögen taucht Köhlers Fundgrube in seinem ersten Dienstjahr aber nur einmal am Verwiegetag am 5. November 1823 auf, als hier 20 Zentner Braunstein zu verwiegen waren (40014, Nr. 267, Film 0074). Außerdem wurden dem Eigenlehner am 2. Januar 1823 vom Bergamt zwei gevierte Maße zusätzlich zum bestehenden Grubenfeld bestätigt (40169, Nr. 194, Rückseite Blatt 3).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung von Köhlers Fundgrube
durch Herrn Gebler fand dann am 12. März 1824 statt, wobei er die
Grube wie auch zuvor mit 4 Mann belegt fand (40014,
Nr. 271, Film 0016). Außerdem
notierte er in seinem Fahrbogen:
„Von dem in der St. 11,0 niedergebrachten 6 Ltr. tiefen Schachte hat man ein Ort gegen Mittag getrieben und mittelst desselben bey 10 Ltr. Länge ein Braunsteinlager von ohngefähr 3 bis 4 Zoll Mächtigkeit angetroffen, so man auch bebaute. Nächstdem fanden sich Eisenstein- Gewinnungsbaue vom Schachte aus gegen Abend sowohl als gegen Mittag, indem man hier (...?) wiederum mittelst Ortsbetrieb vom Schacht aus bey 3 Ltr. Länge gegen Abend und bey ihrem Forttrieb gegen Mittag ein Lager von Brauneisenstein, ohngefähr ⅛ bis ¼ Ltr. Mächtigkeit, angetroffen hatte.“ An Eisenstein waren bis zum 26. März des Jahres 25 Fuder ausgebracht und zu vermessen (40014, Nr. 271, Film 0021). Bis zum 8. Oktober hatte man erneut 23 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 271, Film 0061). Eine zweite Befahrung dieser Grube erfolgte am 6. November 1824, wobei die Belegung auf 5 Mann angestiegen war (40014, Nr. 271, Film 0067). Den Grubenbetrieb beschrieb Herr Gebler in seinem Fahrbogen so: „Von dem dortigen Schachte aus 10 Ltr. lang gegen Mittagabend und daselbst querschlagsweise 3 Lachter gegen Mitternachtabend befindet sich ein kleiner Firstenbau von derbem schwarzbraunem, zum Theil sehr dichten, mitunter glasköpfigen Eisenstein, der aber dermalen nicht zu befahren stand, weil man wegen des durch die auf dieser Grube vorhandenen großen allgemeinen Drucks entstandenen Bruchs daselbst eben mit dessen Aufgewältigung beschäftigt war. Von dem Schacht aus hat man vor den nach allen Weltgegenden, mit Ausnahme der gegen Mittag getriebenen Hauptörter, und mit den von diesen aus wiederum doppelt, nemlich nach beyden anliegenden Weltgegenden angelegten Querschlagsörtern meistens überall bald größere, bald kleiner Nester von Braunstein angetroffen, auch davon ohngefähr 50 Ctr. gefördert und am Tage liegen.“ Verwogen wurde das Ausbringen an Braunstein ‒ zumindest zufolge fehlender dementsprechender Eintragungen in den Fahrbögen ‒ im Jahr 1824 aber nicht mehr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im folgenden Jahr war Herr
Gebler nur einmal auf dieser Grube zugegen und notierte darüber in
seinem Fahrbogen (40014, Nr. 273, Film 0005):
„Desselben Tages (13.1.1825) gefahren auf Köhlers Fdgr. bey Langenberg, belegt mit
Braunsteinbau. „Mit Hilfe der vom Schacht aus gegen Mitternacht, gegen Morgen und gegen Abend getriebenen kleinen Strecken und der von solchen in der Winkelkreutzstunde wiederum querschlagsweise doppelt abgehenden Örtern gewinnt man überall Braunstein, wovon auch ein Theil wiederum vorräthig in der Kaue lag, ein anderer aber bereits abgeliefert war.“ Aufgewältigung. „Mit Aufgewältigung des in dem vorigen Quartal auf eine gegen Abend getriebenen Querschlagsstrecke unter einer Eisensteinförste entstandenen Bruches war man zu Stande gekommen und fertig geworden, sah sich aber eben dadruch genothiget, nach dem verlaßnen Bau, dem nunmehro nicht mehr wohl von hieraus beizukommen war, ein anderes Ort heran zu treiben, welches gelegentlich geschehen wird.“ Offenbar wurde eine Eintragung über das Verwiegen des ‒ ja bereits abgelieferten Teils des Ausbringens an Braunstein ‒ auch jetzt vergessen. Weitere Eintragungen zu dieser Zeche finden sich in den Fahrbögen des Geschworenen im Jahr 1825 nämlich nicht. Stattdessen wurden dem Eigenlöhner Christian Friedrich Köhler am 20. Januar 1825 noch zwei gevierte Maßen (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 292) und am 6. April 1826 vom Bergamt die nächste abendliche gevierte Maß zusätzlich zum bereits aus einer Fundgrube nebst zwei gevierten Maßen bestehenden Grubenfeld bestätigt (40169, Nr. 194, Blatt 4, Abschrift in 40014, Nr. 270, Blatt 48).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Erwähnung von Köhlers
Fundgrube in den Fahrbögen des Herrn Gebler datiert auf den 28. April 1826 (40014, Nr. 275, Film 0040),
wo es heißt, er habe an jenem Tage
„auf Meyers Hoffnung Fdgr. und Freundschaft Fdgr. im Tännicht und
Friedrich Fdgr bey Langenberg und Köhlers Fdgr. bey Raschau den
vorhandenen Braunstein theils besichtigt, theils verwogen.“
Vom Sommer des Jahres 1826 stammt dann der folgende Eintrag im Fahrbogen des Geschworenen (40014, Nr. 275, Film 0045): „Desselben Tages (am 5.6.1826) gefahren auf Köhlers Fdgr. im Kieferholze bey Raschau ohnweit Langenberg, belegt mit
Braunsteinbau. „Der vom Schachte aus bey 8 Ltr Teufe aus bey ohngefähr 12 bis 14 Ltr. Entfernung gegen Abend befindliche Braunsteinbau war nicht ohne Lebensgefahr zu befahren, indem eine ganze Anzahl Thürstöcke sowohl, als auch mehrere Kappen völlig zerdrückt, zersprengt und zerknickt waren und alle Augenblicke der Einsturz der Strecke eintreten (könnte), indem es der Grube an dem nöthigen Stammholze zur Verwahrung der Baue fehlte. Nun hatte man sich zwar bey Ermanglung desselben aus königl. Waldung (?) (Anmerkung von Herrn Gebler im Text: „da die Holzanweisung gewöhnlicherweise erst an diesem Lohntage ansteht.“) durch Ankauf von solchem aus eigenen Mitteln zu helfen und mit demselben die Baue zu verwahren gesucht, auch lag desgleichen noch etwas auf der Halde vorräthig. Da aber dasselbe seiner Quantität nach unzulänglich, auch viel (?), also habe ich den Eigenlöhnern untersagt, so lange, als jene gefährliche Strecke nicht verwahrt worden, den Braunsteinbau zu befahren und zu belegen und nun entweder die bald Statt habende Stammholzanweisung abzuwarten oder noch einige Stämme stärkeren Holzes einstweilen zu kaufen und in der Folge bey der bergamtlichen Berechnung der Grubenhölzer deren Bezahlung mit in Ansatz bringen zu lassen.“ Aua ‒ das war ja quasi eine behördliche Betriebsstillegung... Wahrscheinlich aber haben die Eigenlöhner unverdrossen weitergemacht, denn am 11. August 1826 waren für Herrn Gebler hier dennoch 8 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 275, Film 0060). Wir unterstellen aber mal, der Lehnträger hat bei der nächsten Grubenholzanweisung einen genügenden Anteil abbekommen, um den Ausbau in Ordnung zu bringen. Ende des Monats wollte Herr Gebler sich sicherlich überzeugen, daß alles in Ordnung gebracht war, doch liest man in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 275, Film 0069): „desselben Tages (am 31.8.1826) habe ich mich auf Köhlers Fdgr. bey Raschau begeben, habe aber daselbst wegen nicht hinlänglich vorhandenen Wetterwechsels, letzteren man sich durch Anlage eines neuen Tageschachtes zu verschaffen sucht, nicht fahren können.“ Zumindest in diesem Jahr fand danach keine erneute Befahrung durch den Geschworenen auf dieser Grube ausweislich seiner Fahrbögen mehr statt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im März 1827 wäre wieder eine Befahrung
an der Reihe gewesen, doch muß dieses Frühjahr ein sehr nasses gewesen
sein und so mußte Herr Gebler unverrichteterdinge wieder abreisen
(40014, Nr. 278, Film 0022):
„Freytags, den 16ten März habe ich mich auf mehrere der Langenberger Eisenstein und Braunsteinzechen begeben, als Köhlers Fdgr., Friedrich Fdgr. und Neu Geschrey Fdgr., dieselben aber wegen vieler Niederfälle (?) sich gesammelter zum Theil etwas aufgegangener Waßer, auch der Abwesenheit der Eigenlöhner wegen nicht befahren können.“ Daher fand im Jahr 1827 nur eine einzige Befahrung durch den Geschworenen statt, über die Herr Gebler in seinem Fahrbogen kurz notierte (40014, Nr. 278, Film 0061): Braunsteinbau. „Man betreibt hier in der Teufe von einigen Lachtern einen Braunsteinabbau, welcher sich zwischen dem zeitherigen Tageschachte und einem neuen, seit einiger Zeit, besonders des Wetterwechsels wegen, abgesenkten, von dem zeitherigen etwa 12 is 14 Ltr gegen Mittag Abend entfernten befindet. Es zeichnet sich diese Grube durch viele Brüche aus und bedarf deswegen häufiger und starker Zimmerung und daher auch noch mehrern Holzes.“ Ein zu vermessendes Erzausbringen ist in diesem Jahr nicht genannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr 1828 ist
Köhler's Fundgrube dagegen dreimal in den Fahrberichten des
Geschworenen Gebler erwähnt, als er hier am 6. Juni, am 14. Oktober
und am 18. November den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr.
280, Film 0033, 0076 und 0085).
Das Ausbringen im gesamten Jahr 1828 summierte sich demnach auf 31 Fuder, 3
Tonnen Eisenerz, aber keinen Braunstein. Befahrungen der Grube selbst sind dagegen nicht in seinen
Fahrbögen aus diesem Zeitraum dokumentiert.
Die nächste Befahrung durch den Geschworenen fand erst am 13. Mai 1829 statt, worüber er berichtete, die Grube sei mit 6 Mann belegt und (40014, Nr. 280, Film 0136f): „Mittelst Forttrieb von Örtern aus dem vor ohngefähr 1½ Jahren (...) gegen Mittag Abend neu angelegten Schacht hoffte man bessre und mächtigere Punkte des hier vorhandenen Lagers besonders in Betreff des Eisensteins anzutreffen. Inzwischen ist dieß nicht nur nicht der Fall gewesen, sondern das Lager wird in diese Richtung aufsteigend schmäler. Hinzu kommt, daß man von dem vorhandenen und gewonnenen Braunstein beynahe gar keinen Absatz mehr machen kann, so daß die Eigenlöhner beynahe Willens sind, (...) mittelst Schürfversuchen auf Silber etwas nur einigermaßen bauwürdiges anzutreffen, diese Grube lieber ganz liegen zu lassen.“ Obwohl diese Grube mit der genannten Belegschaft nicht gerade zu den kleinsten im Revier gehört hat, hatte man hier wenig Erfolg, verkaufbaren Eisenstein aufzufinden und der Braunstein war gerade nicht gefragt... Kann man schon mal die Lust verlieren. Doch war Herr Gebler in diesem Jahr noch zweimal vor Ort (40014, Nr. 280, Film 0139 und 0175), um den ausgebrachten Eisenstein zu vermessen. Mit insgesamt 26 Fudern, 7 Tonnen hatte man 1829 fast die Menge des Vorjahres wieder erreicht, was aber dennoch im Vergleich zu anderen Gruben des Reviers eine ziemlich unbedeutende Menge war. Aber noch gaben die Betreiber nicht auf. Aus dem Jahr 1830 gibt es erneut drei Nennungen von Köhlers Fundgrube in den Fahrbögen, als Herr Gebler hier den geförderten Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 280, Film 0230, 0252 und 0265), dessen Menge sich im Jahr 1830 doch wieder auf insgesamt 37 Fuder summierte. Grubenbefahrungen fanden in diesem Jahr aber offenbar wieder nicht statt. Aus dem folgenden Jahr 1831 gibt es überhaupt keine Erwähnungen dieser Grube in den Fahrbögen des Berggeschworenen. Erst am 7. Januar 1832 ist sie noch einmal genannt, indem Herr Gebler an diesem Tage hier eine Menge von 11 Fudern Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 281, Film 0083). Nicht anders war es im folgenden Jahr 1833 ‒ auch diesmal war der Geschworene nur einmal am 4. September des Jahres auf Köhlers Fundgrube, um die nur bescheidene Menge von 14 Fudern Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 281, Film 0216). Danach setzen die Erwähnungen in den Fahrbögen aus. Am 3. Juli 1835 sagte der Eigenlehner Köhler dann zunächst die drei gevierten Maßen und am 30. Juli 1836 schließlich auch die Fundgrube los (40169, Nr. 194, Rückseite Blatt 4f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fast zehn Jahre später kommt es zu einer Wiederaufnahme. Unter dem 4. April 1842 hielt der Annaberg'er Rezeßschreiber Lippmann, welcher zu dieser Zeit den abwesenden Geschworenen Theodor Haupt in Scheibenberg vertrat, in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 321, Film 0027), an diesem Tage „besichtigte ich wegen verlangter Bestätigung Köhlers gev. Fdgr. bei Langenberg.“ Am 27. November 1841 hatte Christian Friedrich Wolf aus Raschau die Grube „auf des Begütherten Carl Friedrich Weigel zu Raschau Grund und Boden“ unter dem früheren Namen Köhlers gevierte Fundgrube erneut gemutet. Die Bestätigung durch das Bergamt erfolgte dann am 7. April 1842 unter dem früheren Namen der Grube (40169, Nr. 194, Rückseite Blatt 5, 40014, Nr. 298, Blatt 62 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 346). Kurz darauf heißt es im Fahrbogen: „Am 12. April 1842 gab ich auf Köhlers gev. Fdgr. bei Langenberg die Ortung eine abzusinkenden Tageschachtes an; es macht sich derselbe durch den Wettermangel nothwendig, welcher in den, schon vor der Bestätigung dieser Grube zu ziemlicher Ausbreitung gelangten Bauen herrscht.“ Der neue Eigenlöhner ging es wohl noch einmal richtig an, denn schon am 18. April 1842 hatte Herr Lippmann hier schon den ersten Eisenstein „an das Obermittweider Hammerwerk“ zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0029). Bei seiner Gegenwart am 27. April war der neue Wetterschacht war schon 4½ Lachter abgesenkt (40014, Nr. 321, Film 0032). Dann trat aber erstmal wieder das altbekannte Problem auf und Herr Lippmann hielt in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 321, Film 0048): „Am 21. Juni und 22. Juni 1842 inspizierte ich die Eigenlöhnergruben bei Langenberg, im Tännicht und bei Schwarzbach, unter denen ich Köhlers, Ullricke, Bestehend Glück, Distlers Freundschaft und Meyers Hoffnung gev. Fdgr. unbelegt fand.“ Dennoch war am 12. Juli des Jahres schon wieder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0055). Luciae 1842 kehrte Herr Haupt dann wieder in sein Amt zurück und befuhr die Grube selbst erneut am 21. Dezember 1842. In seinem Fahrbogen heißt es nun einmal etwas ausführlicher zu dieser Grube (40014, Nr. 321, Film 0121): „Auf Köhlers gev. Fdgr. fahren abermals 2 Mann an, die schon viel Arbeit angewendet haben, ohne besonders vom Glück belohnt worden zu seyn. Über den untern Schacht hat man eine Kaue aufgerichtet und in 3½ Lachter Saigerteufe eine Strecke in SW 15 Lachter in Mulm getrieben, wobei man bald auf Nesterchen von Braunstein und Eisenstein, bald auf alten Mann gestoßen ist...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung durch den
Geschworenen Haupt erfolgte am 22. Februar 1843. Auch jetzt klingt
sein Bericht allerdings wenig optimistisch
(40014, Nr. 321, Film 0144): Auf
Köhlers gev. Fdgr. sind 3 Mann angelegt, hier hat man „den Tiefbau
verlassen, weil überhaupt nur wenig von Braunstein und Eisenstein und
viel mehr vom alten Mann zu finden war und (...) in dieser Sohle alles zu
Bruche gehen wollte.“ Man habe dann in 4 Lachter Teufe des Tageschachts
zunächst hora 9 NW getrieben, aber keine Anbrüche gefunden, daraufhin hora
2 Süd angehauen, womit man in 7 Lachter Entfernung ein Eisensteinlager
anzufahren hofft, „dessen man sich von früheren Zeiter her erinnerlich
ist.“
Na, dann... viel Glück. Auch hier handelt es sich offenbar um eine Art ,Nachlesebergbau'. Trinitatis 1843 wurde Herr Haupt erneut abgeordnet und Herr Lippmann trat wieder an seine Stelle. Der aber konnte die Grube am 3. Mai nicht befahren, „weil keiner der Eigenlöhner anwesend war.“ Auch am 15. Mai waren sie nicht auf der Grube und erneut am 13. Juni 1843 fand Herr Lippmann die Grube unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0173, 0177 und 0181). Das hätte nun schon Konsequenzen für den Lehnträger haben können, aber dennoch muß ein gewisser Betrieb umgegangen sein, denn am 30. August hatte Herr Lippmann hier Eisenstein an das Hammerwerk Obermittweida zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0201). Am 6. November 1843 hatte Herr Lippmann hier erneut Eisenstein, nur diesmal neben dem Nietzschhammer auch an den Rothen Hammer (bei Unterwiesenthal), zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0218f). Wie die Betreiber das angestellt haben und zu diesem Ausbringen gekommen sind, ist unklar, denn schon bei seiner nächsten Befahrung am 22. November 1843 fand Herr Lippmann die Grube erneut unbelegt... (40014, Nr. 321, Film 0225) Im Dezember 1843 kehrte Herr Haupt dann zunächst wieder nach Scheibenberg zurück. Am 1. März des Folgejahres 1844 hat er auch Köhlers gev. Fdgr. wieder befahren (40014, Nr. 322, Film 0020) und hier gefunden, es „hat die in Nord gehende Strecke und den obern Tageschacht verbrochen, auf der in Ost gehenden Strecke standen so viele Wasser, die dem Schachte zugehen, daß dieselbe nicht zu befahren war.“ Auch jetzt ist es uns mehr als unklar, wie diese Grube bei den eben beschriebenen Zuständen überhaupt etwas fördern konnte, doch war Herr Haupt nur drei Tage später wieder hier, um Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 322, Film 0020). Über seine Befahrung am 14. März 1844 hielt der Geschworene dann fest, nachdem sich die Wasser wieder verloren hatten, habe man angefangen, die in 4 Lachter Teufe des unteren Schachtes in NW. gehende Strecke zu gewältigen, welche bei 7½ Lachter Länge vom Schacht auf 5 Lachter Länge zugeschoben war. Vor derem Ort gab es zwar keine Anbrüche, doch „lädt das Gebirge zur Untersuchung ein.“ (40014, Nr. 322, Film 0026) Der obere Schacht und die Verbindungsstrecke waren noch verbrochen. Ende April 1844 wurde Herr Haupt dann schon wieder abgeordnet und diesmal vertrat ihn der Markscheider Friedrich Eduard Neubert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der letztgenannte wollte die Gruben bei
Langenberg erstmals am 7. Mai 1844 befahren, fand dabei jedoch auch
Köhlers gev. Fdgr. unbelegt (40014, Nr. 322,
Film 0038). Über diese
heißt es in seinem Fahrbogen noch:
„Von (...) derselben bemerke ich, daß im Laufe dieses Frühjahrs
daselbst fast alles zu Bruche gegangen sein soll, was sich zum Theil auch
durch mehrere entstandene Tagebrüche wahrnehmen läßt.“ Upps...
Auch im Juni und im September 1844 fand Herr Neubert die Grube ohne Betrieb vor (40014, Nr. 322, Film 0047f und 0068). Unter dem 15. November 1844 liest man dann im Fahrbogen, an diesem Tage „begab ich mich zuvörderst nach dem Berggebäude Distlers Freundschaft gev. Fdgr., um dasselbe zu befahren... Von da weg nahm ich hierauf meine Tour nach der Grube Köhlers gev. Fdgr. bei Langenberg, welche ich im Beisein des Lehnträgers derselben befuhr und worüber ich an das Königl. Bergamt bereits besondere Anzeige erstattet habe.“ Den Inhalt dieser Anzeige können wir uns lebhaft vorstellen... Da nun offenbar alles zubruchgegangen war, heißt es dann im Fahrbogen unter dem 7. März 1845, an diesem Tage „habe ich zuvörderst bei der zeither nicht in Betrieb gewesenen Grube Köhlers gev. Fdgr. bei Langenberg im Beisein des Grundbesitzers Weigel zu Raschau den Punct besichtigt, wo die Eigenlöhner bei Wiederbelegung der Grube einen neuen Schacht, der sich namentlich der Wetter wegen nothwendig macht, niederzubringen gedachten und wogegen der Grundbesitzer etwas nicht einwendete.“ (40014, Nr. 322, Film 0097) Diesen Plan nahm man auch unverzüglich in Angriff und so fand Herr Neubert am 10. April hier zwei Mann angelegt, die in dem 15 Lachter westlich vom alten Schacht liegenden Schachtabteufen arbeiteten. Das Abteufen hatte 3,8 Ltr. Teufe erreicht und bis dahin einen Mulm, „in welchem viel ganz abgerundete Geschiebe von Quarz, Hornstein und Glimmerschiefer liegen,“ durchsunken (40014, Nr. 322, Film 0104). Bis zum 2. Mai 1845 hatte man dabei 4 Fuder 2 Tonnen Eisenstein ausgebracht und Herr Neubert informiert uns in seinem Fahrbogen noch, daß diese an das Eisenhüttenwerk Rothenhammer zu Wiesenthal geliefert worden sind (40014, Nr. 322, Film 0111). Damit war die Euphorie aber wohl auch schon wieder vorüber, den am 18. und 19. Dezember 1845 fand Herr Neubert die Grube wieder unbelegt vor (40014, Nr. 322, Film 0159). Auch in seinem Fahrbericht vom 12. Februar 1846 heißt es, die Grube sei „im Winter nur periodisch belegt.“ Der neue Schacht hatte 4,5 Ltr. Teufe erreicht und in dieser Teufe war ein Ort 3 Ltr. hora 11,4 in SO. sowie eines 3,5 Ltr. in hora 3,5 NO. erlängt. Letzteres stand aber in Preßbau und soll auf die vom unteren Schacht aus getriebene Baue nur behufs Wetterwechsel durchgeschlagen werden. Vor dem anderen Ort wurde „Rotheisenstein, welcher erbsengroße Parthien von Titaneisenerz enthält und in einem Gemenge von Glimmerschieferbruchstücken, Hornstein und Mulm nicht sehr häufig liegt, (gefunden?). Wahrscheinlich ist diese Masse die Ausfüllung von durch Tagebau entstandenen Pingen, die vor circa 50 Jahren sich hier befunden haben sollen.“ Ein Vorkommen von Titaneisenerz (Ilmenit: Fe2+TiO3) in dieser Region wird hier das erste Mal erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleich im März darauf fand Herr
Neubert die Grube erneut unbelegt vor (40014, Nr. 322,
Film 0180). Am 7. Mai 1846
hat er hier zwar den ausgebrachten Eisenstein vermessen, konnte die Grube
aber wegen Wettermangel nicht befahren. Und auch am 8. September herrschte
Mangel an Frischwetter in der Grube, so daß sie wieder nicht belegt werden
konnte (40014, Nr. 322,
Film 0193 und 0218f).
Mit dem Quartal Reminiscere 1847 endet die Reihe der überlieferten Fahrbögen in diesem Aktenbestand. Bis zu diesem Zeitpunkt sind demnach auch keine weiteren Befahrungen auf dieser Grube erfolgt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reppels gevierte Fundgrube bei
Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch der Name dieser Familie ist uns in den Protokollen über eingelegte Mutungen im Bergamt Scheibenberg mehrfach begegnet. Bereits unter dem 19. Oktober 1778 findet man in den Verleihungsakten die Eintragung, daß Gottfried Reppel „auf das Obern Gebürges übern Langenberg auf Herrn Gottlieb Heinrich Treutlern Grund und Boden“, wo er „in 5 Lachter Teufe vom Tag nieder bricht“ und „zwey Lehn auf Braunstein“ mutete. Die bekam er auch „mit dem Nahme Grüner Zweig“ am 9. Januar 1779 verliehen (40014, Nr. 129, No. 43 / Film 0049). Eine Fundgrube diesen Namens gab es später erneut am Graul und am Adelsberg bei Raschau. Das nächste Mal mutete Johann Gottfried Reppel am 25. Mai 1784 eine gevierte Fundgrube nebst der ersten oberen und ersten unteren Maß auf Eisenstein und alle Metalle, allerdings zu dieser Zeit im Raschau'er Gemeindewald am Graul (40014, Nr. 153, Blatt 30). Am Graul, dem Höhenrücken zwischen dem Schwarzbach- und dem Oswaldbachtal nordwestlich von Langenberg, ging neben Eisensteinbergbau auch so umfangreicher Erzbergbau um, daß dieser mindestens einen weiteren Beitrag füllt und hier von uns im Wesentlichen ausgeklammert wird. Herr Johann Gottlieb Reppel wurde 1803 auch Geselle bei Christian Fundgrube und war 1808 Mitgeselle der Vier Brüder Fundgrube. Der Bergarbeiter Johann Gottfried Reppel, als Lehnträger, und dessen Consorten, als da genannt wurden Christian Ehregott Weißflog und Gottlob Hubrich, muteten im Februar 1804 außerdem einen Reppel Stolln bei Mittweida. Auch der Name Weißflog ist uns doch nicht neu...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten ist Reppels gevierte
Fundgrube bei Langenberg jedenfalls von 1816 bis 1822 und noch einmal von 1843 bis 1845 mit
Ausbringen aufgeführt. In dieser Zeit hat sie ausschließlich Eisenstein
gefördert und zwar insgesamt zirka 340 t (40166, Nr. 22 und 26).
Der Berggeschworene Schmiedel hat sie laut seinen Fahrbögen am 15. August 1815 das erste mal aufgesucht (40014, Nr. 254, Film 0068); sie scheint aber gleich einmal vom Pech verfolgt, denn Herr Schmiedel notierte, daß sie an diesem Tage „wegen der durch das anhaltende Regenwetter in den Fund- und Tageschächten aufgegangenen Grundwasser nicht befahren werden“ konnte. Demnach scheint sie aber auch schon einige Zeit zuvor aufgenommen worden zu sein. Tatsächlich datiert die Bestätigung der gevierten Fundgrube „im Raschauer Pfarrwald am linken Gehänge des Schwarzbachs“ an Johann Gottfried Reppel bereits auf den 31. Januar 1815 (40169, Nr. 274, Blatt 1), nach der Eintragung im Verleihbuch dagegen auf den 6. Juli 1815 (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 271). Auch am 6. November dieses Jahres befand der Geschworene die Grube bei seinem Besuch unbelegt (40014, Nr. 254, Film 0093). Endlich gelingt am 5. Dezember eine bergamtliche Befahrung, über die Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen berichtete (40014, Nr. 254, Film 0105f): „Durch die hier anfahrenden 4 Mann wird a.) bei 8 Lachter Teufe des Fundschachtes auf dem allhier aufsetzenden Eisensteinlagers ein Ort Stunde 7,0 gegen West und b.) ein zweites Ort Stunde 1,2 gegen Nord betrieben. Jenes ist 9 Lachter, dieses aber 7½ Lachter von dem Fundschacht erlängt und das allhier Stunde 5,2 streichende, beinahe 1 Lachter mächtige Lager, bestehet vor beiden Örtern aus Gneus, Quarz, braunem Hornstein, gelben ockerigen und dichten Brauneisenstein.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 18. März 1816 war der Geschworene
das nächste mal vor Ort, fand das Ort gegen Nord in der Richtung Stunde
11,0 noch in Betrieb, statt dem anderen nun aber ein neues mit gleicher
Richtung, aber gegen Süd, aufgenommen und 2 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 257, Film 0025).
Bis zum 3. Mai 1816 waren hier immerhin 25 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 257, Film 0039).
Dann aber stockte der Betrieb und am 8. Juli 1816 fand Herr Schmiedel die Grube unbelegt, diesmal aber heißt es: „wegen Mangel an Eisenstein Abnahme“ (40014, Nr. 257, Film 0058). Am 13. August des Jahres war sie aber wieder umgängig. Es fuhren wieder 5 Mann an, die bei 8 Lachter Teufe des Fundschachtes auf dem Eisensteinlager zum einen das schon bestehende Ort Stunde 11,2 gegen Nord betrieben und nun 9¼ Lachter erlängt hatten, sowie ein zweites Ort gegen Südwest, das jetzt 4 Lachter fortgebracht war (40014, Nr. 257, Film 0071). Außerdem hatte der Geschworene an diesem Tage noch 15 Fuder Eisenstein zu vermessen. Bis zur nächsten Befahrung am 24. Oktober 1816 war das erste Ort 10 Lachter lang geworden und das zweite 4¾ Lachter ausgelängt. Beide Örter wurden mit je 1 Lachter Weitung aufgefahren (40014, Nr. 257, Film 0094). Am 2. Dezember des Jahres war Herr Schmiedel noch einmal vor Ort, um 21 Fuder Eisenstein vermessen zu lassen (40014, Nr. 257, Film 0104f). „Sodann bin ich auf dieser Grube gefahren und habe daselbst nachstehendes zu bemerken befunden: Durch 2 Mann wird 1.) bey 8 Lachter Teufe des Fundschachtes auf dem allhier aufsetzenden Eisensteinlager ein Ort Stundte 11,3 gegen Mitternacht zu 2/3 betrieben und ist dasselbe von besagtem Fundschachte 13½ Lachter erlängt. Sodann wird 2.) durch 2 Mann ein anderweites Ort Stundte 3,2 gegen Mittag Morgen zu 2/3 und zwar mit 1 Lachter Weitung betrieben, dessen Länge 8 Lachter beträgt. Vor beiden Oertern besteht das ¾ Lachter mächtige, ungefähr 10 Grad gegen Mitternacht fallende Lager aus gelbem Ocker, mildem Gneus, Quarz, braunem Hornstein, ockerigen und dichten Braun- und Rotheisenstein.“ Dieser Fahrbogen enthält hier einen der seltenen Hinweise darauf, daß auch Roteisenstein (Hämatit) beigebrochen ist. Am 14. Januar 1817 lagen schon wieder 17 Fuder zum Vermessen bereit (40014, Nr. 258, Film 0013f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 10. März des Jahres 1817 fand der
Geschworene die Grube mit 4 Mann belegt und ebenfalls zwei, in
entgegengesetzte Richtungen angesetzte Örter in Betrieb vor (40014, Nr. 258, Film 0023f).
Diesmal aber hatte er auch Grund zu folgender Veranstaltung:
„Da die Zimmerung in dem Fundschachte sehr wandelbar befunden wurde, so habe ich dem Versorger qu. Gebäudes aufgegeben, daß dasselbe sofort in guten tüchtigen Standt gesetzt, die beyden Örter aber, vor welchen sich ebenfalls viel Druck äußert, mit stärkerem Holze verwahrt werden sollen.“ Von dergleichen hören wir auch nicht das erste Mal: Der Schacht kann kaum zwei Jahre in Betrieb gewesen sein und da wird das Ausbauholz schon ,wandelbar'... Es durfte wohl nichts kosten, was da eingebaut worden ist. Am 3. April 1817 erhielt der Eigenlehner noch eine weitere gevierte Maß Grubenfeld bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 275). Dennoch fand der Geschworene die Grube am 21. April 1817 wieder unbelegt (40014, Nr. 258, Film 0040). Auch am 10. September des Jahres fand Herr Schmiedel sie unbelegt, diesmal aber wieder mit der Begründung „wegen Mangel an Eisenstein Abnahme“ (40014, Nr. 258, Film 0081). Dieselbe Notiz findet man auch in allen vier Fahrbögen vom 26. Februar, vom 23. April, vom 1. September und vom 24. November des Jahres 1818 (40014, Nr. 259, Film 0018, 0035, 0082 und 0108). Eigentlich hätte sie nach drei aufeinanderfolgenden Terminen, an denen die Grube nicht belegt gewesen ist, bereits ins Freie fallen können. Aber wenn man ,mangelnde Abnahme' als Argument geltend machen kann... In Anbetracht des Vorstehenden weiß man nicht so genau, wie es Herr Reppel und Consortschaft eigentlich gemacht haben, aber am 8. Januar 1819 waren auf Reppels Fundgrube derwegen doch 66 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 261, Film 0002). Bei seiner Befahrung am 3. März 1819 fand Geschworener Schmiedel die Grube endlich einmal wieder belegt, und zwar mit 5 Mann, vor. Diese betrieben in 8 Lachtern Teufe des Fundschachtes ein Ort Stunde 12,4 gegen Nord, welches nunmehr bei 1¼ Lachter Weitung 11¾ Lachter fortgestellt war (40014, Nr. 261, Film 0020f). Herr Schmiedel fand auch Gefallen an dem Aufschluß des Lagers in der Ortsbrust, über den er notierte: „Das vor selbigem Ort so regelmäßig geschichtete ¾ Lachter mächtige Lager, fällt 14 Grad gegen Morgen und besteht von der Sohle weg aus
übrigens aber sowohl das Dach als die Sohle aus, dem Glimmerschiefer sich nähernden Gneus.“ Schon bei der nächsten Befahrung am 9. Juni 1819 aber fand der Geschworene Reppels Fundgrube wieder unbelegt... (40014, Nr. 261, Film 0053), und auch am 22. September, am 26. Oktober und am 11. November war niemand vor Ort (40014, Nr. 261, Film 0080f, 0092 und 0098). Dennoch waren bis zum 29. Juni des Jahres 33 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 261, Film 0061f). Am 15. November scheint die ganze Belegschaft aus dem Urlaub zurück gewesen zu sein: Jetzt fuhren gleich 6 Mann an und hatten das Ort Stunde 12,3 gegen Nord nun 13 Lachter ausgelängt; zudem noch ein zweites Ort Stunde 6,5 gegen Morgen angehauen und mit ¾ Lachter Weitung bereits 2¼ Lachter ausgelängt (40014, Nr. 261, Film 0100). Vor beiden Orten fand Herr Schmiedel das Lager „sehr regelmäßig geschichtet“ und nach Osten insgesamt ¾ Lachter, nach Norden dagegen 1⅛ Lachter mächtig. Am 15. Dezember 1819 waren auf Reppels Fundgrube noch einmal 16 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 261, Film 0110), „Übrigens ist bey dieser Grube (Reppels) außer, daß in voriger Woche mit dem in 8 Lachter Teufe des Fundschachtes ... gegen Mitternacht betrieben werdenden Orte bey 14 Lachter Länge der Durchschlag in den neuen Tageschacht gemacht und hierdurch sowohl ein frischer Wetterwechsel, als auch leichtere und wohlfeilerer Förderung bewirkt worden, nichts veränderliches vorgefallen,“ notierte Herr Schmiedel noch. Na ja, die teufen einen neuen Tageschacht, aber ,nichts veränderliches vorgefallen' ? Zugegebenermaßen aber war es auf allen Gruben rundherum gängige Praxis, neue Tageschächte niederzubringen, wenn man sonst nicht weiter wußte. Also, alles völlig normal...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seine nächsten Befahrungen der Gruben
am Emmler faßte Herr Schmiedel wie folgt zusammen (40014, Nr. 262, Film 0014ff):
„Freytags, den 18. Februar 1820, bin ich auf mehrern bey Langenberg gelegenen Gruben, wovon erstere sechse auf einem und demselben Lager bauen, gefahren, und ist hierüber folgendes zu bemerken gewesen:“ g.) Reppels Fundgrube unterhalb Langenberg anlangend. „Diese Eigenlehnerzeche ist mit 6 Mann, als 1 Versorger, 3 Häuern und 2 Knechten belegt, durch welche folgende Baue betrieben werden: In 7½ Lachter Teufe des Fundschachtes, woselbst das Lager ersunken worden und welches hier Stundte 10,6 streicht, ungefähr 15 Grad gegen Morgen fällt, wird 1.) durch 3 Mann ein Ort mit ⅞ Lachter Weitung und ansteigender Sohle Stundte 6,1 gegen Abend betrieben, dessen Erlängung von oberwähnten Fundschachte auf 15 Lachter sich erstreckt. Sodann wird 2.) mit 1 auch 2 Mann hinter diesem Orte ein ¼ Lachter hoher Förstenstos nachgerissen. Das Lager auf diesen Bauen ist ⅞ Lachter mächtig und besteht aus braunem Ocker, Gneus, Quarz, Hornstein, aufgelößtem Feldspath, dichten Brauns- und Rotheisenstein. Übrigens wird noch 1 Mann bey der Zimmerung beschäftiget. Da auf dieser Grube das Lager ein regelmäßiges Streichen und Fallen hat, so habe ich, um einen gehörigen, möglichst wohlfeilen Abbau zu erlangen, unter anhoffender Genehmigung Eu. Königl. Bergamtes veranstaltet, daß nach dem Streichen des Lagers ein Ort Stundte 10,6 gegen Mitternacht söhlig betrieben werden soll.“ Die angehoffte Genehmigung des Bergamtes hierzu wurde im Rahmen der Bergamtssitzung am 26. Februar 1820 auch erteilt (40169, Nr. 274, Blatt 2). Am 12. Mai des Jahres 1820 fand der Geschworene demgegenüber nichts Veränderliches im Grubenbetrieb vor (40014, Nr. 262, Film 0041). Auch an den Verwiegetagen ist die Grube in diesem Jahr nicht mit Ausbringen genannt. Am 7. Juli trug Herr Schmiedel zum Stand der Dinge noch einmal im Bergamt in Scheibenberg vor (40169, Nr. 274, Blatt 3). Erst nach seiner Befahrung am 10. November notierte Herr Schmiedel wieder über Reppels Fundgrube (40014, Nr. 262, Film 0099), man betreibe zum einen in nun 8 Lachter Teufe ein Ort mit aufsteigender Sohle Stunde 9,2 gegen Nordwest, welches inzwischen 16 Lachter Länge erreicht hatte, sowie ein zweites Stunde 4,6 gegen Ost, das 6 Lachter ausgelängt war. Das Lager war vor beiden Orten ½ bis ¾ Lachter mächtig. Neben den üblicherweise hier vorkommenden Mineralien nannte Herr Schmiedel hier auch Rotheisenstein. Außerdem traf er die folgende Veranstaltung: „Um eine leichtere und wohlfeilere Förderung, als auf dem zeitherigen Wege, auf obbeschriebener, mit vielen Krümmungen getriebener Strecke bis zu dem Fundschachte zu erlangen, habe ich veranstaltet: Daß die bey den obbeschriebenen Bauen näher liegenden neuen Tageschacht noch 1¼ Lachter lang mit ¼ bis ⅜ Lachter Höhe ansteigende Strosse nachgerissen und sodann die Förderung durch diesen erfolgen soll.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl doch eigentlich im
Winterhalbjahr der Wetterzug auf den kleinen Gruben gewöhnlich besser
gewesen ist, fand der Geschworene die Grube bei seiner nächsten Befahrung
am 6. Februar 1821 unbelegt vor (40014, Nr. 264,
Film 0017). Seine nächste
Befahrung im Sommer statt und darüber hielt Herr Schmiedel in
seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 264, Film
0017):
„Dienstags den 28sten August (1821) bin ich auf mehrern der zu Schwarzbach und Langenberg gelegenen Gruben gefahren, wovon nachstehendes zu bemerken gewesen. (...)“ d.) Reppels Fundgrube ebenfalls bey Langenberg. „Mit den allhier in Arbeit stehenden 3 Mann, als 1 Versorger, 1 Häuer und 1 Knecht, wurden folgende Baue betrieben: 1.) Auf der Sohle des 6 Lachter tiefen Tageschachtes, woselbst das Lager ersunken wurde, ist mit 2 Mann auf selbigem ein Ort gegen Mittag Morgen belegt, solches auch zur Zeit 5 Lachter erlängt. Das Lager daselbst ist ½ Lachter mächtig, fällt etliche 30 Grad gegen Mittag Abend und besteht aus Gneus, Quarz, braunem Hornstein, ockerigen und dichtem Brauneisenstein. Sodann wird 2.) in derselben Sohle ein Ort mit 1 Mann gegen Mitternacht Morgen in Quergestein zu Aufschließung des nach dieser Gegend noch ziemlich unaufgeschlossenen Grubenfeldes betrieben, dessen Erlängung von dem Tageschachte 3¾ Lachter beträgt.“ Hier ist von dem neuen Tageschacht die Rede, den man im Vorjahr abgesunken hatte. Ansonsten fand der Geschworene über die Grube nichts zu berichten; auch an den Verwiegetagen ist sie nicht mit einem Ausbringen erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was beim Betrieb der Grube eigentlich
herausgekommen ist, bleibt unklar, denn auch am ersten Verwiegetag im neuen
Jahr am 5. Februar 1822 erscheint die Grube nicht in der Aufführung des
Geschworenen (40014, Nr. 265, Film 0014).
Aus dem ganzen Jahr 1822 finden sich dann kleine Fahrberichte zu Reppels
Fundgrube aus der Feder des Geschworenen Schmiedel mehr. Da
auch die Nennungen in den Erzlieferungsextrakten 1822 aussetzen, dürfte
die Grube also zu diesem Zeitpunkt zum Erliegen gekommen sein.
Damit war aber noch nicht ganz Schluß. Einem Schreiben der Superintendur in Annaberg vom 22. Februar 1840 zufolge hat Pfarrer Schulze in Raschau nämlich am 28. Januar 1840 derselben angezeigt, daß Steiger Gäbler auf verpachteten Kirchengrund einen neuen Schacht teufe (40169, Nr. 274, Blatt 4). Der Name des Steigers ist hier mit einem ,ä' geschrieben, aber uns fällt zu diesem Zeitpunkt nur ein Steiger Gebler bei Wilkauer vereinigt Feld ein. Möglicherweise hat also nun die Königin Marienhütte auf dem im Freien liegenden Feld Untersuchungen anstellen lassen. Passiert ist in diesem Zusammenhang mangels weiterer Aktenlage allerdings offenbar nichts; die Untersuchungen sind sicher gleich wieder eingestellt worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach einer über zwanzigjährigen Lücke vermerkte
der nun als solcher hier amtierende Berggeschworene Theodor Haupt
unter den 22. Februar 1843 in seinem Fahrbogen
(40014, Nr. 321, Film 0144): „Auf
der noch nicht bestätigten Grube Reppels gev. Fdgr. hat man den Schacht 6 Lachter
tief gemacht und von ihm aus ein Ort hora 5 SW. ohngefähr 3,5 Lachter in
Mulm und etwas sehr schwebend liegenden Eisenstein getrieben.“
Am 4. April des Jahres hat Herr Haupt nur kurz vermerkt, er habe an diesem Tage „die neu gemuthete Grube besucht.“ (40014, Nr. 321, Film 0161) Die Neuverleihung an Carl August Weigel unter dem früheren Namen Reppels gevierte Fundgrube „unterhalb Riedels Fundgrube und hart an der Schneeberger Reviergrenze gelegen,“ ist am 6. April 1843 erfolgt (40169, Nr. 274, Blatt 8 und 40014, Nr. 298, Blatt 89). Danach wurde Herr Haupt erneut zu anderen Aufgaben abgeordnet und wie wir schon wissen, vom Annaberg'er Rezeßschreiber Lippmann vertreten. Der letztere wollte am 3. Mai 1843 die Grube befahren, konnte aber nicht, „weil keiner der Eigenlöhner anwesend war.“ (40014, Nr. 321, Film 0173) Grund dafür war wohl eine erneute Beschwerde der Kircheninspektion vom 20. April 1843, daß sie auch jetzt vom wieder aufgenommenen Bergbau überrascht und nicht informiert worden sei. Man habe deswegen über die Lokalgerichte (das Justizamt Grünhain) den weiteren Betrieb der Grube untersagt (40169, Nr. 274, Blatt 9ff). Zunächst einmal fand man aber auf der Bergamtssitzung am 21. April des Jahres hieran nichts auszusetzen, daß vielmehr die Kircheninspektion „eine irrige Auffassung der Sachlage“ habe und wies Herrn Lippmann an, er solle den Eigenlöhnern mitteilen, daß der Betrieb wieder aufzunehmen sei. Am 15. Mai hat dann Herr Lippmann hier „14 Fuder Rotheiesenstein Eisenstein für das Hammerwerk Erla vermessen. Außerdem wies ich den Eigenlöhner an, wozu aber der obwaltenden Verhältnisse halber Anzeige an das Bergamt von mir gelangt ist.“ (40014, Nr. 321, Film 0176f) Für die Abfuhr des Eisensteins war natürlich ein Fahrweg erforderlich, den Herr Lippmann bei dieser Gelegenheit bestimmt und ausgemessen hat, damit ein Zins für die Flächeninanspruchname mit dem Grundeigentümer verhandelt werden könne (40169, Nr. 274, Blatt 14). Die berechnete Fläche teilte das Bergamt auch an die Kircheninspektion mit. Bezüglich der hier ,obwaltenden' Verhältnisse berief die Kircheninspektion für den 27. September 1843 eine Lokalexpedition ein. Weil man im Bergamt immer noch keine Vorstellung hatte, worin denn eigentlich das Problem bestehe, sandte man Herrn Lippman hin. Dieser notierte in seinem Fahrbogen unter dem 27. September 1843, er habe an diesem Tage „in Folge bergamtlicher Anordnung einer von der Raschauer Kircheninspektion, wegen (?) auf den Raschauer Pfarrgrund Stücken auflässig gewordenen und in neuerer Zeit wieder in Betrieb genommenen Zeche Reppels gev. Fdgr., anberaumten Expedition“ beigewohnt (40014, Nr. 321, Film 0210). Darüber berichtete er dann (40169, Nr. 274, Blatt 23ff), es sei von der Kircheninspektion eine ziemlich große Runde zusammengerufen worden, bestehend aus:
Seitens der Kirchenvertreter wurde
angemahnt, daß schließlich sie die Grundeigentümer seien; sie aber zum
wiederholten Male keiner informiert habe.
Tatsächlich hatte es einen gleichartigen Fall bereits
Nun, das kann so aber nicht stimmen, denn Herr Reppel hatte ja erst 1815 bis 1820 in diesem Bereich noch geschürft... Es ging aber nicht um eine nicht eingeholte Genehmigung zur Einebnung der Bergbauhalde. Auch Herr Lippmann erklärte der Runde nun, daß die jetzt verliehene Grube genau an derselben Stelle läge, wo zuvor schon eine Grube gleichen Namens gebaut habe. Die Halde sei daher in jedem Falle als ein bergmännisches Gebäude und zur Fundgrube gehörig zu betrachten. Außerdem sei schließlich auch an den Pächter eine Anmeldung ergangen, weswegen er, als Vertreter des Bergamtes, die sofortige Wiederaufnahme der Grube zu fordern habe. Daß der Muter ihn informiert habe, bejahte auch der Pächter, Bäckermeister Freitag, wobei er den Lehnträger aber darauf hingewiesen habe, daß er sich an die Kircheninspektion wenden müsse. Ob Herr Weigel als Lehnträger dies getan hatte, wußte auch Herr Lippman nicht zu sagen und der erstere war ja nicht geladen. So ging dieser Termin ein bißchen wie das Hornburger Schießen aus und die Kirchenvertreter behielten sich nur weitere Kommunikation mit dem Bergamt vor. Aus dem nachfolgenden Schriftverkehr (40169, Nr. 274, Rückseite Blatt 28ff) bin ich nicht so richtig schlau geworden: Das Bergamt schrieb am 9. November 1843 noch einmal an die Kircheninspektion, sandte derselben eine Aufstellung von Verleihungen im Raschau'er Pfarrwald aus dem Zeitraum von 1780 bis 1843 und erklärte dann einerseits, daß die Geschworenen natürlich die eine Haldeneinebnung betreffenden Verordnungen von 1805 und 1819 kannten und daß eine solche genehmigt werden könne, wenn sie nicht mehr gebraucht würden. Andererseits aber hätte der Pächter die Einebnung beantragen müssen. Damit war man seitens der Kircheninspektion wohl nicht zufrieden. Im weiteren Akteninhalt findet sich dann ein mehrseitiges Schreiben der Kreisdirektion Zwickau, die sich nun eingeschaltet hatte, an das Oberbergamt, in dem zunächst die Vorgeschichte wiederholt ist (40169, Nr. 274, Blatt 44ff): Der Pächter Freitag hatte sich ja bei seinem Verpächter, also der Raschau'er Kirchgemeinde, beschwert, daß sein gerade urbar gemachtes Pachtgrundstück erneut durch den Bergbau beeinträchtigt werde ‒ und die wußte von gar nix, weil es Lehnträger Weigel versäumt hatte, auch den Grundeigentümer zu informieren. Vonseiten der Kreisdirektion schlug man daher vor, daß vor der Erteilung von Schurferlaubnissen auf geistlichen Lehen zukünftig stets auch die zuständige Kircheninspektion hinzuzuziehen sei. Dem folgte man auch im Oberbergamt. Weil man es auch in Freiberg als „nicht genügend“ ansah, nur den Pächter zu Lokalbesichtigungen heranzuziehen, traf man am 5. Oktober 1844 die Verordnung, daß durch die Bergämter diesem Vorschlag zu folgen sei.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Belegung bestand jedenfalls zum Zeitpunkt der Befahrung am 15. Mai 1843 in 3 Mann, welche in 6,75 Lachter Teufe des Tageschachtes ein Ort hora 5 in Ost betrieben, „welches bei der bis jetzt erreichten Erlängung von 4,5 Lachtern in altem Mann steht und womit man ein angeblich vorliegendes, mit schönen mächtigen Anbrüchen verlassenes Eisensteinlager anfahren will.“ Mit in 5,75 Lachter Teufe hauptsächlich gegen S und SW getriebenen Örtern ist man den vom früheren Abbau her noch stehengelassenen Pfeilern nachgegangen und hat dabei den Roteisenstein noch ausgehauen. Diese waren jetzt schon wieder verlassen und größtenteils versetzt... Außerdem hatte man bei 6,5 Lachter Teufe mit dem Schacht „ein 6 – 8 Zoll mächtiges Arsenikkieslager durchsunken, welches 55 Grad in Morgen fällt und späterhin Gegenstand des Abbaus werden soll.“ Über diese Besonderheit berichtete Herr Lippmann am 27. Mai 1843 auch im Bergamt Annaberg (40169, Nr. 274, Blatt 16f). Auch hier scheinen sofort wieder die üblichen Bewetterungsprobleme in den Sommermonaten eingetreten zu sein, denn am 13. Juni 1843 hat Herr Lippmann dem Eigenlöhner „wegen des benöthigten neuen Schachtes die nothwendigen Angaben gemacht.“ (40014, Nr. 321, Film 0181) Diesen neuen Schacht fand Herr Lippmann bei seiner nächsten Befahrung bereits 6,5 Lachter abgesenkt, wo man „das hier 15 Zoll mächtige Eisensteinlager ersunken hat. Nach der Sicherstellung des Schachtes wird man den Durchhieb einer Communicationsstrecke aufnehmen.“ (40014, Nr. 321, Film 0192) Außerdem wurde am 24. Juni 1843 in Annaberg zu Protokoll genommen, daß der hier geförderte Brauneisenstein „zur besseren Qualität im Refier“ gehöre, weswegen er auf 1 Thaler, 15 Neugroschen pro Fuder zu taxieren sei (40169, Nr. 274, Blatt 18). Bis zum 18. August 1843 war dies aber noch nicht bewerkstelligt und so fand an diesem Tage Herr Lippmann „die Eigenlöhnergruben dieser Gegend theils wegen Wettermangel nicht zu befahren, theils der eingefallenen Ernte wegen außer Belegung.“ Nur Wilkauer vereinigt Feld, Gott segne beständig und Riedels Fundgrube standen in Betrieb (40014, Nr. 321, Film 0200). Von Reppels Fdgr. berichtete er, daß „man mit dem Ausschlagen des Eisensteinhaufwerks beschäftigt war, und habe ich zu erwähnen, daß, da der Durchschlag der Communikations- Strecke noch nicht erfolgt ist und Wettermangel die Befahrung ziemlich hinderte, ich den Eigenlöhnern angerathen habe, sich durch Einbau von Wetterlutten im alten Tageschacht, deren oberes Ende über die Hängebank noch circa 5 Ellen in die Höhe zu führen und (...?), wahrscheinlich Hilfe zu verschaffen.“ Den ausgeschlagenen Eisenstein hat Herr Lippmann dann am 12. September wieder „an das Hammerwerk Erla“ vermessen (40014, Nr. 321, Film 0201). Am 21. September 1843 fand erneut eine Befahrung statt. Herr Lippmann fand 3 Mann auf Reppels Fdgr. angelegt und seinen Vorschlag umgesetzt (40014, Nr. 321, Film 0208): Man hatte „durch Einbau von Wetterlutten und Aufsetzen eines Wetterschutzes den bis dahin herrschenden Wettermangel beseitigt und dadurch ermöglicht, das mit dem neuen Tagschachte bei 7 Lachter saigerer Schachtteufe ersunkene ca. 0,25 Lachter mächtige, aus Roth- und Brauneisenstein mit Hornstein bestehende Lager, welches hora 11 streicht und im Ganzen genommen nur sehr flach gegen Abend einzufallen scheint, in Abbau nehmen zu können. Zu diesem Behufe hat man vom Schacht weg das Lager mittelst eines Streichortes 10 Lachter gegen Mittag und 6 Lachter gegen Mitternacht verfolgt und mit ziemlich gleich bleibender Mächtigkeit aufgeschlossen, auch bereits in der Fallrichtung des Lagers mit einigen steigenden Örtern gegen Morgen auf demselben ausgelängt und einige Pfeiler abgebaut.“ Manchmal gibt es so einfache technische Lösungen und es ist immer wieder erstaunlich, daß man die Wetterprobleme auf den Gruben dieser Revierteils einfach nicht in den Griff bekam. Vielleicht war es aber auch gar nicht gewollt, konnte man sich doch damit über die Sommermonate Zeit für andere Arbeiten verschaffen und im Winter die Weilarbeit fortsetzen... Weil es jedenfalls eine praktikable Lösung gewesen ist, gab es auch hierzu am 30. September einen Fahrbogenvortrag im Bergamt zu Annaberg (40169, Nr. 274, einer nachträglichen Heftung geschuldet, auf den Rückseiten der Blätter 22 und 26).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 26. Oktober 1843 war hier erneut Eisenstein an das Hammerwerk Erla vermessen. Bei seiner Befahrung der Grube fand Herr Lippmann keine erwähnenswerten Veränderungen vor (40014, Nr. 321, Film 0216). Noch einmal war Herr Lippmann am 22. November 1843 auf der Grube und notierte in seinem Fahrbogen, die drei Eigenlöhner bauten weiter das Lager in 7 Lachter Teufe „nach Mittag hin durch ziemlich unregelmäßigen Abbau“ ab (40014, Nr. 321, Film 0224). IM Dezember 1843 kehrte Herr Haupt dann zunächst wieder nach Scheibenberg zurück. Am 29. Januar 1844 hat er Reppels Fdgr. wieder befahren und darüber berichtet (40014, Nr. 322, Film 0002), daß von den anfahrenden 3 Mann „zwei den Neuschacht tiefer absinken, der dritte in der 7 Lachtersohle das 7 Lachter vom Schacht hora 4 in Ost gehende Ort auf dem Mulm- und Eisensteinlager forttreibt und hiermit 2 Lachter vorgerückt ist. Das Lager ist aber auf wenige Zolle zusammengedrückt und enthält nur Spuren von Eisenstein... Zuvor hatte man in Richtung Süden 10 Lachter getrieben, wo es noch 10 – 15 Zoll mächtig ansteht. Dieser Ortsbetrieb ist aber aus Mangel an Holz eingestellt.“ Seine nächste Grubenbefahrung fand am 4. März 1844 statt (40014, Nr. 322, Film 0020f). Dem Fahrbogen ist zu entnehmen, daß man das Schachtabteufen des Wasserzudrangs wegen verlassen mußte und stattdessen ein zweites Ort 5 Lachter vom Schacht auf demselben Lager hora 10 NW angehauen und mit diesem Roteisenstein ausgerichtet hat, der nesterweise in Quarz einbricht. Vor dem Ort sah man drei Lager, zwischen 2 Zoll und 1¼ Elle mächtig, in 18 Zoll Abstand übereinander anstehen. Auch das im vorigen Fahrbogen erwähnte Versuchsort wird weiter betrieben, obwohl das Lager dort nur noch aus Quarz und Glimmerschiefer bestand. Auch hierzu wurde am 30. März 1844 von Herrn Haupt im Bergamt vorgetragen (40169, Nr. 274, Blatt 33). Schließlich war Herr Haupt noch einmal am 23. April 1844 auf dieser Grube, worüber man in seinem Fahrbogen liest (40014, Nr. 322, Film 0031f), daß auch der Betrieb des in 7 Lachter Teufe vom Neuschacht getrieben Ortes sistiert werden mußte, weil hier die Wasser 0,5 Lachter hoch stehen. Dagegen wird nun ein bei 6 Lachter Teufe in SW. gehendes Ort in Betrieb gehalten, welches bereits zirka 6,5 Lachter fortgestellt, bei 4,8 Lachter allerdings in alten Mann geschlagen ist. Um diese Strecke in festes Gestein zu bringen, hat man die Sohle auf 3 Lachter Länge nachgenommen, so daß sie nun auf 0,6 Lachter Höhe von der Sohle „in einem weißen thonigen Gestein (von den Arbeitern Wacke genannt), einer 0,2 Lachter mächtigen Lage von leicht thonigem... Rotheisenstein, der jedoch nicht schmelzwürdig ist und worinnen rundliche, 2 – 4 Zoll große Parthien von Arsenikkies vorkommen, sowie einer 0,15 Lachter mächtigen Lage von Quarz ansteht. Über dem Quarz nimmt alter Mann die übrige Ortshöhe ein.“ Danach kam es zu einem Streit unter den Gesellen (40169, Nr. 274, Blatt 35ff). Der Lehnträger, Steiger Carl August Weigel aus Raschau, erschien dazu am 29. April 1844 vor dem Bergamt in Annaberg und legte eine Abrechnung auf Luciae 1843 und Reminiscere 1844 vor. Dieser Geschichte ist zunächst einmal zu entnehmen, daß er noch zwei Mitgesellen hatte, nämlich einen Carl August Weigel in Langenberg und einen August Friedrich Riedel. Die Anteile an der Fundgrube hatten diese drei untereinander wie folgt aufgeteilt:
Das waren nach Adam Ries in Summe also 125 Kuxe, die übrigen drei Kuxe waren offenbar, wie bei gewerkschaftlichen Gruben schon immer üblich, dem Grundeigentümer, der Gemeinde und der Knappschaft vorbehalten. Der Abrechnung ist dann zu entnehmen, daß in diesem Halbjahr Kosten von 125 Thalern, 18 Groschen und 9 Pfennigen entstanden waren. Aus dem Verkauf von 27 Fudern, 3½ Tonnen Eisenstein hatte man einen Erlös von 76 Thalern, 5 Groschen und 2 Pfennigen erzielt. Die Differenz hatte Steiger Weigel geviertelt und jeder der anderen beiden hatte nun also auf ein Viertel noch 12 Thaler, 10 Groschen und 9 Pfennige einzuzahlen. Weil nun aber Herr Riedel schon öfter mit seinen Gesellenbeiträgen im Rückstand gewesen sei, beantragte Steiger Weigel nun bergamtliche Strafandrohung gegen diesen, um die Nachzahlung zu erzwingen. Das war auch völlig rechtens und das Bergamt setzte dem Gesellen Riedel eine Frist von 28 Tagen, die ausstehenden Beiträge auszugleichen. Weil Herr Riedel bis zum 30. Juli 1844 dem aber nicht nachgekommen ist, fuhr Steiger Weigel an diesem Tage wieder nach Annaberg und beantragte nun die Einziehung der Kuxe Riedel's. Auch dies war rechtens, das Bergamt wies am 6. August 1844 die „Gegenbuchexpedition“ an, diese Kuxe auszutragen. Die beiden verbliebenen teilten das Viertel anschließend wieder unter sich auf, so daß Steiger Weigel nun ein Drittel und Gesellen Weigel zwei Drittel der Anteile gehörten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ende April wurde Herr Haupt
dann schon wieder abberufen und diesmal hat ihn in seiner Funktion als
Geschworener in Scheibenberg der Markscheider Friedrich Eduard Neubert
vertreten. Eine der ersten Aufgaben des Vertreters
war (40014, Nr. 322, Film 0035),
den Punkt zu besichtigen, „wo
der Lehnträger von Reppels gev. Fdgr. C. A. Weigel zu Langenberg den, auf
des Erbrichters Nestler zu Mittweida Grund und Boden gemutheten Gang
auszuschürfen, beabsichtigt und worüber ich dem Königl. Bergamte bereits
Anzeige erstattet habe.“
Hatte Herr Weigel auf Reppels Fdgr. gerade nicht genug zu tun ? Besagter Punkt lag jedenfalls an der Flurgrenze zwischen Markersbach und Schwarzbach oberhalb von Andreas Fdgr. auf dem Gegentrum des Vater Abraham'er Lagers und fällt damit höchstens am Rande in unser für diesmal gewähltes Arbeitsgebiet. Wie aus späteren Eintragungen in den Fahrbögen zu folgern ist, wurde der dort vermutete Eisensteingang auch nicht aufgefunden und die Sache dürfte im Sande verlaufen sein. Ob dieser Schurfversuch an anderer Stelle der Grund dafür war, weiß man nicht genau; jedenfalls fand Herr Neubert nach dem doch recht schwungvollem Beginn in diesem Jahr die Grube am 28. Mai 1844 unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0042). Auch am 12. Juni des Jahres fand Herr Neubert die Grube unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0056f) und am Schluß seines Fahrbogens aus der 10. bis 13. Woche Crucis (September) 1844 fügte er noch an (40014, Nr. 322, Film 0068): „Übrigens bemerke ich noch, daß ich in No. 10te und 11te Woche zu mehreren Malen die Gruben Distlers Freundschaft, Hausteins Hoffnung, Friedrich, Gelber Zweig, Köhlers und Reppels gev. Fdgr. bei Langenberg... besuchte, diese aber stets unbelegt fand.“ In seinen Fahrbögen findet man dann noch eine Eintragung unter dem 7. März 1845, daß er an diesem Tage „bei dem wegen nicht berichtigter Quatembergelder ins Freie gekommenen Berggebäude Reppels gev. Fdgr. bei Langenberg die Taxation der dasigen Inventarienstücke...“ vorgenommen hat (40014, Nr. 322, Film 0097). Ach schau an: Das war der Grund. Wie man dann auch in der Grubenakte findet, hatte der Lehnträger bis Luciae 1844 viermal in Folge die Quatembergelder nicht an die Bergamtskasse eingezahlt. Daraufhin wurde die Grube bergamtlicherseits am 18. Januar 1845 ausgetan, also aus dem Verleihbuch ausgetragen (40169, Nr. 274, Blatt 44, allerdings ist hier die Blattnummerierung in der Akte durcheinandergekommen und nach Blatt 59 geht es noch einmal mit Nummer 40 weiter). Die ziemlich kurze Liste der Inventarienstücke geben wir hier gern wieder, gibt sie uns doch einen Einblick in die technische Ausstattung einer solchen Eigenlehnergrube (40169, Nr. 274, Blatt 42). Sie bestand in:
Das ganze taxierte Markscheider Neubert auf einen Wert von 4 Thalern, 19 Groschen und 2 Pfennigen, wovon allerdings allein die Kaue 3 Thaler ausmachte. Man vergleiche diese Liste doch einmal mit der
technischen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das war aber noch nicht der allerletzte Akt: Steiger Weigel schien es noch einmal versuchen zu wollen und erklärte am 26. März 1845 vor dem Bergamt, das angeführte Inventar der ins Freie gekommenen Grube zu dem von Neubert taxierten Preis wieder übernehmen zu wollen (40169, Nr. 274, Blatt 43). Am selben Tage wurde ihm auch die Grube erneut bestätigt, wobei Steiger Weigel zugleich erklärte, die Grubenschuld mit übernehmen zu wollen (40169, Nr. 274, Blatt 45). Keinen Monat später stellte er dann aber den Antrag, die Grube ab Trinitatis 1845 in Fristen setzen zu lassen (40169, Nr. 274, Blatt 46). Ob tatsächlich noch einmal bergmännische Arbeiten auf Reppels Fundgrube erfolgt sind, weiß man nicht so genau. Das letzte Aktenstück in der Grubenakte ist jedenfalls eine Geldforderung von Nestler & Breitfeld in Erla über mehr als 33 Thaler für „Brod und Eisenwaaren“ an Weigel, worüber ihn das Bergamt am 21. Dezember 1850 schriftlich in Kenntnis setzte (40169, Nr. 274, Blatt 47ff). Ob er die Summe beglichen hat, wissen wir nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freundschaft Fundgrube bei
Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wird eine Freundschaft Fundgrube im Zeitraum von 1819 bis 1827 aufgeführt (40166, Nr. 22 und 26). In dieser Zeit hat die Grube ausschließlich Braunstein, und zwar insgesamt knapp 54 t ausgebracht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der zuständige Berggeschworene, Christian Friedrich Schmiedel, befuhr die Grube erstmals am 11. November 1819 (40014, Nr. 261, Film 0098) und berichtete, es werde durch zwei anfahrende Mann in 4 Lachter Teufe des Fundschachtes ein Ort mit 1 Lachter Weitung Stunde 7,6 gegen West getrieben und sei 2½ Lachter erlängt. Das Lager vor dem Ort war ⅞ Lachter mächtig und führe „braunen Ocker, milden Gneus, Quarz und Braunstein.“ Am 22. Januar 1820 wurde die Verleihung einer gevierten Fundgrube „bei dem Dorfe Langenberg am linken Ufer des Dorfbachs gegen Mittag... auf des Herrn Premier Lieutenands von Querfurth auf Förstel und Herrn Wagner zu Schwarzbach Grund... aufsetzenden Eisen- und Braunstein führenden Lager“ unter dem Namen Freundschaft Fdgr. an Schichtmeister Christian Gottlob Neuberth im Lehnbuch eingetragen (40014, Nr. 43, Blatt 277). Die nächste Befahrung durch den Geschworenen erfolgte am 18. Februar 1820, worüber im Fahrbogen recht ausführlich zu lesen steht (40014, Nr. 262, Film 0014f): „Freytags, den 18. Februar 1820, bin ich auf mehrern bey Langenberg gelegenen Gruben, wovon erstere sechse auf einem und demselben Lager bauen, gefahren, und ist hierüber folgendes zu bemerken gewesen:“ a.) Freundschafts Fundgrube betr. „Mit den allhier in Arbeit stehenden 3 Mann, wird in 2¾ Lachter Teufe des Fundschachtes, auf dem allhier aufsetzenden und so wie bey den folgenden Gruben Stundte 4 bis 5 streichenden, 10 bis 15 Grad gegen Mitternacht fallenden Lager, ein Ort mit 1 Lachter Weitung, Stundte 10,1 gegen Mitternacht betrieben und ist dasselbe von genanntem Fundschachte 3 Lachter erlängt. Das allhier über 1½ Lachter mächtige Lager besteht aus gelbem Ocker, mildem Gneis, Hornstein, Braunstein und etwas Schwarzeisenstein. Da bey dieser Grube das ziemlich mächtige Lager bey 1¼ Lachter Teufe unter Tage aufsetzt, und bey den dermaligen guten Braunstein Anbrüchen Nachhalt hoffen läßt, so dürfte es sowohl in Hinsicht der Holzersparniß, als auch wegen eines wohlfeilen Abbaus gerathen seyn, wenn dasselbe gleich vom Tage nieder, steinbruchweise abgebaut würde. Da aber daselbst einiges Holz steht, so habe ich den Eigenlehnern aufgegeben, sich hierüber des fördersamsten mit dem Grundbesitzer, Herrn Prem. Lieutn. von Querfurth auf Förstel, zu besprechen, um vielleicht ein gütliches Abkommen mit selbigem zu treffen.“ 1¼ Lachter sind nur rund 2,5 m
Abraum ‒ da kann man sich einen Tagebau durchaus vorstellen, zumal, wenn
das Lager darunter rund 3 m mächtig angetroffen worden ist. Wahrscheinlich
aber sind sich die Betreiber mit dem Grundeigentümer, schon mehrfach genannten Herrn
von Querfurth, nicht einig geworden, da dieser den ausgedehnten Abbau
auf seinen Fluren ja schon gegenüber dem Bergamt beklagte (sieh unseren
Von seiner nächsten Befahrung am 11 April 1820 berichtete Herr Schmiedel jedenfalls, man betreibe das Ort in 3 Lachter Teufe des Fundschachts gegen Abend weiter und habe es bei 1¼ Lachter Weitung nun 4 Lachter erlängt (40014, Nr. 262, Film 0032). Bis zum Verwiegetag am 20. Juni hatte man hier 24 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0059), bis zum 16. August 14 Zentner (40014, Nr. 262, Film 0067f) und bis zum 9. November 1820 erneut 17 Zentner Braunstein ausgebracht (40014, Nr. 262, Film 0096). Damit gehörte die Freundschaft Fundgrube in ihrer Anfangsphase durchaus zu den ertragreichen Braunsteingruben des Gebietes, wie auch folgende kleine Zusammenstellung einiger Förderzahlen aus diesem Zeitraum illustriert:
Dazu ist aber noch zu bemerken, daß einige Gruben (u. a. Meyers Fundgrube) daneben auch Eisenstein ausgebracht haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über seine Befahrung der Grube am 6.
März 1821 hielt Herr Schmiedel in seinem Fahrbogen fest
(40014, Nr. 264, Film 0026):
Freundschaft Fdgr. bey Langenberg betr. „Mit den auf dieser Eigenlöhnerzeche in Arbeit stehenden 2 Mann wird in 4½ Lachter Teufe des Fundschachtes auf dem allhier aufsitzenden, Stundte 5,5 streichenden, ungefähr 10 Grad gegen Mitternacht fallenden, ¾ Lachter mächtigen, aus braunem Ocker, mildem Gneus, Quarz, Hornstein und Braunstein bestehenden Lager ein Ort gegen Mitternacht Morgen zu 2/3 betrieben, welches zur Zeit von obgedachten Schacht 3 Lachter fortgebracht ist.“ Gegenüber dem Fahrbericht vom Vorjahr hatte man sich also in größere Tiefe verlegt und dort ein neues Streckenort aufgehauen. Bis zum Verwiegetag am 8. Mai 1821 hatte man dabei 46 Zentner Braunstein gefördert (40014, Nr. 264, Film 0048) und am 7. August des Jahres standen erneut 40 Zentner zum Verwiegen an (40014, Nr. 264, Film 0077). Dann verlegte man sich offenbar wieder auf die obere Sohle, denn über seine Befahrung am 28. August 1821 berichtete der Geschworene, man treibe nun in 3½ Lachter Teufe des neuen Tageschachtes ein Ort mit 1 Lachter Weitung gegen Morgen und habe dieses 4¼ Lachter fortgestellt (40014, Nr. 264, Film 0086f). In der zweiten Jahreshälfte schlug man außerdem ein zweites Ort gegen gegen Nordwest an und hatte es bis zur Grubenbefahrung am 12. Dezember um 2½ Lachter fortgebracht (40014, Nr. 264, Film 0116f). Mahr gab es für Herrn Schmiedel im Jahr 1821 nicht über Freundschaft Fundgrube zu berichten; auch an den Verwiegetagen ist die Grube nicht mehr genannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner Befahrung am 20. März 1822
berichtete der Geschworene dann, man habe das Ort gegen Morgen in 4 Lachter
Teufe nunmehr 6 Lachter ausgelängt (40014, Nr. 265,
Film 0030). Außerdem fand Herr
Schmiedel Anlaß zu der Veranstaltung:
„Da dieses Ort mit mehrern Krümmungen und ansteigender Sohle getrieben ist, so wurde dem Lehnträger aufgegeben, solches künftig möglichst zu vermeiden und von jetzt an dasselbe sowohl des Wetterzuges, als auch der leichteren Förderung halber, gehörig nach dem Streichen des Lagers sowie auch söhlig zu treiben.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ende des Jahres 1822 wurde Herr
Schmiedel dann von Johann August Karl Gebler in seiner Funktion
abgelöst. Der neue Geschworene befuhr diese Grube erstmals am 30. April
1823 und hielt in seinem Fahrbogen darüber fest (40014, Nr. 267,
Film 0039):
„Denselben Tages gefahren auf Freundschaft Fdgr. daselbst, belegt mit 4 Häuern. Aus einem nur 3 Lachter tiefen Schacht hat man das dort angetroffene Braunsteinlager fast nach allen Richtungen auszurichten angefangen, so aber, daß gegenwärtig die Entfernung vom Tageschacht noch ganz unbedeutend ist. Die Anbrüche bestehen aus dichtem, zuweilen selbst aus krystallischem Braunstein und in der Kaue hat man zum Pochen desselben ein trocknes Sandpochwerk erbaut.“ Von einer solchen Aufbereitungsanlage haben wir oben in unserem Kapitel zu Gelber Zweig zwar schon einmal gelesen, doch im zeitlichen Ablauf ist ein Pochwerk in Langenberg an dieser Stelle und im Jahr 1823 überhaupt das erste Mal erwähnt, auch wenn dieses hier sicherlich ziemlich klein war und noch in der Kaue Platz gefunden hat. Erst 1826 haben dann die Herren Trommler und Weißflog ein zweites für ihre Grube Gelber Zweig erbaut, das als einziges ‒ mit mehreren Reparaturen ‒ bis zum Verkauf der Grube an E. Zweigler 1861 in einigem Umgang gestanden hat. Gleichartige Pläne, wie etwa 1833 bei Junger Johannes oder 1843 bei Meyer's Hoffnung, sind dagegen wohl nie umgesetzt worden. Danach wird diese Grube allerdings weder in der Fahrbögen, noch mit einem Erzausbringen, in den Fahrbögen des Jahres 1823 noch einmal genannt. Auch im Jahr 1824 war Herr Gebler offenbar nie dort, oder der Grubenbetrieb hat ganz geruht (40014, Nr. 271).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dafür war der Geschworene dann gleich
am 14. Januar 1825 auf dieser Grube zugegen (40014, Nr. 273,
Film 0005f) und fand sie mit 4
Häuern belegt. Über den Abbau notierte Herr Gebler: „Aus dem nur
2 und ein halbes Lachter tiefen, neuen Tageschachte hat man ein Ort zwey
Lachter gegen Morgen getrieben und gewinnt vor demselben Braunstein. Zur
Beförderung von Wetterwechsel hat man angefangen, in einiger Entfernung
von dem angegebenen Schachte gegen Mitternacht Abend einen neuen zu
sinken, ist mit diesem nur erst 1½ Ltr. tief niedergekommen und gedenkt,
aus diesem mit dem oberen durchschlägig zu werden.“
Binnen kurzer Zeit waren es also auch hier schon drei Tageschächte geworden. Die waren allerdings mit kaum 6 m auch von äußerst geringer Teufe... Bis zu seiner nächsten Befahrung am 11. Mai 1825 war der genannte, dritte Schacht dann jedenfalls niedergebracht. Der Geschworene hielt in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 273, Film 0032): „Mittelst eines daselbst ohnweit des vorigen Schachtes wiederum und zwar in der St. 7,0 niedergebrachten neuen (Schachtes) zur Entdeckung anderweitiger Braunstein- Nieren hat man bey 3 Ltr. Teufe wieder dergleichen aufgefunden, wird fernerhin den Gewinnungsbau hier fortsetzen, den vorigen Schacht aber ganz verlassen, sobald nach (?) des erforderlichen Holzes der in demselben noch anstehende wenige Braunstein gewonnen seyn wird, ohne dabey ein neues Mittel ausgerichtet zu haben. Zur Erlangung der nöthigen Sicherheit über Tage habe ich angeordnet, diesen letzten einstweilen nicht erforderlichen Schacht vor der Hand zu verbühnen, in der Folge aber bey gänzlicher Verlassung des Baues völlig auszustürzen.“ Am 2. November 1825 ist Herr Gebler noch einmal auf dieser Grube angefahren und berichtete darüber, mit 4 Häuern werde der Braunsteinabbau unmittelbar in der Nähe des nur 2½ Ltr. tiefen Schachtes in Richtung Süd- und Nordost betrieben (40014, Nr. 273, Film 0074). Viel mehr gab es auch nicht dazu zu sagen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Februar des Folgejahres stand wieder
eine Grubenbefahrung an, über die der Geschworene in seinem Fahrbogen
festhielt (40014, Nr. 275, Film 0021):
„Desselben Tages (am 28.2.1826) bin ich gefahren auf Freundschaft Fdgr. bey Langenberg und dem Tännicht, belegt mit 2 Mann.“ Braunsteinbau. „Man gewinnt hier bey 2½ Ltr Teufe unter Tage und bey 2 bis 3 Ltr Entfernung vom Schachte Braunstein von ziemlich guter Beschaffenheit.“ Knapper geht´s allerdings kaum. Leider nannte uns Herr Gebler keine Zahlen zum Vorrat oder zum verwogenen Braunstein, als er zwei Monate später notierte (40014, Nr. 275, Film 0040), er habe am 28. April 1826 „auf Meyers Hoffnung Fdgr. und Freundschaft Fdgr. im Tännicht und Friedrich Fdgr bey Langenberg und Köhlers Fdgr. bey Raschau den vorhandenen Braunstein theils besichtigt, theils verwogen.“ Aber immerhin scheint ja etwas dabei herausgekommen zu sein. Den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22) zufolge allein im Jahr 1825 eine Menge von 166 (Berg-) Zentnern (rund 8,6 metrische Tonnen) Braunstein. Weitere Grubenbefahrungen sind seit diesem Jahr nicht mehr dokumentiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schuberts Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wenn wir nichts übersehen haben, ist eine solche Grube in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere nicht aufgeführt (vgl. 40166, Nr. 22 und 26). Der Familienname Schubert ist uns aber als Lehnträger auf anderen Gruben und als Schichtmeister in Raschau bereits begegnet. Möglicherweise handelt es sich also bei dieser ,Fundgrube' nur um einen Schurf, der mangels Erfolg bald wieder aufgegeben worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der zuständige Berggeschworene,
Christian Friedrich Schmiedel, befuhr die Grube am 15. November 1819 (40014, Nr. 261, Film 0100)
und berichtete darüber:
„Mit den allhier in Arbeit stehenden 2 Mann wird auf dieser zwar gemutheten, jedoch noch nicht bestätigten Grube, ein Tageschacht auf das allhier bekannte und gewöhnlich in 4 bis 5 Lachter Teufe unter Tage aufsetzende Lager abgesunken und ist derselbe bis jetzt 3½ Lachter in mildem Gneuse niedergebracht.“ Der Geschworene fand auch sogleich Grund zu einer Veranstaltung: „Da dieser Tageschacht gar nicht mit Zimmerung versehen ist, das dasige milde Gebirge aber nicht genugsame Haltbarkeit hat, so wurde den Eigenlöhnern aufgegeben, solchen sofort und ehe weiter abgeteuft wird, mit gehöriger Zimmerung zu verwahren.“ Danach wird die Grube in den Fahrbögen nicht mehr erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osterfreude Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine solche Grube ist in den Erzlieferungsextrakten
sächsischer Bergreviere im Zeitraum von 1825 bis 1827 aufgeführt (40166,
Nr. 22 und 26). In dieser kurzen Zeit hat sie ausschließlich Eisenstein,
und zwar reichlich 94 Fuder oder etwas über 80 metrische Tonnen
ausgebracht. Sie ist aber nicht mit dem
Christian Gottlieb Kräher und Konsortschaft muteten diese Grube am 19. April 1824 (40014, Nr. 270, Blatt 33). Geschworener Gebler berichtete von seiner Befahrung des Reviers am 8. April 1824, die neue Grube solle zwischen dem zum Rittergut Förstel gehörigen Obstgarten und der Grube Christbescherung zu liegen kommen (40014, Nr. 270, Blatt 29ff). Sie wurde dem Muter am 8. April 1825 bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 33).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Grube wird auch in Zusammenhang
mit den
„Donnerstags, den 2ten Juny habe ich mich nach dem Tännicht und nach Langenberg begeben und die dortigen Eisensteingruben besucht, wobey ich gefunden, daß (...) 2) der Eigenlöhner Stgr. Kräher von Osterfreude daselbst, nachdem solchen von mir zuvor die Ortung angegeben worden, bergamtlicher Anordnung zu Folge gleichfalls ein kleines Lottenschächtchen niedergebracht, damit auch glücklich die von dem Schachte aus gegen Mittag Morgen getriebene Strecke auf dem gewünschten Punkte getroffen. Allein wegen der aus Holzmangel nicht hinlänglichen Verwahrung der Strecke bey dem Punkte des Einkommens mit dem Schächtchen war derselbe wieder eingegangen, weshalb er ihn auch völlig zugefüllt hatte, nicht Willens, denselben wieder aufzumachen, vielmehr anführte (?) er die alte, Eu. königl. Bergamte von ihm selbst vorgetragene Absicht, einen zweyten Wetter- und Förderschacht nach der gewöhnlichen Weise weiter gegen Morgen hin anzulegen. Die völlige Unzuläßigkeit seines Begehrens habe ich ihm unter den bekannten, obwaltenden Umstaänden dargethan, ihn mit seinem Gesuche gänzlich zurück- vielmehr ihn angewiesen, vor allen anderen Dingen der erhaltenen bergamtlichen Vorschrift mittelst Einführen der nöthigen Wetter durch eine vom Tage nieder eingelegt Lotte, was er doch bereits unternommen habe, pünktlich (?) Folge zu leisten und für die Zukunft und bey weiteren Bedarf die Entschließungen deßelben zu erachten.“ Der Name Kräher ist uns auch
in anderem Zusammenhang hier schon bekannt geworden, etwa von
Ein Ausbringen gab es aber auch zu verzeichnen und am 14. Juli 1825 wurden hier 25 Fuder Eisenstein vermessen (40014, Nr. 273, Film 0048). Dann waren es schließlich aber nicht die umschlagenden Wetter, sondern ein anderes Problem, das im Sommer 1825 hinderlich wurde. In seinem Fahrbogen vom 15. Juli 1825 hielt Herr Gebler nämlich fest (40014, Nr. 273, Film 0048): „Desselben Tages habe ich mich auf einige der übrigen Eisensteinzechen daselbst und in Langenberg begeben und gefunden, dass man auf der Großzeche Fdgr., ingleichen auf der Gesegneten Anweisung Fdgr. wegen ermangelnder Wetter, und auf Osterfreude wegen ermangelnden Grubenholzes die Arbeiten (?) einstellen musste.“ Weitere Nennungen dieser Grube gibt es in den Fahrbögen des Jahres 1825 nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfangs des Folgejahres war Herr
Gebler wieder dort und berichtete in seinem Fahrbogen auf Reminiscere
1826 darüber recht knapp (40014, Nr. 275, Film 0011):
„Desselben Tages (am 24.1.1826) habe ich noch die Grube Osterfreude Fdgr. bey Langenberg, belegt mit 1 Lehnträger, und 1 Knecht, mit 2 Mann in Summa, besucht, und gefunden, daß man daselbst fortdauernd Brauneisenstein in den ohngefähr 6 Ltr vom Tageschacht gegen Morgen daselbst vorkommenden Nestern gewinnt.“ Am 13. Februar waren hier 6 Fuder Eisenstein ausgebracht (40014, Nr. 275, Film 0014) und am 13. April 1826 hatte der Berggeschworene erneut immerhin 19 Fuder Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 275, Film 0030). Weitere Fahrberichte zu dieser Grube gibt es auch aus dem Jahr 1826 nicht mehr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Tauwetter und Niederschläge im
Frühjahr 1827 auf mehreren Gruben der Umgegend Probleme verursacht hatten,
beabsichtigte man auch bei Osterfreude Fdgr. einen neuen Schacht
anzulegen, worüber der Grundeigentümer, Karl Edler von Querfurth,
seinen Unmut äußerte und daraufhin der Geschworene Gebler wieder in
Langenberg zu tun bekam. Er notierte ausführlich in seinem Fahrbogen
(40014, Nr. 278, Film 0026f),
am 6. April des Jahres. „habe ich mich wiederum nach Langenberg begeben
und theils den Zustand des bey Friedrich Fdgr. durch Thauwetter und Nässe
entstandenen Tagebruchs und was hier fernerweit zu thun, untersucht,
theils die Stelle besichtiget, wo der Eigenlöhner von Osterfreude Fdgr. in
seinem ihm verliehenen Felde einen neuen Schacht zu schlagen Willens ist,
übrigens aber wegen beabsichtigter gänzlicher Sicher- und
Zufriedenstellung des Herrn Besitzers und zu Verhütung von etwaigem
Niedergehen einzelner Stellen von der Oberfläche der Erde so wie zeitheriger Abbaue bis in die Nähe des zeitherigen Tageschachtes völlig
ausgestürzt hat, auch selbst diesen noch ausstürzen will. Von alledem zu
dem mehren Besten des Herrn Besitzers, Rittmeister von Querfurth,
unternommenen habe ich diesem zu Vermeidung aller ferneren von ihm
unaufhörlich und meist unbillig erhobenen Beschwerden sogleich unendlich
unterrichtet. Er erklärte hierauf, er wolle sich – eine ganz unpassende
Entgegnung – hinsichtlich seines Entschlusses über die Anlage eines neuen
Schachtes erklären, sobald der obgedachte Eigenlöhner jenes Zustürzen des
Schachtes vollbracht haben würde. Wenn eine solche Beantwortung der ihm
von mir gemachten Bekanntmachung sich mit den für den Bergbau geltenden
Verfassung und mit den für solchen vorhandenen Gesetzen schon an sich
nicht verträgt, so ist solche hier noch viel unpassender deshalb, weil
eben die Stelle, wo der Herr Grundbesitzer den Bergbau eigenmächtig zu
behandeln, ihn zu erschweren oder ihn gar zu verhindern gedenkt, alten
Bergbau enthält, dessen Halden von ihm eingeebnet und zu Felde gemacht
worden sind, wie solches wenigstens eine glaubwürdige Person in Langenberg
darthun und die Personen, durch welche diese Arbeit verrichtet worden,
(?) behauptet.“
Ja,
„Donnerstags, den 12ten April, Grüner Donnerstag. Nachmittags habe ich mich in Dienstgeschäften in Betreff der von dem Herrn Rittmeister von Querfurth auf Förstel gegen die Abfuhr des Eisensteins von Osterfreude Fdgr. zu Langenberg in das Hammerwerk Großpöhla erhobenen Beschwerde und daraufhin nach St. Annaberg begeben, um hierüber für den sogleich mit zur Stelle gebrachten Eigenlöhner die Erklärung des Herrn Bergcommissionsraths von Zedtwitz zu vernehmen.“ Weitere Nennungen dieser Grube oder Vermerke zum Ausbringen gibt es in den Fahrbögen aus den auf das Jahr 1827 folgenden Fahrbögen nicht mehr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neu Geschrey Fundgrube bei
Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Grube ist in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere im Zeitraum von 1826 bis 1829 aufgeführt (40166, Nr. 22 und 26). In dieser kurzen Zeit hat sie ausschließlich Eisenstein, und zwar reichlich 100 Fuder oder etwas über 86 metrische Tonnen ausgebracht. Sie wurde am 9. Oktober 1824 von Carl August Weißflog und Konsortschaft „auf Försteler Grund nahe Osterfreude Fundgrube, wo gegen Mittag 26 Lachter weit ein Suchstolln getrieben und ein Schacht abgesenkt ist,“ gemutet und den Mutern am 6. April 1826 bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 50).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein erster Fahrbericht des zu Scheibenberg amtierenden
Berggeschworenen Johann August Karl Gebler datiert auf den
26. April 1826 (40014, Nr. 275, Film 0039f),
worin es heißt:
„Mittwochs, den 26ten April bin ich gefahren auf Neu Geschrey Fdgr. bey Langenberg, belegt mit
Eisenstein und Braunsteinbaue. „Auf dem mittelst eines vom Dorf hinaus gegen Mittag angelegten Suchstollens hatte man bey ohngefähr 20 Ltr Länge durch Auslängen auf einige Lachter gegen Morgen ein Trum Braunstein, bey 24 Ltr. Länge aber ein Eisensteinlager, auch etwas Braunstein angetroffen, auf dasselbe einen kleinen Tageschacht von etwa 8 Ltr. Teufe abgesunken und gewinnt man sowohl Braunstein als Eisenstein.“ Am 8. Dezember des Jahres notierte der Geschworene in seinem Fahrbogen noch, er habe hier 23 Fuder, 3 Tonnen Eisenstein zu vermessen gehabt (40014, Nr. 275, Film 0095). Weitere Nennungen dieser Grube gab es im Jahr 1826 in dieser Quelle nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Frühjahr 1827 muß ein besonders
nasses gewesen sein und so mußte am Tag der ersten geplanten
Grubenbefahrung der Geschworene unverrichteterdinge wieder abreisen (40014, Nr. 278, Film 0022):
„Freytags, den 16ten März habe ich mich auf mehrere der Langenberger Eisenstein und Braunsteinzechen begeben, als Köhlers Fdgr., Friedrich Fdgr. und Neu Geschrey Fdgr., dieselben aber wegen vieler Niederfälle (?) sich gesammelter zum Theil etwas aufgegangener Waßer, auch der Abwesenheit der Eigenlöhner wegen nicht befahren können.“ Im gesamten Jahr 1827 fanden offenbar keine weiteren Befahrungen durch den Geschworenen auf dieser Grube statt. Jedoch muß die Grube stetig in Betrieb gestanden haben, denn Herr Gebler hatte hier am 15. Juni 30 Fuder und am 11. Dezember noch einmal 14 Fuder ausgebrachten Eisensteins zu vermessen (40014, Nr. 278, Film 0050 und 0089). Allerdings fand die Grube noch anderweitig Eingang in die Fahrbögen dieses Jahres, denn auch bei Neu Geschrey Fdgr. hatten Regen und Tauwetter offenkundig zu Brüchen und Setzungen geführt. Der uns schon wohlbekannte Herr Rittmeister von Querfurth auf Förstel zeigte gleich mehrere derselben im April an, worauf Herr Gebler dies natürlich prüfte und dazu notierte (40014, Nr. 278, Film 0033f): „Desselben Tages (am 20.4.1827) habe ich mich wiederum nach Langeberg begeben, theils die nach Angabe des Herrn Rittmeisters von Querfurth in dem Bezirk der Grube Neu Geschrey Fdgr. neuerlich entstandenen, seinem Benehmen nach, sehr erheblichen Schaden zu besichtigen, theils um zu untersuchen, ob man etwas von Seiten des Besitzers sowohl als der sich mit Muthung gemeldeten Eigenlöhner vor Eingang der darüber aberwerteten bergamtlichen Resolution, also ohne Erlaubnis dazu abzuwarten, Versuchsarbeiten gemacht habe. In Betreff des letzteren Umstandes fand ich für heut noch alles unverletzt. Was aber die bitteren Klagen des Herrn Grundbesitzers über den erstern Gegenstand anlangte, so ergab sich nachstehendes. 1) Etwa 3½ Ltr vom Mundloche der (?) hinan befand sich fast ganz am Rande des dortigen Rübsenfeldes eine schräge Vertiefung, 3 ½ Ellen lang, 2 ¾ Ellen weit an der einen Seite 10 Zoll und an der anderen 31 Zoll tief. Sodann zeigte sich 2) von dieser 7¾ Lachter das Feld hinauf in der Richtung nach dem Schacht zu in demselben Rübsenfelde eine runde trichterförmige Vertiefung, etwa 1 Ltr im Durchmesser und gegen 3 Ellen tief. Diese war unter allen die bedeutendste. Ferner wurde eine 3) in weniger Entfernung von dem Schachte, links von der angegebenen Richtung abwärts, in dem anliegenden Gras- und Baumgarten eine kleine runde Vertiefung gezeigt, 1½ Ellen lang, 1 Elle weit und 22 Zoll tief. Endlich lag 4) noch einige Schritte weiter herauf in demselben Garten noch unbedeutende Vertiefung, (?) nicht einmal der Rasen des Gartens verschwunden, sondern hatte sich nur gesetzt. Es befand sich dieselbe kaum 3 Ellen lang, 2½ Ellen breit und nicht einmal 1 Elle tief und ich würde solche gar nicht, ohne gegebene Erklärung, für eine Beschädigung angesehen haben. Von der letzteren behauptete der Lehnträger der Grube, Stgr. Weißflog, gradzu, es liege solche gar nicht auf seinen Bauen. Alle diese Vertiefungen können übrigens von zwey Mann in Zeit von 3 Stunden zugeworfen und eingeebnet werden, auch würde solches bereits geschehen seyn, wenn man nicht Seiten des Lehnträgers neue Beschwerde in Betreff der dortigen mehrern Beschädigung des Rübsens besorgt, hiernächst aber auch noch durch Wegnahme der Arbeiter dieser Grube durch den Herrn Grundbesitzer zum Betrieb seines Kalkbruches und Kalkofens, was diese gewöhnlich zu besorgen haben, verhindert worden wäre. Unterdessen wird der Lehnträger sofort für die Beseitigung dieser Mängel Sorge tragen. Hierbey habe ich noch zu bemerken, daß wenn hier und da in des Herrn Grundbesitzers Felde sich etwas senkt, was bey den bisherigen Thauwetter gar nicht zu vermeiden (?) ist, solches nicht allerorten den jetzt bauenden Eigenlöhnern zur Last geleget werden kann, inmaßen sich unter seines Feldes Oberfläche alter Bergbau befindet und sowohl von seinem Herrn Vater als von ihm Halden eingeebnet worden sind, was Stgr. Weißflog darthun zu können behauptet.“ Wie man sich geeinigt hat und ob die Einsenkungen durch den Lehnträger der Grube und seine Arbeiter wieder aufgefüllt worden sind, geht leider aus dem Akteninhalt nicht hervor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im folgenden Jahr 1828 ist die Grube
Neu Geschrey nur ein einziges Mal in den Fahrbögen des
Geschworenen Gebler erwähnt, als er hier am 8. Mai 14 Fuder, 3
Tonnen ausgebrachten Eisensteins zu vermessen hatte (40014, Nr.
280, Film 0033).
Dasselbe ist auch aus dem Jahr 1829 zu berichten: Am 20. Mai hatte der Geschworene hier 10 Fuder, 1 Tonne Eisenstein zu vermessen (40014, Nr. 280, Film 0139). Fahrberichte gibt es nicht. Ab dem Jahr 1830 wird die Grube in den Fahrbögen nicht mehr erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschert Glück gevierte Fundgrube
bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausweislich der Erzlieferungsextrakte (40166, Nr. 22 und 26) hat diese Grube im Zeitraum von 1835 bis 1837 insgesamt 143 Zentner, und nochmals im Jahr 1842 zwanzig Zentner Braunstein ausgebracht. In den Fahrbögen der Berggeschworenen aus der ersten Phase taucht die Grube nicht auf. Verliehen wurde die Grube „auf dem Seidelacker und Waldsaume bei Schwarzbach“ am 8. Januar 1835 an den Muter Friedrich August Jahn aus Mittweida und Konsortschaft (40169, Nr. 23, Blatt 1). Auf dessen Mutung hin hatte am 2. Dezember 1834 Geschworener Gebler die Örtlichkeiten besichtigt und berichtet, daß sie neben der Grube Distlers Freundschaft zu liegen komme (40014, Nr. 270, Film 0131ff). Herr Jahn sagte sie dann aber schon am 6. Juli 1837 wieder los (40169, Nr. 23, Blatt 2).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus einem Streit mit den Grundbesitzern
der Güter Förstel und Tännicht um die Flächeninanspruchnahme durch den
Bergbau auf ihren Fluren im Frühjahr 1835 erfahren wir aber, daß zu den
Geladenen des Ortstermins damals auch der Steiger Christian Gottlieb Kräher als Lehnträger
von Bescheert Glück gevierte Fundgrube gehörte (40014, Nr. 292,
Rückseite Blatt 7ff).
Zwischendurch hatte aber auch August Riedel Mutung auf die durch die Lossagung durch Friedrich August Jahn ins Freie gekommene Grube eingelegt, weswegen Geschworener Gebler die Örtlichkeiten am 26. September 1837 in Augenschein nahm und dabei eigentlich Herrn Kräher angetroffen haben müßte (40014, Nr. 270, Film 0205f). Auf die Mutung des letzteren über die offenbar schon wieder im Freien liegende Grube hin wurde sie dem letzteren am 7. April 1842 vom Bergamt erneut bestätigt (40169, Nr. 23, Rückseite Blatt 2 und 40014, Nr. 43, Blatt 347). Da Herr Kräher aber nur kurze Zeit später verstorben ist, wurde am 7. Juli 1842 Friedrich Fürchtegott Schubert als neuer Lehnträger der Grube angenommen. Der Rezeßschreiber Lippmann aus Annaberg, welcher den eigentlich amtierenden, aber von höherem Orte mehrfach mit anderen Aufgaben betrauten Geschworenen Theodor Haupt in Scheibenberg vertrat, notierte dann in seinem Fahrbogen unter dem 18. Februar 1842, an diesem Tage „besichtigte ich die neu gemuthete Zeche Bescheert Glück gevierte Fundgrube im Tännichtwalde.“ (40014, Nr. 321, Film 0016) Das war nun mindestens schon die zweite Wiederaufnahme dieser Grube. Wahrscheinlich hatte man zuvor in den Bauen der Vorgänger geschürft und die Halden untersucht, denn am 27. April 1842 hielt Herr Lippmann fest (40014, Nr. 321, Film 0033): „Da man auf Beschert Glück gev. Fdgr. ebenfalls durch Wettermangel sehr gehindert wird, so habe ich nach genommener Rücksprache mit dem Hrn. Grundbesitzer, den Eigenlöhnern die Absinkung eines Wetterschachtes erlaubt und ihnen den behufigen Punkt dazu angewiesen. Übrigens beschäftigt man sich auch hier jetzt mit dem Aussieben des klaren Braunsteins.“ Da war also schon etwas zum Aussieben da, was Herr Lippmann auch noch am selben Tag verwogen hat (40014, Nr. 321, Film 0033). Bei seiner Inspektion der Eigenlöhnergruben am 21. und 22. Juni 1842 fand Herr Lippmann die Grube allerdings schon wieder unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0048). Das ist zugleich die letzte Erwähnung dieser Grube in den Fahrbögen. Am 8. Februar 1843 hat sie der Lehnträger Schubert wieder losgesagt (40014, Nr. 23, Rückseite Blatt 3).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gott segne beständig Fundgrube
bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22 und 26) ist eine Grube dieses Namens im Zeitraum zwischen 1835 und 1866 aufgeführt. In dieser Zeit hat sie fast ausschließlich Braunstein ausgebracht (1.467 Zentner ≈ 75 t), nur im Jahr 1860 ist daneben ein Ausbringen von 18 Fudern Eisenstein vermerkt.
Eine zweite
Die gevierte Fundgrube wurde durch den Bergarbeiter Johann Gottlieb Bach aus Raschau und Konsorten gemutet und nach der Besichtigung durch den Geschworenen unter diesem Namen am 8. Januar 1835 an ihn verliehen (40169, Nr. 127, Blatt 1, 40014, Nr. 270, Film 0131ff und 40014, Nr. 43, Blatt 322). Obwohl also schon 1835 in Umgang, ist diese Grube in den Fahrbögen des in den 1830er Jahren in Scheibenberg zuständigen Berggeschworenen Johann August Karl Gebler nie ausdrücklich genannt (40014, Nr. 289 und 294). Seltsamerweise hat dieser Geschworene zwar mehrfach in seinen Fahrbögen festgehalten, er habe im Revier „die Braunsteinvorräte besichtigt“, allerdings dabei keinerlei Angaben zum Betrieb der ausschließlich auf Braunstein bauenden Eigenlehnergruben hinterlassen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Funktion des Berggeschworenen hatte nach Herrn Gebler ab 1840 Herr Theodor Haupt inne. Dieser befuhr am 10. Januar des Jahres sämtliche gangbaren Gruben seines Reviers und berichtete danach in seinem Fahrbogen über diese (40014, Nr. 300, Film 0016): „Auf Gott segne beständig gev. Fdgr. ist der untere Tageschacht wieder hergestellt und in 7 Lachter Saigerteufe die früher in Süd getriebene Strecke 1 Lachter aufs Neue in quarzigem Braunstein erlängt worden.“ Diese nur knappe Beschreibung sagt uns immerhin, es gab schon länger einen Tageschacht und der mußte wieder hergestellt werden. Am 7. April 1840 fand die im Quartal Trinitatis erforderliche Befahrung statt und auch jetzt hielt Herr Haupt nur recht knapp fest (40014, Nr. 300, Film 0042), es werde nun in 3½ Lachter Teufe und 3 Lachter süwestlicher Entfernung vom Schacht „vor einem nach NW gehenden Streckenort Braunstein mittelst Übersichbrechen gewonnen.“ Noch eine weitere Befahrung fand am 8. September 1840 durch Herrn Haupt statt. Während zur gleichen Zeit andere Gruben im Tännicht wieder mit Wettermangel zu kämpfen hatten, fand er diese in Umgang vor (40014, Nr. 300, Film 0108f). Wieder ist die Beschreibung des wohl auch wenig umfänglichen Betriebes durch den Geschworenen nur knapp: Man gewann hier „tagebaumäßig ohngefähr 2 ½ Lachter vom untern Tageschachte in West etwas Braunstein, der hier in Mulm und fast unmittelbar unter dem Rasen liegt und mehrere Zoll mächtig ist.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Ende Crucis 1840 bis Mitte Reminiscere 1841 waren Herrn Haupt wohl andere Aufgaben übertragen. In dieser Zeit wurde er in seiner Funktion als Geschworener des Bergamts Scheibenberg durch den Raschau'er Schichtmeister Friedrich Wilhelm Schubert vertreten. Derselbe befuhr die Grube am 22. Oktober 1840 und berichtete in seinem Fahrbogen etwas ausführlicher darüber (40014, Nr. 300, Film 0121): „Nachdem bin ich 2.) auf der Grube Gott segne beständig gev. Fdgr. bei Langenberg gefahren und zwar gegen 7 Ltr. tief im Tageschachte, in welchem bei 6 Ltr. Teufe in Südwest 3 Ltr. entfernt ein Versuchsörtchen nach Braunstein mit 1 Mann getrieben wird. Ferner wird bei 7 Ltr. Teufe hora 4,6 in Ost ein Ort größtentheils in Glimmerschiefer, nach einem neuen, gegen Nord 10,5 Ltr. entfernten, 4 Ltr. tief abgeteuften Tageschachte zu getrieben, um nicht allein Wetterwechsel zu verschaffen, sondern auch bauwürdige Lagerstätten damit auszurichten beabsichtigt wird.“ Größer als der hier genannte eine Mann war die ganze Belegung der Grube nicht... Bei seiner Befahrung am 28. November 1840 fand Herr Schubert die Grube unbelegt: „Auf dem Rückwege habe ich bei Gelber Zweig gev. Fdgr., Friedrich gev. Fdgr., Gott segne beständig gev. Fdgr., Ullricke gev. Fdgr. und Hausteins Hoffnung gev. Fdgr. niemand in Arbeit getroffen.“ (40014, Nr. 300, Film 0134f) Am 19. Januar 1841 hatte Herr Schubert hier das Ausbringen von gerade einmal 9 Zentnern Braunstein zu verwiegen und sich anschließend den eingestürzten Tageschacht besehen (40014, Nr. 300, Film 0146). An diesem Unglück hatte, seiner Einschätzung nach, vor allem schlechte Zimmerung Schuld. Dennoch hielt er dem Betreiber zu Gute: „Obgleich die Zimmerung bei bemerkten Gruben nicht in gutem Stand gewesen, so ist die große Nässe (und das?) Tauwetter als Ursache dieser Brüche anzusehen und wurden die Eigenlöhner angewiesen, dauerhafte Zimmerung herzustellen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trinitatis 1841 kehrte Herr Haupt nach Scheibenberg zurück und befuhr die Gruben am 27. Juli dieses Jahres wieder selbst. Über diese aber hatte er nur mitzuteilen (40014, Nr. 300, Film 0208): „Auf den Gruben Hausteins Hoffnung, Gott segne beständig und Friedrich Fdgr. habe ich nicht fahren können, weil die daselbst anfahrenden Leute, ohngeachtet sie Tags vorher bestellt worden sind, nicht zugegen waren.“ Zu einer Grubenbefahrung kam es hier erst wieder im August 1841, worüber im Fahrbogen zu lesen steht (40014, Nr. 300, Film 0223f): „Am 19.8.1841 habe ich die Eigenlöhnergruben im Tännicht und Langenberg befahren, von diesen sind aber Ullricke gev. Fdgr und Distlers Freundschaft wegen Wettermangel jetzt gar nicht und Gott segne beständig gev. Fdgr. nur selten zu befahren. Letztgedachte Grube ist schon seit längerer Zeit die ärmste und deshalb auch in schlechterem Zustande als die übrigen Tännichter Gruben. Man betreibt in 6 Lachtern saigerer Teufe ein Ort in Mittag in braunem Mulm, um Braunstein anzufahren.“ Kurz darauf wurde Herr Haupt erneut von höherem Orte mit anderen Aufgaben betraut. Diesmal vertrat ihn in der Funktion als Berggeschworener der Rezeßschreiber Lippmann aus Annaberg (40014, Nr. 300, Film 0230). Der fand bei seiner Anwesenheit am 15. September 1841 die Grube erneut unbelegt: „Gott segne beständig, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. waren wegen Wettermangels nicht zu befahren.“ (40014, Nr. 300, Film 0242f) Der viel beklagte Wettermangel hörte erst spät im Winter wieder auf und am 8. Dezember konnte Herr Lippmann die Grube befahren. Darüber berichtete er in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 300, Film 0269), sie sei seit einigen Wochen wieder in Betrieb gekommen und mit 2 bis 3 Mann belegt. Man betrieb in 7 Lachter Teufe des oberen Förderschachtes hora 10,4 NW. ein Fallort, das bis jetzt 1½ Lachter vom Schacht aus „in Brockenquarz mit wenig beigemengtem Braunstein“ erlängt ist. Ferner war ein Steigort in derselben Sohle hora 2,3 nach NO. belegt, welches 6 Lachter durchgehend in Mulm vorgerückt war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang des
Folgejahres 1842 war Herr Lippmann wieder zugegen und hielt in
seinem Fahrbogen fest
(40014,
Nr. 321, Film 0002),
es sei
„jetzt nur das bei 7 Lachter Teufe vom obern Tageschacht in der
Richtung hora 2,3 NO. in braunem Mulm stehende Steigort in Schlage, vor
welchem man in letzterer Zeit auch kleine Parthien von Braunstein
aushalten konnte.“
Den ausgebrachten Braunstein hat Herr Lippmann am 11. Februar verwogen und anschließend am 17. Februar 1842 wieder eine Befahrung durchgeführt (40014, Nr. 321, Film 0011 und 0014f). Darüber berichtete er, daß die hier anfahrenden Eigenlöhner bei 7 Lachter Teufe in 14 Lachter südöstlicher Entfernung vom Förderschacht „ein... Braunsteintrum abbauen, welches sich von 3 Zoll bis zu 0,1 Lachter (≈7,5 cm bis 20 cm), letzteres freilich nur selten, mächtig erweißt.“ Die Anbrüche müssen tatsächlich gut gewesen sein, denn am 11. März und erneut am 27. April 1842 hatte der Vertreter des Geschworenen hier schon wieder den ausgebrachten Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 321, Film 0021 und 0033). Zum zweiten Termin war man übertage mit der Scheidung des gewonnenen Braunsteins beschäftigt. Zu diesem notierte Herr Lippmann noch: „Da derselbe hier größtentheils als das Bindemittel des Brockenquarzes vorkommt, so ist er von letzteren auch nicht vollkommen zu trennen und hat daher einen geringeren Verkaufswerth.“ Im Juni schlug auch hier dann wieder der alljährliche ,Wettermangel' zu. Wie Herr Lippmann von seinen Befahrungen am 21. und 22. Juni 1842 aber berichtete (40014, Nr. 321, Film 0050), versuchten sich die Eigenlöhner hier anderweitig zu helfen: „Auf Gott segne beständig, abwechselnd mit 3 Mann belegt, sind die beiden Schächte und die von denselben aus getriebenen Baue dermalen wegen Wettermangel nicht zu befahren. Gegenwärtig geht man gleich oberhalb des alten, verstürzten Fundschachtes mit einem Luftstöllnchen gegen Mittag und hat damit auf 3 Lachter Länge gelben Mulm mit einzelnen Braunsteinschmitzen durchfahren.“ Es verwundert immer wieder, daß die Betreiber nicht weit eher auf die Idee gekommen sind, diesem Problem mit dem Heranbringen von Stolln grundsätzlich abzuhelfen. Das Gelände am Abhang des Emmler- Rückens gab es doch her. Die begrenzten Grubenfelder dagegen hätten eine zusätzliche Mutung erforderlich gemacht. Auch dieser Stolln war nicht eigentlich als Wetterstolln angelegt und tatsächlich ein Durchschlag auf das Schachttiefste angedacht, sondern vielmehr als alternativer Betriebspunkt für die warmen Monate, in denen der Wetterzug nicht ausreichte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man blieb aber auch im Winter 1842/1843 auf dem Stolln und am 22. Februar 1843 hatte der wieder zurückgekehrte Geschworene Theodor Haupt in seinem Fahrbogen zu berichten (40014, Nr. 321, Film 0145), man habe nur „einige Lachter vom ersten Tageschachte in Süd einen Stolln... angelegt und diesen sowohl 4 Lachter in Mittag erlängt, als auch bei 1¾ Lachter Entfernung vom Mundloche ein Ort 2 Lachter in West getrieben. Mittelst beider Strecken wurde auch etwas Braunstein ausgerichtet.“ Bis zur nächsten Befahrung durch den Geschworenen am 13. März 1843 (40014, Nr. 321, Film 0154) hatten die zwei anfahrenden Eigenlöhner den Stolln und dessen Seitenflügel beide auf etwa 5 Lachter ausgelängt. Mit dem Stollnort wurde etwas Braunstein angefahren, mit dem Flügelort dagegen in alten Mann eingeschlagen... Hm ‒ auch hier wieder. Außerdem bemerkte Herr Haupt noch: „Da, wo beide ich kreutzen, steht noch ein Lager von braunsteinigem Eisenstein von 1 – 2 Fuß Mächtigkeit an, das vielleicht als Flöße Abgang findet.“ Herr Haupt war noch einmal am 28. März zugegen, wobei er aber den Betrieb unverändert fand (40014, Nr. 321, Film 0158). Danach löste ihn wieder Herr Lippmann ab. Letzterer befuhr die Grube am 3. Mai 1843 (40014, Nr. 321, Film 0174), fand sie „abwechselnd mit 2 und 3 Mann“ belegt, den Seitenflügel inzwischen auf 6 Lachter Gesamtlänge fortgestellt und dort habe man „recht leidlichen 6 – 8 Zoll mächtigen Braunstein... angefahren.“ Auch in diesem Sommer wiederholte sich das bekannte Problem. Von seiner Befahrung am 13. Juni 1843 berichtete Herr Lippmann (40014, Nr. 321, Film 0182), die Grube sei „wegen Wettermangel nicht zu befahren“ und die Eigenlöhner befaßten sich übertage mit Auskutten. Auch am 18. August 1843 (40014, Nr. 321, Film 0199) standen im Revier nur Wilkauer vereinigt Feld, Gott segne beständig und Riedels gevierte Fdgr. in Umgang, „die übrigen Eigenlöhnergruben dieser Gegend waren theils wegen Wettermangel nicht zu befahren, theils der eingefallenen Ernte wegen außer Belegung.“ Zur Gott segne beständig Fdgr. notierte der Vertreter des Geschworenen außerdem: „Die Eigenlöhnerschaft beschäftigt sich mit der Aufgewältigung des gegen Mittag ins Gebirge getriebenen Stollns auf dem es bei 5 Lachter einen Bruch gemacht hat.“ Auch das noch... Der war aber offenbar bald wieder beseitigt und von seiner Befahrung der Grube am 21. September 1843 berichtete Herr Lippmann (40014, Nr. 321, Film 0208f), die anfahrenden drei Mann hatten „auf dem hinter dem alten Fundschacht angesessenen, 12 Lachter gegen Mittag erlängten Stöllnchen bei 4 Lachter vom Mundloche in SW abgehenden Flügelort 10 Lachter in braunem Mulm mit hin und wieder bald schmälern, bald mächtiger sich erweisenden Braunsteintrümern und Schmitzen erlängt (...). In demselben Maße, nur noch etwas geringer, zeigt sich der Braunstein vor dem anstehenden mittäglichen, jetzt aber unbelegten Orte.“ Nachdem er am 26. September den ausgebrachten Braunstein verwogen hatte, hat Herr Lippmann die Grube noch einmal am 15. November 1843 befahren (40014, Nr. 321, Film 0210 und 0219). Das Stollnort ist offenbar noch nicht weiter fortgestellt worden, daher war es noch immer nur 12 Lachter vom Mundloch erlängt. Man baute stattdessen auf dem Flügelort fallortweise gegen Nord Braunstein ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ende Dezember 1843 kehrte Herr Haupt
dann zunächst wieder nach Scheibenberg zurück und hat diese Grube am
29. Februar 1844 wieder selbst befahren (40014,
Nr. 322, Film 0019).
Darüber schrieb er in seinem Fahrbogen, das in Süd gehende Hauptstollnort
sei deshalb unbelegt, weil hier „nur schwache Trümchen von Braunstein
davor brechen.“ Gangbar waren dagegen die Baue auf dem Stollnflügel:
Zum einen ein Fallort bei 5 Lachter Länge des Westflügels, das 5½ Lachter
nach NW niedergeht und ½ Lachter in SO aufsteigt. Dort stand man in Quarz
mit Spuren von Braunstein. Ein zweites Ort ist bei 4 Lachter vom
Streckenkreuz angehauen und soll in Süd gehen, sand bis jetzt aber nur in
braunem Mulm.
Wie schon mehrfach erwähnt, wurde Herr Haupt Ende April 1844 schon wieder abgeordnet und diesmal in seiner Funktion als Geschworener durch den Markscheider Friedrich Eduard Neubert vertreten. Dieser befuhr die Grube erstmals am 7. Mai 1844 und berichtete darüber in seinem Fahrbogen recht ausführlich (40014, Nr. 322, Film 0036), hier waren 3 Mann angelegt, „welche die mit A. B. und C. auf beigezeichneten ungefähren Grundriß des Stollns bemerkten Orte betreiben.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr Neubert erläuterte dazu:
„Das Hauptstollnort (A.) ist 6,6 Lachter vom Mundloch ausgelängt und steht in Mulm und Hornstein an. Man beabsichtigt, mit demselben das Mulmlager... zu durchfahren. Das Stollnflügelort (B.) steht bei 8 Lachter Erlängung vom Hauptstolln in Mulm und sehr geklüfteten Quarz mit schmalen Schmitzen von Braunstein an. Man wird dasselbe hora 8,6 gegen NW. weiter erlängen. Das Stollnflügelort (C.) endlich hat eine Entfernung von überhaupt 10,1 Lachter vom Hauptstolln und ist zuletzt in Quarz, welcher Trümchen von Braunstein enthält, fortgebracht worden. Der Quarz liegt hier auf Glimmerschiefer, den man zur Sohle gelassen hat; die Grenze fällt in W. ein und die Sohle des Ortes liegt daher nun circa 2,2 Lachter tiefer, als die des Hauptstollns. Man gedenkt, dieses hora 7,0 in West weiter fortzubringen.“ Wie es hier fast schon die Regel war, fand auch Herr Neubert die Grube im Sommer erst einmal unbelegt, diesmal aber noch einen anderen Grund, als den Wettermangel (40014, Nr. 322, Film 0047f): Unter dem 12. Juni 1844 ist im Fahrbogen zu lesen, an diesem Tage „beabsichtigte ich, die übrigen im Tännicht und bei Langenberg liegenden Gruben, als Riedels, Reppels, Köhlers, Gelber Zweig, Friedrich, Gott segne beständig, Hausteins, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. zu befahren, sie waren jedoch sämmtlich außer Belegung, wovon bei den meisten die Unmöglichkeit, die Producte zu verwerthen, die Ursache sein mag.“ Die Nachfrage und damit auch die für den Braunstein erzielbaren Verkaufserlöse waren also auch wieder ,im Keller'. Am 1. August 1844 hat Herr Neubert hier dennoch 30 Ctr. verkaufsfähigen Braunstein verwogen und die Grube dann befahren, welche aber „seit meiner vorigen Befahrung nicht belegt gewesen (...) und wo ich auch nichts Veränderliches fand. Die Eigenlöhner gedachter Grube wollen den Betrieb derselben so lange noch sisitieren, bis ein größerer Absatz des Braunsteins erfolgt.“ (40014, Nr. 322, Film 0056) Immerhin nahm man auf dieser Grube den Betrieb ‒ wenn auch nur mit geringster Belegung ‒ schon im September wieder auf. Herr Neubert hat sie am 12. September 1844 (40014, Nr. 322, Film 0065f) wieder befahren, „wo ich blos einen Bau mit einem Arbeiter belegt fand“, welcher auf einem Ort 3 Ltr. westlich vom Hauptstolln auf dem Stollnflügel arbeitete und das in SW. 4 Lachter fortgebracht werden sollte, aber erst 0,5 Ltr. erlängt war und in Braunsteinschmitzen führendem Mulm stand. Vermutlich ist die Nachfrage nach dem Braunstein doch nicht wieder gestiegen, weswegen Herr Neubert die Grube bei seinen weiteren Befahrungen in diesem Jahr, am 15. November und am 6. Dezember 1844, wieder unbelegt vorfand (40014, Nr. 322, Film 0075 und 0082).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seinem Fahrbogen auf Reminiscere 1845
fügte Herr Neubert am Schluß hinzu:
„Noch bemerke ich, daß die Gruben Rother Stolln zu Schwarzbach und
Hausteins Hoffnung, Gott segne beständig, Gelber Zweig und Riedels Fdgr.
bei Langenberg, welche ich am 14. und 15. Januar mit besuchte, wiederum
nicht belegt waren.“ Und auch am 14. März 1845 fand er die Grube
unbelegt (40014,
Nr. 322, Film 0092 und 0100).
Wie man das angestellt hat, weiß man nicht, aber am 10. April 1845 hatte Herr Neubert hier trotzdem 12 Zentner Braunstein zu verwiegen. Von seiner anschließenden Grubenbefahrung heißt es, es seien 3 Mann angelegt, welche aber nur einen Bau auf dem 1,5 Ltr. südlich vom Mundloch angesetzten und insgesamt 7,5 Ltr in W. und SW. erlängten Flügelort des Stollns betrieben und dort „in Mulm mit quarzigem Braunstein“ stand (40014, Nr. 322, Film 0103). Am 6. Juni 1845 waren erneut 3 Zentner zu verwiegen. Von der anschließenden Befahrung gab es nichts bemerkenswertes zu berichten, man war mit dem Ausschlagen des Eisen- und Braunsteins befaßt (40014, Nr. 322, Film 0119f). Auch unter dem 21. Juli liest man im Fahrbogen, die drei Eigenlehner führen nur „periodisch“ an und halten nur ein Fallort auf dem westlichen Stollnflügel bei 5 Ltr. Entfernung vom Hauptstolln in Betrieb, das 1,5 Ltr. nach Nord in Mulm mit quarzigem Braunstein fortgestellt war (40014, Nr. 322, Film 0128f). Dabei hatte man bis August 1845 immerhin wieder 15 Zentner Braunstein zusammenbekommen und zum Verwiegen bereit (40014, Nr. 322, Film 0133). Im Dezember diesen Jahres fand Herr Neubert hier nur zwei Mann, die vor zwei Flügelörtern des Stollns arbeiteten, wo aber „nur spärliche Braunsteinanbrüche in quarzigem Mulm“ brachen. Das eine Ort lag 5,5 Ltr. vom Mundloch und war 1,6 Ltr. in West erlängt, das andere bei 1,6 Ltr. vom Mundloch war 8,7 Lachter gegen West erlängt (40014, Nr. 322, Film 0160).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 16. März 1846 fand Herr Neubert
die Grube wieder unbelegt vor und unter dem 8. Mai steht im Fahrbogen
wieder zu lesen, es gäbe nur
periodischen Betrieb und ein Fallort auf dem Stolln zur Aufsuchung von
Braunstein nahe beim Mundloch war erst 0,7 Ltr. in Abend erlängt (40014,
Nr. 322, Film 0180 und 0194f).
Als Herr Neubert am 24. Juni wieder vor Ort war, fand er besagtes
Fallort 2,3 Lachter ausgelängt, sonst aber nichts verändert vor (40014,
Nr. 322, Film 0203).
Von seiner Befahrung am 23. Juli 1846 berichtete Herr Neubert dann, nachdem mit mehreren Versuchsörtern auf dem Stolln keine bauwürdigen Anbrüche ausgerichtet werden konnten, plane man nun, bei 7,5 Ltr. vom Mundloch einen Schacht abzuteufen, um den westlichen und nordwestlichen Teil des Feldes zu untersuchen. Neubert würde den Schacht genehmigen, allein der Grundbesitzer, Begüterter Heinrich Ficker aus Raschau, wolle dies nur dann gestatten, wenn der Grundzins von bisher 20 Ngr. jährlich auf 2 Thl. erhöht wird, da der Punkt in jungem Holz zu liegen kommt (40014, Nr. 322, Film 0207f). Hierzu trug Herr Neubert auch am 1. August 1846 im Bergamt Annaberg vor (40169, Nr. 127, Blatt 2). Vonseiten des Bergamtes wurde das Schachtabsenken dabei genehmigt, jedoch die Bedingung gestellt, daß sich der Lehnträger zuvor mit dem Grundbesitzer ins Vernehmen setze. Der hohe Grundzins war den Eigenlöhnern wohl zuviel und so heißt es im Fahrbericht vom 13. August, Herr Neubert habe die Grube befahren „und habe ich zu berichten, daß man daselbst, ohne sich mit dem Grundbesitzer wegen des Grundzinses vereinigt zu haben, einen neuen Tageschacht 7,5 Lachter westlich vom Stollnmundloch schon 2,4 Ltr. niedergebracht und dort ein Ort in SW angehauen hatte. Dort steht aber bereits Glimmerschiefer an, der in Südwest noch bedeutend aufzusteigen scheint, so daß man sich auf ein Ort in Nordost verlegen will.“ (40014, Nr. 322, Film 0213) Ob das wohl gut geht ‒ um den Grundzins gab es schließlich ja schon andernorts viel Streit... Am 8. September 1846 fand er die Grube jedenfalls wieder unbelegt und auch am 21. Januar 1847 war es nicht anders. Die Grubenakte verrät uns noch, daß am 5. Januar 1848 die beiden Mitgesellen des Lehnträgers Johann Gottlieb Bach, Johann Gottlieb Friedrich und Christian Heinrich Bach, beide aus Langenberg, sich beim Bergamt beschwerten, daß der erstere seine Pflichten vernachlässige und Gesellenbeiträge spät begleiche (40169, Nr. 127, Blatt 4f). Sie beantragten deshalb, daß der Lehnträger seiner Funktion enthoben werde. Der wiederum entschuldigte sich vor dem Bergamt am 19. Februar 1848 mit Krankheit, woraufhin man seitens der Bergbehörde von einer Enthebung absah, ihm aber bedeutete, sich dergleichen in Zukunft nicht wieder zu Schulden kommen zu lassen. Damit endet aber auch schon die Aktenüberlieferung. Da mit Reminiscere 1847 auch die Reihe der überlieferten Fahrbögen der Berggeschworenen zu Scheibenberg endet, erfahren wir leider nicht, was danach noch geschehen ist. Die Gesellen scheinen sich jedenfalls wieder vereinigt zu haben, sonst hätte die Grube ausweislich der Erzlieferungsextrakte nicht noch weitere 18 Jahre Braunstein ausgebracht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kautzschens Hoffnung gevierte
Fundgrube bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausweislich der Erzlieferungsextrakte (40166, Nr. 22 und 26) hat diese Grube nur in den beiden Jahren 1848 und 1850 die bescheidene Menge von insgesamt 16 Zentner Braunstein ausgebracht. Folgendem Rissausschnitt zufolge hat diese Grube östlich der Friedrich Fundgrube in Langenberg gelegen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viel geschehen ist in dieser Zeit wahrscheinlich nicht. Auch der Inhalt der Grubenakte beginnt schon mit einem Bericht des amtierenden Geschworenen Troll vom 30. Dezember 1852, die Taxation des Inventars der losgesagten Grube betreffend. Der fiel aber sehr kurz aus, denn es gab gar kein grubeneigenes Inventar. Die Schachtkaue hatte Herr Kautzsch zerlegt und das Holz sichergestellt. Dessen Wert schätzte Herr Troll auf 1 Thaler (40169, Nr. 184, Blatt 1). Das im Freien liegende Grubenfeld
holte sich dann
Der Bergarbeiter Kautzsch mutete stattdessen
im Jahr 1851 die dazumal im Freien liegende Junge Gesellschaft
Fundgrube bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gottes Geschick gevierte
Fundgrube und Stolln bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) haben wir diese Grube der Namensgleichheit mit der weitaus bedeutenderen Fundgrube am Graul halber vielleicht übersehen... Laut bergschadenkundlicher Analyse (40073-1, Nr. 39 und Rissbeilagen Nr. 2-945 bis 2-975) war dieser Stolln jedenfalls nordwestlich unterhalb des späteren Carlschachtes auf dem Grundstück von Christian Friedrich Weißflog unterhalb der Dorfstraße angesetzt. Am 22. August 1849 nahm man im Bergamt Annaberg die Verleihung über einen Stolln nebst einer gevierten Fundgrube auf dem mit dem Stolln bei 14 Lachter Entfernung vom Mundloch angefahrenen Eisensteinlager an Heinrich Ludwig Richter aus Langenberg zu Protokoll (40169, Nr. 111, Blatt 1). Wie man dem entnehmen kann, war der Stolln zu diesem Zeitpunkt bereits wenigstens 14 Lachter hora 5,2 gegen Südwest ins Feld gebracht. Der dritte Mitgeselle neben dem Grundbesitzer war Traugott Friedrich Merkel. Für den Haldensturz und die Zuwegung hatte man sich auch gleich auf einen Thaler Entschädigung pro Jahr an den Grundbesitzer geeinigt. Etwas später (so ist es auch auf einem 1851 angefertigten Grubenriß (40040, Nr. I9144) dargestellt) hatte man auf den Stolln noch einen Tageschacht abgesenkt und im Streichen des Lagers nach Ost und West zwei Flügelörter getrieben. Zumindest Wetterprobleme dürfte man in diesem Grubengebäude nicht gehabt haben. Wohl der Zuwegung zum Tageschacht wegen zeigte Geschworener Troll am 10. Juli 1851 auch in Annaberg an, daß eine neue Vereinbarung über nun 2 Thaler, 15 Groschen pro Jahr Grundentschädigung getroffen worden sei (40169, Nr. 111, Blatt 3). Zugleich hatten die Gesellen vereinbart, den Eisenstein nur vom Tageschacht abzufahren, um mit den Fuhrwerken das Grundstück nicht durchfahren zu müssen. Außerdem hielt Herr Troll noch fest, daß auch Braunstein ausgebracht und gewaschen werde, wozu man den Bewässerungsgraben von Herrn Weißflog mitbenutzte. Demnach brachte man also auch Erz aus. Nach seiner nächsten Befahrung hatte der Geschworene zu bemängeln, daß der Ausbau mit zu schwachen Holz erfolge. Wie er am 26. Februar 1852 auch in Annaberg anzeigte, habe er dies schon wiederholt angemahnt. Der Kommunikationsweg nach Schwarzbach sei „schon einigen Senkungen unterworfen“ gewesen, die Einsenkungen jedoch jedesmal von den Eigenlehnern wieder aufgefüllt worden (40169, Nr. 111, Blatt 5). Das befand man auch im Bergamt und setzte am 3. März 1852 eine schriftliche Anweisung an den Lehnträger auf, zukünftig den Ausbau „nicht mehr mit Stangen, sondern nur noch mit Stammholz“ vorzunehmen, sonst sähe man sich „zur Anordnung von Strafmaßnahmen veranlaßt.“ (40169, Nr. 111, Blatt 7) Eine Bestätigung darüber ist zwar in der Grubenakte nicht zu finden, doch muß Herr Richter, der anfänglichen Erfolge halber, noch eine gevierte Maß hinzugenommen haben. Denn am 27. Juli 1853 nahm man in Annaberg zu Protokoll, daß er diese wieder losgesagt habe (40169, Nr. 111, Blatt 8). Offensichtlich hielten auch hier die Erzvorkommen aber nicht lange aus, denn am 24. Januar 1855 wurde im Bergamt protokolliert, daß die Grube für die letzten vier Quartale mit den Quatembergeldern im Rückstand geblieben sei. Damit wurde sie von Bergamts wegen „wieder ausgethan.“ (40169, Nr. 111, Rückseite Blatt 8) Das war auch schon die ganze Geschichte. Die damit ins Bergfreie gefallene Grube holte sich anschließend Herr Fikentscher zu seinem Grubenfeld hinzu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoffnung Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wird eine Hoffnung Fundgrube im Zeitraum von 1793 bis 1796 genannt (40166, Nr. 22 und 26). Das darin über diesen recht kurzen Zeitraum dokumentierte Ausbringen an Eisenerz summierte sich auf 878 Fuder (rund 750 t). Unter dem ähnlichen Namen Hoffnung Gottes wurde schon 1746 „den 9. Februarii Herrn Hannß Heinrich von Elterlein aufn Pfeilhammer 1 Fundgrube nebst des 1ten obern Maas auf Hrn. Gottlieb Meyers Erbguth in Tännicht auf Silber, Kupffer, Zinn, Eisenstein und alle Metalle und Mineralien verliehen und zur Hoffnung Gottes genennet... Das Anhalten der Fundgrube soll in der alten Binge, welche itzo von neuem gewältigt worden, genommen und halb hinauf halb aber hinunter gestrecket werden, vgl. Muthung sub No. 202“ (40014, Nr. 43, Blatt 30). Am 20. April 1746 wurden Hans Heinrich von Elterlein hierzu noch weitere 8 Lehne auf 2 Posten verliehen (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 30). Wenn sich schon die Fundgrube um eine alte Pinge herum erstreckte, hatte auch diese natürlich noch Vorläufer... Letzterer blieb aber nicht lange im Feld, denn Reminiscere 1754 wurde unter diesem Grubennamen erneut eine Verleihung eingetragen: „Den 20. Martii ist von mir Samuel Enderlein, Bergmeister, 1 fundgrube und erste obere Maß auf Eisenstein, alle Metalle und Mineralien auf Hrn. Gottlieb Meyers in Tännicht Grund und Boden Christian Heinrich Reppeln, Bergarbeiter in Langenberg, verliehen und mit dem Nahmen Hoffnung Gottes benannt worden, wobey zu gedencken, daß das Anhalten im alten Schacht genommen werden soll.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 45) Ob diese Grube aber mit der späteren Hoffnung Fundgrube identisch war, ist nicht mehr zu klären. Der Name dieser letzteren Grube taucht auch noch an anderer Stelle auf, denn am 16. Juni 1793 mutete der Zehntner Gottlob Benjamin Reinfeld aus Erla „auf Herrn Erbrichter Naumann in Schwarzbach Grund und Boden eine Fundgrube auf einem flachgangweise streichenden und gegen W. fallenden Gange auf Eisenstein und alle anderen Metalle.“ Derselbe hat am 17. Juni 1793 auch die beiden nächsten Maße gemutet und mutete am 24. Juli 1793 noch zwei weitere obere und eine weitere untere Maß und erhielt alles auch bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 155ff). Noch ein Blatt weiter ist dann in dieser Akte aufgeführt, daß ein Herr Carl Friedrich Haustein am 2. Oktober 1793 „nach dem Willen des Herrn Zehndners Reinfeld zur Hoffnung Fundgrube“ noch weitere Maße (bis zum 5. oberen und 5. unteren Maß) „auf einem spatgangweise übersetzenden Eisensteingang unter dem Nahmen Gottes Gnade“ hinzu gemutet hat. Ob es sich dabei nun um einen Vorgänger der Gnade Gottes Fundgrube (dann hätte sie allerdings unterhalb von Langenberg am Roten Hahn gelegen) oder aber der Hoffnung Fundgrube handelte, ist noch unklar, jedenfalls mutete besagter Reinfeld am 31. Juli 1793 dann wieder selbst „zum Besten der Hoffnung Fundgrube auf einem übersetzenden Eisensteingang, deßen Streichen noch nicht gehörig angegeben werden kann, eine Fundgrube nebst beiden nächsten Maßen.“ Das Schreiben ist unterzeichnet mit „Erlaer Hammerwerk, den 31.July 1793,“ was uns den Hinweis gibt, daß der Zehntner Reinfeld damals im Besitz des Eisenhammers in Erla gewesen sein dürfte und wohin das erhoffte Erz geliefert werden sollte (40014, Nr. 153, Blatt 104ff). Schließlich wurde am 3. Oktober 1793 hierzu noch ein tiefer Stolln gemutet, welcher „ohngefähr 50 – 60 Lachter von der Hoffnung Fdgr. angesetzt“ werden sollte, was uns nun wieder den Hinweis gibt, daß beide Gruben nicht weit auseinander gelegen haben können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch die Hoffnung Fundgrube bei Schwarzbach haben wir in den Fahrbögen des Geschworenen Johann Samuel Körbach am Ende des 18. Jahrhunderts finden können (40014, Nr. 185, Film 0074): Hoffnungs Fundgr. auf Eisenstein,
in Scheibenberger Bergamts Refier gelegen, „Befande solche mit dem Steiger und 10 Mann beleget, durch solche würd der Tageschacht mit 6 Mann saiger von Tag abgesunken, war in allem in Stunde 10,2 4 Lachter niedergebracht, kommen noch in Flachen Ganges Liegendem ein Eisenstein Trümer herein, bey 3 Lachter unterm Tag wird ein Ort mit 2 Mann in der (?) breit gegen Nord halb Ost betrieben, war 5 Lachter fortgebracht, und von der Mächtigkeit des Eisensteins noch nicht zu bestimmen ist. Bestehet aus rothem thonartigem und grauen vermengten Eisenstein.“ 23. Sep. 1793 Im folgenden Quartal notierte Herr Körbach (40014, Nr. 185, Film 0084), es „wird ein Ort bey 5 Ltr. Teufe unterm Tag auf dem flachen Eisensteingang in Nord mit 3 Mann betrieben, der Gang ist noch nicht in seiner Mächtigkeit ausgerichtet, bestehet aus aufgelöster rother Eisenerde und führet grauen Eisenstein, würd ein Ort auf nur gedachtem Gange in Süd betrieben, mit 3 Mann bey 3 Ltr. unterm Tag aus dem mittäglichen Schachtstoß, der Gang bestehet aus gemelten Bestandtheilen, ist 100 Fuder in diesem Qua. gewonnen und an das Erlaer Hammerwerk á 1 Th. ‒ ‒ vermeßen worden.“ 20. Dec 1793 Abnehmer des Erzes waren hiernach wie schon 1793 die Besitzer des Erla'er Eisenhammers südlich von Schwarzenberg. Im Folgejahr befand der Geschworene das Folgende für bemerkenswert (40014, Nr. 185, Film 0095): Über daß Eigenlöhner Grubengebäude
Hoffnungs Fundgrube Eisensteinzeche „Befande solches mit dem Steiger und 6 Arbeitern beleget. Durch solche wird das Ort bey 4½ Ltr. Teufe von Tag herein vom Schacht auf dem flachen Gang in halb Ost und Süd betrieben. Der Gang ist gegen 1 Ltr. mächtig, führt rothe aufgelöste Eisenerde Quarz und braunrothen Eisenstein, ist sothanes Ort vom Tageschacht in allem 7 Lachter erlenget. Die Waßer werden vermittelst einer Pumpe mit 3 Mann zu 3/3teln gehalden und sind so stark, daß solche kaum können zu Sumpfe gehalden werden.“ 19. April 1794 Auch im zweiten Halbjahr 1794 hat Herr Körbach pflichtgemäß diese Grube befahren und notierte in seinen Fahrberichten darüber (40014, Nr. 185, Film 0114): „a) Belegung war mit 1 Steiger, 3 Häuern, 2 Lehrhäuer, 2 Knechte, und 1 Jungen beleget, in summa 9 Mann. b) gangbare Baue betr. Würd von dem 5 Ltr. saiger tiefen Tageschacht in 10½ Ltr. langen, betriebenen Quärschlag in halb Ost und Süd auf dem angefahrenen flach streichenden Eisenstein Lager deßen Neigung unter einem Winkel von 50 Grad in Ost hat, ein Ort mit 1 Ltr. Höhe durch 3 Mann in Nord betrieben, zu 3/3tel Belegung, sothanes Lager ist ¾ bis 1 Ltr. mächtig und bestehet aus Gneis mit vermengter Eisenerde und grauem einbrechenden Eisenstein. Würd bey nur gedachter Teufe und Länge ein Ort mit 3 und 4 Mann Abend zu auf dem selben in Süd betrieben, hier führt das Lager völlig aufgelöste Eisenerde, welche mehrentheils roth ist, sehr (?) und wird wohl nur eine angeschobene Lage sein.“ 20. Oct. 1794
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im nächsten Jahr fand der Berggeschworene für
berichtenswert (40014, Nr. 193, Film 0014):
Über Hoffnungs Fundgrube bey
Schwarzbach gelegen „a) Belegung betreff. Befande solches mit 1 Steiger, 3 Häuern, 3 Knechten, 1 Jungen beleget, in summa 8 Mann, durch solche Zweitens würd bey 5 Lachter untern Tag auf dem Tagschacht der westliche Schachtstoß ein Ort auf einem Stunde 2 streichenden und in Abend fallenden, rothen Eisenstein Lager in Mitternacht betrieben, finden sich häufige Waßer, ist sehr nothwändig, wenn dieses Grubengebäude soll einen Fortgang haben, daß auf einen Stolln zu betreiben getrachtet wird.“ Und am 22. August 1795 notierte er (40014, Nr. 193, Film 0022), durch die Belegschaft werde „bey 8½ Ltr. Teufe unterm Tag aus dem saigeren Schacht ein Ort in der Stunde 6,7, gegen Morgen, das fürliegende Eisenstein Lager anzufahren betrieben, die Grund Waßer sind sehr häufig, müßen vermittelst einer Trikelpumpe (Drückelpumpe ?) gehalden werden, mit 3 Mann zu 3/3teln wird gedachtes Ort fernerweit in Quergestein fortgestellt, war 2½ Ltr. erlengt und wird noch gegen 15 Ltr. bis an das Eisenstein Lager zu treiben seyn.“ Ein halbes Jahr später hieß es dann im Fahrbogen von Herrn Körbach (40014, Nr. 193, Film 0039): „Mann hat bey diesem Grubengebäude mit Betrieb des Versuchsorts von dem 8½ Ltr. tiefen Tageschacht bei 11 Ltr. Entfernung in Süd einen Stunde 9 streichenden und gegen 60 Grad in West fallenden Gang angefahren, welcher ½ Ltr. mächtig ist, aus führender aufgelöster Gneis und Quarz bestehet und auf solchem soviele Waßer erschroten, das 6 Mann kaum imstande sein, zu 3/3tel Belegung solche zu halten, da nun der Eisenstein sehr geringe ist, so will der Eigenlöhner solches Grubengebäude liegen laßen, und dafür das Beylehn am Graul Gottes Seegen schwunghaftiger betreiben.“ 4. März 1796 Nun, das dürfte denn auch das Ende dieses Bergbauversuchs gewesen sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sieben Brüder Stolln bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Stolln dieses Namens mutete Schichtmeister Christian Gottlob Richter vor dem Bergamt in Scheibenberg am 7. Juni 1793 „auf Christian Friedrich Treidels (Name unleserlich ?) Erbgut zu Schwarzbach an der so genannten Schwarzenberger Straße, so von Elterlein nach Schwarzenberg gehet.“ (40014, Nr. 153, Blatt 102) In den Fahrbögen der Berggeschworenen haben wir eine Grube dieses Namens aber bisher nicht finden können. Es gab jedoch einen zweiten Stolln
desselben Namens unterhalb von
Außerdem gab es in den 1840er Jahren noch einen dritten Stolln diesen Namens bei Hermannsdorf im Zschopautal nördlich von Schlettau (noch zum Scheibenberg'er Bergrevier gehörig) ‒ der ist uns aber bei unserem Thema zu weit abgelegen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neues Jahr Fundgrube bei Schwarzbach
oder Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch bei dieser Zeche handelte es sich um ein wohl eher unbedeutendes Eigenlehnergebäude, das keinen langen Bestand hatte. Den Namen Neu Jahr haben wir erstmals aber schon im Jahr 1763 im Verleihbuch des Bergamts Scheibenberg gefunden, wo es heißt: „Den 30. Martii sind von mir, dem Bergmeister, Carl Friedrich Riedel 2 Eisenstein Lehn auf Johann Benjamin Fickers Feld, denen dasigen Neuen Jahres Lehnen zum Besten auf 1 Post verliehen worden.“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 52) Der Berggeschworene Samuel Körbach hielt dann 1794 in einem seiner Fahrbögen fest (40014, Nr. 185, Film 0096): Über das Eigen Löhner Gruben
Gebäude Eisensteinzeche Neue Jahr Fdgr. bey Elterlein, „Es wird durch 3 Eigenlöhner von Tage nieder auf einem flach streichenden Eisenstein Lager ein Schacht niedergebracht, war gegen 3 Lachter niedergebracht. Dieses Lager war 18 bis 20 Zoll mächtig, führte Gneiß, Hornstein mit einbrechendem braunrothen Eisenstein, wird gedachter Schacht fernerweit abgesunken.“ 9. April 1794 Da diese Grube hiernach bei Elterlein, respektive ziemlich weit oben im Schwarzbachtal, gelegen haben dürfte, haben wir ihre Geschichte in den Fahrbögen der Berggeschworenen aus späterer Zeit nicht mehr weiter verfolgt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Fahrbögen des zu dieser Zeit in
Scheibenberg zuständigen Berggeschworenen Johann August Karl Gebler
haben wir dann aber eine Eintragung vom 3. Juli 1832 gefunden, die
möglicherweise auf die Wiederaufnahme dieser Grube ‒ jedenfalls einer
Grube recht ähnlichen Namens und ebenfalls bei Schwarzbach gelegen ‒
verweist (40014, Nr. 281, Film 0131).
An diesem Tage nämlich hat er „die
Besichtigung einer neuen Eisenstein- und Braunsteingrube nahmens Neujahrs
Freundschaft im Tännicht bey Schwarzbach abgehalten.“
Wahrscheinlich ist es aber damals nicht zur Bestätigung gekommen, denn das war auch schon wieder die einzige Erwähnung dieses Grubennamens in den Fahrbögen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 11. Oktober 1848 erhielt der
Bergarbeiter Traugott Friedrich Weigel dann unter dem Namen
Neues Jahr bei Langenberg eine gevierte Fundgrube bestätigt (40169,
Nr. 263, Blatt 1). Unter dem gleichen Datum ist vermerkt, daß als
Lehnträger Carl Heinrich Schürer angenommen werde, übrigens auch
für die Neue Gnade Gottes Fundgrube, über die wir
Am 10. Juli 1850 trug der Geschworene Friedrich Gotthold Troll dann aus seinem Fahrbogen in Annaberg vor, daß man einen Tageschacht von 6 Lachter Teufe niedergebracht und dort ein Ort hora 2 Süd angeschlagen und 2,6 Lachter ausgelängt habe. Weil dieses Ort in Richtung des Reppel'schen Wohnhauses führe, hatte der Geschworene diesen Ortsbetrieb aber zu sistieren angewiesen. Der Anweisung folgte auch das Bergamt und gab sie sicherheitshalber auch schriftlich an den Lehnträger weiter (40169, Nr. 263, Rückseite Blatt 2). Die Grube stand von Anfang an nicht unter einem guten Stern und der nächste Ärger folgte gleich: Am 24. Juni zeigte Traugott Friedrich Weigel im Bergamt an, daß er für die Abfuhr geförderten Erzes einen Fahrweg auf dem Grund und Boden von Carl Friedrich Weigel zu Raschau nutzen müsse, mit dem seit längerem schon, unabhängig von der Anzahl der Fuhren, für die jeweiligen Tage eine Entschädigung von 7 Neugroschen, 5 Pfennigen vereinbart war. Nun habe letzterer aber sein Gut an seinen Sohn gleichen Namens übergeben und der wolle die Vereinbarung nicht fortführen, verweigere das Wegerecht und habe sogar eine Fuhre gepfändet. Er ersuchte nun das Bergamt um Abhilfe (40169, Nr. 263, Blatt 4f). Im Übrigen erfahren wir hieraus noch, daß die Käufer des Erzes, in diesem Fall das Breitfeld'sche Hammerwerk in Großpöhla, die Abfuhr mit eigenen Fuhrleuten selbst übernahmen. Um die Angelegenheit zu einer gütlichen Einigung zu bringen, setzte das Bergamt für den 2. Juli 1851 einen Verhandlungstermin an. Dem Protokoll zu dieser Verhandlung ist zu entnehmen, daß sich der Bauer Weigel „auf das Bestimmteste“ weigerte, weitere Erztransporte über seinen Boden zuzulassen, zumal es andere Möglichkeiten gäbe. Die Alternativen beschränkten sich aber auf einen Fußweg durch Witwe Reppel's Garten, was wiederum der Bergmann Weigel als unzumutbar ansah und auch der anwesende Geschworene Troll bestätigte (40169, Nr. 263, Blatt 8f). Daher vertagte man sich und beraumte für den 14. Juli 1851 eine Lokalexpedition unter Zuziehung der Ortsrichter an (40169, Nr. 263, Blatt 10). Dem Protokoll zu diesem Ortstermin kann man dann entnehmen, daß man sich am Ende einigen konnte, allerdings hatte der Bergmann von nun an für jede Fuhre, die den Grund des Bauern überquerte, einen Zins von 1 Neugroschen, 5 Pfennigen zu zahlen. Außerdem sollte Carl Friedrich Weigel einen Teil der Erzfuhren übernehmen; durfte dafür aber keinen höheren Lohn, als die Fuhrleute der Hammerwerke fordern. Auch die Anfuhr des Zechenholzes sollte der Bauer übernehmen (40169, Nr. 263, Blatt 13ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 18. Februar 1852 beklagte dann die
andere Nachbarin, die Witwe Christiane Friedericke Ullmann, geb.
Reppel, vor dem Bergamt, daß die Eigenlöhner der Grube ihre Stolln bis
unter ihr Haus getrieben hätten und bat wegen der befürchteten
Einsturzgefahr um eine Untersuchung (40169, Nr. 263, Blatt 17). Schon am
folgenden Tag berichtete Geschworener Troll nach Annaberg, es gebe
tatsächlich einen Mauerriß im Stall und Senkungen zwischen der Scheune und
dem Schacht, welche aber durch die Grubenbesitzer jedesmal „sogleich
wieder aufgefüllt worden sind.“ Auch habe sich „die Hausmauer...
der Länge nach geteilt,“ was Herr Troll aber dem „zu
leichten Grund, auf dem sie ruht,“ geschuldet ansah. Jedenfalls hat
der Geschworene auch gleich noch den Mitgesellen Eduard Weigel
aufgesucht und den Grubenbetrieb bis auf weiteres untersagt, woraufhin der
aber angab, Reppel's Sohl selbst habe im Keller des Gebäudes
unerlaubterweise Bergbau betrieben und ihm sogar einige Zentner Braunstein
verkauft (Upps, das wäre ja jetzt eine Selbstanzeige wegen
Steuerhinterziehung und Hehlerei...), wovon allerdings der Geschworene
nichts mitbekommen haben wollte (40169, Nr. 263, Blatt 18f). Außerdem
wurde durch Herrn Troll noch ein Sicherheitsabstand für alle
Grubenbaue zum Haus hin festgesetzt. Auch seitens des Bergamtes in
Annaberg wurde daraufhin am 24. Februar 1852 die Abbaueinstellung
bekräftigt und dem Lehnträger schriftlich angewiesen, daß er sämtliche
Abbauhohlräume in der Nähe des Hauses gründlich auszusetzen habe (40169,
Nr. 263, Rückseite Blatt 19f).
Das beruhigte aber die Hausbesitzerin nun nicht, sie beschwerte sich am 23. März 1852 erneut beim Bergamt und forderte Schadenersatz für die Mauerwerksschäden (40169, Nr. 263, Blatt 22f). Vom Bergamt wurde Geschworener Troll mit einer erneuten Kontrolle beauftragt, was man auch Frau Ullmann mitteilte, aber die hatte inzwischen vor dem zuständigen Gericht in Grünhain Klage eingereicht. Beim Justizamt wußte man anscheinend nicht so genau, welches Bergamt denn nun hier zuständig war und hatte behufs weiterer Erörterung durch Sachverständige am 2. September 1852 zuerst nach Johanngeorgenstadt geschrieben. Dort hatte man die Anfrage aus Grünhain natürlich nach Annaberg weitergeleitet (40169, Nr. 263, Blatt 25ff). Das Bergamt wiederum schrieb dann am 15. September an das Justizamt in Grünhain, der vorgebrachte Antrag der Klägerin auf Untersagung des gänzlichen Grubenbetriebes bis zur Regulierung der Schäden gehe zu weit. Der Geschworene habe in der Zwischenzeit kontrolliert, daß der Versatz der dem Hause naheliegenden Hohlräume richtig ausgeführt worden ist. Sofern das Justizamt aber eine eigene Lokalexpedition abhalten wolle, bot man die Mitwirkung an. Wie diese Geschichte ausgegangen ist, verraten uns die Bergamtsakten nicht. Man kann aber mit einigem Recht vermuten, daß den Bergleuten die Sache zu heiß geworden ist. Am 21. Mai des Jahres 1853 nahm man jedenfalls in Annaberg zu Protokoll, daß der Lehnträger mit Ende Luciae 1852 den Betrieb eingestellt und die Grube nun losgesagt habe (40169, Nr. 263, Rückseite Blatt 28).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krähers Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wird Krähers Fundgrube einmalig im Jahr 1796 mit einem Ausbringen von 15 Fudern Eisenstein genannt (40166, Nr. 22 und 26). Die Mutung des Herrn Johann Friedrich Kräer (hier wurde der Familienname ohne das ,h´ geschrieben) vom 24. Mai 1796 galt einer Fundgrube „auf einem stehenden Gang in Schwarzbach auf Georgii Grund und Boden“ (40014, Nr. 191, Blatt 15). Sie wurde ihm nach Freifahren durch den Berggeschworenen am 24. Mai 1796 (oder am 6. Juli) auch bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 180).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Grubenname erscheint Ende des Jahres 1796 auch erstmals in den Fahrbögen des Scheibenberg'er Berggeschworenen Johann Samuel Körbach, worin dieser berichtete (40014, Nr. 193, Film 0072): Über Kräers Fundgrube zu
Schwarzbach, „Bey diesem eigenlöhnerischen Grubengebäude wird bey 3 Ltr. untern Tag auf einem Stunde 3 streichenden und gegen 30 Grad in Abend fallenden Eisensteingang der Bau förstenweiß vermittelst Ortsbetriebs in Nord verführet, der Gang war 12 bis 20 Zoll mächtig und führte grauen Eisenstein mit Horn und Quarz.“ Die Notiz Körbach´s im Folgejahr ist fast gleichlautend (40014, Nr. 196, Film 0017): Kräers Fundgrube zu Schwarzbach, „Befand das Eigenlöhnergebäude mit 2 Mann beleget, wird der Bau bey 3 Ltr. untern Tage auf dem Stunde 3 streichenden und gegen 30 Grad in West fallenden Gang, welcher 12 bis 20 Zoll mächtig war und aus grauem Eisenstein mit vermengten Hornstein bestand, mittelst Überhauen fortgestellt.“ Auch Trinitatis 1797 fand Herr Körbach nichts wesentlich anderes vor, als daß der Gang nun 22 Zoll Mächtigkeit aufweise und „stark in Abend falle“, weswegen man den Bau nun auch strossenweise führe. (40014, Nr. 196, Film 0025) Johann Friedrich Kräher mutete dann am 3.
Juni 1802 einen alten Erbstolln, der in das daselbst gegen Mitternacht
aufsteigende Gebirge getrieben und „auf Hrn. Erbrichter Ehregott Meyers
zu Schwartzbach Grund und Boden“ gelegen war, auf Silber und alle
Metalle und Mineralien. Am 7. Oktober 1802 wurde er ihm unter dem Namen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie Gott will Fundgrube bei
Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wird die Fundgrube Wie Gott will einmalig im Jahr 1802 und nochmals im Zeitraum von 1825 bis 1826 aufgeführt (40166, Nr. 22 und 26). Über die kurzen Betriebszeiträume hat diese Grube demnach 37,6 Fuder Eisenstein (zirka 32 t) ausgebracht. Ein Johann Gottlieb Füscher (oder Fischer) und Consorten muteten am 2. November 1801 eine Fundgrube nebst 1. oberer und 1. unterer Maß „auf des Grundbesitzers Julius Friedrich Seltmanns in Schwarzbach Grund und Boden, die Fundgrube soll heißen Wie Gott will, das Streichen des Ganges soll bey der Bestädigung angegeben werden...“ (40014, Nr. 191, Film 0091 des Digitalisats). Nach der Besichtigung durch den Scheibenberg'er Berggeschworenen Johann Samuel Körbach erhielten sie am 1 Januar 1802 aber zunächst nur eine Fundgrube bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 222). Diese Grube erscheint danach auch Anfang des Jahres 1802 nochmals in den Fahrbögen Körbach's, worin dieser berichtete (40014, Nr. 202, Film 0080): Über die gevierte Fundgrube Wie
Gott will bey Schwarzbach „War der Fundschacht untern Tag gegen 2 Lachter saiger tief mit 3 Ellen Weithung von dem Eigenlöhner auf dem spatgangweiß streichenden Eisenstein Lager abgesunken, hat sich solches Lager mehrentheils in Quarz verwandelt und scheint, als wenn solches nicht wollte fortsetzen. Soll der gedachte Tageschacht noch tiefer abgesunken werden, bis man das Liegende vom Lager eingeholt hat, als dann mit Ortsbetrieb auf solchem sowohl in Abend als Morgen untersucht werden.“ Scheibenberg, den 3. April 1802 Johann Samuel Körbach, Berggeschworener. In der 3. Woche des Quartal Trinitatis 1802 hielt Herr Körbach fest (40014, Nr. 202, Film 0083): „Wird der Tageschacht fernerweit vom Eigenlöhner abgesunken, war gegen 3 Ltr. saigertief niedergebracht und war das Eisenstein Lager noch nicht ausgerichtet und das Liegende noch nicht erreicht worden.“ Auch bei diesem ,Eigenlöhner´ hat es sich vermutlich um einen ,Nebenerwerbs-Bergmann´ gehandelt, denn als der Geschworene in der 7. Woche Trinitatis hier erneut vorbeischaute, fand er „solches Grubengebäude mittwochs vom Eigenlöhner unbelegt.“ Herr Körbach hatte in diesem Quartal wohl öfter hier zu tun, denn in der 11. Woche Trinitatis 1802 war er schon wieder hier und notierte, der Tageschacht werde weiter abgesunken, „das Lager, so etwas Eisenstein und Braunstein und Quarz führt, zu durchsinken.“ (40014, Nr. 202. Film 0092) Damit war man schließlich auch erfolgreich und im Fahrbogen auf das Quartal Luciae 1802 heißt es dann (40014, Nr. 202, Film 0116): Gevierte Fdgr. Wie Gott Will bey
Schwarzbach „Wurde der Bau von Eigenlöhnern bey 2 Ltr Teufe unterm Tage mittels Ortsbetrieb gegen Süd in dem sehr mächtigen Eisenstein Lager fortgestellt, solches Lager führt Quarz, Hornstein und rothbraunen Eisenstein.“ Oh, auch hier wieder ein ,sehr mächtiges Lager´ ‒ vielleicht aber auch nur wieder eine dicke Beule in einer lateral nicht aushaltenden Linse... Im Spätsommer 1803 war man immer noch mit der Ausrichtung befaßt (40014, Nr. 209, Film 0044f) und es „wurde bey 3 Ltr. Teufe unterm Tag in dem noch nicht ausgerichteten sehr mächtigen Eisenstein Lager ein Versuchsort von Eigenlöhnern in Südwest betrieben, bricht in solchem Lager Quarz, Hornstein und etwas Eisenstein mit ein.“ Das hatten wir doch auch schon andernorts: Das Lager sei zwar ,sehr mächtig´, aber es bricht nur ,etwas Eisenstein´ mit an...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osterfest Stolln bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer
Bergreviere wird nur die Osterfreude Fundgrube bei Langenberg
aufgeführt (40166, Nr. 22 und 26). Diese hat allerdings nichts mit
dem
Osterfest Stolln zu tun, denn über
die Osterfest Fundgrube heißt es im folgenden Text ausdrücklich ,bei
Schwarzbach´, während
Der Stolln wurde am 3. Juni 1802 durch Johann Friedrich Kräher „auf Herrn Erbrichter Ehregott Meyers Grund und Boden zu Schwartzbach“ gemutet und ihm am 7. Oktober des Jahres auch bestätigt (40014, Nr. 191, Film 0096 und 40014, Nr. 43, Blatt 225).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Grubenname erscheint Ende des Jahres 1802 erstmals in den Fahrbögen des Scheibenberg'er Berggeschworenen Johann Samuel Körbach, als dieser berichtete (40014, Nr. 202, Film 0111): Über den in dem Qu. Luciae 1802,1te
Woche erst bestätigten „war solcher von Eigenlöhnern in dem Qu. Luciae a. c. No 4te Woche vom Stollnmundloch 4 Ltr. in Stunde 7 gegen Ost in Quergestein betrieben und die Waßer Saige vom Faßungs Puncte bis Stolln Mundloch von 1 Elle bis 2½ Ellen Höhe gehörig hergestellt, wird das Stollnort fernerweit von Eigenlöhnern in obgedachter Richtung fortgestellt, einen fürliegenden und über Tage erschürften stehenden Gang anzufahren.“ Scheibenberg, den 1. November 1802 Johann Samuel Körbach So richtig ernst scheinen die Eigenlehner die Sache aber doch nicht angegangen zu sein, denn schon im Quartal Trinitatis 1803 fand der Berggeschworene den Stolln von den Eignern unbelegt vor (40014, Nr. 209, Film 0034) und schon Crucis 1803 heißt es in Körbach´s Fahrbogen lapidar (ebendort, Film 0043): „Wird solcher Stolln von Eigenlöhnern nicht mehr betrieben.“ Wieder ein Versuch ohne jeglichen Erfolg...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neuberts Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Mutungsprotokollen des Bergamtes Scheibenberg zufolge haben die Herren Christian Gottlob Neuberth und Gottfried Heinrich Riedel am 4. Oktober 1804 eine gevierte Fundgrube „auf Hr. Meyers grundt und bothen zu Schwarzbach“ gemutet. Diese wurde ihnen auch am 3. Januar 1805 unter dem Namen Neuberts Fundgrube bestätigt (40014, Nr. 211, Film 0014 und 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 234). Möglicherweise war derselbe Herr Riedel später auch an Riedels Fundgrube bei Langenberg beteiligt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der erste Fahrbericht der Berggeschworenen entstammt
dem Quartal Reminiscere 1805 und daher dazumal aus der Feder des Herrn
Johann Samuel Körbach. Er berichtete, man treibe ein Versuchsort vom
Tageschacht in 3 Lachter Teufe gegen Morgen, das Lager ist aber noch nicht
richtig ausgerichtet, führe aber Hornstein Quarz und grauen Eisenstein
(40014, Nr. 232, Film 0013).
Schon im folgenden Quartal Trinitatis 1805 fand der Geschworene die Grube allerdings unbelegt vor (40014, Nr. 232, Film 0014). Crucis 1805 heißt es dann, man betreibe nun in 4 Lachtern Teufe vom neuen Tageschacht aus ein Ort in Morgen, „in der Hoffnung das Lager, welches aus Hornstein und Quarz bestehet mit einbrechendem Eisenstein, auszurichten“ (40014, Nr. 232, Film 0023). Luciae 1805 blieb die Grube erneut unbelegt (40014, Nr. 232, Film 0032).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab 1806 hatte dann Herr Christian Friedrich
Schmiedel die Funktion des Berggeschworenen in Scheibenberg inne und
dieser berichtete in der 12. Woche Reminiscere 1806 (40014, Nr. 235,
Rückseite Blatt 21):
„Bei Neuberts gevierde Fundgrube, ebenfalls Eigenlöhner Zeche im Tännigwalde bei Schwarzbach Wird durch die hier anfahrenden 2 Eigenlöhner ein Schacht, um das noch ohngefähr 1 bis 1½ Lachter tief liegende Eisensteinlager zu ersinken, niedergebracht, und hat erwähnter Schacht zur Zeit eine Teufe von 3 Lachter unter Tage erreicht.“ Man suchte immer noch nach einem geeigneten Aufschluß, um einen regulären Abbau anzulegen... Danach setzen die Erwähnungen dieser Grube in den Fahrbögen der Bergbeamten wieder aus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weißflogs Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere wird eine Weißflogs Fundgrube nur einmalig im Jahr 1808 mit einem Ausbringen von 24 Zentnern Braunstein genannt (40166, Nr. 22 und 26). Ferner finden sich darin noch einzelne Angaben unter ähnlichen Bezeichnungen, wie ,Weißflogs Schurfarbeit'. Die Weißflog's waren offenbar an mehreren
Stellen im Eisensteinbergbau der Region aktiv, denn der Herr
Carl August Weißflog mutete am 28. November 1795 auch eine
Fundgrube und das erste oberes Maß „unter dem Nahmen Gelber Zweig im
Raschauer Pfarrwald“ (40014, Nr. 191, Blatt 8). Über diese Grube haben
wir weiter
Auch der Herr Christian Friedrich Weißflog legte am 16. April 1796 Mutung vor dem Bergamt zu Scheibenberg auf „im Freyen liegende Halden auf Herrn Meiers Grund und Boden im Tännig befindlich“ ein (40014, Nr. 191, Blatt 12) und noch einmal am 19. September 1796 auf eine alte Halde ein, worüber der zu dieser Zeit im Bergamt Scheibenberg zuständige Reviergeschworene Johann Samuel Körbach an eben dieses berichtete (40014, Nr. 193, Film 0053f): Dienstschuldigste Anzeige von der unterm 16ten Sept. a. c. eingelegten Muthung (...) „Ferner über die unterm 19ten Sept. a. c. von Christian Friedrich Weißflog eingelegte Muthung auf eine alte Halde, solche befindet sich auf des Herrn Carl Gottlieb Meyers Grund und Boden im Tänigwald an dem in Ost ansteigenden Gebirge, bittet der Muther Eu. Wohllöbl. Bergamt um Bestätigung derselben, habe den Schurf und alte Halde am 28ten Sept. 1796 besichtiget. Johann Samuel Körbach, Refiergeschworener.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Weißflogs Fundgrube findet dann erst 1803 in den Fahrbögen Körbach's wieder Erwähnung, wo es allerdings nur lapidar heißt (40014, Nr. 209, Film 0049): Das Eigenlöhner Grubengebäude
Weisflogs Fundgrube bey Langberg „Habe solches Grubengebäude donnerstags unbelegt befunden.“ Hm. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten ‒ die Fundgrube war jedenfalls nicht Herrn Weißflog's Hauptwerk... Stattdessen aber taucht ein Lehnträger dieses
Namens in dem Fahrbogen Körbach's auf das Quartal Luciae 1801 auf ‒
jedoch bei der Grube
Ferner wird 1807 auch als Lehnträger der Grube
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distlers Freundschaft Fundgrube bei
Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Grube ist in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) im Zeitraum von 1832 bis 1845 mit nur einzelnen Unterbrechungen im Ausbringen verzeichnet. Über diese Betriebszeit wurden 1.329 Zentner (zirka 66,5 t) Braunstein, aber kein Eisenstein gefördert. Georg Friedrich Distler aus Raschau mutete am 31. Dezember 1831 eine gevierte Fundgrube zwischen Hausteins Hoffnung und Großzeche Fundgrube. Nach Besichtigung der Örtlichkeiten durch den in Scheibenberg zuständigen Geschworenen Johann August Karl Gebler am 4. Juli 1832 erhielt er sie am 24. November 1832 bestätigt (40169, Nr. 42, Blatt 1, Abschrift in 40014, Nr. 270, Film 0107ff und 40014, Nr. 43, Blatt 319).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Fahrbögen des in den 1830er Jahren in Scheibenberg zuständigen Berggeschworenen Johann August Karl Gebler (40014, Nr. 281, 289 und 294) ist sie danach überhaupt nicht erwähnt, allerdings hat dieser auch stets nur über die Vermessung des Eisensteins in seinen Fahrbögen geschrieben und über die ausschließlich auf Braunstein bauenden Gruben meist nur ganz allgemein erwähnt, er habe im Revier die Braunsteinvorräte besichtigt. Lehnträger Distler hatte diese Grube am 4. Januar 1838 wieder losgesagt (40169, Nr. 42, Rückseite Blatt 2 sowie 40014, Nr. 43, Blatt 319). Daraufhin wurde sie jedoch bereits
am 5. Juli 1838 erneut, und zwar diesmal an Christian Friedrich Köhler
aus Raschau, verliehen, welcher zuvor von 1820 bis 1836 der
Lehnträger von Köhlers gev. Fdgr. bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr Gebler hatte die Funktion des
Berggeschworenen bis Trinitatis 1838 inne. Danach besteht eine zeitliche Lücke von mehreren
Quartalen in den Fahrbögen. Ab Reminiscere 1840 sind danach wieder
Fahrbögen des neuen Berggeschworenen Theodor Haupt überliefert
(40014, Nr. 300). Er war gleich
am 10. Januar dieses Jahres auf den in Umgang stehenden Gruben seines Reviers
und berichtete über diese (40014, Nr. 300,
Film 0015):
„Auf Distlers Freundschaft hat man ohngeachtet der bergamtlichen Anordnung an Instandsetzung des untern Tageschachtes noch nicht gedacht, sondern immer nur in 5 Lachter nordwestlicher Entfernung vor zwei in NW. und SO. gehenden Örtern Braunstein gewonnen, der nicht allein mächtig genug, sondern auch von guter Beschaffenheit davor bricht.“ Die zeitliche Lücke in den Fahrbögen hat auch die hier erwähnte ,bergamtliche Anordnung' verschluckt... Aber sicher war wohl wieder einmal der Ausbauzustand des jetzt ja vermutlich auch schon acht Jahre alten Tageschachtes Anlaß für die bergamtlicherseits getroffene Anordnung, diesen instandzusetzen. Bis April 1840 war dies offenbar immer noch nicht erledigt und so kam Herr Haupt in seinem Fahrbogen vom 7. April zu der Einschätzung (40014, Nr. 300, Film 0042): „Nach meinem Erachten ist diese Grube nicht fahrbar.“ Junge, Junge ! Das ist schon ein herbes Urteil und hätte eigentlich die Anordnung der sofortigen Betriebseinstellung bis zum Vollzug besagter Anordnung nach sich ziehen müssen... Etwas schlauer macht uns dann aber der Fahrbogen von Trinitatis 1840, worin unter dem 19. Mai zu lesen steht (40014, Nr. 300, Film 0060f): „Auf Distlers Freundschaft Fdgr. hat man endlich den untern Schacht zugefüllt und nur eine hölzerne Röhre in demselben stehen gelassen, durch die die Wetter vom Tage einströmen sollen. Der jetzige Bau ist in 7 Lachter nordwestlicher Entfernung vom obern Schachte, und die Anbrüche von Braunstein ziemlich gut.“ Na, zumindest das. Der obere Schacht muß demnach in Ordnung gewesen sein. Von seiner Befahrung am 10. August 1840 berichtete Herr Haupt noch (40014, Nr. 300, Film 0092), daß man doch noch einen neuen kleinen Schacht abgeteuft habe: „Auf Distlers Freundschaft gev. Fdgr. hat man circa 7 Lachter vom alten obern Tageschachte einen neuen Tageschacht 3 ½ Ltr. niedergebracht und von da ein Ort in West getrieben, um beide Schächte durchschlägig zu machen und frischen Wetterwechsel in die Grube zu bringen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie schon mehrfach erwähnt, wurde ab
Ende Crucis 1840 Herr Haupt mit anderen Aufgaben betraut und in der
Zeit bis Mitte Reminiscere durch den Schichtmeister Friedrich Wilhelm
Schubert aus Raschau vertreten. Über den Sommer kam es auch hier
wieder zu den bekannten Problemen, worüber man in dessen Fahrbogen unter
dem 8. September 1840 lesen kann: „Auf Meyers, Kästners, Distlers,
Ullricke und Hausteins Fdgr. findet gegenwärtig wegen Wettermangels kein
Betrieb statt.“
(40014, Nr. 300, Film 0107f)
Die Investition in die Wetterführung machten sich aber bezahlt und eher als andere Gruben ging Distlers Freundschaft wieder in Betrieb. In seinem Fahrbogen notierte Herr Schubert unter dem 19. Oktober 1840 (40014, Nr. 300, Film 0118), er habe an jenem Tage „Distlers Freundschaft gev. Fdgr. bei Langenberg befahren, wobei zu bemerken gewesen, daß bei 3 Ltr. Teufe im Tageschachte hora 7,4 in West ein 1,3 Ltr. lang etwa 0,7 Ltr. hoch abgehendes Feldörtchen, welches so eben bis an einen alten zubruche gegangenen Braunsteinabbau fortgestellt, worinnen am südl. Stoße das Braunsteinlager gegen 0,5 Ltr. mächtig angetroffen worden. Indem bis jetzt der alte Abbau noch nicht unterstützt ist, konnte man auch eine genauere Bemerkung nicht einholen und wegen Mangel an Wettern weiter nichts zu befahren. Auch konnte wegen Mangel an Holz der neuerlich 4 Ltr. tief abgesunkene neue Tageschacht bis zur Zeit noch nicht ausgebaut werden. Die Belegung besteht in 1 Knecht und 1 Jungen, Summa 2 Mann.“ Schon am 27. Oktober und nochmals am 9. November 1840 (40014, Nr. 300, Film 0122 und 0123f) hatte der Geschworene dann aber hier den ausgebrachten Braunstein zu verwiegen. Am 26. November hat Herr Schubert erneut „32 Ctr. Braunstein verwogen und dann die Grube befahren. Wobei wahrzunehmen, daß bei 2 Ltr. Teufe im Tageschacht 6 Ltr. hora 7,4 gegen West am südlichen Stoß eines alten Abbaus ein Braunsteinlager 0,3 Ltr. mächtig (...) mitunter ganz schön größtentheils klarer chrystallisirter Braunstein ausgerichtet worden, worauf gegenwärtig der Abbau verführt wird. Die Grube ist belegt mit 1 Knecht und 1 Jungen, summa 2 Mann, bisweilen auch mit einigen Weilarbeitern.“ (40014, Nr. 300, Film 0132f) Regen und Tauwetter machten zu Beginn des nächsten Jahres auf mehreren der Grube des Reviers Probleme. Am 19. Januar 1841 fand Herr Schubert hier den Tageschacht nebst den Abbauen zusammengestürzt vor und notierte darüber hinaus in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 300, Film 0146): „Obgleich die Zimmerung bei bemerkten Gruben nicht in gutem Stand gewesen, so ist die große Nässe (und das?) Tauwetter als Ursache dieser Brüche anzusehen und wurden die Eigenlöhner angewiesen, dauerhafte Zimmerung herzustellen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab März 1841 war dann Herr Theodor
Haupt wieder im Bergamt Scheibenberg tätig und berichtete von seiner
nächsten Befahrung am 24. Mai des Jahres, man
habe hier in 4½ Lachtern Tiefe mehrere Strecken in NW. und SO. getrieben
und nordwestlich vom unteren Tageschacht dabei etwas Braunstein angefahren
(40014, Nr. 300, Film 0181).
Bei seiner nächsten Befahrung von Distlers Freundschaft gev. Fdgr. am 27. Juli 1841 herrschte schon wieder Wettermangel... (40014, Nr. 300, Film 0207) Deswegen war natürlich „der Betrieb sehr schwach und besteht hauptsächlich in Kuttarbeit. Man ist nun gesonnen, in 12 bis 14 Lachter nördlicher Entfernung vom alten Fundschachte einen Stolln anzulegen, der an den jetzigen Schächten ungefähr 6 bis 7 Lachter Saigerteufe einbringen könnte.“ Gute Idee: Irgendwie mußte man ja die ständigen Wettersorgen beheben. Das scheint man aber nicht ernsthaft in Angriff genommen zu haben, denn als Herr Haupt am 19. August im Revier unterwegs war, notierte er über die hiesigen Gruben (40014, Nr. 300, Film 0223f), an jenem Tage „habe ich die Eigenlöhnergruben im Tännicht und Langenberg befahren, von diesen sind aber Ullricke gev. Fdgr und Distlers Freundschaft wegen Wettermangel jetzt gar nicht und Gott segne beständig gev. Fdgr. nur selten zu befahren.“ Wie schon bekannt, wurde Herr Haupt danach erneut mit anderen Aufgaben betraut und diesmal vertrat ihn als Geschworener der Rezeßschreiber Lippmann aus Annaberg (40014, Nr. 300, Film 0230). Dem erging es aber nicht anders. Auch er notierte in seinem Fahrbogen unter dem 15. September 1841 (40014, Nr. 300, Film 0242f), „Gott segne beständig, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. waren wegen Wettermangels nicht zu befahren:“ Der Zustand hielt auch noch weiter an, und so hat Herr Lippmann am 19. Oktober 1841 diese Grube „wegen Wettermangel erneut unbelegt gefunden.“ (40014, Nr. 300, Film 0256) Erst am 11. November 1841 stand Distlers Freundschaft gev. Fdgr. wieder im Umgang. Über seine Befahrung hielt Herr Lippmann nun fest (40014, Nr. 300, Film 0262), daß dieselbe „seit kurzem erst wieder befahrbar und abwechselnd mit 3 Mann belegt (ist). Man baut mit großer Unregelmäßigkeit von dem 5 Lachter tiefen unteren Tageschacht aus ortweise nach allen Richtungen, in der Hauptsache aber gegen Abend, den nesterweise in schwarzem Mulm einbrechenden Braunstein ab.“ Den ausgebrachten Braunstein hat Herr Lippmann dann am 11. Februar 1842 verwogen (40014, Nr. 321, Film 0011).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung der Grube durch
Herrn Lippmann fand kurz darauf am 17. Februar 1842 statt
(40014, Nr. 321, Film 0014).
Die 4 Mann Belegung bauten auch weiterhin „in 8 Lachter Teufe bei 6 Lachter nördilcher Entfernung vom Förderschacht das... in schwarzem Mulm
aufsetzende Braunsteinlagertrum in hora 6 streichortweise sowohl in Morgen
als in Abend ab; das morgendliche Ort ist 6 Lachter, das abendliche Ort
aber 4,5 Lachter ausgelängt worden und die Mächtigkeit des Braunsteintrums
variirt in dieser Extension von einigen Zollen bis zu 0,15 Lachter.“
Schon am 27. April 1842 fand Herr Lippmann die Grube aber wieder unbelegt (40014, Nr. 321, Film 0014). Auch unter dem 21. Juni 1842 steht in seinem Fahrbogen zu lesen (40014, Nr. 321, Film 0048), er habe an diesem Tage „die Eigenlöhnergruben bei Langenberg, im Tännicht und bei Schwarzbach (inspiziert), unter den ich Köhlers, Ullricke, Bescheert Glück, Distlers Freundschaft und Meyers Hoffnung gev. Fdgr. unbelegt fand.“ Das änderte sich wohl in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr, denn weitere Eintragungen zu dieser Grube finden sich in den Fahrbögen aus dem Jahr 1842 nicht. Luciae 1842 war der Geschworene Theodor Haupt wieder nach Scheibenberg zurückgekehrt und bevor er erneut abgeordnet worden ist, hat auch er erst am 28. März 1843 die Grube Distlers Freundschaft wieder befahren (40014, Nr. 321, Film 0159). In seinem Fahrbericht heißt es recht knapp, man habe in 7 Lachter Teufe eine Strecke 5 Lachter in NW und von da 5 Lachter in Ost getrieben, damit sehr schönen Braunstein angefahren, den man mittelst eines Steigortes abbaute. Danach wurde er schon wieder abgeordnet und Herr Lippmann übernahm seine Aufgaben wieder. Der letztere hat dann am 3. Mai 1843 hier wieder Braunstein verwogen und danach die Grube befahren (40014, Nr. 321, Film 0173), wobei aber nicht wirklich etwas Neues zu berichten war. Die anfahrenden 3 Mann bauten nach wie vor in 7 Lachter Teufe und inzwischen in 11 Lachter östlicher Entfernung „sehr schönen und in schwarzem Mulm einbrechenden, 4 – 6 Zoll mächtigen Braunstein mittels eines Steigortes ab.“ Danach schlug wieder der in den Sommermonaten regelmäßig eintretende Wettermangel zu und Herr Lippmann notierte unter dem 13. Juni 1843 (40014, Nr. 321, Film 0182), die Grube sei „wegen Wettermangel nicht zu befahren und die Eigenlöhner befassen sich mit dem Auskutten übertage.“ Fast dasselbe liest man noch einmal von der Befahrung am 21. September 1843 (40014, Nr. 321, Film 0209): „Hier ist man schon seit längerer Zeit mit Wettermangel belästigt und wird daselbst jetzt nur 1 Mann über Tage mit der Aufbereitung des geförderten klaren Mulmhaufwerks, in welchem ziemlich viel Braunstein liegt, beschäftigt.“ Auch am 15. November 1843 blieb die Grube unbelegt. Den ausgeschiedenen Braunstein hat Herr Lippmann am 22. November 1843 verwogen (40014, Nr. 321, Film 0219 und 0224).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Dezember 1843 bis April 1844 nahm
dann Herr Haupt seine Funktion als Berggeschworener wieder selbst
wahr. Im ersten Quartal 1844 war er allerdings nicht auf dieser Grube
anwesend. Anschließend wurde er aber schon wieder mit anderen Aufgaben
betraut und diesmal vertrat ihn in Scheibenberg der Markscheider
Friedrich Eduard Neubert. Letzterer besuchte den Schwarzbach'er und
Langenberg'er Revierteil am 7. Mai 1844, fand die Grube dabei aber wieder
unbelegt
(40014, Nr. 322, Film 0038).
Über mögliche Ursachen für die Nichtbelegung äußerte sich Herr Neubert in seinem Fahrbogen unter dem 12. Juni 1844 (40014, Nr. 322, Film 0047). An diesem Tage, heißt es dort, „beabsichtigte ich, die übrigen im Tännicht und bei Langenberg liegenden Gruben, als Riedels Reppels, Köhlers, Gelber Zweig, Friedrich, Gott segne beständig, Hausteins, Ullricke und Distlers Freundschaft gev. Fdgr. zu befahren, sie waren jedoch sämmtlich außer Belegung, wovon bei den meisten die Unmöglichkeit, die Producte zu verwerthen, die Ursache sein mag.“ Also waren diesmal nicht nur Wetterunbilden am Stillstand schuld, auch die Nachfrage und damit die Verkaufspreise waren wieder einmal im Keller... Nicht anders war es auch bei seinen Besuchen im Revier im August und im September (40014, Nr. 322, Film 0056f und 0068). Seinem Fahrbogen aus dem Zeitraum 10. bis 13. Woche Crucis 1844 fügte Herr Neubert am Schluß an: „Übrigens bemerke ich noch, daß ich in No. 10te und 11te Woche zu mehreren Malen die Gruben Distlers Freundschaft, Hausteins Hoffnung, Friedrich, Gelber Zweig, Köhlers und Reppels gev. Fdgr. bei Langenberg (...) besuchte, diese aber stets unbelegt fand.“ Das blieb auch den Rest des Jahres 1844 so, allerdings war bei seiner Befahrung am 15. November dann doch wieder der matte Wetterzug die Ursache für die Betriebsaussetzung. Unter diesem Datum steht im Fahrbogen zu lesen, „begab ich mich zuvörderst nach dem Berggebäude Distlers Freundschaft gev. Fdgr., um dasselbe zu befahren, was jedoch wegen der sehr schlechten Wetter im dasigen Tageschachte unmöglich war und verfügte mich dann über die Gruben Ullricke, Hausteins, Gott segne beständig, Friedrich und Gelber Zweig gev. Fdgr., die ich sämmtlich unbelegt fand...“ Mehr gab es 1844 von hier nicht zu berichten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung durch Herrn
Neubert gab es am 14. Januar 1845 (40014, Nr. 322, Film 0089f).
Die Grube war nun seit 10. Woche
letzten Quartals wieder mit 3 Mann belegt und ein Ort im Schlage, das in
6,5 Ltr. Teufe des östlichen Tageschachts und 8 Ltr. nordwestlich von
diesem hora 4,0 NW und mit 25° Steigen auf dem Lager getrieben wurde. Und
Herr Neubert notierte noch: „Bergamtlicher Anweisung zufolge
habe ich bei Befahrung dieser Grube mein Augenmerk vorzüglich mit auf die
dasige Zimmerung gerichtet.“
Am 25. Januar 1845 trug Markscheider Neubert im Bergamt Annaberg zu dieser Befahrung der Grube vor (40169, Nr. 42, Blatt 4f), er habe dabei anweisungsgemäß sein Augenmerk auf die eingebrachte Zimmerung gerichtet, ob denn die in den Registern auf Reminiscere und Trinitatis 1844 in Abgang gebrachten Holzmaterialien in der Grube auch wirklich verbaut worden seien. Er berichtete, er habe nur einige neue Türstöcke, Pfosten usw. gefunden, welche zum größten Teil erst nach der Gewältigung der im Frühjahr verbrochen Baue eingebracht worden sind; nach Angabe der Arbeiter aber sei im Vorjahr tatsächlich eine größere Menge Holz verbaut worden, welches aber nicht sichtbar sei, weil es sich in den zubruche gegangenen Bauen befände. Das Bergamt ließ es bei dieser Erklärung bewenden. Herr Neubert war noch einmal am 14. März zugegen, fand die Grube an diesem Tage aber unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0100), und ein weiteres Mal am 16. Mai 1845, um 20 Zentner Braunstein zu verwiegen (40014, Nr. 322, Film 0115). Ende September 1845 fügte er seinem Fahrbogen noch an: „Noch bemerke ich, daß in diesem Quartale zu mehrern Malen die nicht in Fristen stehenden Gruben… Köhlers, Gelber Zweig, Distlers, Rother Stolln besucht, aber stets unbelegt gefunden habe.“ (40014, Nr. 322, Film 0143) Ein Jahr später endete die Geschichte mit der Lossagung dieser Grube, welche dem Lehnträger Köhler am 24. Januar 1846 vom Bergamt bestätigt wurde (40169, Nr. 42, Rückseite Blatt 5).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trommlers Fundgrube bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Grube ist nur einmalig im Jahr 1817, immerhin aber mit einem Ausbringen von knapp 20 t Eisenstein in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) verzeichnet. Unter dem 3. April 1817 ist im Lehnbuch des Bergamts Scheibenberg eingetragen, daß auf deren Mutung vom 1. Dezember 1816 hin den Bergarbeitern Carl Heinrich Riedel, Christian Gottlieb Trommler und Karl August Kreher (oder Kräher ?) „im Tännigwalde bei Schwarzbach auf dem mit einem 4 Lachter tiefen Schachte ersunkenen, ½ Lachter mächtigen, aus Gneis, Quarz, braunem Hornstein, auch gelben und braunem Brauneisenstein zu gleichen Theilen eine gev. Fdgr. unter dem Namen Trommlers Fdgr.“ verliehen worden ist (40014, Nr. 43, Blatt 275, Abschrift in 40169, Nr. 307, Blatt 1). Am 29. Juli 1817 hat der Berggeschworene Christian Friedrich Schmiedel die Grube befahren und in seinem Fahrbogen dazu festgehalten, es werde durch 2 Mann ein Tageschacht abgesenkt und man sei in 4¼ Lachter Tiefe auf das allhier aufsetzende Lager gekommen (40014, Nr. 258, Film 0068). Danach taucht auch diese Grube in den Fahrbögen nicht wieder auf. Auch die Grubenakte (40169, Nr. 307) hat außer der Bestätigung keinen weiteren Inhalt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gabe Gottes Fundgrube bei
Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Grube hat im Tännicht nahe bei Meyers Fundgrube gelegen und ist in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) im Zeitraum von 1824 bis 1826 und nochmals von 1844 bis 1850 verzeichnet. In beiden Betriebsphasen zusammengenommen hat sie rund 460 Fuder Eisenstein (rund 390 t) ausgebracht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Fahrbögen des Scheibenberg'er
Berggeschworenen Johann August Karl Gebler wird sie am
11. September 1823 erstmals wie folgt erwähnt
(40014, Nr. 267, Film 0064):
„Deßelben Tages besichtiget eine von dem (unleserlich ?) Riedel unternommene Schurfarbeit auf Eisenstein, gleich nahe Meyers gev. Fdgr. im Tännicht, und zwar zu nächst oberen Felde gegen Mittag. Man ist hier so glücklich gewesen, guten Brauneisenstein, auch etwas Braunstein anzutreffen, und wird diese Grube bey dem nächsten Sessionstage unter dem Namen Gabe Gottes bestätigen laßen.“ Sie wurde am 4. Juli 1823 durch Carl Friedrich Riedel gemutet und ihm am 8. Januar 1824 bestätigt (40169, Nr. 119, Blatt 1, 40014, Nr. 270, Blatt 3 sowie 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 297).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über die Aufnahme des Betriebes bei dieser Grube
berichtete stattdessen Herr Gebler im Quartal Reminiscere 1824 in
seinem Fahrbogen
(40014, Nr. 271, Film 0004):
„Desselben Tages (am 16. Januar) befahren Gabe Gottes Fdgr. daselbst (in Schwarzbach), belegt mit 3 Eigenlöhnern. Mit dem erst 3 Ltr. tiefen Schacht hat man auf ein Lager von Brauneisenstein getroffen und fängt nun an, theils durch weiteres Niedergehen, theils durch Untersuchung desselben in die Stöße des Schachtes hinaus, zu untersuchen und hat dabey eine Anzahl Fuder Eisenstein gewonnen.“ Die , Anzahl Fuder' belief sich bis zum 29. April 1824 auf ein Ausbringen von 14 Fudern Eisenstein (40014, Nr. 271, Film 0027). Die nächste Befahrung durch den Geschworenen erfolgte am 19. Mai 1824, über die er berichtete (40014, Nr. 271, Film 0032), die Grube sei nun „Belegt mit
Aus dem 5½ Ltr. tiefen Schacht heraus baute man die in dessen Nähe angetroffenen Eisensteinnieren ab und betrieb ferner aus dem mittagabendlichen Schachtstoß Stunde 11,0 gegen Mittag ein Ort, um es mit einem dort angefangenen, schon 4½ Ltr. tiefen, zweiten Schacht durchschlägig zu machen und dadurch besseren Wetterwechsel zu erhalten. Dann folgte allerdings wieder einmal ein heftiger Sommerregen, worüber Herr Gebler (in Bezug auf diese Grube) notierte (40014, Nr. 271, Film 0042f): „Sonnabends, den 26ten Juny (1824) habe ich mich nach dem Tännicht bey Schwarzbach begeben, um zu sehen, in welchem Zustande sich die daselbst befindlichen Eisensteingruben durch das erwähnte gestrige und vorgestrige heftige Regenwetter versetzt fänden mögten und gesehen, daß die beyden kleinen, zu der neuen Eisensteinzeche Gabe Gottes gehörigen Schächte meistens aus Mangel an hinlänglichem Holze zusammengegangen waren.“ Die Eigenlöhner ließen sich von diesem Rückschlag aber offenbar nicht verdrießen, denn der Geschworene berichtete von seiner Befahrung der Grube am 10. August 1824 wieder (40014, Nr. 271, Film 0052f): „Desselben Tages gefahren auf Gabe Gottes Fdgr. im Tännicht, belegt mit
An Statt der beyden ohnlängst statt gehabten (so steht's wörtlich im Text) Schächte, hat man angefangen, einen neuen abzusinken, mit welchem man gegen 3 Ltr. dermalen niedergekommen war, auch dabey einige Fuder Eisenstein gewonnen hatte.“ An den Verwiegetagen ist die Grube in diesem Jahr noch einmal am 3. Dezember 1824 aufgeführt, als der Geschworene hier 12 Fuder Eisenstein zu vermessen hatte (40014, Nr. 271, Film 0073).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahr 1825 war der Geschworene gleich
am 20. Januar vor Ort und notierte über diese Grube in seinem Fahrbogen (40014,
Nr. 273, Film 0009):
„Desselben Tages bin ich gefahren auf Gabe Gottes im Tännicht, belegt mit
Aus dem seit vorigem Herbst von neuem eingebrachten Schachte hat man bey 5 Ltr. Teufe ein Ort gegen Mitternachtmorgen getrieben und mit demselben ein Lager von Brauneisenstein angefahren, auf welchem man die Gewinnung von Eisenstein wiederum betreibt und desgleichen zu Tage gefördert hat.“ Herr Gebler befuhr die Grube am 3. März 1825 ein zweites mal (40014, Nr. 273, Film 0017f), danach aber in diesem Jahr nicht mehr. Die Belegung hatte sich im März etwas erhöht, es waren jetzt
Über den Betrieb heißt es an dieser Stelle: „Aus dem in St. 2,7 niedergebrachten, 3 Ltr. wieder ausgestürzten, anjetzt nur noch 4 Ltr. tiefen Schachte hat man ein Ort gegen Mittag Abend angelegt, daselbst 6 Ltr. fortgebracht und in dieser Länge einen Nieren Brauneisenstein angetroffen, hiervon auch nach angefangener Gewinnung eine Anzahl Fuder solchen zu Tage gefördert. Zwey andre gegen Mittag sowohl als gegen Mitternacht angelegt gewesene Suchörter hat man, da mit denselben nichts ausgerichtet worden, wieder zugestürzt.“ Wie groß die ,Anzahl Fuder' gewesen ist, können wir nicht sagen, denn eine Eintragung über deren Vermessen fehlt in den Fahrbögen. Viel wird es aber nicht gewesen sein, denn mit den Suchörtern hatte man ja nichts ausgerichtet. Den Erzlieferungsextrakten zufolge sind im ganzen Jahr 1825 nur 12 Fuder Eisenstein ausgebracht worden (40166, Nr. 22 und 26).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleich anfangs des Folgejahres war Herr
Gebler nach seinem Besuch der benachbarten Grube Meyers Hoffnung
wieder vor Ort und notierte in seinem Fahrbogen darüber (40014,
Nr. 275, Film 0010f):
„Desselben Tages (am 24.1.1826) habe ich mich auf das Grubengebäude Gabe Gottes Fdgr. daselbst begeben, belegt mit 2 Häuern, 1 Knecht, mit 3 Mann in summa.“ Eisensteingewinnung. „Auch hier betreibt man bey etwa 4½ Ltr unter Tage in des Schachtes Nähe einen Gewinnungsbau auf Brauneisenstein, welcher aber dem der vorigen Grube (Meyers Hoffnung) an Güte keineswegs gleichkommt. Auch hier gedenkt man Untersuchungen in Betreff des Auffindens von Braunstein durch Betrieb eines Ortes gegen Mittag Morgen anzustellen. Da in dem verflossnen Jahre der Eisenstein nicht allzuviel Absatz gefunden und dessen auf mehrern Gruben viel liegen geblieben, weil einige Hammerwerke kalt gestanden, und die umgegangenen sich mit dem bey Vater Abraham Fdgr. und mit dem am Rothenberge bey Erla gelegenen Gruben (?) erkauften versorgt haben, so wäre den Eisenstein- und Braunsteingruben bauenden Eigenlöhnern das Auffinden des jetzt so zu kaufen gesuchten Braunsteins als Ersatz zu wünschen.“ Der alte Eisenhammer zu Erla südlich von Schwarzenberg ‒ vielleicht der älteste überhaupt, jedenfalls den Urkunden nach zu urteilen ‒ saß ja gewissermaßen auf seiner eigenen Lagerstätte: dem mächtigen und auf mehrere Kilometer Länge bergmännisch untersuchten Crandorf'er Eisensteingang. Dennoch lag das Ausbringen dieser Grube am folgenden Verwiegetag (am 5. Juni 1826) unter den umgängigen Gruben mit 27 Fuder, 3 Tonnen Eisenerz an der Spitze (40014, Nr. 275, Film 0045). Nur von Vater Abraham zu Oberscheibe wurde es mit den dort üblichen 40 Fudern im Quartal noch übertroffen. Weitere Erwähnungen der Grube in den Fahrbögen des Jahres 1826 gibt es nicht und auch in den Folgejahren wird sie nicht mehr genannt. Auch in der Grubenakte klafft danach eine Lücke, so daß wir vermuten müssen, daß sie danach recht schnell wieder ins Freie gefallen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fast zwanzig Jahre später nahm die
Grube ein neuer Muter wieder auf. In den Fahrbögen des Markscheiders Friedrich Eduard Neubert,
welcher zu jener Zeit den eigentlich in Scheibenberg amtierenden
Berggeschworenen Theodor Haupt vertrat, ist unter dem 12. September 1844
festgehalten (40014,
Nr. 322, Film 0065f),
an diesem Tage „besichtigte
ich den Punkt, wo Carl Heinrich Lei aus Raschau das auf Herrn Meiers zu
Tännicht Grund und Boden aufsetzende und auf Meiers Hoffnung gev. Fdgr.
bebaut werdende Eisensteinlager, worauf derselbe eine gevierte Fundgrube
gemuthet hat, erschürfen will. Dieser Punkt liegt auf dem Waldboden bei
1,5 Ltr. südlicher Entfernung von der Ecke, welche von der südlichen
kurzen und östlichen langen Seite der Fundgrube von Meiers Hoffnung
gebildet wird... Der Grundbesitzer, Hr. Meier, sah übrigens von Erlegung
einer Caution und Vorzeigung eines Schurfzettels seitens des Muthers ab.“
Drei Tage später war der Markscheider noch einmal vor Ort (40014, Nr. 322, Film 0075) und hat „noch bei Meiers Hoffnung gev. Fdgr. auf dem südöstlichen Eckpunkte der Fundgrube Lochsteine setzen lassen und die Notizen zu der Besichtigungsanzeige gesammelt, welche behufs der Bestätigung des, von dem Bergarbeiter C. H. Lei an der südlichen Seite besagter Fundgrube gemutheten Grubenfeldes bereits an das Königl. Bergamt abgegeben worden ist.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bestätigung des Grubenfeldes ist dann auch am 20. November 1844 erfolgt (40169, Nr. 119, Blatt 1a), wobei in der Bestätigung auch gleich festgelegt worden ist, der Lehnträger habe kein Anrecht auf freies Schachtholz. Sein Name ist in den Akten übrigens ganz verschieden notiert: Mal mit einem ,i', mal mit einem ,y'. Er selbst unterschrieb als ,Heinrich Lein' und so wollen wir es auch halten. Der neue Betreiber nahm die Sache offenbar auch mit einigem Schwung in Angriff. Am 6. Dezember 1844 hat Herr Neubert dann die neue Grube zum ersten Mal befahren und darüber in seinem Fahrbogen festgehalten (40014, Nr. 322, Film 0082f): „Gabe Gottes gev. Fdgr., welche erst in diesem Quartale bestätigt worden ist, und wo ich bereits 5 Fuder Eisenstein für das Hammerwerk Obermittweida sowie 14 Fuder, 3 Tonnen desgleichen für das Großpöhlaer Hammerwerk vermessen habe, war mit 3 Mann belegt und man hat hier bei 3,4 Lachter südöstlicher Entfernung vom südöstlichen Lochstein der Fdgr. von Meiers Hoffnung einen 3,2 Ltr. tiefen Schacht niedergebracht, und aus demselben in 2,3 Ltr. ein damit erreichtes, in Mulm liegendes, circa 20° in SO. einschießendes und 0,5 bis 0,8 Ltr. mächtiges Eisensteintrum mittelst eines 5 Ltr. langen, in hora 10,2 SO getriebenen Fallortes verfolgt, welches Ort ich in altem Mann, unter dem sich jedoch noch Eisenstein hineinzieht, anstehend fand. Der beschwerlichen Förderung halber ist der fernere Betrieb desselben eingestellt worden und man beabsichtigt, nächstens den Schacht weiter abzusinken und dann in einer tieferen Sohle mit einem horizontalen Orte bis unter den Punkt, wo das Fallort ansteht, fortzufahren. In Betrieb war ein in 2,3 Ltr. Teufe und bei 0,6 Ltr. süöstlicher Entfernung vom Schachte angesetztes und 0,5 Ltr. in Ost erlängtes Ort, vor welchem schöner Eisenstein einbricht.“ Das klingt doch gut. Gleich am 13. Dezember war Herr Neubert noch einmal zugegen, um weitere 29 Fuder, 2 Tonnen Eisenerz für den Pfeilhammer in Großpöhla zu vermessen (40014, Nr. 322, Film 0086). Aus dem Fahrbogen wurde auch bei der Bergamtssitzung in Annaberg am 28. Dezember 1844 vorgetragen, wobei noch zu bemerken war, daß die gesamte Förderung im ersten Jahr bei 49 Fudern gelegen hat (40169, Nr. 119, Rückseite Blatt 2) und daß der Verkaufspreis vom Bergamt auf 1 Thaler, 15 Neugroschen pro Fuder taxiert worden ist. Nach der „Ausbeut- und Verlagsdeliberation“ im Januar 1845 konnte der Lehnträger auf Luciae 1844 eine Ausbeute von 19 Neugroschen pro Kux, in Summe 81 Thaler, 2 Groschen Ausbeute ausweisen (40169, Nr. 119, Rückseite Blatt 3). Das ist recht beachtlich, waren die meisten der Eigenlöhnerzechen doch in finanzieller Hinsicht Zubuß- oder bestenfalls Verlagsgruben. Zu der Gesellenschaft, die davon profitierte, gehörten neben dem Lehnträger Carl Heinrich Lein seine Söhne Carl August und Friedrich Eduard Lein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 7. März des Folgejahres fand Herr Neubert die Grube erst einmal unbelegt (40014, Nr. 322, Film 0099). Am 11. April hat er sie erneut befahren und berichtete darüber in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 322, Film 0104f): „In Folge des Thauwetters vor einigen Wochen ist auf der in 2,3 Ltr. Teufe des Tageschachtes etwa 10 Ltr. fortgebrachten Strecke bei 3 Ltr. vom Schacht ein Bruch entstanden, welcher wegen der geringen Teufe bis zu Tage ausgeht, wobei sich herausgestellt hat, daß sich hier der Eisenstein (...) bis unter die Dammerde herauszieht.“ Die beiden Besitzer arbeiteten selbst und füllten den Bruch ganz ab, dabei klaubten sie den Eisenstein aus. Das soll nun noch bis auf die verbrochene Strecke nieder getan werden, diese dann mit neuer Zimmerung versehen und dann der Bruch wieder ausgefüllt werden. „Bei dem dasigen Vorkommen... würde es sehr zweckmäßig sein, wenn man den Abbau... durch bloses Ausfüllen vom Tage nieder bewirkte,“ fand er noch zu bemerken. Diese Arbeit wurde das ganze Frühjahr fortgesetzt und über seine Befahrung der Grube am 6. Juni 1845 liest man (40014, Nr. 322, Film 0120), „die beiden Eigenlöhner fahren fast täglich an“ und hatten den Tageschacht um 2,8 Ltr. auf nun 6 Ltr. vertieft, außerdem ein Fallort aus dem im Frühjahr entstandenen Bruch 1 Ltr. hora 9,4 SO. erlängt, welches nun unmittelbar über der verbrochenen Strecke stand. Den Eigenlöhnern mußte Herr Neubert dabei aufgeben, „die ziemlich hohe Rückseite des Bruches, in welcher besagtes Fallort angesetzt war, entweder durch eine Mauer oder durch Zimmerung zu verwahren, um das Hereinrollen des Gesteins, worüber sich der Grundbesitzer Herr Meier beschwert hat, zu beseitigen, denselben übrigens auch angerathen, sich mit Herrn Meier wegen des Abbaus des Eisensteins gleich vom Tage nieder, was hier als das Zweckmäßigste erscheint, zu verständigen.“ Bis Ende Juli waren dabei 42 Fuder, 3 Tonnen Eisenstein gefördert und dann nach Großpöhla vermessen worden (40014, Nr. 322, Film 0127). Auch bei seinen Befahrungen im September fand er die Grube „fast jeden Tag mit 2 Mann belegt.“ Das Schachtabteufen wurde nicht fortgesetzt, man gewann vielmehr Eisenstein in dem Fallort aus dem Bruch, wo man ini 2,7 Ltr. Teufe einen Querschlag in Ost angeschlagen und 1,3 Ltr. erlängt hatte (40014, Nr. 322, Film 0137). Dabei hatte man bis Mitte September weitere 6 Fuder ausgebracht, die diesmal nach Breitenhof vermessen wurden (40014, Nr. 322, Film 0139). Im November 1845 hatte man sich wieder in das Tiefste des Tageschachtes verlegt und bei 6,2 Ltr. Teufe ein Ort hora 4,2 nach NO 2 Ltr. aufgehauen, stand dort im Brockenfels und kurz vor der Feldgrenze nach Meyers Fdgr., weswegen Herr Neubert anwies, auf hora 6,0 Ost einzuschwenken. Außerdem hatte man das Ort aus dem Tagebau heraus weiter getrieben und bei 2,2 Ltr. südöstl. Entfernung vom Mundloch in der nordöstlichen Ulme Eisenstein angetroffen und abgebaut, der hier bis zu 0,5 Lachter mächtig und „von keiner schlechten Beschaffenheit“ war (40014, Nr. 322, Film 0154f). Bei seinen Befahrungen des Reviers am 18. und 19. Dezember 1845 fand Neubert die beiden Arbeiter wieder auf dem Ort im Tagebau beschäftigt (40014, Nr. 322, Film 0161).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleich am 23. Januar 1846 war dann hier
wieder Eisenstein zu vermessen. Am 12. und 13. Februar hat Markscheider
Neubert die Grube wieder
befahren, diesmal aber nur einen Mann vorgefunden, der vor dem in 6,2
Lachter Teufe aus dem Neuschachte in Morgen erlängten Orte arbeitete,
welches nun 4,7 Ltr. Länge erreicht hatte und in Mulm mit klarem
Eisenstein stand (40014, Nr. 322,
Film 0169 und 0173f). Auch im
März 1846 fand der Geschworenendienst- Versorger das Ort im Tiefsten des
Tageschachtes in Umgang, weil man den oberen Eisensteinbau erst im Sommer
wieder belegen wollte, wenn des Wettermangels halber in der tieferen Sohle
nicht gearbeitet werden kann (40014,
Nr. 322, Film 0178).
So kam es dann auch und am 24. Juni 1846 fand Herr Neubert hier nur nur schwachen Betrieb auf dem Eisensteinabbau auf dem aus dem Tagebruch getriebenen Fallort, während der in 6 Ltr. Teufe am Schacht verführte Bau wegen Wettermangel eingestellt werden mußte. Am 8. September 1846 war die Grube nicht belegt (40014, Nr. 322, Film 0204 und 0218f). Die Überlieferung in diesem Aktenbestand reicht zwar noch weiter bis Reminiscere 1847, doch sind in dieser Zeit offenbar hier keine weiteren Grubenbefahrungen durch die Geschworenen mehr erfolgt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Geschworene Friedrich Gottlob
Troll gab dann am 21. Juli 1848 in Annaberg zu Protokoll, daß er den an den
Grundbesitzer, Herrn Erdmann Friedrich Meyer, zu zahlenden
Grundzins für die Flächeninanspruchnahme auf 1 Thaler, 10 Neugroschen
jährlich festgesetzt habe. Außerdem muß es 1847 zu einem Überbau durch
Meyers Hoffnung auf dem Feld von Gabe Gottes Fundgrube
gekommen sein, aber diese Handschrift ist wieder einmal schwer zu lesen (40169, Nr. 119, Blatt 4).
Ein Jahr später, am 7. November 1849, referierte Troll im Bergamt Annaberg, daß ihm der Verwalter Dietz des Meyer'schen Gutes von einem Überbau durch Gabe Gottes im Feld von Meyers Hoffnung Fundgrube berichtet habe, woraufhin nun Herr Meyer einen Schacht an seiner Feldgrenze teufen wolle, um sich darüber zu vergewissern. Dies hatte er gestattet, woraufhin der Schacht tatsächlich in Abbau eingeschlagen habe, wovon er, Troll, sich gestrigen Tages überzeugt habe. Der Abbau war aber mit Bergen wieder ausgesetzt. Herr Meyer erwarte nun bergamtlicherseits Maßnahmen. Wie zu erwarten, hat das Bergamt daraufhin den Weiterbetrieb bei Gabe Gottes vorläufig untersagt, namentlich die Abfuhr des geförderten Eisensteins, der vermessen werden soll, um die geraubte Menge festzustellen (40169, Nr. 119, Blatt 5ff). Einige Tage später berichtete Troll an das Bergamt, er habe gemeinsam mit Steiger Krauß von Wilkauer vereinigt Feld die Grube Gabe Gottes befahren und die in Rede stehende Menge zu 6 bis 8 Fuder Stufwerk und 3 bis 4 Fuder klaren Eisenstein bestimmt. Der Lehnträger gebe sich unwissend. Bei einer Vernehmung des Lehnträgers Carl Heinrich Lein in Annaberg verwies der auf den zurückliegenden umgekehrten Fall, schob sonst aber alles auf seine mitbauenden Gesellen ab und räumte mangelnde Kontrolle der Arbeit seiner Söhne ein (40169, Nr. 119, Blatt 8ff). Daraufhin wurden beide Parteien am 2. Januar 1850 zu einer Verhandlung ins Bergamt vorgeladen, wobei man sich schließlich gütlich auf eine Ausgleichszahlung von 5 Thalern einigte (40169, Nr. 119, Blatt 18ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch um einen von Carl Heinrich Lein
geforderten Häuersteig durch den Tännigwald für seine Arbeiter aus
Langenberg gab es im März 1850 noch einigen Streit mit dem Grundbesitzer
Meyer. Nachdem sich Geschworener Troll die Situation vor Ort
angesehen und befunden hatte, daß der Umweg über einen bestehenden Waldweg
nur 5 Minuten ausmache, lehnte das Bergamt Lein's Forderung aber ab (40169, Nr. 119, Blatt 20f).
Dann kam ganz plötzlich das Ende: Am 25. Januar 1851 erschienen Carl August und Friedrich Eduard Lein sowie Erdmann Friedrich Meyer, der bekanntlich ja auch Eigenlöhner von Meyers Hoffnung Fundgrube gewesen ist, im Bergamt, wo erstere erklärten, sie wollten ihre Grube Gabe Gottes „zum Besten Herrn Meyers“ gänzlich fallen lassen. Nachdem das Bergamt dies zu Protokoll genommen hatte, legte der letztere darauf sofort Mutung auf das ins Freie gehende Feld ein, das danach im Grubenfeld von Meyers Hoffnung gev. Fundgrube aufgegangen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vier Gesellen bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) haben wir eine Grube dieses Namens nicht gefunden. In den Verleihbüchern des Bergamtes Scheibenberg haben wir die Eintragung gefunden, daß eine Fundgrube diesen Namens am 5. Juli 1807 durch Christian Ehregott Krauß gemutet worden ist, welche jedoch „am Rehhübler Gebirge bei Großpöhla“ gelegen hat (40014, Nr. 43, Blatt 241). Der Berggeschworene Gebler hat in seinem Fahrbogen vom 10. Juni 1824 dazu festgehalten (40014, Nr. 271, Film 0036), er habe nach dem Vermessen des Ausbringens auf zwei anderen Gruben „Desselben Tages in dem Bezirk des Hammerguthes Tännicht einen nahe an der Rainung des Ritterguthes Förstel angelegten Schurf auf Eisenstein, (der) den Namen 4 Gesellen erhalten soll, besichtiget.“ Wenn dieser Schurf nahe an der
Rainung zwischen den Hammergütern Tännicht und Förstel gelegen hat, dann
kann er nicht mit der Grube
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gesegnete Anweisung bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22 und 26) ist eine Grube einmalig im Jahr 1825 mit einem Ausbringen von 35 Fudern Eisenstein (knapp 30 t) erwähnt. Sie wurde am 13. Dezember 1824 durch Christian Gottlieb Weigel gemutet und nach einer Besichtigung durch den Berggeschworenen Gebler am 8. April 1825 durch das Bergamt bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 29ff und 40014, Nr. 43, Blatt 303). Über seine Besichtigung berichtete Herr Gebler, daß der Schürfer und seine Konsorten mit einem Schacht in 8 Lachter Teufe ein Lager von Brauneisen- und Braunstein ersunken haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In seinen Fahrbögen hat der Berggeschworene Gebler diese Grube (und noch einige andere) am 14. April 1825 erstmals genannt (40014, Nr. 273, Film 0024f), wo es heißt, er habe sich „in den Raschauer, Langenberger und Schwarzbacher Reviertheil begeben und sämtliche daselbst befindliche Eisensteingruben in Ansehung von neuen abzusinkenden oder abgesunkener Schächte und der etwa hier oder da zu besorgen gewesener (?) begeben und die Anlage neuer Hilfsschächte zu Beförderung des Wetterwechsels besonders auf dem Grubengebäude Junger Johannes und Köhlers Fdgr. auf Raschauer Gebiet, Osterfreude Fdgr. Langenberg, Freundschaft, Gesegnete Anweisung, Großzeche, Fröhliche Zusammenkunft und Gabe Gottes im Tännicht nöthig befunden.“ Nachdem am 9. Mai 1825 die ersten 22 Fuder ausgebrachten Eisensteins vermessen wurden, fand die erste Befahrung durch den Geschworenen am 11. Mai 1825 statt, worüber es im Fahrbogen heißt, er habe diese Grube mit vier Eigenlöhnern belegt gefunden (40014, Nr. 273, Film 0032f). Außerdem hielt Herr Gebler fest: „Hier habe ich gefunden, daß, weil das dortige Eisenstein- und Braunsteinlager fast unter dem Rasen liegt, ein Stück der dortigen, zwischen den Schächten befindlichen Gebirgsoberfläche sich ohngefähr ½ Ltr. tief niedergesetzt hat.“ Man hatte also bereits zwei oder mehr Schächte geteuft, denn der Geschworene spricht von diesen ja im Plural... Am 21. Juni 1825 waren schon wieder 13 Fuder Eisenstein ausgebracht und zu vermessen (40014, Nr. 273, Film 0041), womit die in den Erzlieferungsextrakten genannte Förderung bereits aufgelaufen war. Als Herr Gebler am 15. Juli 1825 wieder vor Ort gewesen ist, befand er (40014, Nr. 273, Film 0048), „dass man auf der Großzeche Fdgr., ingleichen auf der Gesegneten Anweisung Fdgr. wegen ermangelnder Wetter, und auf Osterfreude wegen ermangelnden Grubenholzes die Arbeiten (?) einstellen musste.“ Der Wetterzug hätte sich eigentlich im Herbst wieder einstellen müssen; dennoch ist die Grube bereits in diesem Jahr nicht noch einmal in den Fahrbögen erwähnt. Bereits neben der Eintragung im Verleihbuch vom 8. April 1825 findet sich der Vermerk: „Losgesagt Reminiscere 1828“ (40014, Nr. 43, Blatt 303).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weigels Hoffnung Fundgrube bei
Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausweislich der Erzlieferungsextrakte (40166, Nr. 22 und 26) hat diese Grube im Jahr 1826 insgesamt 17 Fuder Eisenstein ausgebracht. Der Berggeschworene Gebler hat in seinem Fahrbogen vom 24. Mai 1826 dazu nur knapp festgehalten (40014, Nr. 275, Film 0043), er habe „desselben Tages eine Besichtigung einer im Tännicht neu aufgenommenen Eisensteinzeche, welche unter dem Namen Weigels Hoffnung Fdgr. zur Bestätigung bestimmt ist, ...vorgenommen.“ Im Verleihbuch des Bergamts Scheibenberg ist vermerkt, daß Carl August Weigel aus Raschau dieses Grubenfeld, neben der Grube Gesegnete Anweisung gelegen, am 16. Januar 1825 gemutet hatte. Nach der Besichtigung durch den Berggeschworenen erhielt der Muter das Grubenfeld auch am 3. Juni 1826 bestätigt (40014, Nr. 270, Blatt 54f sowie 40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 308). Da sie in den Erzlieferungsextrakten nur in einem Jahr genannt wurde, ist sie sicherlich aber schon kurz darauf wieder ins Freie gegeben worden. Im Verleihbuch findet sich gleich neben der Eintragung der Bestätigung vom Juni 1826 der Vermerk: „losgesagt Reminiscere 1828“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 308).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Markscheider Friedrich Wilhelm
Neubert, welcher 1845 wieder einmal den Geschworenen Theodor Haupt
in Scheibenberg zu vertreten hatte, notierte in seinem Fahrbogen, er habe
am 2. Mai 1845 „endlich noch den Punct besichtigt, wo der Bergarbeiter
Friedrich Eduard Weigel zu Langenberg in dem laut der Muthung sub. No. 100
an der nordöstlichen Seite der Fundgrube von Friedrich gev. Fdgr. auf dem
dasigen Eisen- und Braunsteinlager gemutheten Felde einen Schurf
aufzuwerfen beabsichtigte, welcher bei circa 8 Ltr. nordwestlicher
Entfernung von dem nördlichen Eckpunkte der gedachten Grube in der Nähe
alter Bingen und auf Waldboden liegt. Indem der Begütherte Ficker zu
Raschau, welcher Besitzer dieses Bodens ist und nebst dem Muther der
Besichtigung beiwohnte, beim Beginn des Schürfens einen Schurfzettel nicht
zu sehen verlangte, so habe ich auch über diese Expedition keine besondere
Anzeige an das Königl. Bergamt erstattet.“ (40014,
Nr. 322, Film 0111f)
Unter dem Namen Weigels Schurfarbeit findet sich daraufhin im Jahr 1848 derselbe Familienname auch noch einmal in den Erzlieferungsextrakten. Zu diesem Zeitpunkt hatte man (ob nun an derselben Stelle, wie 1826 oder auch nicht) nochmals 10 Zentner Braunstein und 6 Fuder Eisenstein gewonnen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Concordia gevierte Fundgrube
bei Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einem Betriebsplan von Schichtmeister Heß aus dem Jahr 1857 ist zu entnehmen, daß nach seiner Kenntnis der erste bergmännische Betrieb hier bereits auf das Jahr 1842 zurückgehe, als ein Bergarbeiter namens Kräher einen Schacht abgeteuft habe, aber des zudringenden Wassers wieder verlassen mußte (40169, Nr. 36, Blatt 11ff). Darüber haben wir aber in der Grubenakte nichts finden können. Erst im Haushaltsprotokoll des Bergamts Annberg vom 18. August 1849 ist die Verleihung einer gevierten Fundgrube „am südlichen Abhange des Haasenberges“ auf dem Grund und Boden des Tännichtgutes, auf einem hora 3 streichenden und 15 Grad in Südost fallenden Eisenstein- und Braunsteinlager an Carl Friedrich Viehweg vermerkt (40169, Nr. 36, Blatt 1). Als Lehnträger dieser Grube wurde am 2. Januar 1850 der Bergarbeiter Christian Friedrich Weißflog angenommen (40169, Nr. 36, Blatt 2). Viel Erfolg scheinen die Muter aber nicht gehabt zu haben, denn schon am 2. August 1852 hatte Geschworener Troll beim Bergamt anzuzeigen, daß die Grube auflässig sei. Zugleich meldete er, daß der 8 Lachter tiefe Tageschacht völlig unverwahrt sei (40169, Nr. 36, Blatt 3). Seitens des Bergamtes folgte man dem Vorschlag des Geschworenen natürlich auch und forderte mit Schreiben vom 12. August den Lehnträger zur ordnungsgemäßen Verwahrung des Schachtes auf. Dieses Schreiben war aber an einen neuen Lehnträger ‒ der also in der Zwischenzeit schon wieder gewechselt haben muß ‒ namens Friedrich August Hammerschmidt adressiert (40169, Nr. 36, Blatt 4). Derselbe konnte oder wollte aber offenbar nichts tun, denn nach seiner nächsten Anwesenheit berichtete Herr Troll am 18. Mai 1853 erneut nach Annaberg, daß die Grube nicht wieder belegt und der Tageschacht noch immer unverwahrt sei. Daher wurde der Lehnträger am 21. Mai erneut zur Verwahrung des offenen Schachtes aufgefordert (40169, Nr. 36, Blatt 5). Die Aufforderung wurde am 18. Juni 1853 nochmals wiederholt, da sich offensichtlich noch immer nichts getan hatte, und diesmal drohte das Bergamt auch an, die Verbühnung des Schachtes auf Kosten des Lehnträgers selbst vornehmen zu lassen und das Berggebäude für bergfrei zu erklären (40169, Nr. 36, Blatt 6). Das war Herrn Hammerschmidt aber wohl doch nicht recht und so konnte Herr Troll am 8. August 1853 nach Annaberg vermelden, daß die Verbühnung der Schachtöffnung nun erfolgt sei, allerdings so mangelhaft, daß dadurch nun „die Erdbewohner noch mehr Gefahr ausgesetzt sind.“ Der Geschworene fand es zweckmäßiger, den Schacht gleich mit Haldenbergen auszustürzen (40169, Nr. 36, Blatt 7). Das Bergamt forderte daher Herrn
Hammerschmidt am 10. August 1853 noch einmal zur soliden Überbühnung
des Schachtes auf (40169, Nr. 36, Blatt 8). Offenbar
ist aber auch daraufhin nicht wirklich etwas geschehen und das
Bergbaurecht entzogen worden, denn am 22. Dezember 1855 wurde sie an
Schichtmeister Heß zugunsten von Carl Friedrich Fikentscher
neu verliehen. Damit kommen wir aber zu einem neuen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neue Unternehmungen
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wilkauer vereinigt Feld
ab 1839
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Erzlieferungsextrakten
aus dieser Zeit (40166, Nr. 22 und
26) ist die Grube unter dem Namen Wilkauer
vereinigt Feld ab 1840 und in den Jahrbüchern für das Berg- und
Hüttenwesen in Sachsen noch bis 1921 aufgeführt. Hier wurde vorrangig
natürlich der Eisenstein gesucht, aber auch Braunstein ausgebracht. In den ersten zehn
Betriebsjahren belief sich das Ausbringen von Eisenstein nach den Angaben
in den Erzlieferungsextrakten auf knapp
700 (metrische) Tonnen, an Braunstein lediglich auf 42 Zentner. Ab 1857 und bis zur Jahrhundertwende
förderte man auf dieser Grube dann insgesamt über 19.000 t Eisenerz, hinzu kamen
noch 732 t Braunstein. In der letzten Betriebsphase bis 1921 wurden noch
einmal über 2.000 t Eisenerz und 225 t Braunstein ausgebracht (40166, Nr. 1 sowie Jahrbücher für das Berg- und
Hüttenwesen in Sachsen).
Sie war nicht die letzte Bergbauunternehmung am Emmler und sie war eigentlich auch kein ,neues' Bergwerk. Fast zeitgleich (Anfang 1841) ist es auch zwischen Friedlich Vertrag und Kästners Hoffnung zu einer ersten Konsolidation gekommen. Bis dahin aber blieben auch die konsolidierten Gruben immer noch Eigenlöhner- Gesellenschaften, auch, wenn die Vergrößerung der Grubenfelder ihnen ein wirtschaftlicheres Arbeiten eigentlich ermöglichen konnte. Wilkauer vereinigt Feld war für dieses Revier deshalb ein neuer Schritt, weil erstmals eine kapitalstarke Aktiengesellschaft im Hintergrund stand, welche hier freie Grubenfelder erworben und zusammengelegt und darauf eine Gewinnung in einer ganz neuen Größenordnung etabliert hat. Anfahrende Belegschaften von mehr als zwanzig Mann hat es hier in den letzten 100 Jahren auf keiner Grube gegeben. Mit einer Mannschaft von um die 15 Bergarbeitern, die sich lange Zeit auch ziemlich konstant hielt, war Vater Abraham zu Oberscheibe die größte Eisensteingrube im hier betrachteten Umfeld; auf allen Gruben am Emmler hingegen waren nur zwei bis vier, selten einmal 10 Arbeiter angelegt. Das Wilkauer gemeinschaftliche Feld befand
sich im Eigentum der Sächsischen Eisencompagnie, eine durch die von
Arnim'sche Berg- und Hüttenverwaltung in Wilkau gegründete
Aktiengesellschaft zur Aufsuchung und Gewinnung von Eisenerzen, welche
namentlich für den kontinuierlichen Rohstoffnachschub für die
Da man nun einen Hochofen
kontinuierlich betreiben muß und nicht einfach ausblasen kann, wenn der
Rohstoffnachschub einmal stockt, suchte die von Arnim'sche Berg- und
Hüttenverwaltung überall im Erzgebirge und im Vogtland nach den nötigen
Rohstoffen. Zu einigen dieser Eisenerz- Bergbaustandorte, etwa bei
Zumindest in der Anfangszeit ab 1839 standen im Revier auch noch folgende Eigenlöhnerzechen zeitgleich in Umgang:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch hier am Emmler erwarb die Eisen- Aktien- Compagnie also nun alle irgendwie noch zu bekommenden Abbaufelder. Einige der bisherigen Eigenlöhner gaben ihre Felder sicherlich auch gern zu einem günstigen Preis ab... Als erstes legte Bergfaktor Ernst Julius Richter aus Cainsdorf am 9. Mai 1839 Mutung ein auf (40014, Nr. 298, Blatt 17ff):
Der hier genannte Ernst Julius Richter war Offiziant der von Arnim'schen Berg- und Hüttenverwaltung und als Schichtmeister für sämtliche der Königin Marienhütte gehörigen Bergbaubetriebe, namentlich der Eisenerzgruben, aber auch anderer Bergbaubetriebe, wie etwa in Wahlen bei Crimmitschau, zuständig. Er wurde auf Empfehlung von Bergrat Friedrich Constantin von Beust im April 1839 von der Sächsischen Eisen- Compagnie eingestellt und nach nur einjähriger Einarbeitung war er ab 1. April 1840 etwa 20 Jahre lang der Bergmännische Bevollmächtigte der Sächsischen Eisen- Compagnie. Auf die oben genannte Mutung hin wurde der im Bergamt Scheibenberg als Geschworener tätige Theodor Haupt mit der Besichtigung der gemuteten Felder beauftragt, worüber er am 23. Juni 1839 an das Bergamt Annaberg berichtete (40014, Nr. 298, Blatt 11ff). In der seinem Bericht beigefügten Skizze zur Lage der zahlreichen Maße ist auch ein „projektirter Julius Stolln“ vermerkt, welcher unweit der Förstel Schenke im Schwarzbachtal angesetzt werden sollte. Der Lageskizze zufolge scheint uns dieser Stolln auf frühere Aktivitäten an just dieser Stelle – etwa durch Carl’s Glück und Nachfolger – im dortigen Obstgarten des Förstelgutes zurückzugehen. Der Stollnverlauf zielte nun aber eine neue Julius Fundgrube unterhalb von Friedrich und Gelber Zweig Fundgrube an. Ziemlich sicher ist anzunehmen, daß der Name dieses Stollns auf den jetzigen Muter, Ernst Julius Richter, zurückgeht. Der Name der Arnim Fundgrube geht dagegen zweifelsohne auf die im Hintergrund stehenden Besitzer der Königin Marienhütte, die Gebrüder von Arnim auf Planitz sowie Frau von Arnim auf Crossen, zurück.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach der Besichtigung durch den
Geschworenen wurden die oben genannten Grubenfelder durch Bergmeister
Julius Bernhard von Fromberg am 26. Juni 1839 zum Besten der Eisen
Actien Compagnie zu Wilkau auch bestätigt, wobei das „pp.“
ausweislich der Bestätigung noch den Kirchenstolln samt dessen
3. Lichtloch und den geplanten Julius Stolln einschloß. Daraus wurden die
drei Teilfelder:
gebildet und alles unter dem „Collectionsnamen“ Wilkauer gemeinschaftliches Feld zusammengefaßt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 337ff sowie 40169, Nr. 142, Blatt 1f). Mit dem nötigen Kapital im Hintergrund ging man die Ausrichtung nun viel systematischer an, als es die Eigenlöhner je hätten umsetzen können. Auch aufgrund der bekannten und schon viel beschriebenen Probleme der kleinen Gruben hinsichtlich der Wasserhaltung und der Bewetterung plante man sofort aus dem Tal heraus neue Stolln oder wältigte die bereits begonnen wieder auf, um sie weiter ins Feld zutreiben. Als erster Steiger für das Wilkauer gemeinschaftliche Feld wurde Karl August Gebler angestellt, der zuvor auf dem Tiefen Kuttenstolln (bei Elterlein) und auf dem Tiefen Engelschar Stolln (einen solchen gab´s bei Waschleithe) Steiger gewesen ist ‒ die Namensgleichheit mit dem früheren Berggeschworenen, der just um dieselbe Zeit aus dem Dienst in Scheibenberg ausschied, ist purer Zufall. Als Schichtmeister wurde von der von Arnim'schen Bergverwaltung Markscheider August Friedrich Strödel benannt (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 2). Am 27. Juli 1839 berichtete Theodor Haupt nach seiner ersten Befahrung im Bergamt, daß man parallel den Arnimschacht abteufe und den Julius Stolln angehauen habe. Das ehrgeizigste Projekt aber war wohl die Gewältigung des 3. Lichtlochs des früheren Kirchenstollns, von dem aus das Stollnort gegen Mitternachtmorgen bis ins Schwarzbachtal weiter getrieben werden sollte (40169, Nr. 142, Blatt 3). Am 28. September 1839 konnte der Geschworene dann bereits vortragen, daß man mit dem Julius Stolln ein Braunstein- und Eisensteinlager angefahren habe (40169, Nr. 142, Blatt 5). Nun, daß bei Förstel solches zu finden sein müßte, war eigentlich keine Neuigkeit ‒ dort haben schon viele vorher darauf gebaut. Bis zu seiner nächsten Befahrung, über die Herr Haupt am 26. Oktober 1839 im Bergamt vortrug, war der Julius Stolln bereits 26 Lachter ausgelängt und der Arnimschacht hatte 11 Lachter Teufe erreicht. Am 12. September 1839 hat auch eine erste Generalbefahrung des neuen Grubengebäudes durch das Bergamt stattgefunden. Der Registratur hierzu ist zu entnehmen (40169, Nr. 142, Blatt 11ff), daß insgesamt 19 Mann auf Wilkauer vereinigt Feld angelegt waren. Der Grube waren zu diesem Zeitpunkt die schon genannten 2 Stolln, 3 gevierte Fundgruben und 26 obere nebst 50 untere gevierte Maßen verliehen. Sie war vergewerkt, wobei sich jedoch sämtliche Kuxe im Eigentum der Sächsischen Eisen Compagnie befanden. Da man das Feld noch ausrichtete, war bisher kein Ausbringen zu verzeichnen und stattdessen eine Grubenschuld von 62 Thalern sowie ein Rezeß von 809 Thalern, 21 Groschen und 3 Pfennigen aufgelaufen. Unter dem Punkt III. Befund bei der Befahrung heißt es in der Niederschrift, daß das Hauptort des Julius Stollns bei 33 Lachter Erlängung in „unregelmäßig geschichtetem, mit Lagern von Quarz und eisenschüssigem Mulm durchzogenem Glimmerschiefer“ stehe, eventuell aber später wieder aufgenommen und noch zirka 40 Lachter bis Gelber Zweig Fdgr. fortgestellt werden solle. Das Flügelort nach Osten war inzwischen 16 Lachter ausgelängt, wobei man aber schon 6 Lachter vom Hauptstolln in alten Mann eingeschlagen habe. Ja, ja ‒ die Alten waren schon da... Über den Arnim Stolln steht zu lesen, daß man eine Wassersaige von 27 Lachtern Länge angelegt hatte und der Stolln nun 24 Lachter ins Feld gekommen war. Dessen Ort stehe „in zerrüttetem Glimmerschiefer.“ Schließlich hatte der Grubenvorstand noch angesprochen, daß man ein Huthaus benötige. Die Gewerkschaft des Tiefen Kuttenstollns habe angeboten, ihr nicht mehr benötigtes Huthaus zu übernehmen, was das Bergamt auch genehmigte. Auch der Kaufpreis von 100 Thalern für das Huthaus war bereits ausgehandelt...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als Schichtmeister und
Rechnungsführer der neuen Grube hatte Markscheider Strödel am
11. Oktober offiziell Mutung über einen tiefen Stolln „zur Lösung des
Armin Schachtes und des dasigen Brauneisensteinlagers“ eingelegt
(40014, Nr. 298, Blatt 27f). Nach Besichtigung durch
den Geschworenen erhielt er den Armin Stolln dann am 23. Oktober 1839
bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 341 und 40169,
Nr. 142, Blatt 6). Am
23. November hatte der Geschworene hierzu zu berichten, daß das Abteufen
des Arnimschachtes wegen Wasserzudrang und Wettermangel sistiert
werden mußte und man stattdessen nun zuerst den Arnimstolln
heranbringen wolle. Auch das Stollnort des Julius Stollns hatte man
nach dem Durchfahren des Lagers wieder sistiert und nun ein Flügelort
gegen Südost angehauen (40169,
Nr. 142, Rückseite Blatt 6f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch am 29. November 1839 legte Herr Strödel außerdem noch Mutung auf:
zugunsten von Wilkauer vereinigt Feld ein (40014, Nr. 298, Blatt 30). Auch diese Grubenfelder wurden ihm am 22. Januar 1840 bestätigt (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 341 und 40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 16). Stattdessen sagte er am 14. Dezember 1839 das gesamte Feld von Bernhardt Fdgr. und Maßen, sowie die 7. bis 22. untere Maß bei Julius Fdgr. wieder los (40169, Nr. 142, Blatt 15). Die Hoffnungen auf bauwürdige Anbrüche bestätigten sich dort wohl nicht. Am 22. April 1840 mutete Markscheider Strödel hierzu noch zwei gevierte Wehre und eine Überschar zwischen Großzeche und Kästners neue Hoffnung Fdgr. (40014, Nr. 298, Blatt 35). Diese wurden ihm vom Bergamt am gleichen Tage bestätigt (40014, Nr. 43, Blatt 342 und 40169, Nr. 142, Blatt 26). Außerdem erhielt er am 2. Juli 1840 noch eine Huthausstätte „290 Schritte hora 2,4 Ost vom Tageschacht der Ullricke Fdgr. an der Tännicht- Försteler Reinung oberhalb des von Langenberg nach Schwarzbach führenden Fahrweges“ (40014, Nr. 43, Rückseite Blatt 343 und 40169, Nr. 142, Blatt 29) bestätigt. Das dritte Teilfeld im Bereich der Arnim Fundgrube, der früheren Großzeche Fundgrube sowie der oberen Maßen von Kästners Hoffnung im Tännicht entwickelte sich damit zum Kern des Bergbaufeldes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Theodor Haupt befuhr die Grubenanlagen des
vereinigten Feldes wieder am 10. Januar des Jahres und erneut am
3. Februar 1840 (40014, Nr. 300, Film 0007 und 0020ff). Über den Fortgang
der Aufschlussarbeiten liest man im
Fahrbogen vom 3. Februar 1840:
„Der Arnim Stolln steht noch in stückligem Glimmerschiefer, der auf Schichtungs- und Querklüften häufig Quarzdrusen enthält. Die Belegung dieses Stollns ist 8 Mann stark, die ganze Länge desselben vom Mundloche beträgt 47 Lachter. In einer Woche werden durchschnittlich 6 Lachter aufgefahren und demgemäß wird in ca. 4 Wochen der Stolln mit dem Arnim Schacht durchschlägig werden. Ungefähr 33 Lachter vom Stollnmundloch in Ost hat man einen Schurf niedergebracht, indem mehrere Bergleute behaupten, früher an diesem Puncte Eisenstein gefunden zu haben, ihn nur wegen Waßerzudrang nicht haben abbauen können. Dieser Schurf ist 3 Lachter tief in Mulm niedergegangen, unter dem in dieser Tiefe allerdings Eisenstein liegt, der genauer untersucht werden soll, sobald zur Haltung der Grundwaßer eine Handpumpe... eingebaut wird... Zwischen Kästners Maaß und Großzeche gev. Fdgr. ziemlich im Mittel zwischen den beiden Fundschächten hatten die früheren Eigenlöhner von Kästners Maaß einen Schacht 8 Lachter saiger in schönem gelben 50° in NW hora 11 einschießendem Mulm mit Schnüren von Brauneisenstein niedergebracht. Um nun die beiden genannten, dem Wilkauer gemeinschaftlichen Felde zugeschlagenen Grubenfelder in Angriff zu nehmen, schien es am zweckmäßigsten, den obengedachten Schacht so tief als möglich niederzubringen und von da aus Strecken nach Kästners Maaß und Großzeche gev. Fdgr. zu treiben. Seit einigen Tagen ist nun dieser Schacht belegt worden und jetzt 10 Lachter tief. Wie es scheint, gereichen aber die in 10½ Lachter saigerer Teufe getriebenen Baue von Kästners Neue Hoffnung gev. Fdgr. über die Markscheide in das Feld von Kästners Maaß. Deshalb ist vor allem vondem jetzigen Tiefsten aus ein Ort nach der Markscheide in NO hora 2 und sodann eine Strecke entlang der Markscheide so schwunghaft als möglich zu treiben... Auf dem Julius Stolln, der noch mit 9 Mann belegt ist, hat der bei 13½ Lachter vom Mundloche vom Hauptstollnflügel in Ost abgehenden Seitenflügel nun einen Totalerlängung von 32 Lachtern erreicht. Davon stehen die ersten 6 Lachter in Mulm mit Spuren von Eisenstein, die folgenden 17 Lachter in altem Mann und die letzten 9 Lachter in Glimmerschiefer, der 30° bis 50° in Nord fällt. Um die Stärke des Glimmerschiefers einigermaßen beurtheilen zu können, hat man 1 Lachter zurück vom Ortstoß ein Überhauen angelegt und hiermit in 1½ Lachter Höhe über der Förste wieder Mulm angetroffen, hiernächst hat man endlich 7 Lachter noch weiter zurück ein neues Ort angehauen, das auf der Sohle in Glimmerschiefer, übrigens aber in Mulm steht, und gedenkt, dasselbe in NO hora 5,2 zu treiben. Allem Anschein nach wird man damit nur in Mulm bleiben...“ Insbesondere der möglichen Überbaue von Kästners neuer Hoffnung ins Nachbarfeld halber trug der Geschworene am 22. Februar aus seinem Fahrbogen auch im Bergamt Annaberg vor (40169, Nr. 142, Blatt 18f). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur gleichen Zeit kam es wieder einmal
zu Differenzen mit den Grundeigentümern ‒ in diesem Fall mit der
Superintendentur Grünstädtel. Zufolge einer Anzeige eines G. A. Schulze
aus Raschau vom 28. Januar 1840 an die Kircheninspektion nämlich hatte der
Grubenvorstand ungefragt Untersuchungen an einem alten Schacht von
Reppels Fundgrube vorgenommen, der nun aber dummerweise auf
verpachtetem Kirchenland lag (40169, Nr. 142, Blatt 21). Pächter der Flur,
auf der Reppels Fundgrube lag, war der Bäckermeister August
Friedrich Wilhelm Freitag. Nach der Lageangabe in oben zitiertem
Fahrbogen kann es sich dabei aber nicht um den dort genannten Schacht ,33
Lachter in Ost vom Mundloch des Arnim Stollns' gehandelt haben, da
Reppels Fundgrube auf Förstel'er Flur nahe der Reviergrenze, also viel
weiter westlich, gelegen hat.
Auf die Beschwerde der Superintendentur beim Bergamt vom 22. Februar 1840 hin (40169, Nr. 142, Blatt 20) wurde Steiger Gebler jedenfalls für den 18. April nach Annaberg einbestellt und nach Anhörung „ernstlich verwiesen,“ den betreffenden Schacht weiter in Schlag nehmen zu lassen (40169, Nr. 142, Blatt 25). Auch die Kircheninspektion hatte eingelenkt und teilte unter dem 7. Mai 1840 nach Annaberg mit, man habe den Pächter angewiesen, auf das weitere Einebnen der alten Halden zu verzichten (40169, Nr. 142, Blatt 28). In der Zwischenzeit hatte auch Schichtmeister Strödel am 3. Juli 1840 Mutung über das im Freien liegende Gebäude Reppels gevierte Fundgrube eingereicht und erhielt das Feld „bei dem 67 Ltr. nordöstlich von Riedels gev. Fdgr. niedergebrachten neuen Tageschacht“ am 15. Juli des Jahres „unter dem alten Namen Reppel gev. Fdgr.“ auch zugesprochen (40014, Nr. 298, Blatt 42, sowie 40014, Nr. 43, Blatt 344 und 40169, Nr. 142, Blatt 29). Wie in unserem Abschnitt zu
Reppels Fundgrube schon zu lesen stand, wiederholte sich die Sache nur
drei Jahre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch aus dem nächsten Fahrbogen
Theodor Haupt's vom 16. März 1840 zitieren wir hier gern und fast
vollständig (40014, Nr. 300, Film 0027ff): An genanntem Tage „habe ich die Gruben des Wilkauer gemeinschaftlichen Feldes sowie mehrere der Langenberger und Tännichtwalder Eigenlöhnergruben befahren und zwar 1.) Julius Stolln beym sogenannten Förstel. Dieser Stolln ist mit 8 Mann belegt und mittelst dieser Belegung wird a.) der bey 23½ Lachter östlicher Entfernung vom 1ten Seitenflügel angesetzte 2te Seitenflügel 13 Lachter in hora 5,2 Ost an der Grenze des Glimmerschiefers und Mulmgebirges getrieben und hiermit bey 11 Lachter Erlängung ein Braunsteinlager von durchschnittlich 5 Zoll Mächtigkeit angefahren. Dieses hat man 5 Lachter mittelst Steigortes verfolgt du gedenkt man hierauf einen Abbau anzulegen. b.) wurde vom Ortstoße des 2ten Seitenflügels ein 3ter in Nord hora 11,2 bereits 3½ Lachter in Mulm getrieben, um das Gebirge nach einer anderen Richtung zu untersuchen. Bey 3 Lachter Entfernung traf man hiermit auch bereits ein 5 Zoll mächtiges Eisensteinlager, das ebenfalls im Aufsteigen verfolgt worden ist, sich aber in kurzer Entfernung schon wieder verlor. Jedenfalls dürfte es rathsam erscheinen, sowohl den 2ten als den 3ten Seitenflügel weiter fortzutreiben. 2.) der Arnim Stolln im Tännichtwald ist mit 9 Mann belegt. Er ist am Freytag No. 9te Woche instehenden Quartals bey 68 Lachter Entfernung vom Mundloche mit dem Arnimschacht durchschlägig geworden und hat denselben in 9,8 Lachter saigerer Teufe gelößt. Auf die gedachte Länge steht der Stolln in Glimmerschiefer, der allmählig fester geworden ist. Bergamtlicher Direktorial Verfügung gemäß geht nun der Stollnbetrieb in hora 12 Süd fort, und zuvörderst die benachbarten Gruben Friedlicher Vertrag und Kästners Hoffnung gev. Fdgr., hierauf aber die dem Wilkauer gemeinschaftlichen Felde zugeschlagenen Gruben Kästners Maas und Großzeche gev. Fdgr. zu lößen. 3.) In nur gedachten Felde von Kästners Maaß ist bey 10 Lachter saigerer Teufe des neuen Tageschachtes der durchaus in Mulm steht, eine Strecke in Nord hora 2,2 schon 8 Lachter bis an die Markscheide von Kästners neue Hoffnung gev. Fdgr., sodann dieselbe auf der Markscheide selbst in Ost hora 5,5 getrieben worden... (Es) steht in kurzem der Durchschlag derselben in die Baue von Kästners Maas zu erwarten... Bey 4 Lachter vom tageschachte hat man nun auf dieser Strecke ein 20 Zoll mächtiges Eisensteinflötz angefahren, das zwar hier und da noch etwas hornsteinartig, aber jedenfalls immer sehr untersuchungswürdig ist. Ein zweites Eisensteinlager von beßrer Beschaffenheit überfuhr man unmittelbar an der Markscheide. Dieses ist auf 8 Lachter Länge 2 bis 2½ Ellen mächtig durchfahren worden, worauf es sich auf 5 bis 6 Zoll zusammendrückt... Nächst diesem Betrieb wurde in 8 Lachter Saigerteufe des mehrerwähnten neuen Schachtes ein Ort in Abend hora 5,2 getrieben und hiermit in die Baue von Großzeche gev. Fdgr. gekommen... auch durch diese Strecke hat man an mehreren Punkten untersuchungswürdige Eisensteinlager überfahren, obschon auf die letzte Hälfte der aufgefahrenen Länge die Strecke in alten Mann gegangen ist...“ Aus diesem Fahrbogen trug Herr Haupt am 28. März 1840 in Annaberg vor (40169, Nr. 142, Blatt 23).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 8. April 1840 war Herr Haupt
schon erneut zugegen und hat „die
angelieferten Materialien auf dem Wilkauer gemeinschaftlichen Felde
besichtigt und hierauf die Gruben befahren.“
(40014, Nr. 300, Film 0043f) In
diesem Fahrbericht ist auch nunmehrige die Gesamtbelegung
genannt: „Das Wilkauer gemeinschaftliche Feld ist jetzt mit 26 Mann
belegt, wovon 5 Mann auf dem Julius Stolln, 9 Mann auf dem Armin Stolln,
11 Mann in dem Felde von Kästners Maaß angelegt und 2 Mann mit Ausscheiden
des Eisensteins beschäftigt sind.“
Diese Belegung überstieg nun sogar deutlich die der seit alter Zeit durchgehend in Betrieb stehenden und immer mit durchschnittlich 15 Mann belegten Grube Vater Abraham bei Oberscheibe. Mit diesen Kräften gelang es im gemeinschaftlichen Feld verständlicherweise auch so schnell, die alten Gruben anzufahren und zu verbinden. Im gleichen Fahrbericht heißt es zum Stand der Arbeiten: „1.) auf dem Julius Stolln fahren 5 Mann an, welche das 2te Flügelort, das nun 16 Lachter... in Ost erlängt ist, im Mulm weitertreiben, um Eisenstein auszurichten. Der 3te Seitenflügel und das Steigort auf dem Braunsteintrum sind wieder eingestellt und bereits ausgesetzt worden... 2.) der Arnim Stolln im Tännichtwalde ist noch mit 9 Mann belegt und das Stollnort, das noch in Glimmerschiefer steht, nun 7 Lachter über den Arnimschacht hinaus getrieben worden. 3.) In dem Felde von Kästners Maas ist die 10 Lachter Strecke mit den alten Bauen... bei 25 Lachter Entfernung vom neuen Tageschacht durchschlägig geworden, worauf nun der Abbau des angefahrnen Eisensteins beginnen soll. Die 8 Lachter Strecke, die zur Lösung von Großzeche gev. Fdgr. hora 5,2 in West getrieben wird, ist... 22 Lachter erlängt und der Durchschlag in den Großzecher Tageschacht jede Stunde zu erwarten. Bei 19 Lachter Entfernung hat man mit dieser Strecke ein Quarzlager angefahren, das allmählig Brauneisenstein in sich aufnimmt, so daß endlich ein bauwürdiges Lager resultirt, das zwar viel Sorgfalt im Ausscheiden erfordert, aber ein desto bessere Gattung von Eisenstein liefert. Zugleich findet sich hiermit etwas Rotheisenstein.“ Das klingt doch alles sehr erfolgversprechend und so trug der Geschworene sicher sehr gern auch aus diesem Fahrbogen am 25. April 1840 wieder in Annaberg vor (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 26). Dennoch hatte man sich wohl in Cainsdorf mehr versprochen und so kam es schon jetzt zu Umsetzungen bei den anfahrenden Mannschaften. Herr Haupt notierte dazu nur wenige Tage später (am 15. April 1840): An diesem Tage „habe ich gemeinschaftlich mit dem Herrn Schichtmeister Richter die Gruben des Wilkauer Feldes befahren und den Betrieb nach der von Seiten der Eisencompagnie gewünschten Einschränkung für die Zeit bis zu Ablauf instehenden Gedinges regulirt. Demgemäß ist der Betrieb auf dem Julius Stolln sistirt und die 5 Mann von demselben in den Schacht von Kästners Maas verlegt worden, um gedachtes Schachtabteufen tiefer abzusinken.“ (40014, Nr. 300, Film 0047f) Doch nur einen Monat später reduzierte die Eisen- Compagnie die Belegschaft schon wieder, wobei aber der Julius Stolln wieder in Betrieb genommen worden ist. Es heißt dazu im Fahrbogen unter dem 14. Mai 1840 (40014, Nr. 300, Film 0056f): „Am 14ten Mai habe ich den Grubenbetrieb im Wilkauer gemeinsch. Felde revidirt, wo seit No. 5te Woche instehenden Quartals die Belegung um 12 Mann geschwächt worden ist, so daß überhaupt nur noch 14 Mann incl. Steiger anfahren. Von diesen liegen 2 Mann noch auf dem Julius Stolln, welche durch die Gewinnung von Braunstein den Betriebsaufwand decken müssen. Zu diesem Behufe hat man vom 2ten Seitenflügel aus an mehrern Puncten sowohl in Nord, als in Süd kleine Örtchen getrieben und mit einem derselben hübschen Braunstein ausgerichtet. Da sich derselbe aber an alten Mann wieder verloren hat, so sucht man durch andere Örtchen von gedachtem Seitenflügel aus neue Braunsteinanbrüche auf. Der Arnim Stolln ist mit 4 Mann belegt, welche das Stollnort in Mittag in Quergestein forttreiben. Dasselbe ist nun 15 Lachter vom Armin Schacht erlängt... Im Felde von Kästners Maaß hat man, nachdem mit den Schächten von Kästners Maaß und von Großzeche die Durchschläge bewirkt worden waren, auf der tiefen Strecke bey 13 Ltr. östlicher Entfernung vom neuen Tageschachte einen Abbau etablirt, wo seit No. 5te Woche 2 Mann förstenweise Eisenstein gewinnen. Die Anbrüche sind ziemlich mächtig, obschon der Eisenstein nicht sehr compact ist, und meist nur in kleinen Stücken bricht. Außerdem werden von der in 8 Mann bestehenden Belegung dieser Grube fortwährend 2 Mann auf Versuchsbauen und 4 Mann zur Förderung und Instandhaltung der Zimmerung verwendet. Von Versuchsbauen hat man zuvörderst in 6 Lachter Entfernung vom Tageschachte ½ Lachter in Mitternacht ein Steigort getrieben, hiermit aber in alten Mann geschlagen. Hierauf wurde vom östlichen Stoße des neuen Tageschachtes aus ein Ort in Süd getrieben, das jetzt 3 Lachter erlängt ist... worin vor Ort ein schwaches Trümchen von Brauneisenstein aufsetzt. Dieser Ortsbetrieb soll bis zum Erreichen der Glimmerschiefergrenze fortgesetzt werden. Außerdem hat man noch einen auf der Markscheide hereingehenden alten Schacht abrollen lassen, der großentheils mit hübschen Brauneisensteinstücken ausgefüllt war, und an dessen Stößen auch noch Brauneisenstein anstehen hat, der später abgebaut werden soll. Auf der oberen Strecke, welche bis zum Großzecher Tageschacht 24 Lachter lang ist, hat man nach erfolgtem Durchschlag bey 21 Lachter Entfernung vom neuen Tageschacht in West ein Versuchsörtchen getrieben, aber hiermit schon bey 1 Lachter länge alten Mann angetroffen. Bey 23 Lachter Entfernung vom... Schacht hat man hierauf ein 2tes Ort in Mittag getrieben und mit diesem bey 1 Lachter Länge in einen alten Bau von Großzeche gev. Fdgr. geschlagen, wo der Eisenstein 1¼ Elle mächtig und ziemlich compackt verlassen worden ist.“ Man liest hier wieder einmal, daß auch Wilkauer vereinigt Feld mit seinen Ausrichtungsbauen an vielen Stellen in alten Mann gekommen ist. Wegen der Schwächung der Belegschaft gab es hierzu am 28. Mai 1840 auch wieder einen Fahrbogenvortrag in Annaberg (40169, Nr. 142, Blatt 23). Außerdem findet man in der Grubenakte noch eine Registratur vom 18. April 1840, der zufolge die Eisen Compagnie angezeigt hatte, daß es „wegen dermaligen Mehrbedarfs zum Hüttenbau“ eine Kapitalerhöhung bei der Aktiengesellschaft gebe, weswegen man die Belegung bei Wilkauer vereinigt Feld von derzeit 26 auf nur noch 12 Mann reduzieren müsse (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 25).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was die wirtschaftliche Seite des
Unternehmens anbetrifft, so gibt uns Berggeschworener Haupt an
gleicher Stelle noch folgende Auskunft (40014,
Nr. 300, Film 0058f):
Nachweisung des Freyverbaus der Grube. „Seit No 5te Woche wurden im Felde von Kästners Maaß pro Woche 6 – 8 Fuder Eisenstein gewonnen, wovon auf den benachbarten Gruben 1 Fuder mit 2 Thl., 6 Gr. – Pf. verkauft würde. Rechnet man nun eine wöchentliche Production von durchschnittlich 7 Fuder, (...) so gewinnt man pro Woche für 15 Thl. 18 Gr. – Pf. Eisenstein. Der Aufwand der Grube beträgt nun pro Woche 8 Thl.
12 Gr. – Pf. an Berglöhnen Zieht man nun diese Summe von der Einnahmesumme ab, so bleiben 4 Thl. 15 Gr. – Pf. für Materialien, Bergamtsgebühren etc. pro Woche übrig, die aber kaum von diesen Gegenständen absorbirt werden dürften, so daß wohl ein kleiner Theil wenigstens schon als Verlag übrig bleibt. Der Aufwand, den daher jetzt das ganze gemeinschaftliche Wilkauer Feld der Comp. eigentlich noch macht, besteht nur noch in den Kosten für den Betrieb des Arnim Stollns.“ Na ja, 4 Thaler pro Woche oder 16 Thaler im Monat klingt nun für das groß aufgezogene, neue Unternehmen auch nicht gerade nach einer vortrefflichen Dividende... Aber es ging der Königin Marienhütte ja gar nicht um zusätzlichen Gewinn ‒ den machte man mit dem erzeugten Roheisen und Stahl und mit den daraus hergestellten Bahnschienen, Brücken und Maschinen ‒ sondern um die Absicherung der eigenen Rohstoffbasis.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung durch den
Geschworenen fand dann am 15. Juni 1840 statt
(40014, Nr. 300, Film 0066f).
Darüber berichtete er, daß man auf dem Julius Stolln in bisheriger Weise
etwas Braunstein gewinne und: „Durch die hier... gewonnenen Mineralien
ist das Kostenbedürfniß bis Schluß Crucis... gedeckt und dürfte der Betrieb
des Julius Stollns in der zeitherigen Weise fortgehen, um dieses
Grubenfeld mehr und mehr zu untersuchen.“
Der Arnim Stolln war nun schon 19 Lachter über den Arnim Schacht hinaus nach Süden getrieben und stand dort zur Gänze im Glimmerschiefer, ohne neue Erzlager anzutreffen. Im Feld von Kästners Maß war das Versuchsort aus dem östlichen Stoß des Tageschachtes nun 6 Lachter hora 10 – 11 Süd fortgestellt und stand zunächst ganz in Mulm, jetzt aber hatte man damit ein mächtiges Quarzlager mit einzelnen Nestern von Brauneisenstein angefahren. Auch mit einem zweiten Versuchsort traf man ein solches schon im ersten Lachter vom Schacht und beide Örter sollten nun noch bis an den vorliegenden Glimmerschiefer getrieben werden. Der auf Kästners Maß bei 13 Lachter östlicher Entfernung vom Schacht eingerichtete Abbau war dagegen an seiner Südseite bereits abgebaut und man begann nun, auch dessen nördlichen Flügel in Verhieb zu nehmen. Schon am 30. Juni war Herr Haupt erneut zugegen und berichtete (40014, Nr. 300, Film 0074ff): „Am 30. Juni habe ich auf Friedlich Vertrag Eisenstein vermessen und die Gruben des Wilkauer gemeinschaftlichen Grubenfeldes befahren, und von diesem letzteren zu berichten, daß der Julius Stolln von heute an einstweilen außer Betrieb gekommen ist, weil die Anbrüche von Eisenstein und Braunstein, welche zuletzt bei 16 Lachter Entfernung vom Hauptstollnflügel mittelst eines Steigörtchens erbrochen worden waren, sich wieder verloren hatten, und weil zugleich in dem Felde von Kästners Maas, als dem aussichtsvollsten Felde des Wilkauer Grubenfeldes, gegenwärtig 2 Mann beßer als auf dem Julius Stolln verwendet werden konnten. In letztgedachtem Grubenfelde gehen daher die beiden in hora 10 – 11 in Süd getriebenen Versuchsörter anstatt mit 1 Mann jetzt jedes mit 2 Mann. Das eine derselben vom östlichen Stoße des neuen Tageschachtes ausgehend, ist nun 7 Lachter erlängt und steht noch immer durchaus in Quarz, der mit einigen schwachen Mulmeinlagen durchzogen ist. Das 2te dieser Versuchsörter, das bei 18 Lachter nordöstlicher Entfernung von obgedachten Tageschachte angesetzte ist 3½ Lachter von der Grundsohle erlängt und steht jetzt durchaus in rothem Hornstein, der auf den Klüften mit Brauneisenstein beschlagen ist. Der 1 Lachter von dieser Strecke in Ost angelegte Förstenbau ist wie zeithero an dem Südflügel mit 2 Mann belegt, und hat bis jetzt 3 Lachter Höhe und 4 Lachter Länge. Die Anbrüche sind sich gleich geblieben. Eben so werden noch wie zeithero 1 – 2 Mann zu Gewinnung von Eisenstein in den von den Alten verlaßnen, vom alten oder oberen Tageschachte in Nordwest in 6 Lachter Teufe unter Tage liegenden Bauen verwendet, indem der Eisenstein bei genügender Mächtigkeit von sehr guter Qualität ist. Auf dem Armin Stolln ist seit meiner letzten Befahrung kein Betrieb gewesen, indem man seitdem mit dem Aufbau eines Huthauses beschäftigt ist und die Belegung von genanntem Stolln hierzu verwenden mußte. Dieses Huthaus ist am Sonnabend No. 12te Woche gehoben worden und wird in No. 4te Woche vollkommen hergestellt seyn. Der Aufbau dieses Gebäudes, wozu man bekanntlich das von der Wilkauer Compagnie erkaufte alte Huthaus auf dem Kuttenstolln an der Winterleithe (bei Elterlein) benutzt hat, ist zum größten Theile einem Zimmerermeister in Accord gegeben worden und nur die Abplanierung des Raumes, das Bedecken des Daches von den Bergleuten des Armin Stollns übertragen worden, demgemäß dieselben nächstens wieder auf ihre gewöhnliche Arbeit fahren werden.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung durch den
Geschworenen Haupt fand am 28. Juli 1840 statt. In seinem Fahrbogen
heißt es hierzu
(40014, Nr. 300, Film 0083f),
der Arnimstolln sei mit 4 Mann belegt. Das Stollnort ist nun 21½
Lachter über den Arnim Schacht hinaus erlängt und stehe nur etwa
noch 8 Lachter von der Markscheide der Grube Friedlicher Vertrag
zurück. Die Grube Kästners Maß war mit 10 Mann belegt, welche die
beiden Versuchsörter und den Eisensteinbau betrieben. Pro Woche wurden
hier 4 – 5 Fuder gefördert. Mit einem der Versuchsörter „hat man ein
Trum Eisenstein gefunden, das wenigstens untersuchungswerth erscheint und
daher mittelst eines kleinen Orts jetzt verfolgt wird.“
Am 7. August 1840 war Herr Haupt erneut auf dem vereinigten Felde zugegen (40014, Nr. 300, Film 0091), diesmal aber „um die umgehenden Örter nach dem Wunsche des Herrn Schichtmeister Richter ins Gedinge zu geben. 1 Lachter Vortrieb bei 0,3 Lachter Weite und ¾ Lachter Höhe wurde mit 12 Thl. verdungen. Mit dem Armin Stollnort ist man jedoch jetzt bei 20 Lachter südlicher Entfernung vom Armin Schacht an einen alten Schacht gekommen und deshalb muß dieses Ort vor der Hand noch in Schichtlohn fortgehen...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Quartal Crucis 1840 waren Theodor Haupt dann wohl andere Aufgaben
übertragen und während seiner Abwesenheit wurden die Aufgaben des Berggeschworenen in
Scheibenberg vertretungsweise durch den Schichtmeister Friedrich
Wilhelm Schubert aus Raschau wahrgenommen.
Herr Schubert befuhr das Wilkauer gemeinschaftliche Feld erstmals in seiner neuen Rolle am 25. August 1840 und berichtete darüber in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 300, Film 0096f), es seien jetzt 13 Mann hier angelegt. Das Armin Stollnort stand bei 22½ Lachter noch in dem alten Schacht. Die Versuchsörter in Kästners Maß hatte man eingestellt und wieder verstürzt, da man mit beiden den Glimmerschiefer bzw. den davor liegenden Quarz angefahren hatte. Stattdessen betrieb man nun ein Ort auf dem schon am 28. Juli angetroffenen Eisensteinlager. Die Anbrüche im Firstenbau nahmen mehr und mehr ab, indem sich roter Hornstein in dem Lager einfinde. Dann wurde noch ein Ort in 8 Lachter Teufe und 4½ Ltr. vom neuen oder 2ten Schacht in Kästners Maß in Ost 5 Lachter nach Süd getrieben, und gleich bei ½ Ltr. Länge hatte man dabei Eisenstein von verschiedener Mächtigkeit erbrochen. Ein drittes Ort war 13 Ltr. östlich des vorgenannten ebenfalls in Süd angehauen. Schließlich war noch zu bemerken, daß der Huthausbau vollendet und das Huthaus nun vom Steiger bewohnt werde. Am 8. September 1840 hielt Herr Schubert dann in seinem Fahrbogen fest, das der Armin Stolln 23 Lachter vom Armin Schacht aus erlängt sei und hier 3 Mann angelegt waren. In Kästners Maß ging kein Betrieb um, „da man die sämmtlichen Leute zum Ausschlagen von Eisenstein verwenden muß, um in der No. 12ten Woche die bestehenden Vorräthe ausmessen zu können.“ Sonst gab es nichts bemerkenswertes. Nur bemerkte Herr Schubert noch: „Die Baue stehen im Ganzen und sind daher äußerst geringköstig. Unter diesen Verhältnissen ist daher ein Eisensteinlager von 6 Zoll Mächtigkeit schon bauwürdig zu nennen.“ Glück gehabt. Vier oder fünf Fuder in der Woche sind nun vielleicht nicht der große Wurf, aber das immerhin zu vernünftigen Gewinnungskosten... Den ausgebrachten Eisenstein (leider ohne Information über die Menge) hat Herr Schubert dann auch am 15. September vermessen (40014, Nr. 300, Film 0111). Die Gesamtförderung im Jahr 1840 belief sich ausweislich der Erzlieferungsextrakte sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22 und 26) auf 163 Fuder oder rund 140 Tonnen. Am 12. September 1840 wurde außerdem durch das Bergamt der Verkaufspreis für das ausgebrachte Erz festgelegt. Demnach gab es eine erste und zweite Sorte Eisenstein; nur die erste war zur Abgabe an die Königin Marienhütte, die mindere Qualität dagegen zum freien Verkauf an die obergebirgischen Hammerwerke bestimmt. Die erste Sorte wurde zu 1 Thaler, 16 Groschen das Fuder, die zweite zu 1 Thaler, 1 Groschen das Fuder taxiert (40169, Nr. 142, Blatt 30).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Unterbrechung hat
Theodor Haupt die Gruben des Wilkauer vereinigten Feldes im
September 1840 wieder selbst befahren. Am 26. September trug er in
Annaberg dazu vor, daß man Gewinnungsversuche mit dem eisenschüssigen Mulm
aufgenommen habe. Mit dem Arminstollnort hatte man den Arnimschacht
inzwischen um 22½ Lachter Länge überfahren, dort einen alten Tageschacht
angefahren und diesen durchörtert (40169,
Nr. 142, Blatt 31f). Auch
das Huthaus war nunmehr fertiggestellt.
Dieses Huthaus hat der bekannte Fotograf Paul Schulz 1927 noch vorgefunden, wie die folgenden Aufnahmen zeigen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Huthaus der Grube "Wilkauer vereinigt Feld" im Schwarzbachtal - recht einsam an der Straße von Langenberg nach Schwarzbach gelegen. Foto: P. Schulz, 1927, Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Huthaus der Grube "Wilkauer vereinigt Feld", im Jahr 1927 von der Landstraße aus gesehen, auf einem weiteren Foto von P. Schulz, Bildquelle: Deutsche Fotothek. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 21. Oktober 1840 protokollierte man
im Bergamt Annaberg, daß der Arnimstollnflügel in Kürze die Markscheide
zur Friedlich Vertrag Fdgr. unterfahren werde. Dem Schichtmeister
Strödel von Wilkauer vereinigt Feld wurde deshalb durch das
Bergamt ein ,Patent' ausgestellt, demzufolge er dies den
Eigenlehnern der Nachbargruben Friedlich Vertrag und Kästners
Hoffnung anzuzeigen habe. Zugleich waren damit von nun an die Kosten
für den Vortrieb des Stollnflügels anteilig (mit dem 4. Pfennig, also zu
25%) durch die Besitzer der durch diesen gelösten Gruben zu tragen. Nach
dem Einkommen des Stollnflügels in dem jeweiligen Grubengebäude wurden
dann Wassereinfallgeld und ein Neuntel des Ausbringens für den Betreiber
des Wasserlösestollens fällig (40169,
Nr. 142, Blatt 33).
Schichtmeister Strödel informierte hierüber natürlich den
Eigenlehner der
Am selben Tage hielt man in Annaberg noch fest, daß sich Schichtmeister Strödel mit dem Grundbesitzer, Erdmann Friedrich Meyer, für die zum Haldensturz benötigten Flächen des Tännichtgutes auf einen Grundzins in Höhe von 12 Thalern jährlich geeinigt habe. Obwohl bis hierhin alles zufriedenstellend ablief, ersuchte dann doch schon unter dem 3. Februar 1841 die sächsische Eisencompagnie das Bergamt um Befreiung vom Zehnten auf sechs Jahre. Das Schreiben ist übrigens von Heinrich von Arnim auf Planitz als Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft persönlich unterzeichnet (40169, Nr. 142, Blatt 35). Nebenbei geht daraus hervor, daß es eine zweite Grube im Besitz der Compagnie unter demselben Namen bei Cranzahl gegeben hat. Dies wurde aber vom Bergamt am 13. Februar rundweg abgelehnt, weil darin kein Betriebspunkt angegeben sei, zu dessen Fortstellung das der Gesellschaft ersparte Geld verwendet werden solle. Außerdem befand man im Bergamt, daß „das Gesuch nicht im Mindesten motiviert“ sei und überhaupt müsse es vor Anfang und nicht innerhalb einer Finanzperiode gestellt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung hat
Theodor Haupt auf den Gruben des Wilkauer vereinigten Feldes am
18. März 1841 durchgeführt (40014, Nr. 300, Film 0153f). Insgesamt waren
noch 18 Mann hier angelegt, davon allein 7 Mann „auf dem Armin Stolln,
dessen Ort 7 Lachter vom letzten Markscheidepunkt hora 2,4 in Mulm und
Eisensteinlagern, worunter namentlich zwei von größerer und zwar ½ Ltr.
betragender Mächtigkeit sind, getrieben ist.“ Der Stolln hatte inzwischen eine Gesamtlänge von 146 Lachtern ab Mundloch
erreicht und er werde
weiter betrieben, „um neue Lager auszurichten.“
Das Feld von Kästners Maß war mit 10 Mann
belegt, welche Eisenstein in der 8 Lachter- Sohle vom neuen Tageschacht 5
Lachter in Abend abbauten. Dieser Abbau war inzwischen 5 Lachter lang und
4 Lachter hoch und von dort eine Förderrolle auf die 8 Ltr. Sohle geführt.
Das Lager war hier zwar nur 6 – 8 Zoll mächtig, aber die Gewinnung decke
nach Obersteiger Karl August Gebler's angestellten Versuchen die
Kosten. Ein Mann gewann hier in 6 Schichten pro Woche 1 Fuder Eisenstein,
das nach dem Ausschlagen einen Verkaufswert von 3 Thl. hatte,
was freilich deutlich mehr, als die erst kurz zuvor festgelegte
Bei seiner Befahrung vom 5. April 1841 fand Herr Haupt dann den Julius Stolln wieder belegt, wo aber zunächst aufgesäubert und der Ausbau erneuert wurde. Auch auf dem Armin Stolln hatte man den Ausbau nachgezogen. In Kästners Maß drohte der Förstenbau zusammenzubrechen, weswegen man auch dort zunächst ausbauen mußte (40014, Nr. 300, Film 0164f). Unter dem 10. Mai 1841 hielt Herr Haupt dann in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 300, Film 0172), das Hauptseitenflügelort des Julius Stollns sei wieder in Angriff genommen worden. Im Feld von Kästners Maß stand nur der Abbau in Umgang, außerdem werde der Arnim Stolln in vier Dritteln mit 11 Mann sehr schwunghaft betrieben. Dessen Ort stehe in Mulm und Eisenstein, 11¾ Lachter vom Schacht und nur noch 1 Lachter von der Feldgrenze zurück. Außerdem machte man sich offenbar auch weiter Gedanken um eine effizientere Aufbereitung, worüber Herr Haupt am 24. Mai 1841 in seinem Fahrbogen festhielt (40014, Nr. 300, Film 0181): „Die Siebversuche mit dem Haldenklein, das man beim Durchwerfen des Eisensteins durch den Durchwurf auf mehreren Gruben des Tännichtwaldes erhält, gehen nicht allein auf dem Wilkauer Felde fort, sondern sind auch auf Friedlich Vertrag unternommen worden und mit Vortheil ausgefallen. Auf dem Wilkauer Feld baut man jetzt zu diesem Behufe eine Rüttelmaschine, welche aus zwei untereinanderliegenden Sieben besteht, wovon das obere den früher angewendeten Durchwurf vertreten soll...“ Hierzu fand am 29. Mai 1841 auch wieder ein Fahrbogenvortrag in Annaberg statt (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 39f), dem darüber hinaus noch zu entnehmen ist, daß die Abgänge des Ausschlagens bisher nicht genutzt würden, nun aber „durch einen gröberen Setz- und Klaubeproceß“ die „klaren, milden und der Qualität nach besten Eisensteine“ gewonnen werden sollten. Die Versuche bei Wilkauer vereinigt Feld „scheinen ein günstiges Resultat zu erbringen“ und eine Nachahmung durch die Eigenlehner stehe zu erwarten. Beim Bergamt war man der Meinung, das habe man doch schon immer empfohlen und fand die Versuche sehr „lobenswerth.“ Herr Haupt solle weiter darüber berichten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächsten Befahrungen durch den
Geschworenen fanden dann am 3. und am 10. Juni 1841 statt
(40014, Nr. 300, Film 0184f und 0187f).
Über den Betrieb heißt es, auf dem Julius Stolln treibe man das
zweite Seitenflügelort weiter, welches nun 28 Lachter vom ersten aus
erlängt war. Das Ort stehe in Mulm ohne Eisenstein und auf der Sohle
milder Glimmerschiefer.
Der Arnim Stolln wurde inzwischen bei 156 Lachter Länge und dort bei 12,3 Lachter Saigerteufe in den neuen Tageschacht von Kästners Maßen eingebracht. Auf der Sohle würden nun Querschläge angesetzt, um die in den benachbarten Feldern bekannten Eisensteinlager im eigenen Felde auszurichten. Eisenstein wird in der 8 Lachter- und der 10 Lachter Sohle abgebaut, die Anbrüche sind aber „nicht bedeutend, nur kostentragend.“ Dann wird noch berichtet: „Die Siebmaschine ist nun hergestellt und sollen nächstens Versuche damit gemacht werden. Hierzu sind drei schwerlöhnige Arbeiter vonnöten, von denen einer aufgiebt, der 2te den sich absondernden klaren Eisenstein abhebt und etwas überklaubt und ein 3ter die Maschine mittelst einer Kurbel in Bewegung setzt. Die Separation wird durch zwei untereinanderliegende geneigte feinere und gröbere Siebe bewirkt, die hin und her gestoßen werden.“ Über den erfolgreichen Durchschlag des Stollnflügels auf den neuen Tageschacht berichtete Herr Haupt am 3. Juli 1841 auch wieder im Bergamt (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 41). Was sich schon angedeutet hatte, setzte sich nun aber fort: Am 3. Juli 1841 wurde in Annaberg auch protokolliert, daß Schichtmeister Strödel das gesamte Feld von Julius Fundgrube losgesagt hat (40169, Nr. 142, Blatt 41). Hier liest man auch, daß er auch die Bernhard Fdgr. mit allen Maßen losgesagt habe, aber das war doch eigentlich schon am 14. Dezember 1839 der Fall...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 13. Juli 1841 war Herr Haupt erneut vor Ort und berichtete (40014, Nr. 300, Film 0198ff), „dem Antrage der Eisencompagnie zu Kainsdorf zu Folge ist der Betrieb des Julius Stollns wieder eingestellt.“ Die dortige Kaue solle abgebaut und vor dem Mundloch des Arnim Stollns wiederaufgebaut werden, um Wetterschutz beim Ausschlagen zu bieten. Vom Tageschacht bei Kästners Maß aus hatte man mit dem einen Querschlagsort hora 10,4 NW. bei 6 und bei 10 Lachter Erlängung Eisensteinlager überfahren. Das hintere davon sei von „sehr guter Qualität und ansehnlicher Mächtigkeit.“ Bei 12 Lachter hatte man dann aber in einen „sehr preßhaften alten Bau“ eingeschlagen, so daß man das zweite Lager nicht direkt aus dem Querschlag heraus abbauen könne. Man nahm zuerst das schwächere Lager in Verhieb und fahre nach gewisser Erlängung von diesem aus einen zweiten Querschlag nach NW. Außerdem standen ein Abbau auf der Markscheide zwischen Kästners Maß und Kästners Hoffnung Fundgrube sowie der am neuen Tageschacht oberhalb der 8 Lachter- Sohle in Umgang. Wegen der Sistierung des Betriebes beim Julius Stolln infolge der Lossagung trug Herr Haupt auch aus diesem Fahrbogen in Annaberg vor (40169, Nr. 142, Blatt 42f). Der Niederschrift ist noch zu entnehmen, daß man anstelle der bisherigen Karrenförderung nun auf den Stollnflügeln des Arnimstollns ungarische Hunte einführen wolle. Noch einmal ist Herr Haupt am 2. August 1841 auf den Gruben von Wilkauer vereinigt Feld angefahren (40014, Nr. 300, Film 0209ff). Diesmal waren hier insgesamt 19 Mann angelegt. Davon lagen 2 auf dem Firstenbau, welcher an der Ostseite vom Arnim Stolln an der Markscheide zu Kästners Fdgr. etabliert war. Dieser Bau war inzwischen 4 Ltr. lang und 3 Lachter hoch und reichte bis auf die 10 Lachter- Sohle. Dort war das Lager bereits abgebaut, das hier durchschnittlich ¼ Ltr. mächtig gewesen ist. Wenn es auch östlich vom Stolln vollständig ausgehauen sei, werde man die Westseite angreifen. Weitere 2 Mann waren auf dem Abbau oberhalb der 8 Lachter- Sohle angelegt, wo der Eisenstein 6 bis 8 Zoll mächtig war. Dieser Abbau war inzwischen auch schon 4 Lachter hoch und gegen 5 Lachter lang geworden. Daneben wurde auch das mit dem Stollnquerschlag 6 Lachter nördlich vom Schacht überfahrene Lager durch 2 Mann abgebaut, der Abbau hier war erst 1½ Lachter lang. Das Lager zeigte sich hier 10 Zoll mächtig, verlor aber bald an Mächtigkeit und zieht sich unter die Stollnsohle nieder, so daß dieser Teil wohl bald abgebaut sein wird. Der Stollnseitenflügel hora 4 ist mit seiner Firste in die alte 12 Lachter- Strecke eingeschlagen. Zuvor hat man auch hiermit ein 8 Zoll starkes Eisensteinlager durchfahren. Auch vom neuen Kästners Maßener Tageschacht 5 Ltr. zurück stand Eisenstein in beiden Stollnulmen an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crucis 1841 wurde Herr Haupt
dann von höherer Stelle wieder zu anderen Aufgaben abgeordnet. In der
folgenden Zeit vertrat ihn als Geschworener des Bergamts Scheibenberg der
Annaberg'er Rezeßschreiber Lippmann
(40014, Nr. 300, Film 0230). Dieser war auch gleich am
1. September auf den Gruben von Wilkauer vereinigt Feld zugegen und
berichtete in seinem Fahrbogen ausführlich
(40014, Nr. 300, Film 0230ff):
„Die Belegung besteht in 19 Mann, als
durch welche... 1.) in der Arnim Stollnsohle 144,3 Lachter vom Mundloch oder 11,7 Lachter vom neuen Kästners Maaßner Tageschacht zurück durchörtert ein mit 2 Mann belegter Stollnflügel in Richtung hora 6 W. die Markscheide von Kästners neue Hoffnung Maaßen mit Kästners neue Hoffnung Fundgrube. Dieses Flügelort... ist bis jetzt 3½ Lachter erlängt. Bei 3 Lachter hat man eine Brauneisensteintrum... überfahren und es wird... behufs zu etablierenden Abbaus im Streichen weiter verfolgt werden. 2.) unmittelbar vom neuen Kästners Maaßner Tageschacht weg hat man querschlagsweise 5 Lachter lang hora 10,4 in NW. ausgelängt und bei dieser Erlängung ein circa 10 Zoll mächtiges Lagertrum... getroffen, das man jetzt in südwestlicher Richtung förstenweise abzubauen beginnt. Das mit ¾ Lachter Höhe und ½ Lachter Weite angelegte Steigort ist 4 Lachter lang und läßt zwischen Schacht und Abbau zur Sicherung des ersteren einen Pfeiler von circa 2 Lachter Stärke stehen. 3.) ein zweiter mit 2 Mann belegter Querschlag wird in 5 Lachter südwestlicher Entfernung vom vorgedachten in paralleler Richtung betrieben und ist jetzt 5½ Lachter ausgelängt, ohnlängst aber in alten preßhaften Bau des ehemaligen Großzechner Fundgrübner Feldes gelangt und muß daher seitdem mit doppelter Thürstockzimmerung fortgebracht werden. 4.) Unter der 8 Lachterstrecke vom neuen Kästners Maaßner Tageschacht 3 Lachter gegen SW. befindet sich ein 4ter und letzter ganghafter Bau. In diesem Förstenbau von ziemlich 7 Lachter Länge und 5 Lachtern Höhe... hat das Eisensteintrum eine Mächtigkeit von 8, 10 und 12 Zoll und bis zu 3½ Lachter Höhe, das gewöhnliche Fallen von 15 – 20 Grad richtet sich dann aber auf einmal unter circa 60 Grad auf und wandelt sich bei 1¾ Lachter weiterer Höhe nach und nach in Hornstein.“ Außerdem fand Herr Lippmann bemerkenswert: „Über die Gewinnung allhier ist im Allgemeinen zu bemerken, daß fast durchgängig die Keilhaue und nur, wo gewisse Parthien von Hornstein in Mulm vorkommen, auch Schlägel und Eisen dabei angewendet wird...“ Dabei werde durchschnittlich pro Mann in 6 Schichten 1 Fuder Eisenstein gewonnen. Die Strecken- und Schachtförderung erfolgte seit Anfang diesen Quartals mit ungarischen Hunten. Außerdem waren auch noch 4 Mann übertage mit dem Ausschlagen befaßt. Und schließlich fügte er noch hinzu: „Binnen kurzem beabsichtigt man, einen Versuch mit dem Waschen des beim Sieben durchgefallenen Haufwerks im Schlämmgraben anzustellen.“ Am 30. September 1841 war Herr Lippmann erneut vor Ort und hielt darüber im Fahrbogen fest (40014, Nr. 300, Film 0245ff), er sei abermals „und zwar mit Hrn. Factor Richter gefahren, wobei ich als Nachtrag zu meiner früheren Relation Folgendes zu berichten habe.“ Mit dem sub. 3.) aufgeführten Querschlag hatte man bei fernerem Forttrieb in altem Mann bei 10 Lachter Erlängung vom Hauptstollnflügel das Dachgebirge der Mulmablagerung, den Glimmerschiefer erreicht, der sich in sehr aufgelöstem Zustand befindet. Das sub. 2.) erwähnte Hauptstollnort ist in Richtung hora 4,4 SW fernerweit fortgestellt worden. Bei 1¾ Lachter weiterer Erlängung hat man damit den Brockenquarz angefahren, an dessen Grenze man in der Richtung hora 7,4 NW 3 Lachter hingegangen ist und sich dann mit dem Ort querschlagsweise in hora 11,0 NW herumgewendet hat; hiermit ist man aber bei 1 Lachter wieder in den alten Mann gekommen... Oh je ‒ viel haben die Vorgänger auch hier nicht stehen gelassen. Daher heißt es hier weiter: „Der üble Umstand, daß man sowohl mit dem 1ten, als 2ten und 3ten Querschlag in den alten Mann gekommen, der sich, wie die Erfahrung nun beim 2ten Querschlag gelehrt hat, bis an das Dachgebirge der Mulmablagerung zieht, sowie nächstdem das Vorgreifen des Quarzes, läßt vor der Hand keinen andern Ausweg, als mit dem Streichen durch den Quarz durchzubrechen, demgemäß auch unter Anhoffung der Genehmigung des Kgl. Bergamtes dem Obersteiger von mir in Übereinstimmung mit Hrn. Richter angewiesen worden ist.“ Außerdem war noch zu bemerken: „Der am heutigen Nachmittag in unserem Beysein begonnene Versuch mit Schlämmen des beim Sieben des Grubenkleins durchgefallenen klaren Haufwerks im Schlämmgraben, wodurch der Mulm von dem klaren Eisenstein getrennt und fortgejagt werden soll, gab den äußeren Ansehen nach keine recht günstigen Resultate, indem Quarz und Hornstein sich als der bedeutend überwiegende Theil des rein gewaschnen Haufwerks zeigten...“ Von diesen ,üblen Umständen' berichtete Herr Lippmann am 3. Oktober auch in Annaberg, wo man der Anweisung des Geschworenendienst- Versorgers auch die angehoffte Genehmigung erteilte (40169, Nr. 142, Blatt 49f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 27. September 1841 setzte das
Bergamt ein Schreiben an das Directorium der Eisencompagnie auf, daß man
bei einer ,Localexpedition' festgestellt habe, daß im Julius
Stolln die Zimmerung geraubt werde. Weil schon früher auf Herrn von
Querfurth's Grund Tagesbrüche eingetreten seien, habe man Steiger
Gebler befragt, der daraufhin angegeben habe, er habe eine Anweisung
von Factor Richter befolgt. Man wollte beide dieses Verhaltens
wegen eigentlich „ernsthaft verweisen,“ doch ging dieses Schreiben
nicht zur Post (40169, Nr. 142, Blatt 45f), da nur drei Tage später ein
Brief von E. J. Richter in Annaberg einging, in dem er erklärte
(40169, Nr. 142, Blatt 47f): „Schließlich habe ich das königliche
Bergamt gehorsamst um Vergebung zu bitten, daß wegen der Ausholzung des
Julius Stollns keine Meldung... erfolgte. Dieses Ausholzen erfolgte in
keinem anderen, als einem oeconomischen Interesse der Grube.“ Na,
dann...
Der andere Inhalt dieses Briefes ist aber für den Fortgang der Entwicklung bei Wilkauer vereinigt Feld von größerem Interesse: Herr Richter teilte nämlich mit, daß der bereits vermessene Eisenstein zunächst in Vorrat bleiben solle, da der Abgabepreis an die Cainsdorfer Hütte noch verhandelt werde und bei der nächsten Generalversammlung sollen „die pecuniären Verhältnisse näher erwogen werden.“ Ferner hatte der Bergverwalter bereits am 26. August 1841 angezeigt, daß in Ehrenfriedersdorf und Geyer der Obersteiger Wendler abgehe und man Steiger Gebler dort annehmen wolle. Nun bat er auch für die Neubesetzung der Steigerstelle bei Wilkauer vereinigt Feld um Aufschub. Interimistisch soll der Zimmerling Carl Gottlieb Graupner den Steigerdienst versorgen und Erdmann Weigel Hutmann sein. Was vor kaum zwei Jahren so erfolgreich begann, scheint hier bereits einem frühen Ende entgegenzugehen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da es bis dahin aber immer noch das größte
Bergbauunternehmen seiner Zeit im Revier gewesen ist, war auch Herr
Lippmann schon am 18. Oktober 1841 erneut vor Ort und berichtete
wieder ausführlich
(40014, Nr. 300, Film 0251ff), es
seien weiterhin 17 Mann hier angelegt, durch die...
1.) 1½ Lachter vom Hauptstolln in der Arnimstollnsohle vom zweiten Querschlag aus nach Westen ein Eisensteinlager ortweise abgebaut wiurde. Dieses war anfänglich nur 3 – 4 Zoll, jetzt vor dem Ort aber 1 Elle und darüber mächtig... Man erwartete leider aber, bei 4 Lachtern weiterer Erlängung wieder in alten Mann zu kommen. 2.) betrieb man den dritten Querschlag hora 10,4 NW. weiter durch alten Mann hindurch, „in welchem jedoch so häufig Parthien von sehr gutem Eisenstein vorkommen, daß die Betriebskosten hinlänglich gedeckt sind.“ 3.) wurde ein Firstenbau in der Nähe von Kästners Maaßner Tageschacht betrieben, der inzwischen 2 Lachter lang und 4 Lachter hoch ist. Bei dieser Höhe war das unter 20 Grad in NW. fallende Eisensteinlager aber auf 2 – 3 Zoll zusammengedrückt und ging in Hornstein über. 4.) befand sich auch der über der 8 Lachter Sohle ebendort gelegene Firstenbau gegen SW. im Schlage und ist nun 8 Lachter lang. Auch hier ging bei 3 Lachter Höhe im Steigort das Lager in Hornstein über. Das Streichort darunter stand in altem Mann, kam aber bei 1½ Lachter weiterer Erlängung aus diesem heraus und „läßt vor dem Ortstoß recht guten Eisenstein von circa 10 Zoll Mächtigkeit erblicken.“ Die Aufbereitungsversuche liefen noch: „Auch der Versuch mit dem Waschen des Kleins, wozu 10 Fuder bestimmt sind, geht in unvermindertem Maße mit 1 Mann fort.“ Dem Fahrbogenvortrag am 2. Oktober 1841 hierüber ist ferner noch zu entnehmen, daß Steigerdienstversorger Graupner nunmehr seinen Dienst auf der Grube angetreten hatte. Außerdem habe man „thiefer im Thale“ Schürfe angelegt, welche „die Fortsetzung des Lagers in die Teufe nachweisen.“ (40169, Nr. 142, Blatt 52) Ähnlich lautete auch der Bericht des Geschworenendienstversorgers in seinem folgenden Fahrbogen vom 12. November 1841, worin es heißt (40014, Nr. 300, Film 0264ff), das jetzt in Mitternacht Abend hora 6,4 betriebene Hauptstreichort in der Arnim Stollnsohle sei bis 10 Lachter Erlängung vom zweiten Querschlag aus fortgerückt und stehe in altem Mann, in dem jedoch noch soviel guter Eisenstein vorkomme, daß in der Schicht regelmäßig 1 bis 2 dreikübelige Hunte davon ausgebracht werden konnten. Bei 8 Lachter Erlängung ist man damit auf das hier 18 – 20 Zoll mächtige Eisensteinlager gekommen, welches die Fortsetzung desjenigen ist, das auf dem zweiten Querschlag bei 1½ Lachter Länge angefahren worden ist. Bei 6 Lachter nach NW. wird dieses Lager mittels Abteufens verfolgt. Mit diesem Abteufen hatte man 1½ Lachter Teufe unter der Stollnsohle erreicht und es fanden sich nun Wasser ein, die man aber mit einer Drückelpumpe noch leicht zu halten vermochte. „Einen ferneren Punkt zum Abbau bietet das mit dem ersten Querschlag bei 7½ Lachter Länge überfahrene und dort 0,2 Lachter mächtige Eisensteinlager.“ Herr Lippmann wies an, es durch Streichörter in beide Richtungen zu verfolgen und zu untersuchen. Am 10. Dezember 1841 erfolgte noch eine weitere Befahrung durch Herrn Lippmann. Diesmal hielt er in seinem Fahrbogen fest (40014, Nr. 300, Film 0273ff), es werde bei 7 Lachter südwestlicher Entfernung vom ersten Querschlag auf dem Hauptflügel des Arnim Stollns hora 12,0 Süd ein Querschlag betrieben, der bis jetzt 3 Lachter erlängt ist. Damit hatte man den Quarzbrockenfels durchbrochen und den Mulm wieder erreicht, auch ein kleines Eisensteintrum angefahren. Desweiteren wurde das Hauptstollnort betrieben und war nun vom ersten Querschlag aus 19 Lachter fortgestellt. Man ging nun in Richtung hora 5,0 immer noch in altem Mann mit häufig inneliegenden Eisenstein fort. Ferner war auch das Abteufen im Gange, wo das Lager ½ – ¾ Lachter Mächtigkeit besaß. Bis 1½ Lachter Teufe konnte man die Wasser niederhalten und ging deshalb nun in der Länge fort. Auch dabei ist man aber auf ein noch offenes Streichort der Alten gestoßen, welches im Hangenden des Eisensteins getrieben war und wo die Alten denselben noch ½ Lachter mächtig stehengelassen hatten. Man wird das Abteufen des großen Druckes wegen aber in Bolzenschrot oder ganzen Schrot setzen müssen. Dasselbe Lager wird 2 Lachter südwestlich vom zweiten Querschlag auch förstenweise abgebaut. Das Waschen dagegen hatte man sistiert, da „die Gehaltsproben nur auf 23 Procent gekommen sind.“ Das war auf jeden Fall nicht das erhoffte Resultat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch im Jahr 1841, und zwar am
30. Dezember, besuchten dann seitens der von Arnim'schen Berg- und
Hüttenverwaltung der Herr
Kammerherr von Arnim, der Herr Stadtrath Hänig aus Zwickau
sowie Herr Factor Richter das vereinigte Feld. Herr Lippmann
notierte über diesen Besuch
(40014, Nr. 300, Film 0273ff):
„Durch Verminderung der Betriebsgelder für den Bergbau sieht sich die erzgebirgische Eisencompagnie veranlaßt, unter anderen ihr angehörigen Gruben auch bei Wilkauer vereinigt Feld den Betrieb, namentlich den der Abbaue zu beschränken, weil der gewonnene Eisenstein vor der Hand noch nicht verwerthet werden kann, und deshalb auch in angemessener Weise die Mannschaftszahl zu reduciren. Nach beschehener Befahrung und Besprechung wurde für zweckmäßig erachtet und bestimmt: 1.) auf dem in meiner Relation vom 10. Dezember sub 3.) gedachten mächtigen Punkte des dasigen Eisensteinlagers, welches in letzterer Zeit auch sehr schönen braunen Glaskopf zu führen angefangen, soll dasselbe durch reguläres Abteufen, soweit es die Umstände erlauben, der Teufe nach untersucht werden. Hierzu werden incl. des Steigerdienstversorgers 9 Mann für nöthig erachtet... 2.) soll das bei 7 Lachter südwestlicher Erlängung vom ersten Querschlag in Mittag und nach dem Liegenden des Mulmlagers betriebene Querschlagsort auch ferner noch mit 2 Mann in 2 Dritteln fortgestellt werden, nur mit dem Unterschiede, daß der Betrieb desselben... ins Gedinge zu geben seyn wird. 3.) soll das in meiner Relation vom 10. Dezember sub 2.) erwähnte Hauptstreichort sowohl, als der dort sub 4.) erwähnte Abbau, den im Anfang erwähnten Gründen zufolge, eingestellt werden. 4.) Da nun statt der bisherigen Belegung von 17 Mann nach dem vorgeschickten nur eine Belegung von 11 Mann benöthigt ist, so sollen die entbehrlich gewordenen 6 Mann nach vorschriftsmäiger 4wöchentlicher Kündigung der Arbeit, abgedingt werden.“ Über seine beiden Befahrungen, insbesondere über den Inhalt der letzteren, informierte Herr Lippmann noch am selben Tage auch das Bergamt. Dort kam er „nicht umhin, sein Bedauern darüber auszusprechen, dem Bergamte von der Befahrung und Betriebsregulierung einige Kenntniß zukommen zu laßen...“ (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 53) Schon nach zwei Jahren zeigt sich in dieser Niederschrift also das Ende der ersten Euphorie. Noch war der Absatz von Eisen und Stahl, soweit er nicht durch die Königin Marienhütte selbst verarbeitet werden konnte, zu gering. Das änderte sich zwar in der Folgezeit sehr deutlich, insbesondere durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes. Dadurch wurden aber zugleich auch Importe billigeren und besseren Eisenerzes nach Sachsen erleichtert... Der Betrieb auf den zumeist kleinen und weit aufwendiger zu gewinnenden Lagerstätten im Erzgebirge und im Vogtland, auf denen die Eisencompagnie bis dahin die Abbaurechte erworben hatte, hatte daher in vielen Fällen keinen langen Bestand, jedenfalls nicht mit großem Betrieb.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner ersten Befahrung im Jahr
1842, die am 19. Januar stattfand, war aber noch alles beim alten und 17
Mann angelegt
(40014, Nr. 321, Film 0004f).
Herr Lippmann notierte weiter, durch die Belegschaft sei:
1.) das vom Hauptflügel des Arnim Stollns bei 7 Lachter südwestlicher Entfernung vom ersten Querschlag in Mittag betriebene Querschlagsort (...) 12½ Lachter zu Felde gebracht worden. Bei 9 Lachter hat man ein 1,5 Lachter mächtiges Lager „von sehr zerrüttetem Hornstein mit Quarz“ durchbrochen, dahinter wieder Mulm erlangt, dann aber bei 10,9 Lachtern Länge den liegenden Glimmerschiefer angefahren. „Nach den nunmehr gemachten Erfahrungen beträgt die Mächtigkeit des Mulmlagers in dieser Gegend daher circa 33 Lachter.“ Und: „Da der weitere Forttrieb dieses Querschlages nicht räthlich erscheint, so ordnete ich unter Anhoffung der Genehmigung des Kgl. Bergamtes die Sistierung dieses Betriebes an.“ 2.) das jetzt noch betriebene Hauptstreichort ist nunmehr 22 Lachter vom ersten Querschlag aus in Mittag Abend erlängt und steht immer noch in altem Mann. 3.) in 12 Lachter südwestlicher Entfernung vom ersten Querschlag ist zur Gewinnung von Räumlichkeit für das einzubauende Pumpzeug des nunmehro in Angriff zu nehmenden Abteufens, für dessen Hornstatt und Füllort... 6 Ellen mit Getriebe abgetrieben worden. Am 29. Januar trug Herr Lippmann im Bergamt wieder aus diesem Fahrbogen vor. Diesmal erteilte man die angehoffte Genehmigung zur Sistierung des Querschlags aber nicht. Vielmehr heißt es, man könne sich damit „umso weniger einverstanden erklären, als daßelbe wünscht, das Liegende des Mulmgebirges durch einen entscheidenden Versuch genauer untersucht zu sehen, (weil) ... schon in einer oberen Sohle die Existenz von Eisensteinlagern im frischen Glimmerschiefer nachgewiesen, dieser Versuch jedoch nicht weiter fortgestellt worden ist.“ In Annaberg wurde daher festgelegt, daß der Querschlag noch 10 Lachter fortzubringen sei. (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 57). Zum Zeitpunkt seiner nächsten Befahrung am 17. Februar 1842 (40014, Nr. 321, Film 0015f) war die Belegschaft dann schon auf 11 Mann reduziert. Da das Bergamt die Sistierung des Querschlags aufgehoben hat, hat Herr Lippmann im Fahrbogen notiert: „Der mir gewordenen bergamtlichen Anordnung zufolge habe ich in No. 5te Woche den Steigerversorger angewiesen, den mittägigen Querschlag wieder in Betrieb zu nehmen. Gegenwärtig befindet sich der Betrieb bei dieser Grube nur allein auf die Niederbringung eines neuen, von Herrn Schichtmeister Richter angegebenen und bei 12 Lachter südwestlicher Entfernung vom ersten Querschlage... mit 1,1 Lachter Länge und 0,5 Lachter Weite unter 25 Grad Fallen angesetzten Abteufens; es ist dieses... bis jetzt theils in altem Mann, theils in Mulm 3 Lachter niedergebracht worden. Zudringende Wasser haben sich dermalen noch nicht gezeigt und es hat sich daher auch der Einbau der Pumpe noch nicht nöthig gemacht.“ Hier fällt uns nebenbei noch auf,
daß Herr Lippmann nur noch von einem ,Steigerdienstversorger'
spricht. Wie wir in einer anderen Akte (zu
Reppels Fundgrube) bereits gelesen haben, ist der Obersteiger bei Wilkauer vereinigt Feld, Karl August Gebler,
nach Geyer versetzt worden (40169, Nr. 274, Rückseite Blatt 28ff und 40169, Nr. 142, Blatt 44 und 47ff). Auch
aus der
Am 5. März 1842 ging eine Beschwerde des Steigers Vulturius, Eigenlehner der Nachbargrube Friedlich Vertrag, in Annaberg ein, daß seinen tieferen Bauen übermäßig Wasser zulaufe, weil der Wasserabtrag auf dem Arnimstolln schadhaft sei (40169, Nr. 142, Blatt 62). Auch deshalb hatte man den Querschlag nicht gleich wieder belegt, denn wie Herr Lippmann bei seiner Befahrung am 9. März 1842 feststellte (40014, Nr. 321, Film 0017f), waren die 11 Mann „sämtlich bei der Niederbringung des Abteufens bei 12 Lachter südwestlicher Entfernung vom ersten Querschlag oder bei 17 Lachter Entfernung vom neuen Kästners Maaßner Tageschacht beschäftigt.“ Damit waren nun 4 Lachter Teufe erreicht und „In dieser Teufe zeigt sich nun recht guter Eisenstein und wie es scheint, von nicht unbedeutender Mächtigkeit.“ Na, das war doch was. Außerdem hatte man ab 3 Lachter Teufe aber auch hier Wasserzutritte, die noch mit der Drückelpumpe niederzuhalten möglich war. Über dem Gesenk wurde die „Haspel aufgerichtet und die Tonnung gehörig eingebaut. Auch mußten der Auflöslichkeit des Mulmlagers halber zur Abführung der gehobenen Wasser auf einer Strecke von 78 Lachtern Gerinne gelegt werden. Die durch das Überlaufen derselben hervorgerufene Beschwerde des Fundgrübners Vulturius aber ist dadurch beseitigt worden, daß man einestheils die Gerinne auf eine bedeutende Distanz gehoben hat, wodurch man ein gleichmäßigeres Fallen erzielte, anderntheils aber auch von Zeit zu Zeit Schlämmungen der ganzen Gerinntour zur Entfernung des sich darin in nicht unbedeutendem Maße absetzenden Schlammes vornimmt.“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 24. März 1842 schrieb dann der Besitzer des Tännichtgutes, Erdmann Friedrich Meyer, nach Annaberg, daß er aufgrund des Stollnbetriebes befürchte, daß seinem oberhalb liegenden Brunnen das Wasser entzogen werde und er deshalb um eine Befahrung durch das Bergamt bitte (40169, Nr. 142, Blatt 60). Schichtmeister Strödel wurde davon informiert und Geschworenendienst- Versorger Lippmann ausgesandt, die Sachlage zu überprüfen. Schon am 30. März 1842 folgte daher die nächste Befahrung (40014, Nr. 321, Film 0025f). Jetzt kam auch noch Tauwetter hinzu und deshalb wurde „wie dem Kgl. Bergamt aus mündlicher Relation auch schon bekannt ist, der Betrieb des bei 173 Lachter Entfernung vom Stollnmundloch unter der Arnim Stollnsohle niedergehenden Abteufens, der in der jetzigen nassen Jahreszeit mit den vorhandenen Hilfsmitteln nicht zu gewältigenden starken Wasserzudrangs halber, mit Schluß No. 11te Woche und nachdem man überhaupt bis zu 4,5 Lachter flacher Teufe damit niedergekommen war, eingestellt werden müssen. Es ist daher das bei 7 Lachter südwestlicher Entfernung vom ersten nordwestlichen Querschlag vor der Hand unbelegt gewesene südliche Querschlagsort, womit man bei 10,9 Lachter (...) den Glimmerschiefer angefahren hatte, (...) wieder in Belegung genommen worden. Nächstdem macht es sich nöthig, auf der Stollnsohle an vielen Punkten nicht allein einzelne Thürstöcke, sondern auch stellenweise ganze Getriebe, die durch den starken Druck zerdrückt worden sind, auszuwechseln, wozu der Steigerversorger... Anweisung erhielt.“ Hinsichtlich des befürchteten
Brunnenwasserentzuges berichtete Herr Lippmann am 2. April nach
Annaberg, daß fragliches Stollnflügelort nur 19 Lachter vom Brunnen
entfernt und in demselben Gestein stehe; die Befürchtungen des
Grundbesitzers also berechtigt seien. Das Flügelort war daher schon wieder
zu sistieren (40169,
Nr. 142, Blatt 63). Diesmal wurde diese Entscheidung des
Geschworenendienst- Versorgers vom Bergamt ,ratifizirt' und dies
auch Herrn Meyer so mitgeteilt (40169,
Nr. 142, Blatt 64). Nur zwei Jahre
Derweil hat wahrscheinlich auch die Generalversammlung des Vorstands der Eisencompagnie stattgefunden. Am 16. April 1842 nahm man in Annaberg die Anzeige von Bergverwalter Richter zu Protokoll, daß das Direktorium nur noch 600 Thaler Betriebsmittel für Wilkauer vereinigt Feld zur Verfügung stelle. Deshalb sei er gezwungen, die Belegschaft auf nur noch 3 Mann zu reduzieren. Er beabsichtigte, mit dieser Mannschaft neben der Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen im Arminstolln nur einen Stollnflügel nach Osten zu belegen und in geringem Umfang Eisenstein abzubauen (40169, Nr. 142, Blatt 68f). Am 23. April 1842 sagte Herr Richter außerdem die Reppels Fundgrube und nun auch den Julius Stolln wieder los (40169, Nr. 142, Blatt 70). Die Julius Fundgrube war ja schon losgesagt. Die Erneuerung des Ausbaus auf dem Stolln war bei der nächsten Befahrung durch Herrn Lippmann am 21. April 1842 (40014, Nr. 321, Film 0033f) auch im Gange, ging aber der nunmehr stark reduzierten Belegschaft halber natürlich nur schleppend voran. Andernteils war man auch „mit Abbau eines Eisensteinlagers, welches 9,6 Lachter nordwestlich vom neuen Kästners Maßner Tageschacht aufsetzt,“ befaßt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch am 19. Mai 1842 lief die Erneuerung des Stollnausbaus noch (40014, Nr. 321, Film 0040). Daneben stand der Firstenbau am neuen Kästners Maßner Tageschacht in Betrieb, wo man das Lager zunächst streichortweise verfolgte und bis dahin auf 3 Lachter Länge aufgeschlossen hatte. Erst im Juni 1842 war die Auswechslung des Ausbaus abgeschlossen und die Belegschaft nun „mit Ausschlagen und Durchwerfen des geförderten Eisensteins beschäftigt.“ (40014, Nr. 321, Film 0045) Das Lager am neuen Kästners Maßner Tageschacht war „in seiner Mächtigkeit ab- und zunehmend und zeigt jetzt nach der Sohle nieder ausgezeichnet schönen braunen Glaskopf.“ Auf der mit dem Streichort durchfahrenen Länge werde man sich deshalb demnächst überhauen. Vorher aber waren die zusitzenden Wasser so weit abgesunken, daß man sich Anfang Juli 1842 wieder auf das in der Stollnsohle niedergebrachte Gesenk einlegte, wo man das angetroffene, „1 Elle starke, zum Theil aus Glaskopf, zum Theil aus gewöhnlichem Brauneisenstein bestehende Lager“ nun örterweise hora 7- 8 zu verfolgte und das erste Ort schon 2 Lachter in schönem Eisenstein fortgebracht hatte (40014, Nr. 321, Film 0054). Am 26. Juli 1842 fand Herr Haupt nach seiner Rückkehr ins Bergamt Scheibenberg dann (40014, Nr. 321, Film 0060), daß „das früher erwähnte Ort 5½ Lachter Länge erreicht (hatte) und ist in alten Mann gekommen...“ Auch da waren die Alten schon... Zumindest hatte man aber „in der Förste und auf die ganze Länge von 3½ Lachter an der rechten Ulme sehr hübschen Eisenstein anstehen.“ Bei seiner nächsten Anwesenheit am 4. August 1842 war man erstmal wieder mit dem Ausschlagen des vorrätigen Eisenstein beschäftigt (40014, Nr. 321, Film 0064f). Wenn dies beendet ist, wolle man dem in der Firste des Stollnflügelorts anstehenden Eisenstein mit einem Fallort nachgehen. Als Geschworener Haupt am 6. September 1842 wieder zugegen war, mußte er allerdings konstatieren, daß sich die Anbrüche vor dem Ortstoß verloren haben und auch in dem Förstenbau darüber waren sie „nicht eben von Belang.“ Immerhin gelang es noch immer, binnen 5 Tagen im Durchschnitt 1 Fuder rein geschiedenen Stein auszubringen, was die Sebstkosten deckte (40014, Nr. 321, Film 0074). Die Situation blieb so auch erst einmal unverändert, nur hatte man bei der nächsten Befahrung durch den Geschworenen am 7. Oktober 1842 im Firstenbau wieder „hübsche Anbrüche“ von Eisenstein gefunden (40014, Nr. 321, Film 0088). Von seiner Befahrung am 3. November 1842 berichtete Herr Haupt erneut, man folge dem Lager noch mit dem „Überhauen,“ sei aber nach Osten nun in alten Mann gekommen, so daß man in die Gegenrichtung umschwenken müsse (40014, Nr. 321, Film 0096). Außerdem hat er an diesem Tage Eisenstein „für das Kainsdorfer Hammerwerk“ vermessen. Cainsdorf bei Zwickau ist ja richtig, aber ein solches ,Hammerwerk' hat Herr Haupt wohl noch nicht gesehen... Am 1. Dezember 1842 war er noch einmal auf der Grube. Dem Fahrbogen ist zu entnehmen, daß der Firstenbau nun „ziemlich ausgeerzt“ gewesen ist und man dem Lager nun im Streichen mit einem Feldort nach Westen folgen werde (40014, Nr. 321, Film 0109). Nicht zuletzt hatte Herr Richter
aus Cainsdorf schon am 11. Juni 1842 mitgeteilt, daß der bisherige, sehr
hohe
Auf das verflossene Jahr 1842 reichte Schichtmeister Strödel eine Anzeige über den Betrieb in Annaberg ein, die im wesentlichen die uns aus den Fahrbögen bereits bekannten Betriebsausführungen beschreibt. Der Umfang des Abbaus wird darin mit einem Firstenbau beim Kästners Maßen'er Tageschacht von 4 Lachter Länge und 3 Lachter Höhe angegeben, wobei man 81 Fuder Eisenstein ausgebracht hatte. Von der inzwischen ja konsolidierten Grube Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung hatte man außerdem 54 Fuder als Stollnneuntel erhalten. Die in Summe 135 Fuder Erz wurden zu 349 Thalern als Einnahmen verrechnet (40169, Nr. 142, Blatt 77f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 28. November hat Herr Richter
auch den Jahresetat für das Jahr 1843 nach Annaberg übersandt, demzufolge
man nur noch 30 Fuder Förderung erwartete. Das Stollnneuntel wurde mit 33
Fudern erwartet und überstieg damit erstmals das eigene Ausbringen. Die
veranschlagten Ausgaben in Höhe von rund 393 Thalern wurden durch die für
63 Fuder Erz zum Preis von 2 Thalern pro Fuder natürlich bei weitem nicht
gedeckt. Den Rest mußte die Eisencompagnie zuschießen (40169,
Nr. 142, Blatt 73ff).
Am 20. Januar des folgenden Jahres 1843 fand Herr Haupt folglich nur noch 2 Mann auf der Grube angelegt (40014, Nr. 321, Film 0132). Außerdem notierte er in seinem Fahrbericht, der Firstenbau über dem Arnim Stolln sei nun völlig ausgehauen und man habe danach „mehrere kleine Eisensteinmittel“ in der Nähe des Stollngesenkes zwischen dem Kästners Maßner Tageschacht und dem Hauptstollnort abgebaut. Nun solle ein 1,5 Lachter hinter dem Ortstoß anstehendes Erzmittel von 1 Elle Mächtigkeit, aus Hornstein mit Eisenstein bestehend, in Angriff genommen werden. Dasselbe geschah auch bei seiner nächsten Befahrung am 8. Februar 1843 (40014, Nr. 321, Film 0140). Ferner fand Herr Haupt die Schachtzimmerung im Kästners Maßner Tageschacht erneuerungsbedürftig. Da man die geschwundene Belegschaft nun schlecht noch weiter teilen konnte, haben die zwei Mann im Monat Februar erst einmal die Zimmerung ausgebessert (40014, Nr. 321, Film 0145). Außerdem waren schon zum zweiten Mal Tagesbrüche im Verlauf des längst aufgegebenen Julius Stollns niedergegangen, die man bis 13. März 1843 aufgefüllt hatte (40014, Nr. 321, Film 0153f). Natürlich zog sich all das in Anbetracht der nur noch minimalen Belegschaft hin... Danach wurde Herr Haupt erneut abgeordnet und Herr Lippmann mußte ihn wieder vertreten. Hatte man die Auszimmerung von Kästners Maßner Tageschacht beendet, so folgte gleich die nächste unaufschiebbare Baustelle: Am 1. Mai 1843 fand Herr Lippmann die Mannschaft „in der Nähe des neuen Friedlich Vertrager Tageschachtes mit der Auswechslung der durch den Frühjahrsdruck ganz unhaltbar gewordenen Zimmerung auf dem Arnimstolln“ befaßt (40014, Nr. 321, Film 0171f). Damit war man noch bis Mitte Juni beschäftigt. Natürlich kam dabei kein Ausbringen an verkaufsfähigem Erz zustande... Bei seiner Befahrung am 18. Juli 1843 war man noch immer mit dem Nachziehen des Tragwerkes auf dem Stolln befaßt (40014, Nr. 321, Film 0192). Herr Lippmann polterte daraufhin in seinem Fahrbericht: „Mit mir das Unzweckmäßige der nassen Arbeit bei den jetzigen Verhältnissen der Grube anerkennend, wird es das Kgl. Bergamt gewiß billigen, daß ich im Interesse der Eigenlöhnerschaft dem Steigerversorger allen Ernstes den unverzüglichen Wiederangriff und Belegung des Arnim Stollnortes anbefohlen habe.“ Na ja, kann man so sehen. Später wurde dieser Stollnbetrieb von Herrn Haupt als ,Versuchsbau' bezeichnet. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Selbstverständlich folgte man der nachdrücklichen Aufforderung des Geschworenen und am 18. August fand Herr Lippmann das hora 5,3 SW. führende Arnim Stollnort wieder belegt und auf der Grenze zwischen Mulm im Hangenden und Glimmerschiefer im Liegenden vom neuen Kästners Maßner Tageschacht aus nunmehr 26,5 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 321, Film 0199). Auch gab es wieder einen Personalwechsel auf der Grube (40014, Nr. 321, Film 0207): „Am 15. September 1843 (ließ) ich bergamtlicher Anordnung zufolge das Inventarium bei Wilkauer vereinigt Feld (?) von dem neuangestellten Steiger Krauß übernehmen.“ Wie wir schon wissen, wurde Herr Graupner ja entlassen und Karl August Krauß ‒ zuvor auf der Grube Churprinz Seegen Gottes zu Elterlein angestellt ‒ wurde nun am 2. September 1843 offiziell als neuer Steiger bestätigt (40169, Nr. 142, Blatt 79). Ein bekannter Familienname... Der Betrieb des Stollnortes schritt aber fort und bei der Befahrung am 21. September 1843 fand Herr Lippmann das Hauptstollnort vom Kästners Maaßner neuen Tageschachte aus „nunmehr 29,2 Lachter fortgebracht. Das Mulmlager hat sich verloren und man muß sich zu dessen Wiedererlangung aus dem bisherigen Streichen hora 5,3 SW in ein niedrigeres wenden.“ (40014, Nr. 321, Film 0209) Am 18. Oktober hatte Herr Lippmann dann sogar noch einmal etwas Eisenstein „an die Königin Marienhütte“ zu vermessen (40014, Nr. 321, Film 0213). Hatte sich herumgesprochen, daß dies kein ,Hammerwerk' war. Am nächsten Tag hat er die Grube auch befahren und „besteht die Belegung aus 1 Steiger und 1 Doppelhäuer, welche behufs der Untersuchung des ehemaligen Großzechner Feldes das dermalen in der Richtung hora 2,4 SW stehende Hauptstollnort des Arnim Stollns forttreiben... 30 Lachter von Kästners Maaßen neuen Tageschacht. Und steht dasselbe noch theils in sehr aufgelöstem eisenschüssigem Glimmerschiefer, theils in gelblichrothem Letten, in welchem letzteren sich mitunter schon kleine Schmitzen von röthlichem Mulm einstellen, so daß die Erbrechung des Hangenden von dem Hauptmulmlager demnächst zu erwarten steht.“ (40014, Nr. 321, Film 0215) Am 16. November ist noch einmal Herr Lippmann angefahren und fand das Stollnort nun hora 10,6 SO umgeschwenkt (40014, Nr. 321, Film 0220). Ende Luciae 1843 kehrte Herr Haupt dann wieder in das Bergamt Scheibenberg zurück und befand bei seiner nächsten Befahrung, man treibe das inzwischen 35 Lachter erlängte und „in hora 9,4 – 10 SO gehende Hauptstollnort als Versuchsbau weiter.“ (40014, Nr. 321, Film 0229) Der Anzeige des Schichtmeisters für das Jahr 1843 zufolge hatte man bei diesen Ausführungen aus dem 2 Lachter langen und 0,6 Lachter hohen Firstenbau alles in allem 22 Fuder Eisenerz ausgebracht. Hinzu kamen 26 Fuder Neuntel, so daß man Einnahmen in Höhe von 97 Thalern, 22 Groschen verbuchen konnte. Das war noch weniger, als Anfang des Jahres erwartet (40169, Nr. 142, Blatt 87f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 14. Dezember 1843 hat Faktor Richter wieder einen Jahresetat für das neue Jahr 1844 nach Annaberg übersandt (40169, Nr. 142, Blatt 80ff). Diesmal plante er nur noch ganze 10 Fuder eigenes Ausbringen und 25 Fuder Stollnneuntel ein, was bei dem Verrechnungspreis von 2 Thalern pro Fuder gerade einmal 70 Thaler Einnahmen bedeutete und die veranschlagten Betriebsausgaben in Höhe von 346 Thalern natürlich keineswegs decken konnte. Anscheinend war damit aber nur die erste Qualität gemeint, während man von der zweiten noch 125 Fuder in Vorrat hatte. Die solle Schichtmeister Strödel nun anderweitig verwerten. Im Bergamt protokollierte man dazu aber am 16. Dezember, daß letzterer erklärt habe, das ihm dies schon bisher nicht gelungen sei. Deshalb informierte die Bergbehörde die Eisencompagnie, daß auch weiterhin bare Zuschüsse erforderlich seien (40169, Nr. 142, Blatt 85). Am 26. Januar 1844 hat Herr Haupt „mit dem Factor Richter und dem Steiger Krauß von Wilkauer vereinigt Feld eine Berathung über die gedachte Grube gehalten“ und die Grube am 29. Januar wieder befahren (40014, Nr. 322, Film 0002 und 0003f). Über letztere liest man in seinem Fahrbogen, man habe in der letzten Zeit in 6 Lachter Entfernung vom Kästners Maaßner Tageschacht „auf einem früher mit dem Arnim Stolln angefahrenen Eisensteinlager ein Ort hora 8,3 in SO. 3 Lachter weit getrieben und etwas darauf überhauen. Dort schlug man aber sehr bald in alte Baue und vor dem Ort verlor sich der Stein.“ Man begann nun wieder, das östliche Gebirge zu untersuchen und hatte dazu ein Ort auf der Armin Stollnsohle 30 Lachter nordwestlich vom Armin Schacht angehauen, das längs der Markscheide zu Friedlich Vertrag gehen soll. Hierüber trug Herr Haupt am 2. März auch in Annaberg vor (40169, Nr. 142, Blatt 88f). Am 6. Februar 1844 ist Herr Haupt wieder hier angefahren und fand das letztgenannte Versuchsort ½ Lachter fortgebracht und es „steht in ganz aufgelöstem Glimmerschiefer.“ (40014, Nr. 322, Film 0009) Der geringen Belegung halber ging es natürlich nicht mehr so schnell voran. Am 29. Februar hat Herr Haupt erneut und mit Faktor Richter den Arnim Stolln befahren, fand dabei das Ort auf 2,2 Lachter ausgelängt und sonst nichts neues vor (40014, Nr. 322, Film 0019). Auch bei seiner Befahrung am 19. April (40014, Nr. 322, Film 0029f) war dieses Ort mit dem Steiger und einem Lehrhäuer belegt und nun 7,2 Lachter erlängt. „Bei 3,2 Lachter Länge hat man einen alten Tageschacht und alten Pressbau, der mit Mulm und Glimmerschiefer versetzt ist, in der Sohle überfahren,“ heißt es wieder einmal. Unangenehmer war jetzt eine andere Feststellung, die auf das wenig standfeste Gebirge zurückzuführen war: „Auf dem Stolln, wo die Ulmen nicht verpfählt sind, schossen die Stöße aus, so daß er an zwei Punkten schon bis auf die Hälfte seiner Höhe zugeschoben war.“ Das mußte natürlich aufgesäubert und ordentlich verwahrt werden. Die Unterhaltung des Armin Stollns war ja nicht nur für die eigene Grube wichtig; schließlich löste er über das Flügelort zu Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung ja auch diese Grube. Die beim Aufsäubern des Stollns anfallenden Berge könne man aber gleich verwenden, um die „auf des Schankwirthschaftsbesitzers Goldhahn zu Förstel Feldern die von dem Julius Stolln heraus entstandenen Tagebrüche einzuebnen.“ (40014, Nr. 322, Film 0050) Upps. Dort war die Ruhe in das durchörterte Gebirge noch längst nicht wieder eingekehrt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits am 29. März 1844 hatte sich auch Herr Meyer vom Tännichtgut erneut beim Bergamt in Scheibenberg gemeldet und seine Besorgnis über den steigenden Wasserabtrag auf dem Arnimstolln und dem schon zwei Jahre zuvor in Rede stehenden Brunnen ausgedrückt. Er forderte eine Garantie von der Eisencompagnie für die Sicherheit der Wasserversorgung für sein Gut (40169, Nr. 142, Blatt 90). Nun wurde Ende April 1844 Herr Haupt,
wie schon mehrfach erwähnt, erneut zu anderen Aufgaben abgezogen und
diesmal vertrat ihn in seiner Funktion als Berggeschworener in
Scheibenberg der Markscheider Friedrich Eduard Neubert. Derselbe berichtete am 18. Mai 1844 nach Annaberg,
er habe am 18. April Herrn Meyer aufgesucht und ihm ,notificiret',
daß er keine Garantie bekommen könne; doch so, wie der Betrieb zur Zeit
ablaufe, seine Befürchtungen unbegründet seien. Das stand allerdings im
Widerspruch zu den Feststellungen von Herrn Lippmann
Am 10. Juni 1844 fuhr Herr Neubert auch auf der Grube an und berichtete danach recht ausführlich in seinem Fahrbogen (40014, Nr. 322, Film 0044f): „Wilkauer v. F. ist zeither fast immer mit 2 Mann in Betrieb gehalten worden, welche hauptsächlich mit Auswechslung der an mehreren Punkten wandelbar gewordenen Zimmerung auf dem Stolln beschäftigt gewesen sind, so daß das Versuchsort nur dann und wann in Belegung gekommen ist. Dasselbe hat nunmehr eine Erlängung von 8 Lachtern erreicht und steht (...) in altem Preßbau. In dem Mulm, womit dieser alte Bau versetzt ist, findet sich sehr hübscher Eisenstein an.“ Ansonsten war noch zu bemerken, daß der Kästners Maßner Tageschacht neu auszuzimmern ist. Wenn der Mulm, in dem der Schacht niedergebracht ist, bei nasser Witterung durchweicht wird, stehe sonst zu befürchten, daß der Schacht zusammengeht. „Die baldige Ausführung dieser Arbeit habe ich dem Steiger dringend anempfohlen.“ Der arme Kerl wußte wahrscheinlich schon nicht mehr, was er zuerst liegenlassen sollte... Bei seiner nächsten Befahrung am 22. Juli fand Herr Neubert Steiger Krauß ganz allein auf der Grube vor (40014, Nr. 322, Film 0054f). Es konnte gar nicht anders sein: „Der einzige betriebene Bau ist das Versuchsort, welches nun 10 Lachter ausgelängt ist und ganz in altem Mann steht, worin sich aber ziemlich viel Eisenstein findet.“ Nicht viel Neues gab es auch nach der nächsten Grubenbefahrung vom 5. September 1844 zu berichten (40014, Nr. 322, Film 0062f): Das Versuchsort war nun 12 Lachter erlängt. Im letzten Lachter ist es in eisensteinführendem Mulm gekommen, aber nun stand man schon wieder vor einem ausgestürzten, alten Schacht. Auch von der Befahrung am 7. November 1844 war „blos zu referiren, daß das Arnim Stollnflügelort (...) bis zu 14 Ltr. erlängt war und in Eisenstein führendem Mulm anstand.“ (40014, Nr. 322, Film 0073f) Zuletzt in diesem Jahr war Herr Neubert noch einmal im November zugegen, diesmal aber nur, um übertage nach dem Rechten zu sehen: „Am 15. November 1844 begab ich mich (...) nach dem im Freien liegenden Julius Stolln, wo vor kurzem zwei nicht unbedeutende Tagebrüche entstanden waren, die auf meine Veranlassung von Seiten der Grube Wilkauer v. F. zugefüllt wurden.“ (40014, Nr. 322, Film 0073f) Zum Jahr 1844 ist noch zu vermerken, daß am 3. August Carl August Krauß als Steiger und am 24. August 1844 Carl Heinrich Viertel als Hutmann vom Bergamt in ihrer Funktion bestätigt und verpflichtet worden sind (40169, Nr. 142, Blatt 96). Die Anzeige des Schichtmeisters sagt uns nichts neues zu den Betriebsabläufen. Der Abbau umfaßte nur eine kleine Lagerfläche von 0,6 Lachter Länge und 0,5 Lachter Höhe, wobei man „einige Fuder“ Erz gewonnen habe. Außerdem erhielt man 18 Fuder Neuntel von der Nachbargrube (40169, Nr. 142, Blatt 102).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem am 20. Dezember 1844 von Faktor Richter übersandten Jahresetat für das folgende Jahr ist zu entnehmen, daß es immer noch „in übergenügendem Maße“ Eisensteinvorrat in Cainsdorf gäbe. Wie im Vorjahr plante er 70 Thaler Einnahmen bei nun 337 Thaler Betriebskosten. Die Differenz schoß die Eisencompagnie „verlagsweise“ zu (40169, Nr. 142, Blatt 97ff). Von seiner nächsten Befahrung der Grube am 15. Januar 1845 berichtete Herr Neubert, daß „die zuletzt nur noch aus dem Steiger bestehende Belegung durch 1 Mann verstärkt worden ist.“ Mit diesen beiden war das Arminstollnflügelort hora 6,0 in Ost an der Markscheide zu Friedlich Vertrag belegt und dieses jetzt 15,5 Ltr. vom Hauptstolln aus erlängt. Man stand dort in altem Mann, der aus sehr lettigem aufgelösten Glimmerschiefer bestand und „den man für ganzes Gestein halten möchte, wenn in demselben nicht altes Holz vorhanden wäre.“ Das Hauptstollnort hinter dem Kästners Maßner Tageschacht war auf 6 Ltr. Länge verbrochen, weil der Steiger dort selbst die Zimmerung herausgenommen hatte ‒ vielleicht war gerade kein anderes Holz für den Streckenvortrieb zu bekommen (40014, Nr. 322, Film 0090f). Die ständig notwendige Erneuerung der Zimmerung auf dem Arminstolln hielt auch im März die kleine Belegschaft von anderen Arbeiten ab und so wurde bis dahin dessen Flügelort auch nur um 0,8 Lachter fortgestellt (40014, Nr. 322, Film 0097f). Auch von der Befahrung am 2. Mai 1845 war zu berichten, daß die anfahrenden zwei Mann seit der letzten Befahrung nur Reparaturen der Zimmerung auf dem Arminstolln ausgeführt haben und: „Es wäre übrigens sehr zu wünschen, daß die dasige Belegung noch um 1 oder 2 Mann verstärkt würde, indem 2 Arbeiter kaum hinreichen dürften, die Auswechslung der defecten Puncte so schnell auszuführen, als sich als nothwendig herausstellt.“ (40014, Nr. 322, Film 0111) Außerdem fielen ja immer noch andere Arbeiten an: „Nach der Befahrung habe ich noch dem Bergarbeiter Viertel die Zufüllung dreier alter im Tännichtwalde in neuverliehenen Felde liegender Schächte, deren Verbühnungen kurz vorher hineingebrochen waren, für 2 Thl. 8 Ngr. verdungen.“ Dann findet man in der Grubenakte eine neue Bestätigung vom 23. April 1845 über die 4. und 5. obere gevierte Maß sowie zwei gevierte Wehre und eine Überschar nach der Arnim Fundgrube (40169, Nr. 142, Blatt 104). Man erhielt die Grube zwar nur notdürftig bauhaft, doch neues Feld sicherte sich der Grubenvorstand noch... Das ist eigentlich jetzt schon kaum zu erklären. Noch im gleichen Monat hat Herr Neubert übrigens noch weitere „3 auf einem der sogenannten Brünlasgüter entstandene Tagebrüche besichtigt, und die Zufüllung derselben dem Steiger Kraus von Wilkauer vereinigt Feld für 1 Thl. 15 Ngr. verdungen.“ (40014, Nr. 322, Film 0116) Und noch einmal war er am 27. Mai zugegen und hat „auf Meiers Hoffnung, Friedlich Vertrag und Wilkauer vereinigt Feld Eisenstein und Braunsteinstufen behufs deren Einsendung zur Industrieausstellung in Dresden ausgeschlagen.“ (40014, Nr. 322, Film 0118) Im Juli 1845 war die Reparatur der Zimmerung noch immer nicht abgeschlossen. Stattdessen war nun der alte Kästners Hoffnung Maßener Tageschacht „theilweise zubruche gegangen und entbehrlich geworden und wurde vollends zugefüllt.“ (40014, Nr. 322, Film 0126) Auch bei der Befahrung am 5. September nahm die Auswechslung der Zimmerung die ja nur aus 2 Mann bestehende Belegung noch in Anspruch. Man war aber soweit fortgeschritten, daß demnächst die Gewältigung eines 24 Ltr. westlich von Kästners Maßnen'er Schacht entstandenen Bruches beginnen könne... (40014, Nr. 322, Film 0136f) Das wird jetzt wie mit einem alten Haus: Ist man vorn fertig mit renovieren, kann man hinten wieder anfangen. Am 12. September 1845 war Herr Neubert wieder zugegen, diesmal aber, um „dem Bergarbeiter Traugott Friedrich Seifert zu Raschau die Lage der von demselben gemutheten, früher dem Wilkauer vereinigt Feld verliehen gewesenen 5ten und 6ten unteren Maß nach Arnim Fdgr. anzugeben, worauf derselbe erklärte, hier keine Versuchsarbeiten zu unternehmen und die Muthung entfallen zu lassen, da zu Ausrichtung von Eisenstein- und Braunsteinanbrüchen in diesem Felde wenig Hoffnung vorhanden ist.“ (40014, Nr. 322, Film 0139) Ob dies das oben erwähnte neuverliehene und vielleicht schon wieder fallengelassene Feld gewesen ist ? Man weiß es nicht mehr so genau. Eine weitere Befahrung fand am 13. November 1845 statt, über die im Fahrbogen zu lesen ist, daß die beiden Arbeiter gerade den bei 30 Ltr. vom Mundloch in Ost abgehenden Stollnflügel abtrieben, der auf 10 Ltr. Länge durch Zusammendrücken der Zimmerung an einigen Stellen ungangbar geworden ist. Nachdem im Kästners Hoffnung'er Feld auf dem Stolln 24,5 Ltr westlich vom Schacht acht Türstöcke ausgewechselt und aufgewältigt worden ist, hatte man dort ein Eisensteintrum durch einen Bau von 1,1 Ltr. Weite auf 0,8 Ltr. Länge in Nord untersucht. Die Trümer hatten sich zu einem Gange vereinigt, der an der östlichen Ulme immerhin ½ Ltr. mächtig war und im Hangenden 0,1 Ltr. mächtigen, ganz derben Brauneisenstein führte. „Wegen Mangels an Absatz sieht man vor der Hand aber von dem Abbau ab.“ (40014, Nr. 322, Film 0152f) Von der letzten Befahrung in diesem Jahr am 18. Dezember heißt es nur, die beiden Arbeiter wechselten immer noch Türstöcke aus, „womit sie auch noch einige Zeit zu tun haben werden, da sich immer aufs Neue wieder nothwendige Reparaturen zeigen.“ (40014, Nr. 322, Film 0161) Auch die Anzeige des Schichtmeisters Strödel kann über den Betrieb im Jahr 1845 nichts ergänzen. „Bei Zufüllung der im Felde von Großzeche entstandenen Tagesbrüche“ hatte man ‒ wahrscheinlich nur aus dem dazu benutzten Haldenmaterial ‒ gerade einmal 3½ Fuder Erz gewonnen, außerdem aber 24 Fuder Stollnneuntel erhalten, wofür man 44 Thaler, 12 Groschen Einnahmen verrechnete (40169, Nr. 142, Blatt 104).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im nächsten Jahr änderte sich an
dieser Situation nichts. In
seinem Anschreiben zum Etat für 1846 schrieb Herr Richter, seine Gelder seien
begrenzt, so lange der zweite Hochofen der Königin Marienhütte nicht
angeblasen sei und höherer Erzbedarf bestehe. Daher plante er nur 5 Fuder
eigene Förderung, 20 Fuder aus dem Stollnneuntel und bei Betriebskosten
von 383 Thalern mit Zuschüssen von 333 Thalern (40169,
Nr. 142, Blatt 105ff). Das war zwar keineswegs wirtschaftlich, wurde
aber als Betriebsplan in Annaberg dennoch genehmigt (40169,
Nr. 142, Blatt 109).
Bei seinen Befahrungen am 12. Februar und am 16. März 1846 fand Herr Neubert die beiden Bergleute nach wie vor mit dem Auswechseln schadhafter Zimmerung beschäftigt vor (40014, Nr. 322, Film 0173f und 0179). Am 14. April nahm Herr Neubert „die Halde vom Julius Stolln, welche einen Flächenraum von 70 Quadratlachter bedeckt haben mag, in Augenschein und fand, daß dieselbe, trotzdem, daß ich es untersagt hatte, von dem Schankwirt Goldhahn zu Förstel urbar gemacht worden war.“ (40014, Nr. 322, Film 0185f) Auf dem Arminstolln hingegen war auch am 23. April 1846 alles wie zuvor. Am 19. Juni des Jahres war man damit endlich wieder fertig und die Mannschaft mit dem Abtreiben der Zimmerung in dem Versuchsort an der Markscheide zu Friedlich Vertrag befaßt (40014, Nr. 322, Film 0201f). Auch diese Zimmerungsreparaturen waren am 22. August dann beendet und man hatte nun auf dem Versuchsort entlang der Markscheide einen Querschlag angeschlagen, wo im November des Vorjahres „einige Eisensteintrümer sichtbar waren.“ Die hatten sich jedoch bald ausgekeilt, daher wurde das Ort bei 1,9 Ltr. Auslängung wieder eingestellt und anschließend das Flügelort wieder in Angriff genommen, welches nun bei 17,9 Ltr. vom Hauptstolln stand ‒ und auch dort in altem Mann... (40014, Nr. 322, Film 0216) Von seiner Befahrung am 8. September 1846 berichtete Herr Neubert in seinem Fahrbogen, das Flügelort stehe eigentlich auf dem unteren Drittel der Höhe des Stoßes in Mulm, also in gewachsenem Gebirge, nur darüber in altem Mann (40014, Nr. 322, Film 0218). Am 2. Oktober heißt es, dieses Flügelort sei nun 20 Lachter vom Hauptstolln ausgelängt und solle nach Osten bis in die Felder von Meyers Hoffnung und Gabe Gottes fortgebracht werden. Hierüber fand auch wieder ein Fahrbogenvortrag in Annaberg statt, wobei dem diesbezüglichen Protokoll noch zu entnehmen ist, daß man bei den genannten 20 Lachter Erlängung wieder einmal in alten Mann gekommen sei. Um den Vortrieb zu beschleunigen, hatte Herr Neubert vorläufig das Nachstrossen des Stollnflügels untersagt. Dem folgte auch das Bergamt (40169, Nr. 142, Blatt 111). Von seiner Befahrung am 18. Dezember 1846 fand Herr Neubert dann bloß zu bemerken, das Flügelort habe nun 21,5 Ltr. Länge erreicht und stand wieder in Eisenstein führendem Mulm (40014, Nr. 322, Film 0233). Aus der Anzeige des Schichtmeisters auf das abgelaufene Jahr 1846 erfährt man noch, daß man bis Schluß des Jahres besagten Flügel noch auf 22 Lachter Gesamtlänge gebracht und dabei alles in allem 2 Fuder Eisenstein gewonnen hat. Außerdem gab es noch 16 Fuder Stollnneuntel und insgesamt Einnahmen aus den Erzlieferungen von 30 Thalern, 21 Neugroschen zu verbuchen (40169, Nr. 142, Blatt 118).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Jahresetat des Bergfaktors auf 1847
sah nicht anders aus: Herr Richter erwartete bei 349 Thalern
Betriebsausgaben nur eine ,Producteneinnahme' von 35 Thalern (also
gerade einmal 10% der Kosten) für 5 Fuder eigene Förderung und 15 Fuder
Neuntel (40169,
Nr. 142, Blatt 113ff).
Bei seinen letzten Befahrungen der Grube als Geschworenendienst- Versorger am 21. Januar 1847 (40014, Nr. 322, Film 0237) und am 8. Februar 1847 (40014, Nr. 322, Film 0242) hielt Herr Neubert in seinen Fahrbögen fest, die Beschäftigung der zwei Mann bestehe seit einiger Zeit wieder in Auswechslung wandelbarer Zimmerung auf dem Stolln. Wie schon mehrfach zu lesen war, endet im Quartal Reminiscere 1847 dann die Überlieferung der Fahrbögen. Auch Schichtmeister Strödel konnte in seiner Jahresanzeige auf 1847 nur berichten, daß man den Stollnflügel noch auf 25 Lachter ausgelängt habe, ansonsten aber nur mit der Unterhaltung des Stollns beschäftigt war. Ein Ausbringen war überhaupt nicht mehr zu verzeichnen, die verbuchte Einnahme von 35 Thalern, 25 Neugroschen ging nur auf das erhaltene Stollnneuntel von 35 Fudern, ⅝ Tonne zurück (40169, Nr. 142, Blatt 122). Der Etat für 1848 fiel dementsprechend aus, wurde aber dennoch am 19. Februar 1848 wieder in Annaberg genehmigt (40169, Nr. 142, Blatt 119ff). Für dieses Jahr fehlt in der Grubenakte eine Jahresanzeige des Schichtmeisters, wahrscheinlich aber gab es auch nichts wesentliches zu berichten. Der neue Geschworene Friedrich Gotthold Troll zeigte am 30. Dezember 1848 lediglich einen Diebstahl von Schachtholz im Bergamt an, den ihm Steiger Krauß gemeldet habe (40169, Nr. 142, Blatt 124A).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch aus dem Jahr 1849 gibt es keine
Fahrberichte des Geschworenen, nur eine Anzeige vom 9. März 1849 über neue
Einsenkungen und Tagesbrüche beim Julius Stolln auf Herrn
Goldhahn's Grund ‒ wenn wir uns richtig erinnern, zu dieser Zeit der
Wirt der Förstelschenke (40169, Nr. 142, Blatt 125). Notwendige
Fuhrleistungen wolle Herr Goldhahn selbst übernehmen, doch müßten
die Arbeiter für das Zufüllen der Pingen aus der Zehntenkasse bezahlt
werden, da der Stolln ja im Bergfreien liege.
Stattdessen berichtet uns die Jahresanzeige des Schichtmeisters auf 1849 dann, daß man im Laufe des Jahres das Arnimstollnflügelort auf 28 Lachter fortgebracht, ferner auch vom Richterschacht aus (dieser Name ist noch nicht gefallen...) 14 Lachter gegen Osten ausgelängt habe. Bei Kästners Maßen hatte man wieder einen halben Quadratlachter Lagerfläche ausgehauen, wobei man immerhin 1 Fuder Erz gewinnen konnte. Hinzu kamen 21 Fuder Neuntel von Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung, wofür alles in allem 38 Thaler, 15 Neugroschen Einnahmen zu verbuchen waren (40169, Nr. 142, Blatt 128). Das folgende Jahr brachte zunächst einmal wieder personelle Änderungen: Am 10. Juni 1850 zeigte Faktor Ernst Julius Richter an, daß er Steiger Krauß „wegen dienstwidrigen Verhaltens“ zum Ende Trinitatis gekündigt habe und Hutmann Viertel vorläufig die Aufsicht führen solle (40169, Nr. 142, Blatt 129). Das wurde auch vom Bergamt genehmigt und am 25. September 1850 Herrn Viertel's Steigerlohn auf 10 Groschen pro Woche festgesetzt (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 130f). Letzterer ist aber noch vor Ablauf des Jahres verstorben und so war am 28. Dezember 1850 in Annaberg zu protokollieren, daß der Steiger vom Tiefen Kuttenstolln bei Elterlein, Friedrich Fürchtegott Wendler, nun als Steigerversorger und Hutmann angenommen werde (40169, Nr. 142, Blatt 132). Ansonsten hatte Schichtmeister Strödel in seiner Anzeige auf das Jahr 1850 zu berichten, daß man den Stollnflügel bei 31½ Lachter Länge nun sistiert habe, da das Gestein dort sehr hart wurde, und stattdessen ein neues Flügelort 11½ Lachter zurück gegen Nordost angehauen und schon 9 Lachter fortgestellt hatte. Ein eigenes Ausbringen benannte der Schichtmeister nicht, nur 22 Fuder Stollnneuntel waren zu verbuchen (40169, Nr. 142, Blatt 133). Am 15. Januar 1851 nahm man in
Annaberg eine Anzeige des Geschworenen Troll zu Protokoll, wonach
aus der Zeit vor Einbringung des Arnimstollns im Feld von
Friedlich Vertrag noch klarer Eisenstein aufgehaldet sei. Herr
Troll schätzte ein, daß man daraus noch 80 Fuder Erz gewinnen könne
(40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 132). Davon haben wir in den Akten zur
Ferner stellte man am 20. September 1851 „bei der Croquierung“ fest, daß die 3. obere Maß von Arnim Fundgrube eigentlich bereits an die Friedlich Vertrag Fundgrube verliehen gewesen ist. Das hat aber lange gedauert... Natürlich wurde der ersteren diese Maß wieder gestrichen (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 134). Die Anzeige auf das Jahr 1851 fehlt, doch ist die auf das folgende Jahr 1852 erhalten (40169, Nr. 142, Blatt 144). Demnach hatte der Betrieb nun doch wieder größeren Umfang angenommen: Der Kästners Maßen'er Schacht war zwar zubruchgegangen, ist aber bis Stollnsohle wieder gewältigt worden. Dort wurde in 8 Lachter Teufe ein Feldort 10 Lachter nach Osten getrieben und zwischen diesem und der Stollnsohle eine Lagerfläche von 2,2 Lachtern Höhe und 4 Lachtern Länge ausgehauen, wobei 177 Fuder Eisenstein selbst ausgebracht worden sind. Hinzu kamen 24 Fuder Neuntel von Friedlich Vertrag, so daß man auf 373 Thaler Einnahmen aus dem Erzverkauf kommen konnte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den nächsten Inhalt der Grubenakte
bildet dann der ,Betriebs- und Oeconomieplan' auf die Periode
1853/1854. Er wurde am 29. September 1852 von Faktor Ernst Julius
Richter erstellt und am 15. November von Heinrich von Arnim auf
Planitz höchstselbst abgezeichnet (40169, Nr. 142, Blatt 136ff). Man
plante mit einer Belegung von nun wieder 6 Mann neue Ausrichtungsbaue in
der Arnimstollnsohle und Abbau im Kästners Maßen'er sowie Großzecher Feld.
Dabei sollten wieder 480 Fuder pro Jahr selbst ausgebracht werden, für die
man bei nun 1 Thaler, 20 Neugroschen pro Fuder Einnahmen von 400 Thalern
erwartete ‒ freilich auch bei ansteigenden Kosten von 640 Thalern pro
Jahr. Das fand man auch im Bergamt genehmigungsfähig und so wurde dem
Schichtmeister anläßlich des Anschnitts am 24. November eröffnet, daß man
gegen diesen Betriebsplan „etwas zu erinnern, nicht gefunden“ habe
und ihn also zulasse (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 142).
Statt der üblicherweise handschriftlichen Anzeigen der Schichtmeister bei den Eigenlehnergruben gab es für das Jahr 1853 Vordrucke mit dem Titel ,Rechenschaftsbericht' (40169, Nr. 142, Blatt 145). Diesem zufolge waren nun wirklich wieder 6 Mann auf der Grube angelegt. Mit dieser Belegung hatte man einerseits aus dem Richterschacht im Großzecher Feld (Aha, dort lag der.) in 8 Lachter Teufe ein Ort 24 Lachter gegen Nordwest getrieben, wobei man ein bauwürdiges Lager von 30 Zoll Mächtigkeit überfahren und auf diesem streichenderweise nach Süd und Nord je 3 Lachter ausgelängt hatte. Auch am Kästners Maßen'er Schacht hatte man die Feldstrecke in 8 Lachter Teufe um 7 Lachter in nördliche Richtung weiter vorgetrieben, an diesem Punkt auch weitere 6 Quadratlachter Lagerfläche abgebaut. Die geplanten 480 Fuder hatte man zwar nicht erreicht, dabei aber immerhin 290 Fuder Erz gefördert. Zusammen mit dem Neuntel von 23½ Fudern kam man so auf 735 Thaler Einnahmen aus dem Erzverkauf, allerdings auch bei Gesamtausgaben in Höhe von 771 Thalern. Das eigene Ausbringen ging übrigens an die Königin Marienhütte, während das Neuntel an den Pfeilhammer verkauft wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei diesem Betriebserfolg legte Schichtmeister
Strödel am 17. Dezember 1853 auch noch neue Mutungen zugunsten von Wilkauer vereinigt Feld über
ein (40014, Nr. 297, Blatt 24f). Nach Besichtigung durch den Geschworenen Troll wurden sie ihm am 29. Juli 1854 bestätigt. Am 9. März 1854 zeigte Schichtmeister Strödel vermeintlichen Raubbau durch Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung an. Man habe mit einem Abbau auf der 8 Lachter- Sohle vom Kästners Maßener Schacht aus in Abbaue eingeschlagen und, weil das drin befindliche Ausbauholz „noch ganz frisch“ sei, den Verdacht, daß erst vor kurzer Zeit der Nachbar Vulturius dort eine „nicht unbeträchtliche Menge Eisenstein“ abgebaut habe (40169, Nr. 142, Blatt 147). Das Bergamt beauftragte daher am 11. März Markscheider Neubert mit einer Befahrung. Der berichtete dann am 7. April 1854 (40169, Nr. 142, Blatt 149), der in Rede stehende Abbau läge in 5 Lachter Teufe gegen Ost und umfasse zirka 5,75 Kubiklachter Raum. Da nun ein Kubiklachter Masse gewöhnlich zu einem Viertel bauwürdigen Eisenstein enthielte, umfasse die streitige Menge rund 2,875 Kubiklachter oder ungefähr 40½ Fuder Eisenstein. Seiner Rechnung entnehmen wir übrigens, daß das Fuder in dieser Zeit auf Wilkauer vereinigt Feld zu 25 Kubik- Fuß gerechnet wurde. Herr Neubert hielt allerdings das Holz wegen seines „trocken faulen Zustands“ für älter; hielt es aber auch nicht für ausgeschlossen, daß es „mit Absicht dahin gebracht“ worden sei. Dann verwies er noch auf einen in der Nähe befindlichen, verbrochenen Schacht im Feld von Wilkauer vereinigt Feld, von welchem aus dieser Abbau früher ebenso gut erfolgt sein könnte. Erstaunlich, wie vergeßlich die Leute waren... Dazu befragt, rechnete Herr Strödel einerseits beim Bergamt die Höhe des Verlustes vor, indem er noch anführte, daß das Fuder zurzeit für 1 Thaler, 7 Neugroschen, 5 Pfennige abgegeben werde. Herr Vulturius hingegen erklärte, sich keiner Schuld bewußt zu sein (40169, Nr. 142, Blatt 151ff). Außerdem hatte Herr Strödel am 13. Juli 1854 zwei Diebstähle von Gezähe anzuzeigen. Das Bergamt wies daraufhin an, das Gezähe mit dem „Grubenzeichen“ zu versehen (40169, Nr. 142, Blatt 155f). Nicht zuletzt erhielt Herr Strödel zugunsten von Wilkauer vereinigt Feld am 29. Juli 1854 noch weitere, nachgemuthete Flächen bestätigt, nämlich
Seinem Rechenschaftsbericht auf das Jahr 1854 ist zu entnehmen (40169, Nr. 142, Blatt 168), daß im Schnitt 9 Mann angelegt waren, mit denen im Großzechner Feld bei 8 Lachter Teufe Strecken gegen den Richterschacht getrieben worden sind, wobei man neue Eisensteinmittel überfahren habe. Vom Kästnersmaßner Schacht aus hatte man einen Querschlag ebenfalls in 8 Lachter Teufe bis an die Feldgrenze mit Friedlich Vertrag aufgefahren, dort auch 10 Quadratlachter Lagerfläche ausgehauen. Nicht zuletzt war die Zimmerung auf dem Arnimstolln schon wieder wandelbar geworden, wo man 127 Stück doppelte Türstöcke habe auswechseln müssen. Dabei wurden 499 Fuder Eisenstein selbst ausgebracht und zuzüglich 22½ Fudern Neuntel für 958 Thaler, 1 Neugroschen, 1 Pfennig verkauft, allerdings auch bei 1.062 Thalern Kosten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Betriebsperiode von 1855 bis
1857 erstellte der Bergfaktor E. J. Richter in Zwickau wieder einen
neuen Betriebsplan (40169, Nr. 142, Blatt 158ff). Darin war vorgesehen,
eine jährliche Förderung von 1.000 Fudern zu erreichen, wobei wieder ein
Erlös von 2 Thalern pro Fuder angestrebt wurde. Dazu sollten durch 8 Mann
in Dritteln untertage 40 Quadratlachter Feldfläche abgebaut; ferner 2 Mann
übertage in der Aufbereitung beschäftigt werden. Das wurde am 19. Februar
1855 auch durch das Bergamt genehmigt.
Am 28. März 1855 zeigte Herr Strödel beim Bergamt den Abtransport von 75 Fudern eisenhaltigen Mulms „zu Probeschmelzen“ nach Cainsdorf an und ersuchte zugleich darum, diese Menge von der Verzehntung auszunehmen. Weil der Mulm bisher noch gar nicht verwertet werden könne, genehmigte man letzteres in Annaberg (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 170). Was bei der Verhüttung herausgekommen ist, findet man an dieser Stelle leider nicht. Der Rechenschaftsbericht auf das abgelaufene Jahr 1855 (40169, Nr. 142, Blatt 172f) weist dann eine Belegung mit 17 Mann aus, durch die ein Stollnflügelort vom Richterschacht aus gegen Südwest 21,5 Lachter ins Feld gebracht und mehrere Querschläge auf bauwürdigen Mitteln angelegt worden sind. Als neuer Förder- und Wetterschacht hatte man den Alexanderschacht 14 Lachter bis auf die Arnimstolln- Sohle niedergebracht. Mit dem von dort aus angehauenen Ort gegen Süd allerdings hatte man 3 Lachter Mulm und schon wieder einmal alten Abbau durchfahren. Ferner wurden auf der 8 Lachter- Sohle im Großzechner Feld und am Kästnersmaßener Schacht Feldstrecken aufgefahren, am letzteren ein Steigort von der 8 Lachter- Sohle aus getrieben. Insgesamt hatte man dabei 26,5 Quadratlachter Feldfläche abgebaut und 812 Fuder Eisenstein selbst gefördert, hierzu 29¾ Fuder Neuntel von Friedlich Vertrag erhalten. Die in Summe 841¾ Fuder konnte man für 1.712 Thaler, 15 Neugroschen absetzen, tatsächlich also für einen angewachsenen Preis von rund 2 Thalern, 10 Neugroschen das Fuder. Außerdem waren für insgesamt 79,4 Fuder Mulm noch 36 Thaler, 14 Groschen Einnahme zu verbuchen. Alles in allem kam man so auf Einnahmen von 1.887 Thalern bei 1.747 Thalern Kosten und damit seit längerem wieder zu einem positiven Betriebsergebnis. Der Überschuß verblieb als „Kassenbestand bei der Königin Marien Hütte.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 19. Januar 1856 wurde auf Antrag der
Eigentümer, jetzt „Kammerherr von Arnims Erben“, zunächst einmal
Friedrich Fürchtegott Wendler als „wirklicher Steiger“
angenommen (40169, Nr. 142, Blatt 171). Sein Lohn als solcher betrug 2
Thaler, 12 Neugroschen pro Woche. Auch Schichtmeister Strödel bekam
ab 28. Juni 1856 aufgrund des wieder anwachsenden Betriebes statt
Wie wir im weiteren Akteninhalt anhand einer Vollmacht für E. J. Richter (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 257) herausfinden konnten, handelte es sich bei „von Arnims Erben“ um die Witwe Isolde von Arnim, geb. Gräfin zur Lippe, und Friedrich Hennig von Arnim aus dem Haus Crossen auf Planitz. Am 3. Mai 1856 beantragte E. J.
Richter eine weitere Feldverleihung und bat bei seiner Nachmutung um
möglichste Beschleunigung der markscheiderischen Zulage, da es „eine
concurrirende Muthung“ gäbe (40169, Nr. 142, Blatt 174).
Tatsächlich nämlich wurden schon 1855 vom Bergamt dem Schichtmeister Friedrich Albin Ferdinand Heß für Herrn Christian Friedrich Fikentscher
unter dem Namen Antonius Fundgrube nicht nur
Am 5. Juli 1856 nahm man in Annaberg dann auch die Verleihung von
zugunsten von Wilkauer vereinigt Feld zu Protokoll (40169, Nr. 142, Blatt 176). Ob hier überhaupt noch bauwürdige Erzvorkommen lagen oder nicht, zeigt der weitere Verlauf der Geschichte ‒ aber erst einmal sicherte man sich die Bergbauberechtigung für alle noch freien Flächen... Das Grubenfeld unter dem Namen Wilkauer vereinigt Feld umfaßte jedenfalls nunmehr 49.431 Quadratlachter Fläche oder 50 neue Maßeinheiten und wurde so am 20. Mai 1857 nach den Maßgaben des Berggesetzes von 1851 beurkundet (40169, Nr. 142, Blatt 182). Der nächste Rechenschaftsbericht auf das abgelaufene Jahr 1856 (40169, Nr. 142, Blatt 180f) berichtet uns dann, daß die Belegung auf 22 Mann weiter zugenommen hatte. Mit dieser Mannschaft hat man „zur Aufschließung und Untersuchung“ das Stollnflügelort vom Alexanderschacht gegen Süd 24 Lachter weiter fortgestellt, war nun aber bei 27 Lachter Erlängung in den Glimmerschiefer gekommen. Auch im Großzechner Feld wurden die Feldörter auf der 4 Lachter- Sohle auf nun 47 Lachter und auf der 8 Lachter- Sohle um 7,5 Lachter erlängt, außerdem von der 8 Lachter- Sohle aus und 24 Lachter südlich vom Richterschacht ein Abteufen 7 Lachter niedergebracht. Auf den Abbauen oberhalb der 8 Lachter- und der 4 Lachter- Sohle hatte man diesmal 129 Quadratlachter Lagerfläche, weitere 73 Quadratlachter im Großzechner Feld ausgehauen. Schließlich wurde auch noch der Kästners Maßener Schacht „zur Erlangung mehrern Haldensturzes“ um 1 Lachter aufgesattelt. Aus den insgesamt 202 Quadratlachtern abgebauter Fläche wurden 1.136 Fuder Eisenstein gewonnen, wozu wieder noch 31¾ Fuder Neuntel von Friedlich Vertrag kamen. Für die 1.167¾ Fuder konnte man 2.335 Thaler, 15 Neugroschen erlösen, was exakt einem Preis von 2 Thalern pro Fuder entsprach. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40040, B8311
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 1. Juli 1857 erhielt E. J.
Richter noch einmal 10.976 Quadratlachter Grubenfeld bestätigt, so daß
Wilkauer vereinigt Feld nun 60.407 Quadratlachter oder 61
Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 142, Blatt 183).
In diesem Jahr nahm aber auch eine andere Geschichte ihren Anfang, die im weiteren Verlauf mehrere Behörden sehr beschäftigt hat. Wie wir schon wissen, war inzwischen Carl Louis Stengel durch Heirat in den Besitz des Tännichtgutes und der dazugehörigen Feld- und Waldflächen gekommen. Der wurde durch den Advokaten Moritz Große aus Grünhain (zumindest in dieser Sache) vertreten und der letztere beantragte erst einmal Akteneinsicht beim Bergamt und erbat Vertragsabschriften bezüglich der Grundzinsabkommen zwischen dem früheren Besitzer des Tännichtgutes und den Besitzern von Wilkauer vereinigt Feld, die aber im Bergamt gar nicht vorlagen (40169, Nr. 142, Blatt 184). Bergfaktor Richter hatte nämlich am 5. Oktober 1857 wegen „der Einleitung eines wieder umfangreicheren Betriebes“ bei Wilkauer vereinigt Feld, dessen Grubenfeld sich ja mit dem Gutsbesitz überschnitt, die ,Expropriation' (Enteignung) von Flächen im Umfang von 3 Acker, 27 Quadratruthen für Haldensturzflächen, Wege, Tagebaue (!!) und dergleichen, jedoch einschließlich der bisher schon genutzten Flächen, beantragt (40169, Nr. 142, Blatt 185ff), worüber das Bergamt am 7. Oktober auch Herrn Große schriftlich informierte. Zunächst einmal wurden seitens der Bergbehörde aber die Berggeschworenen Netto und Tröger mit einer Begutachtung beauftragt. Der letztgenannte berichtete dann am 13. Dezember 1857 nach Annaberg, es beträfe erstens die Stollnhalde vor dem Mundloch Arnim Stollns, desweiteren Haldensturzflächen beim Richterschacht, beim Alexanderschacht und beim Kästnersmaßener Tageschacht, schließlich noch, allerdings unbedeutende, Flächen vor und hinter dem Huthaus. Herr Tröger befand, die Flächen seien für die nächsten Jahre viel zu groß veranschlagt und Steiger Wendler solle den tatsächlichen Bedarf neu ausmessen. Für die bislang schon genutzten Flächen erhalte Herr Stengel jährlich 12 Thaler Entschädigung, könne jedoch keinen diesbezüglichen Vertrag zwischen seinem Schwiegervater und Wilkauer vereinigt Feld vorweisen (40169, Nr. 142, Blatt 189ff). Zunächst aber liest man im Rechenschaftsbericht Strödel's auf das Jahr 1857 (40169, Nr. 142, Blatt 194f), daß man schon wieder einen neuen Fahr- und Förderschacht im Kästners Maßener Feld 10 Lachter tief niedergebracht hatte. Von dem aus hatte man in 8 Lachter Teufe einen Querschlag 18 Lachter gegen West bis an die dortigen alten Baue im Großzechner Feld getrieben. Das Feldort auf der 4 Lachter- Sohle am Kästnersmaßener Schacht war nun auf 56 Lachter Erlängung gekommen; oberhalb hatte man 22 Quadratlachter, darunter von der 8 Lachter- Sohle aus weitere 24 Quadratlachter Lagerfläche abgebaut. Auf derselben Sohle hatte man eine Feldstrecke gegen Ost bis an die Grenze zu Friedlich Vertrag getrieben, damit aber 36 Lachter vom Schacht den Glimmerschiefer angefahren. Mit Versuchsörtern und Querschlägen auf hoffnungsvollen Trümern im Großzechner Feld schließlich hatte man auf die vom Richterschacht aus getriebenen Strecken durchgeschlagen. Außerdem hatte man auch oberhalb der Arnimstolln- Sohle noch einmal 20 Quadratlachter, in Summe also in diesem Jahr 66 Quadratlachter Lagerfläche ausgehauen. Dabei wurden 1.465 Fuder Eisenstein selbst gefördert, wozu noch 42¾ Fuder Stollnneuntel kamen. Das Fuder wurde wieder zu 2 Thalern verrechnet. Nicht zuletzt war man auch mit der Unterhaltung der Grubenbaue beschäftigt und hatte allein auf dem Arnimstolln wieder 142 Stück doppelte Türstöcke auszuwechseln. Mit 3.135 Thalern Einnahmen gegenüber 3.037 Thalern Ausgaben wurde erneut ein kleiner Überschuß erzielt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Betriebsplan Richter's für
die Periode von 1858 bis 1860 (40169, Nr. 142, Blatt 196ff) sah eine
Vergrößerung der Belegschaft auf 36 Mann vor, nämlich
Außerdem sollten 2 Mann die Scheidung übertage besorgen. Mit dieser Mannschaft strebte man in den drei Jahren ein Ausbringen von 4.700 Fudern Eisenstein und 7.000 Fudern Mulm an. Anscheinend waren also die Schmelzproben in Cainsdorf mit dem geringhaltigen Mulm nicht ganz erfolglos ausgefallen. Geschworener Tröger, wie immer hierzu befragt, fand an diesem Plan nichts auszusetzen, woraufhin er auch in Freiberg am 26. Juni 1858 genehmigt worden ist (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 221). In der Einleitung dieses Betriebsplanes heißt es, das Gebäude verführe seinen Grubenbetrieb „auf dem bekannten, in Glimmerschiefer aufsetzenden, von Quarzbrockenfels und zum Theil von Kalkstein begleiteten, mulmigen Eisensteinlager, welches eine durchschnittliche Mächtigkeit von 6 Lachtern hat und außer der mulmigen, Eisenoxidhydrat haltenden Hauptmasse unregelmäßige Trümer und Butzen von derbem Brauneisenstein mit zum Theil eingemengtem Quarz, nächstdem aber Brauneisensteinkiesel, Mangan und in selteneren Fällen Schwefelkies führt.“ Daß auch hier Kalkstein und gelegentlich Pyrit gefunden wurden, war uns bis dahin neu... Auch hinsichtlich des Grubenfeldes schlug man noch einmal richtig zu und am 5. Mai 1858 wurde in Scheibenberg eine Nachverleihung über 223.517 Quadratlachter protokolliert. Damit umfaßte das Wilkauer vereinigte Feld nunmehr 283.924 Quadratlachter Fläche oder 284 Maßeinheiten (40169, Nr. 142, Blatt 210). Zu diesem Zeitpunkt war dies das größte, jemals in Langenberg verliehene Grubenfeld überhaupt. Außerdem erhielt auch Steiger Wendler aufgrund des viel umfangreicheren Betriebes nun einen deutlich höheren Wochenlohn von 4 Thalern (40169, Nr. 142, Blatt 207). Dann war ja aber noch die Flächeninspruchnahme ungeklärt... Um diese Expropriationsangelegenheit zur Erledigung zu bringen, wurde für den 6. Mai 1858 eine ,Localexpedition' anberaumt (40169, Nr. 142, Rückseite Blatt 208). Man traf sich im Huthaus von Wilkauer vereinigt Feld mit den Herren Stengel und Große sowie mit einem Gutsbesitzer Weigel aus Beierfeld, der wohl ebenfalls betroffen war, und protokollierte (40169, Nr. 142, Blatt 211), daß seitens Wilkauer vereinigt Feld auf die kleinen Flächen am Huthaus verzichtet werde und es im wesentlichen um drei Flächen an den Schächten sowie am Mundloch des Arnimstollns gehe. Zu diesem Zeitpunkt erklärte sich, dem Protokoll zufolge, Herr Stengel zur Überlassung gegen einen angemessenen Grundzins bereit. So ging man für diesmal auseinander... Markscheider Reichelt wurde nun mit der endgültigen Vermessung der Flächen beauftragt und dieser berichtete am 15. Juni 1858, deren Flächeninhalt betrage 498,4 Quadratruthen (40169, Nr. 142, Blatt 218f). Eigentlich sollte nun der Wert der Flächen taxiert werden, doch hatte E. J. Richter die zwischenzeitlichen Verhandlungen mit C. L. Stengel für gescheitert erklärt und am 26. August 1858 erneut im Bergamt um Expropriation angetragen (40169, Nr. 142, Blatt 227f). Daraufhin wandte sich das Bergamt am 1. September 1858 an das Gerichtsamt zu Scheibenberg, als der „competenten Ortsverwaltungsbehörde“, die Taxierung doch gefälligst vornehmen zu lassen (40169, Nr. 142, Blatt 229). Das Gerichtsamt aber lehnte glatt ab, da Herr Stengel ja der Expropriation an sich widersprochen habe und es sei zunächst Sache des Bergamtes, dieselbe durchzuführen, bevor die Taxierung erfolgen könne (40169, Nr. 142, Blatt 231). Herr Stengel wehrte sich aber
erfolgreich weiter gegen die zwangsweise Abtretung der Flächen aus seinem
Grundbesitz. Der Schriftverkehr dazu füllt die Grubenakte... Wie wir
Ende 1858 ist der bisherige Schichtmeister, Markscheider August Friedrich Strödel, verstorben und E. J. Richter zeigte am 8. Februar 1859 dem Bergamt die Neubesetzung der Schichtmeisterfunktion mit Herrn Hermann August Oehme, Schichtmeister in Raschau, an (40169, Nr. 142, Blatt 251). Die Anzeige auf das Jahr 1858 stammt deshalb diesmal aus der Hand von Ernst Julius Richter selbst (40169, Nr. 142, Blatt 284ff). Demnach waren im Schnitt des Jahres 1858 bei Wilkauer vereinigt Feld 37 Mann angelegt. Neben verschiedenen Versuchsbauen hatte man Abbau wie zuvor am Kästnersmaßener Schacht über der 8 Lachter- und der 4 Lachter- Sohle betrieben und dort 33 Quadratlachter Lagerfläche abgebaut, wobei 1.070 Fuder ausgebracht wurden. Im Großzecher Feld hatte man über der 12 Lachter- und der 8 Lachter- Sohle 5,5 Quadratlachter abgebaut und dabei 210 Fuder Eisenstein ausgebracht. Außerdem sind auf der Arnimstolln- Sohle aus Streichörtern weitere 550 Fuder gewonnen worden, so daß sich das Ausbringen auf insgesamt 1.830 Fuder Eisenstein belief, wozu noch 62 Fuder Stollnneuntel gekommen sind. Dafür erzielte man einen Erlös von 3.784 Thalern (also gab man wie zuvor das Fuder zu 2 Thalern an die Königin Marienhütte ab), allerdings auch bei Ausgaben von über 4.413 Thalern. Darüber hinaus berichtet uns der
Jahresbericht noch, daß die Aufbereitung nur aus „Auskutten“
bestehe. Unter der Rubrik ,Bemerkenswerthe Betriebsereignisse'
steht ferner zu lesen, es habe im August 1858 so starke Regenfälle
gegeben, daß Strecken und Schächte zubruchgegangen seien, die 4 Lachter-
Sohle so weit „zugrunde gegangen“ sei, daß sie am Schluß des Jahres
noch immer unfahrbar war, alle anderen Baue dagegen „mit vielem Holz“
inzwischen wieder gewältigt worden seien. Auch mußte eine neue Kaue über
dem Alexanderschacht errichtet und das Huthaus repariert werden.
Dieses schwere Sommerhochwasser hat auch die
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Fortsetzung des
Expropriationsverfahrens sei noch erwähnt, daß das Bergamt den Parteien
noch eine vierzehntätgige Frist zur Einigung ab 20. Oktober 1858
eingeräumt
hatte, sofern aber keine zustandekomme, wolle man einen Entscheid fassen
(40169, Nr. 142, Blatt 238f). Schließlich hatte man dann für den 30. April 1859
einen Termin für die Eröffnung dieses Bescheids festgesetzt (40169,
Nr. 142, Blatt 254).
Das Bergamt Schwarzenberg hatte darin die Expropriation des Flächenraums von 498,4 Quadratruthen für „sowohl zuläßig als auch für den Betrieb bei genanntem Berggebäude nothwendig“ befunden und darüber unter dem 30. März 1859 folgende Urkunde ausgestellt, die mit Papiersiegel und Unterschrift des inzwischen ja in Schwarzenberg amtierenden Bergmeisters Julius Bernhard von Fromberg versehen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Begründung dieses Entscheids
(40169, Nr. 142, Blatt 262ff) heißt es zur Zulässigkeit des Verfahrens,
welchem Herr C. L. Stengel ja grundsätzlich widersprochen hatte, unter
Bezug auf §212 des Berggesetzes von 1851, daß jeder Grundeigentümer
verpflichtet sei, sein Grundeigentum, wenn es beim Bergbau notwendig sei,
an den Bergwerksunternehmer gegen vollständige Entschädigung abzutreten.
Nur dann, wenn eine Bodenfläche zu „vorübergehenden bergmännischen
Zwecken“ erforderlich wäre, so daß sie nach Gutachten der Bergbehörde
nach einem Zeitraum von längstens drei Jahren an den Grundeigentümer
zurückgegeben werden könne, wären demnach beide Parteien berechtigt, eine
Überlassung nur für die Zeit des Gebrauchs zu fordern. Weil nun aber die
Grube „weit schwunghafter, als zeither“ in Betrieb gehe, stehe ein
solcher Fall hier nicht zu erwarten.
Herr Stengel ging zwar gegen diesen Bescheid am 6. Mai 1859 in „Recurs“ und wandte sich am 22. Mai auch direkt an das Oberbergamt in Freiberg (40169, Nr. 142, Blatt 270ff), doch wies, danach vonseiten der Behörde befragt, Faktor Richter alle Einwände erneut zurück (40169, Nr. 142, Blatt 280ff). Daher wandte sich das Bergamt Schwarzenberg am 18. Juni 1859 ebenfalls an das Oberbergamt und stellte diesem eine zweitinstanzliche Entscheidung anheim (40169, Nr. 143, Blatt 1). Aus Freiberg erging daraufhin sehr schnell, schon am 22. Juni 1859, die Entscheidung, daß der Bescheid des Schwarzenberg'er Bergamtes bestätigt werde; alles übrige aber solle „auf dem Verwaltungswege geklärt“ werden (40169, Nr. 143, Blatt 4ff). Für die Eröffnung dieses Bescheids gegenüber den Kontrahenten wurde in Schwarzenberg dann der 27. Juli des Jahres angesetzt (40169, Nr. 143, Blatt 10), außerdem wandte man sich bereits am 23. Juli wieder an das Gerichtsamt Scheibenberg und forderte zur Wiederaufnahme des Taxationsverfahrens auf (40169, Nr. 143, Blatt 12). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur gleichen Zeit, nämlich am 28. Juni
1859, zeigte Faktor E. J. Richter dem Bergamt den Ankauf der Grube
Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung an (40169, Nr. 143, Blatt
2f). Den Kauf habe man schon 1856 eingeleitet, doch eines „Grubenkaufstreits“
halber nicht vollziehen können. Offenbar wollte Herr Vulturius
seine doch eigentlich in gutem Umgang stehende Grube nicht so einfach
abgeben. Der Streit sei nun aber am 24. Mai 1859 durch das Gerichtsamt
Scheibenberg zugunsten von Wilkauer vereingt Feld entschieden und
ein Kaufpreis von 1.500 Thalern für das Grubenfeld einschließlich allen sonstigen Eigentums
der Grube vereinbart worden. Herr Richter zeigte zugleich an, daß
die angekaufte Grube ab Crucis 1859 mit Wilkauer vereinigt Feld
unter deren Namen konsolidiert werden solle und danach der Name
Friedlich Vertrag Fdgr. in Wegfall kommen könne.
Das Gerichtsamt Scheibenberg bestätigte dem Bergamt Schwarzenberg am 5. Oktober den Verkauf der Grube durch Vulturius (40169, Nr. 143, Blatt 17). Kurz danach (das Protokoll hierüber ist ausnahmsweise mal undatiert) wurde in Schwarzenberg diese Konsolidation bestätigt, wodurch das an Wilkauer vereinigtes Feld verliehene Grubenfeld nun um das von Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung von 3.136 auf nunmehr 287.060 Quadratlachter weiter anwuchs (40169, Nr. 143, Blatt 20). Schließlich wurde am 16. November auch H. A. Oehme vom Bergamt offiziell als Schichtmeister für diese Grube verpflichtet (40169, Nr. 143, Blatt 21), der dann auch gleich die nächstfällige Anzeige auf das Jahr 1859 erstellt hat ‒ übrigens nicht mehr auf den zuvor von Strödel verwendeten, vorgedruckten Rechenschaftsberichts- Formularen, sondern wieder handschriftlich, wie es bei Eigenlehnergruben erlaubt war und was offenbar auch für das Eisensteingebäude Wilkauer vereinigtes Feld noch immer galt (40169, Nr. 143, Blatt 22ff). Derselben kann man entnehmen, daß 1859 auf Wilkauer vereinigt Feld 24 Mann angefahren sind, durch die im Berichtsjahr im Kästnersmaßener Feldteil oberhalb der 4 Lachter- und 8 Lachter- Sohlen 21,5 Quadratlachter Lagerfläche, im Großzechner Feld oberhalb der 8 Lachter- und 12 Lachter- Sohle 4 Quadratlachter und weitere Abbaue auf den Steigörtern im Alexanderschachtfeld ausgehauen worden sind. Dabei hat man alles in allem 2.406½ Fuder Eisenstein selbst ausgebracht und für 4.813 Thaler (also wieder das Fuder zu 2 Thalern) verwertet. Durch den Aufkauf der Nachbargrube fiel natürlich das sonst von dieser noch hingekommene Stollnneuntell nun weg. Unter der Rubrik ,Hülfsbaue' liest man, daß man noch im selben Jahr den Stollnflügel von der Markscheide aus um 23 Lachter erlängt und mit dem Friedlich Vertrag'er Tageschacht durchschlägig gemacht habe. Auch verschiedene ,Versuchsbaue' wurden wieder aufgefahren, u. a. auf der Stollnsohle vom Richterschacht aus nach Nordwesten, auf der 8 Lachter- Sohle am Alexanderschacht und auf derselben Sohle am Friedlich Vertrag'er Tageschacht. Unter der Rubrik ,Bemerkenswerthe Ereignisse' ist in der Jahresanzeige ferner der Ankauf und die Konsolidation mit der Nachbargrube Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung vermerkt und, daß man die Belegung „wegen Stockung des Eisenhütten Gewerbes“ ab Crucis 1859 von 46 auf 24 Mann verringern habe müssen. Die auf Friedlich Vertrag angelegten Arbeiter hatte man anscheinend mit dem Kauf der Grube zunächst übernehmen müssen, aber nicht behalten wollen. Kündigungsschutz und Sozialpläne gab´s damals noch nicht... Der Anzeige auf das folgende Jahr 1860 (40169, Nr. 143, Blatt 33ff) ist zu entnehmen, daß es bei dieser Belegung geblieben ist. In diesem Jahr hat man auch auf der 8 Lachter- Sohle einen Durchschlag von der Markscheide bis zum Friedlich Vertrag'er Tageschacht aufgefahren, außerdem eine neue Kaue und „zwei Eisenstein Meßkästen á 20 Fuder“ vor dem Mundloch des Arminstollns errichtet. Abbau erfolgte im Kästnersmaßener Feld auf der 4 Lachter- und 8 Lachter Sohle „16 Lachter südlich vom Arno Schacht“ (wieder ein neuer ?), wo man 125 Fuder ausförderte, am Alexanderschacht in 8 Lachter und in 14 Lachter Teufe, wo man 570 Fuder gewann, und schließlich im angekauften Friedlich Vertrag'er Feldteil, wo man weitere 500 Fuder Eisenstein ausbrachte ‒ alles zusammen in diesem Jahr 1.195 Fuder. Außerdem habe man noch 80 Zentner allerdings „geringen“ Braunstein mitgewonnen und alles zusammen für 2.430 Thaler verkauft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Betrieb bei Wilkauer vereinigt Feld
ab 1861 schlage man im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ulricke Fundgrube und Maßen
unter C. F. Fikentscher 1855-1862
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 18. August 1855 wurde dem Schichtmeister Friedrich Albin Ferdinand Heß aus
Cunersdorf bei Annaberg für Herrn Christian Friedrich Fikentscher
unter dem Namen Antonius Fundgrube nicht nur eine Fundgrube,
sondern darüber hinaus 155 gevierte Maße, 12 gevierte Wehre und 1
Überschar vom Bergamt bestätigt (40169, Nr. 305, Blatt 12).
Der langte aber richtig zu...
Diese Euphorie ist nicht allein den
Stein- Hardenberg'schen Reformen in Preußen nach der
Niederlage der Napoleon'ischen Truppen in Leipzig 1813 und nach der Einführung
der Gewerbefreiheit in den folgenden Jahrzehnten auch in Sachsen zu
verdanken. Auch seitens der sächsischen Bergbehörde machte man sich um
diese Zeit ‒ nicht zuletzt auf Basis der vorangegangenen geognostischen
Landesuntersuchung ‒ viele Gedanken, was zum wirtschaftlichen Aufschwung
beizusteuern sei. Bergrat Carl Hermann Müller verfaßte etwa im Jahr
1856 ein Traktat über die Eisenerzlagerstätten in Sachsen, welches sogar
mit einem Vorwort des damaligen Oberberghauptmanns Friedrich Constantin
von Beust in Druck gegangen ist. Wir haben bereits in Zusammenhang mit
den bergbaulichen Aktivitäten der Königin Marien- Hütte in Cunsdorf bei
II.
Die Eisenstein- und Braunstein- Niederlage im Quarzbrockengestein „In der östlich von Schwarzenberg sich ausbreitenden Glimmerschieferregion, namentlich in der Gegend von Raschau, Langenberg, Schwarzbach und Elterlein ist schon seit alter Zeit auf einer eigenthümlichen Art von Lagerstätten Eisenstein- und Braunsteinbergbau gangbar, der bei äußerst schwachem und beschränktem Betriebe jährlich gegen - 1.200
Fuder Eisenstein und producirt. Die Lagerstätten, auf denen diese Erze gewonnen werden, sind stockförmige oder mehr lagerförmige, zum Theil wohl auch nur mächtige Ablagerungen in oberflächlichen Vertiefungen des Glimmerschiefers, die sich sowohl durch ihre unregelmäßige Gestaltung und Begrenzung gegen das Nebengestein, als auch durch den großen Umfang, mit dem sie an der Tagesoberfläche hervortreten, von den (…) Rotheisensteingängen wesentlich unterscheiden, während das Material, aus dem sie bestehen, Quarz, Hornstein, Eisenkiesel, lettiger Thon, zerrüttetes und zersetztes Nebengestein mit verschiedenen Arten von Roth- und Brauneisenstein, sowie von Braunstein der Ausfüllungsmasse jener Gänge ziemlich analog ist, nur daß hier Braunstein im Allgemeinen noch häufiger, alle Erze aber meist viel unregelmäßiger aufzutreten pflegen. Diese finden sich nämlich in verschiedenen Graden der Reinheit, bald als gangartige schmale Trümer, bald als kleinere oder größere Nester und Butzen, bald auch als kurz erstreckte lager- oder stockförmige Massen bis zu ½ und 1 Lachter Mächtigkeit in der festeren, meist sehr zerklüfteten, drusigen, stücklichen oder brockenartigen Quarz- und Hornsteinmasse mehr oder minder häufig, aber ohne irgend eine Regelmäßigkeit vertheilt, bald bilden sie mit etwas Thon und jenen Kieselsubstanzen vermengt, eine bröckliche, mulmige Erzmasse, die z. Th. wie Sand mit der Schaufel gewonnen werden kann. Da diese mulmig sandigen Erzmassen wegen ihres geringen Eisengehaltes an höchstens 20 Procent bisher als zu arm betrachtet wurden, um mit Vortheil verhüttet werden zu können, so sind bis jetzt fast nur die reineren Erzvorkommnisse zwischen dem festen Quarzbrockengestein Gegenstand der Gewinnung gewesen, die sich fast immer nur nahe unter der Oberfläche und wohl nirgends viel über 10 Lachter tief ausgedehnt hat. Die bedeutendsten dieser Lagerstätten ziehen sich von dem unteren Theile des Dorfes Schwarzbach auf der linken Seite des dasigen Thales, in einer sehr schwankenden Breite von 80 bis 150 Lachtern und auf eine nur wenig unterbrochene Länge von 1500 Lachtern oder beinahe ½ Meile bis über Langenberg hinab, woselbst in der Gegend des Arsenikwerkes am Graul breite Arme auch nach der rechten Thalseite, einestheils bis über das Rittergut Förstel hinauf, anderntheils nach dem Oswaldthale und Fürstenberge hinüber sich verzweigen. Eine große Menge von Halden, Pingen und Schächten theils auflässiger, theils noch gangbarer Gruben (Wilkauer vereinigt Feld, Meyers Hoffnung, Friedlicher Vertrag, Friedrich, Gelber Zweig, Frisch Glück, Seegen Gottes, Fürstenberg u. a.) bezeichnet die oberflächliche Verbreitung dieser erzführenden Brockengesteinsmassen und liefert zugleich den Beweis für deren allgemeine Bauwürdigkeit. Besonders wichtig sind die Grubenfelder dem Schwarzbachthaler entlang durch die großen Quantitäten von mulmigem und meist sehr manganhaltigem Eisenstein, der oft in beträchtlicher Mächtigkeit nahe unter der Oberfläche lagert und eine sehr massenhafte Gewinnung gestattet. Nachdem durch die obergebirgische Eisenbahn die Möglichkeit geboten ist, auch diese ärmeren Erze noch zu verwerthen. Übrigens sind dieselben Grubenfelder auch an reinerem Eisenstein und Braunstein immer die ergiebigsten gewesen, und da sie zugleich in den Bereich eines daselbst im Glimmerschiefer aufsetzenden Zuges von Kalksteinlagern fallen, so scheint es, als ob letztere einen besonders günstigen Einfluß auf die Ablagerung genannter Erze gehabt hätten. Andere minder ausgedehnte und minder mächtige Massen von Quarzbrockenfels mit Ablagerungen von Eisenerzen, über deren Wichtigkeit die bisher erfolgten wenigen Aufschließungen noch kein bestimmtes Urtheil zulassen, befinden sich auf dem Gebirgsrücken zwischen Schwarzbach und Waschleithe, dann am Tawalde und bei der ehemaligen Grube Mondenschein zwischen Elterlein und Scheibenberg, ferner am rechten Gehänge des Raschauer Thales, am sogenannten Raschauer Knochen nahe bei dem Arsenikwerk Allerheiligen, wo vormals die Gruben Wunderbar Fürstenglück und Seegen Gottes Eisensteinbaue verführten, und am linken Gehänge des Raschauer Thales bei den auflässigen Gruben Junger St. Johannes und Hausteins Glück, sowie am Rattenberge bei Klein- Pöhla bei der auflässigen Grube Hoh neu Jahr. Vielleicht gehören auch hierher die Brauneisensteinlager des Berggebäudes Vater Abraham bei Oberscheibe, von denen das ½ bis 2 Lachter mächtige Hauptlager bereits auf mehr als 200 Lachter Länge und 28 Lachter Teufe abgebaut ist.“ Von Interesse für den Zeitgeist jener Jahre ist noch das Schlußwort (S. 30ff): Schlußbemerkungen. „Durch die vorstehende Übersicht der wichtigsten Eisenerz- Niederlagen des sächsischen Obergebirges und Voigtlandes dürften diejenigen Stimmen wohl vollkommen beschwichtigt werden, welche noch hin und wieder gegen deren nachhaltigen Reichthum und Bauwürdigkeit Zweifel erhoben haben. Denn abgesehen davon, daß in einigen Gegenden dieser Landestheile, (…) noch eine große Zahl ganz unbekannter und unberührter Eisensteinlagerstätten vorhanden ist, so vermögen doch schon die wenigen bereits aufgeschlossenen und als bauwürdig nachgewiesenen, trotz des z. Th. seit Jahrhunderten auf ihnen verführten Bergbaus, mit wenigen Ausnahmen, nur auf höchst unbeträchtliche Tiefe ausgebeuteten Eisensteinlagerstätten auf eine lange Reihe von Jahren hinaus selbst für die großartigste Eisenproduction hinlängliches Material zu bieten, ohne dabei im Geringsten eine Befürchtung allgemeiner Erschöpfung aufkommen zu lassen… Die wichtigsten obergebirgischen und voigtländischen Eisenerz- MNiederlagen vermögen demnach eine jährliche Production von wenigstens 268.000 Fudern Eisenstein und daraus ungefähr 2.000.000 Ctr. Roh- und Gußeisen, d. i. 10mal mehr, als die gegenwärtige Production sämmtlicher sächsischer Eisenhüttenwerke, zu sichern. Ebenso ist es aber auch unbezweifelt, daß diese Production bei einem rationellen Bergbaubetriebe unbehindert und billig zu bewerkstelligen ist...“ Diese Sätze aus der Feder des
Experten klingen zu dieser Zeit noch ganz anders, als sein geschichtlicher
„Soll aber die Eisensteinproduction billig erfolgen, so ist vor allem eine gründliche Reform des bisher noch in seiner ursprünglichen Unvollkommenheit und Beschränktheit verbliebenen Eisensteinbergbaus unerläßlich nothwendig. Es muß derselbe, welcher bis jetzt fast ohne Ausnahme mit zu schwachen Kräften, in zu kleinen, z. Th. nahe nebeneinander liegenden Gruben planlos und mit den unvollkommensten technischen Hülfsmitteln geführt worden ist, analog dem Steinkohlenbergbau durchaus auf das Princip einer großartigen und massenhaften Production gegründet werden, durch die es nur allein möglich ist, die Gestehungskosten des Eisenstein auf möglichst niedrige Sätze herabzuziehen…“ Hermann Müller erwartete, daß man die Gestehungskosten bei den Lagerstätten im Quarzbrockenfels von derzeit 2½ Thalern pro Fuder (das er hier übrigens ,zu durchschnittlich 20 Ctr. Gewicht' angab) um bis zu 30% reduzieren könne. „Hierbei muß noch auf einen anderen Umstand die Aufmerksamkeit gerichtet werden, welcher von nicht geringem Einflusse auf die Herabziehung der Eisensteinpreis e sein dürfte, nämlich auf die Nothwendigkeit einer leichten und möglichst kurzen Verbindung der Eisensteingruben mit den Hüttenwerken. In dieser Beziehung walten häufig noch Verhältnisse ob, die eine Abänderung dringend wünschen lassen. Nicht nur, daß von vielen Gruben die Abfuhr auf elenden Fahrwegen bergauf bergab und deshalb in kleinen Ladungen z. Th. auf beträchtliche Entfernungen erfolgen muß, so findet auch auf Seiten dr Eisenhüttenwerke der Bezug an Eisenstein mitunter aus weit entfernten Gruben statt, während sie ihren Bedarf aus der größten Nähe befriedigen könnten. (...) Nicht selten betragen deshalb die Transportkosten eben so viel oder noch mehr, als die Gestehungskosten oder der Preis des Eisensteins bei der Grube...“ Der Auftraggeber für die eingangs genannte
Mutung, Carl Friedrich Fikentscher, war eigentlich Besitzer einer Ton- und
Zementwarenfabrik, laut Ludwig Oeser's 1856 erschienenem Album der
sächsischen Industrie (Band 1, S. 17f) auch einer Glas- und chemischen
Fabrik, beides in Zwickau, war demzufolge offenbar gut situiert und ist uns auch schon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Antonius Stolln bei
Die
Außerdem hat Herr Fikentscher Ende 1855 die gerade ins Freie gegebene Concordia Fundgrube unterhalb von Schwarzbach (40169, Nr. 36 und 40040, I6588) und noch eine neue Laurentius Fundgrube „im Sudelgehau zwischen Waschleithe und Langenberg“ gemutet (40169, Nr. 199 und 40040, Nr. I7856). Offenbar wollte der neue Betreiber nicht kleckern, sondern klotzen: Am 22. Dezember 1855 wurden ihm außer der bisherigen Fundgrube auch noch die im Freien liegenden Gruben Neues Jahr, Köhlers, Bau auf Gott, Kautzschens Hoffnung und Gottes Geschick Fundgrube samt Stolln unter deren früheren Namen als Beilehn bestätigt (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 18). Nicht zuletzt war Herr Fikentscher gleichzeitig auch noch am Oberen Eisensumpf Stolln (bei Ehrenzipfel) beteiligt... Bau auf Gott, Kautzschens Hoffnung und die Laurentius Fundgrube wurden später noch mit Ullricke Fundgrube und Maßen konsolidiert, während die drei anderen Beilehn blieben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber auch andere kapitalkräftige
Unternehmer wollten an dem neuen ,Boom‘ teilhaben: 1856 mutete der
nunmehrige Besitzer des Hammerwerkes in Erla, Eduard Wilhelm Breitfeld,
zeitgleich mit dem im Freie liegenden Feld der Roten Grube am
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bleiben wir zuvor aber noch kurz in
Der ,Rechenschaftsbericht' des Schichtmeisters auf das erste Jahr 1856 fiel allerdings sehr kurz aus: Lapidar heißt es, die Grube hat 1856 „nicht in Betrieb gestanden.“ (40169, Nr. 36, Blatt 9) Das war für den neuen Besitzer trotzdem nicht umsonst, der Schichtmeister wies in seinem Jahresbericht nämlich Kosten in Höhe von 39 Thalern, 20 Neugroschen und 7 Pfennigen aus, davon allein 25 Thaler, 24 Groschen, 9 Pfennige „Staatsabgaben.“ Im folgenden Jahr, und zwar am 11. Juli 1857, wurde auch für diese Grube im Bergamt Schwarzenberg die Umwandlung der Fläche nach den Maßgaben des Berggesetzes von 1851 vorgenommen und dem Protokoll hierüber ist zu entnehmen, daß dieses Grubenfeld im Besitz von Herrn Fikentscher eine Fläche von 13.300 Quadratlachtern oder 14 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 36, Blatt 10). Für die Betriebsperiode bis 1860 reichte Schichtmeister Heß auch einen Betriebsplan ein, dem zu entnehmen ist, daß nach seiner Kenntnis der erste bergmännische Betrieb hier bereits auf das Jahr 1842 zurückgehe, als ein Bergarbeiter namens Kräher einen Schacht 6 Lachter tief abgeteuft habe, aber des zudringenden Wassers wieder verlassen mußte (40169, Nr. 36, Blatt 11ff). Weiter heißt es hier: „Doch ganz unerfreulich und muthabsprechend war dieser unbedeutende Versuch nicht zu nennen, denn in der genannten Teufe hatte man ‒ nur durch Schachtaushieb ‒ 5 Fuder Brauneisenstein gewonnen...“ Daher beabsichtige man, den Schacht wieder zu gewältigen, das Lager zu durchsinken und, wenn es lohnend erscheine, einen Abbau einzuleiten. Betrieb werde man aber erst ab Sommer 1859 aufnehmen, da „die von dem Alleineigenthümer zur Untersuchung der Eisenstein- und Braunsteinablagerungen... bestimmten, höchst bedeutenden Geldmittel“ durch seine anderen Vorhaben im Revier bereits „absorbirt“ waren. Dazu kommen wir gleich. Schichtmeister Heß schloß seinen Betriebsplan jedenfalls mit den Worten: „und läßt sich nur der Wunsch aussprechen, daß recht bedeutende Lieferungen sich verwirklichen... mögen.“ Das letztere sah auch Geschworener Tröger so, dem der Betriebsplan wie üblich zur Prüfung übersandt wurde; er hatte ansonsten aber keine Einwände vorzubringen (40169, Nr. 36, Rückseite Blatt 13). Weil nun üblicherweise zu einem Betriebsplan auch damals schon ein Grubenriß gehörte, ein solcher aber nicht vorlag, beauftragte das Bergamt zunächst noch Markscheider Reichelt mit der Anfertigung. Der hat auch weisungsgemäß die Gegend aufgesucht und am 7. Mai 1859 nach Schwarzenberg berichtet, daß doch gar kein Betrieb stattfände (40169, Nr. 36, Blatt 15). Was soll ich eigentlich hier tun, hätte er dazusetzen können... So ging der Betriebsplan ohne Risse nach Freiberg und wurde dort auch am 1. Juni 1859 so genehmigt (40169, Nr. 36, Rückseite Blatt 16). Aus den folgenden Jahren gibt es noch weitere Rechenschaftsberichte des Schichtmeisters zur Concordia Fundgrube, den auf das Jahr 1857 haben wir allerdings in der Akte zum Oberen Eisensumpf Stolln in Ehrenzipfel gefunden ‒ der übrigens auch nicht in Betrieb gestanden hat, was der Schichtmeister zweckmäßigerweise in einem Papier zusammenfaßte (40169, Nr. 64, Blatt 12). Dieser Bericht sagt also auch nichts anderes aus, als der vom Vorjahr. Und auch 1858 und 1859 hatte Schichtmeister Heß nur die Ausgaben zu verrechnen; Betrieb wurde nicht aufgenommen (40169, Nr. 36, Blatt 18 und Blatt 19). Da nun eigentlich schon für den Sommer 1859 die Betriebsaufnahme angekündigt war, forderte das Bergamt Schwarzenberg am 29. September 1860 den Unternehmer zur Aufnahme bergmännischer Arbeiten binnen 4 Wochen auf (40169, Nr. 36, Rückseite Blatt 20). Das geschah aber nicht, stattdessen sagte Fikentscher's neuer Betriebsleiter Cloeter am 1. November 1860 das Feld wieder los (40169, Nr. 36, Blatt 22).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Laurentius Fundgrube hatte im Gegensatz zur Concordia Fundgrube (zumindest im Schwarzbachtal) keinen Vorläufer. Der über diese Grube angelegten Akte zufolge erhielt Herr Fikentscher unter diesem Namen am 20. Oktober 1856 eine gevierte Fundgrube und 40 gevierte Maße bestätigt (40169, Nr. 199, Blatt 1). Seinen Rechenschaftsbericht über die Gruben Laurentius, Concordia und Oberer Eisensumpf Stolln auf das Jahr 1856 hat Schichtmeister Heß gleich wieder zusammengefaßt und es steht auch über die Laurentius Fundgrube nur kurz und knapp darin, „Vorstehendes Gebäude (hat)... nicht in Betrieb gestanden.“ (40169, Nr. 199, Blatt 2) Ansonsten enthält die Grubenakte nur noch die Feldumwandlung nach den Maßgaben des Berggesetzes von 1851, der man entnehmen kann, daß dieses Feld 32.536 Quadratlachter und folglich 33 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 199, Blatt 3). Wie wir oben schon anführten, wurde die Laurentius Fundgrube danach mit Ullricke Fundgrube und Maßen konsolidiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bezüglich seiner Ulricke Fundgrube zeigte Herr Fikentscher ordnungsgemäß am 30. August des Jahres dem Bergamt an, daß er Herrn Ferdinand Heß zum Schichtmeister für seine Grube bestellen wolle (40169, Nr. 305, Blatt 17). Der seinerseits zeigte am 30. August dem Bergamt an, daß der Betrieb aufgenommen werden solle. Man beabsichtige, zu Untersuchungszwecken zwei Stollnbetriebe zu beginnen und zwar am linken und rechten Gehänge des Schwarzbachtales und ungefähr 250 Lachter westlich vom Hasengut (40169, Nr. 305, Blatt 15). Beides wurde auch am 5. September 1855 in Annaberg genehmigt (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 17). Ein erster Fahrbogen des amtierenden Berggeschworenen Theodor William Tröger datiert auf den 10. September 1855. Demnach hatte man in der 10. Woche des laufenden Quartals zunächst den Stolln am Nordufer angeschlagen. Zum Zeitpunkt seiner Befahrung war er aber erst 1,5 Lachter in Glimmerschiefer getrieben (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 19). Für das abgelaufene Jahr 1855 fertigte Schichtmeister Heß auch für die Ullricke Fundgrube einen ,Rechenschaftsbericht' für das Bergamt an, aus dem zu entnehmen ist, daß zunächst 9 Mann angelegt worden sind. Bis zum Jahresende hatte man noch eine Kaue errichtet und den nördlichen Stolln auf 20,5 Lachter Länge hora 12, also in Richtung (magnetisch) Nord, fortgestellt. Nach 8,8 Lachtern hatte man zunächst ein 0,2 Lachter mächtiges Mulmlager durchfahren und ist dann in roten Hornstein gekommen. Anfang des letzten Quartals des Jahres hatte man auch den südlichen Stolln auf die frühere Ullricke Fundgrube zu angehauen. Dieser bekam natürlich den Namen Ullricke Stolln und war hora 9,5 Südost inzwischen 25 Lachter erlängt, stand aber bis dorthin nur „in lehmigen Massen mit Geröllen von Eisenstein.“ Die gesamten Kosten von rund 682 Thalern trug der Eigentümer über Zubußen (40169, Nr. 305, Blatt 21f). Am 4. April 1856 zeigte Herr Heß dann dem Bergamt in Annaberg an, daß der nördliche Stolln „auf Wunsch des Alleineigenthümers“ den Namen Friedrich Stolln bekommen solle, was man dort am 9. April zu Protokoll nahm (40169, Nr. 305, Blatt 23). Es war aber noch ein Grubensteiger nötig. Als solchen benannte Heß am 26. Mai 1856 Friedrich Gottlob Müller aus Annaberg. Er sollte die Ullricke Fundgrube „zur Mitaufsicht“ bekommen. Der war bereits auf den Gruben Margarete gevierte Fundgrube und St. Christoph zu Breitenbrunn tätig, daher im Bergamt bekannt und wurde deshalb auch am 29. Oktober 1856 vom Bergamt zugelassen (40169, Nr. 305, Blatt 24). Am 5. Juli 1856 bekam Herr Heß außerdem zugunsten von Ullricke Fundgrube und Maßen mal eben noch weitere 14 gevierte Lehn und 7 Überscharen bestätigt (40169, Nr. 305, Blatt 26). Sein Rechenschaftsbericht auf das Jahr 1856 (40169, Nr. 305, Blatt 29f) berichtet uns, daß einschließlich des Steigers inzwischen 12 Mann auf der Grube angelegt waren. In diesem Jahr hatte man mit dieser Belegung den Friedrich Stolln in Mulm und Hornstein mit Eisenstein auf nunmehr 97 Lachter Gesamtlänge fortgebracht, bei dieser Länge aber nun einen sehr harten, quarzreichen Schiefer angefahren und den Forttrieb des Hauptstollnorts daher eingestellt. Stattdessen wurde hier bei 54 Lachter Stollnlänge ein Abbau in Schlag genommen, von dem man immerhin 90 Fuder Eisenstein und 29 Zentner Braunstein gewinnen konnte. Auch den Ullricke Stolln hatte man in diesem Jahr um 48 auf nunmehr 73 Lachter Gesamtlänge fortgestellt, allerdings wurde der Betrieb „durch beinahe schwimmendes Gebirge und Mangel an Wettern“ sehr erschwert. Das wenig standsichere Gebirge erforderte sehr viel Ausbauholz und Schichtmeister Heß klagte, „das Holz wollte nicht mehr ausreichen.“ Auch gab es sehr viel Wasserzulauf, weswegen man bei 66 Lachtern Länge ein Flügelort angeschlagen hatte, um die zusitzenden Wässer besser fassen und ableiten zu können. Das Unternehmen hat den Eigentümer in diesem Jahr 2.653 Thaler an Zubußen gekostet. Den geförderten Braunstein hat der Eigentümer selbst für eine Bezahlung in Höhe von 24 Thalern, 15 Neugroschen (im Schnitt also etwas mehr als 25 Groschen der Zentner) abgenommen, was Herr Heß in seiner Abrechnung auch als Einnahmen zu Buche schlug. Der Eisenstein verblieb im Vorrat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 20. Juni 1857 wurde im Bergamt (inzwischen nun in Schwarzenberg) die Umwandlung der Feldgröße nach den Maßgaben des Gesetzes über den Regalbergbau von 1851 protokolliert. Demnach umfaßte die Bergbauberechtigung der Ullricke Fundgrube und Maßen zu diesem Zeitpunkt eine Fläche von 128.576 Quadratlachtern oder 129 Maßeinheiten (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 30). Offenbar war es Herrn Fikentscher aber immer noch nicht genug, obwohl er ja gerade erst vor anderthalb Jahren mit dem Aufschluß begonnen hatte. Schichtmeister Heß wurden am 22. Juli 1857 dann insgesamt 616.824 Quadratlachter Grubenfeld bestätigt. Zugleich wurde die Ullricke Fundgrube mit den innerhalb des bereits verliehenen Feldes liegenden Gruben Laurentius, ferner Kautzschens Hoffnung und Bau auf Gott konsolidiert, so daß es nun eine Gesamtfläche von 782.587 Quadratlachtern oder 783 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 31f). War das nun Größenwahn oder einfach Unkenntnis ? Anmerkung: Die hier auch genannte und wenigstens schon 1737 erwähnte Laurentius Fundgrube samt Erbstolln befand sich bei Scheibenberg, wurde 1834 konsolidiert mit Unserer lieben Frauen Empfängnis und Beständige Einigkeit Fundgrube und war zuletzt eine Kommunzeche der Stadt Scheibenberg (siehe z. B. 40169, Nr. 34 und 209). Jedenfalls sagt uns der Rechenschaftsbericht des Schichtmeisters auf das Jahr 1857 über den Grubenbetrieb (40169, Nr. 305, Blatt 34f), daß im Schnitt über das Jahr 18 Mann auf der Grube angelegt waren. Den Eisensteinabbau auf dem Friedrich Stolln hatte man aufgrund ausgehender Anbrüche eingestellt, zuvor dort aber noch 10 Fuder gewonnen, so daß der Vorrat an Eisenstein auf nun 100 Fuder angewachsen, aber anscheinend unverkäuflich war. Stattdessen hatte man bei 54 Lachter Stollnlänge zwei Flügelörter angehauen. Das Ort in Richtung Westen stand bis 29,8 Lachter Erlängung in braunem und gelbem Mulm, dann hatte man Schiefer angefahren und bei 32,3 Lachtern Länge das Ort eingestellt. Das Gegenort nach Osten war bis Jahresende auf 28 Lachter ausgelängt und stand in Mulm, „mit Eisen- und Braunstein- Schnuren durchzogen.“ Außerdem hatte man noch ein Steigort bei 23 Lachtern Stollnlänge angehauen und auch schon knapp 23 Lachter fortgestellt, weil man vermutete, daß das eigentliche Erzlager höher und der Stolln zu tief liege. Über den Ullricke Stolln erfährt man, daß das Stollnort in diesem Jahr nicht fortgestellt worden ist. Im Rechenschaftsbericht liest man, daß man auf den letzten 24 Lachtern „alten Bau, braunsteinführenden Mulm, Quarzablagerungen, dann wieder Schiefer und braunsteinführenden Mulm“ durchfahren habe. Dort hatte man in diesem Jahr 121 Zentner Braunstein gewonnen. Der starke Wasserzudrang behinderte aber die Arbeit und Trinitatis 1857 mußte der Betrieb wegen Wettermangel eingestellt werden. Daher hat man sich entschlossen, bei 81,6 Lachtern Stollnlänge zunächst ein Lichtloch auf den Stolln abzusenken und außerdem „in der Nähe der alten Ullrick'er Schächte“ einen neuen Förderschacht zu teufen, mit welchem man inzwischen schon 8 Lachter niedergekommen war. Aufgrund der gegenüber dem ersten Jahr verdoppelten Mannschaft waren auch die Kosten weiter angestiegen. Für das Jahr 1857 errechnete der Schichtmeister Gesamtkosten für den Grubenbetrieb in Höhe von 3.620 Thalern, die vollständig vom Eigentümer aufgebracht worden sind. Vom ausgebrachten Braunstein hat der Eigentümer selbst wieder 106 Zentner abgenommen und dafür wurde ein vergleichsweise hoher Preis von 1 Thaler für den Zentner verrechnet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Betriebsperiode 1858 bis 1860 war erstmals auch ein Betriebsplan einzureichen (40169, Nr. 305, Blatt 51Aff). Zumindest bei Schichtmeister Heß scheint der Optimismus ungebrochen gewesen zu sein, wenn er in demselben formulierte, das Grubenfeld „dürfte einer frohen Zukunft entgegen gehen... wenn nur erst die zeitraubenden und kostspieligen Arbeiten zu dessen... Aufschließung beendet sind.“ Im Betriebsplan war unter anderem vorgesehen, nach der Fertigstellung des Ullricker Stolln- oder Ferdinandschachtes den Stolln und Flügelörter nach Südwesten in Richtung Riedels Fundgrube weiter zu treiben, um „die hier mehrfach eingelagerten Schieferrippen zu durchfahren und das Verhalten gegen den sich anschließenden Mulm kennen zu lernen.“ Auch im ehemaligen Gnade Gottes'er Grubenfeld wollte man neue Untersuchungen aufnehmen, weil man glaubte, daß „die Alten hier nicht in bedeutende Tiefe gekommen sind.“ Nun, das wissen wir schon besser. Außerdem heißt es: „In der Nähe des Wilkauer vereinigt Feld'er Huthauses, wo in alten Zeiten ein altes Eisenhüttenwerk gestanden haben soll, worauf allerdings die noch vorhandenen Schlackenhaldenüberreste hindeuten, sollen... mehrere Schürfe angelegt und, wenn die Versuche ergiebig, zur Anlage eines Tagebaues verschritten werden. Zahlreiche kleine Halden und Bingen liefern allerdings den Beweis, daß die Alten hier viel sich beschäftigt haben.“ In der Bewertung des Plans durch Geschworenen Tröger schrieb dieser am 19. April 1859, es handele sich „in der Hauptsache um Versuchsbaue, deren Fortstellung von einem günstigen Erfolg abhängt... Man muß dem Gelingen hoffnungsvoll entgegen sehen.“ (40169, Nr. 305, Blatt 57) Im Jahr 1858 wollte man wohl auch noch an anderer Stelle in dem riesigen Grubenfeld einschlagen. Jedenfalls wurde im Bergamt Schwarzenberg am 20. September 1858 protokolliert, daß es mit dem Grundbesitzer, Carl Friedrich Weigel aus Raschau, über die dazu benötigte Fläche noch keine Einigung gab. Daher wurde Geschworener Tröger ausgesandt, um den Flächenbedarf zu ermitteln. Der berichtete anschließend an das Bergamt, daß dieser „Versuchsschacht“ im Feld von Köhlers Fundgrube zu liegen kommen solle und bestimmte die Höhe des dafür jährlich zu entrichtenden Grundzinses auf etwas mehr als 4 Thaler (40169, Nr. 305, Blatt 37ff). Am 14. Oktober 1858 hat Grubenbesitzer Fikentscher außerdem dem Steiger Müller gekündigt, weil dieser „für meine kostspielige Grube ungeeignet“ sei, da ihm die nötige Erfahrung im Eisensteinbergbau fehle (40169, Nr. 305, Blatt 41). Das erscheint uns allerdings ein Vorwand gewesen zu sein, denn wie wir oben gelesen haben, war der ja unter anderem auch auf St. Christoph in Breitenbrunn tätig, wo man ebenfalls auf Eisenstein (freilich ein Magnetit- Skarnlager) baute. Da Fikentscher offenbar fristlos gekündigt und auch keinen Lohn mehr gezahlt hatte, beschwerte sich Steiger Müller beim Bergamt, wo man ihn aber in dieser Sache an das zuständige Zivilgericht verwies (40169, Nr. 305, Blatt 42f). Der Rechenschaftsbericht von Schichtmeister Heß auf das Jahr 1858 (40169, Nr. 305, Blatt 51f) verrät uns dann, daß der Ullricker Stolln nunmehr 116 Lachter Länge erreicht hatte und daß man bei 113 Lachter und in 14 Lachter Teufe auf den neuen Tageschacht durchschlägig geworden ist. Mit diesem neuen Ullricker Tageschacht hatte man zuvor in 11 bis 12 Lachter Teufe „schönen Braunstein“ durchsunken. In der Stollnsohle dagegen wechselte das Gebirge zwischen hartem Quarzgestein, in welchem man nur mit Bohr- und Schießarbeit vorankam, und sehr mildem Mulm, der „mit Braunstein inficirt“ war. Hier konnte man auch wieder 240 Zentner Braunstein gewinnen. Um das Gebirge weiter aufzuschließen und die Abbauwürdigkeit festzustellen, hatte man zwei Flügelörter vom Stolln nach Südwest und nach Nordost angehauen, das Ort nach Südwest aber schon nach 10 Lachtern wieder eingestellt, weil es nur in sehr hartem Gestein stand. Auf dem anderen Schwarzbachufer hatte man über dem Streckenkreuz bei 54 Lachter Länge des Friedrich Stollns einen Schacht 5,3 Lachter abgeteuft, mit dem man schon 3 Ellen unter dem Rasen in ein Braun- und Eisensteinlager gekommen ist. Das Erz sei von „sehr verschiedener Qualität, doch einige Sorten können noch leidlich genannt werden.“ Hier hatte man 80 Fuder Eisenstein gewinnen können, was den schon vorhandenen Vorrat weiter vergrößerte. Schließlich hatte man noch drei weitere Schürfe von 4 Ellen Teufe angelegt und den oben schon erwähnten Versuchsschacht in Unterlangenberg 2 Lachter abgesenkt, ihn dann aber „wegen angeordneter Betriebsschwächung“ einstellen müssen. Ja, das ganze Unternehmen wurde Herrn Fikentscher wohl zu teuer... Er hat nicht nur seinen Steiger entlassen, sondern auch die bis Crucis 1858 anfahrende Mannschaft von 21 Mann ( !! ) auf nur noch 8 Mann im Quartal Luciae reduziert. Dennoch sind auch 1858 für ihn wieder Zubußen in Höhe von 3.313 Thalern angefallen und da kann die Verrechnung der 240 Zentner Braunstein für 200 Thaler (also der Zentner zu 25 Groschen) wahrlich keinen Gegenwert darstellen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Betriebsplan für den Zeitraum von 1858 bis 1860 hat dann auch das Oberbergamt in Freiberg am 1. Juni 1859 genehmigt (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 62). In der Zwischenzeit hatte aber Schichtmeister Heß im Auftrage des Besitzers am 14. Mai 1859 „wegen den höchst traurigen Zeitverhältnissen“ Fristhaltung beantragt (40169, Nr. 305, Blatt 59). Das wurde wegen des tatsächlichen Absatzmangels an Eisenstein am 18. Mai auch genehmigt. Entsprechend kurz fiel denn auch des Schichtmeisters Rechenschaftsbericht auf dieses Jahr aus: Bis Trinitatis 1859 haben die 8 anfahrenden Mann noch die vorbeschriebenen Arbeiten ausgeführt, seitdem ist nur noch 1 Zimmerling angelegt, um die Zimmerung instandzuhalten. Die drei Schächte hatte man verbühnt, die Haspeln entfernt und das Inventar dem Schmiedemeister zur Aufsicht übergeben. Mit der Aufsicht hatte Fikentscher „interimistisch“ den Steiger Wendler von Wilkauer vereinigt Feld beauftragt. Dann berichtete Schichtmeister Heß am 15. Dezember 1859 an das Bergamt in Schwarzenberg, daß der Steiger Schütz jun. ‒ ob im Auftrage des Besitzers, wisse er nicht ‒ alle Vorräte an Grubenholz nach St. Christoph zu Breitenbrunn gebracht habe, selbst das Holzwerk der Kaue... (40169, Nr. 305, Blatt 64) An dieser Grube war Herr Fikentscher nämlich auch beteiligt. Unter dem gleichen Datum beschwerte sich Schichtmeister Heß noch beim Bergamt, daß Fikentscher nun wohl auch ihn anging und den Betrieb bei Ullricke Fundgrube und Maßen unter seiner Leitung als „nachlässig und leichtsinnig“ bezeichnet habe. Heß bat daher, das Bergamt möge doch einen Geschworenen mit einer Betriebsprüfung beauftragen (40169, Nr. 305, Blatt 65). Zu diesem Zweck wurde Rezeßschreiber Lippmann nach Langenberg entsandt und der berichtete am 19. Januar 1860 an das Bergamt über seine Befahrung des Friedrich Stollns (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 72ff), es sei hier alles „regulär“, der Betriebsplan sei vollkommen eingehalten worden. Nur im östlichen Stollnflügel habe der Gebirgsdruck acht Türstöcke in der südlichen Ulme gesprengt. Die Verbrüche seien aber unvermeidlich, da ein Mann allein die Unterhaltung nicht bewerkstelligen könne. Der 16 Lachter lange Abbau nördlich vom Streckenkreuz in der westlichen Ulme des Hauptstollns war versetzt und wegen der Brüchigkeit des Mulms zusammengegangen; auch das Steigort war nicht mehr fahrbar. Insgesamt kam Herr Lippmann zu der Einschätzung, daß der Friedrich Stolln „im Winkelkreuz zum Streichen der Gesteinsschichten für den damit beabsichtigten Zweck am vortheilhaftesten angelegt und getrieben ist.“ Über den Ullricke Stolln berichtete Lippmann, man habe das bei 81 Lachter vom Mundloch geteufte Lichtloch wieder ausgestürzt, nachdem der Ferdinandschacht bei 113 Lachter durchschlägig geworden ist. Man erneuerte gerade Teile der Bolzenschrotzimmerung im Schacht, die von diesem aus 2 Lachter oberhalb der Stollnsohle angesetzten Örter waren aber nicht mehr fahrbar. Er schätzte ein, daß „die Schwierigkeiten bei diesem Ortsbetrieb mit Geschick überwunden worden sind“ und daß alles „gut ausgeführt zu nennen“ war. Das Gutachten kostete übrigens 9 Thaler, 25 Groschen und 3 Pfennige und wurde einschließlich der ,Liquidation' am 25. Januar 1860 in Abschrift an Herrn Heß gesandt (40169, Nr. 305, Blatt 78f). Der Inhalt wird Herrn Heß sicher gefreut haben, doch konnte er die knapp 10 Thaler nicht bezahlen, weil ihm Herr Fikentscher den Wochenlohn halbiert hatte und bat um Stundung der Gebühren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Wochenlohn des bisherigen Schichtmeisters hat der Besitzer vermutlich aus dem Grund gekürzt, weil er fast die Hälfte des Grubenfeldes, nämlich 347.155 Quadratlachter, losgesagt hat, was man am 4. April 1860 in Schwarzenberg zu Protokoll nahm (40169, Nr. 305, Blatt 82). Dann hat er Schichtmeister Heß aber ganz gekündigt und als neuen Bevollmächtigten Ernst Adolph Clöter aus Breitenhof (bei Breitenbrunn) benannt, den das Bergamt dann am 15. Dezember 1860 auch als neuen Schichtmeister verpflichtete (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 90). Am 31. August 1860 war auch Geschworener Tröger noch einmal zu einer Befahrung zugegen und berichtete am Folgetag an das Bergamt (40169, Nr. 305, Blatt 85ff), daß der neue Schichtmeister den Zimmerling beauftragt habe, auf den Flügeln des Friedrich Stollns die Zimmerung herauszureißen, um das Holz für Reparaturen im Hauptstolln zu nutzen. Freilich sei das geraubte Grubenholz „schon sehr von der Fäulnis angegangen“ und eigentlich nicht mehr brauchbar... Nun sah es Tröger zwar als Entscheidung des Besitzers an, wenn dieser die Flügel abwerfen wollte und machte dagegen keine Einwände, wohl aber dagegen, daß das Rauben des Ausbaus durch einen Mann allein geschehe, was bei dem gebrächen Gebirge auf keinen Fall sein dürfe. Er hatte daher die Fortsetzung des Raubens sofort untersagt und beantrage nun beim Bergamt, es möge Herrn Clöter anweisen, für diese Arbeiten einen zweiten Mann abzustellen. Nach dem Fahrbogenvortrag am 8. September 1860 folgte natürlich auch das Bergamt Tröger's Antrag (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 87f). Von Schichtmeister Clöter gibt es noch einen Jahresbericht über den Betrieb der Grube im Jahr 1860, in dem jedoch alle Punkte mit einem ,Vacat' versehen sind, nur unter dem Punkt ,Versuchsarbeiten' steht zu lesen, daß man vom Ullricke Tageschacht aus noch ein Ort 7 Lachter nach Südost getrieben habe, um damit Braunstein zu gewinnen (40169, Nr. 305, Blatt 95). Darüber berichtete auch Herr Tröger nach seiner Grubenbefahrung am 12. November 1860, daß man 1,5 Lachter über dem Stolln vom Schacht aus ein Ort hora 6 West angehauen, aber „nur unerhebliche Trümchen von Braunstein in Brockenfels gefunden“ habe (40169, Nr. 305, Blatt 101f). Schon am 8. September 1860 hat Herr Clöter im Auftrage des Besitzers weitere 319.960 Quadratlachter des Grubenfeldes losgesagt, so daß nun nur noch 115.472 Quadratlachter oder 116 Maßeinheiten übrig blieben (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 89). Dieses verbliebene Feld hat Fikentscher selbst dann am 31. Dezember 1860 losgesagt (40169, Nr. 305, Rückseite Blatt 92A). Mit gerade einmal sechs Jahren Betriebszeit war es eine kurze Periode, doch war sie recht intensiv: Denn mit bis zu 20 Mann Belegschaft wurden hier noch einmal neue Aufschlüsse im mittleren und nördlichen Teil des Reviers geschaffen ‒ nur eben leider nicht mit dem erhofften wirtschaftlichen Erfolg. Damit endete die Geschichte aber noch nicht, denn nachdem das Grubenfeld nun wieder ins Bergfreie zurückgegeben worden ist und der Geschworene eine Schlusskontrolle ausführen sollte, teilte Herr Tröger am 15. Juni 1861 dem Bergamt mit, daß bereits am 2. Januar 1861 von Schichtmeister Oehme im Auftrage von Wilkauer vereinigt Feld Nachmutung über das freigefallene Feld von Ullricke Fundgrube eingelegt worden sei. Im Bergamt legte man daraufhin am 26. Juni fest, daß nunmehr also der für Wilkauer vereinigt Feld zuständige Bergfaktor Ernst Julius Richter in Zwickau- Schedewitz anzuweisen sei, die von dieser Grube nicht mehr benötigten Baue gehörig zu verwahren (40169, Nr. 305, Blatt 96f). Was danach und bis zum Erwerb des Feldes durch G. Zschierlich
noch hier geschehen ist, berichten wir im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein letztes Nachspiel findet sich noch in der Grubenakte: Im Jahr 1897 nämlich wurde an das Bergamt ein Bergschaden gemeldet. Weil der Tagesbruch auf dem Ullricker Grubenfeld lag, und dieses in die Bergbauberechtigungen von Wilkauer vereinigt Feld übergegangen war, wurde vom Bergamt auch zunächst die Königin Marienhütte als deren Eigentümer mit der Verfüllung beauftragt. Nach einer Befahrung durch Berginspektor Wappler
am 22. Juli 1897 stellte sich
allerdings heraus, daß der Bruch weit im Nordwesten, schon jenseits des
Roten Hahns am nordwestlichen Gehänge des Oswalsbachs, auf einem ‒ wie
Inspektor Wappler schrieb: „dem Namen nach unbekannten“
Stolln ‒ eingetreten ist (40169, Nr. 305,
Blatt 102ff). Nun hatte
Wilkauer vereinigt Feld ja nur das zuletzt bestehende und viel
kleinere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juno Fundgrube
bis zur Konsolidation mit Riedels Fundgrube 1860
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Zwischenzeit geschah aber noch mehr im Revier: Die neue Juno Fundgrube bei Langenberg wurde von Ernst Erdmann Zweigler aus Wildenau gemutet und diesem am 8. September 1860 vom Bergamt Schwarzenberg auch bestätigt (40169, Nr. 174, Blatt 1). Herr Zweigler war kein Bergmann, sondern Geschäftsmann, jedoch im Bergbau nicht ganz unerfahren. Die Juno Fundgrube hieß zwar noch so, umfaßte aber nicht mehr nur eine gevierte Fundgrube (mit 1.372 m² Grubenfeld), sondern ein beträchtliches Grubenfeld von 48.596 Quadratlachtern oder 49 Maßeinheiten (194.384 m² oder knapp 19,5 ha). Wie dazumal bereits üblich, forderte das Bergamt von dem Eigner nun einen Betriebsplan und die Benennung der verantwortlichen Personen. Dies aber tat Herr Zweigler nicht, sondern beantragte stattdessen am 19. Oktober 1860 die Konsolidation seiner Juno Fundgrube mit der ihm bereits gehörigen Riedels Fundgrube, welche auch am 10. November des Jahres vom Bergamt genehmigt worden ist (40169, Nr. 174, Blatt 2). Das war vielleicht die kürzeste Bestandsdauer eines Bergwerkes in dieser Region überhaupt... Die Akte enthält darüber hinaus nur noch einigen Schriftverkehr mit einem der Grundeigentümer aus dem Jahr 1897 (40169, Nr. 174), welcher aber für den weiteren Verlauf der Geschichte nicht mehr von Bedeutung ist. Die genaue Lage des Grubenfeldes ist nicht mehr nachzuvollziehen, jedoch findet man auf dem Übersichtsriß auf dem Stand von 1882 den Juno Stolln nordöstlich unterhalb von Riedels Fundgrube. Zur Fortsetzung der Geschichte schlage man in den folgenden Kapiteln nach...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius
Erbstolln bis zur Konsolidation mit Gelber Zweig 1862-1864
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der von Wilkauer vereinigt Feld am 13. Juli 1841 sistierte und in der Folgezeit ins Bergfreie gelassene Julius Stolln bei Förstel wurde 20 Jahre später als Erbstolln gleichen Namens durch den Obersteiger Gottlob Friedrich Müller zu Raschau gemutet und diesem auch vom Bergamt Schwarzenberg am 20. Dezember 1862 verliehen (40169, Nr. 173, Blatt 1). Wie dazumal bereits üblich, forderte das Bergamt auch von diesem neuen Eigner nun einen Betriebsplan und die Benennung der verantwortlichen Personen. Daraufhin aber schrieb Müller an das Bergamt, seine Mutung sei „zum Besten des Berggebäudes Gelber Zweig erfolgt, welches in meinen Besitz gekommen ist,“ und beide sollten demnächst zu einem Grubenfeld vereinigt werden. Weil er aber erst einmal auf der Fundgrube beschäftigt sei, beantragte er Fristhaltung für den gemuteten Stolln (40169, Nr. 173, Blatt 2). Wegen der „dem Eisensteinbergbau noch immer ungünstigen Conjunctur“ hat man diesen Antrag vonseiten des Oberbergamtes in Freiberg denn auch am 20. Juni 1863 genehmigt (40169, Nr. 173, Blatt 4). Der weitere Akteninhalt besteht zunächst aus Schriftverkehr mit dem Gerichtsamt zu Scheibenberg hinsichtlich des Verkaufs der Grube Gelber Zweig. In der Zwischenzeit ist nun aber 1863 Obersteiger Müller verstorben und seitens des Gerichtsamtes wurde über dessen Nachlaß ein Konkursverfahren eröffnet. Aus diesem Grund wurde auch seitens des Bergamtes zu Schwarzenberg die schon beantragte Konsolidation mit Gelber Zweig nicht vollzogen, man wolle erst das Subhastationsergebnis abwarten (40169, Nr. 173, Blatt 5ff). Letzteres zog sich offenbar hin und so reichte Schichtmeister Oehme am 11. März 1864 einen „Vacat Schein“ zum Grubenbetrieb im Bergamt ein ‒ es hatte im zurückliegenden Jahr nämlich gar keiner stattgefunden (40169, Nr. 173, Blatt 9). Am 7. Januar 1865 nahm man dann im Bergamt Schwarzenberg zu Protokoll, daß die Gelber Zweig Fundgrube an E. Zweigler versteigert worden sei, der Julius Stolln hingegen, als von dieser ja noch abgetrennte Grube, aber nicht und bat das Gerichtsamt um Auskunft, wer denn nun dessen Besitzer geworden sei (40169, Nr. 173, Rückseite Blatt 9). Die Versteigerung des Besitzes von Obersteiger Müller muß ‒ dem Schreiben des Bergamtes an das Gerichtsamt Scheibenberg vom 11. Januar 1865 zufolge (40169, Nr. 173, Blatt 10) ‒ am 5. Oktober 1864 erfolgt sein. Neuer Besitzer der Gelber Zweig Fundgrube war demnach zunächst der Fabrikbesitzer Johann Traugott Weisflog in Langenberg, welcher sie aber sehr bald an den Handelsmann Ernst Erdmann Zweigler aus Wildenau wieder abgetreten habe. Inzwischen hatte Schichtmeister Oehme auch für das Jahr 1864 wieder einen Vacat Schein über den nicht stattgehabten Grubenbetrieb bei Julius Erbstolln eingereicht. Herr Zweigler hat dann den Antrag auf Zusammenlegung der beiden Gruben eingereicht und dieser wurde vom Bergamt zu Schwarzenberg auch am 1. April 1865 genehmigt (40169, Nr. 173, Blatt 12ff). Damit wurden die um 1860 beginnenden Konsolidationen der einzelnen Grubenfelder fortgesetzt, welche schließlich durch G. Zschierlich um 1893 vollendet worden sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrieb bei
Wilkauer vereinigt Feld ab 1861
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Betriebsperiode 1861 bis 1863 war
zunächst einmal wieder ein Betriebs- und Ökonomieplan einzureichen, der von
Bergfaktor E. J. Richter in Zwickau erstellt worden ist (40169, Nr. 143,
Blatt 25ff). Darin wurde zunächst beklagt, daß man „wegen Mangel an
genügendem Eisenstein Absatz“ die Belegung von 25 Mann beibehalten müsse.
Der Hauptteil der Lagermasse, der eisenhaltige Mulm, sei „gegenwärtig noch
nicht zu verwerthen.“ Dennoch plante man binnen der drei Jahre ein
Ausbringen von insgesamt 3.750 Fudern Eisenstein und 100 Zentnern Braunstein,
welchletzteren man für 15 Groschen den Zentnern abzusetzen hoffte. Wieder wurde
kein wirklicher Gewinn, nur der Freiverbau der Grube vorgesehen.
Dazu wie immer befragt, hatte Geschworener Tröger am 19. Januar 1861 „keine Bemerkung“ zu machen (40169, Nr. 143, Blatt 32), und so wurde der Betriebsplan auch am 27. Februar 1861 in Freiberg genehmigt (40169, Nr. 143, Rückseite Blatt 34).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie
Am 24. August 1861 wurden Faktor Richter namens Wilkauer vereinigt Feld gleich noch einmal zwei weitere Flächen von 12.740 und 176.305 Quadratlachtern bestätigt, so daß es nunmehr 591.577 derselben oder 592 Maßeinheiten umfaßte (40169, Nr. 143, Rückseite Blatt 36). Dennoch beklagte Schichtmeister Oehme in seinem Bericht auf das Betriebsjahr 1861 (40169, Nr. 143, Blatt 38f) erneut, daß man „wegen Mangel an Eisenstein Absatz“ die Belegung von 25 auf nur noch 6 Mann habe reduzieren müssen, im Schnitt des Jahres seien 11 Mann auf der Grube angelegt gewesen. Abbau ist nur im Alexanderschachtfelde über der 6 Lachter- und 8 Lachter- Sohle sowie im Friedlich Vertrag'er Felde oberhalb der Arminstolln-, der 8 Lachter-, 6 Lachter- und 4 Lachter- Sohle (also eigentlich über die gesamte Teufe) umgegangen. Insgesamt hatte man 95 Quadratlachter Lagerfläche ausgehauen und dabei 1.570 Fuder, ferner auf einigen Versuchsbauen am Richterschacht und auf einem Feldort am Friedlich Vertrag'er Schacht zusammengenommen weitere 10 Fuder Eisenstein zutage gefördert. Bei einem Verrechnungspreis mit der Königin Marienhütte von 2 Thalern pro Fuder ergaben sich folglich 3.160 Thaler Einnahmen aus dem Erzverkauf. Dabei findet man übrigens nun die Angabe, daß ein Fuder zu 17½ Zentner gerechnet werde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im folgenden Jahr änderte sich nicht
viel und Schichtmeister Oehme hatte in seiner Jahresanzeige auf 1862
(40169, Nr. 143, Blatt 40) nur zu berichten, daß man mit durchschnittlich 9 Mann
Belegschaft am Alexanderschacht in 8 und 14 Lachter Teufe 29 Quadratlachter
Lagerfläche ausgehauen und dabei ganze 290 Fuder Eisenstein ausgebracht hatte.
Zur Erleichterung der Fahrung und Förderung hatte man nebenbei schon wieder
einen neuen Tageschacht 22 Lachter südlich vom Alexanderschacht bis auf
die 8 Lachter- Sohle niedergebracht.
Etwas besser schien das nächste Jahr zu verlaufen, denn über 1863 berichtete Herr Oehme, daß man die Belegung wieder auf 25 Mann (darunter allerdings 10 Grubenjungen) vermehrt habe (40169, Nr. 143, Blatt 41f). Man nahm wieder Versuchsbaue auf, u. a. ein Feldort in dem ein Jahr zuvor geteuften, noch namenlosen Schacht in 6 Lachter Teufe, welches man 10 Lachter hora 4,4 Ost in der Lagermasse fortgestellt hatte. An gleichem Ort hatte man auch in 8 Lachter Teufe ein Ort hora 12 Nord 5½ Lachter teils in Mulm, teils in Glimmerschiefer ausgelängt. Auch am Friedlich Vertrag'er Tageschacht hatte man ein Feldort in 8 Lachter Teufe hora 4,4 West 6 Lachter ausgelängt, war aber in alten Mann gekommen. Abbau ging auf Streich- und Steigörtern im Friedlich Vertrag'er Feldteil auf der 4 Lachter- und 8 Lachter- Sohle um, wo man in diesem Jahr 41½ Quadratlachter, sowie im Alexanderschacht'er Feld, wo man 12 Quadratlachter Lagerfläche aushieb und dabei 545 Fuder Eisenerz ausbrachte. Der Verrechnungspreis blieb bei 2 Thalern pro Fuder, so daß man Einnahmen von 1.090 Thalern verbuchen konnte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 20. September 1864 weilte hoher Besuch im
bescheidenen Huthaus in Langenberg. Bergassessor Ernst Moritz Böhme protokollierte
hierüber (40169, Nr. 143, Blatt 43ff):
„Huthaus Wilkauer vereinigtes Feld bei Langenberg, den 20. September 1864. Am heutigen Tage wurde vom Herrn Oberberghauptmann Freiherr von Beust, nachdem derselbe früh 9 Uhr mit den Herren Oberkunstmeister Schwamkrug aus Freiberg, Bergdirector Rexroth aus Sulzbach bei Saarbrücken, Hüttenmeister von Lilienstein aus Cainsdorf und Bergfactor Richter aus Zwickau in Schwarzenberg eingetroffen waren und sich mit nurgenannten Herren, ingleichen Herrn Bergrath von Fromberg und unterzeichneten Assessor, (auf) die Grube Wilkauer vereinigtes Feld bei Langenberg begeben hatte, daselbst eine Localbesichtigung und Conferenz abgehalten, wobei Folgendes anher zu bemerken war. Wie die übrigen, im Langenberger Thal gelegenen Gruben, Hausteins Hoffnung Fdgr, Friedrich Fdgr, Gelber Zweig Fdgr, Riedels Fdgr und Meyers Hoffnung Fdgr. führt auch die Grube Wilkauer vereinigtes Feld ihren Betrieb auf einem im Glimmerschiefer aufsetzenden, von Quarzbrockenfels und Kalkstein begleiteten Eisenstein- und Braunsteinlager. Dieses Eisenerzlager hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von 6 Lachter, streicht dem Glimmerschiefer und mit diesem der Thalsohle parallel hora 4,4 und scheint auch in seinem Fallen der Thalsohle in der Hauptsache zu entsprechen, indem es auf dem linken Ufer des Langenberger Baches, woselbst sämmtliche genannte Gruben ihren Betrieb verführen, der Tagesoberfläche entsprechend, jedoch zeitweilig etwas steiler, 35 – 40° gegen Nord einfällt, auf dem rechten Ufer des Langenberger Baches aber, wiederum der Tagesoberfläche entsprechend, in dieser Richtung wiederum aufzusteigen scheint. Was seine Zusammensetzung anlangt, so besteht das fragliche Lager in seiner Hauptmaße aus in sehr lockerem Aaggregatzustande befindlichen Eisenoxydhydrat, aufgelöstem, sehr eisenschüssigem Glimmerschiefer, welcher oft, als solcher nur noch an der Textur erkennbar, dem brauchbaren Eisenstein beizuzählen ist, sowie Quarz und Hornstein mit unregelmäßig darin ausgeschiedenen Trümern und Butzen derben Brauneisensteins und Braunsteins, dabei scheint in dem südöstlichen Theile der bis jetzt bekannten Erstreckung dieses Lagers der Braunsteingehalt, im nordwestlichen Feldtheile dagegen der Eisengehalt zuzunehmen. Das quantitative Verhältniß der klaren zur festen nutzbaren Lagermasse möchte auf ungefähr 49 zu 1 anzunehmen sein, so daß die Lagermasse aus 98% eisen- und manganhaltigen klaren Mulm und 2% groben Erzgeschicken bestehen dürfte. Der Mulm aber dürfte nach auf der Marienhütte zu Cainsdorf gemachten Untersuchungen, sowie nach einer vor längeren Jahren aus 10 – 13 Cubiklachtern an verschiedenen Orten gewonnener Masse genommenen Durchschnittsprobe einen Eisengehalt von 20 bis 26% haben. Der Durchschnittsgehalt an Mangan ist zur Zeit noch nicht ermittelt. Diese angegebenen Umstände haben 1.) bei der unterirdischen Gewinnung der Lagermasse einen immensen Holzverbrauch und trotzdem häufige und zwar bei der geringen Überdeckung des Lagers bis zu Tage gehende Brüche, 2.) bei der Verhüttung der Lagermasse häufige Störungen des Ofenganges zur Folge gehabt, indem die klaren Massen den Ofen versetzten, welchem letzteren Nachtheile man zwar dadurch abzuhelfen versucht hat, daß man die ausgesiebte klare Masse auf der Grube selbst und zwar zu 1/60 Theil mit Kalk versetzte und zu Ziegel formte, welche an der Luft getrocknet wurden, jedoch ohne Erfolg, indem diese Ziegel nicht allein schon beim Transport von der Grube auf die Königin Marienhütte, mindestens aber beim Aufgeben auf dem Ofen zersprangen und sich in klare Masse wieder auflösten. Zu erörtern nun, auf welche Weise diesen beiden unter 1. und 2. gerügten Übelständen am besten und gründlichsten abzuhelfen sei, der in der Lagermasse enthaltene, höchst ansehnliche Eisen- und Manganreichthum aber mehr als zeither möglich war, nutzbar gemacht, ja soweit es der jetzige Stand der Technik gestatte, ausgenutzt werden könne, dies war der hauptsächlichste Gegenstand der heutigen Localexpedition. A. den Grubenbetrieb anlangt, zu der Überzeugung, daß die dem zeitherigen Grubenbetrieb infirmierenden Mängel am rationellsten und grundlichsten durch Einleitung von Tagebau dürften beseitigt werden können, wie dies vor längerer Zeit schon oberbergamtlicherseits anempfohlen worden ist. Zunächst nämlich dürfte die Erlangung des hierzu erforderlichen Grund und Bodens, sei es gegen einen jährlich zu entrichtenden Grundzins oder durch Kauf, obgleich die nöthige Fläche nicht unbedeutend ist, mit nicht allzugroßem Kostenaufwand zu erwirken sein, da der betreffende Grund und Boden größtentheils in dermalen abgeholztem Waldboden und nur zum kleinen Theile in Wiesen- und Feldgrundstücken besteht. Dann aber dürfte die Einleitung von Tagebau in Rücksicht auf die Lagerung der Erze selbst nicht mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, indem das auf eine ansehnliche Fläche fast zu Tage liegende Lager in seinem tiefsten Aufschlußpuncte nur gegen 15 Lachter unter Tage, die obere Grenze derselben aber nur einige Lachter unter Tage liegt, so daß etwa 6 Lachter Höhe durchschnittlich abzuteufen sein würden, welche noch außerdem in Dammerde, Gerölle und altem Haldensturz, sowie einem sehr leicht gewinnbaren Schiefer besteht. Als Sohle des Tagebaus würde man die Wassersaige des die Grube lößenden Arnimstollns annehmen, denselben unter der von Langenberg nach Schwarzbach führenden Straße in zur Förderung hinreichender Höhe durchführen und in Mauerung setzen und mit Eisenbahn belegen, um die gesammte, der Aufbereitung zu übergebende Masse durch den Stolln ausfördern, die Aufbereitungsanlagen unterhalb gedachter Straße etabliren zu können, wo man sich das dabei benöthigte Wasser am leichtesten beschaffen kann. Beginnen würde man mit dem Tagebau am zweckmäßigsten bei dem Alexander Tageschachte, oberhalb dessen der Glimmerschiefer im Liegenden des Erzlagers zu Tage austritt und mit dem Abbau von da nach der Thalsohle hin vorschreiten. Selbstverständlich wird die wirkliche Einleitung dieses Tagebaus von dem Resultat der vorzunehmenden Aufbereitungsversuche abhängen. Was nämlich B. die Verwerthung und Verhüttung der Lagermasse anlangt, so kam man auch heut wieder zu der Überzeugung, daß dieselbe eine umfängliche Aufbereitung der nutzbaren Lagermasse voraussetzt. Zunächst nämlich wird die Trennung der gröberen Massen von dem klaren Mulm der Lagermasse, soweit die ersteren nicht sofort bei der Gewinnung ausgehalten werden können, dadurch zu bewirken sein, daß man die gesammte geförderte erzhaltige Lagermasse über feste geneigte Siebe gehen läßt. Aus den gröberen Massen sind durch Ausschlagen und Klauben lieferbare Eisensteine und Berge auszuscheiden, der zwischen diesen beiden Sorten innestehende Theil dieser festen Massen aber behufs späterer Trennung der darin enthaltenen Erze einer weiteren Zerkleinerung zu unterwerfen. Die klaren Massen dagegen würden durch in Wasser umgehende Trommeln nach der Korngröße zu sortieren, die abgehende, die feinsten Erztheilchen enthaltende Trübe aber in größere Sümpfe zu führen und in diesen der feine Erzschlamm aufzufangen sein, die gröberen Kornsorten würden, jede für sich, behufs der Trennung des Quarzes und Glimmerschiefers vom Eisenstein, einem besonderen Wäschproceß zu unterwerfen und der vorliegende Zweck dabei am besten wohl durch einen Apparat mit aufsteigendem Wasserstrom zu erreichen sein. Zu Erreichung des angestrebten Zweckes soll nämlich, wie Herr Director Rexroth sich vorläufig aussprach, der klare Mulm mittelst eines Wasserstromapparates mit aufsteigendem Strome abgefluthet werden und die hierdurch abgefluthete Trübe, welche den hauptsächlichsten Erzgehalt der Masse enthalten würde, in Bassins aufgefangen werden, das klare Wasser würde aus den Bassins mit Pumpen abgehoben und dem Stromapparat wieder zugeführt werden, so daß also frisches Wasser nur dann erst erforderlich sein würde, wenn, nachdem das in Arbeit befindliche Bassin mit Schlämmen sich angefüllt hat, ein ganz neues Bassin in den Proceß gezogen werden müsse. Die gefüllten Bassins würden dann ausgestochen, die Schlämme aber würden, beziehentlich nach vorgängiger Einsümpfung mit Kalk, in Ziegelform gepreßt, getrocknet und dann geröstet werden. Die nach Abfluthen des Mulms zurückbleibende gröbere Masse würde zuerst ihrem Korne nach in vielleicht 3 bis 4 Gröben separirt, dann aber jede Gröbe für sich (?) gesetzt werden. Die hierbei gewonnenen bohnengroßen Eisensteine könnten entweder der gröberen guten Eisensteinsorte zugefügt, oder vielleicht den klaren Schlämmen beigemengt und mit diesen in Ziegelform gebracht werden, worüber jedoch erst noch anzustellende Versuche entscheiden müßten, da es doch möglich wäre, daß dies der Haltbarkeit der Ziegel und der Röstung nachtheilig sein könne. Ein umfängliches genaues Gutachten versprach Herr Director Rexroth zu geben, sobald er die von ihm anzustellenden Versuche mit dem zu probirenden Mulm von Wilkauer vereinigtes Feld bei Langenberg beendigt haben werde und werden ihm dazu von der dasigen Lagermasse, wie solche gefördert, jedoch nach Aushaltung der ganz groben Stücken mittelst eines Durchwurfs oder eines Trommelsiebes, ca. 20 Centner zugesandt werden. Hierbei dürfte auf den der Lagermasse beigemengten Braunstein, welcher allerdings auch deshalb schwer vom Brauneisenstein zu trennen sein würde, als beide ziemlich gleiches specifisches Gewicht, nämlich ersterer 3,72, letzterer 3,4 bis 4,2 haben, Rücksicht weiter deswegen nicht zu nehmen sein, als ein gewisser Mangangehalt der Eisenerze deren Werth für gewisse Zwecke nur erhöht. Nach Vollendung dieser Versuche und Erreichung eines günstigen Resultats würde man die nöthigen Aufbereitungsmaschinen auf der Grube und zwar unterhalb der Langenberg- Schwarzbacher Straße auf der von der Ausmündung der Waßersaige des Arnimstollens befindlichen, zum Hammergut Tännicht gehörigen Wiese aufstellen und zu dem Zwecke von dieser Wiese die nöthige Fläche, eventuell mittelst Expropriation, erwerben. Dagegen beschloß man davon abzusehen, die zum Antrieb der Aufbereitungsmaschinen und Verwaschung der Erze nöthigen Wasser, wie erst beabsichtigt, aus dem Langenberger Bach oder dem Schwarzbach zu entnehmen, da dieselben jedenfalls nur mit bedeutenden Opfern von dem dieselben beanspruchenden Hammergutsbesitzer Stengel auf Tännicht zu erlangen sein würden, fand vielmehr für angemessen, zum Antrieb der Aufbereitungsanstalten eine Locomobile aufzustellen, zur Erlangung der nöthigen Wäschwasser aber auf den zu den Wäschanlagen zu aequirirenden Wiese einen Brunnenschacht abzuteufen und aus diesem solche durch eine von der Locomobile zugleich zu betreibende Dampfpumpe heben zu lassen. So nachrichtlich anher bemerkt, durch Signatur genehmigt und mit unterschrieben.“ Man machte sich also unter Zuziehung allen
ingenieurtechnischen und behördlichen Sachverstands bei der Königin Marienhütte
Gedanken, wie man mit geringerem technischem Aufwand mehr Ausbringen an
nutzbarem Erz erzielen könne. Eine solch hoch angelegte ,Conferenz'
überhaupt zuwege zu bringen, war unter den damaligen Zeitumständen natürlich nur
einem Großunternehmen, wie der Hütte in Cainsdorf, mit denen von Arnim noch dazu
im Besitz einer adligen Familie, überhaupt möglich. Das Unternehmen hatte
freilich auch die technischen und finanziellen Möglichkeiten, derartige
Aufbereitungsanlagen dannn auch wirklich zu errichten. Ob dies am Ende tatsächlich erfolgt ist,
verrät uns die weitere Aktenüberlieferung leider nicht. Der Tagebau jedenfalls
wurde nach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch der für die nächste Betriebsperiode von
1864 bis 1866 erstellte Betriebsplan (40169, Nr. 143, Blatt 53ff) sah jedenfalls
wieder eine Erhöhung der Belegung auf 28 Mann (inklusive 10 Bergjungen) vor,
wovon drei auf Ausrichtungs- und Aufschlussbauen, zwei Mann nur bei der
Aufbereitung eingesetzt werden sollten. In Ergänzung zu obenstehendem, langem
Protokoll sei hier noch angemerkt, daß die Aufbereitung noch bis dahin nur aus „sorgfältigem
Auskutten“ bestanden hat.
Man beabsichtigte, pro Jahr 2.000 Fuder Erz zu fördern, was etwa für das Jahr 1864 bei gleichbleibendem Verrechnungspreis zwar 4.000 Thaler Einnahmen aus dem Erzverkauf, allerdings auch bei 4.531 Thalern Gesamtbetriebskosten bedeutet hätte. Es blieb also beim Freiverbau, einen (zu versteuernden) Gewinn zu erwirtschaften, war auch bei der Königin Marienhütte als wichtigstem Abnehmer des Eisenerzes überhaupt nicht die Absicht. Geschworener Tröger fand hierzu am 16. Dezember 1864 wiederum „nichts zu bemerken“ und so wurde der Plan nach Freiberg eingereicht, wo man ihn so am 4. Januar 1865 auch genehmigte (40169, Nr. 143, Blatt 60). Schichtmeister Oehme berichtet uns in seiner Anzeige auf das Jahr 1864 (40169, Nr. 143, Blatt 62f) denn auch, daß man wieder 28 Mann angelegt hatte, nämlich:
Mit dieser Mannschaft wurden die Versuchsbaue am noch immer namenlosen ,Neuen Schacht' sowie am Friedlich Vertrag'er Tageschacht fortgesetzt, außerdem der Arnoschacht neu ausgezimmert. Abbau erfolgte im Friedlich Vertrager Feld auf der 4 Lachter- und 8 Lachter- Sohle, wo man in diesem Jahr 53,15 Kubiklachter Lagermasse aushieb, im Alexanderschacht'er Feld, wo es 55,7 Kubiklachter wurden, sowie auf dem „Grenzflügelort“ des Arnimstollns (mit dem früheren Friedlich Vertrag'er Feld), wo man noch einmal 12 Kubiklachter des Lagers aushieb. Dabei kam man zu einem Ausbringen von 1.940 Fudern, 3⅞ Tonne oder (man verwandte zunehmend die metrischen Einheiten) 34.063,6 Zentnern Erz, wofür man 3.881 Thaler, 20 Neugroschen, 3 Pfennige Einnahmen verrechnen konnte. In seinem Fahrbericht vom Quartal Crucis 1865 berichtete Geschworener Theodor William Tröger dann, daß man die Belegung inzwischen sogar auf 45 Mann noch weiter verstärkt hatte (40169, Nr. 143, Blatt 64), jedoch gäbe es „keine bemerkenswerthen Veränderungen beim Betrieb, da entsprechend der Eigenthümlichkeit des Lagers nur unregelmäßige Abbaue stattfinden können.“ Jedoch setzte man offenbar einen Teil der Vorschläge der Konferenz vom Vorjahr schon offenbar um und Herr Tröger fand es bemerkenswert, daß man am Alexanderschacht „einen in schiefer Ebene liegenden, eisernen Durchwurf angebracht (hatte), über den die geförderten Eisensteine gestürzt werden, so daß der Mulm und die Graupen bis Erbsengröße sich vom Stückwerk trennen. Erstere Masse wird dann noch einmal in ein Sieb genommen und durchgesiebt, welche dann als unbrauchbare Masse auf die Halde gestürzt wird. Die im Siebe zurückbleibenden Graupen kommen dann mit unter den Eisenstein.“ Auch der Anzeige des Schichtmeisters Oehme zufolge (40169, Nr. 143, Blatt 69) waren im Schnitt des Jahres 1865 bei Wilkauer vereinigt Feld 42 Mann inklusive 11 Bergjungen angelegt. Man hatte den Arnoschacht bis zur Sohle des Arnimstollns noch um 3 Lachter auf nun 13 Lachter Teufe abgesenkt und vom Kästnersmaßener Schacht her, außerdem auch bis zum Richterschacht, den Durchschlag bewirkt. Den Friedlich Vertrag'er Tageschacht hatte man um 1 Lachter aufgesattelt, um mehr Haldensturzraum zu gewinnen. Der Ankauf von Friedlich Vertrag samt Kästners Hoffnung hatte sich offensichtlich gelohnt, denn auch in diesem Jahr wurde ein Großteil des Abbaus (diesmal 96,7 Kubiklachter) hier verführt. Weitere 94 Kubiklachter wurden im Alexanderschacht'er Feld und noch einmal 14 Kubiklachter über der 8 Lachter- und der 10 Lachter- Sohle am Arnoschacht ausgehauen. Das waren also binnen einen Jahres 204,7 Kubiklachter oder mehr als 100.000 m³ ! Aus diesem Volumen wurden 6.500 Fuder oder 113.750 Zentner Eisenstein gewonnen, für die man 13.000 Thaler Einnahmen verrechnen konnte. Die Angabe der metrischen (Gewichts-) Einheit sagt uns nebenbei, daß 1865 ein Fuder 17,5 metrische Zentner besaß (also 875 kg Masse). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Jahre 1865 kam es wieder zu Streit
mit den Besitzern des Tännichtgutes, inzwischen Frau Emilie Thekla
verwittwete Stengel. Letztere hatte über ihren Rechtsbeistand, Advokat
M. Bormann, beim Gerichtsamt Scheibenberg anzeigen lassen, daß sich die
Menge des vom Gut genutzten „Röhrwassers“ seit Anfang des Jahres
allmählich verringert habe und daß es nunmehr gänzlich versiegt sei, wodurch
ihrem Gut ein „unersetzlicher Schaden“ entstehe. Dafür könne nur der
Bergbau durch Wilkauer vereinigt Feld ursächlich sein (40169, Nr. 143,
Blatt 65ff).
Da war doch schon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 4. Mai 1866 zeigte Schichtmeister Oehme
dann beim Bergamt an, daß man beabsichtige, „in nächster Zeit das
Eisensteinlager durch Tagebau abzubauen.“ (40169, Nr. 143, Blatt 73) Dafür
sei es nötig, auf der beanspruchten Waldparzelle des Tännichtgutes das Holz
einzuschlagen und dazu wiederum bat er das Bergamt um Begutachtung und
Flächenbestimmung. Mit den Besitzern des Gutes habe man schon eine einmalige
Entschädigung von 200 Thalern und einen Grundzins von 30 Thalern jährlich
vereinbart, letzteren bereits seit 1862 auch entrichtet. Mit der Begutachtung
wurde Geschworener Tröger beauftragt, der am 18. Mai 1866 auch vor Ort
gewesen ist.
Dem Protokoll zu dieser Lokalexpedition
zufolge waren an diesem Tage neben dem Geschworenen in Vertretung von Frau verw.
Stengel Herr Albrecht Hartmann, Bergfaktor Richter aus
Zwickau, ferner Schichtmeister Oehme und Steiger Wendler zugegen
(40169, Nr. 143, Blatt 75f). Wie es die hohe Kommission zwei Jahre
Jetzt müssen wir doch mal schauen, wo dieser Tagebau hätte zu liegen kommen sollen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch in diesem Jahr wurde in Schwarzenberg zu
Protokoll genommen, daß Faktor Richter am 24. Juli 1866 einen Großteil
des Grubenfeldes, nämlich 397.405 von 591.577 Quadratlachtern wieder losgesagt
habe ‒ darunter sicherlich auch die 1861 ganz im
Der Jahresbericht des Schichtmeisters Oehme über den Grubenbetrieb im Jahre 1866 (40169, Nr. 143, Blatt 79f) besagt dann, daß man mit 18 Mann Belegschaft im Großzechner Feld wieder einen neuen Tageschacht, und zwar 14 Lachter südwestlich vom Richterschacht und 6 Lachter tief bis auf den Glimmerschiefer, niedergebracht, auch verschiedene andere Versuchsörter getrieben hatte. Abbau ging wie im Vorjahr im Friedlich Vertrag'er Feld um, wo es 64,5 Kubiklachter waren, im Alexanderschacht'er Feld, wo man 54,5 Kubiklachter ausgehauen hatte, ferner auf der 8 Lachter- Sohle des Arnoschachtes, wo man weitere 21 Kubiklachter der Lagermasse ausgebrochen hatte, in Summe mit diesmal 140 Kubiklachtern wieder deutlich weniger, als im Vorjahr. Aus dieser Menge wurden 1.860 Fuder oder 31.620 Zentner Eisenstein gewonnen, was uns nebenbei sagt, daß das Fuder inzwischen nur noch glatt 17 Zentner wog, und für 3.720 Thaler, folglich nach wie vor zu 2 Thaler das Fuder, an die Königin Marienhütte geliefert. Den 1860 ausgebrachten, „geringen“ Braunstein hatte man wohl noch einmal durchgekuttet, denn der Bericht wies ferner einen zuvor bestehenden Vorrat von 6 Zentnern desselben aus. In diesem Jahre nun hatte man erstmals seitdem auch wieder 52 Zentner Braunstein mit ausgehalten und die 58 Zentner für 58 Thaler (respektive den Zentner für den recht guten Preis von 1 Thaler) verkaufen können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eigentlich hätte auf die nächste
Betriebsperiode von 1867 bis 1869 wieder ein Betriebsplan eingereicht werden
müssen, doch ein solcher ist in der Grubenakte nicht enthalten.
Aber der Jahresbericht des Schichtmeisters Oehme über den Betrieb im Jahr 1867 (40169, Nr. 143, Blatt 81f) berichtet uns, daß 19 Mann angelegt waren und daß man am Neuen Schacht wegen „bedeutender Wasserzugänge behindert“ war, daher das Feldort dort in 6 Lachter Teufe nur um 2 Lachter habe fortstellen können. Ebendort hatte man auch in 4 Lachter Teufe ein Ort hora 10,4 Süd angeschlagen und 13 Lachter ausgelängt, von diesem aus im Streichen des angefahrenen Lagers hora 4,4 Ost dann einen Querschlag angelegt. Auch weiterhin erwies sich der Ankauf von Friedlich Vertrag als Gewinn, denn auch in diesem Jahr erfolgte der größte Teil des Abbaus in diesem Feld, nämlich allein hier ein Aushieb von 75 Kubiklachtern. Weitere 26 Kubiklachter baute man im Alexanderschacht'er Feld ab, 12 Kubiklachter am Arnoschacht im Kästnersmaßen'er Feld und am Neuen Schacht noch einmal 4 Kubiklachter, alles in allem also diesmal 117 Kubiklachter Lagermasse. Den Tagebau scheint man noch nicht aufgenommen zu haben, denn das hätte der Schichtmeister doch gewiß erwähnt. Das Ausbringen belief sich auf 1.200 Fuder oder 20.400 Zentner Eisenstein, die für 2.720 Thaler verwertet wurden; der Verrechnungspreis mit der Königin Marienhütte ist also auf 2 Thaler, 8 Groschen pro Fuder angehoben worden. Auch Braunstein ist wieder angefallen, wovon man in diesem Jahr 504 Zentner ausgebracht und davon 424 Zentner für 424 Thaler abgesetzt werden konnte, so daß 80 Zentner in Vorrat verblieben. Über das folgende Jahr 1868 heißt es in der Jahresanzeige des Schichtmeisters (40169, Nr. 143, Blatt 83f), es waren nun 21 Mann auf Wilkauer vereinigt Feld angelegt. Mit der wieder etwas angestiegenen Belegschaft hatte man an verschiedenen Punkten insgesamt acht Versuchsörter belegt. Der Abbau wurde wie im Vorjahr in der Hauptsache im Friedlich Vertrag'er Feld auf der 8 Lachter- und 12 Lachter- Sohle (nämlich 60 Kubiklachter), im Alexanderschacht'er Feld in 10 Lachter Teufe (hier 14 Kubiklachter) und schließlich im Kästnersmaßen'er Feld am Arnoschacht in 5 Lachter und in 14 Lachter Teufe (25,5 Kubiklachter) verführt. Gegenüber dem Vorjahr ist das Aushiebvolumen mit nun 99,5 Kubiklachtern weiter abgesunken, dagegen das Ausbringen auf 1.400 Fuder oder 23.093 Zentner angestiegen ‒ man hatte wohl wieder reichhaltigere Partien angefahren. Die Angabe in der metrischen Gewichtseinheit sagt uns nebenbei auch, daß das Gewicht eines Fuders nun auf rund 16,5 Zentner weiter gesunken ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn wir die Zahlen schon haben, dann
vergleichen wir doch auch einmal kurz die Angaben zu abgebauter Feldfläche bzw.
augehauenem Lagervolumen mit der Schüttung:
*) Wenn noch keine Angabe in metrischen Einheiten vorlag, rechnen wir 1 Fuder zu 17,5 Zentner um. Im Jahr 1865 hatte man demnach
nicht nur die größte Menge ausgehauen, sondern auch die deutlich besten Partien
der Eisenstein- Lager angetroffen. Es sei noch hierzu angemerkt, daß ein
Kubiklachter acht Kubikmetern entspricht. Nehmen wir für die Lagermasse mal eine
durchschnittliche Dichte von 2,5 g/cm³ an, dann hätte ein Kubiklachter rund 20 t
Masse. Wenn man aus diesen 20 t nun im Durchschnitt 294 Zentner Erz gewinnen
kann, also mehr als 14,6 t, dann kommt man auf ein ganz anderes Verhältnis, als
im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von den 1868 ausgebrachten 1.400 Fudern hat man 1.285 Fuder für 2.856 Thaler, 24 Neugroschen (also zirka 2 Thaler, 6 Groschen und 7 Pfennige das Fuder) nach Cainsdorf geliefert, es verblieben folglich 115 Fuder als Vorrat, zu welchem nachträglich in der Anzeige eingefügt wurde, es handele sich um Mulm. Hinsichtlich des Ausbringens an Braunstein ist im Jahr 1868 eine Förderung von 291 Zentnern vom Schichtmeister ausgewiesen, hinzu kamen 80 Zentner Vorrat aus dem Vorjahr. Die in der Aufrechnung des Schichtmeisters ausgewiesenen 371 Zentner hatte man erneut zu einem guten Preis von 1 Thaler den Zentner absetzen können. Vom Tagebaubetrieb ist allerdings auch jetzt keine Rede in den Jahresberichten... Anfang 1869 trat im Königreich Sachsen dann das erste Allgemeine Berggesetz in Kraft. Damit änderten sich nicht nur die Aufgaben der Bergbehörden, auch deren Struktur wurde stark verändert, indem die Bergämter aufgelöst und durch Berginspektionen ersetzt wurden. Für unsere hier betrachtete Region war die Berginspektion Zwickau regional zuständig. Auch gab es nun Vordrucke für die Fahrbögen der Berginspektoren.Die erste offizielle Befahrung bei Wilkauer vereinigt Feld durch die neue Berginspektion (ein Name ist auf diesem Fahrjournal leider nicht genannt, aber es dürfte auch hier Berginspektor Gustav Netto gewesen sein) fand am 19. Oktober 1869 statt. Bei seiner „Befahrung der Baue im Neuschachte und Wolfschachte“ (schon wieder ein neuer Schacht, und zwar im ehemaligen Ullricker Feld) fand der Inspektor keine „bergpolizeilichen Bemerkungen“ zu machen, folglich keine Beanstandungen oder sicherheitliche Veranstaltungen für nötig, und notierte nur unter der Rubrik „sonstige Bemerkungen“, daß man im zurückliegenden Zeitraum auf der 8 Lachter- Sohle vom Wolfschacht aus einen Querschlag hora 10 Südost 27 Lachter ausgelängt und dabei „nach Durchfahrung des 3 Lachter mächtigen Quarzbrockenfels und einer 6 Lachter mächtigen, reinen Glimmerschieferparthie das Mulmlager erreicht und in den darauf stehenden Neuschacht bei 13 Lachter unter der Hängebank durchgeschlagen“ habe (40169, Nr. 143, Blatt 85).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über das folgende Jahr 1870 gibt es noch
einmal einen recht ausführlichen Bericht und weil es uns das letzte Jahr zu sein
scheint, in dem noch einmal umfänglicher Betrieb umgegangen ist, zitieren wir
die Abschrift aus der Grubenakte hier vollständig (40169, Nr. 143, Blatt 87ff):
Jahresbericht 2.) Wilkauer vereinigt Feld bei Langenberg „Bei der Grube waren durchschnittlich beschäftigt
Sa. 21 Mann, mit denen nachstehendes während dieses Betriebsjahres zur Ausführung gelangte: A.) Versuchs- und Ausrichtungsarbeiten. 1.) In 40 Lachter Entfernung vom Mundloch des Arnim Stolln hat man das schon früher, Crucis 1868, behufs Untersuchung des Gebirges du Untersuchung des Lagers in hora 3 NO. angesetzte, sowie zur Aufsuchung des Braunsteins in der Nähe des Meiers Hoffnunger Grubenfeldes bestimmte Feldort um 8 Lachter im Glimmerschiefer erlängt, womit dasselbe 34 Lachter Gesamtlänge erreicht hat. Der Betrieb wurde jedoch, da man mit dieser Länge noch nichts erreicht hat, vor der Hand sistiert. 2.) Während der Eisenstein dieser Grube bei der Königin Marienhütte nur in Stückform beliebt ist und man den klaren, wenig oder gar nicht brauchen kann, ersterer jedoch in den jetzigen Bauen in und über der Stollnsohle in nur untergeordneter Bedeutung gegen den klaren auftritt, und man wegen tieferer Lösung der Grube durch einen neuen ca. 180 Lachter langen Stollen bei der jetzigen Eisensteinconjunctur noch nicht Beschluß gefaßt hat, so ist man bestrebt, die Lebensfähigkeit der Grube durch Braunsteingewinnung zu erzielen, weßfalls man im westlichen Theile des Grubenfeldes und zwar 30 Lachter westlich vom Ulricker Schacht einen unteren Schacht 8 Lachter tief und 24 Lachter südlich von diesem einen oberen Schacht, 13 Lachter tief, beide erst in Glimmerschiefer, dann im Braunsteinlager niedergebracht. 3.) Zur Verbindung dieser beiden Schächte, behufs Wetterlösung wurde vom unteren bei 8 Lachter Teufe 27 Lachter Querschlag in hora 10 SO theils im Glimmerschiefer, theils in Mulm getrieben und bei dieser Länge der Durchschlag mit dem oberen Schacht bewirkt. B.) Abbauarbeiten a.) Eisensteingewinnung. 4.) Dieselbe erstreckte sich vorzüglich auf das Friedlich Vertrager Feld, weil in demselben der Eisenstein gewöhnlich mit Braunstein bricht und sich weniger (?) zeigt. Es wurden bei 6,8 und 10 Lachter Teufe, sowie in der Stollnsohle östlich, westlich und südlich vom Schacht, jedoch bei der größten Entfernung von 24 Lachter von demselben, ca. 81 Cubiclachter Lagermasse ausgehauen und dadurch 457 Fuder Eisenstein gewonnen. 5.) Im Alexanderschachter Feld wurden bei 10 und 14 Lachter Teufe bei 9, 18 und 21 Lachter östlicher Entfernung vom Schacht 36,5 Cubiclachter Lagermasse verhauen du dabei 170 Fuder Eisenstein erzielt. 6.) Wurden im Arno Schachter, d. h. Kästners Maßener Feld bei 5 Lachter Teufe und in der Stollnsohle, 14 bis 20 Lachter östlich und westlich vom Schacht 37 Cubiclachter Lagermasse herausgehauen und dadurch 163 Fuder Eisenstein gefördert. 7.) Hat man gegen Ende des Jahres im Großzechner Felde bei 8 Lachter Teufe im Schacht 11 Lachter in hora 4,4 NO. erlängt, kam jedoch ins Braunsteingebirge, in dem man noch 2 Lachter in genannter Richtung auffuhr. Im Ganzen hat man 792 Fuder Eisenstein gewonnen. b.) Braunsteingewinnung. 8.) Wurden im Ullricker Felde bei 6 Lachter Teufe im unteren Schacht 6,5 Lachter in hora 12 Süd im Lager und Mulm getrieben und 9.) bei 8 Lachter Teufe daselbst 6 Lachter in hora 3 NO. im Lager und 6 Lachter im Glimmerschiefer, nach Hausteins Hoffnung zu ausgelängt, theils zur Braunsteingewinnung, theils zur Untersuchung des Gebirges auf Braunstein. 10.) Wurden vom oberen Schacht bei 8 Lachter Teufe 5 Lachter Ort in Ost im Lager getrieben und 6 Cubiclachter in dieser Richtung abgebaut. 11.) hat man desgleichen bei 8 Lachter Teufe des oberen Schachtes 8 Lachter in West im Lager und altem Mann getrieben und ist auf Braunsteinschnüren von 6 Lachter in die Höhe gegangen. 12.) Im Großzechner Felde wurden bei 8 Lachter Teufe und 6 Laschter Entfernung vom Schacht 5 Lachter in hora 4 West im Braunsteinlager aufgefahren. Im Ganzen hat man 442 Centner Braunstein gewonnen. C.) Hülfsarbeiten. Im Ullricker Felde wurde über dem unteren Schacht eine solide Kaue mit eingebauter Scheidestube und verschließbaren Aufbewahrungsraum für den Braunstein hergestellt, nach dem man dieselbe von Sechs Brüder Einigkeit hierher gebracht hatte. Über dem oberen Schacht wurde die Kaue vom Hermann Schacht aufgestellt. Von den geförderten 442 Centnern Braunstein wurden 100 Centner 62% haltender Stein mit 1 Th., 2 Neugr. – pro Centner loco Grube verkauft, so daß noch 342 Centner in Vorrath geblieben. Durch die gewonnenen 792 Fuder Eisenstein konnten 13.464 Centner an die Königin Marienhütte verkauft werden, da jedoch aus im Anfang genanntem Grund nur 9.132,90 Centner im Jahre 1869 nach der Hütte zur Abfuhr gelangten, so ist dieser Vorrath auf der Grube bis zu 101.136,57 Centner angewachsen. Königin Marienhütte, den 2. April 1870 H. W. Hering.“ Nachdem Ernst Julius Richter (*1808, †1868) nach 1860 aus der Sächsischen Eisencompagnie ausgeschieden und die Betriebsleitung beim Zwickau'er Brückenberg Steinkohlenbauverein übernommen hatte, wurde dessen Funktion von Bergingenieur Carl Wilhelm Hering aus Planitz übernommen. Ab 1873 wird in dieser Funktion dann der Bergingenieur Albin (oder Alwin) Hartung sen. aus Cainsdorf in den Jahrbüchern aufgeführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berginspektor Netto befuhr im
folgenden Jahr 1871 am 8. Juli
„sämtliche Baue“, fand aber
wieder keine Veranlassung zu bergpolizeilichen Bemerkungen in seinem Fahrjournal
‒ beim Betrieb war also alles in Ordnung (40169, Nr. 143, Blatt 91f). Unter ,sonstige
Bemerkungen' hielt er nur fest:
„Nach bewirktem Abbau des Lagers in der Nähe des Hermannschachtes hat man
denselben abgeworfen und zusammenbrechen lassen.“
Na ja, so kann man's auch machen...
Auch das Fahrjournal des Inspektors vom 14. Oktober 1872 ist recht kurz. Diesmal hatte er aber die Instandsetzung der Kaue über dem Arnoschacht oder zumindest einen sicheren Verschluß desselben durch einen Schachtdeckel anzuordnen (40169, Nr. 143, Blatt 93f). Aus dem folgenden Jahr gibt es dann nur eine Aktennotiz vom 26. November 1873, worin man beim Bergamt in Freiberg festhielt, daß nach Mitteilung des Gerichtsamtes zu Scheibenberg Wilkauer vereinigt Feld nun an die Deutsche Reichs- und Continental- Eisenbahn Baugesellschaft zu Berlin verkauft worden sei (40169, Nr. 143, Rückseite Blatt 94). Diese Gesellschaft hatte die Königin Marienhütte und zugleich die ihr gehörigen Grubenfeldern übernommen. Darauf folgt eine zeitliche Lücke in der Grubenakte und erst vom 28. Juli 1875 schließt sich dann wieder die Genehmigung zur Fristhaltung für Wilkauer vereinigt Feld bis Ende 1877 an ‒ vermutlich ist in den zwei Jahren zuvor aber auch nichts anderes hier geschehen (40169, Nr. 143, Blatt 95). Die Genehmigung war bereits an den neuen Betriebsleiter A. Hartung gerichtet. Kurz vor Ablauf der Betriebsfrist reichte Herr Hartung am 29. Dezember 1877 dann erneut Antrag auf Fristhaltung in Freiberg ein. In seiner Begründung heißt es: „Die Zeitverhältnisse sind nun aber nicht der Art, daß einer Inetriebsetzung der Gruben gedacht werden kann...“ Das fand man wohl auch im Bergamt und genehmigte den Antrag am 4. Februar 1878 bis Ende 1878 (40169, Nr. 143, Blatt 96). So findet sich in der Grubenakte aus diesem Jahr auch nur noch eine Aktennotiz vom 9. Dezember 1878, daß die Eisenbahnbaugesellschaft wieder umfirmiert sei, ihren Sitz zurück nach Cainsdorf verlegt habe und die Besitzerin von Wilkauer vereinigt Feld nun wieder die Königin Marienhütte AG sei (40169, Nr. 143, Blatt 97ff). Auch am 8.Januar 1879 beantragte
Herr Hartung namens der Königin Marienhütte wieder Betriebsfrist, die am
12. März 1879 ‒ nun gleich für zwei Jahre bis Ende 1880 ‒ auch genehmigt worden
ist (40169, Nr. 143, Blatt 100). Aufgrund des eigentlich nicht stattfindenden
und sich auf Unterhaltungsarbeiten beschränkenden bergmännischen Betriebes
genehmigte man in Freiberg am 6. Dezember 1880 auch, daß der eigentlich auf der
(ebenfalls im Besitz der Königin Marienhütte befindlichen) Grube
Neusilberhoffnung zu
Dasselbe wiederholte sich mit Hartung's Antrag vom 10. Januar 1881, welcher am 1. März 1881 genehmigt wurde (40169, Nr. 143, Rückseite Blatt 101f), und nach Ablauf der Betriebsfrist erneut mit einem Antrag vom 25. Januar 1883 (40169, Nr. 143, Blatt 103). Diesmal heißt es in der Begründung, „es können einige Gruben im Laufe dieses Jahres in Belegung kommen, so ist dieß doch gegenwärtig noch nicht möglich.“ Zu diesem Zeitpunkt waren übrigens noch fünf Eisenerzgruben im Besitz der Königin Marienhütte, u. a. Neusilberhoffnung zu Pöhla. Für Wilkauer vereinigt Feld jedenfalls wurde der Antrag am 4. März 1883 und bis Ende 1884 vom Bergamt genehmigt (40169, Nr. 143, Blatt 104).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann zeigte Herr Hartung am 16. März
1885 aber doch die Wiederaufnahme von Versuchsarbeiten auf Braunstein im
Großzecher Feld an. Den Großzecher Tageschacht habe man bereits um einige Meter
verteuft, einen Querschlag angehauen und mit diesem das dortige Lager
„Braunstein führend“
angetroffen (40169, Nr. 143, Blatt 105). Gleiches liest man auch im Fahrjournal
des Berginspektors L. Menzel, welcher kurz vorher am 13. März des Jahres
auf der Grube zugegen war und die Besitzer wohl erinnert hatte, daß die
Betriebsaufnahme anzuzeigen sei. Nach seiner ,Revision untertage' hatte
der Inspektor keine bergpolizeilichen Erinnerungen zu machen und berichtete
ansonsten, man habe nach Mitteilung des Schichtmeisters Oehme den Betrieb
bereits im Oktober 1884 mit 4 Mann wieder aufgenommen und mit dem
„neuen, 17 m tiefen Schacht das Lager 1 m mächtig und schönen Braunstein führend“
gefunden, seit Ende Februar 1885 auch bereits 60 Zentner davon ausgefördert
(40169, Nr. 143, Blatt 106f).
Weil der Steiger Korb in Pöhla und somit relativ weit entfernt wohne, nun aber wieder regelmäßiger Betrieb umginge, hatte man diesem als „Kameradschaftsführer“ Herrn Albrecht Haustein beigegeben, dies aber vergessen, beim Bergamt anzuzeigen, was einigen Schriftverkehr nach sich zog (40169, Nr. 143, Blatt 108ff). Die nächste Grubenbefahrung fand am 2. November 1886 statt, worüber der damalige Berginspektions- Assistent C. Stephan berichtete, es seien zurzeit 6 Mann und der Steiger angelegt und es werde nur auf Vorrat Braunstein gefördert, weil dafür „gegenwärtig kein Absatz zu finden“ sei, inzwischen umfasse der Vorrat bereits 1.200 Zentner. Beim Betrieb lief jedoch alles in geordneten Bahnen und so waren keine bergpolizeilichen Erinnerungen zu machen (40169, Nr. 143, Blatt 112f). Bei seiner Befahrung am 9. September 1887 fand auch Berginspektor Neukirch zwei Mann angelegt und zwei Örter in Betrieb, sonst aber nichts zu erinnern (40169, Nr. 143, Blatt 114ff). Dabei fällt uns doch auf, daß hier von den früher doch regelmäßig sehr materialaufwendigen Unterhaltungsarbeiten auf dem Arminstolln keine Rede mehr ist... Am 21. Januar 1888 fand erneut eine Befahrung durch die Berginspektion Zwickau statt, diesmal durch Herrn Dr. G. Stein, über die er berichtete (40169, Nr. 143, Blatt 116f): Fahrbericht „Bei Wilkauer ver. Feld sind 2 Schächte vorhanden und zwar der Förderschacht und das sogenannte Lichtloch. Der Förderschacht dient zur regelmäßigen Fahrung, während das Lichtloch als Flucht- und Wetterweg dient. Die Schächte sind 17 m tief und es geht nur in der tiefsten Sohle Betrieb, derselbe besteht nur in Keilhauenarbeit. Es wurde im Förderschachte ein- und im Lichtloch ausgefahren. Beide Schächte sowohl als die Verbindungsstrecke sind in gutem Zustande. Ein Riß ist auf der Grube nicht vorhanden. Der Riß befindet sich in Verwahrung des Herrn Bergingenieur Hartung in Cainsdorf. Die Belegschaft besteht aus 2 Mann und dem Steigerdienstversorger, welcher die Aufsicht führt. Steiger Korb führt die Oberaufsicht und revidiert alle 14 Tage die Grube, Zwickau, den 21. Januar 1888 Dr. Gustav Stein,
Berginspektor, Auf daraufhin ergangene Bergamtsresolution hin, daß der Grubenriß „wenigstens in der Nähe der Grube den Bergbeamten zur Einsichtnahme vorzuliegen“ habe, und Nachfrage bei der Bergverwaltung der Königin Marienhütte brachte man in Erfahrung, daß der Grubenriß zwecks Nachbringung, welche bis 1880 Markscheider Reichelt oblegen hatte, nun gerade bei Markscheider Böhme läge (40169, Nr. 143, Rückseite Blatt 117ff). Auch bei seiner nächsten Befahrung am 24. Juli 1888 fand Dr. Stein die zwei Schächte und den Fluchtweg zwischen beiden in bester Ordnung vor (40169, Nr. 143, Blatt 121f). Nur fehlten an den Schächten Brandklappen, die aber in Anbetracht des kleinräumigen Betriebes „auch keinen Zweck“ hätten. Dennoch ordnete das Bergamt am 1. September 1888 die Nachrüstung an (40169, Nr. 143, Rückseite Blatt 126). Einen richtigen Jahresbericht gibt es zum Grubenbetrieb im Jahre 1888 nicht in der Akte, immerhin aber das Schreiben eines „Contr.“ Robert Schreyer, aus dem zu entnehmen ist, daß drei Mann inklusive des Steigers auf der Grube angelegt waren und daß man 24 t, 450 kg Braunstein im Wert von 1.711,50 Mark ausgefördert habe, wofür Bergkosten in Höhe von 1.523,68 Mark angefallen seien (40169, Nr. 143, Blatt 128).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 11. Juli 1889 schrieb man aus Freiberg an
Herrn Hartung, man habe Veranlassung gefunden, die Einreichung von
Betriebsplänen zu fordern. Am 6. August 1889 setzte derselbe daraufhin das
folgende Schreiben auf (40169, Nr. 143, Blatt 131):
Betriebsplan für die Grube Wilkauer vereinigt Feld zu Langenberg. „Zur Zeit ist die Grube mit zwei Mann belegt, welche, nachdem dieselben kürzlich den Schacht neu ausgezimmert hatten, die sporadisch auftretenden Braunstein Vorkommnisse zum Abbau bringen. Leider ist der Preis des Braunsteines und die Nachfrage nach demselben so gering, daß wir gezwungen sein werden, den Betrieb baldigst zu sistieren und dann nur noch die Grube im baulichen Stand erhalten wird. Cainsdorf, 6ten Aug. 1889 A. Hartung.“ Kürzer geht´s nicht... Das Schreiben wurde aber tatsächlich als Betriebsplan anerkannt und am 20. August 1889 in Freiberg genehmigt, nur mit der einen Auflage, daß eine ggf. eintretende Betriebseinstellung anzuzeigen ist (40169, Nr. 143, Rückseite Blatt 131). Die ließ aber noch auf sich warten und so führten die Berginspektions- Assistenten Hiller und Fuchs am 16. Juli 1889 wieder eine Grubenbefahrung durch, fanden dabei wieder keinen Grubenriß vor (der sich diesmal bei Markscheider Dietze in Lugau zwecks Nachbringung befände), hatten aber „im Übrigen... sonst nichts zu erinnern.“ (40169, Nr. 143, Blatt 133f) Weil zwecks Wetterführung der zweite Schachtdeckel während des Betriebes offen stehen müsse, ordnete man in Freiberg die Anbringung eines „Lattendeckels“ (also eine Art Gitterrost als Absturzsicherung) an. Herr Hartung ließ stattdessen ein Geländer anbauen, was Berginspektor Neukirch schließlich auch als zweckerfüllend befand (40169, Nr. 143, Blatt 134ff). Auch in den folgenden Jahren blieb es bei diesem geringen Betrieb und der Belegung mit 2 Mann, wie uns etwa Berginspektor Neukirch von seiner Befahrung am 5. Juni 1890 berichtete (40169, Nr. 143, Blatt 138f), sowie Herr (inzwischen Berginspektor) Stephan nach seiner Befahrung am 24. Juni 1891 (40169, Nr. 143, Blatt 141f). Am 11. Dezember 1891 wurde endlich auch der Grubenriß „an Bergamtsstelle“ vorgelegt, welcher zuletzt 1888 nachgebracht worden ist; seitdem aber auch nur „etwas Abbau“ nachzubringen sei (40169, Nr. 143, Blatt 143f). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Kontrolle durch die
Berginspektion Zwickau fand am 30. Juli 1892 und diesmal durch A. Fr. Wappler
statt. Er mußte mit dem Häuer Traugott Hermann allein anfahren, weil
Steigerdienstversorger Albrecht Haustein gerade abwesend war. In seinem
Fahrbericht notierte Inspektor Wappler, alle Grubenbaue befänden sich in
gutem Zustand, man baue pro Schicht etwa einen Zentner Braunstein ab, welcher
„in unregelmäßigen Lagern“
vorkomme und auch jetzt waren
„wesentliche Ausstellungen nicht zu machen.“
(40169, Nr. 143, Blatt 146f) Na ja, bei der Königin Marienhütte hatte man ja
auch Fachleute...
Am 29. Dezember 1892 wandte sich Herr Hartung nach Freiberg noch mit der Mitteilung, man wolle „die Gruben nach Entschließung der Direction der Königin Marienhütte AG nicht vollständig außer Betrieb (setzen), sondern... (sie sollen) mit reducirter Belegung bis auf weiteres fortgestellt“ werden (40169, Nr. 143, Blatt 148). Ein Vierteljahr später, am 12. April 1893, beantragte er dann aber dennoch wieder die Fristhaltung; zugleich solle Obersteiger Haugk aus Röttis (auch dort gab es noch eine Eisensteingrube im Besitz der Königin Marienhütte) die Aufsicht für alle in Frist stehenden Gruben übernehmen (40169, Nr. 143, Blatt 149). Letzteres genehmigte das Bergamt auch gleich am 14. April. Aus dem folgenden Befahrungsbericht der Berginspektion ‒ diesmal vom Inspektor K. G. Günther ‒ vom 3. Mai 1893 erfährt man dann, daß der Betrieb bei Wilkauer vereinigt Feld durch die Königin Marienhütte AG im März 1893 eingestellt worden ist. Neben dem Steigerdienstversorger Haustein waren bei dieser Befahrung schon Zschierlich's Bergverwalter Fröbe und der Steiger Mende zugegen und unter Punkt 7.) berichtete Herr Günther noch ganz lapidar: „Zschierlich hat die Grube mit den nicht unbeträchtlichen Braunsteinvorräten der Königin Marienhütte abgekauft.“ (40169, Nr. 143, Blatt 151f) Schau an... Was nach dem Erwerb des Feldes durch G. Zschierlich
noch hier geschehen ist, berichten wir dann in den
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konsolidationen und Neugründungen unter Gustav Zschierlich
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erwerb der Gruben bei
Langenberg ab 1872
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als nächster in der Reihe der Grubenbesitzer zu Langenberg wurde der Kaufmann Ernst Gustav Heinrich Zschierlich, bis 1875 noch als „Kaufmann in Chemnitz“ benannt, in der Region aktiv und mutete 1872 unter dem Namen „Chemnitzer Eisensteingruben“ einen ziemlichen ,Flickenteppich‘ von etlichen Grubenfeldern (40024-10, Nr. 158 und 40169, Nr. 513). Das war noch vor dem Erwerb der Geyer’schen Farbenfabrik durch Zschierlich. Die Gesamtgröße dieser 1872 gemuteten Felder umfaßte besage der dazu erhaltenen Croquis die gewaltige Fläche von 7.259.772 m² oder 1.815 Maßeinheiten (40040, Nr. C6603). War das nun schon Größenwahn oder einfach nur der Zeitgeist der Gründerzeit ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat dieser Croquis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1877 hat Gustav Zschierlich dann das Vitriolwerk zu Geyer erworben, wo er u. a. mineralische Farbpigmente für die Farbenindustrie und Anstrichfarben herstellte. Der neue Besitzer wurde unter dem 27. März 1877 im Gerichtsamt Ehrenfriedersdorf in das Handelsregister eingetragen (40169, Nr. 128, Blatt 122). In diesem Zusammenhang wohl auf die Ocker- Vorkommen in den Langenberg'er Eisenstein- und Braunsteingruben aufmerksam geworden, erwarb er hier 1874 (gemutet auch schon 1872) zuerst die alte Gnade Gottes Fundgrube und kosolidierte sie nur wenig später mit der 1886 gekauften Grube Gott segne beständig am Roten Hahn zu Gnade Gottes vereinigt Feld. Im Jahr 1882 gehörten ihm, einem Antrag um Fristhaltung an das Landesbergamt vom 2. Januar 1882 zufolge (40169, Nr. 95, Blatt 164), außerdem die Gruben:
Für die letzten beiden der hier angeführten Gruben beantragte er damals Infristhaltung. Später kam noch eine Eisensteinzeche am Beutelbach bei Beierfeld hinzu. Außerdem nannte er 1886 noch die
sein Eigen. Wie vor ihm schon Ernst Erdmann Zweigler und Johann Gottlieb Merkel war auch Herr Zschierlich kein Eigenbrötler mehr, sondern ein kapitalistischer Unternehmer, der die Zeichen der Zeit erkannt hatte und sich zu nutze machen wollte. Doch gehen wir der Reihe nach...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neben seinen längst schon mehr oder weniger intensiv
ablaufenden bergbaulichen Aktivitäten in Langenberg und Geyer beantragte
G. Zschierlich aber munter immer noch weitere Schurfberechtigungen
rund um Schwarzenberg, in Ehrenfriedersdorf, Oberscheibe, Oberwiesenthal,
Crandorf, sowie in Röttis und Jößnitz im Vogtland (siehe etwa aus dem
Bestand 40044-7 (Generalrisse, Verleihkarten) die Nummern i812, i768, i769
sowie aus dem Bestand 40024-14 (Landesbergamt, Schurfgesuche und Mutungen)
die Nummern 484, 483, 482, 491, 488, 493, 498 und 455). Beim Landesbergamt
sah man sich sogar im Jahr 1895 einmal veranlaßt, eine Übersichtskarte
über die bis dahin schon von G. Zschierlich beantragten
Schurffelder zu erstellen (40024-15 (Markscheideangelegenheiten), Nr. 17).
Obwohl wir längst nicht alle diese Berechtigungen nachverfolgt haben, sind
wir uns ziemlich sicher, daß deren Geschichte in ziemlich allen Fällen
nach Ende der Gründerzeit ganz ähnlich, wie in Langenberg, und eher
erfolglos verlaufen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrieb bei der Gnade Gottes
Fundgrube unter
G.
Zschierlich ab 1872
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bleiben wir in Langenberg: Am 17. Oktober 1872 legte
Gustav Zschierlich aus Chemnitz Mutung auf das
Grubenfeld der früheren Gnade Gottes Fundgrube ein. Bis zum 30.
März 1874 folgten dieser noch weitere 13 Nachmutungen (40169, Nr. 128, Blatt 97). Die Verleihungsurkunde des Königlichen
Landesbergamtes in Freiberg über das schließlich insgesamt beantragte Abbaufeld von
834.395 m² oder 209 Maßeinheiten unter dem Namen Gnade Gottes vereinigt
Feld wurde am 15. Februar 1875 ausgestellt. Wie folgende Zulage
der zugehörigen Croquis aus dem Jahr 1873 zeigt, schloß dieses vereinigte Feld
auch gleich noch zwei weitere, an sich nicht viel kleinere Grubenfelder
weiter südlich in sich ein, die zuvor zu den Chemnitzer
Eisensteingruben gehört haben.
Wie dazumal üblich, folgte der Verleihung am 2. März 1875 die Aufforderung des Bergamts an den neuen Besitzer nach, die von ihm bestellten Offizianten zu benennen, einen Betriebsplan einzureichen, die Unfallverhütungsvorschriften auszuhängen usw. (40169, Nr. 128, Blatt 98). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Umbildung zu
Gewerkschaften ab 1900 siehe
Digitalisat dieser Croquis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einem Fahrjournal des Berginspektors Gustav Netto von der Berginspektion Zwickau vom März 1874 über die Grube Gott segne beständig am Roten Hahn, welches in der Grubenakte von Gnade Gottes gevierter Fundgrube abgeheftet ist, ist zu entnehmen, daß er den „zufällig anwesenden Schürfer, Herrn Zschierlich aus Chemnitz“ bei seiner Befahrung der Gott segne beständig Stollnsohle angetroffen habe (40169, Nr. 128, Blatt 95f). Wahrscheinlich kannte sich Herr Netto zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht so ganz richtig im Revier aus und hat eigentlich den Sieben Brüder Stolln gemeint. Jedenfalls notierte derselbe, Herr Zschierlich beabsichtige, mit einem Ort von der Stollnsohle aus gegen Nordost auf seinem etwa 200 m entfernten und bereits 19 m tief in Brockenfels mit Braunsteinspuren abgesunkenen Schurfschacht in 27 m Teufe einzukommen. Herr Zschierlich nahm sich seines Vorhabens offenbar zunächst mit großer Energie an. Nach seiner nächsten Befahrung am 14. April 1875 berichtete Inspektor Netto jedenfalls, man sei nun angeblich bei 248 m Stollnlänge (wahrscheinlich vom Mundloch aus gemessen) mit einem 22 m tiefen Lichtloch durchschlägig geworden und habe das Flügelort in Quarzbrockenfels um weitere 100 m erlängt. Der Schurfschacht, den man anfahren wollte, sei inzwischen auf 21 m Teufe abgesenkt, aber 8 Ellen hoch abgesoffen, weswegen der Berginspektor es für angebracht hielt, Vorsichtsmaßregeln für den Durchschlag auszusprechen. Da er sein Fahrjournal erst am 4. Mai 1875 abfaßte, konnte Herr Netto darin dann schon festhalten, daß besagter Durchschlag inzwischen glücklich zuwegegebracht sei (40169, Nr. 128, Blatt 100f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 29. April 1875 teilte auch Herr Zschierlich dem Landesbergamt mit, daß er den Sieben Brüder Stolln (hier wird er explizit so benannt) weiter vorzutreiben gedenke. Der mit dem Flügelort angezielte Schurfschacht liege „auf der Halde der alten Grube Gnade Gottes.“ (40169, Nr. 128, Blatt 102) Ob man dies nun einen Betriebsplan nennen konnte, sei der Bewertung des hochwohllöblichen Bergamtes überlassen. Letzteres sandte das Schreiben jedenfalls am 7. Mai 1875 zwecks Bewertung an Inspektor Netto. Außerdem teilte Herr Zschierlich noch mit, daß ihm „die ungünstige Eisen Conjunctur“ zurzeit nicht erlaube, zwei Lager zugleich abzubauen, daß sein Obersteiger Oswald Pfeiffer zum Militär eingezogen worden sei und die Betriebsleitung daher vorläufig Friedrich August Weißflog aus Langenberg übernehmen solle. Am 4. Juni 1875 sandte Herr Netto seine Einschätzung zurück nach Freiberg, worin man lesen kann, daß er mit Zschierlich gesprochen habe und daß dieser zunächst, „inwieweit dies nicht von den Vorfahren bereits geschehen ist,“ die aufgeschlossenen Braunsteinbutzen abzubauen beabsichtige. Während Steiger Pfeiffer an der Freiberg’er Bergschule gebildet sei, erscheine ihm der Steigerdienstversorger Weißflog „nicht genügend qualifiziert“ (40169, Nr. 128, Blatt 103). Ferner berichtete Inspektor Netto noch, daß der ausgeförderte Braunstein „in einer Art Schlämmgraben vor dem Stollnmundloche aufbereitet, wozu das nöthige Wasser durch ein im Langenberger Bache bereits eingehangenes Schöpfrad gehoben werden soll, wogegen nicht viel einzuwenden seyn wird...“ Daraufhin genehmigte das Landesbergamt am 9. Juni 1875 diesen Betriebsplan und wies nur darauf hin, Herr Zschierlich solle „um die Anstellung eines qualifizierten Steigers besorgt sein“ (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 103). In seinem nächsten Fahrjournal vom 6. Juli 1875 berichtete Berginspektor Netto dann, er habe mit dem Grubenbesitzer am 5. Juni den angeblich 320 m vom Gott segne beständig Stolln (er kannte den richtigen Namen noch immer nicht) in 26,5 m Teufe erreichten Virginia Schacht befahren (40169, Nr. 128, Blatt 104f). Der Name Virginia Schacht findet sich dann auf allen Grubenrissen späterer Zeit, während die alte Gnade Gottes Fundgrube danach verschwunden ist. Weil es noch kein Zechenbuch gab, ordnete der Inspektor die Anschaffung eines solchen an und erteilte solange außerdem mündlich die Anweisung, daß der Schacht durch eine Kaue zu überbauen und das Lichtloch wenigstens durch „gut aufgenagelte Pfosten“ sicher zu verschließen sei. Über die Aufbereitung berichtete er noch, daß das Schöpfrad 10 Ellen Durchmesser habe und der Schlämmgraben „angeblich nach Anweisung eines nassauischen Bergbeamten“ gerade errichtet werde. Warum Herr Netto immer wieder „angeblich“ hinzusetze, bleibt sein Geheimnis, denn wenn er den Stolln befahren hat, hätte er ja nachmessen können... Am 13. September 1875 teilte Herr Zschierlich dem Landesbergamt mit, er habe nun als Obersteiger für seine Gruben Herrn Adolph May aus Diez in Nassau, der zuvor in Oberhausen tätig gewesen sei, angestellt (40169, Nr. 128, Blatt 107). Außerdem bat er um die Genehmigung, ein „am Wege von Langenberg nach Haide vorkommendes, mächtiges manganhaltiges Eisenerzvorkommen tagebauartig abzubauen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 6. November 1875 reichte er außerdem einen neuen Betriebsplan in Freiberg ein, in dem es heißt, er habe 15 Arbeiter auf dem Sieben Brüder Stolln angelegt (40169, Nr. 128, Blatt 109). Diese hohe Belegung erklärt, wie man in der Lage gewesen ist, das Abteufen des Schachtes und den Vortrieb des Stollnflügels gleichzeitig in diesem Umfang in so kurzer Frist voranzubringen. Vom Virginia Schacht aus wolle er nun jedenfalls Feldstrecken zur Untersuchung „der unteren Eisensteinlager“ treiben. Außerdem sollte aber auch „ein durch zwei Schürfe am ,Quarzflügel‘ auf dem Grundstück des Herrn August Graßler in Haide aufgeschlossenes, 2 bis 3 m mächtiges Lager von manganhaltigem Eisenstein, da sich dasselbe unmittelbar unter dem Rasen befinde, tagebauartig abgebaut“ werden (40024-10, Nr. 1178, abschriftlicher Auszug Blatt 3A). Unter demselben Datum gingen gleich zusammen mit dem Betriebsplan in Schwarzenberg nun noch mehrere Anzeigen Zschierlich's ein: In der ersten zeigte er an, daß sich der Grundbesitzer, Johann August Gräßler, weigere, den Tagebau zuzulassen und zur Begründung anführe, daß Ernst Zweigler ‒ inzwischen übrigens Mitglied des Scheibenberg'er Revierausschusses ‒ ihm mitgeteilt habe, daß das Lager an Braunstein zu geringhaltig und daher als grundeigen zu betrachten sei. Herr Zschierlich beantragte mit diesem Schreiben daher zunächst einen „Vereinigungstermin“ und teilte zugleich mit, er wäre bereit, für den Ankauf der Fläche bis zum Vierfachen des Bodenverkehrswertes zu bieten... (40024-10, Nr. 1178, Blatt 4) Mit einem zweiten Schreiben unter demselben Datum zeigte Herr Zschierlich an, daß sich auch der zweite, von seinen Vorhaben betroffene Grundbesitzer, Friedrich August Hartmann, weigere, weitere Schürfe zur Untersuchung der Lagerausdehnung zuzulassen (40024-10, Nr. 1178, Blatt 5). Das dritte Schreiben vom 6. November 1875 beinhaltet dann G. Zschierlich's Antrag auf Expropriation der beiden betroffen Flächen (40024-10, Nr. 1178, Blatt 6). Diesem Schreiben hatte Herr Zschierlich auch einen Auszug aus dem Menselblatt beigefügt, in dem er die beiden streitigen Flächen rot und blau markiert hatte. So etwas gab es doch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie üblich, sandte man seitens des Bergamtes diesen Plan dann am 10. November 1875 an die zuständige Berginspektion in Zwickau. Inspektor Netto hat daraufhin am 2. Dezember 1875 mit Obersteiger May die Grube befahren und berichtete in seiner Bewertung des Betriebsplanes, es sei 70 m vom Stollnmundloch des Sieben Brüder Stollns aus das Flügelort in Richtung Nordost angehauen und durch Altung getrieben, um „von den Vorfahren stehen gelassene Braunsteinreste abzubauen.“ Zwölf Meter weiter feldwärts habe man auch in westliche Richtung ausgebrochen und 48 m vom Lichtloch zurück habe man ein Steigort gegen Nordwest in Schlag genommen. Ferner habe man beim Abteufen des Virginiaschachtes zwei Brauneisensteinbutzen getroffen, die man „bei eintretendem Bedarf abbauen will.“ Jedenfalls hatte der Berginspektor gegen die angezeigten Arbeiten „nicht viel einzuwenden“ und wies nur darauf hin, daß die Zimmerung in gutem Stand zu halten sei. Hinsichtlich des beabsichtigten Tagebaus schlug Netto vor, den Besitzer anzuweisen, wenigstens 5 m Abstand zum Fahrweg und einen Böschungswinkel von höchstens 45° einzuhalten und die obere Böschung einzufrieden. Nicht zuletzt sei auch der Grubenriß nachzubringen (40169, Nr. 128, Blatt 112ff). Unter den von Netto vorgeschlagenen Auflagen wurde dieser Betriebsplan dann auch am 27. Dezember 1875 genehmigt (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 114f und Blatt 120).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Vergleich noch ein etwa gleichaltriger Ausschnitt aus den Äquidistantenkarten von Sachsen, Blatt 137: Schwarzenberg, Ausgabe vom Jahr 1876. Die Straße im Schwarzbachtal nach Schwarzenberg gab es noch nicht, stattdessen aber noch das Arsenikwerk bei Stamm Asser am Graul.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
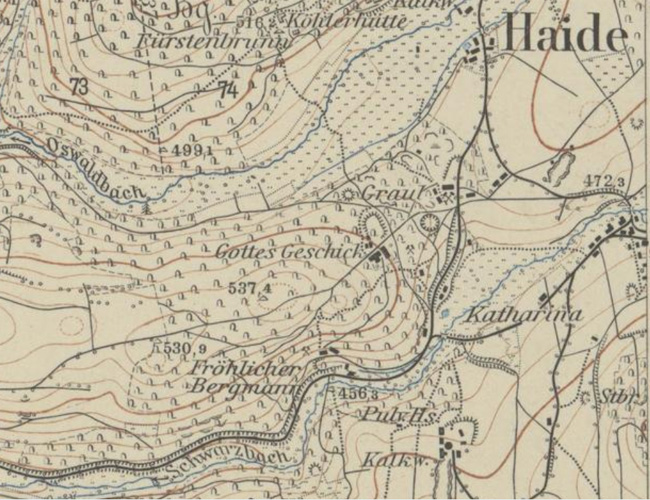 Die nächste Ausgabe dieses Kartenblattes erfolgte leider erst im Jahr 1908 und darauf ist nun an der Nordostseite der alten Grünhainer Straße ein schon ziemlich ausgedehnter Tagebau und direkt am Rand des Blattes eine neue Halde - wohl die des ersten Lichtlochs auf dem Sieben Brüder Stolln - verzeichnet. An der alten Pochwäsche von Gottes Geschick am Graul, an der neuen Talstraße gelegen - ist schon der Name Fröhlicher Bergmann zu finden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bleiben wir zunächst noch bei der Expropriationsangelegenheit. Dazu faßte man am 10. November 1875 im Bergamt erstmal den Beschluß, die Sache zu prüfen (40024-10, Nr. 1178, Blatt 8). Am 9. Dezember 1875 war Berginspektor Netto zu diesem Zweck erneut in Langenberg und berichtete anschließend, die Schürfe habe er nicht sehen können, weil nun Schnee läge und somit sei ihm keine Beurteilung des Lagers möglich (40024-10, Nr. 1178, Rückseite Blatt 11ff). Was das Lager auf Hartmann's Grund anlange, so müsse dieses mit einem Schurfschacht näher untersucht werden, „bevor man große Summen in die Erwerbung von Grund und Boden opfert.“ Sofern dieses Lager bis in dessen Sohle niedersetze, wäre es aus seiner Sicht jedenfalls zu empfehlen, es erst einmal mit einem Stollnflügel aufzusuchen und gegebenenfalls von da aus mit Überhauenbetrieb zu gewinnen, zumal dies die Grundeigentümer nicht verhindern könnten. Was den Tagebaubetrieb betreffe, so wiederholte G. Netto dazu seine Empfehlungen vom 2. Dezember 1875. Nachdem seitens des Bergamtes am 27. Dezember 1875 von G. Zschierlich genauere Risse zur Lage der in Rede stehenden Flächen gefordert und Herr Zschierlich daraufhin am 2. Januar 1876 die oben schon gezeigte ,Extractweise Copie' aus dem Grubenriß eingereicht hatte, beschloß man in Schwarzenberg am 4. Februar 1876, für den 7. März den von Zschierlich beantragten Lokaltermin anzusetzen (40024-10, Nr. 1178, Blatt 14ff). Dieser Termin fand dann auch statt, wobei neben den drei Kombattanten noch Gemeindevorstand Christian Friedrich Bach aus Waschleithe zugegen war. Aus Freiberg ist zudem kein Geringerer, als Bergamtsrat Carl Hermann Müller als Verhandlungsführer angereist. Das Protokoll ist außerdem vom Bergrat C. Freiesleben gegengezeichnet (40024-10, Nr. 1178, Blatt 24ff). Unter Herrn Müller's Vorsitz ist dann nach Vortrag zur Sache und Inaugenscheinnahme der Flächen folgender Vergleich geschlossen worden. Zum ersten wurde vereinbart, daß Herr Zschierlich die von ihm beanspruchte Fläche an der Grenze zwischen dem Gräßler'schen und Hartmann'schen Grundstück auf die mit den in der Karte nachgetragenen Punkten b, c, d und e umgrenzte Fläche verringerte. Für diese Fläche erklärte sich der Besitzer Gräßler mit einem Verkauf an G. Zschierlich zum Preis von 465,- Mark einverstanden. Zum anderen wurde von dazu berufener Seite Herr Hartmann noch einmal über die gesetzlichen Regelungen belehrt, woraufhin sich auch dieser mit einem Verkauf einverstanden erklärte. Der Kaufpreis war zu diesem Zeitpunkt noch zu ermitteln; wie wir weiter hinten im Akteninhalt fanden, sind aber dann 420,- Mark vereinbart worden. Bei den schmalen Streifen unmittelbar neben den Wegen fragt man sich aber dann schon, wie Herr Zschierlich hier eigentlich die Forderungen aus der Betriebsplanzulassung von 45° Böschungswinkel und 5 m Abstand zu den Verkehrswegen einhalten wollte...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl damit eigentlich nun eine Einigung erzielt war, ohne tatsächlich von Amts wegen eine Enteignung durchzuführen, hatte die Angelegenheit noch ein Nachspiel, denn Herr Hartmann hat sich seine Entscheidung noch einmal überlegt und am 29. April 1876 ,Recurs' (Widerspruch) ‒ und zwar beim königlich- sächsischen Justizministerium in Dresden, weil die Amtshauptmannschaft in erster Instanz auf seinen Widerspruch hin den geschlossenen Vergleich als bindend eingeschätzt hatte ‒ eingelegt (40024-10, Nr. 1178, Blatt 35ff). Aus Dresden wandte man sich daraufhin am 3. Juli 1876 an das Bergamt in Freiberg. Von dort antwortete man am 8. Juli, man trete der Auffassung des Justizministeriums bei, daß bestenfalls eine Neuverhandlung des Kaufpreises möglich, eine Klage gegen den geschlossenen Vergleich an sich aber nicht statthaft sei (40024-10, Nr. 1178, Blatt 43ff). Von Interesse sind für uns in diesem Schreiben des Bergamtes noch die Ausführungen zu dem „vom Impetranten vorgebrachten Grundeigenthum an ,erdigen Substanzen' mit zu geringem Metallgehalt.“ Dazu meinte man nämlich im Bergamt, diese Behauptung sei unrichtig, weil es sich hier nicht um Raseneisenstein handele, derber Braunstein und Manganmulm aber zu den regalen Mineralien gehörten. Wenn Herr Zschierlich nun „eisenschüssige Erde, welche zur Farbherstellung geeignet ist,“ mitgewinne, so sei dies zulässig. Dieser Auffassung folgte man auch in Dresden und wies die Kreishauptmannschaft in Zwickau an, Herrn Hartmann die abschlägige Entscheidung mitzuteilen. Damit hatte Herr Zschierlich nun also ‒ wenigstens auf den ihm nun eigentümlich gehörenden Flächen ‒ freie Bahn, auch im Tagebau Farberden abzubauen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Befahrung durch die
Berginspektion fand am
7. Dezember 1876 statt. Darüber berichtete Herr Netto, daß man das
Lichtloch auf dem Stolln bereits wieder ausgestürzt hatte und daß die
Zimmerung im Virginia Schacht so marode war, daß er deren Reparatur
angewiesen habe (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt
121).
Auch Obersteiger May suchte sich andere Aufgaben und ging Ende 1877 wieder ab. Darüber informierte Herr Zschierlich am 5. Januar 1878 das Landesbergamt und schlug zugleich vor, daß den Steigerdienst der Zimmerling Gotthold Weißflog aus Langenberg versorgen solle. Daß er keinen neuen Steiger anstellen wollte, begründete er in diesem Brief damit, daß er „den schlechten Zeitverhältnissen entsprechend, fast gar nicht arbeiten lassen konnte, mit Ausnahme der Gewinnung der zu Tage liegenden Farbenerden und des Schlämmens derselben.“ (40169, Nr. 128, Blatt 123) Das Bergamt forderte, wie üblich, am 9. Januar 1878 die zuständige Berginspektion in Zwickau zu einer Stellungnahme zu dessen Eignung als Steigerdienst- Versorger auf. Herr Netto scheint dies aber mehrfach vergessen zu haben und so blieb es vorläufig dabei... Dabei war der Berginspektor schon am 3. Juli 1878 wieder vor Ort, behufs „Besichtigung eines Tagesbruches und versuchter Stollnbefahrung“ (40169, Nr. 128, Blatt 127). Dabei fand Herr Netto den Virginia Schacht verbrochen und an dessen Stelle eine bis zu 10 m weite und ebenso tiefe Pinge vor. Er ordnete die Ausfüllung der Pinge und die Gewältigung der auf dem Stolln gefallenen Brüche an. Zumindest das erste hatte Herr Zschierlich bis zur nächsten Befahrung des Inspektors am 9. September des Jahres erledigen lassen (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 127). Nun ja, so richtig glücklich scheint dieser Fortgang der Sache nicht und die Euphorie der Gründerzeit war auch vorbei... Offenbar konnte oder wollte Herr Zschierlich auch die für das ziemlich große Grubenfeld zu entrichteten Feldsteuern in Höhe von 348,- Mark nicht bezahlen und bat daher am 30. Oktober 1878 das Bergamt um deren Erlaß. In seiner Begründung liest man: „wegen der im obern Gebirge vollständig darniederliegenden Eisen Industrie, dem sich nicht lohnenden Betrieb in Braunstein, sowie der beabsichtigten Gewältigung des Virginia Schachtes“ und der für letzteres benötigten, zusätzlichen Mittel (40169, Nr. 128, Blatt 128f). Das Landesbergamt in Freiberg trug sich aber mit Bedenken und schlug dem Antragsteller besser eine Verkleinerung seines Grubenfeldes vor. Auch die zuständige II. Abteilung im Finanzministerium in Dresden lehnte einen Erlaß ab und genehmigte am 14. November 1878 nur eine Stundung der Steuern (40169, Nr. 128, Blatt 133f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danach scheint eine Weile nur wenig
geschehen zu sein, denn erst am 10. Januar 1880 zeigte Herr Zschierlich
dann dem Bergamt in Freiberg an, er wolle bei Gnade Gottes den
Betrieb wieder aufnehmen (40169,
Nr. 128, Blatt 137).
Dazu findet sich aber kein weiterer Akteninhalt ‒ vielleicht ist also
(außer etwas Tagebaubetrieb) ‒ auch jetzt nicht viel passiert. Schließlich
zeigte Herr Zschierlich am 2. Januar 1882 erneut die Wiederaufnahme
des Betriebes an und benannte zugleich Ernst Julius Fröbe als neuen
Betriebsleiter (40169,
Nr. 128, Blatt 138).
Letzterer wurde vom Bergamt auch zugelassen.
Am 1. Juni 1883 fand wieder eine Befahrung durch die Berginspektion Zwickau statt, über welche nun der Inspektor L. Menzel in seinem Fahrjournal notierte, daß man auf dem Stolln „schwarzen, manganreichen Braunsteinmulm in abbauwürdiger Menge angefahren“ habe (40169, Nr. 128, Rückseite Blatt 139). Bei seiner nächsten Befahrung am 10. Juni 1884 fand Herr Menzel auf der Grube 2 Arbeiter und 3 Bergjungen angelegt, durch die zu dieser Zeit aber nur in dem inzwischen 8,6 m tiefen Tagebau Manganmulm abgebaut wurde (40169, Nr. 128, Blatt 140f). Die Mächtigkeit dieses Lagers sei noch nicht bekannt, jedoch größer als 5,6 m. Man beabsichtigte nun, aus dem Tagebau heraus Ortbetrieb auf dem Lager einzuleiten und einen neuen Schacht bis auf den Sieben Brüder Stolln abzusenken. Um einen Durchgschlag zu erreichen, müßte der Schacht ungefähr 32 m Teufe erreichen und das Hauptstollnort noch rund 80 m ausgelängt werden. Aus dem Fahrjournal des Berginspektors E. Th. Böhme vom 1. Mai des nächsten Jahres erfährt man, daß auch jetzt nur der Tagebau mit 3 Arbeitern betrieben werde und der geplante neue Schacht erst 7 m abgeteuft war (40169, Nr. 128, Blatt 142f). Aus derselben Zeit stammt auch der folgende, vom Betriebsleiter Fröbe gezeichnete Riß. Auch eine Meldung über ,bemerkenswerte Ereignisse' bei den Gruben im Schwarzenberg'er Revier im Jahr 1885 für die betreffende Ausgabe der Jahrbücher für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen besagt, daß in diesem Jahr „von den zum Vitriolwerk Geyer gehörigen Gruben nur Friedrich Fundgrube zu Langenberg (die besaß Herr Zschierlich inzwischen auch) und Gnade Gottes vereinigt Feld in Betriebe waren. Bei ersterer beschränkte sich der Betrieb aus den Aushieb von 46 qm Lagerfläche und bei letzterer auf die Fortsetzung des Sieben Brüder Stollns nach Nord. In dem zum Grubenfeld von Gnade Gottes vereinigt Feld gehörigen Tagebau wurde ein Schacht 7 m tief abgesunken, um einen bequemeren Förderweg zu schaffen und außerdem eine Lagerfläche von 400 qm ausgehauen.“ (40169, Nr. 95, Blatt 190)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 4. Januar 1886 zeigte Herr Fröbe
dann im Bergamt an, daß der bisherige Steigerdienst- Versorger bei
Friedrich Fdgr., Steiger Carl Wilhelm Lange, wegen Invalidität
aus dem Dienst ausscheide. Weil nun aber der Betrieb „infolge
mangelnden Absatzes äußerst beschränkt“ sei, schlug der Betriebsleiter
vor, daß diese Funktion der Zimmerling Otto Mende mit übernehmen
solle (40169,
Nr. 128, Blatt 144). Wie immer, wurde die
Berginspektion Zwickau mit einer Einschätzung beauftragt, woraufhin der
neue Inspektor G. Tittel am 22. Januar 1886 nach Freiberg
berichtete, daß neben besagtem Herrn Mende nur noch ein weiterer
Arbeiter im Gustav Schacht angelegt und alle anderen der
Zschierlich'schen Gruben in Langenberg außer Betrieb seien. Bei diesem
geringen Umfang könne man die Übertragung der Steigerfunktion an den
Zimmerling befürworten und diesem Vorschlag folgte man denn auch im
Landesbergamt (40169,
Nr. 128, Blatt 145f). Gleichartigen
Akteninhalt findet man auch in der Grubenakte von Friedrich Fdgr.
Im Jahr 1886 hatte G. Zschierlich
auch das südwestlich angrenzende Feld, welches noch den Namen der
alten Grube Gott segne beständig am
Am 6. April 1887 befuhr der Inspektor Neukirch aus Zwickau Gnade Gottes und teilte anschließend nach Freiberg mit, daß hier nur gelegentlich Betrieb im Tagebau stattfände und da die zwei Arbeiter auf der Friedrich Fundgrube (die besaß Herr Zschierlich ab 1881 auch) angelegt seien, habe er gar kleine Revision vornehmen können (40169, Nr. 128, Blatt 148). Auch nach seiner nächsten Befahrung am 14. Mai 1887 heißt es in seinem Fahrjournal, der Grubenbetrieb sei „schon seit längerer Zeit eingestellt“ und man baue nur zeitweilig im Tagebau ab (40169, Nr. 128, Blatt 149). Herr Neukirch war noch einmal am 28. Oktober auf Gnade Gottes zugegen, worüber er diesmal ausführlicher zu berichten hatte, es ginge gerade Betrieb im Tagebau um, der aber wieder eingestellt werden solle, da die ausgebrachte Förderung den diesjährigen Bedarf bereits decke. Der Abbau folge mulmigen Massen im Liegenden und Hangenden eines Quarzganges, welche als Farberde geeignet seien und 3½ Zentner dieses Rohmaterials ergäben 1 Zentner Farberde, welche dann zu 8,- Mark der Zentner verkauft werde. Außerdem traf er die bergpolizeiliche Anordnung, die Tagebaustöße abzuböschen (40169, Nr. 128, Blatt 151). Einem weiteren Fahrjournal von Inspektor Neukirch aus dem Jahr 1888 zufolge betrieb man nun die Strecken aus dem Tagebau heraus weiter, wozu neben dem Steiger 2 Mann angelegt seien. Bergpolizeiliche Erinnerungen hatte er nicht zu machen. Auch der Berginspektions- Assistent Hiller fand nach seiner Befahrung am 29. Dezember 1888 nichts zu erinnern. Man war nun mit dem Umbau der 1875 errichteten Setzwäsche im Schwarzbachtal befaßt und sonst ging kein Betrieb um (40169, Nr. 128, Blatt 159). Für seine Grube Gnade Gottes vereinigt Feld beantragte Herr Zschierlich am 3. Januar 1889 Betriebsfrist, welche ihm auch am 12. Januar genehmigt worden ist (40169, Nr. 128, Blatt 157ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrieb bei der Friedrich
Fundgrube unter G. Zschierlich ab 1881
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Gustav Zschierlich 1875 die Friedrich Fundgrube von deren damaligen Besitzer, Johann Gottlieb Merkel, schon einmal angeboten wurde, hat er sie 1881 dann tatsächlich erworben. Ein erstes Fahrjournal des damaligen
Bergamtsassessors R. Friedemann datiert auf den 21. April 1881
(40169, Nr. 95, Blatt 157f) und
berichtet uns, es seien hier 3 Mann angelegt, von denen keiner
knappschaftlich versichert gewesen ist und die Aufsicht führe ein Herr
Weisflog, der schon „seit Jahren aus der Bergknappschaftskasse...
als Invalide entlassen, von dem neuen Besitzer... als einzige Aufsicht
angelegt war.“ Den Wetterschacht hat der Inspektor unfahrbar und den
Ausbau im Förderschacht immer noch auswechslungsbedürftig vorgefunden ‒
also immer noch genau so, wie es der
Wie es inzwischen üblich war, forderte das Bergamt in Freiberg am 13. Juni 1881 von dem neuen Besitzer einen Betriebsplan und die Benennung der technischen Beamten und Offizianten (40169, Nr. 95, Blatt 159). Den Betriebsplan reichte Zschierlich unter dem 15. Juli 1881 zur Prüfung beim Bergamt ein. Darin heißt es zunächst, daß „bekanntlich bis auf zwei Schächte und einen angetriebenen Stolln alle Zugänge zu der schon ziemlich ausgebauten Fläche verbrochen“ seien. Er wolle daher nun den von Riedels Fundgrube bis zum Ferdinandschacht herangebrachten Stolln noch zirka 120 m in Richtung 95° Südost weiter bis unter den Friedrichschacht treiben, wo er dann 35 m Tiefe einbringen werde. Die Zimmerung im Friedrichschacht habe er inzwischen erneuern lassen. Dort sollte dann ein „rationeller Abbau“ eingerichtet werden (40169, Nr. 95, Blatt 162ff). Als Aufsicht stellte Zschierlich den im vorigen Abschnitt schon genannten Steiger Carl Wilhelm Lange aus Bernsbach ein, welcher zuvor auf Frisch Glück in Globenstein angelegt war. Dieser Plan wurde so auch am 9. September 1881 vom Landesbergamt zugelassen. Außerdem benannte Zschierlich am 2. Januar 1882 noch Ernst Julius Fröbe als „Bergverwalter“ und Obersteiger für die ihm bereits gehörenden Gruben und nun auch für diese (40169, Nr. 95, Blatt 164). Gleichzeitig stellte er noch den Antrag zur Verwendung von Dynamit, weil „Pulver das Gestein nicht sprenge und der Nässe wegen schwierig zu handhaben“ sei. Auch dies wurde genehmigt. Die nächste Grubenbefahrung durch die Berginspektion Zwickau fand am 29. Juni 1882 statt, worüber L. Menzel in seinem Fahrjournal berichtete, der Friedrich- und der Carlschacht stünden in Betrieb, der letztere werde als Fahrschacht genutzt (40169, Nr. 95, Blatt 174). Der Friedrichschacht sei 16 m tief, aber nicht fahrbar und diene als Wetterschacht. Weiter heißt es: „Der übrigens höchst unbedeutende Betrieb findet in 24 m Teufe auf zwei Eisensteinörtern statt, diese waren aber am Tage der Befahrung nicht belegt.“ Da ein Zechenbuch fehle, habe er mündlich angewiesen, einen verschließbaren Deckel auf dem Carlschacht einzubauen, da eine Kaue fehle. Diese Anweisung an den Besitzer wiederholte das Landesbergamt am 5. August des Jahres sicherheitshalber noch einmal schriftlich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im nächsten Journal Menzel's
über seine Befahrung der Grube und die Besichtigung der zugehörigen Wäsche
vom 10. Mai 1883 fand derselbe dann schon keine Veranlassung zu
Erinnerungen mehr und es werde gerade
eine neue Wäsche eingerichtet (40169, Nr. 95, Blatt 179f). Auch gehe jetzt bedeutenderer Betrieb um und es
waren wieder 14 Mann auf Friedrich Fundgrube angelegt. Man habe im
letzten Quartal „schöne Anbrüche von Hartmanganerz“ gefunden und „die
feinsten Teilchen des gelben Mulms werden in Gräben geschlämmt und zur
Farbenfabrikation verwendet.“ Aha: Dafür die Wäsche...
Wie uns das nächste Fahrjournal vom 17. September 1883 unter ,sonstigen Bemerkungen' noch verrät, enthalte der zur Farbenbereitung verwendete Mulm 10% bis 15% Mangansuperoxyd und habe einen Wert von zirka 50,- Mark pro Zentner ‒ den nutzte Herr Zschierlich selber. Der gewonnene Braunstein dagegen enthalte 60 bis 70% Manganoxyd und werde zurzeit für 4,- Mark pro Zentner verkauft (40169, Nr. 95, Blatt 181f). Auch das Fahrjournal Menzel's aus dem folgenden Jahr, vom 10. Juni 1884, berichtet von einem weiteren Ausbau des Betriebs: Inzwischen waren hier 22 Mann und der Steiger angelegt, darunter auch 5 Jungen, die übertage bei der Aufbereitung eingesetzt waren. Der Abbau erfolgte zum einen in Fallörtern von der 24 m- Strecke aus, wo das Lager zwischen 0,3 m und 2,5 m mächtig sei und aus bis zu 8 Trümern von je 0,1 m bis 0,2 m Stärke bestehe. Zum anderen habe man oberhalb mit Überhauen ein 2,5 m mächtiges Brauneisensteinlager angefahren. Die Ausführungen fand der Inspektor offenbar völlig in Ordnung und daher zu bergpolizeilichen Erinnerungen keine Veranlassung (40169, Nr. 95, Blatt 183f). Letzteres befand auch E. Th. Böhme von der Berginspektion Zwickau bei seiner Befahrung am 2. Juni 1885 genauso (40169, Nr. 95, Blatt 185f). Allerdings hatte der Betrieb wieder deutlich abgenommen und es waren nur noch insgesamt 9 Mann angelegt, darunter immer noch 5 Jungen übertage. „Wegen zu geringen Absatzes“ stand nur noch ein Betriebspunkt in Umgang. Den Förderschacht hatte Zschierlich bis auf 36 m verteufen lassen, wo er mit dem 220 m langen Stolln durchschlägig war. Der Inspektor nannte zwar dessen Namen nicht, aber hier kann nur vom Fernandstolln die Rede gewesen sein. Die Anfahrt erfolgte über den 16 m tiefen Fahrschacht, dann weiter über den Förderschacht. Eine Meldung über ,bemerkenswerte Ereignisse' bei den Gruben im Schwarzenberger Revier im Jahr 1885 für die betreffende Ausgabe der Jahrbücher für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen besagt, daß in diesem Jahr „von den zum Vitriolwerk Geyer gehörigen Gruben nur Friedrich Fundgrube zu Langenberg und Gnade Gottes vereinigt Feld in Betriebe waren. Bei ersterer beschränkte sich der Betrieb auf den Aushieb von 46 qm Lagerfläche...“ (40169, Nr. 95, Blatt 190) Am 4. Januar 1886 zeigte dann E. J. Fröbe im Auftrag Zschierlich's dem Bergamt an, daß der bisherige Steiger infolge Invalidität ausscheide. Aufgrund des begrenzten Betriebes bei Friedrich und Gnade Gottes Fundgrube bat er um Genehmigung, daß der Zimmerling Otto Mende auch hier den Steigerdienst versorgen dürfe (40169, Nr. 95, Blatt 187). Daraufhin wurde seitens der Berginspektion Zwickau G. Tittel nach Langenberg entsandt, welcher am 28. Januar 1886 von einer weiteren Reduzierung des Betriebes berichtete, indem auf beiden genannten Gruben in Langenberg zusammengenommen nur noch besagter Mende und ein weiterer Arbeiter angelegt waren. Der Gustavschacht und Gnade Gottes gänzlich seien zugestürzt worden und Friedrich Fundgrube stehe zurzeit außer Betrieb, weswegen der Inspektor gegen den Antrag auch keine Bedenken erhebe.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch das Fahrjournal von Berginspektor
Böhme und Assistent Stephan vom 2. November 1886 besagt, der
Betrieb habe noch denselben geringen Umfang und auf der Friedrich
Fundgrube „werden nur die nötigsten Reparaturen gemacht, um die
Grube bauhaft zu erhalten. Braunstein wurde schon seit etwa 1½ Jahren nicht mehr gefördert. (Die Baue
aber wurden) ...in gutem Zustand befunden.“
(40169, Nr. 95, Blatt 191)
Daran änderte sich auch 1887 nichts, wie eine Information von Berginspektor Neukirch aus Zwickau an das Landebergamt vom 6. April und sein Fahrjournal vom 9. September dieses Jahres besagen. Die beiden Bergarbeiter wären abwechselnd auf Friedrich Fundgrube und auf Gnade Gottes vereinigt Feld angelegt, der bergmännische Betrieb bei letzterer überhaupt gänzlich eingestellt. Dort werde nur gelegentlich Mulm im Tagebau abgebaut. (40169, Nr. 95, Blatt 193 und 194f) Herr Zschierlich bestätigte aber am 3. Januar 1888 dem Bergamt, daß er Friedrich Fundgrube in Betrieb halten wolle (40169, Nr. 95, Blatt 198). Auch in seinem Fahrjournal vom 29. Dezember 1888 konnte Inspektor Neukirch demgegenüber nichts wirklich Neues berichten (40169, Nr. 95, Blatt 199f): Abbau sei nicht umgegangen, nur habe man den im Laufe vergangenen Jahres fertiggestellten Ferdinandschacht zwischen dem Schwarzbachtal und dem Friedrichschacht mit dem letzteren durchschlägig gemacht. Die Grubenbaue befand er auch jetzt aber in ordnungsgemäßen Zustand. Für den weiteren Betrieb forderte das Bergamt in Freiberg am 11. Juli 1889 wieder einen neuen Betriebsplan vom Grubenbesitzer. Daraufhin beantragte G. Zschierlich am 13. August 1889 die Fristhaltung, was ihm am 19. August auch bis Ende 1890 genehmigt worden ist (40169, Nr. 95, Blatt 202ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Zusammenfassung aus dem Jahr
1894
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir haben in unserem Kapitel zur
Silber- und Kobaltbergbau im Scheibenberger und Oberwiesenthaler Bergrevier. „In den Gebieten des ehemaligen Klosters Grünhain und der oberen Grafschaft Hartenstein des Schönburg’schen Hauses war angeblich schon im 14.*) und 15. Jahrhundert mehrorts Bergbau im Gange, so namentlich (...) bei Elterlein, bei Waschleithe und im sogenannten Kutten, an der Winterleithe, sowie am Fürstenberge südlich von Grünhain... Hierneben war schon frühzeitig im Langenberger Thale, wo leicht gewinnbare Eisenerze und Manganerze in großer Verbreitung unter der Tagesoberfläche anstanden und andererseits bei Oberscheibe auf einem dort auftretenden Eisenerzlager (der Grube Vater Abraham) Bergbau auf Eisenstein rege geworden, welcher sich zum Theil bis in die neueste Zeit erhalten hat.“ *) An dieser Stelle verwies Herr
Müller auf H. Ermisch: Das sächsische Bergrecht des
Mittelalters, S. CXXIII, als Quelle dieser Angabe. Daß wenigstens
schon im 15. Jahrhundert auf Klostergrund Eisenhämmer in
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da wir uns hier nun nicht mit dem
Bergbau auf edle Metalle befassen, blättern wir gleich weiter bis
Seite 37, wo man dann liest über den:
Eisenstein- und Braunsteinbergbau. „Nächst der Gewinnung von Silber- und Kobalterzen hat in den vereinigten Annaberger Bergrevieren die Gewinnung von Eisenerzen (...) einen wichtigen Zweig des Bergbaubetriebes gebildet. Schon vor dem Fündigwerden des Annaberger Silberbergbaus sollen in der dortigen Umgegend einige kleine Eisenhammerwerke bestanden haben, welche in ihrer Nähe gewonnene Eisenerze... verarbeiteten, um den damals allerdings noch schwachen Eisenbedarf der umwohnenden, dünnzerstreuten ländlichen Bevölkerung zu befriedigen. So war schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts im gebiete des Klosters Grünhain lebhafter Eisensteinbergbau gangbar, für welchen der Abt des Klosters einen eigenen Bergmeister hielt und zu Elterlein und Waschleithe seine Eisenhämmer besaß (Verweis auf M. Grohmann: Das Obergebirge und seine Hauptstadt Annaberg, 1892). Als aber mit dem Aufleben des Zinn- und Silberbergbaus und mit dem Emporblühen der neuen Bergstädte in der Nachbarschaft eiserne Werkzeuge und sonstige Gegenstände für den Bergbau und für die verschiedenen Gewerbe in steigender Menge gebraucht wurden, fand sich auch Anlaß zur Erweiterung, beziehentlich zur Neugründung von Eisenhammerwerken in der waldreichen Umgegend, so zu Schmiedeberg, Schmalzgrube, Unterwiesenthal, Obermittweida, Tännigt, Gross- und Klein- Pöhla, Unter- und Ober- Rittersgrün, wie an mehreren entfernteren Orten. Um ihren Bedarf an Schmelzgut zu beschaffen, mussten die Hammerwerke auf Eröffnung von Eisensteingruben Bedacht nehmen, zu welchem Behufe sie theils selbst als Eigenlehner, theils als Gesellen oder Gewerken von Eisensteingruben, theils auch nur als Käufer von Eisenerzen auftraten. Demzufolge entstanden an mehreren verschiedenen Punkten, wo sich Eisenstein in genügender Menge fand, Eisensteingruben in großer Anzahl, so vor allem in dem Scheibenberger Bergamts – Reviere auf den Fluren von Elterlein, Schwarzbach, Waschleithe, Langenberg und Raschau, wo Eisenerze nebst Braunstein mahe unter der Tagesoberfläche in den dortigen Quarzbrockenfels- und Mulmlagern ausgebreitet lagen und eine leichte Gewinnung gestatteten. Dieser Bezirk ist auch seitdem bis in die neueste Zeit der Sitz eines mehr oder weniger lebhaften Eisenstein- und Braunsteinbergbaus geblieben, indem nicht selten gleichzeitig 10 bis 20 meist nur schwach belegte Eigenlehnergruben von geringer Ausdehnung und Tiefe gangbar waren. Abgesehen von den störenden Kriegsereignissen des 16. und 17. Jahrhunderts hatten diese Gruben infolge theils des unregelmäßigen Vorkommens der Eisenerze, theils der zeitweiligen Schwierigkeit des Absatzes derselben oft eine kurze Betriebsdauer; aber sie erfuhren im Laufe der Zeit wiederholt neue Aufnahme, zum Theil mit anderen Namen. Indessen hat dieser Bergbau, da er lediglich von dem Geschäftsgange des Eisenhüttenbetriebes in der Umgegend abhängig war, sich niemals zu einer großartigen selbstständigen Entwickelung emporzuschwingen vermocht. Die von ihm gelieferten, hauptsächlich aus Brauneisenstein, weniger aus Rotheisenstein bestehenden Erze hatten zufolge ihrer starken Vermengung mit quarzigen und thonigen Mineralien meist nur einen geringen Eisengehalt von ungefähr 25 – 40 Procent, waren aber damals wegen ihrer häufigen Beimengung von etwas Braunstein (Manganerz) und anderseits wegen gewöhnlicher Freiheit von Schwefel, sowie sehr geringen Phosphorgehaltes bei den Eisenhüttenwerken für die Gattierung mit anderen Eisenerzen sehr beliebt. Schon seit dem 18. Jahrhundert wurde der im Bereiche des Quarzbrockenfelses und Eisenmulms zugleich mit oder neben den Eisenerzen in reinen Partien einbrechende Braunstein (Psilomelan, Pyroluosit, Polianit, Wad) separat gewonnen und verwerthet und ergab bei einigen Gruben eine verhältnismäßig nicht unbedeutende Nebeneinnahme. Einzelne Gruben förderten sogar vorzugsweise oder ausschließlich Braunstein. Genauere statistische Zusammenstellungen über die Stärke des... Ausbringens der dortigen Gruben sind aber erst vom Beginn des jetzigen, 19. Jahrhunderts vorhanden.“ Anmerkung hier: „1 Fuder Eisenstein zu 25 Kubikfuß oder durchschnittlich ca. 17 Centner oder 850 kg Gewicht.“ Diese Angabe haben wir ebenfalls herausgefunden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiter kann man lesen (S. 40):
„Von den an dieser Production betheiligten 59 Gruben standen als Hauptlieferanten obenan die bei Schwarzbach gelegenen Gruben: Friedlicher Vertrag, Kästner’s neue Hoffnung und Meyers Hoffnung und die bei Langenberg gelegenen Gruben Gnade Gottes, Wilkauer vereinigt Feld und Ulrike... Daraus geht zugleich hervor, wie kleinlich und ephemer damals der Betrieb der übrigen Gruben geführt worden ist. In der folgenden jüngsten Zeitperiode ist die Mehrzahl der kleineren Gruben jener Gegend unter der Ungunst der Zeitverhältnisse eingegangen, dagegen hat sich der Betrieb in den größeren Grubenfeldern Wilkauer vereinigt Feld, Riedels Fundgrube, Friedrich Fundgrube und Gnade Gottes vereinigt Feld, sämmtlich bei Langenberg gelegen, concentrirt und eine etwas größere Erzproduction, besonders von Braunstein zu Stande gebracht... Ausser (...) Braunstein hat Gnade Gottes vereinigt Feld in den Jahren 1875 – 1890 auch 79.551 Centner Braunsteinocker (Farbenerde) im Bezahlungswerthe von 52.925 Mark producirt... Ergiebiger und nachhaltiger haben sich einige vormals auf Eisensteinlagern im Scheibenberger und Oberwiesenthaler Glimmerschiefer- und Gneissterritorium bauende Gruben erwiesen. Unter diesen steht hinsichtlich der Ausdauer die auf drei Braunsteinlagern bereits seit dem 15. Jahrhundert bauende Vater Abraham Fundgrube zu Oberscheibe obenan, welche bis in die neuere Zeit fast ununterbrochen in Betrieb gestanden und eine ziemliche Menge von Eisenstein ausgebracht hat... Nach dieser Zeit ist die Eisensteingewinnung dieser Grube zufolge der Erschöpfung der Abbaue geringer und 1862 ganz eingestellt worden. Später wurde die Grube auflässig.“ Als weitere zu dieser Zeit bedeutende Gruben werden hier noch genannt: Rother Adler Stolln bei Rittersgrün und Neue Silberhoffnung zu Pöhla, aber auch Brügners Hoffnung, Häcker, Neuglück und Eisensumpf Fdgr. an der Burkhardtsleithe. Weiter heißt es: „Im Ganzen sind aus den unter dem Bergamte Annaberg seiner Zeit vereinigten Bergrevieren in der letzten Zeitperiode von 1851 bis 1890 producirt worden circa:
Über die Nutzerträge des Eisensteinbergbaus in den verschiedenen Zeitperioden läßt sich etwas Sicheres nicht sagen, da die betreffenden Gruben größtentheils im Besitz von einzelnen oder mehreren Hammerwerken waren, welche sich den in jenen gewonnenen Eisenstein meist zu den Gestehungskosten anrechneten, sodaß der betreffende Nutzertrag erst in den Hüttenrechnungen mit zum Austrag kam... Diese Verhältnisse änderten sich indessen in der neueren Zeit zum Nachtheile der hiesigen Hammerwerke. Zuerst machte sich die seit 1816 eingetretene Beschränkung der Abgabe billiger Deputathölzer bei den mit solchen concessionirten Hammerwerken und die Nothwendigkeit, den Holzbedarf gegen höhere Preise aus Staats- und Privatforsten zu kaufen, in der Steigerung der Erzeugungskosten bemerklich. Sodann trat, besonders seit der mit der Entwickelung des deutschen Eisenbahnnetzes gesteigerten auswärtigen Concurrenz ein starker Druck auf die Preise der Eisenwaren ein. Die Hoffnung dagegen, nach der im Jahre 1858 erfolgten Vollendung der Zwickau- Schwarzenberger Eisenbahn durch die Zufuhr billiger Steinkohlen und Koks aus dem zunächst gelegenen Zwickauer Kohlenbecken dem obergebirgischen Eisenhüttenwesen einen neuen Aufschwung zu geben, hat sich indessen... nicht erfüllt, indem... für einen großartigen Hochofenbetrieb berechtigte Zweifel an der Möglichkeit der Beschaffung entsprechender Eisensteinquanten zu billigen Preisen auftauchten. Infolgedessen haben nach und nach sämmtliche ältere obererzgebirgische Eisenhammerwerke ihren Hochofenbetrieb eingestellt und zum Theil sich in Anstalten für Verarbeitung ausländischen Eisens zu verschiedenen Zwecken umgewandelt. Die war zugleich die Ursache des Erliegens vieler Eisensteingruben. Nur die im Zwickauer Kohlenbecken selbst in großem Stile mit einem Kokshohofen errichtete und 1842 in Betrieb gesetzte Königin Marienhütte zu Cainsdorf hat bis in die jüngste Zeit den Hohofenbetrieb allerdings mit Zuhilfenahme auswärtiger (besonders aus dem benachbarten Bayern) bezogener Eisensteine und unter Verwendung westphälischen Kokses fortgesetzt. Ihr ist auch der Fortbetrieb und Aufschwung der bereits oben genannten wichtigen Eisensteingruben Wilkauer vereinigt Feld, Rother Adler und Neue Silberhoffnung zu verdanken. Jedoch droht auch diesen das Schicksal des Erliegens, nachdem der einzige noch gangbare Hohofen der Königin Marienhütte der ungünstigen Zeitumstände wegen am 2. Juli 1893 ausgeblasen worden ist. Ein in der jüngsten Zeit seitens der Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Hof- Pilsen- Schwarzenberg mit der Anfang der siebziger Jahre erbauten Hohofenhütte unterhalb Schwarzenbergs unternommener Versuch, die Eisenerzeugung im Obererzgebirge neu zu beleben, ist nach kurzer Zeit des Betriebes wieder aufgegeben und 1884 gänzlich eingestellt worden. Damit sind auch einige von dieser Gesellschaft erworbene Eisensteingruben im Annaberger Bergrevier wieder zum Stillstand gekommen.“ Bei den hier noch einmal erläuterten
,Zeitverhältnissen' wird verständlich, warum auch G. Zschierlich
nach dem Ende der Gründerzeit schon keine reale Chance mehr hatte, den
eigentlich vergleichsweise geringumfänglichen Eisensteinbergbau bei
Langenberg wieder zu beleben. Obwohl er aus der Feder desselben Autoren
stammt, ist von der
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann folgt aber noch ein recht kurzer
Abschnitt:
„Die Production und Verwerthung von Braunsteinerzen hat in der Scheibenberger Revierabtheilung erst in dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts begonnen, anfänglich in geringen Mengen und zu niedrigen Verkaufspreisen – jährlich höchstens 70 bis 80 Centner zu durchschnittlich ⅓ bis ½ Thaler. Erst im jetzigen Jahrhundert sind in Folge der umfänglichen Verwendung solcher Erze zu technischen Zwecken sowohl die davon geförderten Mengen, als auch die erlangten Preise beträchtlich gestiegen, dergestalt, daß in dem Jahrzehnt 1841 – 1850 das Ausbringen schon 5.336 Centner zu durchschnittlich 0,468 Thaler = 1,404 Mark und im Jahrzehnt 1861 – 1870 die größte Menge 75.239 Centner zu durchschnittlich 2,222 Mark erreichte. In den folgenden Jahren ist die Production des reinen Braunsteins aber wieder zurückgegangen, so in dem Jahrzehnt 1881 – 1890 auf 11.080 Centner bei einem Durchschnittspreise von 2,833 Mark für den Centner. Dagegen erhob sich seit dem Jahre 1875 das Ausbringen von Braunsteinocker, einem durch Auswaschen des Braunsteinmulms erlangtem Gemenge von feinen Braunsteinpartikeln und Eisenocker, welches als Farbenerde zu dem Preise von ungefähr 0,5 Mark für den Centner Abnahme findet. Von diesem Producte sind in der Zeit von 1875 – 1890 größtentheils aus der Grube Gnade Gottes vereinigt Feld bei Langenberg im Ganzen 93.683 Centner... ausgebracht worden.“ Nun, wir wissen inzwischen, daß auch
die Gewinnung des Braunsteins in Langenberg schon wenigstens 100 Jahre
Soweit C. H. Müller's Zusammenfassung der bisherigen Bergbaugeschichte bis 1894. Schauen wir nun, was danach im Revier noch geschehen ist...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konsolidationen und
gemeinschaftlicher Betrieb unter G. Zschierlich
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inzwischen war die letzte Betriebsfrist bei Gott segne beständig abgelaufen und Inspektor M. Böhm aus Zwickau unternahm dort eine Befahrung, wobei er befand, daß Betrieb noch nicht wieder umgehe. Das Königliche Bergamt in Freiberg forderte daraufhin G. Zschierlich am 7. Mai 1888 zur Betriebsaufnahme auf (40169, Nr. 135, Blatt 113ff), woraufhin Bergverwalter Fröbe einen neuen Antrag auf Verlängerung der Fristhaltung bei Gott segne beständig einreichte. Diesen Antrag lehnte das Landesbergamt aber am 2. Juni 1888 mit der Begründung ab, es sei schon seit längerer Zeit die Absicht zur Konsolidation erklärt, diese aber noch immer nicht vollzogen worden (40169, Nr. 135, Rückseite Blatt 115). Auf den von Zschierlich selbst wiederholten Antrag hin, daß er vom Bau seiner Dynamitfabrik zu sehr in Anspruch genommen sei, nach Beendigung der Farbmulm- Förderung bei Gnade Gottes vereinigt Feld aber den Sieben Brüder Stolln wieder aufnehmen und dazu in Kürze auch einen Betriebsplan einreichen wolle, erhielt er noch eine Frist von vier Wochen zugebilligt (40169, Nr. 135, Blatt 117). Außerdem hatte Herr Fröbe bereits am 23. Januar 1888 beim Bergamt nach den Unterlagen zur früheren Wasserkunst von Gnade Gottes gefragt, die ihm (natürlich gegen Gebühr) auch zur Kenntnis gegeben worden sind (40169, Nr. 128, Blatt 153). Am 18. Juli 1888 hat G. Zschierlich dann die Konsolidation der beiden Grubenfelder von Gnade Gottes vereinigt Feld und Gott segne beständig beantragt. Die Urkunden darüber wurden allerdings aufgrund des Umfangs der Veränderungen offenbar erst nach gründlicher Vermessung und markscheiderischer Zulage am 21. bzw. 22. Mai 1890 ausgestellt (40169, Nr. 135, Blatt 127ff und 40169, Nr. 128, Blatt 167f). Demnach hatte Herr Zschierlich von
Von den im Jahr 1875 bestätigten 209 Maßeinheiten verblieben hiernach bei Gnade Gottes vereinigt Feld noch 24. Zusammen mit dem zugeschlagenen Feldteil von Gnade Gottes von 118.042 m² Fläche belief sich die neue Fläche des Grubenfeldes von Gott segne beständig dagegen nun auf 157.110 m² oder 40 Maßeinheiten. Auch seine übrigen Grubenfelder ordnete Herr Zschierlich neu: Ebenfalls am 21. Mai des Jahres 1890 Jahres beurkundete ihm das Bergamt zum einen die oben schon genannte Übertragung von 195.018 m² Feldfläche von Gnade Gottes vereinigt Feld an Friedrich Fundgrube, zum anderen eine Lossagung bei letzterer über 49.496 m² Feldfläche. Das Grubenfeld von Friedrich Fundgrube umfaßte daher nun 294.550 m² oder weitere 74 Maßeinheiten (40169, Nr. 95, Blatt 206f). Außerdem wurden ihm durch die zuständige II. Abteilung des königlichen Finanzministeriums in Dresden am 22. Dezember 1890 je die halbe Grubenfeldsteuer für 1890 und 1891 für die Friedrich Fdgr. erlassen (40169, Nr. 95, Blatt 208). Im weiteren Verlauf der Geschichte überschneiden sich nicht nur die Inhalte mehrerer Grubenakten. Wahrscheinlich hat Herr Zschierlich auch seine begrenzte Belegschaft ‒ sehr wahrscheinlich waren es immer dieselben Bergarbeiter ‒ je nach Bedarf auf den verschiedenen Gruben eingesetzt. Versuchen wir aber, so gut es geht, etwas Ordnung hineinzubringen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Akteninhalt zur Friedrich Fdgr. endet als erster mit dem Jahr 1893 ‒ beginnen wir also hier: Nach Ablauf der Betriebsfrist informierte Herr Zschierlich am 19. Februar 1891 das Bergamt, daß er den Betrieb bei Friedrich Fdgr. wieder aufnehmen und einen neuen Schacht teufen wolle (40169, Nr. 95, Blatt 210). Der am 1. März 1892 wieder zu einer Befahrung entsandte Inspektor fand aber noch alles beim Alten und noch keinen umgängigen Grubenbetrieb vor (40169, Nr. 95, Blatt 218). Die tatsächliche Lage ist etwas unklar, denn Bergverwalter Fröbe schrieb demgegenüber am 16. März 1892 an das Bergamt, das Schachtabteufen habe schon im Oktober 1891 begonnen, man habe damit 12,8 m Tiefe erreicht und dort eine Ausrichtungsstrecke 24 m ausgelängt (40169, Nr. 95, Blatt 219). Dem wiederum widerspricht aber eine Anzeige Zschierlich's vom 30. Mai 1892, in der er beantragte, daß Otto Mende weiterhin die Steigergeschäfte versorgen dürfe, weil „nur schwacher Betrieb“ umgehe, namentlich bei Friedrich Fundgrube und auf Gott segne beständig Erbstolln am Roten Hahn, wo man nur „Erdfarben nahe der Tagesoberfläche“ gewinne... (40169, Nr. 95, Blatt 221) Auch der nächste Fahrbericht von Inspektor A. Fr. Wappler vom 30. Juli diesen Jahres besagt, daß noch kein Betrieb umgehe (40169, Nr. 95, Blatt 222). Am 24. und 28. September fand der Inspektor neben Steigerdienst- Versorger Mende nur 2 Mann auf den beiden Gruben angelegt (40169, Nr. 95, Blatt 222 und 228f). Allerdings fand er nun den neuen Friedrichschacht nordöstlich vom alten Schacht gleichen Namens ordnungsgemäß in Bolzenschrot gesetzt und den letzteren ausgestürzt vor. Die Ausrichtungsstrecke hatte inzwischen 45 m Länge erreicht, der Betrieb beschränkte sich freilich auf deren Vortrieb. Einen Fluchtschacht wolle man erst bei Anfahren bauwürdiger Erzmittel absenken. Die Meldung Fröbe's vom März war deshalb wahrscheinlich die zutreffende und mit dem Verweis auf den ,schwachen Betrieb' im Mai erhoffte sich Herr Zschierlich nur eine leichtere Genehmigung seines Antrages. Jedenfalls befanden auch die Inspektoren Borchers und Wappler am 24. September 1892 die Aufsicht durch Otto Mende „bei den obwaltenden Verhältnissen genügend.“ Auf Nachfrage des Bergamtes bestätigte Bergverwalter Fröbe am 7. Februar 1893, daß unter den Zschierlich'schen Gruben zu Langenberg gegenwärtig nur bei Friedrich Fundgrube Betrieb umgehe. Am 7. März teilte dann aber Zschierlich selbst mit, daß auf Friedrich Fundgrube Wettermangel herrsche, weswegen die 3 Mann nun wieder auf Gott segne beständig bei der Farberdengewinnung beschäftigt würden (40169, Nr. 95, Blatt 234 und 2235). Oh, das alte Problem kehrte natürlich mit dem geringen Umfang des jetzigen Betriebes sofort wieder zurück... Der Fahrbericht des Berginspektions- Assistenten K. G. Günther vom 3. Mai 1893 bestätigte, daß auf Friedrich Fundgrube Wettermangel herrsche, da der Ferdinandstolln (auf dem Grubenriß von 1893 steht tatsächlich ,Fernand Stolln') noch nicht bis auf den neuen Friedrichschacht durchschlägig, auch dessen Mundloch zugesetzt und das Lichtloch vernagelt sei (40169, Nr. 95, Blatt 236). Die letzte Eintragung im Befahrungsnachweis zu gerade angeführtem Fahrbericht ‒ die wir bei der Aktendurchsicht fast übersehen hätten ‒ lautet dann: „consolidiert mit Wilkauer vereinigt Feld.“ Herr Zschierlich faßte also 1893 die in seinem Besitz befindlichen Grubenfelder zwischen Schwarzbach und Langenberg wieder neu und zu größeren Einheiten zusammen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was geschah derweil nördlich des Schwarzbachs am Roten Hahn: Am 3. Januar 1889 hat Zschierlich auch bei Gnade Gottes die Wiederaufnahme des Betriebes angezeigt (40169, Nr. 135, Blatt 120). Auf die Aufforderung hin, einen Betriebsplan einzureichen, schrieb er nur knapp zurück, der Abbau des Manganmulms solle „wie zeither fortgesetzt werden,“ wozu er aber vorsehe, etwa 30 m vom gegenwärtigen Abbau entfernt einen neuen Tageschacht von 8 m bis 10 m Teufe abzusenken (40169, Nr. 135, Blatt 123). Der hierzu vom Landesbergamt befragte Berginspektor Neukirch aus Zwickau meinte, das sei so in Ordnung, jedoch noch eine gesonderte Anzeige über das Schachtabteufen erforderlich. Diese Anzeige über das 1889 geplante Schachtabteufen hat Bergverwalter Fröbe dann doch erst 1891 eingereicht (40169, Nr. 135, Blatt 131f). Am 13. Mai 1888 waren die Berginspektions- Assistenten Hiller und Fuchs wieder zu einer Befahrung bei Gnade Gottes, über die sie in ihrem Fahrjournal festhielten, es sei nur der Tagebau am Gustav Schacht mit 3 Mann und Steiger Mende belegt. Bergpolizeiliche Erinnerungen hatten sie nicht zu machen (40169, Nr. 128, Blatt 162). Am 16. Juli 1889 waren die beiden erneut vor Ort und berichteten, man sei nun „vom Ziehschacht aus mit einem Streckenort in das etwa 2,25 m mächtige Lager hineingegangen.“ Ein zweiter Schacht sei zirka 15 m nordöstlich angesetzt. Außerdem lobten sie, die Zimmerung sei „gut und sorgfältig“ ausgeführt (40169, Nr. 128, Blatt 164). Am 6. Juni 1890 waren Herr Hiller und Inspektor Neukirch wieder vor Ort und berichteten über Gnade Gottes, der Tagebau sei „nunmehr für immer abgeworfen.“ Der Ausbau von Schacht und Strecken wurde für in Ordnung befunden, allerdings sei die Nachbringung der Grubenrisse zu bemängeln. Neben Steiger Mende war nur noch ein weiterer Arbeiter angelegt (40169, Nr. 128, Blatt 169). Wie zuvor schon bei Friedrich Fdgr. wurden am 22. Dezember 1890 auch für Gnade Gottes vereinigt Feld die halben Grubenfeldsteuern für zwei Jahre vom Finanzministerium erlassen (40169, Nr. 128, Blatt 173). Der Erlaß wurde 1892 auch noch für ein drittes Jahr verlängert (40169, Nr. 128, Blatt 181). Die nächste bergbehördliche Befahrung bei Gnade Gottes erfolgte am 24. Juni 1891 und wurde diesmal von Inspektor Stephan vorgenommen. In dessen Fahrjournal heißt es, es sei ein Feldort vom Tageschacht aus nach Süden mit 2 Mann und Steiger Mende belegt und bereits 40 m erlängt. Der Tagebau war verfüllt und der Stolln in Richtung Virginienschacht verbrochen, daher nun kein zweiter Fluchtweg mehr vorhanden. Der Schachtausbau wurde aber wieder für makellos befunden (40169, Nr. 128, Blatt 176). Ein zweites Mal war Berginspektor Stephan am 6. Oktober 1891 zu einer Befahrung bei Gott segne beständig in Langenberg und berichtete, der neue Schacht solle als Fluchtweg und Wetterschacht dienen, sei 52 m vom alten Schacht entfernt und bereits 9 m tief. Vom Schacht I (vermutlich ist der Gustavschacht I gemeint) aus werde ein Querschlag getrieben, der nunmehr 49 m erlängt sei, mithin nur noch 3 m bis zum Durchschlag fehlten. Der neue Schacht II sei in Brockenfels mit mulmigen Braunsteinnieren abgesenkt und in Bolzenschrotzimmerung gesetzt und die Kaue vom alten Schacht solle abgetragen und hier wieder aufgebaut werden (40169, Nr. 135, Blatt 131f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aufgrund des begrenzten Betriebes bei Friedrich und Gnade Gottes Fundgrube
hatte Fröbe bereits 1886 um
Genehmigung ersucht, daß der Zimmerling Otto Mende den Steigerdienst
bei Friedrich Fdgr.
versorgen dürfe (40169, Nr. 95, Blatt 187).
Weil auch bei Gnade Gottes vereinigt Feld nur geringer Betrieb
umgehe, der zudem hauptsächlich Erdfarbengewinnung nahe der Oberfläche
umfasse, zeigte Zschierlich am 30. Mai 1892 dem Bergamt in Freiberg
an, daß Mende auch hier den Betrieb leiten solle (40169, Nr. 135, Blatt 134). Daraufhin fanden am 30. Juli und am
24. September 1892 Befahrungen durch den zuständigen Inspektor Wappler
aus Zwickau statt, von denen er allerdings beide Male nur zu berichten
hatte, daß entweder gar keiner bzw. nur auf Friedrich Fundgrube
geringer Betrieb umginge (40169, Nr. 135, Blatt
136ff). Außerdem berichtete er
noch, daß der neue (Gustav ?) Schacht II
noch nicht einmal mit Fahrung ausgerüstet sei...
Am 30. Januar 1893 fragte man auch seitens des Landebergamtes beim Grubenbesitzer nach, ob denn nun bei Gott segne beständig Betrieb umgehe (40169, Nr. 135, Rückseite Blatt 142). Daraufhin teilte Bergverwalter Fröbe am 7. Februar 1893 nach Freiberg mit, daß „mit Eintritt des Frühlings wieder Farberden gewonnen werden sollen.“ (40169, Nr. 135, Rückseite Blatt 143) Das reichte dem Bergamt aber nicht aus und so wurde der Grubenleitung am 24. Februar 1893 beschieden, sie solle den Betrieb aufnehmen oder Fristhaltung beantragen, woraufhin wiederum Fröbe am 9. März 1893 antwortete, daß wegen Wettermangels auf Friedrich Fdgr. dort die Arbeiten eingeschränkt werden mußten und drei der Arbeiter nun wieder mit Farberden- Gewinnung bei Gott segne beständig beschäftigt seien (40169, Nr. 135, Blatt 144f). Vom 3. Mai 1893 gibt es noch einen weiteren Befahrungsbericht zu Gott segne beständig, diesmal aus der Feder des Berginspektions- Assistenten K. G. Günther, welcher in seinem Fahrjournal festhielt (40169, Nr. 135, Blatt 146f), es gäbe inzwischen einen Gustavschacht III, auf dem allerdings ohne jede Kaue die Haspel auf der Hängebank im Freien stehe, was natürlich nicht vorschriftsmäßig war, der Ausbau der beiden Schächte sei sonst in Ordnung. Der Gustavschacht I hingegen war bereits abgeworfen und ausgestürzt. Angelegt waren nur 2 Mann, deren Aufsicht durch Otto Mende den Umständen entsprechend genüge. Man verkaufte den gewonnenen Mulm als Farbstoff und als Zuschlag an den Schönheider Hammer. Hinsichtlich Gnade Gottes vereinigt Feld gibt der restliche Inhalt der Grubenakte ein unklares Bild: Zum einen teilte Berginspektor Wappler aus Zwickau im Januar 1892 nach Freiberg mit, die Grube läge in Fristen und Bergverwalter Fröbe äußerte sich am 7. Februar 1893 sogar dahingehend, das Grubenfeld solle losgesagt werden (40169, Nr. 128, Blatt 185ff). Zum anderen aber erklärte Gustav Zschierlich am 9. März gegenüber dem Bergamt, er wolle wieder Farberde abbauen, zumal die drei Arbeiter auf Friedrich Fdgr. wegen Wettermangels dort gerade nicht beschäftigt werden könnten. Ansonsten sei ein „Eisensteinabsatz nicht gegeben,“ weswegen er Betriebsfrist beantragen müsse ‒ was aber vielleicht für die Friedrich Fdgr. galt (40169, Nr. 128, Blatt 188). Die Genehmigung zur Infristhaltung bis Ende 1894 wurde ihm dennoch erteilt (40169, Nr. 128, Blatt 190). Da die Grube Gnade Gottes in Fristen lag, gibt es aus der Folgezeit auch keine Fahrberichte der Berginspektion in Zwickau mehr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem Ableben des Vorbesitzers,
Kaufmann Paul Förster in Berlin, hat G. Zschierlich am 20. Januar 1893 auch noch die diesem zuvor
gehörigen Gruben Gelber Zweig samt Julius
Erbstolln, Hausteins Hoffnung und
Riedels Fundgrube erworben. Nachdem Herr Zschierlich
vermutlich im März 1893 auch noch das
Am 7. Juni 1893 hat G. Zschierlich dann die Konsolidation der ihm nun gehörigen Grubenfelder von Riedels Fundgrube, Friedrich Fundgrube sowie Gnade Gottes vereinigt Feld samt Gott segne beständig Fdgr. mit Wilkauer vereinigt Feld unter dem Namen der letzteren Grube beantragt (40169, Nr. 135, Rückseite Blatt 152f). Dazu übersandte G. Zschierlich am 27. Juni 1893 Kopien der Kaufbriefe über die Friedrich Fdgr., die Riedels Fdgr., das Gnade Gottes vereinigte Feld und die Gott segne beständig Fdgr. nach Freiberg, sagte eine Reihe von Flächen los, mutete zugleich aber andere hinzu (40169, Nr. 143, Blatt 156f). Leider fehlt in der Grubenakte der diesem Schreiben beigelegte Auszug aus der Verleihkarte (40169, Nr. 143, Blatt 159ff). Durch das Landesbergamt wurde daraufhin am 30. Januar 1894 beurkundet, daß
Dies entsprach nach den seit 1851 geltenden Maßgaben einem riesigen Grubenfeld von 246 Maßeinheiten im privaten Besitz eines Geschäftsmannes. Das vereinigte Wilkauer Feld reichte allerdings jetzt nach Norden über den Schwarzbach hinaus, schloß den Roten Hahn mit ein und hatte mit dem früheren Feld nur noch den Namen gemein. Für seine Grubenfelder bekam er noch am 9. Dezember 1893 auch wieder die halbe Feldsteuer erlassen (40169, Nr. 143, Blatt 158). Bereits am 30. April 1894 beantragte G. Zschierlich aber schon die Wiederabtrennung des Grubenfeldes von Gott segne beständig Erbstolln aus diesem Feld (40169, Nr. 135, Blatt 154). So kann man die Bergbehörde auch beschäftigen... Erst am 2. Juni 1900 wurde daraufhin vom Landesbergamt in Freiberg beurkundet, daß eine Fläche von 246.393 m² oder 62 Maßeinheiten aus dem Grubenfeld von Wilkauer vereinigt Feld Fundgrube wieder ausgegliedert worden sind. Am 3. Mai 1893 war auch K. G. Günther von der Berginspektion in Zwickau auf den Grubenfeldern und notierte in seinem Fahrbericht nur kurz: „Vom Julius Erbstolln ist keine Spur mehr zu sehen. Schächte sind nicht vorhanden. Zu Erinnerungen kein Anlaß.“ (40169, Nr. 138, Blatt 151f) Über Hausteins Hoffnung heißt es: „Der Schacht ist verbrochen und unkenntlich geworden. Zu Erinnerungen kein Anlaß.“ (40169, Nr. 160, Blatt 99f) Für das Jahr 1893 wurden G. Zschierlich die Grubenfeldsteuern in Höhe von 496,80 Mark erneut zur Hälfte erlassen (40169, Nr. 160, Blatt 102). Am 27. September 1893 erhielt der neue Besitzer vom Bergamt auch gleich die Aufforderung, alle Tagesöffnungen in den losgesagten Flächen ordnungsgemäß zu verwahren und weil daraufhin nichts geschah, wurde sie am 19. Februar 1894 noch einmal wiederholt (40169, Nr. 143, Blatt 156 und Blatt 162). Zu einer Kontrolle dieshalber ausgesandt, berichtete Berginspektor Wappler dann am 29. April 1894 nach Freiberg, daß nach seiner Besichtigung der losgesagten Flächen südöstlich vom Gottes Geschick'er Grubenfeld sowie südöstlich von Hausteins Hoffnung „überhaupt keine bergbaulichen Einbaue“ mehr beständen; auch die Mundlöcher des Ulricke Stollns und des Friedrich Stollns seien längst eingeebnet (40169, Nr. 143, Blatt 165). Auch Berginspektor A. Fr. Wappler fand bei seiner Tagebesichtigung am 16. August 1894 nichts zu erinnern. In seinem Fahrbericht hielt Inspektor Wappler fest, die Friedrich'er Grubenabteilung läge schon lange still, das Großzecher Feld stehe noch so, wie es von den Vorbesitzern erkauft war und in der Abteilung Gott segne beständig seien die Gustavschächte noch nicht wieder aufgenommen worden, hier werde nur „tagebauweise etwas Farberde gewonnen,“ wofür Zschierlich „3 bis 4 Mann“ angelegt habe, über die Steiger Otto Mende die Aufsicht führe (40169, Nr. 138, Blatt 156f, 40169, Nr. 160, Blatt 104f und 40169, Nr. 143, Blatt 166).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann war aber die bestehende Betriebsfrist wieder abgelaufen und das Bergamt forderte Herrn Zschierlich am 7. Februar 1895 zur Betriebsaufnahme auf (40169, Nr. 160, Blatt 106 und 40169, Nr. 143, Blatt 167f). Der antwortete am 18. Februar mit einem neuen Antrag auf Fristhaltung bei Gelber Zweig, „da Mangel an Eisensteinabsatz vorliegt.“ (40169, Nr. 138, Blatt 158ff) Außerdem heißt es in diesem Schreiben: „Dagegen findet auf Wilkauer vereinigt Feld bei Langenberg der Betrieb auf Braunstein und Farbenerde in dem bisherigen Umfange statt.“ (Abschrift in 40169, Nr. 143, Blatt 168) So erhielt Herr Zschierlich wieder die Genehmigung zur Betriebsaussetzung. Auch wurde ihm 1896 die halbe Grubenfeldsteuer wieder erlassen (40169, Nr. 138, Blatt 167 und Nr. 160, Blatt 115). Inspektor Wappler hat die Gegend am 28. September 1895 erneut begangen, fand dabei aber wieder nichts zu erinnern ‒ was auch, es lag ja fast alles still. Herr Wappler berichtete, daß sich im Friedrich'er und Großzecher Feldteil nach wie vor nichts verändert habe, nur auf dem Gustavschacht III Betrieb umgehe. Dorthin habe man die nicht mehr benötigte Kaue vom Gustavschacht I umgesetzt, die nun als Mannschaftsstube diene. Im 10 m tiefen und 12 m mal 15 m Umfang einnehmenden, also „schachtartigen“ Tagebau habe man das Mulmlager freigelegt. Der Tagebau solle noch ausgebaut und mit dem Schacht III durchschlägig gemacht werden (40169, Nr. 138, Blatt 161f, 40169, Nr. 160, Blatt 112f und 40169, Nr. 143, Blatt 170).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevor es zu übersichtlich wurde, mutete
G. Zschierlich aber noch zwei weitere Teilflächen nach, worüber am
17. Juli 1896 in Freiberg beurkundet wurde, daß
oder 270 Maßeinheiten zugehörig waren (40169, Nr. 143, Blatt 173f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von seiner Befahrung am 21. Juli 1896
konnte Herr Wappler wieder nur berichten, daß der Betrieb im
Friedrich'er und im Großzecher Felde weiter ruhe, die Schächte aber
ordnungsgemäß verschlossen seien. Der Gustavschacht
I
in der Gott segne beständig'er Abteilung war schon verfüllt, der
Gustavschacht III
in Ordnung und gut fahrbar; aber der beabsichtigte Durchschlag in den
Tagebau noch nicht bewirkt. Dann war noch zu bemerken, daß Herr
Zschierlich vor dem Mundloch des Sieben Brüder Stollns
gemeinsam mit einem gewissen Max Mendrines aus Berlin eine
Farbenfabrik anlegen wolle. Da war doch schon
Auch im Jahr 1896 erhielt Zschierlich die halbe Grubenfeldsteuer erlassen (40169, Nr. 143, Blatt 177).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So blieb es auch bei den Gruben Gelber Zweig und Hausteins Hoffnung für die weitere Zeit: 1897 wurden die Betriebsfrist und die Steuerermäßigung wieder verlängert (40169, Nr. 138, Blatt 168ff und Nr. 160, Blatt 116). Ein einziger Fahrbericht zu diesen Gruben und aus dieser Zeit stammt aus der Feder von Berginspektor Tittel, der am 12. Juni 1900 allerdings auch nur bei Bergverwalter Fröbe gewesen ist, weil die Betriebsfrist wieder einmal abgelaufen und noch kein neuer Antrag auf Betriebsaussetzung eingegangen war. Er solle doch den Besitzer veranlassen, die Betriebsfrist zu verlängern oder die Grube loszusagen (40169, Nr. 138, Blatt 175 und Nr. 160, Blatt 123). Herr Zschierlich entschied sich für das erstere und reichte nach der Aufforderung des Bergamtes vom 11. Juli 1900 zur Betriebsaufnahme am 2. August 1900 einen Antrag auf Infristhaltung für seine Gruben Gelber Zweig und Hausteins Hoffnung ein (40169, Nr. 138, Blatt 177ff und Nr. 160, Blatt 125ff). Sie wurde auch erneut genehmigt. Dasselbe wiederholte sich noch mehrmals bis 1904 (40169, Nr. 160, Blatt 131ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damit man sich bei der Bergbehörde
nicht langweile, hatte G. Zschierlich unterdessen auch wieder eine
Nachmutung zugunsten seiner Wilkauer vereinigt Feld Fundgrube
eingereicht, zu welcher am 15. September 1897 in Freiberg beurkundet
wurde, daß
oder 332 Maßeinheiten zugehörig waren (40169, Nr. 143, Blatt 179f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bekanntlich traf im Jahr 1897 Glashütte
im Osterzgebirge gleich zweimal (zuerst am 29. und 30. April), das ganze
Erzgebirge dann nach langanhaltenden Regenfällen am 29. und 30. Juli ein
besonders schweres Hochwasser, welches auch in Langenberg zu Schäden
geführt hatte. Der Fahrbericht von Inspektor Wappler vom
9. November 1897 berichtet uns, daß
„infolge der großen Nässe“
im Gustavschacht
II
die Zimmerung gebrochen sei, der Gustavschacht
III
dagegen noch gut fahrbar war. Es war zu veranlassen, daß Schacht
II
instandgesetzt oder ein neuer
Fluchtschacht angelegt werde (40169, Nr. 143, Blatt 182ff). Im
Friedrich'er und Großzecher Feldteil war dagegen nichts geschehen.
Daraufhin zeigte Bergverwalter Fröbe mit Schreiben vom 17. November 1898 in Freiberg an, er wolle etwa 25 m südöstlich vom Gustavschacht III einen neuen ,Gustavschacht VI' etwa 12 m abteufen, welcher den beschädigten Gustavschacht II ablösen solle; außerdem solle der Gustavschacht III von 10 m auf 15 m verteuft werden. Seitens der Berginspektion wurde am 23. November die Genehmigung dazu erteilt (40169, Nr. 143, Blatt 185). Dem Fahrbericht des Berginspektors Tittel vom 7. Dezember 1898 sagt uns dann, daß dieses Projekt auch aufgenommen wurde: Bei seiner Revision fand er 3 Mann und Steiger Mende damit befaßt, den Gustavschacht VI im Geviert von 2,9 m x 0,85 m abzuteufen, womit man aber erst 2 m niedergekommen war. Den Gustavschacht II hatte man noch nicht verfüllt, Gustavschacht III aber war in Ordnung (40169, Nr. 143, Blatt 189). Außerdem erließ man auch für 1898 Herrn Zschierlich wieder die halbe Grubenfeldsteuer (40169, Nr. 143, Blatt 188). Als der Berginspektor am 16. Februar 1899 wieder in Langenberg zugegen war, mußte er erfahren, daß die kleine Belegschaft seit Neujahr auf der ‒ G. Zschierlich ja auch noch gehörenden ‒ Grube St. Christoph zu Breitenbrunn angelegt war. Der Gustavschacht II war zwar noch nicht verfüllt, aber sonst „alles gut verschlossen.“ (40169, Nr. 143, Blatt 191ff) Den Abschluß der Verfüllung des beschädigten Gustavschachts II zeigte Bergverwalter E. J. Fröbe dann am 28. März 1899 dem Bergamt an. Am 15. April war auch Herr Tittel wieder vor Ort, fand die Mannschaft im Gustavschacht III und den neuen Gustavschacht VI bei 3 m Teufe vorläufig eingestellt (40169, Nr. 143, Blatt 194f). Den letzteren fand er dann bei seiner Befahrung am 19. September 1899 bis auf 10 m Teufe im Quarzbrockenfels niedergebracht, allerdings noch nicht mit Schacht III zum Durchschlag gebracht (40169, Nr. 143, Blatt 198f). Die Verbindungsstrecke hatte man in Angriff genommen, als Berginspektor Tittel am 16. Oktober 1899 erneut zugegen war. Der Gustavschacht VI war auf 14,5 m Teufe niedergebracht, dort aber „wider Erwarten in Quarzglimmerschiefer gekommen“ (40169, Nr. 143, Blatt 203f). Aus diesem Grund beantragte Fröbe am 19. Oktober auch zum Zwecke der Auffahrung der Verbindungsstrecke die Verwendung von Dynamit, welchen man von der nur 10 Minuten entfernten Häßler'schen Niederlage holen wollte. Das Bergamt erteilte hierzu auch die Genehmigung (40169, Nr. 143, Blatt 200ff). Noch einmal war Inspektor Tittel am 2. November 1899 in Langenberg, worüber in seinem Fahrjournal zu lesen steht, daß man vom Sprengstoff noch keinen Gebrauch gemacht habe. Der Gustavschacht III war von Steiger Mende und seinen zwei Bergleuten nun auch auf 16,2 m Teufe niedergebracht, wo man den Manganmulm aber nur 0,5 m mächtig angetroffen habe. Außerdem hatten sich die Füllmassen im Gustavschacht II um 2 m gesetzt, so daß eine Nachverfüllung anzuweisen war (40169, Nr. 143, Blatt 205f). Auch für 1899 wurde übrigens wieder die halbe Feldsteuer erlassen (40169, Nr. 143, Blatt 196).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seine nächste Befahrung bei Wilkauer
vereinigt Feld Fundgrube führte Inspektor Tittel am 9. Februar
1900 durch, worüber aber nur zu berichten war, daß es keine Fortschritte
gab, nur Manganerzabbau im Gustavschacht
III
umgehe (40169, Nr. 143, Blatt 207f).
Bereits am 30. April 1894 hatte G. Zschierlich die Wiederabtrennung des Grubenfeldes von Gott segne beständig Erbstolln aus dem Feld von Wilkauer vereinigt Feld Fundgrube beantragt. Aber erst am 2. Juni 1900 wurde dann vom Landesbergamt in Freiberg beurkundet, daß
In der Abschrift ist die jetzige Grubenfeldfläche allerdings mit 1.080.216 m² oder 271 Maßeinheiten angegeben (40169, Nr. 135, Blatt 154, Abschrift in 40169, Nr. 143, Blatt 209ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 7. Juli 1900 zeigte dann
Bürgermeister Johannes Oertel, inzwischen Besitzer des
Tännichtgutes, einen Tagesbruch nahe der Straße von Langenberg nach
Schwarzbach über einem alten Stolln an (40169, Nr. 143, Blatt 213ff). Die
Berginspektion Zwickau wurde mit einer Erörterung beauftragt, über welche
am 18. Juni 1900 nach Freiberg ausführlich berichtet wurde. Dem Bericht
ist ein Ausschnitt aus der Verleihkarte beigefügt (siehe folgende
Abbildung), nach dem der Tagesbruch richtig dem Arnimstolln
zugeordnet ist. Dieser Name ist aber im Text gar nicht genannt ‒ ist ja
auch schon wieder ein paar Tage her und schon vor dem Verkauf an
Zschierlich wurde dieser nicht mehr unterhalten...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem Bericht der Berginspektion zufolge
wollte Herr Oertel sich um die Verfüllung des Tagesbruches selbst
kümmern und hierzu Haldenmassen verwenden. Danach befragt, äußerte Herr
Zschierlich dagegen zunächst keine Einwände (40169, Nr. 143, Rückseite
Blatt 218) ‒ warum auch, wenn ihm ein anderer Arbeit und Kosten abnimmt...
Inspektor Tittel mußte sich die Sache noch einmal anschauen und berichtete am 10. August 1900 nach Freiberg, daß es sich bei der infrage kommenden Halde um „noch unbewachsene Halden von Brauneisenstein, der noch verwerthbar ist,“ handele. Andere, benachbarte Halden dagegen seien als „ungangbar“ anzusehen und könnten für die Verfüllung genutzt werden (40169, Nr. 143, Blatt 229ff). Aus diesem Grund erhob nun Herr Zschierlich doch Einspruch gegen die Haldenabtragung. Sein Bergverwalter Fröbe aber war clever und stimmte der Nutzung des Haldenmaterials unter der Voraussetzung zu, daß Zschierlich danach von der Nachsorgepflicht für alle weiteren Bergschäden befreit werde (40169, Nr. 143, Blatt 231). Wie die Angelegenheit gelöst worden ist, geht aus dem Akteninhalt leider nicht hervor. Zwischendurch war Inspektor Tittel auch wieder zu normalen Grubenbefahrungen im Revier. Vom 12. Juni 1900 hatte er zu berichten, daß zusammen mit Steiger Mende nur der Bergarbeiter Groß im Tagebau beschäftigt waren, der dritte Mann war gerade zum Wehrdienst eingezogen. Untertage fand kein Betrieb statt und es war alles „sicher verwahrt.“ (40169, Nr. 143, Blatt 224) Ein letztes Mal war Herr Tittel am 15. Oktober diesen Jahres in Langenberg, fand die Verbindungsstrecke nun fertig vor und die Gustavschächte III und VI „in gutem Ausbau.“ Man baute mittels eines Streichortes den Manganmulm ab (40169, Nr. 143, Blatt 239f). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ende 1900 kam es auch auf der Südseite
des Schwarzbachs noch einmal zu bergmännischen Arbeiten. Am 14. September
1900 zeigte Bergverwalter Fröbe beim Bergamt an, daß man einen
neuen Schacht auf dem Grundstück des Bergarbeiters Weißflog in
Langenberg zur Gewinnung von Braunstein vorsehe. Die Berginspektion
Zwickau hatte hierzu keine Einwände und am 11. Januar 1901 genehmigte auch
das Bergamt in Freiberg die Schachtabsenkung (40169, Nr. 144, Blatt 1).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 2. Februar besprach sich Inspektor Tittel mit Bergverwalter Fröbe und teilte anschließend mit, daß der neue Schacht bereits 10 m niedergebracht sei. Beim Absenken habe man alte Baue durchteuft, die auf dem Grubenriß nicht eingetragen waren (40169, Nr. 144, Blatt 4f). Am 11. März 1901 hat sich Inspektor Tittel die Sache auch vor Ort angeschaut und fand in 10 m Teufe ein Ort nach Südost schon 11 m und ein zweites nach Nordost 3 m ausgelängt. Der Carlschacht II stand in Bolzenschrotausbau und war mit Haspelförderung versehen; man gewänne nun Braunstein, doch „ist selbiger gering.“ Das Lager war hier recht steil einfallend, doch ein weiteres Niedergehen mit dem Schacht des Wasserzudrangs wegen nicht möglich (40169, Nr. 144, Blatt 6f). Als Herr Tittel am 13. Mai 1901 erneut zugegen war, hatte man den Schacht zwar zuvor noch einmal bis auf 12 m Teufe weiter verteuft, dann aber im April doch wieder aufgegeben und verfüllt, weil man der Wasser nicht Herr wurde. Auf der anderen Seite des Tals, an den Gustavschächten ging kein Betrieb um (40169, Nr. 144, Rückseite Blatt 8). Am 28. Oktober 1901 erfolgte dann eine Revision der Gustavschächte, da Verwalter Fröbe mitgeteilt hatte, daß ab November hier wieder Abbau umgehen solle. Herr Tittel fand aber nichts zu bemerken (40169, Nr. 144, Blatt 14f). Das nächste Mal ist Inspektor Tittel am 24. April 1902 hier angefahren, wobei er 3 Mann mit der Förderung im Gustavschacht III befaßt vorfand (40169, Nr. 144, Blatt 18f). Auch über seine Befahrungen am 23. Februar, am 20. August und am 10. September 1903 hatte Berginspektor Tittel in Anbetracht des geringen Betriebes keinen Grund für bergpolizeiliche Bemerkungen (40169, Nr. 144, Blatt 22f, 25f und Blatt 29f). Dem Fahrjournal zufolge befuhr Herr Tittel am 8. und am 23. Oktober noch einmal die Gustavschächte III und VI, wobei er aber alles in gutem Zustand befand (40169, Nr. 144, Blatt 31f). Am 13. Oktober 1903 teilte die Berginspektion auch nach Freiberg mit, daß nur von März bis Mai des Vorjahres Betrieb auf den Gustavschächten umgegangen sei, wobei man aber die Streckenauszimmerung ertüchtigt und nur ein Ort neu getrieben habe (40169, Nr. 144, Blatt 27).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Fahrjournal vom 31. Mai 1904 fiel
noch kürzer aus: Alle Schächte waren ordentlich verschlossen und Betrieb
ging nicht um (40169, Nr. 144, Blatt 37). Am 13. September 1904 hat Herr
Tittel noch einmal die Gustavschächte und
„die wenigen offenen Strecken“
befahren. In seinem Fahrbericht liest man, der ,Kobalt- Mulm' sei
„zu geringhaltig und macht die Gewinnungskosten nicht bezahlt.“
(40169, Nr. 144, Blatt 39). Wo kommt denn nun das Kobalt her ?
Aus dem folgenden Jahr 1905 gibt es eine Befahrung der ungangbaren Halden übertage durch Berginspektor Tittel vom 8. Mai, wobei er festgestellt hatte, daß sich die Füllmassen im Alexanderschacht gesetzt haben. Für ihn bestand aber keine Veranlassung, Maßnahmen anzuordnen, weil „das umliegende Gelände infolge starker Wellung durch Halden und Senkungen der Tagesoberfläche schwer gangbar ist.“ (40169, Nr. 144, Blatt 44) Auch von seinen Befahrungen am 7. und 14. September 1905 hatte Herr Tittel nur zu berichten, daß wegen Absatzmangel für den ,Kobalt- Mulm' kein Betrieb umgehe und alles ordnungsgemäß verschlossen war. Die Halde des Ferdinandschachtes (bei Friedrich Fdgr.) hatte man, ohne beim Bergamt um Genehmigung nachzusuchen, zum Teil abgegraben und das Material zum Bau der staatlichen Straße von Schwarzenberg nach Elterlein verwendet. Am 15. Dezember 1905 hat Herr Tittel noch einmal die Gustavschächte III und VI befahren und dabei festgestellt, daß das Ausbauholz sehr trockenfaul geworden ist. Vor einer eventuellen Wiederinbetriebnahme sei der Ausbau zu erneuern (40169, Nr. 144, Blatt 46). Den Vollzug hat Herr Fröbe an das Bergamt gemeldet, wovon wiederum letzteres am 21. April 1906 auch die Berginspektion Zwickau in Kenntnis setzte (40169, Nr. 144, Blatt 47). Als ordentlicher Inspektor wollte sich auch Herr Tittel die Sache vor Ort anschauen, fand aber am 28. Juli 1906 wieder alles verschlossen vor... (40169, Nr. 144, Blatt 48) Kurz darauf muß Herr Zschierlich dann auch die Wilkauer vereinigt Feld Fundgrube in eine Gewerkschaft unter dem Namen ,Wettin' umgebildet haben, womit wir zum letzten Kapitel kommen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bildung von Gewerkschaften durch
Gustav Zschierlich
ab 1898
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginnend schon vor 1900 hat Gustav Zschierlich hinsichtlich der Betriebsstruktur Veränderungen vorgenommen
und aus seinem Alleinbesitz mehrere Gewerkschaften gebildet, als erste
wurden 1898 die Chemnitzer Eisensteingruben (die gab´s ja auch
noch, wenn auch nicht mehr viel davon übrig war) zu einer ,Gewerkschaft Fürstenberg' umgebildet.
Nach der Übergabe seiner Firma in Geyer an seinen
Sohn Walter Zschierlich im Jahr 1904 hat er dann auch die vormaligen Gruben
in Langenberg:
Nach dem Übersichtsblatt in der Akte zur Gewerkschaft St. Catharina hatte Herr Zschierlich diese als nächste und zwar am 2. Juni 1900 gebildet (40169, Nr. 136). In der Grubenakte von Hausteins Hoffnung findet man eine Aktennotiz des Bergamtes in Freiberg vom 9. Juli 1906, nach der G. Zschierlich die Gewerkschaft Rautenkranz am 28. Mai diesen Jahres gebildet habe (40169, Nr. 160, Blatt 145). Den Betriebsakten zu Wilkauer vereinigt Feld zufolge wurde auch die Gewerkschaft Wettin Mitte des Jahres 1906 gebildet (40169, Nr. 144, Blatt 50). Vorstandsvorsitzender der Gewerkschaften war er in allen Fällen zunächst einmal selbst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An dieser Stelle ‒ weil es hier in den
zeitlichen Ablauf gehört ‒ sei auch noch angemerkt, daß Gustav
Zschierlich aus Anlaß des fünfundzwanzigjährigen Bestehens seiner
Farben- und Vitriolfabrik in Geyer und des 42-jährigen Bestehens seines
Unternehmens überhaupt (er war ja zuvor schon in Chemnitz als Kaufmann
tätig) im Jahr 1901 eine Stiftung unter dem Namen
„Gustav
Zschierlich's Jubiläumsstiftung“ ins Leben gerufen hat, deren Zweck laut
Satzung (40055, Nr. 184, Blatt 3ff) die Unterstützung von hilfsbedürftigen
Erzbergleuten und deren Angehörigen gewesen ist. So schlecht können seine
Geschäfte also nicht gelaufen sein, denn Mäzenatentum muß man sich
schließlich leisten können.
Das galt allerdings nicht generell: Die Unterstützung aus seiner Stiftung sollten nur diejenigen Bergleute und deren Familien erhalten können, die zuvor auf einer seiner Gruben gearbeitet hatten und erst dann, wenn von diesen „keiner mehr da ist,“ sollten auch andere in den Genuß einer Unterstützung aus den Stiftungsmitteln kommen können. Vorschlagsberechtigt waren dann die Revierausschüsse der Reviere Geyer, Scheibenberg und Johanngeorgenstadt (mit Schwarzenberg). Herr Zschierlich verlegte den Sitz dieser Stiftung von Beginn an nach Freiberg und auch das Königlich- Sächsische Finanzministerium hat in seiner Genehmigung vom 15. August 1901 (40055, Nr. 184, Blatt 2) die Verwaltung und Kassenführung für die Stiftung der Hauptbergkasse in Freiberg übertragen. Das Stiftungskapital in Höhe von 3.000,- Mark hat Herr Zschierlich in sächsischen Staatsschuldverschreibungen angelegt, die damals mit 3% verzinst wurden. Aus den Zinsen sollten jedes Jahr drei Bedürftige in je drei Raten von 10,- Mark jeweils 30,- Mark Beihilfe erhalten. Am 29. Januar 1902 wurde in Freiberg über die ersten drei Begünstigten entschieden und die Hauptbergkasse angewiesen, die ersten Raten auszuzahlen (40055, Nr. 184, Blatt 8). Es waren
Diese drei blieben es auch für die nächsten Jahre. Aus dem Jahr 1905 ist eine Abrechnung der Hauptbergkasse erhalten, nach der seit 1901 Zinsen in Höhe von 139,38 Mark gutgeschrieben wurden, aus denen in den zurückliegenden drei Jahren oben genannte Witwen jeweils 30,- Mark erhielten, davon also in Summe 90,- Mark ausgereicht worden sind. Verwaltungsgebühren berechnete die Bergkasse der Stiftung offenbar nicht (40055, Nr. 184, Blatt 16f). Im Jahr 1907 ist Frau Weißflog verstorben, woraufhin an ihrer Stelle der Steigerwitwe Therese Schulz in Raschau die Unterstützung zugesprochen worden ist (40055, Nr. 184, Blatt 21). Diese drei Damen erhielten die Unterstützung noch bis zum Jahr 1916 (40055, Nr. 184, Blatt 23). An dieser Stelle endet der Akteninhalt. Was nach dem Ende des 1. Weltkrieges und der Abdankung des letzten Königs in Sachsen aus den Stiftungsmitteln geworden ist, ist uns zumindest noch nicht bekannt... Gustav Zschierlich und dessen Firma in Geyer ‒ nur inzwischen unter Leitung seines Sohnes Walter Zschierlich ‒ gab es ja eigentlich auch nach 1918 noch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gewerkschaft Adelma ‒ vormals
Gelber Zweig samt Julius Erbstolln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zuvor hat Gustav Zschierlich auf
die Aufforderungen zur Betriebsaufnahme nach Ablauf der Betriebsfrist vom
4. Oktober 1902 und erneut am 13. August 1903 erst gar nicht reagiert und
schließlich am 26. November 1904 einen neuen Antrag auf Fristhaltung für
Gelber Zweig und Hausteins Hoffnung eingereicht (40169, Nr. 138, Blatt
187ff). Zu diesem Zeitpunkt
hießen die Gruben jedenfalls noch so. In seiner Begründung schrieb er: „Diese
beiden Felder, die ich von Paul Förster erwarb, sind nur 2 und 6 Maßeinheiten groß und wurden immer von dem mir gehörigen Nachbarfelde Wilkauer vereinigt Feld aus, sei es auch nur durch Haldenauskutten, mit
bewirtschaftet und quasi als Zubehör zu derselben betrachtet.“ Die
Genehmigung zur Fristhaltung wurde auch am 1. Dezember 1904 erteilt (40169, Nr. 138, Blatt
193).
Außerdem zeigte Gustav Zschierlich mit oben genanntem Schreiben dem Bergamt auch die Übergabe seiner Firma, dem Vitriol- und Farbenwerk in Geyer, an seinen Sohn Walter Zschierlich an (40169, Nr. 138, Blatt 192). Darin ist sicher auch ein Grund für die Umstrukturierung seines bis dahin persönlichen Grubenfeldbesitzes in Gewerkschaften zu sehen. Wann genau die Gewerkschaft ,Adelma' gebildet wurde und wie die Kuxe verteilt wurden, haben wir noch nicht herausgefunden. Jedenfalls wurde am 15. August 1906 die Satzung derselben vom Bergamt genehmigt (40169, Nr. 138, Blatt 197). Leider ist die Satzung selber in dieser Grubenakte nicht enthalten. Weil damit aber nun formal ein neuer Besitzer hinter dem Grubenbetrieb stand, erging am 10. August 1906 die übliche Aufforderung durch das Bergamt, den Betrieb aufzunehmen, einen Betriebsplan einzureichen und die technischen Leiter zu benennen (40169, Nr. 138, Blatt 198). Daraufhin erbat Gustav Zschierlich am 19. September 1906 als Vorsitzender der Gewerkschaften Adelma und Rautenkranz zunächst einmal Kopien der Verleihkarten im Bergamt, um einen Betriebsplan erstellen zu können. Am 1. November 1906 benannte er außerdem Ernst Julius Fröbe als Betriebsleiter für alle seine neugebildeten Gewerkschaften (40169, Nr. 138, Blatt 202ff). Zu letzterem erklärte auch der dazu befragte Berginspektor Tittel aus Zwickau sein Einverständnis mit der Einschränkung, daß Herr Fröbe nur bei den von ihm auch bisher betreuten Gruben den Betrieb leiten könne, nicht aber bei den Herrn Zschierlich auch noch gehörigen Gruben in Geyer und im Vogtland. Als Betriebsleiter für die oben aufgeführten vier Gruben bei Langenberg wurde Herr Fröbe daraufhin am 15. Dezember 1906 vom Bergamt bestätigt (40169, Nr. 138, Blatt 205). Am 27. Dezember 1906 erklärte auch Herr Fröbe selbst gegenüber dem Bergamt sein Einverständnis, die Funktion zu übernehmen, da es sich ‒ außer bei Gott segne beständig, wo in den Gustavschächten Mulm gewonnen wird ‒ zumeist nur um Fristgruben handele (40169, Nr. 138, Blatt 207). Da Herr Zschierlich senior zuletzt auch die Grubenfelder mehrfach umgeformt hatte, kann man sich da schon mal irren: Das Bergamt wies den neuen Betriebsleiter am 2. Januar 1907 darauf hin, daß die Gustavschächte inzwischen im Grubenfeld von Gelber Zweig lagen (40169, Nr. 138, Rückseite Blatt 207). Außerdem benannte Herr Fröbe als Aufsicht vor Ort Franz Oskar Weißflog, was das Bergamt am 22. Januar 1907 auch genehmigte (40169, Nr. 138, Blatt 210). Nicht zuletzt reichte Gustav Zschierlich am 26. Dezember 1906 auch noch einen neuen Fristhaltungsantrag in Freiberg ein, erneut wegen des Mangels an Absatz von Eisenerz. Er hoffe aber auf zunehmende Nachfrage, wenn die Mannesmann Röhren AG in Böhmen neue Hochöfen errichte (40169, Nr. 138, Blatt 206). Die Fristhaltung für alle Grubenfelder wurde ebenfalls am 22. Januar 1907 genehmigt (40169, Nr. 138, Blatt 209).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berginspektor Tittel war am 15. April 1907 wieder in Langenberg, fand aber bei seiner Befahrung der Gustavschächte alle verschlossen vor, womit für den Moment alles in Ordnung war (40169, Nr. 138, Blatt 211). Auch nach seiner Anwesenheit am 18. September 1907 notierte er in seinem Fahrjournal: „Die Schächte waren gut verwahrt. Betrieb findet nicht statt.“ (40169, Nr. 138, Blatt 214) Im Jahr 1909 folgte ein neuer
Fristhaltungsantrag. Der Fahrbericht von Inspektor Tittel vom
17. Mai 1909 lautete wie der vom September 1907
(40169, Nr. 138, Blatt 215).
Auch am 24. November 1910 beantragte Betriebsleiter Fröbe namens
der Gewerkschaft weitere Betriebsaussetzung, zumal auf der Kiesgrube
in Geyer zusätzliche 10 Mann angelegt worden und kein geschultes Personal
zu bekommen sei (40169, Nr. 138, Blatt 218).
Dasselbe wiederholte sich auch 1912 und 1914
(40169, Nr. 138, Blatt 220ff). Betrieb ging bei
Gelber Zweig ‒ jetzt Gewerkschaft Adelma ‒ jedenfalls nicht
mehr um. Schließlich wurde 1914 aber noch ein kleiner Teil des
Grubenfeldes unter dem alten Namen der Gnade Gottes Fundgrube an
Walter Zschierlich abgetreten. Die Nachtragsurkunde zur
Feldübertragung datiert auf den 9. Juli 1914. Herr Zschierlich
junior beabsichtigte in diesem Feld weiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste Antrag auf Betriebsfrist
vom 24. Dezember 1915 ist dann schon von einem Landrat a. D. Dewitz
aus Berlin (wahrscheinlich derselbe Landrat Dr. jur. Dewitz von Woyna
auf Poggenhagen in der Provinz Hannover, der zum gleichen
Wie wir das schon bei Meyers Hoffnung gelesen haben, kam es auch hier, mitten im 1. Weltkrieg, am 11. April 1917 dann zur Rücknahme der Genehmigung zur Betriebsaussetzung durch das Bergamt (40169, Nr. 138, Blatt 234). In diesem Fall ging das Schreiben mit der Aufforderung zur Betriebsaufnahme noch an Gustav Zschierlich, der aber nun ,Rentier' war und am 16. April nach Freiberg antwortete, daß seit der Gewerkenversammlung am 19. März 1917 nun ein Karl August Zinnitz in Berlin neuer Vorsitzender der Gewerkschaft Adelma und ein Bergassessor namens Leutnant Reuther dessen Stellvertreter sei und man sich doch bitte dorthin wenden möge.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das tat man seitens des Bergamtes auch
und sandte am 8. März 1918 eine erneute Aufforderung zur Betriebsaufnahme
nach Berlin. Im Auftrag der Gewerkschaft Adelma antwortete Herr Zinnitz
am 11. März nach Freiberg, daß
der „Bergbetrieb bei Gelber Zweig in Gemeinschaft mit der Gewerkschaft
Wettin ausgeübt (wird)... Dort herrscht ein reger
Betrieb...“ und der beziehe sich auch auf das Grubenfeld von Gelber
Zweig (40169, Nr. 137, Blatt 6).
Auch Berginspektor Tittel teilte am 19. März 1918 nach Freiberg
mit, daß tatsächlich im Feld der Gewerkschaft Wettin drei neue
Versuchsschächte geteuft würden und der eine davon läge auf dem Feld von
Gelber Zweig „an der Grünhainer Straße nahe der Bachquerung.“
(40169, Nr. 137, Rückseite Blatt 6) Dabei blieb es vorerst.
Bei der Lageangabe kommen wir allerdings ins Grübeln, denn dann muß Herr Zschierlich zuvor noch weitere Veränderungen in der Grubenfeldaufteilung vorgenommen haben... Da wohl nichts weiter über den Grubenbetrieb zu erfahren war, erging am 29. Januar 1919 eine neue Aufforderung zur Betriebsaufnahme durch das Bergamt. Daraufhin schrieb ein Dr. jur. Werner Arendt als stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft aus Berlin nach Freiberg, er müsse um Aufschub bitten, da sich der Vorsitzende ‒ nunmehr ein Wilhelm Mendel ‒ im „vom Feind besetzten Gebiet aufhält“ und nicht nach Berlin kommen könne (40169, Nr. 137, Blatt 10). Der Aufschub wurde auch bis August des Jahres gewährt. Am 1. März 1919 teilte Herr Arendt dann aber nach Freiberg mit, er habe den Bergdirektor Heinrich Keiner aus Breitenbrunn zur Betriebsaufnahme bevollmächtigt (40169, Nr. 137, Blatt 13). Der letztere wiederum teilte am 8. März 1919 nach Freiberg mit, daß sich der Betrieb der Gewerkschaft Wettin mit einem „Aufschlußschacht XIII“ ‒ vermutlich noch derselbe, wie schon im Jahr 1918 ‒ bereits im Feld von Gelber Zweig bewege, womit die Betriebsaufnahme erfolgt sei, was er hiermit nachträglich anzeigen wolle (40169, Nr. 137, Blatt 17). Damit gab man sich in Freiberg wieder für einige Zeit zufrieden. Am 16. Mai 1920 erfolgte erneut eine Aufforderung zur Betriebsaufnahme. Diesmal schrieb Herr Keiner am 14. Juni 1920 nach Freiberg zurück, daß „kleinere Arbeiten, wie der Abtransport der in letzter Zeit aufgestapelten Eisenerze“ ‒ etwas Erz scheint man demnach bei den Untersuchungsarbeiten ausgebracht zu haben ‒ immer erfolgt seien und daß es aber „gegenwärtig wegen der Feldbestellung und Arbeitermangel unmöglich ist, neue Schächte zu teufen.“ Deswegen müsse er Betriebsaussetzung beantragen (40169, Nr. 137, Blatt 24). Die wurde auch am 17. Juni vom Bergamt genehmigt. Der Vorgang wiederholte sich nun bis 1923 noch mehrfach, nur war im Antrag Keiner's vom 30. Juli 1921 dann wieder Absatzmangel daran schuld, daß ein Betrieb ohne Zuschüsse nicht möglich sei (40169, Nr. 137, Blatt 26ff). Am 9. April 1923 wandte sich dann der Gemeindevorstand Rötsch an das Bergamt und informierte es, daß Herr Keiner unbekannt verzogen sei, sich der Wilhelmschacht „unweit eines öffentlichen Weges und Sportplatzes in einem lebensgefährlichen Zustand befindet“ und erbat eine Inspektion und dessen ordnungsgemäße Verwahrung (40169, Nr. 137, Blatt 32). Der daraufhin dort hin gesandte Berginspektor Bachmann aus Zwickau berichtete am 23. April 1923 nach Freiberg, daß alles den Tatsachen entspreche und der Schacht vorläufig durch den Grundbesitzer abgesperrt werde. Auch sei ein vereinbarter Grundzins von 50,- Mark pro Jahr nur einmal durch den Obersteiger Hunger im Jahr des Abteufens des Schachtes ‒ also 1919 ‒ überbracht worden und stehe seitdem aus (40169, Nr. 137, Rückseite Blatt 32).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie wir aus dem nachfolgenden
Schriftverkehr erfahren, hat 1923 der Besitzer der Kuxe der Gewerkschaft
Adelma erneut gewechselt. Deren noch stellvertretender Vorsitzender
Arendt aus Berlin nämlich teilte nach Freiberg mit, daß sie nun in den
Besitz einer Bergbau AG Fichtelgold mit Sitz in Bayreuth
übergegangen seien und man sich bezüglich der Kosten für die
Schachtverfüllung doch dorthin wenden solle (40169, Nr. 137, Blatt 33).
Diese Gesellschaft baute ausweislich des folgenden Akteninhalts an
mehreren Standorten, namentlich aber in Brandholz bei Goldmühl in
Oberfranken und in Hußdorf bei Lähm in Schlesien, goldhaltige Kieserze mit
einem Goldgehalt bis zu 0,0006% (was ungefähr 360 g in 60 t Pocherz entsprach) ab.
Allerdings hatte man technische Probleme mit der Aufbereitung. Die Kuxe
der Gewerkschaft Adelma hatte die Bergbau AG bereits 1922 über ein
Bankhaus L. Wittmann & Co. in Stuttgart erworben. Ob man sich in
deren Grubenfeld neue Aufschlüsse von Kieslagern erhoffte, wie sie etwa
bei Stamm Asser am Graul vorkamen, bleibt ihr Geheimnis.
Die Bergbau AG Fichtelgold wurde daraufhin jedenfalls am 5. Mai 1923 vom Bergamt in Freiberg mit der Verwahrung des Schachtes in Langenberg aufgefordert und benannte am 9. Mai des Jahres zunächst einmal den Bergdirektor a. D. Stohn aus Freiberg als ihren Bevollmächtigten (40169, Nr. 137, Blatt 34). Auf den 15. Mai datiert dann eine Aktennotiz in der Grubenakte, daß derselbe „das erforderliche angeordnet“ habe und daß die Verwahrung des Wilhelmschachtes nach Pfingsten erledigt gewesen ist. Auf die Aufforderung zur Betriebsaufnahme an die neuen Besitzer vom 26. Juni 1924 hin reichte nun ein Herr Dr. Favreau als neuer Vorsitzender der Gewerkschaft aus Bayreuth „wegen der allgemeinen Finanznot“ am 9. Juli 1924 einen neuen Fristhaltungsantrag ein (40169, Nr. 137, Blatt 36ff), der auch genehmigt worden ist. Weil aber in Langenberg auch weiter nichts geschah, folgte am 8. Januar 1925 die nächste Aufforderung zur Betriebsaufnahme, woraufhin am 2. Februar 1925 erneut Betriebsaussetzung beantragt wurde, diesmal mit der Begründung der hohen Kosten für die Beseitigung der Folgen eines schweren Wassereinbruchs in ihrem Bergwerk Brandholz (40169, Nr. 137, Blatt 44ff). Auch dieser Antrag wurde noch einmal genehmigt. Dann aber muß es schon nach der ersten Verlängerung der Betriebsaussetzung zu einer Entziehung des Bergbaurechtes gekommen sein, die am 2. Dezember 1925 rechtskräftig geworden ist (40169, Nr. 137, Blatt 51). Am 19. Januar 1926 wurde die Bergbau AG daraufhin zur Verwahrung ihrer Schächte sowie zur Nachbringung der Grubenrisse aufgefordert, woraufhin man allerdings aus Bayreuth antwortete, daß man seit der Übernahme des Bergbaufeldes im Jahr 1922 hier „gar nichts unternommen habe, folglich auch keine Risse nachzubringen sind.“ (40169, Nr. 137, Blatt 54ff) Weil man seitens des Bergamtes in Freiberg wohl auf der Übergabe der Grubenrisse insistierte, schrieb man am 16. April 1926 außerdem, man habe nie Grubenrisse besessen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einige Seiten weiter in der Grubenakte
erfährt man dann auch, daß das Grubenfeld von Gelber Zweig samt Julius
Erbstolln nach der Entziehung des Bergbaurechtes „zufolge
Zuschlags“ an den sächsischen Staat, vertreten durch das
Finanzministerium, übertragen worden ist. Das letztere wiederum teilte
dann am 10. Mai 1927 nach Freiberg mit, man „will den Betrieb in dem
erworbenen Bergbaurechte... zunächst aussetzen. Das Oberbergamt wolle
die... erforderliche Entschließung fassen.“ (40169, Nr. 137, Blatt 65)
Dieser Aufforderung der übergeordneten
Dienststelle hat man im Oberbergamt natürlich auch Folge geleistet.
Außerdem findet sich in der Akte noch eine Nachtragsurkunde vom 27. März 1930, besage derer das Bergbaurecht im Grubenfeld nun auf alle Metalle, also auch Gold und Silber, erweitert worden sei (40169, Nr. 137, Blatt 69). Schau an: Etwas hat die Fichtelgold AG also doch hier bewirkt... Ansonsten aber fanden auch unter der Rigide des Staatsfiskus hier keine praktischen Arbeiten mehr statt. Von 1928 bis 1938 wiederholten sich Fristhaltungsanträge, die natürlich auch sämtlich genehmigt worden sind ‒ zuletzt bis 1940 (40169, Nr. 137, Blatt 67ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gewerkschaft St. Catharina ‒
vormals Gott segne beständig
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berginspektor Tittel berichtete nach seiner Befahrung am 25. Januar 1902, der Betrieb sei tatsächlich im Herbst des Vorjahres mit 3 Mann Belegung und dem Zimmerling Otto Mende als Aufsicht auf einem Stolln wieder aufgenommen worden. Dieser Stolln aber läge mit seinem Mundloch und dem ersten Abschnitt noch im Gottes Geschick'er Grubenfeld (40169, Nr. 135, Blatt 158f). Auch G. Zschierlich zeigte am
20. Februar 1902 dem Bergamt an, er beabsichtige, den Jung Katharina
Stolln ‒ um
Am 24. April 1902 berichtete Inspektor Tittel in seinem Fahrjournal, daß auf dem Jung Katharina Stolln zwei Örter in Umgang stünden (40169, Nr. 135, Blatt 177f). Ein Jahr später schrieb derselbe nach seiner Befahrung am 23. Februar 1903, der Betrieb sei „nur schwach“ (40169, Nr. 135, Blatt 187f) und auch bei den nachfolgenden Befahrungen in den Jahren bis 1905 fand Herr Tittel nicht wirklich viel neues vor. Die Bemerkung in seinem Fahrjournal vom 12. Januar 1904, der Stolln stehe in Verbindung mit dem benachbarten Kalkwerk, welches die Wasser nach dem Erbstolln abführe, scheint uns allerdings ein Irrtum zu sein (40169, Nr. 135, Blatt 200f). Das Stollnort ist auch ausweislich späterer Grubenrisse nie auf den Facius Schacht, geschweige denn auf den eigentlichen Kalkbruch oben am Emmler, durchschlägig geworden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Offenbar ist 1906 auch Otto Mende aus seiner Stellung als Steigerdienst- Versorger ausgeschieden, denn Bergverwalter Fröbe zeigte am 8. Oktober 1906 dem Bergamt an, da „ein größerer Betrieb gegenwärtig nicht zu erwarten sei,“ solle der Zimmerling Franz Oskar Weißflog die Aufsicht übernehmen (40169, Nr. 135, Blatt 218), was auch genehmigt wurde. Viel Betrieb kann tatsächlich nicht mehr umgegangen sein, denn am 29. November 1906 hielt Berginspektor Tittel in seinem Fahrjournal fest, daß der Betrieb auch auf dem Jung Katharina Stolln schon seit 4. April des Jahres wieder eingestellt sei (40169, Nr. 135, Blatt 231). Am 22. Januar 1907 genehmigte das Landesbergamt wieder die Infristsetzung der Grube (40169, Nr. 135, Blatt 233). Nach Ablauf der Betriebsfrist befuhr Inspektor Tittel am 9. Juni 1909 wieder die Grubenfelder, fand bei Gott segne beständig zwar keinen Betrieb, jedoch die Kaue auf dem Jung Katharina Stolln ordnungsgemäß verschlossen vor, womit für ihn für den Moment alles in Ordnung gewesen ist (40169, Nr. 135, Blatt 237).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Gewerkschaft St. Catharina
gibt es noch weitere Akten (40169, Nr. 136).
Nach dem Übersichtsblatt darin hatte Herr Zschierlich diese schon
am 2. Juni 1900 gebildet. Nach einer Erörterung im Büro von Bergverwalter
Fröbe notierte Inspektor Tittel aber noch am 2. Januar
1908, es sei „keine Betriebsaufnahme beabsichtigt.“ (40169, Nr. 136, Blatt 1)
Da sich nun aufgrund der großen Grubenfeldflächen allein die Feldsteuern für die vier hier in seinem Besitz befindlichen Gewerkschaften auf einen Betrag summierten von:
beantragte Herr Zschierlich am 13. September 1908 wieder den Erlaß der halben Feldsteuer beim Bergamt (40169, Nr. 136, Blatt 4ff). Da man dies schon seitens des Bergamtes direkt ablehnte, wiederholte er seinen Antrag noch einmal am 28. Dezember 1908 und begründete ihn mit der schlechten Konjunktur und hohen Fuhrkosten (40169, Nr. 136, Rückseite Blatt 5). Momentan lasse er nur aus Halden Farberden auskutten und hoffe nach dem in der zurückliegenden Zeit eingetretenen Preisverfall für Eisenerz nun auf wieder steigende Nachfrage, wenn auf böhmischer Seite des Erzgebirges neue Hochöfen errichtet würden, die für seine Grubenfelder auch verkehrsgünstiger lägen. Auch Inspektor Tittel befürwortete in seiner Stellungnahme vom 10. Februar 1909 diesen Antrag aber nicht und bemerkte noch, daß ihm Fröbe erst heute angezeigt habe, daß allein im November und Dezember 1908 bei Wilkauer vereinigt Feld zirka 800 Zentner Farberde gewonnen worden seien. Bei den anderen Gewerkschaften gehe nach wie vor gar kein Betrieb um. „Es würde dem erzgebirgischen Bergbau nicht zum Vorteil gereichen, wenn Zschierlich auch fernerhin verschiedene Grubenfelder besitzt, die in der Hauptsache nur dazu dienen, Gewerkschaften zu gründen und mit diesen einen Handel zu treiben,“ schrieb er weiter (40169, Nr. 136, Blatt 12f). Damit ist eigentlich alles gesagt. Folgerichtig lehnte am 19. Februar 1909 auch die II. Abteilung des königlichen Finanzministeriums den Antrag ab und Herr Zschierlich mußte die Steuern in voller Höhe bezahlen (40169, Nr. 136, Blatt 15).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die beiden Folgejahre reichte
Bergverwalter Fröbe wieder einen Fristhaltungsantrag ein (40169, Nr. 136, Blatt 18).
Dennoch wandte er sich am 5. Oktober 1910 wieder an das Bergamt und teilte
mit, da die Gewerkschaft von Gottes Geschick vereinigt Feld nun den
Jung Katharina Stolln auf den Facius Schacht zu
weitertreiben wolle, würde er nun auch den Abbau in diesem Stolln wieder
aufnehmen wollen und die erbohrten Braunsteinvorkommen durch Überhauen
aufschließen (40169, Nr. 136, Blatt 20).
Berginspektor Tittel befuhr die Grube daher am 23. November 1910
und fand tatsächlich wieder 4 Mann in der Tag- und weitere 2 Mann in der
Nachtschicht angelegt, welche die Gleisverlegung für eine Huntebahn
vorbereiteten (40169, Nr. 136, Blatt 24f).
Auch bei seiner Befahrung am 4. Februar 1911 war der Stolln belegt (40169, Nr. 136, Blatt 28f) und
am 5. Dezember 1912 hielt der Inspektor fest, das Stollnort stehe zwar
kurz vor dem Facius Schacht, es sei aber der Durchschlag noch nicht
erfolgt; unterwegs nur ein alter Schacht angefahren worden, auch das
Überhauen hatte das Liegende des erwarteten Braunsteinlagers noch nicht
erreicht (40169, Nr. 136, Blatt 36 und 36A).
Da in dem 22 m tiefen Facius Schacht nur 2 m hoch Wasser stehe,
seien aber, außer vorzubohren, keine besonderen Anweisungen beim Anfahren
des Schachtes erforderlich.
Dieser kurze Aufschwung war aber bald wieder vorbei und bei seinen Befahrungen am 13. März 1912 und am 23. Januar 1913 fand Herr Tittel den Betrieb wieder eingestellt (40169, Nr. 136, Blatt 41 und 46). Auf die Aufforderung zur Betriebsaufnahme hin schrieb Fröbe an das Bergamt in Freiberg, er könne es wegen fehlender Betriebsmittel gar nicht tun (40169, Nr. 136, Blatt 55). Am 15. Dezember 1913 drohte das Bergamt dann erstmals die Entziehung des Bergbaurechtes an, wenn keine Betriebsaufnahme erfolge (40169, Nr. 136, Blatt 56). Daraufhin zeigte Zschierlich dem Landesbergamt am 5. Februar 1914 an, er habe sämtliche Kuxe an die Technische Studienanstalt Separation GmbH in Hannover veräußert (40169, Nr. 136, Blatt 57). Dieser Gesellschaft scheint Herr Zschierlich die Grubenfelder bereits 1911 zum Kauf angeboten zu haben, doch schrieb man aus Hannover auf die Rückfrage vom Bergamt hin damals zurück, es sei bislang nur eine Kaufoption und kein Pachtvertrag ausgehandelt (40169, Nr. 136, Blatt 31). Dort interessierte man sich vermutlich eigentlich für die 1902 angefahrenen Zinkblendevorkommen. Die Studienanstalt wurde in der Zwischenzeit auch selbst in der Region aktiv und hat sich 1912 unter dem Namen Neue Hoffnung bei Wildenau ein Grubenfeld verleihen lassen. Das wurde aber nur in Fristen gehalten und schon 1916 wieder losgesagt (40169, Nr. 1328). Tatsächlich meldete sich dann aber die Studienanstalt am 16. Mai 1914 beim Landesbergamt und verwandte sich für eine Betriebsfrist; beglich auch die für 1914 anstehenden Feldsteuern (40169, Nr. 136, Blatt 68). Vorstand der Gewerkschaft der Kuxinhaber und Vertreter der Studienanstalt war ein Landrat Dr. jur. Dewitz von Woyna auf dem Rittergut Poggenhagen in der Provinz Hannover. Herr Fröbe blieb auch jetzt in seiner Funktion als Vertreter des neuen Besitzers und wandte sich am 12. Januar 1916 in dessen Auftrag wieder mit einem Fristhaltungsantrag an das Bergamt (40169, Nr. 136, Blatt 78). Weil inzwischen der 1. Weltkrieg tobte und es kaum noch Bergarbeiter gab, wurde dieser Antrag wieder genehmigt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann entschied man sich im Königlich-
sächsischen Landesbergamt aber anders: Man war hier der Auffassung, es
läge doch im kriegswirtschaftlichen Interesse, alle verfügbaren
Rohstoffvorkommen einer Ausbeutung zuzuführen und zog daher am 11. April
1917 die Genehmigung zur Fristhaltung der Grube zurück (40169, Nr. 136, Blatt 82).
Da hatte man aber nicht mit den Beziehungen des Herrn Landrates in Hannover gerechnet, der sich umgehend an das Kriegsministerium in Berlin wandte. Von der Kriegs- Rohstoff- Abteilung des Ministeriums schrieb man am 23. Juni 1917 an das sächsische Bergamt zurück, „daß ein außerordentlicher Mangel an Arbeitskräften herrsche und die noch zur Verfügung stehenden Bergarbeiter solchen Betrieben zugeführt werden müssen, die in Förderung stehen oder in kürzester Zeit größere Mengen Eisen- und Manganerze gewinnen können. Ferner zwingt auch der Mangel an Betriebsmaterialien... diese für vorstehend geschilderte Betriebe zu verwenden. Aus diesem Grunde erscheint es nicht angebracht, die Gruben Gott segne beständig und St. Katharina selbstständig in Betrieb zu setzen. Es wird daher empfohlen, die gegen den Grubenbesitzer erlassene Anordnung zurückzunehmen.“ (40169, Nr. 136, Blatt 85) Das sah man in Freiberg aber immer noch anders und wandte sich am 5. Juli 1917 an die Kriegsmetall AG und die Manganerzgesellschaft mbH in Berlin und klagte, daß „die Besitzer der Grubenfelder allem Anschein nach nicht die Absicht haben, ernsthaften Betrieb aufzunehmen, sondern nur den Wunsch möglichst günstiger spekulativer Verwertung ihrer Grubenfelder.“ (40169, Nr. 136, Blatt 86ff) Die Kriegsmetall AG antwortete darauf am 9. Juli 1917, man werde grundsätzlich Untersuchungsarbeiten unterstützen, aber nur, wenn tatsächlich gute Aussichten bestehen, schnell zur Förderung zu gelangen. Dabei sehe man für Arsen- und Wismut- Erze im sächsischen Erzgebirge bessere Voraussetzungen (40169, Nr. 136, Blatt 91ff). Auch die Manganerzgesellschaft schrieb am 13. Juli 1917 nach Freiberg zurück, daß nach ihrer Kenntnis bisherige Untersuchungen bei Wilkauer vereinigt Feld „wenig ermutigend verlaufen“ seien und man lieber bereits in Betrieb stehende Gruben, wie Stamm Asser unterstützen solle (40169, Nr. 136, Blatt 96). Unter Bezug auf diese Schreiben, die ihm wohl in Abschrift auch zugegangen sind, wandte sich dann auch Landrat von Woyna am 25. März 1918 an das Landesbergamt und bat um Aufhebung der Betriebsaufnahmeverpflichtung (40169, Nr. 136, Blatt 102). Am 12. April 1918 beantragte er dann auch gleich erneut die Fristhaltung für die gewerkschaftlichen Grubenfelder. Be soviel Widerstand konnte man auch in Freiberg nicht mehr anders und erteilte dann auch am 20. April 1918 eine neue Genehmigung zur Infristhaltung (40169, Nr. 136, Blatt 104f). Dabei blieb es dann im wesentlichen aber auch ‒ nur wechselten die Besitzer und deren Vertreter noch ein paar mal. Wie wir schon wissen, ist Gustav Zschierlich am 19. März 1917 aus dem Vorstand der Gewerkschaft Adelma ausgeschieden. 1921 löste Bergdirektor Heinrich Keiner aus Breitenbrunn den langjährigen Schichtmeister und Bergverwalter Ernst Julius Fröbe auch bei der Gewerkschaft St. Catharina ab (40169, Nr. 136, Blatt 112). Der beantragte auch am 28. Februar 1921, nun aber schon namens der Eisenerz AG in Schwarzenberg, erneut Betriebsfrist für Gott segne beständig, da man zuerst die Aufschlußarbeiten bei Wilkauer vereinigt Feld fortsetzen wolle (40169, Nr. 136, Blatt 119). Bei der erstgenannten Grube hatte man am 23. Mai 1921 noch einmal zwei neue Bohrungen niedergebracht, dabei aber keine bauwürdigen Vorkommen ausfindig machen können. Auch bei Meyers Hoffnung war die Eisenerz AG zu dieser Zeit bereits aktiv.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1922 hat dann die Firma Schulz & Sackur AG aus Berlin die Eisenerz AG übernommen. Auch jetzt war am 8. Januar 1922 die erste Amtshandlung des Bergdirektors wieder, einen Fristhaltungsantrag für die Gewerkschaft St. Katharina einzureichen (40169, Nr. 136, Blatt 122ff). Dies wiederholte sich noch mehrfach, bis der Vorstandsvorsitzende der Gewerkschaft, ein Walter Lewinsky in Berlin, am 19. März 1926 verstorben ist. Daraufhin sah man im Bergamt am 6. Januar 1927 das Bergbaurecht als erloschen an. Behufs der Regulierung möglicher Folgeschäden wandte sich das Bergamt nochmals an den Vorstand der Gewerkschaft, woraufhin aber der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, ein R. Hausmann, das sächsische Oberbergamt an die Schulz & Sackur AG als den alleinigen Inhaber aller Kuxe verwies (40169, Nr. 136, Blatt 138ff). Zur Klärung, ob denn überhaupt Verwahrungsarbeiten erforderlich seien, wurde daraufhin der Berginspektor Sarfert aus Zwickau nach Langenberg gesandt, der aber meinte, es seien gar keine notwendig, weil der Jung Katharina Stolln überhaupt der einzige noch offene Zugang im ganzen Grubenfeld der Gewerkschaft sei und dessen Mundloch liege im Feld der noch bestehenden Gewerkschaft von Gottes Geschick am Graul (40169, Nr. 136, Blatt 147). Rund anderthalb Jahre später kontrollierte den Zustand ein Inspektor Hammer nochmals und berichtete, daß der Gutsbesitzer Meinhold in Langenberg „das versteckt gelegene Stollnmundloch zur Einlagerung von Kartoffeln nutze“ und 4 m vom Mundloch herein dazu eine feste Tür eingebaut habe (40169, Nr. 136, Blatt 148).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gewerkschaft Rautenkranz ‒
vormals Hausteins Hoffnung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie es üblich war, wurde nach dem ‒
eigentlich ja nur formalen Besitzwechsel ‒ auch der neue Besitzer des
Grubenfelds von Hausteins Hoffnung vom Bergamt am 7. August 1906
wieder zur Betriebsaufnahme und zur Benennung der verantwortlichen Leiter
aufgefordert. Wie wir schon wissen, benannte G. Zschierlich
daraufhin Herrn Ernst Julius Fröbe, damals auch Stadtrat in
Schwarzenberg, als Betriebsleiter für alle seine Gewerkschaften. Nach
dessen Eignung befragt, erhob Berginspektor Tittel aus Zwickau
dagegen keine Einwände, lehnte nur hinsichtlich der außerhalb der
Revierabteilung gelegenen ,Gewerkschaft Erasmus'
(die vormalige Kiesgrube zu Geyer) sowie für die ,Gewerkschaft Saxonia- Bavaria'
im Vogtland dessen
Anstellung als Betriebsleiter ab. Daraufhin genehmigte auch das Bergamt
Fröbe's Anstellung. Die nächste Aufforderung, einen Betriebsplan
einzureichen, ging nun an Herrn Fröbe (40169,
Nr. 160, Blatt 146ff).
Letzteres tat Herr Fröbe allerdings nicht, stellte vielmehr einen erneuten Antrag auf Fristhaltung der Gruben, was ihm auch bis Ende 1908 genehmigt worden ist (40169, Nr. 160, Blatt 152). Diese Fristsetzungsgenehmigung vom 22. Januar 1907 (40169, Nr. 135, Blatt 233 und Nr. 160, Blatt 152) galt für alle Gewerkschaften. Das ganze wiederholte sich nun auch hier mehrfach (40169, Nr. 160, Blatt 153ff). In Fröbe's Antrag auf Verlängerung der Fristhaltung vom 24. November 1910 etwa heißt es zur Begründung, für eine Betriebseröffnung fehle es an geschultem Personal und die Verhandlungen mit den Grundbesitzern über die Flächennutzung für das Anlegen neuer Schächte zögen sich in die Länge. Tatsächlich geschehen ist hier wohl nichts. Auch ein Fahrbogenauszug vom 11. Februar 1913 sagt aus, daß kein Betrieb eröffnet sei und daß auch keine Senkungserscheinungen beobachtet wurden (40169, Nr. 160, Blatt 159). Am 6. April 1914 teilte dann Bergverwalter Fröbe nach Freiberg mit, daß G. Zschierlich die Gewerkschaft Rautenkranz an einen Herrn Schmoll in Hamburg verkauft habe. Er habe sich dorthin gewandt, jedoch keine Antwort erhalten und lege daher sein Amt als Betriebsleiter für die Gewerkschaft Rautenkranz nieder (40169, Nr. 160, Blatt 165).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Bergamt wußte man wohl schon mehr:
Man hatte als Vorsitzenden der Gewerkschaft einen Herrn Dr. Hollebeum
(oder Hollefreund) in der Kantstraße 126 in Berlin- Charlottenburg
ermittelt und forderte nun diesen als neuen Besitzer am 14. April 1914 zur
Betriebsaufnahme und zur Benennung der Vertreter in Sachsen auf (40169,
Nr. 160, Rückseite Blatt 165).
Als Betriebsleiter wurde daraufhin Herr Hugo Naprawnik, wohnhaft in der Strehlener Straße in Dresden, angezeigt. Der stammte aus Wittkowitz / Vítkovice bei Ostrau / Ostrava in Mähren und hatte 1877 an der Bergakademie sein Diplom abgelegt. Daher gab es auch keine Einwände und dessen Anstellung wurde am 8. August 1914 vom Bergamt genehmigt (40169, Nr. 160, Blatt 166 und Blatt 171). Am 30. Juli 1914 schrieb auch der Vorsitzende der Gewerkschaft nach Freiberg, er habe alles Nötige eingeleitet und Herrn Naprawnik beauftragt, Betriebspläne zu erstellen, erlaube sich jedoch die Frage, ob in Anbetracht der politischen Lage der Betrieb vorerst ausgesetzt bleiben könne (40169, Nr. 160, Blatt 169). Bevor man dazu aus Freiberg antworten konnte, schrieb Herr Dr. Hollefreund am 4. August 1914 nochmals nach Freiberg und beantragte mit Hinsicht auf den Ausbruch des 1. Weltkrieges Betriebsfrist. Das wurde auch zunächst bis April 1915 genehmigt (40169, Nr. 160, Blatt 170ff). Am 17. Februar 1915 schrieb dann Betriebsleiter Naprawnik nach Freiberg, daß aufgrund des Krieges „der Eingang der Zubußen ganz und gar aufhörte“ und beantragte erneut weitere Fristhaltung. Man glaubt wohl noch an ein schnelles Ende des Krieges und gewährte die Betriebsaussetzung daher nur bis Ende 1915 (40169, Nr. 160, Blatt 176f). Als diese Frist abgelaufen war, forderte das Bergamt Herrn Dr. Hollefreund am 5. Februar 1916 wieder zur Betriebsaufnahme auf. Der war aber inzwischen aus hier nicht genannten Gründen aus dem Vorstand ausgetreten. Ehe man dies in Freiberg ermittelt hatte, verstrich einige Zeit und am 1. April 1916 erhielt dann der bisherige Stellvertreter des Vorsitzenden der Gewerkschaft Rautenkranz, der auch bei der Gewerkschaft Adelma als solcher fungierende Karl August Zinnitz in Berlin- Schöneberg, wieder die Aufforderung zur Betriebsaufnahme (40169, Nr. 160, Blatt 178ff). Der letztere wiederholte daraufhin den Antrag Naprawnik's vom Vorjahr auf weitere Fristhaltung und bekommt sie in Anbetracht des andauernden Krieges auf weitere zwei Jahre auch genehmigt (40169, Nr. 160, Blatt 183ff). Das Ganze wiederholte sich wieder nach Ablauf der Frist im Jahr 1918.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann hat der Vorstand der Gewerkschaft
erneut gewechselt: Am 11. September 1918 teilte die Rechtsanwaltskanzlei
Zöphel, Brecht & Gaul in Leipzig dem Bergamt mit, daß
sie mit der Interessenvertretung der Gewerkschaft beauftragt seien und
beantragte erst einmal Akteneinsicht (40169,
Nr. 160, Blatt 188). Am 29.
September des Jahres teilte dann ein Bankdirektor Schmidt dem
Bergamt mit, der Sitz der Gewerkschaft sei nun in der Südstraße 69 in
Leipzig und beantragte zugleich weitere Fristhaltung bis nach dem
Kriegsende, was vom Bergamt auch genehmigt wurde (40169,
Nr. 160, Blatt 189f).
Besagter Herr Schmidt beantragte noch mehrfach weitere Fristhaltung, was ihm inhaltlich der Grubenakte auch wenigstens noch bis Ende 1922 gewährt worden ist (40169, Nr. 160, Blatt 191ff). Dann aber traf man in Freiberg eine andere Entscheidung: Auf den 22. Oktober 1924 ist ein Aktenvermerk datiert, daß das Bergbaurecht entzogen ist (40169, Nr. 160, Rückseite Blatt 198). Ohne Blattnummerierung liegt ein weiteres Schreiben vom 13. August 1925 lose in der Akte, mit welchem das Bergamt offenbar den Gewerkschaftsvorsitzenden, nun aber wieder ein Herr Peter Stein in Berlin, über das Erlöschen der Abbaurechte informieren wollte. Da dieser wohl kurz zuvor verstorben ist, kam dieser Brief nach Freiberg zurück. So endet auch die Geschichte dieser Grube
irgendwo im Nebel der Geschichte und scheint ein weiterer Beleg dafür
zu sein, daß Berginspektor Tittel im Jahr 1909 mit seiner
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gewerkschaft Wettin ‒ vormals
Wilkauer vereinigt Feld
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bleibt noch die flächenmäßig umfangreichste: Die
Gewerkschaft Wettin muß ebenfalls Mitte des Jahres 1906 von G.
Zschierlich gebildet worden sein, denn
auf den 19. Oktober diesen Jahres datiert die dann stets seitens des
Bergamtes in Freiberg erfolgende Aufforderung an das neue Unternehmen zur
Betriebsaufnahme und zur Benennung der leitenden Beamten (40169, Nr. 144,
Blatt 50).
Den oben schon angeführten, vielfachen Umstrukturierungen der Grubenfelder halber gehörten nun auch die Gustavschächte im früheren Gnade Gottes vereinigten Feld in das Feld der Gewerkschaft Wettin. Dieselben hat Inspektor Tittel am 22. Oktober 1906 wieder befahren, fand sie ordnungsgemäß verschlossen, sonst aber keinen umgehenden Betrieb vor (40169, Nr. 144, Blatt 55). Auch bei seiner Befahrung am 9. November war es nicht anders und Herr Tittel fand nur im Tagebau Arbeiter vor. Sobald der Winter das Arbeiten übertage aber nicht mehr erlaube, solle wieder untertage abgebaut werden (40169, Nr. 144, Blatt 57). Offenbar wurde aber doch kein bergmännischer Betrieb wieder aufgenommen, denn stattdessen wurde auf Antrag Zschierlich's am 22. Januar 1907 Fristhaltung bis Schluß 1908 genehmigt (40169, Nr. 144, Blatt 59). Auch danach beschränkten sich die Aktivitäten offenbar auf einen bescheidenen Tagebaubetrieb und nachdem die Betriebsfrist abgelaufen war, wurde sie bis Ende des Jahres 1909 erneut gewährt (40169, Nr. 144, Blatt 64). Den Termin für die nächste Antragstellung auf Fristhaltung hat Herr Zschierlich wohl verpaßt, denn am 1. August 1910 schaute sich Berginspektor Tittel „zur Feststellung etwa umgegangenen Betriebes“ wieder im Revier um, wobei er aber alles beim alten und die Schächte gut verschlossen vorfand. In seinem Fahrbericht hielt er aber fest, es werde auf dem Bahnhof in Schwarzenberg Manganmulm verladen, der aus einem neuen Tagebau stammte. Ferner noch brachte er in Erfahrung, daß auch der Gutsbesitzer Emil JIling in Hayde „schon seit längerer Zeit ebenfalls Manganmulm in einem Tagebau abbauen und verkaufen“ solle. Der Berginspektor hielt aber „weitere Erörterungen hierzu vorerst noch nicht (für) nötig“ ‒ es war ja nur ein Tagebau... (40169, Nr. 144, Blatt 70) Bei der Gelegenheit hat er aber sicher den inzwischen auch für die Gewerkschaft Wettin wieder als Betriebsleiter zugelassenen Ernst Julius Fröbe auf die offene Situation aufmerksam gemacht und der reichte dann am 24. November 1910 schnell noch einen neuen Fristhaltungsantrag ein. Auch der wurde wieder genehmigt (40169, Nr. 144, Blatt 71f). So ging´s auch in den nächsten Jahren weiter. Auch am 29. Januar 1912 wurde wieder weitere Fristhaltung genehmigt, bei seiner Befahrung am 13. März 1912 fand Inspektor Tittel dann aber doch ein kleines Schachtabteufen zur Gewinnung von Manganmulm in Betrieb vor, mit dem man aber nur 4 m Tiefe erreicht hatte (40169, Nr. 144, Blatt 75f). Die Gustavschächte dagegen habe man inzwischen abgeworfen und nur „gelegentlich“ ginge Betrieb im Tagebau um.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch für die Jahre 1914/1915 beantragte
Herr Fröbe wieder Antrag auf Fristhaltung und weil demnach der
Betrieb ja ruhte, hätte auch der Berginspektor eigentlich gar nicht
zugegen sein müssen (40169, Nr. 144, Blatt 81f). Der hat sich aber dennoch
am 12. Dezember 1913 umgeschaut und darüber berichtet, daß der eine der
noch zwei Gustavschächte nun „verfüllt oder zu Bruch gegangen“ war
(40169, Nr. 144, Blatt 85). Auch im alten Feld von Kästners Hoffnung
muß es einen Tagesbruch gegeben haben und Herr Fröbe teilte in
diesem Zusammenhang am 15. Juni 1914 nach Freiberg mit, daß er sich zum
Zwecke der Regulierung der Verfüllungsarbeiten an den „zukünftigen
Besitzer“ ‒ ein Herr Spinzig in Clausthal ‒ gewandt, diesen
aber nicht habe erreichen können und deshalb sein Amt als Betriebsleiter
niederlege (40169, Nr. 144, Blatt 87f). Herr Zschierlich hatte
offenbar nun Erfolg damit, die Kuxe dieser Gewerkschaft unter die Leute zu
bringen... Auch als Vorsitzender des Vorstands der Gewerkschaft zeichnete
nun nicht mehr Gustav Zschierlich, sondern ein Herr Max Päßler
in Geyer (40169, Nr. 144, Blatt 89).
Den Tagebruch hat Herr Fröbe aber noch verfüllen lassen, worüber die Berginspektion Zwickau (der Name des Inspektors ist hier unleserlich, aber wahrscheinlich war es ein Bergassessor Schwartz) am 28. Juli 1914 nach Freiberg Bericht erstattete (40169, Nr. 144, Blatt 92). Am 14. Mai 1915 war wieder ein Mitarbeiter der Berginspektion wieder vor Ort und berichtete, es sei nur noch der westliche der Gustavschächte vorhanden, aber mit einer Kaue versehen und ordnungsgemäß verschlossen. In dem östlichen, zuvor schon verfüllten oder verbrochenen Schacht allerdings seien die Füllmassen um 3 m bis 4 m nachgesackt. Auch diese Nachverfüllung hat Herr Fröbe wieder veranlaßt, worüber die Berginspektion am 12. Juli 1915 Vollzug meldete (40169, Nr. 144, Blatt 98f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nächste Antrag auf Fristhaltung vom
18. Januar 1916 kam dann aber schon von einem Herrn Direktor Paul Busch,
Charlottenstraße 49 in Berlin. Weil inzwischen der 1. Weltkrieg tobte,
wurde auch dieser Antrag wieder genehmigt (40169, Nr. 144, Blatt 100f).
Nach einer Übertagebesichtigung am 3. April 1916 berichtete auch die
Berginspektion, daß kein Betrieb umgehe, wie immer aber die Kaue auf dem
letzten der Gustavschächte ordentlich verschlossen sei (40169, Nr. 144,
Blatt 103).
Dann aber teilte Herr Fröbe am 13. Dezember 1916 an das Bergamt mit, daß „auf Rat der Manganerzgesellschaft“ doch wieder Schurfarbeiten im Grubenfeld aufgenommen werden sollen. Auch gäbe es wieder einen neuen Vertreter der Gewerkschaft: Das war nun Herr Karl Zinnitz in Berlin (40169, Nr. 144, Blatt 105). Tatsächlich findet man einige Seiten weiter in der Akte ein Schreiben der Manganerzgesellschaft vom 6. Dezember 1916, mit dem sie – ähnlich, wie schon zuvor auch bei der Gewerkschaft St. Katharina – bestätigte, daß man die Untersuchungsarbeiten begrüße und bei Erfolg auch den weiteren Aufschluß der Lagerstätte unterstützen werde (40169, Nr. 144, Blatt 117f). Nach einer diesbezüglichen Pressemitteilung in der Dresdner Volkszeitung vom 29. Dezember 1916 fragte man übrigens seitens des königlich- sächsischen Innenministeriums beim Bergamt nach, um was für Erze es sich denn hier handele, woraufhin das Bergamt am 3. Februar 1917 dorthin mitteilte, daß zunächst nur Untersuchungen erfolgen sollen und „ob diese Manganerze... den Ansprüchen der Manganerzgesellschaft mbH genügen werden, ist noch nicht sicher.“ (40169, Nr. 144, Blatt 122ff) Dabei fallen uns doch die zur gleichen Zeit auch an anderen Stellen im Revier aufgenommenen Untersuchungen wieder ein. Am 9. Januar 1917 fand der Inspektor aus Zwickau jedenfalls den Grubenbetrieb noch nicht wieder aufgenommen vor (40169, Nr. 144, Blatt 120). Aber inzwischen wurde Paul Hunger als Steiger für die Untersuchungsarbeiten von der Gewerkschaft Wettin angestellt und am 22. Januar 1917 zeigte dann Karl Zinnitz dem Bergamt offiziell die Betriebseröffnung an (40169, Nr. 144, Blatt 114). Am 24. Januar zeigte auch Betriebsleiter Fröbe die Betriebsaufnahme in Freiberg an und berichtete zugleich, es würden zunächst „ein Mann und zwei Frauen beschäftigt,“ durch die in einem Schurfgraben das Lager aufgesucht und dann „mit einem Schächtchen“ näher untersucht werden solle (40169, Nr. 144, Blatt 126). Kurz darauf kam es aber dann doch zur Trennung von dem langjährigen Betriebsleiter, was unabhängig voneinander K. Zinnitz am 30. Januar 1917 und kurz darauf auch Herr Fröbe selbst dem Bergamt mitteilten. Herr Fröbe begründete sein Ausscheiden damit, daß er sich über die Betriebsführung nicht mit dem Vorstandsvorsitzenden habe einigen können (40169, Nr. 144, Blatt 128f). Herr Zinnitz dagegen informierte das Bergamt in seinem Schreiben außerdem, daß „auf Wilkauer vereinigt Feld jetzt etwa 12 Mann anfahren, um den begonnenen Tagebau energisch fortzusetzen.“ Der wohl ,energische', aber gleichermaßen planlose Angriff führte prompt auch wieder zu Streitigkeiten mit dem Grundbesitzer, inzwischen Frau verw. Oertel auf Tännicht, in deren Auftrag Gutsverwalter C. Böhme dem Bergamt am 11. März 1917 mitteilte, daß sich die Gewerkschaft nicht an die getroffenen Absprachen über die Flächeninanspruchnahme halte und ‒ weil die ersten Versuche „nichts ergeben haben“ ‒ ohne Rücksprache einfach weitere Flächen benutze (40169, Nr. 144, Blatt 130ff). Soweit die Aufschlußarbeiten aber innerhalb des verliehenen Grubenfeldes stattfänden, verwies das Bergamt die Grundbesitzerin aber auch jetzt wieder an „ordentliche Gerichte.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwei leider nicht mit den Namen der fahrenden Beamten versehenen Abschriften von Fahrberichten der Berginspektion Zwickau vom 20. April und 11. Mai 1917 kann man dann entnehmen, daß die neuen Betreiber für die Anteile an der Gewerkschaft Wettin 100.000,- Mark an G. Zschierlich gezahlt haben sollen ‒ da hätte letzterer aber ein gutes Geschäft gemacht. Gerade wurde ein neuer, 5 m tiefer Schurfschacht in der Nähe des alten Großzecher Tageschachtes abgesenkt, auch weiter nördlich ein Schurfgraben gezogen, wobei man das Mulmlager 1 m mächtig angetroffen habe. Die hier entnommenen Proben sollen bis zu 10,5% Manganoxyd gehalten haben. Auch die alten Halden bei Gelber Zweig und Köhlers Fdgr. habe man beprobt und zwischen 16% und 21% Manganoxydgehalt festgestellt; nur seien deren Umfänge zu gering für eine lohnende Gewinnung. Eisenstein dagegen habe man beim Abteufen von inzwischen insgesamt schon sechs ( !! ) weiteren Schächten nicht angetroffen. Da kann man den Ärger der Grundbesitzer nachvollziehen... Einen der Schächte hatte man bis auf 17,5 m Teufe abgesenkt, dann aber wegen zu großen Wasserzudrangs aufgeben müssen. Außerdem würden Bohrungen durchgeführt, die auch auf das gegenüberliegende Ufer des Schwarzbachs ausgedehnt werden sollten, wo sich aber das Grubenfeld der Vereinigten Braunsteinzechen befinde (40169, Nr. 144, Blatt 134ff). Auf die Vereinigten
Braunsteinzechen ‒ wen wundert´s: Auch dies eine Gründung von Gustav
Zschierlich ‒ kommen wir weiter
Die Fahrberichte vom Frühjahr 1917 schließen jedenfalls schon mit der Einschätzung: „Die Schurfarbeiten haben wenig Aussicht auf die Erschließung von Manganerzen.“ Die Alten hatten schließlich die Rosinen schon weggeholt... Dem ungeachtet mutete die Gewerkschaft aber auch jetzt noch weitere Grubenfeldflächen und am 22. Mai 1917 bestätigte das Bergamt die Verleihung von 240 Maßeinheiten, so daß man nun über ein Grubenfeld von insgesamt 471 Maßeinheiten oder 188 Hektar, 1 Ar und 57 m² verfügte (40169, Nr. 144, Blatt 137f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein weiterer Fahrbericht der
Berginspektion vom 21. Juli 1917 berichtet dann schon, daß die Schächte
sämtlich eingestellt und der Schurfgraben verfüllt seien, weil man kein
abbauwürdiges Erz festgestellt habe und „Der Abbau dürfte bereits
früher erfolgt sein.“ Wissen wir doch... Es seien zwar noch Bohrungen
im Gange, aber auch die seien, bislang zumindest, ergebnislos verlaufen.
Selbst die in altem Mann noch gefundenen Erze hielten nur 5,4% bis 8,4%
Mangan und 3,0% bis 9,9% Eisen, der Rest war zumeist Quarz (40169,
Nr. 144, Blatt 139).
Dasselbe zeigte auch K. Zinnitz am 30. August 1917 beim Bergamt an: „Die Hoffnung, Braunstein bei den Arbeiten (...) anzutreffen, hat sich als gänzlich irrig erwiesen, ebenso, wie die im Bergwerksbesitz liegenden Halden nicht, wie mir vorher mitgeteilt, reiche Erze enthalten...“ Welche Märchen wird ihm wohl der Vorbesitzer erzählt haben ? Er wollte jedenfalls die Untersuchungsarbeiten einstellen, fragte aber sicherheitshalber die Bergbehörde nach deren Genehmigung (40169, Nr. 144, Blatt 140f). Im Bergamt fand man keine Einwände gegen eine Betriebseinstellung. Zur gänzlichen Betriebseinstellung kam es aber dann doch noch nicht. Am 29. Oktober 1917 war die Berginspektion wieder in Langenberg und besprach sich auch mit Steiger Hunger. Anschließend wurde darüber nach Freiberg berichtet, daß die Bohrungen noch fortgesetzt würden und beim Betrieb alles ordnungsgemäß ablaufe. Wieder kam der Berginspektor aber zu der nicht gerade rosigen Einschätzung, daß, selbst wenn in dem jetzt in Angriff genommenen Gelände das erhoffte Erz gefunden würde, dessen Abbau fraglich sein dürfte, weil das Gelände dicht bebaut sei und die Straße nahe liege (40169, Nr. 144, Blatt 143). Nach einer weiteren Befahrung am 22. November 1917 war zu berichten, daß dennoch auch wieder ein neuer Schacht geteuft werde, der schon 16 m Teufe erreicht hatte (40169, Nr. 144, Blatt 144). Dazu reichte die Geschäftsführung
aus Berlin noch 1917 auch einen neuen Betriebsplan in Freiberg ein, aus
dem wir erfahren, daß dieser neue Versuchsschacht „beim alten
Karlschacht“ läge und „im November fündig geworden“ sei. Man
habe hier das Lager mit 1,5 m Mächtigkeit und mit Gehalten von 17% Eisen
und 33% Mangan angetroffen. Nach diesem lange erhofften Erfolg solle der
Schacht nun auf 30 m Teufe abgesenkt und mit elektrisch betriebener
Wasserhaltung ausgerüstet werden (40169, Nr. 144, Blatt 145ff). Da kratzen
wir uns doch wieder am Kopf: War nicht mit seinem Carlschacht II
im Jahre
Von seinen Befahrungen im März 1918 berichtete Berginspektor Tittel dann, dieser Versuchsschacht sei im Profil 1 m x 5 m inzwischen 19 m abgeteuft, aber das Wasser bis 5 m über dem Tiefsten aufgegangen. Daher habe man einen zweiten Schacht in Angriff genommen, inzwischen auf 8 m Teufe niedergebracht und auch mit diesem Eisen- und Manganerz angetroffen (40169, Nr. 144, Blatt 149f). Von seiner Befahrung am 20. Juni 1918 berichtete er aber wieder, man habe ein Streichort im Lager 10 m in Richtung Osten „ohne Ergebnis“ aufgefahren... (40169, Nr. 144, Blatt 152) Außerdem notierte Herr Tittel noch: „Die Berginspektion ist der Ansicht, daß die (hier angelegten) Leute... bei dem Mangel an Arbeitskräften im Erzgebirge... bei anderen Gruben zur Steigerung des Ausbringens an Wismut- und Arsenerzen weit nutzbringender beschäftigt werden könnten.“ Bei der Gewerkschaft Wettin waren 1918 in Langenberg übrigens 12 Männer und 4 Frauen in zwei Schichten angestellt. Am 22. Juni des Jahres zeigte die Berginspektion dann noch in Freiberg an, daß man vermute, daß der starke Wasserzugang in den Versuchsschächten durch den Verschluß des Juno Stollns bewirkt sei. Auch Steiger Hunger hatte schon am 17. Juni 1918 angezeigt, daß beabsichtigt sei, diesen Stolln wieder zu gewältigen (40169, Nr. 144, Blatt 153f). Inzwischen hatte man dann aber endlich doch eine elektrische Pumpe beschaffen können und im Fahrbericht vom 13. August heißt es dann, sie sei nun in Betrieb und man habe ein zweites Ort angehauen, um doch noch Erz zu finden (40169, Nr. 144, Blatt 155). Bereits am 23. September aber war der Motor kaputt, der Schacht wieder ersoffen und die Mannschaft werde nun verringert (40169, Nr. 144, Blatt 158). Außerdem erfährt man aus diesem Fahrbericht noch, der Betrieb in Langenberg koste derzeit etwa 3.000,- Mark pro Monat und man habe bislang „nur unbedeutende Mengen Erz“ gefördert. So kam es nun doch zur Betriebseinstellung. Noch 1918 wurde der ,Schacht Nr. XI' verfüllt und am 26. Februar 1919 berichtete die Berginspektion, auch ,Schacht Nr. XIII' werde nun verfüllt, es gäbe aber noch einen neuen Schacht unweit der Förstelschänke (40169, Nr. 144, Blatt 160ff). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wer nun aber gedacht hätte, es müsse
sich doch langsam auch unter den Banken und Investoren herumgesprochen
haben, daß man hier keinen, den Anforderungen der modernen Wirtschaft
gerecht werdenden Bergbau mehr etablieren könne, der irrt sich.
Auf den 11. März 1919 datiert ein Fahrbericht der Berginspektion, in dem es heißt, es sei nun ein ,Schacht Nr. XIV' bis auf 16 m Teufe abgesenkt worden, dort habe man eine Strecke nach Nord 12 m aufgefahren und ein Flügelort nach Ost inzwischen 6 m ausgelängt, wo man in alte Baue gekommen sei (40169, Nr. 144, Blatt 167). Bergpolizeiliche Erinnerung hatte die Berginspektion nicht zu machen und der Beamte notierte nur noch: „Die Aussichtslosigkeit des Unternehmens bleibt weiter bestehen.“ Am 24. März teilte die Berginspektion außerdem nach Freiberg mit, es gäbe einen neuen Besitzer namens Dr. Arendt in Berlin (40169, Nr. 144, Blatt 164). Der war aber offenbar wieder nur ein Zwischenhändler, denn aus einem Schreiben des Bergamts- Markscheiders Weiße vom 22. April 1919, in dem es eigentlich um die fehlenden Rissunterlagen ging, erfährt man nebenbei, daß die Gewerkschaft Wettin nunmehr an die Oldenburgische Eisenhüttengesellschaft zu Augustfehn verkauft sei und von deren ,Direktion Berlin' verwaltet werde (40169, Nr. 144, Blatt 169ff). Der Kaufpreis soll 1.000.000,- Mark betragen haben. Diese Wertsteigerung ist in Anbetracht der vorangegangenen, kläglich gescheiterten Wiederbelebungsversuche völlig unerklärlich, aber nun begannen ja auch die ach so ,goldenen' Zwanziger... Was die fehlenden Rissunterlagen
anbetrifft, so findet man aus dem weiteren Akteninhalt noch heraus, daß
sie zu dieser Zeit von einem konzessionierten Markscheider namens
Weigand in Goslar geführt worden sind (40169, Nr. 144, Blatt 195ff) ‒
Grubenrisse scheinen jedoch nie in Freiberg angekommen zu sein, denn es
wurde noch wiederholt nach ihnen gefragt und keiner wollte welche im
Besitz gehabt haben... Allerdings gibt es zumindest den oben schon
gezeigten
Die neue Besitzerin benannte erst einmal den uns an anderer Stelle auch schon begegneten Heinrich Keiner aus Breitenbrunn zum Bergdirektor und wie die Berginspektion Zwickau am 5. Juni 1919 nach Freiberg schrieb, seien neue Schächte „oberhalb vom Kalkwerk“ geplant (40169, Nr. 144, Blatt 173ff). Zwei neue Schächte hat man, nach dem nächsten Fahrbericht vom 31. Juli 1919, dann aber doch „400 m südöstlich vom Tännichtgut“ angesetzt ‒ also wieder dort, wo sämtliche Vorgänger auch schon alles umgegraben hatten ‒ sie auch schon 18 m niedergebracht, aber wieder eingestellt. Stattdessen fördere man nun Haldenberge ab, welche angeblich noch 33% Eisen und 4% Mangan enthielten (40169, Nr. 144, Blatt 178f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unter Bezug auf die eigentlichen
Besitzer der Gewerkschaft Wettin und die nur allzu gern nur im Hintergrund
stehenden Kapitalgesellschaften findet man in den Grubenakten dann folgende,
sehr
interessante Abschriften aus der Presse (40169, Nr. 144, Blatt 182ff):
Aus ,Das Archiv‘, Jahrgang 1919, Heft 29 und 34, S. 111 und 259: „Nr. 866 I: Die Vorgänge bei der Oldenburger Eisenhütten Gesellschaft, auf die wir mehrfach hingewiesen haben, bedürfen, wie wir wiederholt betonen möchten, dringend einer Aufklärung. In dem Aktienbesitz ist eine Verschiebung eingetreten. Die Bremer Gruppe, die anscheinend mit Rheinland-Westfalen zusammengearbeitet hat, ist mit dem Geheimen Bergrat Grossmann, früher vom Kohlensyndikat, aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Vorsitzender des Aufsichtsrates wurde nun Generaldirektor Fritz Kohl, offenbar der Leiter der Löwenbrauerei zu Berlin-Hohenschönhausen; neben ihm war noch ein Direktor Otto Roth in den Aufsichtsrat eingetreten. Ausgeschieden war auch Bankier Ernst Wallach von der Firma A. Falkenburger, der übrigens zum Aufsichtsrate der Löwenbrauerei gehört. Ganz neuerdings muß aber noch eine Verschiebung bei der Gesellschaft vor sich gegangen sein. Denn soeben ist, bemerkenswerter Weise nach Warstein in W. die Einladung zu der ordentlichen und gleichzeitig zu einer außerordentlichen Generalversammlung ergangen. Diese Einladung war aber von ganz anderen Herren unterzeichnet, als sie eben noch in der Verwaltung maßgebend waren. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates zeichnete ein Herr W. Hoffmann. Auch in dem Vorstande muß eine Veränderung erfolgt sein, denn jetzt zeichnen als Vorstandsmitglieder die Herren de Vries und Batschis; eben vorher die Herren Klinsmann und Meschede und kurz vorher die Herren Pagels und Klinsmann. Auch in der Bankverbindung ist eine teilweise Veränderung eingetreten; denn jetzt soll Hinterlegung der Aktien auch bei dem Bankhaus Arens & Wolter in Berlin und der Firma Wittman & Co. Stuttgart erfolgen. Allem Anschein nach ist auch wieder eine Verlegung des Sitzes der Gesellschaft vorgenommen worden. Im März d. J. war der Sitz der Gesellschaft nach Warstein verlegt worden wegen der Beziehungen zu den Warsteiner Gruben und Hüttenwerken, zu deren Aufsichtsrat Bankier Ernst Wallach und die Bremer Herren, die aus der Oldenburger Eisenhütte ausgeschieden sind, gehören. Jetzt wird mit einem Male wieder Berlin als Sitz der Oldenburger Eisenhütte angegeben. Eine Aufklärung all dieser Vorgänge wird umso mehr erwünscht, als die Aktien neuerdings an der Börse viel und zu steigenden Kursen gehandelt worden sind und eben eine neue Aktien- Emission, ohne Angabe der Modalitäten, angekündigt worden ist.“ Mitgeteilt von der B.B.Z. (Bergbehörde Zwickau) am 1. Juli 1919, sowie: „III. Oldenburgische Eisenhüttengesellschaft AG in Warstein i. Westfalen. Anfang Juni d. J. wurde berichtet, daß die Oldenburgische Eisenhüttengesellschaft, nachdem sie seit dem Verkauf ihrer gesamten Anlagen an die Warsteiner Gruben- und Hüttenwerke annähernd 9 Jahre lang untätig geblieben war, neuerdings sich industriell zu betätigen begonnen habe durch Aufnahme der Ausbeutung der im sächsischen Erzgebirge gelegenen Mangan- und Eisenerzfelder der 2000teiligen sächsischen Gewerkschaft Wettin. Im Zusammenhang hiermit soll sich in der auf den 25. d. M. einberufenen Generalversammlung über den Erwerb dieses Unternehmens Bericht erstattet werden. Nach Informationen besitzt die Gesellschaft gegenwärtig annähernd die Hälfte der Wettin- Kuxe. Nach einem Rundschreiben, unterzeichnet vom Aufsichtsratsvorsitzenden der Oldenburger Eisenhüttengesellschaft und vom Grubenvorstandvorsitzenden wie auch vom bergmännischen Direktor der Gewerkschaft Wettin haben der Oldenburger Aufsichtsrat und der Grubenvorstand von Wettin gemeinsam am 5. August (1919) eine Besichtigung der gesamten Anlagen der Gewerkschaft Wettin vorgenommen. Als Resultat dieser Besichtigung wird berichtet: 1. Gewerkschaft Wettin, Abteilung Eisenerze. Auf der Grube Wilkauer vereinigt Feld liegen ca. 2.000 Tonnen manganhaltiger Brauneisenerze, Brauneisenstein und Manganmulm zum Abtransport bereit und können gleich mit gutem Nutzen verkauft werden. Der Versand hat bereits begonnen. 2. Gewerkschaft Wettin, Abteilung Marmor- und Kalkwerke. Die Besichtigung der Gruben ergab ein allgemein befriedigendes Resultat. Die Anbrüche sind als sehr gut zu bezeichnen, Die Förderung beträgt zur Zeit ca. 20 t täglich. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß der Betrieb zur Zeit in eingeschränktem Maße stattfindet und in aller Kürze bedeutend vergrößert werden wird. Die Fabrikanlage befindet sich ebenfalls in gutem Zustande und ist in vollem Betrieb. Die Maschinen- und Gebäudeanlagen besitzen jetzt einen ziemlich großen Wert. 3. Gewerkschaft Wettin, Abteilung Zinkvorkommen. Die Zinkerze in der Grube Herkules, die bisher mangels einer Aufbereitung nicht abgebaut wurden, stehen in ziemlich großen Mengen und reichhaltiger Qualität an und zwar in den Gehalten 22 – 40 Proz. Zink im Roherz. Diese Zinkerze sollen jetzt in der ersten Zeit für den Abbau vorgerichtet, gefördert und versandfähig gemacht werden und versprechen einen großen Nutzen abzuwerfen. 4. Gewerkschaft Wettin, Abteilung Meyers Hoffnung Fundgrube. Nachdem der neue Stollen aufgewältigt und mit dem Tagebau in Verbindung gebracht worden ist, wird die Förderung nächstens durch den Stollen vor sich gehen. Dieselbe betrug bisher 15 – 20 t und wird jetzt voraussichtlich auf das Doppelte erhöht. Das dortige Kalkvorkommen eignet sich hervorragend für Bau- und Düngezwecke und findet bei der enormen Nachfrage reißenden Absatz, so daß wir den Anforderungen nicht entsprechen können. Die Gewerkschaft Wettin beschäftigt zurzeit ca. 100 Arbeiter und verspricht, den Gewerken und Aktionären der O. E. für das Geschäftsjahr 1919/20 einen großen Gewinn zu bringen. Der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft in Gemeinschaft mit dem Grubenvorstand beabsichtigt, den Betrieb jetzt weiterhin zu vergrößern, um ihn lukrativer zu gestalten. Sämtliche anwesende Herren waren über das Ergebnis der Besichtigung äußerst zufrieden. Die Verwaltungserklärung vom 3. Juli, wonach die Beteiligung an einem Unternehmen mit großem Nutzen abgestoßen werden konnte, kann sich also nicht auf die Gewerkschaft Wettin, sondern nur auf ein anderes Geschäft beziehen, worüber eine nähere Mitteilung vom 25. d. M. zu erwarten ist. Bei dieser Gelegenheit dürfte auch ein weiteres Geschäft zur Sprache kommen, das die Gesellschaft einzugehen im Begriff stehen soll. Zu der letzten Bemerkung möchten wir darauf hinweisen, daß, wie von uns bereits früher betont, die Meldungen über das Antreffen von abbauwürdigen Erzvorkommen im Hunsrück vorläufig mit großer Vorsicht aufzunehmen sind. Auch maßgebende amtliche Stellen scheinen den Wert der Lager nur verhältnismäßig niedrig einzuschätzen.“ An das Oberbergamt von der B.B.C. (Bergbehörde Chemnitz) am 10. August 1919 mitgeteilt. Wir konnten uns nicht verkneifen, diese Texte hier vollständig zu zitieren; konnten allerdings noch nicht herausfinden, um was für eine Zeitschrift es sich hier gehandelt hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Unternehmen selbst sah sich
natürlich ganz anders und verfaßte über die eigene bergbauliche und
wirtschaftliche Situation das nachstehende (40169, Nr. 145, Blatt 32ff)...
Exposé Abt. Eisensteinbergbau. „Der Eisensteinbergbau in den Feldern der Gewerkschaft Wettin bei Langenberg ist uralt und kam zu Anfang der 90er Jahre infolge Einstellung der Schwarzenberger Hochöfen zum Erliegen, ohne daß die Vorräte der im Betrieb befindlichen Gruben auch nur annäherungsweise erschöpft waren. Schon die Pingenzüge des alten Bergbaus zeigen, daß enorme Ablagerungen vorhanden waren und daß vordem ein großzügiger Bergbau umgegangen ist. Man nahm mit Recht allgemein an, daß mehrere solcher Erzlager, wie sie bereits abgebaut wurden, noch unberührt und nicht erschlossen vorhanden seien. Man kann heute mit Bestimmtheit sagen, daß noch sehr große Mengen von Mangan- und Brauneisenstein in den Grubenfeldern der Gewerkschaft Wettin gefördert werden können und daß sich ein gut rentabler Abbau daselbst entwickeln kann. Schon seit langer Zeit wurde von vielen Seiten angeregt, das ausgedehnte Gebiet der Gewerkschaft durch einen Wünschelrutengänger begehen und auf vorhandene Ablagerungen von Brauneisenerzen untersuchen zu lassen, um vor langwierigen und oft fehlschlagenden Aufschlußarbeiten, wie sie beim Brauneisensteinbergbau nach der Natur der Vorkommen sehr oft eintreten, vorbei zu kommen. Diesem Gedanken schlossen sich nach und nach auch die Bergbaufachleute an und wurde daher kürzlich das ganze Gebiet von einem solchen Techniker mehrere Tage begangen, welcher hierbei eine Menge Lager noch unberührt von den verschiedensten Mächtigkeiten und Längserstreckungen feststellte. Die Überdeckung dieser Lager soll nach dessen Angaben zwischen 18 m an den leichten Anhöhen und bis zu 25 m in den Mulden betragen. Starke Wasser sollen nach dessen Angaben im allgemeinen nicht vorhanden sein, die den späteren Abbau hindern. Um einen Beweis für die Richtigkeit dieser Angaben zu haben, wurde er an den im Vorjahre betriebenen Schacht im Dorfe, der infolge starken Wasserzudrangs zugrundeging und verfüllt werden mußte, hingeführt. Dort stellte er als eine Ausnahme starke Wasser fest, wonach man auf ziemliche Genauigkeit seiner sämtlichen Angaben schließen kann. Die bergmännischen Arbeiten sind
in der kurzen Zwischenzeit noch nicht soweit vorgeschritten, daß man mit
dem im Betrieb befindlichen Schachte das Lager, welches bei 22 m Teufe
angehauen werden soll, erreicht hat, da es zurzeit sehr an geeigneten
bergmännischen Arbeitskräften fehlt. Der Schacht ist zurzeit 15 m tief und
würde sich nach den Angaben des Wünschelrutengängers folgendes Bild
ergeben lassen, welches ich im Querschnitt durch anliegende Skizze Nr. 1
dargestellt habe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skizze 2 zeigt einen Grundriß der
Lagerstätte, wo die Überdeckungsmassen als abgedeckt und die Erzlager als
freigelegt zu betrachten sind. Nachstehend folgt ein Entwurf, der ein
solches Vorkommen im Grundriß bildlich zeigt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solche Erzlager sollen über das
ganze Grubengebiet nach der Feststellung des Wünschelrutentechnikers noch
sehr viele unberührt vorkommen. Diese sind wegen der geringen Teufe vorab
mit kleinen Schächten zu gewinnen. Schließt sich die Sache günstig auf,
was nach diesen Feststellungen anzunehmen ist, kann man je nach
Geländelage nachher entweder durch Stollenabbau oder durch maschinell
betriebenen Schacht die Erze in großem Stile abbauen und durch Erhöhung
der Arbeiterzahl jedes gewünschte Quantum fördern. Bei der geringen
Überdeckung kann mit einem sehr gut rentablen Abbau für die Zukunft
gerechnet werden, der große Gewinne abwerfen kann. Nach diesen
Feststellungen und den angegebenen Zahlen ließen sich bei 100 Mann
Belegschaft monatlich 1.250 t manganhaltiger Brauneisenstein mit 50%
Metallinhalt fördern. Diese 1.250 t würden bei einem Verkauf auf der Basis
42% zu 35,- M. per Tonne, 1,- M. per % und Tonne = 43,- M. per Tonne frei
Station Schwarzenberg ergeben. Mithin wäre eine monatliche Einnahme = 25
mal 100 mal ½ mal 43 = 53.750,- M. zu erzielen. Die Betriebs- und
Gewinnungskosten würden sich folgendermaßen gestalten:
mithin im Jahre 12 mal 14.000,- = M 168.000,- Reingewinn. Eine genaue Mengenberechnung würde nach den enormen Angaben des Wünschelrutengängers zu phantastischen Zahlen führen und soll daher nicht weiter erwähnt werden. Immerhin ist damit zu rechnen, daß ein langjähriger Betrieb mit diesen Zahlen umgehen kann. Auf den verschiedenen Schächten lagern außerdem ca. 2.500 t manganhaltige Brauneisensteine und Manganmulm zum Abtransport. Diese Erze haben einen Gehalt zwischen 38 – 42% Metall (35 – 37% Fe und 3 – 5% Mn) und sind vorab 500 t davon an die Firma Bloch in Breslau zu M 35,- frei Waggon Schwarzenberg auf der Basis 42% M 1,- per % und Tonne verkauft. Diese Vorräte werfen einen ziemlich großen Nutzen ab und kann man immerhin nach Abzug von Fuhrlohn und Verladekosten mit einem Reingewinn von rund 18,- M per Tonne rechnen. (...) Raschau i. Erzg., den 1. September 1919“ Unterzeichnet ist das Exposé vom Vorsitzenden der Gewerkschaft Wettin, nun ein Herr Gustav Knapper, und von dem uns schon bekannten Bergwerksdirektor Heinrich Keiner. Nun, wenn man diese Selbstdarstellung des Unternehmens genau liest, kann man durchaus herauslesen, daß Vorräte tatsächlich vorhanden waren und daß man nur annehme, daß es noch weitere gäbe. Ansonsten erscheint mir dieses Traktat eine völlig übertriebene Lobhudelei zu sein, die nur dazu dienen konnte, unwissende Aktienkäufer hinters Licht zu führen. Oder die Verfasser hatten wirklich keine Ahnung von ihrem Fach, denn wenn man sein ganzes Gutachten auf die Angaben eines „Wünschelrutentechnikers“ stützt, dann weiß eigentlich jeder halbwegs Sachverständige, was es wert ist.Mit Bezug auf die angeblich so reichhaltigen Zinkerzvorkommen der „Abteilung Marmor- und Kalkwerk Fürstenberg“ der Gewerkschaft ‒ nebst Meyers Hoffnung hatten sie nämlich auch das erworben ‒ im weiteren Text dieses Exposés findet man übrigens die handschriftliche Anmerkung eines sächsischen Bergbeamten: „Schwindel oder Dummheit.“ Mehr gibt´s dazu auch meinerseits nicht zu sagen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nicht besser wurde ein Jahr später auch
in der Regionalpresse über die Gewerkschaft Wettin und ihre amtierenden
Hintermänner berichtet. Ein in der Grubenakte enthaltener Ausschnitt aus
dem ,Erzgebirgischen Volksfreund‘ Nr. 269 vom 7. November 1920 (Ausriß
in 40169, Nr. 145, Blatt 1) berichtete über die:
Eisenerz AG Schwarzenberg i. Sa. „Wir lesen in der Frankfurter Zeitung: Die Mißwirtschaft bei diesem Unternehmen, das seit 1 – 2 Jahren nur ein börsengängiges Gehäuse für neugekaufte Effekten und Erzkuxe darstellt, scheint darin zu bestehen, daß ungehörige, wenn nicht unzulässige Geschäfte mit diesen Wettin- Kuxen gemacht werden. Die Gewerkschaft Wettin ist 1919 von der Aktiengesellschaft aus dem Kreis ihrer neuen Großaktionäre erworben worden und sollte auf Erze usw. ausgebaut werden. Inzwischen hat man aber entweder Geld für den Betrieb und Ausbau gebraucht oder eine glatte Spekulation machen wollen. Denn schon die letzte Bilanz zeigte, daß die Eisenerz AG einen Teil ihrer 1000 Kuxe verkauft und Nutzen daraus gezogen hatte. Es wird nun behauptet, daß diese oder weitere Kuxanteile dazu dienten, auch noch vereinzelten Verwaltungsmitgliedern Geld oder Provision zuzuführen, ferner, daß Garantien bei diesen und anderen Effektenverkäufen von der Eisenerz AG übernommen seien. Daß die Vorgänge zur Suspension des Direktors Bries geführt haben, ist bereits bekannt. Die Verwaltung zögert merkwürdiger Weise mit der offiziellen Bekanntgabe der Einzelheiten. Man muß das, nachdem die Gerüchte über die Vorgänge bereits in breitere Kreise gelangt sind, d. h. nachdem die Zustände selbst der Verwaltung bereits seit einiger Zeit bekannt sein müssen, als befremdlich erklären, gleichviel, welche Absichten man mit der Geheimhaltung verbindet. Eine authentische Auslassung, auch über die Situation der Hauptaktiva, also der Gewerkschaft Wettin, muß umso dringender verlangt werden, als die Aktienkäufer der letzten Zeit offenbar ahnungslos sind, wie der Kurs von 187 ä 184,50 (bei zuletzt 0 Dividende) zu beweisen scheint.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat der Zeitung bei der
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berginspektor G. Tittel hatte
mit seiner
Aber zur Beruhigung der Aktionäre hielt man einen gewissen Betrieb in Gang, über den die Berginspektion am 24. Oktober 1919 berichtete, einen der Schächte habe man auf nun 19 m Teufe weiter abgesenkt und beim Abteufen auch Brauneisenerz gewonnen, das bereits zum Versand gelangt sei (40169, Nr. 144, Blatt 189). Und im Fahrbericht vom 13. Dezember 1919 (40169, Nr. 144, Blatt 191) heißt es, der untere Schacht solle „mit seinem Fuße in Brauneisenerz anstehen, doch sind bereits alte Strecken vorhanden.“ Wen wundert's... Offenbar aber war der Glaube an die
Dividende ungebrochen und Herr Keiner teilte am 3. Januar 1920 nach
Freiberg mit, man habe nun auch das
Wie die Berginspektion nach einer weiteren Befahrung am 27. Mai 1920 nach Freiberg berichtete, hatte man den noch bis auf 26 m verteuften Schacht inzwischen wieder abgeworfen und verfüllt. Der zweite war außer Betrieb, stattdessen wurde das Abfüllen von Haldenbergen fortgesetzt (40169, Nr. 144, Blatt 198).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von der Befahrung am 1. Februar 1921
war dann zu berichten, man habe schon wieder einen neuen Schacht „neben
dem alten“ angesetzt und 17 m abgeteuft. Weil er ringsum von Bruchfeld
umgeben sei, so schätzte der Berginspektor wieder ein, gäbe es nur „wenig
Hoffnung auf bauwürdige Erze.“ (40169, Nr. 145, Blatt 6) Außerdem fand
Berginspektor Tittel im April 1921 auch wieder Bohrungen „in der
Flur Raschau“ im Gange vor (40169, Nr. 145, Blatt 7).
Auch am 30. Oktober des Jahres ruhte der bergmännische Betrieb, der alte Schacht war nun ganz verfüllt und es erfolgte nur die „Wegfüllung von Eisenerz aus den vorhandenen Halden.“ (40169, Nr. 145, Blatt 12) Nach Wintereinzug scheint man dann die übertägigen Arbeiten eingestellt und den Schacht wieder belegt zu haben, worüber die Berginspektion unter dem 16. Dezember 1921 berichtete, der verbliebene Schacht war nun 24 m niedergebracht; dort habe man ein Eisenerzlager von ein bis zwei Meter Mächtigkeit angefahren und ein Streckenort belegt (40169, Nr. 145, Blatt 16). Am 1. Februar 1922 berichtete Regierungs- Bergrat Bachmann dann, im Schacht seien die Wasser wieder um 3 m über die Schachtsohle aufgegangen. Statt sich um eine vernünftige Wasserhaltung zu kümmern, teufte man nun, nur 60 m südwestlich vom letzten, wieder einen neuen Schacht ab... Das Abteufen zeigte Herr Keiner am 8. Februar auch offiziell beim Bergamt an (40169, Nr. 145, Blatt 17ff). Mit Schreiben vom 26. September 1922 zeigte Bergdirektor Keiner dann „infolge der fortgesetzten wirtschaftlichen Unsicherheit“ die gänzliche Einstellung des Betriebes an und beantragte Fristhaltung, welche auch genehmigt worden ist (40169, Nr. 145, Blatt 22f). Weil das ja nur eine befristete Betriebseinstellung bedeutete, führte Herr Bachmann am 7. November 1922 eine Kontrolle durch, wobei er aber alles ordentlich verschlossen fand (40169, Nr. 145, Blatt 24).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das war aber immer noch nicht das Ende
der Spekulationen. Anfang 1923 hat dann die uns aus dem voranstehenden
Text auch schon bekannte Berlin'er Gießerei und Metallwarenfabrik Schulz &
Sackur zumindest „eine Kuxmajorität“ der Gewerkschaft Wettin
erworben. Deren Aufsichtsratsvorsitzender Walter Lewinsky wurde nun
auch Vorstandsvorsitzender der Gewerkschaft (40169, Nr. 145, Blatt 27f).
Getan wurde aber nicht mehr wirklich etwas, nur die Verlängerung der Fristhaltung beantragt. Auch um die noch vorhandenen Anlagen kümmerte man sich nur mangelhaft und Inspektor J. V. Schotte aus Zwickau fand am 30. Juli 1923 die Schächte unverschlossen vor. Auf die Aufforderung des Bergamtes hin wurden die Schachtöffnungen mit Pfosten abgedeckt und zugenagelt (40169, Nr. 145, Blatt 38f). Am 16. September 1924 fand der Inspektor aber schon wieder die Schachtkaue aufgebrochen und die Schachtabdeckung kaputt vor. Das wurde noch einmal in Ordnung gebracht (40169, Nr. 145, Blatt 42). Weil die letzte Genehmigung Ende 1924 abgelaufen war, erging am 12. Januar 1925 die übliche Aufforderung zur Betriebsaufnahme an den Vertreter der Besitzer, W. Lewinsky (40169, Nr. 145, Blatt 44). Schnell wurde noch ein neuer Antrag eingereicht und tatsächlich noch einmal genehmigt (40169, Nr. 145, Blatt 46ff). Das wiederholte sich nach Ablauf der Betriebsfrist Anfang 1926 wieder. Weil keine Reaktion aus Berlin erfolgte, drohte das Bergamt am 10. Februar 1926 diesmal aber die Entziehung des Bergbaurechtes an (40169, Nr. 145, Blatt 55). Auf die Mitteilung aus Berlin hin, daß Herr Lewinsky am 19. März 1926 verstorben sei, beschloß man in Freiberg die bereits angedrohte Entziehung des Bergrechts umzusetzen, was dann auch am 16. Juni 1926 formal erfolgt ist (40169, Nr. 145, Blatt 64ff). Das war's nun wirklich. Die Grube Wilkauer vereinigt Feld und ihre Nachfolger war immerhin diejenige, welche noch am längsten, bis ins 20. Jahrhundert hinein, zumindest Bergbauversuche in Langenberg angestellt hatte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Entziehung des Bergbaurechtes
1926 sind die Grubenfelder der Gewerkschaft Wettin übrigens um 1929 in staatlichen (sächsischen)
Besitz übergegangen und sind in
einem neuen Feld unter dem Namen ,Greifenstein' mit anderen Flächen zusammengefaßt
worden (40169, Nr. 134, Blatt 80ff).
Dies diente aber nur der Sicherung des staatlichen Vorrechts, den Bergbau
‒ sofern es sich denn lohnen würde ‒ selbst in die Hand zu nehmen und auf
eigenen Gewinn zu betreiben. Geschehen ist hier nichts mehr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gewerkschaft Fürstenberg ‒ vormals
Chemnitzer Eisensteingruben
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die gab´s ja auch noch. Obwohl das
eigentliche Grubenfeld schon außerhalb des Schwarzbachtales lag, dem sich
unser Beitrag vorrangig widmet, waren die Chemnitzer Eisensteingruben ja
die erste Mutung des Herrn Gustav Zschierlich (schon
Laut dem Übersichtsblatt in der
Grubenakte umfaßte das am 24. April 1875 dann tatsächlich verliehene
Grubenfeld übrigens die gegenüber der Mutung vom 17. Oktober 1872 (und den
alles in allem 14 Nachmutungen) viel kleinere Fläche von 176.708 m² oder
30 Maßeinheiten (40169, Nr. 513, Blatt
I).
Wahrscheinlich handelte es sich dabei um diejenige Teilfläche in der
Croquis, die westlich des Fürstenbergs zum Sauerwiesengrund hin gelegen
hat. Unter dem Namen Fürstenberg Fundgrube ist außerdem ein
winziges Feld unweit der Köhlerhütte in den
Gleich am 22. Dezember 1875 hat G. Zschierlich die Fristhaltung des Grubenfeldes beantragt und bekam sie zunächst bis Ende 1876 auch genehmigt (40169, Nr. 513, Blatt 8). Als Betriebsleiter benannte Herr Zschierlich auch hier den uns schon bekannt gewordenen Steiger Adolph Mai aus Dietz in Nassau. Der hatte freilich nicht wirklich viel zu tun, denn auch für das folgende Jahr 1877 wurde wieder Betriebsaussetzung genehmigt (40169, Nr. 513, Blatt 9f). Der nächste Antrag auf Fristhaltung vom 5. Januar 1878 kam schon aus Geyer, wo Herr Zschierlich ja inzwischen die Farbenfabrik erworben hatte. Wegen der „immer noch so ungünstigen Eisen- Conjunctur und dem anhaltend geringen Absatz“ wurde er auch wieder genehmigt (40169, Nr. 513, Rückseite Blatt 11). Es lief also auch hier kaum anders, als bei seinen übrigen Grubengebäuden. Schon in einem Bescheid über die Stundung der Grubenfeldsteuern vom 18. November 1878 schrieb das Bergamt aus Freiberg an den Besitzer: „Übrigens glauben wir bei gegenwärtiger Gelegenheit Ihnen empfehlen zu dürfen, selbst in Überlegung zu ziehen, ob Sie nicht durch gänzliche oder wenigstens theilweise Lossagung der Ihnen verliehenen Grubenfelder sich eine wesentliche Erleichterung in der Grubenfeldsteuerentrichtung, ohne wesentliche Nachtheile für Ihr bergbauliches Interesse befürchten zu müssen, verschaffen können.“ (40169, Nr. 513, Blatt 12f) Das tat Herr Zschierlich aber nicht, stellte vielmehr Anfang 1879 den nächsten Fristhaltungsantrag (40169, Nr. 513, Blatt 14). Das wiederholte sich nochmals, ohne daß bis Ende 1881 auch nur irgend etwas praktisches in diesem Grubenfeld getan worden ist (40169, Nr. 513, Rückseite Blatt 15).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 2. Januar 1882 schrieb G.
Zschierlich dann nach Freiberg, „im Laufe diesen Jahres hoffe ich,
meine Gruben in Betrieb zu setzen...“ und benannte nun auch hier den
uns wohlbekannten Ernst Julius Fröbe als Betriebsleiter (40169,
Nr. 513, Rückseite Blatt 16). Der wiederum zeigte dann, freilich erst am
12. Dezember 1882, beim Bergamt den Vortrieb eines Rothenberger Stollns
zwischen Globenstein und Pöhla (diese Teilfläche aus der Mutung muß also
in der Verleihung eingeschlossen gewesen sein) sowie eines zweiten Stollns
am Fürstenberg bei Waschleithe an (40169, Nr. 513, Blatt 19).
Aufgrund der nun erfolgten Betriebsaufnahme besuchte Berginspektor L. Menzel am 10. Januar 1883 den Fürstenberg und berichtete dann in seinem Fahrjournal: „Ein alter Schacht ist wieder in Stand gesetzt und eine alte Strecke wieder befahrbar gemacht und erlängt worden und hat man damit schönen Eisenstein angefahren, dessen Gewinnung in Aussicht genommen ist.“ Bergpolizeiliche Erinnerungen hatte er nicht zu machen (40169, Nr. 513, Blatt 21f). Etwas ausführlicher berichtete über seine Befahrung vom 30. April 1885 dann der damalige Berginspektions- Assistent G. Tittel, die Grube sei ohne Belegung, jedoch in fahrbarem Zustand, „bis auf den verbrochenen, jedoch das Wasser abführenden Stolln.“ Der Schacht war 18 (Ellen, Angabe der Maßeinheit im Originaltext unklar) tief, der Holzausbau schon wandelbar, solle jedoch nach Angabe des Betriebsleiters Fröbe fahrbar erhalten werden. Es war nur ein Ort und eine kurze Seitenstrecke getrieben, von letzterer aus ein Überhauen von 12 m Höhe unter 25° (dem Fallen des Lagers). Bergpolizeiliche Erinnerungen hatte auch er nicht zu machen und so stehe weiterer Fristhaltung nichts entgegen (40169, Nr. 513, Blatt 23f). Schau an, das war's also schon wieder... Die Fristhaltung wurde auch bis Ende 1886 erneut genehmigt und war diesmal von Zschierlich in seinem Antrag mit „der beabsichtigten Liquidation der Schwarzenberger Hütte“ begründet (40169, Nr. 513, Blatt 26f). Auch jetzt wiederholte sich das weiter bis Ende 1888...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann zeigte Gustav Zschierlich
am 3. Januar 1889 in Freiberg an, er wolle das Stollnort zu
Untersuchungszwecken wieder in Schlag nehmen. Auf die Aufforderung aus
Freiberg hin benannte er außerdem W. Schramm, Zimmerling auf
Friedrich Fdgr., als Steiger für die Chemnitzer Eisensteingruben
(40169, Nr. 513, Blatt 30ff). Am 12. April 1889 schrieb Zschierlich
dann aber nach Freiberg, die Betriebsaufnahme sei bisher „wegen des
großen Schneefalls“ und „weil der Schacht mitten im Walde am
Fürstenberge“ läge und unzugänglich gewesen ist, noch nicht möglich
gewesen. Nun sei zwar Tauwetter eingetreten, aber weil der noch immer
verbrochene Stolln das Wasser ja nur verzögert abführte, stehe die
Stollnsohle einen halben Meter hoch unter Wasser (40169, Nr. 513,
Blatt 33).
Übrigens erfolgte auch am Rothenberger Stolln die Betreibsaufnahme nicht, nur habe Herr Zschierlich hier noch keine Einigung über einen Haldensturzplatz mit den Grundeigentümern erzielen können... Das nächste Fahrjournal vom 13. Mai 1889 stammt aus der Hand des Inspektors Neukirch und berichtet uns (40169, Nr. 513, Blatt 36f): „Von sämmtlichen in und bei Langenberg befindlichen und dem Fabrikbesitzer Zschierlich in Geyer gehörigen Berggebäuden war nur der zu Gnade Gottes vereinigt Feld gehörige Tagebau am Gustavschacht mit 3 Mann belegt... Von der Chemnitzer Eisensteingrube am Fürstenberge (unweit vom Fürstenbrunnen) ist der etwa 10 m tiefe Schacht neu ausgezimmert worden. Die weitere Aufnahme des Betriebes konnte hier deshalb nicht geschehen, weil die vom Schachte aus getriebene Stollnstrecke ungefähr 0,5 m hoch unter Wasser stand. Der Stolln ist nach seinem Mundloche zu verbrochen und läßt die Wasser nur langsam abfließen.“ Zu bergpolizeilichen Ausstellungen fand auch Herr Neukirch keinen Anlaß (40169, Nr. 513, Blatt 36f). Nun, wenn man´s ernsthaft angehen wollte, hätte man je den Stolln zuerst in Angriff genommen, um sich Wetter- und Wasserlösung zu verschaffen, aber der Leser ahnt schon: Darum ging´s auch hier ja gar nicht... Auf die Aufforderung des Bergamtes, doch für den weiteren Aufschluß einen Betriebsplan einzureichen, antwortete Herr Zschierlich jedenfalls am 13. August 1889 mit einem neuen Antrag auf weitere Fristhaltung (40169, Nr. 513, Blatt 39), diesmal mit der Begründung, daß „Herrn Förster in Berlin der nachgesuchte, ermäßigte Tarif seitens der königlich- preußischen Staatseisenbahn noch nicht genehmigt worden ist und es so vollständig an Absatz für Eisenstein mangelt.“ Ah, ja, wir erinnern uns ‒ aber was hat denn eigentlich Paul Förster in Berlin jetzt auch mit dieser Grube zu tun ? So verliefen auch die folgenden Jahre und im weiteren Akteninhalt stapeln sich Anträge auf Fristhaltung und Feldsteuererlaß, die gewöhnlich auch genehmigt worden sind und über 1898 hinaus reichen. Ein einziges Fahrjournal des Inspektors Wappler vom 26. Juli 1893 haben wir dazwischen noch gefunden, dem zufolge er mit Bergverwalter Fröbe das Grubenfeld begangen und dabei gefunden habe, daß „an der Hängebank des Schachtes Eisenerze zur Abfuhr aufgestürzt (waren). Zschierlich hat in letzter Zeit einen Posten von ungefähr 200 Centnern nach Chemnitz verkauft.“ Betrieb ist (zumindest bei seiner Anwesenheit) nicht auf der Grube umgegangen (40169, Nr. 513, Blatt 53f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf der Gewerkenversammlung in Geyer am
14. Januar 1899 ‒ am 23. Oktober 1898 hatte die ,Gewerkschaft
Fürstenberg' ihre Statuten in Freiberg eingereicht (40169, Nr. 513,
Blatt I)
‒ gab Gustav Zschierlich sein Ausscheiden aus dem Vorstand bekannt.
Zum weiteren Betrieb beschloß man, die Brüche auf dem Stolln zu gewältigen
und dann das Ort weiter nach dem Lager zu treiben (40169, Nr. 513, Blatt
75f). Tatsächlich erfolgt ist aber wieder einmal mehr gar nichts, und am
3. März 1898 wurde weitere Fristhaltung beantragt, diesmal mit der
Begründung, daß keine Arbeiter zu engagieren seien (40169, Nr. 513, Blatt
80).
Die folgenden Grubenfeldbefahrungen hat dann Inspektor Tittel vorgenommen. Am 25. Februar 1899 etwa berichtete er, daß ein Durchschlag auf den benachbarten Kräherschacht nicht zu erwarten sei ‒ wie auch, da hätte man die Grube ja erst einmal in Betrieb setzen müssen. In diesem Fahrjournal ist aber eine Abzeichnung des folgenden Grundrisses enthalten und dazu ein mit Bleistift gezeichneter Saigerriß, welche uns einen Eindruck vermitteln, was in der ganzen bisherigen Zeit denn eigentlich geschehen ist. Der wieder gewältigte Stollnteil hat in der Zeichnung des Inspektors 1899 den Namen ,Fürstenstolln' erhalten (40169, Nr. 513, Blatt 82f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei seiner Anwesenheit am 11. Juli 1899
fand Herr Tittel dann, daß der Kräherschacht nachverfüllt
und der Deckel am Lichtloch des Fürstenstollns repariert werden
müsse. Bergverwalter Fröbe hat sich darum gekümmert und bei seinen
nächsten Befahrungen am 12. Juni 1900 und am 11. September
1901 fand der Inspektor alles ordnungsgemäß vor (40169, Nr. 513, Blatt
87f, 93f und 99f).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann muß die Gewerkschaft Fürstenberg
einen neuen Besitzer bekommen haben ‒ offenbar auch hier wieder auswärtige
Investoren. Die Grubenakte enthält die folgende Abschrift aus der
zugehörigen Akte des Landesbergamtes, die Verleihung
betreffend (40024-10, Nr. 158, enthalten in 40169, Nr. 513, Blatt 104,
Eingangsvermerk 19. April 1902):
„An das Königliche Bergamt Freiberg i. Sa. Am 18. März fand zu Düsseldorf eine außerordentliche Gewerkenversammlung der Gewerkschaft Fürstenberg mit folgender Tagesordnung statt. (...) Für das Einschreiten der Bergbehörde dürfte aber die Feststellung genügen, daß der Existenzberechtigung der Gewerkschaft jede gesetzliche Basis fehlt, weil das Fundament, auf dem dieselbe sich aufzubauen hat, hier nicht vorhanden ist. Das erste Erfordernis für die Verleihung von bergbaulichen Rechten ist der zu erbringende Nachweis, daß von den Betreffenden in dem ihnen verliehenen oder in den von ihnen sonstwie erworbenen Bergrechtsamen auch thatsächlich in bergmännischer Weise und nicht nur scheinhalber Bergbau betrieben wird. Dieses unerläßliche Kriterium fehlt hier aber, die Gewerkschaft hat niemals Bergbau betrieben. Erst nachdem die Bergbehörde einschritt, hat der Grubenvorstand etliche Arbeiter ‒ ich glaube 2 bis 3 ‒ in Geyer angenommen und sie scheinshalber in den Eisensteinfeldern mit allem anderen, nur nicht mit Arbeiten, wie sie ein ordnungsmäßiger Bergbau erheischt und voraussetzt, beschäftigt. Mit vorzüglicher
Hochachtung, ppa. Max Erler, Ob die zwei Herren aus Leipzig zu den Investoren gehört haben und das sächsische Bergamt mit diesem Schreiben über die in Düsseldorf besprochenen Inhalte nur in Kenntnis setzen wollten, oder ob Herr Max Erler wirklich noch Prokura für die Gewerkschaft inne hatte, weiß man nicht so genau. Darüber befragt, teilte aber auch Herr Tittel von der zuständigen Berginspektion in Zwickau nach Freiberg mit, es habe während seiner Amtszeit hier „keine echten bergmännischen Arbeiten“ gegeben (40169, Nr. 513, Blatt 106). Tatsächlich muß es hierüber ein Gerichtsverfahren in Nordrhein- Westfalen gegeben haben, jedenfalls fragte auch ein Richter des königlichen Landgerichtes in Düsseldorf im Dezember 1902 beim königlich- sächsischen Bergamt nach und ersuchte in der Untersuchungssache gegen den Bergwerksdirektor Rudolf Landgraf wegen Betruges um Auskunft, ob denn in dem in Rede stehenden Bergwerk der Gewerkschaft Fürstenberg in Sachsen, dessen Ertrag nun in Lintorf im Rheinland geschehe, Betrieb umgehe. Dem Schreiben des Landrichters ist zu entnehmen, daß besagter Herr Landgraf die Kuxe der Gewerkschaft zu 750,- Mark (wohlgemerkt: pro Stück, nicht etwa alle zusammen) verkauft habe und daß der Käufer nun klage, daß weder damals noch heute überhaupt kein bergmännischer Betrieb stattgefunden habe (40169, Nr. 513, Blatt 109). Dem weiteren Akteninhalt ist zu entnehmen, daß offenbar die Walz- und Stanzwerke zu Lintorf, damals ein Hersteller für Spaten, Kohlenschaufeln und Pflugriestern aus Gusstahlblechen, der Käufer dieser Kuxe gewesen sind. Herr Landgraf in Lintorf war von 1898 bis 1902 Vorsitzender (und dessen Stellvertreter ein Herr Regnier Eickworth) des Vorstands der Gewerkschaft. Ab 1902 war dann ein Kaufmann Wilhelm Hüllstrung in Düsseldorf der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertreter ein Ingenieur Eugen Küderling, ebendort (40169, Nr. 513, Blatt I). Auf die Nachfrage des Bergamtes zu den Eigentumsverhältnissen der Gewerkschaft hin teilte dann das Amtsgericht in Ehrenfriedersdorf am 22. Dezember 1902 nach Freiberg mit, daß (wohl um weiteren Klagen aus dem Wege zu gehen) „das Lintorf'er Unternehmen“ nach dem Beschluß der Gewerkenversammlung vom 25. November liquidiert werden solle (40169, Nr. 513, Blatt 111). Daraufhin befand man im Bergamt, daß eine Betriebsaufnahme nun nicht mehr zu erwarten sei und teilte am 26. Februar 1903 an Herrn Hüllstrung die Entscheidung mit, daß die Bergbaurechte entzogen werden (40169, Nr. 513, Blatt 116). Ein Widerspruch kam dazu aus Düsseldorf nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der letzte Akt umfaßte das übliche
Schreiben seitens des Bergamtes, daß die Walz- und Stanzwerke als letzter
Betreiber noch für die Verwahrung der Grubenbaue zuständig seien,
woraufhin man aus Lintorf den Herrn Jean Ewald nach Sachsen sandte.
Wirklich viel zu tun gab es für ihn freilich nicht. Nur das
Stollnlichtloch wurde im August 1903 unter Aufsicht von Bergverwalter
Fröbe verfüllt (40169, Nr. 513, Blatt 119ff). Das werden die
Investoren wohl noch verschmerzt haben.
Gelegentlich einer Besichtigung in anderen Angelegenheiten war Herr Tittel am 1. Juli 1907 noch einmal zu einer Kontrolle vor Ort und bestätigte anschließend, daß es keine neuen Einsenkungen gäbe (40169, Nr. 513, Blatt 143).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G. Zschierlich's letzte
Versuche:
Vereinigte Braunsteinzechen im Schwarzbachtal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unter dem Namen ,Vereinigte
Braunsteinzechen im Schwarzbachtal' wurde Gustav Zschierlich,
inzwischen ,Rentier', am 23. Januar 1917 noch einmal ein Grubenfeld
von 35 Hektar, 94 Ar und 54 m² oder 90 Maßeinheiten verliehen (40169, Nr. 179, Blatt 1 und Übersichtsblatt in der
Akte). Eine Croquis zu diesem
Feld haben wir noch nicht gefunden. Aus dem Inhalt anderer Akten
erfuhren wir aber schon, daß es im nördlich des Schwarzbachs
gelegen haben muß.
Wie es üblich war, folgte sogleich die Aufforderung des Landesbergamtes in Freiberg an den Besitzer, die verantwortlichen Leiter zu benennen, einen Betriebsplan einzureichen usw. (40169, Nr. 179, Blatt 2). Am 15. März 1917 zeigte Zschierlich daraufhin die Betriebsaufnahme an und erklärte, er wolle den Friedrichstolln wieder eröffnen und einen neuen Tageschacht am Virginienschacht teufen (40169, Nr. 179, Blatt 6). Das sagt uns zumindest ungefähr, wo dieses Grubenfeld gelegen haben muß ‒ nämlich an der Nordseite des Schwarzbachtales. Bereits am 4. April 1917 folgte ein Schreiben, das von Gustav Zschierlich und von dem uns auch schon bekannten Karl August Zinnitz aus Berlin gemeinsam unterzeichnet war, in dem die beiden den Verkauf des Bergbaurechtes von Zschierlich an Zinnitz dem Bergamt mitteilten und der letztere hinsichtlich der Betriebsabsichten erklärte, er wolle den von Zschierlich bereits erläuterten Vorhaben folgen (40169, Nr. 179, Blatt 5). Am 25. April 1917 berichtete dann die Berginspektion Zwickau an das Landesbergamt, man habe „gelegentlich einer Besichtigung bei Wilkauer vereinigt Feld“ Bergdirektor Fröbe hierzu befragt und dieser habe angegeben, daß „nach seiner Kenntnis der früher vorhandenen Grubenbaue und der geologischen Verhältnisse die Absichten Zschierlich's aussichtslos wären, da sich das Grubenfeld am Ausstrich des Braunsteinlagers befinde.“ (40169, Nr. 179, Rückseite Blatt 6) Ganz offenkundig hatte
Zschierlich senior mit diesem Feld nur eines im Sinn: Den Handel mit
dem Bergbaurecht. Er selber hatte keineswegs die Absicht, hier noch einmal
etwas zu tun...
Berginspektor Tittel hatte mit seinem Urteil
über Zschierlich's
Immerhin berichtete die Berginspektion am 27. Juli 1917 erneut nach Freiberg, daß nördlich und östlich des Virginienschachtes drei Bohrlöcher gestoßen würden, „bisher jedoch ohne Erfolg.“ (40169, Nr. 179, Blatt 7)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da aufgrund der Verkaufsmitteilung vom 4. April des Jahres ja der Besitzer gewechselt hatte, erhielt am 7. Mai 1917 nun auch Karl Zinnitz vom Bergamt die übliche Aufforderung zur Betriebsaufnahme (40169, Nr. 179, Blatt 8). Ob dieser in Anbetracht des noch tobenden Weltkrieges Fristhaltung beantragt und für gewöhnlich zwei Jahre gewährt bekommen hat, geht aus dem Akteninhalt nicht hervor. Dann aber folgte am 22. Mai 1919 ein Schreiben der Gewerkschaft Wettin, in welchem sie dem Bergamt mitteilten, daß das Feld der Vereinigten Braunsteinzechen inzwischen zu dem ihren gehöre und daß sich die Gewerkschaft seit 24. März 1919 im Besitz der Oldenburgischen Eisenhütten AG zu Augustfehn befinde. Herr Zinnitz hat es also weiterverkauft... Hinsichtlich einer Betriebseröffnung heißt es darin weiter, daß man noch mit der Grundbesitzerin, Frau Bürgermeistergattin Oertel auf Tännicht über die Flächeninanspruchnahme in Verhandlungen stehe und bitte um Aufschub (40169, Nr. 179, Blatt 9). Die Akte enthält noch einigen Schriftwechsel hinsichtlich der Bestätigung des Besitzwechsels und dann einen Antrag auf weitere Betriebsaussetzung wegen des Mangels an ausgebildeten Bergarbeitern vom 8. März 1920, nun unterzeichnet von Grubenverwalter Heinrich Keiner (40169, Nr. 179, Blatt 12). Diesmal aber fackelte man in Freiberg gar nicht lange: Dem Übersichtsblatt ist zu entnehmen, daß der Gesellschaft am 27. Mai 1920 das Bergbaurecht für dieses Grubenfeld entzogen wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stattdessen hat Herr Keiner ‒ nun im Auftrag der Firma Schulz & Sackur zu Berlin ‒ 1921 unter dem neuen Namen Elisabeth Zeche dasselbe Feld noch einmal gemutet. Auch jetzt wurde es aber nur in Fristen gehalten und 1925 wieder losgesagt... (40169, Nr. 63 und 40024-10, Nr. 219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erhaltung der Bergbaurechte bei Gnade Gottes
durch
W. Zschierlich
bis 1938
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 11. April 1914 beantragte
Walter Georg Zschierlich, der Sohn von Gustav Zschierlich,
welcher 1904 das Farbenwerk in Geyer vom Vater übernommen hatte, die
Abtrennung eines Teils des der Gewerkschaft Adelma seines Vaters noch
gehörigen Grubenfeldes von Gelber Zweig. Dies wurde auch am 9. Juli
des Jahres genehmigt (40169, Nr. 134, Blatt 2).
Walter Zschierlich hat demnach ein Grubenfeld von 3 Hektar, 54 Ar
und 31 m² Größe oder 9 Maßeinheiten aus dem Besitz der Gewerkschaft Adelma
übernommen und diesem den Namen der alten Grube Gnade Gottes
gegeben. Auf der gerade oben gezeigten
Walter Zschierlich war ‒ dem Briefkopf eines seiner Schreiben zufolge ‒ inzwischen ,Chemiker' und in seiner Fabrik wurden inzwischen auch chemische Farbstoffe hergestellt, in geringerem Umfang aber noch immer ,Erdfarben'. Wie üblich, folgte auf die Verleihung am 1. August 1914 die Aufforderung des Bergamtes an den Besitzer, die leitenden Beamten zu benennen und einen Betriebsplan einzureichen. Nun begann aber der 1. Weltkrieg, Herr Zschierlich junior wurde eingezogen und bat daher noch am 12. August 1914 um Fristhaltung für das neue Feld. Diese wurde in Anbetracht der Umstände auch eine Woche später genehmigt (40169, Nr. 134, Blatt 4f). Nach Ablauf von zwei Jahren erging am 11. Februar 1916 seitens des Bergamtes die Aufforderung, den Betrieb aufzunehmen oder erneute Fristhaltung zu beantragen, woraufhin Herr Zschierlich seinen Antrag mit Schreiben vom 2. März 1916 erneuerte, weil „während des Krieges… eine Belegung der Grubenfelder ausgeschlossen ist.“ Auch dieser wurde genehmigt und es geschah in Langenberg weiterhin nichts (40169, Nr. 134, Blatt 6ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Genau so, wie es zur
Bei
Hier beauftragte das Landesbergamt nun die Berginspektion Zwickau damit, Erkundigungen einzuziehen, ob die von Walter Zschierlich getroffene Aussage, der Manganmulm sei als Manganrohstoff gar nicht zu gebrauchen, auch den Tatsachen entspreche. Daraufhin gab unter dem 13. Mai 1917 Inspektor Sarfert eine lange Stellungnahme ab, in der es heißt (40169, Nr. 134, Blatt 12ff), daß Walter Zschierlich das Teilfeld nur dazu übernommen habe, um hier weiter für die von seinem Vater übernommene Farbenfabrik Mulm als Farberde zu gewinnen. Der Inspektor sah daher auch ‒ übrigens im Gegensatz zu den Gewerkschaften, die aus dem Besitz von Gustav Zschierlich stammten ‒ daher auch keine Gefahr, daß die Bildung dieser Grube nur spekulativen Zwecken diene. Tatsächlich habe dieser Betrieb zuletzt nur geringen Umfang gehabt und ruhe seit 1912 ganz. Von den insgesamt vier Schächten seien drei schon wieder verfüllt, nachdem dort das Lager gänzlich abgebaut gewesen ist. Der Manganmulm enthalte bestenfalls 5 bis 6% Mangan und dafür habe „die Kriegs- Mangangesellschaft nach eigener Angabe keine Verwendung.“ Freilich könne in größerer Tiefe im Quarzbrockenfels noch Roteisenstein und Hartmanganerz mit bis zu 60% Mangangehalt (im Konzentrat ‒ natürlich nicht im Roherz) vorhanden sein, wie es früher auch im Sieben Brüder Stolln gefunden worden ist. Berginspektor Sarfert sprach sich infolgedessen für eine Verlängerung der Betriebsfrist aus, zudem „in der Schwarzenberg'er und Langenberg'er Gegend wirklich Arbeitermangel bestehe“ und nur, wenn sich ein Unternehmer zur Untersuchung der tieferen Schichten fände, wäre aus seiner Sicht eine Aufhebung der Betriebsfrist angeraten. Daraufhin zog man seitens des Bergamtes am 13. Juli 1917 die Aufhebung der Betriebsfrist gegenüber Walter Zschierlich's kleinem Grubenfeld wieder zurück (40169, Nr. 134, Blatt 13).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einmal wieder aufmerksam geworden,
folgte am 6. Juni 1917 auch eine Befahrung durch die Berginspektion, über
die es m Fahrbericht heißt, es gäbe noch zwei, mit Kauen überbaute
Schächte und in einem dritten hatte sich die Füllsäule um etwa 1 m
gesetzt, was nachzuverfüllen sei. Außerdem hatte man wohl den früheren
Bergverwalter Ernst Julius Fröbe konsultiert, der aber nach seiner
Aussage mit beiden Zschierlich's „nichts mehr zu tun“ habe (40169, Nr. 134, Blatt 14ff).
Das Auffüllen des dritten Schachtes hat Walter Zschierlich bis zur
nächsten Befahrung am 14. September 1917 auch erledigen lassen.
Das nächste Mal hat Herr Zschierlich rechtzeitig an einen neuen Infristsetzungsantrag gedacht; er wurde aber in Vertretung durch Frau Major Zschierlich unterzeichnet und am 5. Februar 1918 nach Freiberg gesandt. Weil noch immer Krieg herrschte, wurde dieser Antrag auch ohne Umschweife genehmigt (40169, Nr. 134, Blatt 17f). Nach Kriegsende wiederholte sich diese Geschichte mehrfach: Weil am 12. Mai 1920 noch kein Infristsetzungsantrag in Freiberg vorlag, erging wieder die Aufforderung zur Betriebsaufnahme an den Besitzer. Der sandte daraufhin am 31. Mai 1920 einen neuen Antrag nach Freiberg, in welchem es diesmal heißt, er könne „wegen hoher Holzpreise, Arbeiterlöhne und Arbeiterverhältnisse“ den Betrieb nicht aufnehmen (40169, Nr. 134, Blatt 19ff). Der Antrag wurde genehmigt und so geschah auf Gnade Gottes in Langenberg auch weiter nichts. Nach zwei Jahren war die Betriebsfrist wieder abgelaufen und auf die Aufforderung seitens des Bergamtes hin, begründete Walter Zschierlich seinen nächsten Fristhaltungsantrag nun damit, daß „infolge des Darniederliegens des Malergewerbes (...) der Bedarf an Manganmulm so sehr zurückgegangen“ sei, daß er seinen geringen Bedarf von 50 bis 60 t im Jahr günstiger bei den benachbarten Gruben Stamm Asser und Gottes Geschick einkaufe. Dem Antrag wurde am 20. Januar 1922 durch das Bergamt stattgegeben (40169, Nr. 134, Blatt 22ff). 1925 wiederholte sich der Vorgang erneut: In dem Antrag auf Fristhaltung vom 2. Juni des Jahres heißt es diesmal, daß sein Bedarf an Farberde „wegen ungünstiger Geschäftslage, besonders der Umstellung vieler Papierfabriken von farbigen Papieren zu Druckpapier“ weiterhin nur gering sei. Der Antrag wurde am 15. Juni 1925 wieder genehmigt (40169, Nr. 134, Blatt 25ff). Nur ein Jahr später begann alles von vorn und Herr Zschierlich begründete seinen Fristhaltungsantrag am 22. August 1926 jetzt damit, daß „infolge der Mode, möglichst helle, feurige Farben zu verwenden, der Bedarf an dunklen Nuancen (...) auf ein Minimum herabgesunken“ sei. Auch dieser Antrag wurde genehmigt (40169, Nr. 134, Blatt 31ff). Natürlich folgte der Unternehmer aber der Nachfrage und begann nun auch „Chemische Farben: Chromgelb, Chromgrün, Zinkgrün“ herzustellen. Wie man auf seinen Briefköpfen aus dieser Zeit lesen kann, stellte er aber noch immer auch „Manganbraun für Tapeten“ her. Die Sache wiederholte sich auch 1928 und 1930 (40169, Nr. 134, Blatt 37ff). Im Antrag vom 29. Januar 1930 wird die Fristhaltung des Grubenfeldes mit der „Geldknappheit“ begründet ‒ die Weltwirtschaftskrise und die Inflation suchten auch Europa heim... So ging es weiter, ohne daß ein wirklicher Bergbaubetrieb wieder aufgenommen wurde, bis Walter Zschierlich am 18. Oktober 1936 dann selbst die Wiederaufnahme des Betriebs „in Vereinigung mit Stamm Asser am Graul“ anzeigte und das Bergamt um Übersendung der dort deponierten Grubenrisse bat (40169, Nr. 134, Blatt 68). In Freiberg lagen aber gar keine deponierten Risse vor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die letzten Glücksritter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wahrscheinlich jedoch hatte Walter
Zschierlich auch jetzt gar nicht die Absicht, selbst bergmännischen
Betrieb wieder aufzunehmen, denn am 12. Dezember 1936 hatte Gnade
Gottes einen neuen Besitzer: Als solcher beantragte nun ein Theodor
Sieber, Bankdirektor a. D. in Hannover, das Oberbergamt, die Belegung
des Grubenfeldes auf zwei Jahre gegenüber den gesetzlichen Vorschriften
verringern zu dürfen, da zunächst einmal ein neuer Schacht auf den
verbrochenen Sieben Brüder Stolln geteuft werden müsse (40169, Nr. 134, Blatt 69).
Wie wir noch wissen, umfaßte das im Besitz von W. Zschierlich
verbliebene Grubenfeld von Gnade Gottes 9
Maßeinheiten; wie wir hier erfahren, das von Stamm Asser deren 26. Der
Besitzer hätte daher mindestens 10 Mann in einem konsolidierten Feld
anlegen müssen. Außerdem hatte Herr Sieber einen Bergwerksdirektor
Otto Heine in Hannover und einen Karl A. Schumann in Plauen
(1940 in Jocketa im Vogtland ansässig) als
Bevollmächtigte benannt. Der letztere hatte im Dezember 1936 das (demnach
ihm zuvor zuständige) Bergbaurecht in Stamm Asser zugunsten von Herrn
Sieber aufgelassen und reichte nun auch gleich einen Betriebsplan
ein, in welchem ein gemeinsamer Betrieb der Gruben Gnade Gottes und
Stamm Asser vorgesehen war.
Was nun folgte und den restlichen Inhalt dieser Grubenakte füllt, war wieder kein Bergbau, sondern in erster Linie eine Schlacht zwischen Juristen und Beamten. Inzwischen war auch nicht mehr das Sächsische Finanzministerium der oberste Dienstherr des wieder so benannten Oberbergamtes, sondern der Reichsstatthalter in Sachsen und das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit in Dresden. An letzteren berichtete das Oberbergamt am 31. Dezember 1936, ein Verkauf von Bergbaurechten oder ein Grunderwerb durch die voranstehend genannten Personen sei weder in Freiberg, noch beim Amtsgericht in Schwarzenberg bekannt. Der eingereichte Betriebsplan (welcher bedauerlicherweise aber nicht in dieser Akte zu finden war), beruhe nur auf den Ergebnissen von bereits 1883 ausgeführten geologischen Bohrungen, die zudem in benachbarten Grubenfeldern gelegen haben. Auch sei zur Finanzierung des Unternehmens im Betriebsplan nichts ausgesagt. Aus Sicht des Bergamtes sei daher zunächst die Umsetzung der Konsolidation und ein Besitzübergang an einen der Unternehmer, ferner eine vertiefende Erkundung von diesem zu fordern, und auf deren Grundlage schließlich solle ein neuer Betriebsplan eingereicht werden. Diese Ansicht teilte man auch in Dresden (40169, Nr. 134, Blatt 71ff). Derweil benannte Herr Sieber am 8. März 1937 einen Bergingenieur Paul Heine aus Schönfeld bei Dippoldiswalde (wie man später noch erfährt, der Sohn von Otto Heine) beim Bergamt als Betriebsleiter und beantragte am 16. März 1937 die Konsolidation der beiden Gruben (40169, Nr. 134, Blatt 98ff). Das neue Unternehmen sollte Vereinigte Mangangruben zu St. Katharina heißen (40169, Nr. 134, Blatt 116f). In Langenberg hatte er jetzt 7 Arbeiter und als vorläufige Aufsicht einen pensionierten Steiger namens Richter angestellt, durch die mehrere Schurfgräben angelegt wurden, um der geforderten Erkundung nachzukommen. Paul Heine wurde inzwischen als Betriebsleiter vom Bergamt zugelassen, habe sich aber mit ,Bergdirektor' Schumann zerstritten und noch gar nicht in Langenberg blicken lassen. All dem geschuldet, äußerte sich sowohl die Lagerstättenforschungsstelle, als auch die Bergwirtschaftsstelle gegenüber dem Oberbergamt weiter sehr kritisch zu dem Vorhaben und es kam nicht zu einer Zulassung des Betriebsplanes. Man versicherte sich aber vor neuen Festlegungen auch jetzt besser in Dresden und teilte den Sachstand dorthin am 24. Juli 1937 mit, bevor man den Weiterbetrieb der Untersuchungsarbeiten untersagen wollte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitte des Jahres 1937 muß dann Herr
Sieber verstorben sein, denn im weiteren Verlauf traten nun die Witwe
Emmeline Sieber und deren zwei Töchter in Hannover als Erben auf,
welche nach Aussage ihres Anwaltes Stumpf in Hannover „völlig mittellos“
hinterblieben sind. Der Erblasser hatte aber bis dahin das Geld für die Entlohnung
der angestellten Arbeiter aufgebracht und Herr Schumann hatte sich
um die Auszahlung vor Ort sowie um die Bezahlung der Grubenfeldsteuern
gekümmert. Inzwischen hatte der Rechtsanwalt auch
die Zwangsversteigerung des Grubengebäudes veranlaßt (40027, Nr. 751,
Blatt 7).
Im Streit um den Wert des Erbes ‒ oder die darauf liegenden Schulden ‒ suchte sich nun auch Herr Schumann juristischen Beistand. Am 10. November 1938 mischte sich dann auch Otto Heine noch in diesen Rechtsstreit ein mit der Angabe, daß ihm nach dem mit Theodor Sieber geschlossenen Vertrag doch 50% an den Vereinigten Mangangruben St. Katharina gehörten... (40169, Nr. 134, Blatt 165) Den Fortgang der Geschichte wollen wir aber nicht weiter verfolgen, zumal auch der Akteninhalt an dieser Stelle endet und vermerken nur noch kurz, daß am 29. November 1937 seitens des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit in Dresden entschieden wurde, daß „die Entziehungsverfahren (für das Bergbaurecht) einzuleiten sind, nachdem nicht mehr damit gerechnet werden kann, daß der gegenwärtige Bergbauberechtigte Untersuchungsarbeiten in dem Umfange durchführen wird, wie das im Interesse der deutschen Volkswirtschaft gefordert werden muß.“ (40169, Nr. 134, Blatt 137) Dem Bericht des Oberbergamtes vom 10. Dezember 1937 an das Ministerium in Dresden zufolge hatte man bis dahin nur im Feld von Stamm Asser in nennenswertem Umfange Schurfgräben gezogen und kleine Schächtchen abgesenkt, sowie alte Halden durchgekuttet. Die dabei ausgehobenen Manganmulme wurden übrigens „zu der Zschierlich'schen Arsenhütte gebracht und sollen dem Vernehmen nach zur Farbgewinnung verwendet werden.“ Schau an... Am 9. April 1938 wandte sich ferner die Generaldirektion der Staatlichen Hütten- und Blaufarbenwerke an die Lagerstättenforschungsstelle mit der Mitteilung, daß sich bei der Hauptblaufarbenlager GmbH in Leipzig „auch Herr Schumann wieder einmal mit Angeboten von Bismut bemerkbar macht. Derselbe teilte mit, daß er waggonweise oder auch tonnenweise (...) die folgenden bismuthaltigen Rückstände abzugeben habe:
Außerdem soll bald lieferbar sein:
Die Abbrände sollen in der Nähe von Schwarzenberg lagern. Ich wäre für recht baldige Mitteilung dankbar, was von diesen Angaben Schumanns wahr ist.“ (40028, Nr. 344) Was die Bergbehörden darauf beschieden haben, verrät der Inhalt dieser Akte leider nicht. Die Handelsabteilung der Staatlichen Hütten- und Blaufarbenwerke bescheinigte der Bergwirtschaftsstelle am 11. Juni 1938 nur, daß sie an diesem Material kein Interesse habe. Die Entziehung des Bergbaurechtes ist dann laut einem Aktenvermerk vom 25. April 1939 „durch Beschwerdebescheid des Herrn Reichswirtschaftsministers vom 22. August 1938“ rechtskräftig geworden (40027, Nr. 751, Blatt 1). Die Bergbehörde in Zwickau bestätigte am 16. September 1939 noch, daß durch den letzten Betreiber keine neuen Grubenbaue verführt worden seien, mithin auch keine Verwahrungsmaßnahmen vorzuschreiben wären (40027, Nr. 751, Blatt 8). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das war aber noch immer nicht der
letzte Akt: Bergwerksdirektor Karl Schumann (nun aus
Jocketa im Vogtland)
hatte zumindest bei Stamm Asser auch danach weiter die Bergbaurechte inne.
Wie oben zu lesen stand, sollte diese Grube 1939 schon zwangsversteigert werden, wie
man auch einem
Fahrbericht von Dr. Oelsner über die Gruben am Roten Hahn vom 9.
Januar 1945 entnehmen kann (40030, Nr. 719, Blatt 72ff und Nr. 664,
Blatt 25ff). Herr Schumann aber hatte mit dem Bauunternehmer
Ernst Lorenz in Berlin- Wilmersdorf noch einmal einen Käufer gefunden,
der unter dem Namen ,Erzgruben St. Katharina' die Sache wieder
aufnahm. Der hat kurz darauf auch gleich noch die Grubenfelder von Gottes Geschick
am Graul und Treue Freundschaft bei Schwarzenberg (der
Hauptwasserlösestolln der Grube), die sich zuvor im Besitz der Stadt
Schwarzenberg befanden, mit erworben. Angeblich nämlich hatte Herr
Schumann im vorangegangenen Zeitraum hier 20.000 t Haldenmaterial
durchgekuttet und dabei bei Stamm Asser ein Brauneisensteinlager
gefunden. Über dieses Lager nun erstellte ein Wirtschaftsprüfer und Oberbergrat a. D.
Rohrlich, auch aus Berlin, ein Gutachten, in dem
er behauptete, daß bei Stamm Asser noch 450.000 t
Brauneisenerz mit 40% Eisengehalt und 300.000 t Manganerz „guter Qualität vorhanden
(sind) und sichtbar anstehen.“ Aufgrund dieser Annahmen hatte Bergrat
Rohrlich jährlich zu erwartende Gewinne aus dem Abbau der Erze von 180.000,- Mark errechnet (vgl. 40030,
Nr. 719, Blatt 4ff).
Bei solchen Aussichten hatte Herr
Lorenz besagten Herrn Rohrlich sogleich als Berater und Herrn
Schumann wieder als Bergwerksdirektor angestellt. Aus einem
Betriebsplan für diese Grube für den Zeitraum 1941/42 erfährt man, daß er
1941 auf Stamm Asser „27 hiesige Mann und 22 französische
Kriegsgefangene“ angelegt hatte. Mit dieser beachtlichen Belegschaft
entnahm man „alten, dem Quarzbrockenfels entstammenden Halden Tempererz“
(ein Begriff, auf den wir
Auf die Anfrage des Reichsstatthalters in Sachsen zur ,wehrwirtschaftlichen Bedeutung' dieser Eisenerzgrube hin forderte das Oberbergamt die Bergwirtschaftsstelle zu einer Stellungnahme auf. Am 7. Juli 1941 befuhr daher Dr. Oelsner die Grube und berichtete anschließend, daß die noch vorhandenen Vorräte an aufgehaldetem Tempererz bestenfalls 300 t umfaßten und daß durch den laufenden Grubenbetrieb dem Besitzer Kosten von monatlich rund 12.000,- Mark entstünden (40030, Nr. 718, Blatt 10ff). Die Bergwirtschaftsstelle faßte ihre Lagerstättenbewertung dann am 1. August 1941 so zusammen (40030, Nr. 718, Blatt 17ff): „Gegenwärtig werden im sogenannten großen Tagebau (...) weitere Aufschlüsse versucht, aber auch hier dürften nur noch unbedeutende Reste anstehen. Die hier ausgeführten Untersuchungsarbeiten trafen überall nach wenigen Metern in alten Mann. Als Eisen- und Manganerzlagerstätte kann dem Vorkommen der Fa. E. Lorenz keine Bedeutung zugemessen werden. Zu einer wehrwirtschaftlichen Betreuung liegt kein Anlaß vor.“ Dasselbe teilte die Bergwirtschaftsstelle am 30. September 1941 auch an Herrn Lorenz selbst mit (40030, Nr. 718, Blatt 39ff). In diesem Schreiben heißt es, man habe „den Eindruck gewonnen, daß über die Lagerstättenverhältnisse bei St. Katharina falsche Anschauungen bestehen. Wir möchten daher nicht versäumen, auch Ihnen unmittelbar unsere Auffassung über die Lagerstättenverhältnisse darzulegen, wie wir das bereits mehrfach Ihrer Betriebsleitung gegenüber mit einem Hinweis auf die geringen Aussichten der Arbeiten (...) taten. Wir fühlen uns hierzu verpflichtet, um weitere Fehlleitung von Kapital und Arbeitskraft in der jetzigen Zeit zu vermeiden, in der dringendere, kriegswirtschaftlich nötige Arbeiten im Vordergrund stehen müssen.“ Auch die Zeiten hatten sich ja wieder geändert. Weiter heißt es hier: „Die bisher von Ihnen durchgeführten Untersuchungsarbeiten bestätigen vollauf unsere Ansicht über die Lagerstättenverhältnisse... Die bisherigen Mißerfolge Ihrer Arbeiten scheinen darauf zurückzuführen zu sein, daß sie auf unhaltbaren Grundlagen fußten...“ ‒ womit die Bergwirtschaftsstelle das Gutachten von Bergrat Rohrlich meinte. Nichtsdestoweniger hielt Herr
Lorenz noch an seinem Glauben fest und veranlaßte sogar
geophysikalische Untersuchungen, um die tatsächliche Lage und Ausdehnung
des angeblichen Brauneisensteinlagers festzustellen. Profilmessungen der
magnetischen Vertikalintensität mittels Feldwaage, wie sie einige Jahre
zuvor übrigens auch
bei Neusilberhoffnung in
Die Akte des Oberbergamtes enthält
abschließend noch einen ausführlichen Bericht vom 16. Juli 1942 über die ab 1940 durch Ernst
Lorenz initiierten und unter Leitung von Karl Schumann
ausgeführten Aufschlußarbeiten bei Stamm Asser (40030, Nr. 718,
Blatt 139ff). Demnach hat der Besitzer den Betrieb am 30. Juni 1942
endgültig eingestellt. Herr Lorenz kann immerhin als der letzte,
wirklich praktisch tätige Bergbauunternehmer im Revier gelten ‒ jedenfalls
bevor dann 1948 die Wismut AG auch hier nach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grund- und Saigerriß der 1940-1942 bei Stamm Asser noch ausgeführten, bergmännischen Auffahrungen, farblich markiert sind darin die mit dem Fallort 2 aus dem Tagebau heraus nach Südosten angefahrenen Erzlager. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40030, Nr. 718, Blatt 153, Ausschnitt mit dem Grundriß, Norden ist oben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
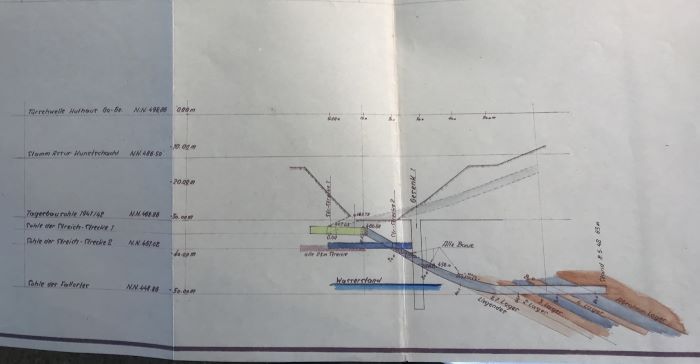 Ausschnitt mit dem Saigerschnitt zu obigem Grundriß. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40030, Nr. 718, Blatt 153.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Sache hatte aber noch ein
juristisches Nachspiel. In erwähntem Bericht über die bergmännischen
Arbeiten steht gleich einleitend zu lesen, daß Herrn Lorenz bereits
im Mai 1941 ein Gutachten eines Dipl.-Ing. Weber von einer Afrika
Bergbau AG in Berlin vorgelegen habe, nach dem bei Stamm Asser sichtbare
Erzmengen weder vorhanden, noch aufgeschlossen seien. Ein zweites
Gutachten wurde im Februar 1941 durch einen Bergingenieur Trotzig
im Auftrag des Amtsgerichts Schwarzenberg angefertigt, welches zu
demselben Ergebnis kam. In dem Bericht vom 16. Juli 1942 heißt es dazu: „Damit
wird evident, daß das Gutachten Rohrlichs sehr zweifelhaften Wert besitzt.
(...) Man gewinnt den Eindruck, daß eine gewisse Verbindung zwischen dem
wenig gut beleumdeten Vorbesitzer der Grube, Herrn Schumann, und Herrn
Rohrlich zu bestehen, zumindest aber bestanden zu haben scheint...“
Tatsächlich hat Herr Lorenz dann Klage gegen Rohrlich und Schumann wegen Betruges eingelegt. Vielleicht, weil es in diesem Fall so offensichtlich und ,evident' gewesen ist, hat sich auf Ansuchen von Herrn Lorenz diesmal auch die sächsische Bergwirtschaftsstelle in den juristischen Streit eingemischt und am 9. Oktober 1942 ein Gutachten dazu erstellt (welches Herr Lorenz übrigens 90,- Mark gekostet hat) und in dem auf etlichen Seiten das Gutachten Rohrlich's geradezu ,zerpflückt' wird (40030, Nr. 719, Blatt 44ff). Das Gerichtsverfahren hat Herr Lorenz auch in erster Instanz gewonnen, nur Herr Schumann hat Revision eingelegt und an ihm hätte es doch gar nicht gelegen, er habe schließlich alles schon vorher gewußt... Wie das ausgegangen ist, verrät uns die Bergamtsakte nicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allerdings fanden wir Herrn Schumann noch einmal wieder: Der nämlich hatte offenbar auch das Kriegsende unbeschadet überlebt und nannte sich immer noch Bergwerksdirektor. Am 25. Oktober 1946 wandte er sich mit einem Schreiben an die sächsische Landesverwaltung, Abteilung für Wirtschaft und Arbeit, in dem es heißt, er sei mit Zustimmung der SMA in Sachsen „mit der Oberleitung der sowjetischen Sonderbetriebe im Bergbau des Landes Sachsen betraut worden.“ (40030, Nr. 719, Blatt 81) Weil dies nun nicht in diesen, ihm anvertrauten Aufgabenbereich gehöre, wolle er darauf aufmerksam machen, daß er „nach meinen Erfahrungen die nachstehend benannten Rohstoffgrundlagen für wert (halte), in Betrieb versetzt zu werden: 1.) Eisenerz- Manganerz- Basis bei Schwarzenberg, Tagebau, von mir bis 1940 betrieben, Produkte an Hütte Amberg geliefert. 2.) Steinkohle bei Flöha, Gückelsburg, erbohrt, geringe Teufen, mehrere gute Flöze, günstige Lage zu Eisenbahnen.“ Die Landesregierung fragte bei der Bergbehörde nach, denn zu dieser Zeit wurde natürlich jeder Roh- und Brennstoff dringend benötigt. Dort erinnerte man sich aber wohl noch an die vorausgegangenen Vorgänge und lehnte in einer Stellungnahme vom 10. Dezember 1946 rundweg ab, weil die Lagerstätte in den Grubenfeldern, welche sich 1940 in Schumann's Besitz befanden, restlos abgebaut sei.
Daß Schumann den Gückelsberg bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit diesen Episoden ist das Ende des
Bergbaus auf Eisenerz und Braunstein in Langenberg endgültig erreicht. In
der folgenden Übersicht haben wir auf Basis des Gelesenen einmal
zusammenzufassen versucht, wie sich bis Ende der 1930er Jahre die Besitzverhältnisse an
den Gruben und Bergbaurechten verändert haben und wie aus den zahllosen
Einzelgruben größere Einheiten entstanden sind.
Es erweist sich auch, daß Berginspektor Tittel mit seiner Auffassung schon im Jahr 1909 völlig Recht hatte, indem Zschierlich's Gewerkschaftsgründungen kaum noch das Ziel hatten, den Bergbau tatsächlich wieder in Gang zu bringen. Vielmehr wurde mit den Kuxen und Bergbaurechten durch Bankhäuser gehandelt. Am Ende wurde das Bergbaurecht durch die Bergbehörde entzogen oder es ist infolge Ablebens der Besitzer und Mittellosigkeit der Erben ‒ die meist ganz anderenorts ansässig waren und mit der Region nichts mehr zu tun hatten ‒ einfach erloschen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Untersuchungen
in den 1930er und 1940er Jahren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie gelangte man eigentlich in den
1930er und 1940er Jahren bei der
Lagerstättenforschungs- und der Bergwirtschaftsstelle des Oberbergamtes in
Freiberg zu der
Natürlich liefen in der sächsischen Bergverwaltung im Oberbergamt nicht nur alle betrieblichen Informationen über den umgehenden Bergbau, sondern (spätestens seit dem Beginn der geognostischen Landesuntersuchung) auch alle geologischen Kenntnisse über die im Lande vorhandenen Bodenschätze zusammen. Dabei bestand neben dem Bergamt, welches ab 1869 nur noch wirtschaftliche und bergpolizeiliche Aufgaben innehatte, ab 1924 außerdem ein Geologisches Landesamt in Sachsen mit Sitz in Leipzig. Der Sitz dieses Amtes wurde 1937 nach Freiberg verlegt. Infolge der Autarkiepolitik des nationalsozialistischen Deutschlands wurde das sächsische Landesamt 1939 als Zweigstelle Freiberg der Reichsstelle für Bodenforschung unterstellt. Diese Reichsstelle wurde 1941 zum Reichsamt erhoben. Zeitgleich wurde aber auch beim Oberbergamt in Sachsen wieder eine Lagerstättenforschungsstelle eingerichtet. Nach 1945 wurde die Freiberg'er Einrichtung als Zweigstelle der Geologischen Landesanstalt des Landes Sachsens geführt, doch schon bald den Zentralstellen der DDR untergeordnet. Seit 1950 war sie der Staatlichen Geologischen Kommission unterstellt. Von 1950 bis zur Auflösung des Landes Sachsen firmierte sie als Zweigstelle Sachsen, nach 1952 bis 1956 als Außenstelle Freiberg, seit 1956 als Geologischer Dienst Freiberg. 1961 erfolgte die Umwandlung in einen Wirtschaftsbetrieb. Der VEB Geologische Erkundung Süd mit Sitz in Freiberg wurde 1968 als Betriebsteil dem VEB Geologische Forschung und Erkundung Halle unterstellt. Seit 1979 führte er den Titel VEB Geologische Forschung und Erkundung Freiberg im VEB Kombinat Geologische Forschung und Erkundung Halle (40131). Diese Zweiteilung besteht bis heute fort, indem neben dem Sächsischen Oberbergamt in Sachsen auch ein Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie besteht. Während letzteres aber dem Ministerium für Umwelt nachgeordnet ist, ist das Oberbergamt als Mittelbehörde dem Wirtschaftsministerium unterstellt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ende der 1920er Jahre war zwar der aktive Bergbau auch in diesem Revier praktisch erloschen, doch hatten sich dazu zahlreiche Unterlagen angesammelt. Die ersten Erkundungsmaßnahmen nach noch unbekannten Erzvorkommen ließ bereits die von H. Gruson begründete Schwarzenberg'er Hütte in den erworbenen Grubenfeldern bzw. in deren Umgebung im Jahr 1883 ausführen. Die damals niedergebrachten Bohrungen wurden auch später immer wieder herangezogen ‒ zuletzt übrigens auch wieder von Bergrat Rohrlich in seinem Gutachten für E. Lorenz im Jahr 1940. Vielleicht aus diesem Grund haben wir betreffende zeichnerische Darstellungen auch in den Oberbergamtsakten aus dieser Zeit gefunden (40030, Nr. 718). Das anhand der Bohrergebnisse von 1883 im Jahr 1940 erstellte Profil zeigte deutlich das Auskeilen der Mulmlager und des Brockenfelses nach Süden, zur Hochlage des Emmler- Rückens hin, aber auch die irreguläre Verteilung von Erzanreicherungen innerhalb der zerrütteten Gesteinslage.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Darstellung der Bohrergebnisse als farbig kolorierte Bohrsäulen, 1941 abgezeichnet. Es sind zwar nicht alle Bohrungen aufgetragen, doch einige finden wir auch im Schnitt oben wieder. Bohrung N° 2 stand offenbar ganz nahe am Kalkbruch (durchstoßene Kalksteinablagerungen sind hierin mit weißer Farbe dargestellt). Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40030, Nr. 718, Blatt 85.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nicht anders sahen auch die Ergebnisse der ab 1917, während des 1. Weltkrieges, unter Karl August Zinnitz' Bergverwalter Ernst Julius Fröbe niedergebrachten Bohrungen und abgeteuften Versuchschächte aus: Es existiert hier eben kein zusammenhängendes Erzlager, sondern nur unregelmäßig geformte Mulden in der Glimmerschieferoberfläche und die bauwürdigsten Erzlinsen darin hatten die Alten längst abgebaut... Eine Wiederaufnahme des Eisenstein- und Braunstein- Bergbaus ‒ erst recht unter den wirtschaftlichen Bedingungen der Neuzeit ‒ machte keinen Sinn mehr. Aus der Lagerstätte entlang des Schwarzbachtales war eine Aufreihung von Mineral- Vorkommen geworden, die bestenfalls noch ein geologische Kuriosität darstellte, aber keinen ökonomischen Ertrag mehr erbringen konnte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nun war Deutschland infolge des
Versailler Vertrages 1918 auch der Eisenerzlagerstätten Lothringens verlustig
geworden. Ein Umstand, den zwar die Eisenhüttenindustrie beklagte; daran
etwas zu ändern aber während der Wirren der Weimarer Republik niemand in
der Lage gewesen ist. Das änderte sich mit der Machtergreifung der
Nationalsozialisten 1933 und einem Aufschwung der Wirtschaft ‒ darunter
natürlich auch der Rüstungsindustrie ‒ und Stahl war ohnehin längst das
Metall der Zeit geworden. Auch die Presse nahm sich dieses
Themas an und in einer Materialsammlung des Oberbergamtes zur
Rohstoffversorgung mit Eisen- und Manganerz fanden wir die nachstehende
Auswahl von Artikeln zum Thema (40030, Nr. 661).
1934 wandte sich auch die Industrie- und Handelskammer Chemnitz mit einer Anfrage an das Wirtschaftsministerium in Dresden ‒ veranlaßt durch ein Memorandum der Eisengießerei C. A. Richter in Chemnitz, in dem es heißt (40028, Nr. 325, Blatt 1ff): „Die Frage der Ersatzstoffe beschäftigt jetzt nicht nur die betroffenen Industrien, sondern die gesamte Öffentlichkeit, und mit nicht ganz wenig Optimismus glaubt man, der Schwierigkeiten Herr werden zu können. Das mag in manchen Fällen zutreffen, in einem ganz gewiß nicht: Für Eisen gibt es keinen Ersatz... Bismarck hat in richtiger Erkenntnis dieser Tatsache die Eisenindustrie als Schlüsselindustrie bezeichnet, das ist sie auch heute noch. (...) Die deutsche Eisenindustrie ist infolge des Versailler Vertrages auf ein Fünftel zusammengeschrumpft. (...) Es wäre Pflicht, jede Möglichkeit, die Eisenerzeugung zu erhöhen, auszunutzen. Im Erzgebirge verdankten eine ganze Anzahl von Hämmern ihre Entstehung dem Vorhandensein von Eisenerzen an Ort und Stelle. Diese Hämmer gingen ein oder wurden in Eisengießereien umgewandelt, als die Roheisenerzeugung an anderen Orten in großem Maßstabe errichtet wurde, nämlich da, wo neben dem Eisenerz die Kohle gefunden wurde und die Erze einen höheren Eisengehalt hatten. (...) Heute dürfte nicht mehr die Frage der Rentabilität ausschlaggebend sein, denn es steht mehr als bloßes Wirtschaftsinteresse auf dem Spiele...“ Die Bergwirtschaftsstelle beim Oberbergamt nahm dazu am 6. April 1935 Stellung (40028, Nr. 325, Blatt 4ff). In diesem Schreiben an das sächsischen Wirtschaftsministerium heißt es unter anderem, daß die Krise der sächsischen Eisenindustrie um die Jahrhundertwende auch durch die damals herrschende, „liberalistische Weltanschauung“ ausgelöst war, indem die Schwerindustrie Nordrhein- Westfalens „Tausende von Polen, Tschechen und Italienern einführte, um den durch die billige Minette ohnehin schon niedrigen Gestehungspreis des Roheisens durch Lohndrückerei noch mehr zu senken. Daß dadurch der Lebensstandard der einheimischen Arbeiterbevölkerung auf polnische Höhe heruntergedrückt wurde, spielte keine Rolle. Unter solchen Verhältnissen konnte sich im Erzgebirge der Eisenerzbergbau und damit ein Hochofenwerk nicht halten...“ Eingehend auf den Kern des Memorandums liest man dann weiter, es dürfe „mit Eisenerzvorräten in Sachsen noch gerechnet werden, wenn sich auch die Vorräte zahlenmäßig zurzeit nicht angeben lassen. Besonders die Lagerstätten der Umgebung von Schwarzenberg und Berggießhübel bieten offenbar noch Aussichten für einen bescheidenen Bergbau. Als Abnehmer für das sächsische Eisenerz kamen früher die kleinen Eisenhütten des Erzgebirges und die Hütten in Cainsdorf und Schmiedeberg in Frage. Die ungünstigen Transportverhältnisse im Erzgebirge und Vogtland verhinderten die Verwendung des Erzes an einem günstig gelegenen Platze. Auch ist der sächsische Koks für den Hochofen nicht sehr gut geeignet... Auch heute wird es sich kaum empfehlen, das Erz aus dem gesamten Revier bei einem größeren Ofen zusammenzuziehen, vielmehr kommen, wenn überhaupt, nur kleinere Hütten in Frage.“ Diese Einschätzung der sächsischen Bergbehörde war vollkommen realistisch. Auch die Geologen suchten lieber in anderen Gegenden Deutschlands nach wirtschaftlich gewinnbaren Erzvorkommen. Dennoch blieb auch der Gedanke der Errichtung kleinerer, dezentraler Hüttenwerke noch eine Zeitlang im Gespräch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ganzseitiger Artikel aus der ,Berliner Börsenzeitung' vom 26. September 1933. Hier sind einleitend - allerdings erst unter Punkt 8 - auch noch ,sächsisch- thüringische Vorkommen' (und zwar mit Schmiedefeld und Schmalkalden) angeführt. Das größte Projekt dieser Zeit war dagegen die Erschließung der Eisenerze von Salzgitter und Peine, wo man Vorräte im Umfang von 300 Millionen Tonnen vermutete. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40030, Nr. 661.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
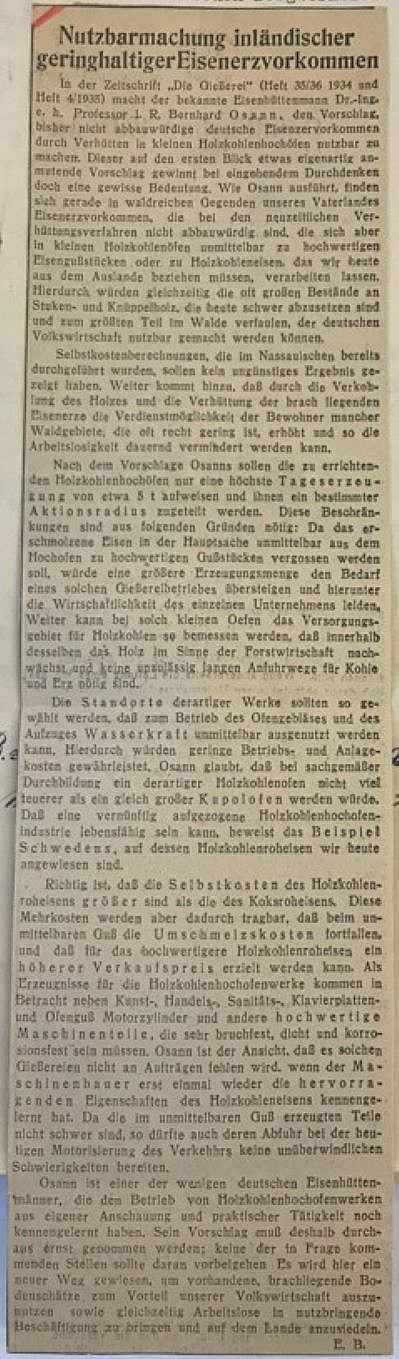 Dieser Artikel aus der ,Deutschen Bergwerkszeitung' vom 24. Februar 1935 griff auch das Thema der kleinen Eisenhütten noch einmal auf. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40028, Nr. 325, Blatt 24.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
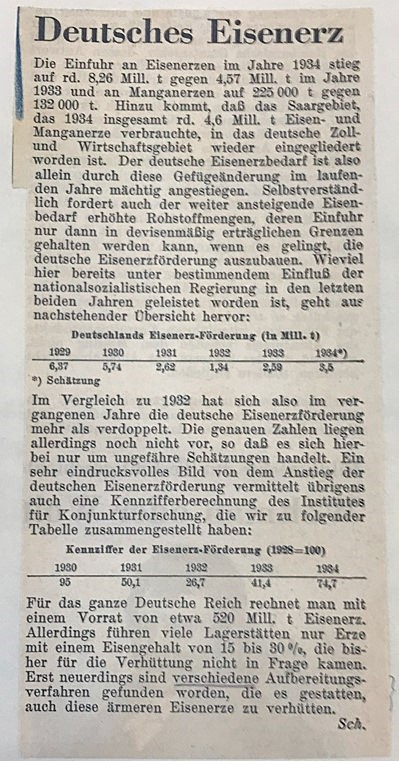 In dieser Meldung aus der ,Rundschau Technischer Arbeit' vom 22. Mai 1935 ist auch die jährliche Importmenge von Manganerz nach Deutschland wieder beziffert. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40028, Nr. 325, Blatt 29.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch ein mehrspaltiger Artikel aus der Zeitung ,Arbeit und Staat', Nr. 22/23 im Jahr 1935. Bereits zu dieser Zeit kamen hiernach 75% des in Deutschland verhütteten Eisenerzes aus dem Ausland. So wundert es nicht, daß man sich nicht nur um die Erschließung eigener, bis dahin noch kaum angegriffener Lagerstätten machte, sondern auch um die Effektivität der Hochofenprozesse. An dieser Stelle begegnen wir, nebenbei bemerkt, auch den Gruson- Werken in Magdeburg wieder, die allerdings inzwischen zum Krupp- Konzern gehörten. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40030, Nr. 661, Blatt 28.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits 1936 wurde von der
Reichsregierung ein ,Gesetz zur Erschließung von Bodenschätzen'
erlassen (40028, Nr. 325, Blatt 42). Damit die Erkundung und Erschließung auch zu
wirtschaftlichen Ergebnissen führte, erließ das Wirtschaftsministerium in
Berlin, in diesem Fall vertreten durch den ,Beauftragten für den
Vierjahresplan', Ministerpräsident Generaloberst Hermann Göring,
am 23. Juli 1937 dazu eine ,Anordnung über die Ausnutzung der deutschen
Erzlager', nach der es dem Staat erlaubt wurde, Bergbauberechtigte ,zum
Zwecke des Aufschlusses und Abbaus von Mineralien' zusammenzuschließen
(§1), sprich: Die bisherigen Eigentümer mußten zwar an einer zu gründenden
Gesellschaft beteiligt werden, hatten aber ihre Berechtigungen an dieselbe
abzugeben. Ausgenommen waren davon allerdings Steinkohle, Stein- und
Kalisalz sowie Solequellen (40030, Nr. 661, Blatt 51). Am 25. Juli 1937 wurde von Göring
auch gleich noch eine ,Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten'
gegründet (40030, Nr. 661, Blatt 52). Nach der Meldung darüber im ,Freiheitskampf'
vom Folgetag sollten durch diese Aktiengesellschaft zuerst neue Werke in Salzgitter,
aber auch in Baden und
Franken errichtet werden.
Nicht nur auf der Suche nach Eisenerz im Nordharzgebiet bei Salzgitter, auch in Sachsen wurde in der Folgezeit die geologische Erkundung noch einmal intensiviert, alte Resultate wurden überprüft und ggf. revidiert. Am 29. November 1937 schrieb der Reichsstatthalter in Sachsen, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, an die Lagerstättenforschungsstelle beim Oberbergamt, „Die weitere Untersuchung der Mulmlagerstätten im Gebiet von Langenberg erscheint mir erwünscht. Sie wollen mir daher im Einvernehmen mit der Bergwirtschaftsstelle einen Betriebs- und Zeitplan für die erforderlichen bergmännischen Untersuchungsarbeiten baldmöglichst vorlegen...“ (40028, Nr. 325, Blatt 51f) Am 15. Januar 1938 wurde diese Anordnung dahingehend noch präzisiert, daß in die Untersuchungen zur Nutzbarmachung sächsischer Eisenerze einzubegreifen sei: „1. Angabe der aussichtsreichsten Eisenerzgruben nach Lage und möglicher jährlicher Erzeugungshöhe... Im Hinblick auf schwebende Verhandlungen über die Nutzbarmachung sächsischer Eisenerze sind die vorstehenden Untersuchungen beschleunigt in Angriff zu nehmen.“ (40028, Nr. 325, Blatt 99f) Der Vorstand der Bergwirtschaftsstelle antwortete darauf auch umgehend am 7. Februar 1938 mit einer zumindest vorläufigen Einschätzung, in welcher die folgenden Vorkommen für weitere Untersuchungen benannt wurden (40028, Nr. 325, Blatt 100ff):
Unser Arbeitsgebiet bei Langenberg war immer noch unter den ersten dreien. Weiter heißt es hier: „Bei der derzeitigen jährlichen Roheisenerzeugung haben die sächsischen Erzmengen allerdings keine allzugroße Bedeutung...“ Aber: „Unter der Voraussetzung, daß es gelingt, die Eisenmanganmulme entsprechend anzureichern, würden diese wegen den großen Schwierigkeiten am Manganmarkt der gesamten deutschen Volkswirtschaft besonders nützlich sein.“ So wurde also auch die Erkundung der Langenberg'er Lager noch einmal aufgenommen und dazu am 28. März 1938 eine Planung vorgelegt (40028, Nr. 325, Blatt 156ff und Nr. 344). Im Vordergrund stand dabei jetzt wieder der Mangangehalt der ,Mulme'. Man sah ursprünglich sowohl Tiefbohrungen, als auch bergmännische Arbeiten vor. Probematerial wurde bereits Anfang 1938 hinsichtlich der Gewinnungsmöglichkeit von reinem Mangan oder Ferromangan durch das Labor des Sächsischen Blaufarbenwerksvereins untersucht und Aufbereitungsversuche durchgeführt, wobei man zu der Einschätzung gelangte, daß sie zumindest als Zuschläge im Hochofenprozeß verwendbar seien, für sich allein nach entsprechender Aufbereitung aber auch auf Ferromangan verhüttet werden könnten (40028, Nr. 325, Blatt 192ff). Seitens der Bergwirtschaftsstelle zweifelte man anschließend aber namentlich die Analyseergebnisse des Rohmaterials an und hielt den darin mit rund 9% ermittelten Mangangehalt für viel zu hoch. Zeitgleich wurde aber auch die Lagerstättenforschungsstelle mit der Ausführung der Bohrarbeiten beauftragt. Am 8. Juli 1938 heißt es in einem Sachstandsbericht für das Wirtschaftsministerium, daß mit den Bohrungen in Langenberg Anfang Juni begonnen worden sei. Die Arbeiten seien aber infolge der Eigenart der Lagerstätte, daß mulmige Schichten mit kristallinen Schiefern und Quarzbrockenfels in fortlaufendem Wechsel stehen, schwierig. Während die ersten beiden Bohrungen als Trockenbohrungen mit Schappe ausgeführt und nur abschnittsweise unverwitterte, harte Schieferlagen mittels Meißel durchbohrt wurden, sollten die folgenden daher als Kernbohrungen durchgeführt werden (40028, Nr. 325, Blatt 204ff).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einer Aktennotiz über die Sitzung vom
11. April 1938 zufolge waren die ersten beiden Bohrpunkte dann „150 m
östlich der ,Gifthütte' im östlichen Feldesteil von Stamm Asser und die
zweite zirka 225 m südlich von Bohrung 1 am Ufer des Schwarzbaches“
festgelegt. Wo die Bohrungen 3 und 4 gelegen haben, konnten wir anhand
der Akten noch nicht herausfinden. In der dazu vorliegenden Planung vom
28. März 1938 (40028, Nr. 344, Blätter dieser Akte sind nicht nummeriert)
heißt es nur, daß „durch eine Reihe von Tiefbohrungen die Ausdehnung
des Lagers untersucht werden
(soll), um eine genauere Vorratsberechnung aufstellen zu können.
Durch
(die ersten) zwei Bohrungen sollen die Ergebnisse der vor 50 Jahren
durchgeführten Tiefbohrungen kontrolliert werden. Für die Untersuchung der
sich nach Osten hin erstreckenden Lagerstätte sind eine Reihe weiterer
Bohrlöcher geplant, deren Lage aus der beiliegenden Karte ersichtlich ist.“
Auf der oben gezeigten Kartenbeilage sieht man, daß zwei Bohrlöcher
tatsächlich im
Südwesten innerhalb der grau schraffierten Fläche liegen, in der auch die
Bohrungen von 1883 angesetzt waren. Welche von den übrigen 18 Bohrungen
dann ausgeführt worden sind, ist nicht nachvollziehbar.
Mit dem Niederbringen dieser ersten beiden Trockenbohrungen wurde jedenfalls am 9. Mai 1938 die Firma Reinhard Zaensler, Tief- und Flachbohrungen in Brandis bei Leipzig, beauftragt. Witzigerweise hatte die Lagerstätten- Forschungsstelle dabei doch ganz vergessen, auch das Bergamt in Zwickau von diesen Untersuchungen zu informieren, welches sich über die fehlende Anzeige der Bohrarbeiten am 9. Juli 1938 bei der Bergwirtschaftsstelle beschwerte... Das Bohrloch 1 wurde vom 25. Mai bis 22. Juli 1938 dann bis auf 49,5 m niedergebracht und hat bei 18,3 m Teufe Grundwasser erreicht. Die Arbeiten vor Ort wurden von der Sachsenerz Bergwerksgesellschaft mbH, Betriebsabteilung St. Christoph Fundgrube in Breitenbrunn, begleitet. Die Kosten für diese erste Bohrung beliefen sich übrigens auf 3.017,90 Mark, zuzüglich einer Pauschale von 30,- Mark als Entschädigung für den Grundbesitzer Max Weißflog. Die Bohrungen 3 und 4 wurden danach durch die Firma August Borrmann, Unternehmung für Brunnenbau, Bohrungen und Schachtbauten in Dresden, im September des Jahres nach einem Craelius'schen Kernbohrverfahren ausgeführt. Die Bohrung 3 erreichte 52,25 m Teufe. Allerdings war der Kerngewinn aufgrund des damit durchsunkenen, lockeren, teils ganz sandigen Materials auch nicht höher, als bei den vorangegangenen Bohrungen. Auch in einer Übersicht über ,die bisher in Sachsen durchgeführten Bodenforschungsarbeiten' vom 3. Juni 1939 (40030, Nr. 410, Blatt 32ff) findet man unter Punkt e), daß im Berichtszeitraum 1938/1939 in Langenberg vier Bohrungen von insgesamt 180 Bohrmetern zur Manganerzerkundung durch die Lagerstättenforschungsstelle veranlaßt und auch niedergebracht worden sind. Dabei habe man „das Mulmlager auf größere Erstreckung nachgewiesen.“ (40030, Nr. 410, Blatt 35) Na gut, daß war nun nicht unbedingt neu... Der geologische Kenntnisstand, den man bis 1938 erreicht hatte, ist in der Planung für diese Bohrungen kurz zusammenfassend beschrieben (40028, Nr. 344). Einleitend dazu heißt es unter der Überschrift: Geologische Position der Lagerstätte: „In der Gegend von Langenberg setzen Gänge der Eisen- und Manganerzformation von häufig mehr als 10 m Mächtigkeit auf; sie sind stark brecciös und werden deshalb als Quarzbrockenfels bezeichnet. Ihre Mineralführung besteht aus Quarz verschiedener Ausbildung und aus Mangan- und Eisenerzen. Die Manganerze treten als Wad, Weichmanganerz, Hartmanganerz und Polianit auf. Zusammen mit Braun- und Roteisen sind sie gelegentlich stark angereichert. An den Ausbissen stehen die Gänge in Verbindung mit ausgebreiteten Lagerstätten von Eisen- und Manganerzmulmen. Diese lockeren Mulme, die zahlreiche Blöcke von Ganggestein einschließen, bilden eine Decke, deren Mächtigkeit meist gering ist. Gelegentlich auftretende, größere Mächtigkeiten werden als Füllungen von Taschen des Untergrundes erklärt. Außerdem wurde durch frühere Bohrungen nachgewiesen, daß sich inmitten von Glimmerschiefer noch Mulmlager befinden, die wohl nur durch primäre metasomatische Verdrängung entstanden sein können. Nach R. Beck stehen diese in direktem Zusammenhang mit den Eisen- und Manganerzgängen. Durch die bereits erwähnten Tiefbohrungen (die von 1883) sollen Mulmvorkommen bis zu einer Mächtigkeit von 30 m festgestellt worden sein. Bei der ehemaligen Friedrich Fundgrube ist ein Förderschacht niedergebracht worden, der ein 24 m mächtiges Mulmlager durchsunken haben soll. Die Ausdehnung dieser Vorkommen ist unbekannt.“ Metallgehalte: „Der Metallgehalt der Mulme schwankt zwischen 4 - 17% Mangan und 16 - 27% Eisen. Der Durchschnitt dürfte jedoch den genannten, niedrigeren Werten sehr nahe kommen. Vom Aufbereitungs- Institut der Bergakademie wurden auf Veranlassung der Staatlichen Lagerstätten- Forschungsstelle Versuche unternommen, den Erzgehalt des Mulmes anzureichern. Diese Versuche haben zu einem überraschend guten Ergebnis geführt. Es hat sich gezeigt, daß der hauptsächliche Erzgehalt sich in den feineren Korngrößen des Mulmes befindet, während die gröberen Korne sich als vollständig wertlos erwiesen haben. Durch einfaches Klassieren und Schlämmen ist eine Anreicherung des Konzentrates auf etwa 14% Mangan und 34% Eisen (...) erzielt worden. Durch Sinterung kann diesesso gewonnene Erzeugnis stückig gemacht werden, um hüttenmännisch weiterverarbeitet zu werden.“ Auch wenn wir noch keinen
Abschlußbericht zu diesen Maßnahmen gefunden haben, war man also in
Freiberg wirklich ziemlich gut informiert, als Herr Lorenz es
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während es neben dieser Bohrerkundung
durch die Lagerstättenforschungsstelle in Langenberg in der
Folgezeit nur noch zu begrenzten, bergbaulichen Aktivitäten auf
Brauneisenstein und Manganerz durch Schumann und Lorenz
gekommen ist, stieg zeitgleich der Bedarf an sogenanntem ,Tempererz'
an. Beim geologischen Landesamt in Leipzig fragte etwa am
27. Februar 1937 ein Herr Dr. Franz Roll von der Eisengießerei
Meier & Weichelt in Großzschocher bei Leipzig, selbst Leiter des
Fachausschusses Temperguß im Verein deutscher Gießereifachleute, an, ob
man solches Material nicht auch aus sächsischen Lagerstätten beziehen
könne. Er habe von Oberingenieur Bäumert von der
Lagerstättenforschungsstelle bereits eine kleine Probe solcher Erze vom
Rothenberg (bei Erla) erhalten, die sich als geeignet erwiesen habe
(40030, Nr. 661, Blatt 64).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hierzu sei an dieser Stelle eingefügt,
daß ,tempern' ‒ wie beim ersten Hören des Begriffes naheliegend
wäre ‒ durchaus auch etwas mit der Temperatur zu tun hat. Der Fachbegriff aus
der Gießereitechnik ist aber vom lateinischen Verb temperare... ,mäßigen'
abgeleitet. Gleichbedeutend sind auch der dem französischen entstammende
Begrif ,adoucieren' oder der deutsche Begriff ,anlassen'.
Rein physikalisch beinhaltet dieser Vorgang, daß ein festes Material auf eine Temperatur unterhalb seiner Schmelztemperatur erhitzt wird. Dies geschieht über eine längere Zeit hinweg (bis hin zu einigen Tagen). Durch die erhöhte Beweglichkeit der Atome können dadurch Strukturdefekte ausgeglichen und die Kristallstruktur in der Nah- und Fernordnung verbessert werden (wikipedia.de). Bei Gußeisen versteht der Fachmann darunter ein längeres Glühen des Rohmaterials bei Temperaturen zwischen 750°C und 1.050°C, wobei das Gußeisen seine übliche Sprödigkeit verliert und an Schmiedbarkeit gewinnt. In Meyers Konversationslexikon von 1888 ist der Vorgang so beschrieben: „Gußeisen wird mit Lehm bestrichen, in grob gepulverten Koks und Sand vergraben, bis zur Rotglut erhitzt und dann sehr langsamer Abkühlung überlassen. Es genügt auch, die noch heißen Gußstücke in einen Ofen zu bringen, bis nahe zum Schmelzpunkt zu erhitzen und nach Verschluß aller Öffnungen in 3 bis 4 Tagen erkalten zu lassen.“ Im Brockhaus liest man 1902 darüber, daß die Abgüsse „mit Eisenerzen geglüht, dadurch entkohlt und in schmiedbares Eisen umgewandelt“ werden (peterhug.ch). Um das dafür benötigte Erz also, vorzugsweise Roteisenstein, ging es nun. Herr Dr. Roll teilte einige Zeit später auch mit, daß infragekommendes Material einen Eisen III- Oxyd- Gehalt von etwa 30% haben müsse, möglichst wenig Phosphor, Schwefel und Kalk (unter 0,5%) enthalten soll, eine Körnung von 3 mm bis 11 mm aufweisen müsse (wegen der Gaszirkulation durfte es nicht pulvrig sein) und in der Quarzzusammensetzung so gestellt, daß die Körner nicht zu leicht zerspringen (40030, Nr. 664, Blatt 13). Im Hauptartikel zum Eisen liest man in Meyers Konversationslexikon von 1888, daß „früher Schmiedeeisen und Stahl direkt durch Reduktion aus den Erzen hergestellt wurden (Rennarbeit), während man gegenwärtig fast ganz allgemein zunächst Roheisen aus den Erzen erzeugt und letzteres als Ausgangsprodukt für die Herstellung von schmiedbarem Eisen benutzt; der dabei gemachte Umweg wird dadurch reichlich aufgewogen, daß die zur Erzeugung des Roheisens ausreichende Temperatur auch zur Schmelzung desselben und zur Abscheidung der Gangarten in Form einer flüssigen und eisenfreien Schlacke genügt, während man bei der Rennarbeit das Eisen im festen, teigartigen Zustand gewinnt und außerdem einen großen Teil von Eisen durch Verschlackung verliert. Zur Erzeugung von schmiedbarem Eisen aus dem Roheisen wird dem letztern durch Oxydation ein Teil des Kohlenstoffs entzogen. Häufig wird die Entkohlung so weit fortgeführt, daß das erzeugte Produkt genau den Kohlenstoffgehalt des gewünschten schmiedbaren Eisens besitzt (Frisch- und Puddelprozeß); in vielen Fällen wird aber auch die Entkohlung weiter getrieben und das kohlenstoffarme Produkt durch erneute Hinzufügung von Kohlenstoff (meist in Form von Spiegeleisen) wieder höher gekohlt. Man ist dadurch weit besser als früher imstande, Schmiedeeisen oder Stahl von bestimmter Qualität herzustellen.“ (peterhug.ch)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was 1937 wohl nur eine Kostenfrage
gewesen ist, wurde kurz vor Kriegsende, als die Fronten näherrückten, zu
einem Beschaffungsproblem. Im Wahn des ,Endsieges' verhaftet, versuchte
man nicht nur in Großzschocher, die Gießereien am Laufen zu halten. Der
Mitinhaber der oben genannten Gießerei, Weichelt, übrigens auch
Vorsitzender des Vereins deutscher Gießereifachleute, wandte sich am
6. Januar 1945 direkt an den Berghauptmann Friedrich Alfred Otto Wernicke
(*1902, †1982, Berghauptmann in Sachsen von 1940 bis 1945) mit der Bitte,
doch
Versorgungsmöglichkeiten für Tempererz ausfindig zu machen, welches bisher
aus dem Siegerland bezogen worden ist (40030, Nr. 664, Blatt 1ff). Der
letztere wies auch sofort an, die Unterlagen zu infragekommenden
Lagerstätten, etwa den Roteisenstein- Vorkommen am Roten Hahn bei
Langenberg, zu sichten und an Ort und Stelle zu prüfen, ob sich hier ein
größerer Betrieb aufziehen lasse.
Obwohl es natürlich Winter war und Schnee lag, wurde am 9. Januar 1945 ein Beamter ausgesandt (das Namenskürzel unter dessen Bericht ist leider undeutlich), der dann in Freiberg berichtete, daß am Roten Hahn noch Pingen im ehemaligen Grubenfeld von Gott segne beständig bestanden haben ‒ dabei handelte es sich sehr wahrscheinlich um die letzten Farberde- Tagebaue der Zschierlich's, denn der Lagebeschreibung nach lagen sie rund 400 m östlich der Grube Stamm Asser (40030, Nr. 664, Blatt 25ff). Weiter heißt es: „Der aus dem Schwarzbachtal heraufführende Fahrweg von Langenberg nach Haide führt unmittelbar an den Pingen vorbei. Die Höhe dieses Weges an den Pingen ist anscheinend die tiefste Bausohle gewesen. Darüber sind auf einer kaum 1 Hektar großen Fläche an dem nach Osten noch ansteigenden Rücken bis zu etwa 5 m hinauf in verschiedenen Höhen einige dicht beieinanderliegende Einschnitte, teilweise mit kesselartigen Erweiterungen, in Quarzbrockenfels gegraben worden. Die Stöße sind mit Schuttmassen verdeckt. An einigen Stellen ragt der Fels noch hervor. Hier sieht man das Gestein von zahlreichen Klüften kreuz und quer durchsetzt. Die Klüfte sind mit Quarzgrus und eisenschüssigen, mulmigen Massen ausgefüllt. Der Zusammenhalt des Gesteins ist dadurch nur sehr gering. Erzhöffige Stellen konnten nicht gesehen werden... Das Gelände fällt nach Westen flach ab und besteht teils aus von alten Manganschurfgräben durchzogenem Ödland, teils aus landwirtschaftlich genutztem Boden.“ Nach dieser Beschreibung des vom Bergbau hinterlassenen Geländes oben am Hahn, suchte der Beamte noch nach dem Sieben Brüder Stolln, fand das Mundloch aber nicht mehr, und besuchte daraufhin noch die Standorte der Bohrungen N°1, 2 und 5 aus dem Jahr 1883 auf dem gegenüberliegenden Hang des Schwarzbachtales. Am 25. Januar 1945 kam man in Freiberg zu einer Beratung zusammen, wobei seitens des Bergamtes erklärt wurde, daß die Erschließung von Erzen am Roten Hahn zu langwierig werde und man stattdessen die Gewinnungsmöglichkeit von Roteisenstein im Rothenberger Gangzug bei Erla prüfe (40030, Nr. 664, Blatt 16ff). Die Gewinnungsarbeiten selbst könnten durch die Sachsenerz AG erfolgen, wobei jedoch seitens der interessierten Gießereibetriebe Arbeitskräfte und Geräte gestellt werden müßten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tatsächlich entschloß man sich dann, in
Erla einen ,Notbetrieb' zur Tempererzversorgung in den staatlichen
Grubenfeldern Erste Heinzenbinge und St. Johannes Stolln
aufzunehmen. Um die Genehmigung des Bergbauberechtigten, also des Landes
Sachsen, dazu zu erhalten, wandte sich das Oberbergamt am 31. Januar 1945
an das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit bei der Landesregierung in
Dresden (40030, Nr. 664, Blatt 36). Die Genehmigung wurde auch zeitnah am
3. Februar erteilt (40030, Nr. 664, Blatt 42).
Selbst, wenn das nötige Personal durch die Sachsenerz AG von der derzeit stilliegenden Grube St. Christoph in Breitenbrunn noch abgezogen und für den Betrieb in Erla bereitgestellt würde, fehlte es nun aber dort an den nötigen Geräten, wie Steinbrechern, Siebtrommeln und Kippern. Es dauerte noch bis zum 13. April 1945, bis man geeignete Technik in einem Steinbruch in Niederbobritzsch aufgetrieben hatte, aber die mußte ja auch noch von dort nach Erla transportiert werden... (40030, Nr. 664, Blatt 61) Wir dürfen wohl davon ausgehen, daß dieser Betrieb bis zum Kriegsende am 8. Mai 1945 nicht mehr aufgenommen worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Frage nach geeigneten Erzen zum
Tempern bestand offenbar aber auch noch nach Kriegsende im Land Sachsen
und später in der DDR
fort, denn die Akte enthält noch einen Bericht von Dr. Oelsner vom
12. Juni 1950, daß nach den 1945 angestellten Ermittlungen im Erzgebirge
an den oben schon angeführten zwei Stellen die Möglichkeit zur Gewinnung
von Tempererzen bestünde (40030, Nr. 664, Blatt 74ff). Über Langenberg
heißt es darin: „Während der Zeit der Förderung aus dem Rothenberger
Gangzug wäre eine Untersuchung des Quarzbrockenfelses bei Langenberg, in
dem wesentlich größere Mengen von Tempererzen neben kleinen Mengen
hochwertiger Hämatiterze, sowie Manganerze zu erwarten sind, in die Wege
zu leiten, um nach dem Abbau der Erlaer Erze weitere Erzmittel
vorgerichtet zu haben.“ Dr. Oelsner schlug vor, den Sieben
Brüder Stolln zu gewältigen, den alten Tagebau ,aufzuräumen' und etwa
2 km Ausrichtungstrecken aufzufahren, was binnen drei Jahren erfolgt sein
könnte. Er verwies aber auch darauf, daß beide Bereiche ja inzwischen
innerhalb des Grubenfeldes der Wismut AG lägen und man deren Genehmigung
einholen müsse.
Außerdem fanden wir eine Notiz vom 7. Februar 1951, nach der ein Herr Döhnel vom VEB Schachtbau Nordhausen in Freiberg vorgesprochen und um Auskunft über die bei Erla und Langenberg in diesem Jahr auszuführenden Arbeiten gebeten habe (40030, Nr. 664, Blatt 66). Der betreffende Fragekatalog ist auch ausgefüllt (40030, Nr. 664, Blatt 67ff) ‒ darüber, ob der Auftrag aber auch erteilt und diese Erkundungsarbeiten tatsächlich aufgenommen worden sind, verrät der weitere Akteninhalt nichts und uns ist auch an anderen Stellen nichts darüber zu Ohren gekommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Angaben zum
Ausbringen der Gruben
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Angaben zu den Maßeinheiten
aus den Akten und Unterlagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den nachfolgenden Überlegungen zu Fördermengen, Erlösen und Wirtschaftlichkeit der Gruben am Emmler ist noch ein Abschnitt zu den verwendeten Maßeinheiten voranzustellen. Das bis in die 1870er Jahre für die Vermessung des Eisensteins gebräuchliche ,Fuder' ist eine der am schlechtesten nachzuvollziehenden Mengenangaben im sächsischen Bergbau überhaupt. Zwar entsprach es näherungsweise einer Fuhrwerksladung ‒ doch war dieses Volumen von der Art und (Schütt-) Dichte des transportierten Materials, seiner Verladung (lose oder verpackt) und nicht zuletzt vom Transportweg abhängig. In steilem Gebirge zog ein Fuhrwerk einfach weniger, als auf einer ausgebauten Chaussee in ebenem Gelände... Vor allem, wenn es bergab ging. Pferde haben keine Bremsen. Je nach Ort und Material schwanken die Angaben zum Fudermaß daher zwischen fast 1,5 t und nur 0,5 t Gewicht. Weil es ein Volumenmaß gewesen ist, wurde der Eisenstein im Gegensatz zu den Gewichtsmaßen im übrigen auch immer ,vermessen' und nicht ,verwogen'.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Gruben, welche hier in der Region im betreffenden Übergangszeitraum ab 1862 und noch bis 1871 in Betrieb gestanden haben, können wir uns aber die eine Zeitlang im herkömmlichen Fudermaß und in metrischen Zentnern dokumentierten Fördermengen einmal herausziehen und vergleichen. Dies führt uns hier am Emmler auf einen Mittelwert von 0,833 t pro Fuder Brauneisenstein, wobei unsere nachstehende Grafik sowohl die Streuung des Fudermaßes bei den einzelnen Gruben untereinander, als auch eine tendenzielle leichte Abnahme des Gewichtes eines Fuders über das Jahrzehnt deutlich macht. Bei den zuletzt noch in Betrieb stehenden Gruben wog ein Fuder zwischen 16,5 und 17,0 Zentner.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
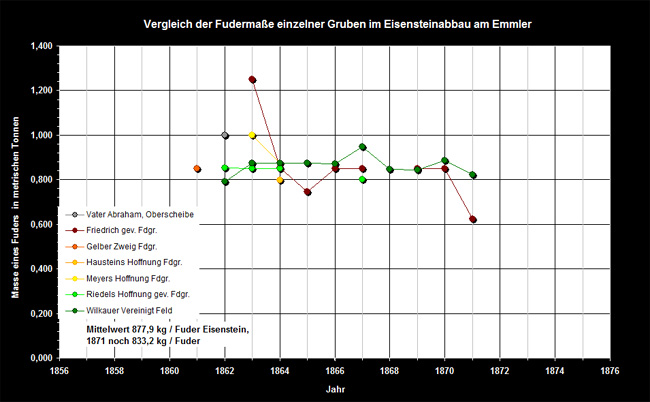 Graphische Darstellung des Verhältnisses der Angaben der Fördermengen verschiedener Gruben der Region an Eisenstein in Fudern und in Zentnern aus dem Zeitraum 1861 bis 1871.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Zahl gilt im Übrigen nur für das Ausbringen an
Eisenstein. Die meist viel geringere Menge an ausgebrachtem Manganerz
(Braunstein) wurde im Gegensatz zu den Volumenmaßen schon immer ,verwogen'
und in Zentnern angegeben, wobei nur zu beachten ist, daß ältere Angaben
bis zur Einführung der metrischen Maße und Gewichte durch den deutschen
Zollverein ab 1854 gewöhnlich noch den Bergzentner von 112 bis 114 Pfund
und nicht den metrischen Zentner von 50,0 kg beinhalten. Da das im
sächsischen Raum übliche Leipziger Pfund nun nur 467,625 Gramm wog,
umfaßte
der Bergzentner also eine Masse zwischen 52,37 und 53,31 Kilogramm.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die gelegentlich in Abrechnungen auftauchende und für Eisenstein und Flöße gleichermaßen gebräuchliche Maßeinheit ,Tonne' ist ebenfalls ein Volumenmaß gewesen, hat mit der späteren metrischen Gewichtseinheit von 1.000 kg allerdings gar nichts zu tun; vielmehr dürfte sich der Begriff einfach vom benutzten Messgefäß abgeleitet haben. In den Akten des Oberbergamtes zu Freiberg haben wir zwischen Abschriften verschiedener landesherrlicher Befehle und Weisungen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts die folgende, leider selbst undatierte Tabelle gefunden, welche uns zeigt, daß auch das Volumenmaß dieser Tonne zwischen den einzelnen Bergrevieren in einem ziemlich bedeutenden Intervall von 5.376 Kubikzoll (zirka 70,6 Liter) bis 15.552 Kubikzoll (zirka 204,4 Liter) schwankte (40001, Nr. 3287, Rückseite Blatt 11 bzw. Film 0014). Dabei muß man natürlich auch noch beachten, daß selbst die Längeneinheit ,Zoll' ja von Region zu Region verschieden gewesen ist ‒ wir haben das 1869 in Sachsen gültige Zollmaß von zirka 2,3599 cm (wikipedia.de) für unsere Umrechnung verwendet. Mit einem Volumen zwischen 70 und 200 Litern kam die ,Tonne' auch dem Scheffelmaß nahe. Die kleinsten ,Tonnen' hatte man offenbar in den Revieren Schneeberg und Voigtsberg in Verwendung, während sie in Glashütte und Neustadt am größten, und zwar rund dreimal so groß gewesen sind. Seltsamerweise fehlt in dieser Liste aber das Revier Annaberg, so daß man vermuten kann, daß sie aus der Zeit stammt, als Annaberg und Marienberg kombiniert waren (nach 1847). Ein Fuder enthielt in den meisten erzgebirgischen Revieren hiernach fünf derartige Tonnen, nur in Berggießhübel und im Neustädter Kreis wurden vier ,Kübel' pro Fuder gerechnet. Das Volumen von vier Berggießhübel'er Kübeln entsprach dabei aber ungefähr dem von fünf Schneeberg'er Tonnen. Viel Spaß beim Umrechnen in heutige Maßeinheiten...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verkaufspreise und Fördermengen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrachten wir zunächst den
Eisenstein: Der Bergmeister in Annaberg mit
Scheibenberg und spätere Leiter des Bergamts Schwarzenberg, Julius
Bernhard von Fromberg, hinterließ uns in seinen privaten Akten
folgende kleine Aufstellung über das Ausbringen einiger zwischen
Schwarzbach und Langenberg bis 1843 in Umgang gewesener Eisensteingruben
(40003, Nr. 223, Blatt 23). Nicht enthalten sind darin allerdings die 1843
noch in Betrieb stehenden Gruben, für die es eine gleichartige Liste an
dieser Stelle leider nicht gibt. Deren Ausbringen können wir aber den
Erzlieferungsextrakten entnehmen. Er notierte sich über die...
Auflässige Eisensteingruben b.) bey Langenberg, Tännicht, Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herr von Fromberg hat seine Liste nach den Grubennamen alphabetisch
geordnet. Wir ordnen sie einmal nach der Betriebsdauer der Gruben um und
lassen gleich diejenigen weg, welche nur Braunstein gefördert haben:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Der Vereinfachung halber haben wir nur die Thalerbeträge durch die Fuderanzahl dividiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hieraus ersieht man nun nicht nur, daß die meisten der aufgeführten Gruben
nur eine kurze Betriebsdauer von weniger als 5 Jahren aufzuweisen hatten,
sondern auch, daß deren Gesamtförderung nicht proportional zur
Betriebsdauer gewesen ist. Die durchschnittliche jährliche Förderung
schwankte vielmehr zwischen weniger als 20 Fudern und über 120 Fudern, was
auf die Verschiedenheit der Anbrüche einerseits, aber auch auf den Umfang
des Betriebes während der Betriebsdauer andererseits verweist. Wenn wir
außerdem die angeführten Erlöse durch das Ausbringen dividieren, dann
sehen wir auch, daß während dieser Zeit (mit Ausnahme von Köhlers
Hoffnung, wo sie darüber hinausging, lag die Betriebszeit sämtlicher
hier aufgeführten Gruben im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts) die
durchschnittlichen Preise pro Fuder Erz mit weniger als 1 Thaler (rund 27
Groschen nach dem Münzfuß ab 1841) und mehr als 2 Thalern sehr deutlich
verschieden gewesen sind. Der Mittelwert, der sich aus unserer Rechnung
hier ergibt, liegt bei rund 1 Thaler, 6 Groschen pro Fuder Eisenstein.
Zwar sind die niedrigsten Preise mit rund 27 Groschen pro Fuder bei zwei
Gruben, deren Betriebszeit vor 1810 endete, zu finden, doch ein
Zusammenhang zwischen Betriebszeit und Erlös läßt sich nicht erkennen –
ein Zeichen dafür, daß die Preise immer von der unterschiedlichen Qualität
des Erzes bestimmt waren.
Für die Bezahlung des Eisenerzes pro Fuder haben wir
aus den Grubenakten auch noch folgende Beispiele herausgezogen.
Sofern er den brach, wurde übrigens Roteisenstein (mit bis zu 3 Thaler pro
Fuder) gewöhnlich deutlich höher bezahlt, als Brauneisenstein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da die Gewerken bei Vater Abraham lange Zeit
dieselben blieben (wenn auch die Besitzer der Hammerwerke über die
Jahrhunderte wechselten), auch deren Abnahme pro Jahr lange Zeit sehr
konstant gewesen ist, kann der von diesen Hammerwerksbesitzern für das
Eisenerz berechnete Preis (es war ja eigentlich kein freier Verkauf,
vielmehr wurden die Erzlieferungen mit den Betriebskosten verrechnet) als
Mittelwert für den langen Betriebszeitraum dieser Grube angesehen werden.
Bei den Eigenlehnern, die ihr Ausbringen dagegen an verschiedene Hammerwerke absetzten, spiegelt auch der erzielte Verkaufspreis einige der politischen und finanziellen Umbrüche wider, wie es folgende Grafik veranschaulichen soll.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suchen wir die in den verschiedenen Quellen angegebenen oder aus den in den Anschnitten angegebenen Einnahmen wieder errechneten Verkaufspreise für den Braunstein aus unserem Text heraus, so ergibt sich folgendes Bild. Bedingt durch die 1680 an Johann Friedrich und erneut 1717 an Christoph Flemming erteilten Handelsmonopole für Braunstein und andere ,Fossilien' erscheinen die zumindest von diesen Zwischenhändlern erzielten Preise mit teils über einem Thaler pro Zentner vergleichsweise hoch. Das relativiert sich aber sofort deutlich, wenn wir uns erinnern, daß der Braunstein etwa auf der Leipzig'er Messe zu 3 Thalern und mehr gehandelt wurde. Bei den Eigenlehnern in Langenberg kam davon schon immer nur wenig an; im Gegenteil wurde denen noch der Fuhrlohn bis zum Fossilienwerk in Schwarzenberg und natürlich der Zehnte an die Bergkasse aufgebrummt. Ende des 18. Jahrhunderts kam es zu einem weiteren Preisverfall, nachdem Grubenbetreiber auch anderenorts auf die Verdienstmöglichkeiten mit diesem Nebenprodukt aufmerksam geworden sind und nun ebenfalls den Braunstein ‒ wo er denn beibrach ‒ aushielten und zum Verkauf brachten. Mehr als 10 oder 12 Groschen pro Zentner brachte der Verkauf in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Eigenlehnern nicht ein. Wie beim Eisenerz auch, brachte die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber eine steigende Nachfrage und damit auch deutlich steigende Verkaufspreise mit sich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vergleichen wir nun die Fördermengen, so ergibt sich ein ähnliches Bild. Mit wenigen Ausnahmen überstieg das Ausbringen der Eigenlehnergruben an Eisenerz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Menge von 200 t pro Jahr nicht. Wie hätten die Eigenlehner auf ihren winzigen Grubenfeldern es auch bewerkstelligen sollen... Erst im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts stiegen die Fördermengen an Eisenerz deutlich an und überschritten namentlich bei den konsolidierten Gruben, wie Wilkauer vereinigt Feld oder Riedels Fdgr. die Grenze von 1.000 t deutlich. Daran hatten neben der Königin Marienhütte in Zwickau vor allem Unternehmer, wie die Kaufleute Merkel aus Raschau und E. E. Zweigler aus Wildenau, großen Anteil. Mit dem Ende der Gründerzeit brach aber auch dieser Aufschwung abrupt wieder ab. Nach 1875 waren die meisten Gruben zwar in den Händen weniger, meist auswärtiger Unternehmer, wie G. Zschierlich und H. Gruson, konzentriert, wurden aber die meiste Zeit nur noch in Fristen gehalten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
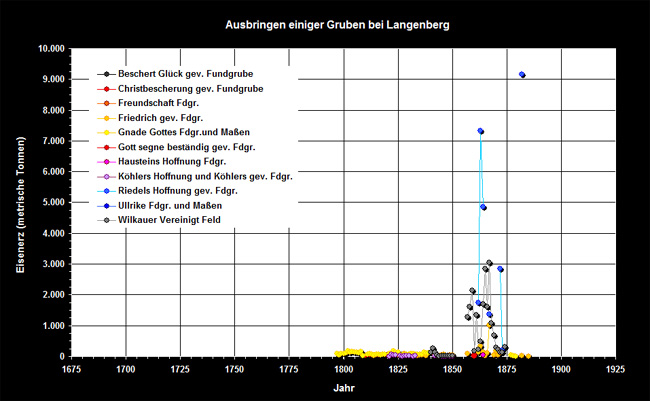 Vergleich des in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr.22 und 26) sowie den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen dokumentierten Ausbringens einiger Gruben bei Langenberg an Eisenerz (überwiegend Brauneisenstein).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
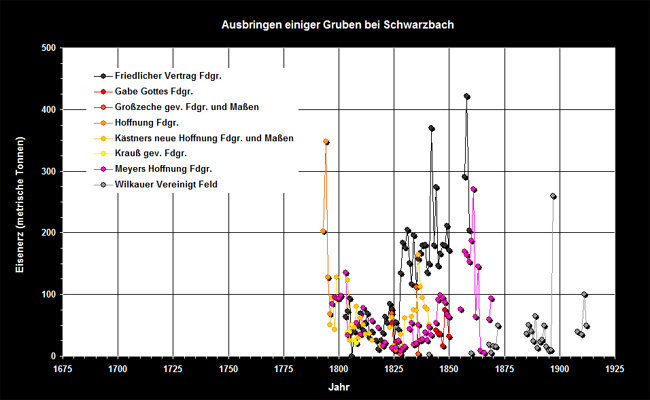 Vergleich des in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 1, 22 und 26), den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen sowie den Grubenakten dokumentierten Ausbringens einiger Gruben bei Schwarzbach an Eisenerz (überwiegend Brauneisenstein).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nur wenig anders sieht es bei der Braunstein- Förderung aus. Insbesondere bei Langenberg gab es eine Reihe von Gruben, die vorrangig oder ausschließlich auf diesen Rohstoff bauten und schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Ausbringen von 100 t pro Jahr erreichten oder überschritten. Namentlich bei Riedels Fundgrube samt Juno Stolln wurde schon vor 1870 unter E. E. Zweigler eine bedeutende Förderung erreicht. Im Gegensatz zum Eisenerz blieb die Krise am Ende der Gründerzeit bei diesem Rohstoff jedoch nur kurz, wofür aber auch der neue Eigentümer G. Zschierlich sorgte, der den Braunstein nicht mehr vollständig zum Verkauf stellte, sondern diesen (und den beibrechenden Ocker) in seinen eigenen Farbenwerken in Geyer verarbeitete.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses ,Nachlaufen' der auf Braunstein bauenden Gruben gegenüber den ausschließlich oder vorrangig auf Eisenstein bauenden Gruben wird auch anhand der Anzahl der verliehenen Gruben sichtbar, wenn wir einmal differenzieren, welche denn hauptsächlich das eine oder das andere Material gefördert haben. Dennoch ging der Bergbau am Emmler ‒ mit Ausnahme der Kalksteingewinnung ‒ mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges endgültig zu Ende. Nicht einmal die Manganerz- Gesellschaft innerhalb der Kriegsmetall AG hatte noch Interesse an den kleinen und schon lange bebauten Erzlagern zwischen Raschau, Langenberg und Schwarzbach. Den für diese Auswertung verwendeten
Aufzeichnungen in den Erzlieferungsextrakten und den Jahrbüchern zufolge
summierte sich das nachweisbar dokumentierte Ausbringen an Eisenerz in der Zeit nach dem
Dreißigjährigen Krieg im Langenberg- Schwarzbach'er Revier übrigens auf
insgesamt etwas über 54.462 t. Zur Einschätzung der Größenordnung sei
aber hinzugefügt, daß allein auf der einen Grube Vater Abraham zu
Oberscheibe von 1677 bis 1865 wenigstens 29.022 t Eisenerz
gefördert worden sind. Wahrscheinlich ist das
Gesamtausbringen aber bedeutend größer gewesen, denn diese Aufzeichnungen weisen
so einige Lücken auf und
aus alten Halden ausgeklaubte, nur geringe Mengen haben wir hier gar nicht
erst mit eingerechnet. Nehmen wir aber nur einmal an, daß sich die Förderung
aus dem Jahr
An Braunstein wurden in der Zeitspanne nach dem Dreißigjährigen Krieg, bis in die die Erzlieferungsextrakte zurückreichen, in Langenberg und Schwarzbach nachweisbar reichlich 12.870 t ausgebracht. Bei dieser Zahl reichen die zugrundeliegenden Angaben in diesen Akten aber nur bis in das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts zurück.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
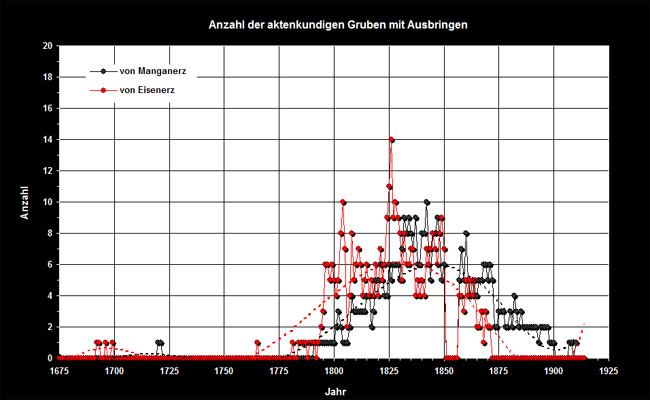 Entwicklung der Anzahl der zwischen Oberscheibe, Schwarzbach, Langenberg und dem Emmler bei Raschau auf Eisenerz und Manganerz bauenden Gruben. Unsere Auflistung ist dabei keineswegs vollständig, illustriert jedoch - nur anhand der Aktenüberlieferung - die Tendenz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemerkungen
zur Wirtschaftlichkeit der Gruben
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anhand der ab 1868 in den Jahrbüchern für
das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen aufgeführten Zuschüsse zum Betrieb und
den Einnahmen
aus dem Erzverkauf können wir auch versuchen, uns ein Bild von der
Wirtschaftlichkeit der Gruben machen. Beispielhaft ziehen wir uns dazu
Riedels Fdgr. und Wilkauer vereinigt Feld heraus ‒ beide
zuletzt im Eigentum von G. Zschierlich.
Wie die beiden folgenden Grafiken deutlich machen, überstiegen die Betriebskosten die Einnahmen in den hier erfaßten Zeiträumen zumeist deutlich. Die Gewinnung mineralischer Farbpigmente durch Zschierlich wog die für Betrieb und Neuaufschlüsse anfallenden Kosten in keiner Weise auf. Auch für die Erhaltung des Bergbaurechtes durch Fristhaltung der Gruben fielen bei der Bergbehörde natürlich Gebühren an. Von einem auskömmlichen oder gar einträglichen Betrieb kann man zu dieser Zeit wohl schon nicht mehr sprechen und so wird das Ende des Bergbaus nur allzu verständlich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
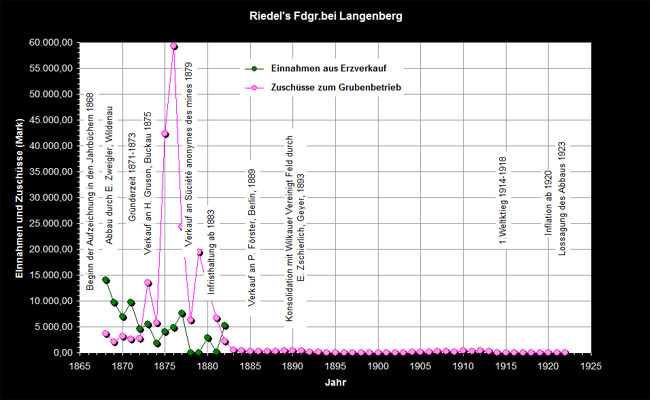 Angaben zu den Einnahmen aus dem Erzverkauf und zu den Betriebskostenzuschüssen in den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen für die Riedels Fdgr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
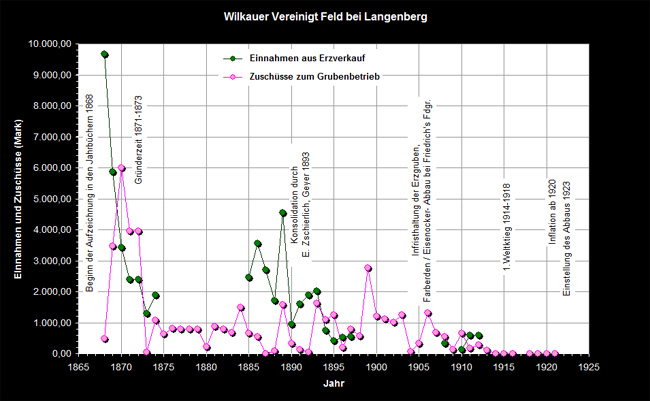 Angaben zu den Einnahmen aus dem Erzverkauf und zu den Betriebskostenzuschüssen in den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen für Wilkauer vereinigt Feld.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erkundungsarbeiten durch die SDAG Wismut
1953-1957
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schurf 17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die haben aber auch wirklich überall
gegraben. Zwischen dem Knochen und dem Emmler erfolgte nach dem
Auslaufen des Uranerz- Abbaus im Revier
Da wir hier nun geologisch schon im Glimmerschiefer der Raschauer Folge stehen, dürfte die Erkundung von Uranerz an diesem Punkt freilich ergebnislos gewesen sein. Selbst die Eisen- und Manganerz- Vorkommen konzentrieren sich auf dem Nordhang der Emmlerhöhe. Zwar sind auch etliche Bergbauversuche an der Südseite des Emmlers von Raschau und Markersbach her bekannt, doch hat wohl keine dieser Gruben längere Zeit beständig Ausbeute gegeben. Nach Absenken des Schachtes und Auffahren eines Querschlages, wobei man noch zwei kurze Gangstrecken anschlug, hat auch die SDAG die ganze Sache bereits nach einem Jahr wieder abgebrochen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die kleine, baumbestandene Halde des Schurfs 17 der SDAG Wismut direkt unterhalb der Emmlerhöhe im Sommer 2018 vom Emmlerweg aus gesehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am bergseitigen Rand der Halde, gleich am Rand zum Acker, befand sich der eingezäunte Schurfschacht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Bruchtrichter war ziemlich groß und hatte mehr als 10 m Durchmesser, was wohl daran lag, daß dieser Schacht ungewöhnlich flach tonnlägig abgesenkt war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Sohle der Pinge erkannte man das Schachtauge und außerdem Müll und Schlachtabfälle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da der Schurf 17 ziemlich weit abseits
vom vielbegangenen Wanderweg und mitten in der Feldfläche liegt, stand er
nicht ganz oben in der Proritätenliste. Aber im Zusammenhang mit den
Verwahrarbeiten im Bereich des Gangs 58 im Erkundungsrevier August im
Zeitraum 2020 bis 2022 wurde auch dieser Schurfschacht endgültig
verschlossen.
Die folgenden Aufnahmen wurden uns freundlicherweise vom Ingenieurbüro TABERG-Ost für diese Dokumentation zur Verfügung gestellt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dazu wurde er erstmal von Ruderalbewuchs und Müll beräumt und hier sieht man noch einmal die ganze Größe dieses Lochs.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann kam Verbau hinein und der Bruchtrichter wurde schon einmal angefüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seltsam war nur, daß sich die lose Masse auch im Vertikalen fortsetzte - es war (außer auf dem Streifen, auf dem die Fahrten aufstehen) - keine feste Sohle zu finden. Vermutlich hatte die Wismut ihren Schurfschacht also am Standort eines älteren, steil tonnlägigen Schachtes angelegt und diesen überteuft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von der Sohle in zirka 10 m Tiefe der erste Blick in den Schacht: Zwischen den nachgerollten Massen steckte auch noch hier jede Menge Müll. Diese Pinge lag weiß Gott abseits aller Fahrwege und auf dem Hügel - ich frage mich immer wieder, wer seine Abfälle lieber heimlich den Berg raufschleppt, anstatt sie vor der Haustür in die Mülltonne zu stopfen und wenn man sie schon auflädt, kann man sie doch auch zum Wertstoffhof fahren...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier sieht man im unteren Bildteil etwas später noch einmal den Bereich, in dem festes Gebirge in der Sohle anstand, und dort, wo der Minibagger arbeitet, lag nur loses Gestein. Irgendetwas schien auch mit der Neigung des Schachtes, die im Risswerk angegeben war, nicht zu stimmen. Allein der Sicherungsausbau des entstehenden, großen offenen Profils machte die Gewältigung mehr und mehr aufwendig.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jedenfalls wurde nun auf Schrägförderung mit Hilfshaspel umgestellt und nur noch der Wismut- Schurfschacht weiter aufgewältigt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Blick von unten...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und der Blick nach unten. Ein ziemlicher Bruchschuppen !
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der genaue Blick auf die Firste zeigt zudem: Der Schacht war genau im Fallen der Schieferung abgeteuft. Die eigentliche Überraschung ergab sich aber aus der Vermessung, denn wie sich herausstellte, besaß dieser Schurf eine Neigung von lediglich 27° - das war eher ein Fallort, denn ein Schacht. Laut Altriss hätte er 45° Einfallen aufweisen müssen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Füllort in etwa 25 m Tiefe kam dadurch jedenfalls ziemlich weit draußen auf dem Feld zu liegen - etwa dort, wo das Bohrgerät steht. Das Foto ist ungefähr im Verlauf der Schachtachse aufgenommen. Da die Bergefeste über der Schachtfirste aufgrund seines sehr flach tonnlägigen Verlaufs auch nur langsam anwächst, wurde sicherheitshalber über die Bohrungen eine Füllortplombe eingebaut und dann der komplette Schacht verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Emmlerhöhe im April 2023 von Raschau aus über das Mittweida- Tal hinweg gesehen. Der Bewuchs der kleinen Halde des Schurfs 17 hat sich zwar noch nicht wieder geschlossen, aber der wächst von allein wieder zu. Die Halde wird als Zeugnis dieses letzten Kapitels des Bergbaus bestehen bleiben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schurf 562
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Ostteil unseres
Betrachtungsraumes in diesem Beitrag grenzt dann an das Erkundungsgebiet
Elterlein- Hermannsdorf- Schlettau der SDAG Wismut an. Die Chronik der Wismut (Abschnitt
2.1.12) nennt uns aus der Arbeitsetappe von 1947 bis 1954 in diesem Raum
neben großflächig durchgeführten geophysikalischen und hydrogeologischen
Arbeiten und der Gewältigung mehrerer Altstolln und Schächte auch einige
neu geteufte Schächte und Tiefschürfe bei Dörfel und bei Scheibenberg.
Zum Nachweis einer bauwürdigen Uranlagerstätte ist es in diesem Gebiet nicht gekommen. Die auf einzelnen Gängen mit BiCoNi- Vererzungen sowie in tektonischen Zonen in den Grubenbauen lokal angetroffene Uranvererzung besaßen nur die Größenordnung von Erzvorkommen von mineralogischem Interesse, aber ohne wirtschaftliche Bedeutung. So wurden 1954 auch hier die bergmännischen Arbeiten eingestellt. Aussagekräftige Unterlagen über die bergbauliche Tätigkeit der SDAG Wismut aus dieser Zeit liegen allerdings nicht mehr vor. Bei Schwarzbach wurde in dieser Phase (um 1950) der Schurf 562 saiger bis auf zirka 40 m Teufe abgesenkt. Der Ansatzpunkt befand sich direkt am Emmlerweg nördlich der Bahnlinie Schwarzenberg- Annaberg auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche. Der Schurf wurde nach Einstellung der Erkundung offenbar nur oberflächennah abgebühnt. Nach dem Versagen der Abbühnung sackten die Füllmassen in der Schachtröhre um 20 m Teufe nach und die offenstehende Schurfröhre wurde begeistert als Mülldeponie genutzt. Im Jahr 2013 wurde der Schurfschacht verwahrt (wismut.de).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das freigelegte Schachtauge in der Felsoberkante: Da dieser Schurf einen deutlich kleineren Querschnitt als der Schurf 17 besaß und saiger abgeteuft war, konnte er mit einem tagesnahen „Stöpsel“ sicher verschlossen werden. Foto: B. Tunger
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dann können die Fahrmischer kommen… Foto: B. Tunger
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 …und der Schacht wird mit einem Betonpfropfen verschlossen. Sicherheitshalber bekam dieser noch ein Drainagerohr, damit das Grundwasser zirkulieren und sein Druck den Pfropfen nicht ausheben kann. Foto: B. Tunger
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bergschäden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der intensive und zumeist recht tagesnah
umgegangene Bergbau hat bis heute spürbare Folgen. Wie oben zu lesen war,
wurde er zumeist von Eigenlehnern betrieben, die wenig Interesse daran
hatten, ihr mühsam verdientes Geld in rissliche Dokumentation und
hinterher in eine ordentliche Verwahrung ihrer Schächte und Abbaue zu
stecken. Auch die Bergbehörden achteten in der Vergangenheit noch wenig
darauf und Abschlussbetriebspläne sind eine Forderung heutiger Zeit... Die Beschwerden und Befürchtungen des Herrn Carl von Querfurth
beim Bergamt zu Scheibenberg waren jedenfalls nicht so ganz unbegründet.
Und auch die heutigen Anwohner werden sich bestimmt erinnern.
So erfolgten zum Beispiel im Zeitraum 2004 bis 2006 Sanierungsmaßnahmen im Bereich des ehemaligen Riedelschachtes in Langenberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Upps - schon wieder ein Loch. Ein Tagesbruch mitten auf dem Feld, wo die Landwirtschaft späterer Zeit alle Spuren des umgegangenen Bergbaus wieder verwischt hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwischen Emmlerweg und Langenberg gab es 2005 gleich mehrere davon.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im Jahr 2007 fiel der nächste Bruch auf dem Feld zwischen Emmlerhöhe und Kirchsteig...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 wurden sie dann im Auftrag des Sächsischen Oberbergamtes untersucht und verwahrt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Baggerschurf auf dem ersten Tagebruch. Außer völlig gebrächem, eisenschüssigem Gestein und erdigen Füllmassen war hier nichts mehr zu finden... Alles zubruchgegangen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der zweite: Unter einer dünnen, kaum einen Meter starken Auflage aus gelblich- braunem Gehängelehm kam in der Felsoberfläche das Schachtauge zum Vorschein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Blick in den Schacht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch hier steht in den Schachtstößen eisenschüssiger Brockenfels an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Abbaugassen waren auch hier durch Verbrüche - bis auf kleinere Resthohlräume - im Laufe der Zeit wieder zusammengegangen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei Nummer drei war noch mehr davon erhalten. Hier sieht man auch besonders gut, wie tagesnah die Vorfahren eigentlich abgebaut haben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man sieht auf diesem Bild auch gut den Wechsel im Gestein: Unter rötlichem, eisenschüssigem Schiefer liegt hier eine Lage von gelblich- braunem, „ockerigem, auch dichtem Eisenstein“ und den haben die Alten gesucht und abgebaut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Darin waren auch unregelmäßig „nesterweise“ verteilte Anreicherungen von schwarzem Braunstein eingeschaltet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und auch weiter oben im Schwarzbachtal - unterhalb des einstigen Huthauses von Wilkauer vereinigt Feld - ist die Erde noch nicht wieder zur Ruhe gekommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein neuer Tagesbruch im Verlauf des Ullrike- Stollns zwischen dem Schwarzbach und der Landstraße ist im Jahr 2014 gefallen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am letzten stand 2023 noch die Einzäunung
auf der Wiese. Und das werden gewiß noch längst nicht
die letzten Tagesbrüche in diesem Revier gewesen sein, auch wenn man davon
ausgehen kann, daß das oft als wenig standfest beschriebene Gebirge die
verbliebenen Hohlräume sukzessive wieder schließen wird.
Wie es der Zufall wollte: Noch während wir zur Bergbaugeschichte für diesen Beitrag recherchierten, öffnete sich doch mitten in Langenberg erneut die Erde...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Anwohner fanden in ihrem Keller unter dem Hausgiebel ein Loch und meldeten es dem Oberbergamt, wobei uns doch sofort das
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Weil dieser Bruch direkt unter einem Wohnhaus lag, war sofortiges Handeln vonnöten und die Bergsicherung Sachsen GmbH wurde vom Sächsischen Oberbergamt nicht nur mit der Fertigung einer Sachstandsanzeige, sondern daraufhin auch mit der Erkundung und Verwahrung beauftragt. Foto: Bergsicherung Sachsen GmbH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Frühjahr 2024 wurde deshalb eine Baustelle daraus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Lage des Bruches machte den Zugang natürlich nicht einfach...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Berufs wegen dürfen wir einmal hineinschauen: Es geht erst einmal unter den Hausgiebel...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann geht es um die Ecke und weiter hinunter...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch wir fahren mal an...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das höchst gebräche Gestein machte auch hier massiven Ausbau mit Stahlrahmen, Baustahlmatten und Spritzbeton erforderlich und die Sohle der Erkundungsteufe hatte zum Zeitpunkt unserer Befahrung gerade den braunen Mulm unter dem zersetzten Glimmerschiefer erreicht. Irgendwann ging es hier nicht weiter...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daher wurde der erste Schacht verfüllt, damit war der Gebäudegiebel erst einmal wieder standsicher und dann ging es mit einer zweiten Untersuchungsteufe etwas abgerückt vom Haus noch einmal hinunter.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wenigstens geht es hier nun senkrecht und ohne gebrochene Förderwege vorwärts. Stand der Teufarbeiten im März 2025. Einige Holzfunde belegten, daß diese Teufe nun wirklich auf dem früheren Tageschacht angesetzt war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei etwa 15 m Teufe wurde hier eine Strecke auf der oberen Sohle oberhalb des östlichen Flügels des Juno- Stollns erreicht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Aufwältigen fanden die Kollegen die Strecke aber gänzlich zusammengegangen vor: In der oberen Hälfte sieht man unverritzten und noch halbwegs kompakten ,Mulm', darunter feines, dichtes, dunkelbraunes Material, mit dem die Strecke gänzlich ausgefüllt ist. Man weiß nicht, ob dies als Versatz eingebracht oder ob das weiche Material durch den Druck des überlagernden Gesteins hineingedrückt wurde...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein paar Meter gruben sich die Männer noch hinein. Es hätte ja ein Schüttkegel der Schachtverfüllung sein können und dahinter wär´s hohl. Hier sieht man das Profil der ausgefüllten Strecke anhand der dunklen Verfärbung noch besser - hier jedenfalls scheint nichts mehr offen zu sein. Daher konnte man an dieser Stelle aufhören...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auf diesem Rissausschnitt haben wir die Lage dieses Schachtes nordöstlich vom alten Köhlerschacht markiert, graugrün ist hier die obere Sohle, hellrot die Strecken auf der Sohle des Juno Stollns in etwa 22 m Tiefe gekennzeichnet. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040, Nr. L8310, Ausschnitt, Norden ist rechts oben.
Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Schacht wurde wieder verfüllt und
für´s erste können die Bewohner dieses Hauses wieder ruhig schlafen. Wie
der Rissausschnitt aber auch illustriert, wurde dieser Teil von Langenberg
von den Vorfahren gründlich unterhöhlt ‒ also schauen wir mal, wo es das
nächste Mal im Untergrund knirscht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erhaltene Zeugnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vater Abraham
bei Oberscheibe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da unser hier betrachtetes Gebiet zu weitläufig ist, um es „in einem Ritt“ abzulaufen, und auch wir mehrere Exkursionen gebraucht haben, um alle wichtigen Punkte wenigstens einmal gesehen zu haben, untergliedern wir auch die folgende Bilddokumentation und beginnen ‒ wie in unserem Text auch ‒ ganz im Osten in Oberscheibe. Die folgenden Aufnahmen entstanden im Vorfrühling 2024. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir versuchen einmal, den zur Grube Vater Abraham im Bergarchiv vorliegenden Riß (Bestand 40040, Nr. K8845) so gut es geht, in die heutige Topographie einzupassen. Irgendwo unten im Dorf, oberhalb des Abzweigs des Mühlgrabens, muß das Mundloch des Tiefen Stollns gelegen haben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir stehen hier an der Dorfstraße am Abrahamsbach. Von einer Einleitung der Stollnwässer finden wir nichts, obwohl doch Müller Arnold schon 1853 das Wasser genutzt hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Blick talaufwärts: Auch hier findet man zwar einige Regenwassereinleitungen, aber nichts mehr, was aus dem Stolln kommen könnte…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Gebäude am Ende dieser Grundstückszufahrt müßte das vormals Ullmann'sche Gut sein. Nach unserer Zulage müßte das Stollnmundloch einst links der Zufahrt – vielleicht dort, wo die Fichten stehen – gelegen haben. Auch der Röschenverlauf unterhalb des Bauerngutes ist heute mit Einfamilienhäusern überbaut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wandern wir also am Bach entlang durch das Dorf bergwärts und passieren die alte Schule, die mit ihrem Dachreiter an ein Huthaus erinnert…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
… und entdecken stattdessen das schick hergerichtete Mundloch des Neue Hoffnung Gottes Stollns.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der noch tiefstehenden Morgensonne entgegen geht es weiter aufwärts.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon außerhalb des Ortes entdecken wir dann beimBlick von der S 208 nach Westen die große Halde des Vater Abraham’er 2. Tageschachtes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Um diese Jahreszeit können wir noch einfach über's Feld laufen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Wasserfassungen in dieser Quellmulde gibt es offenbar schon lange.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…und gelangen zu den beiden Teichen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Teiche von oben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberhalb befindet sich die kleine Halde des Lichtlochs auf dem Entwässerungsstolln und dahinter die große Halde des Kalkwerks von Oberscheibe. Vom 3. und 4. Tageschacht sowie vom Frenzelschacht ist hier aber nichts mehr zu entdecken… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
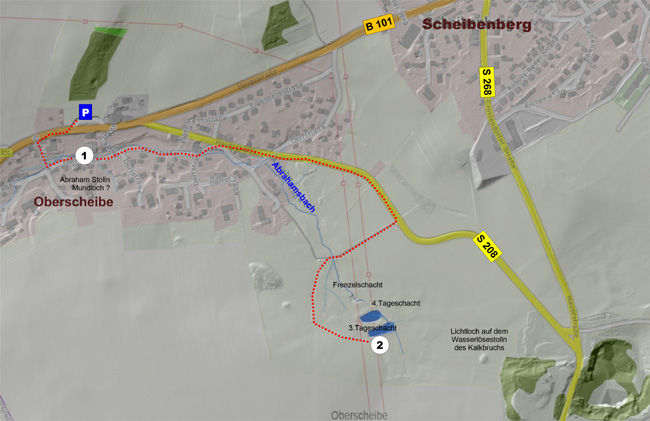 Unser jetziger Standort auf der Reliefkarte, Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
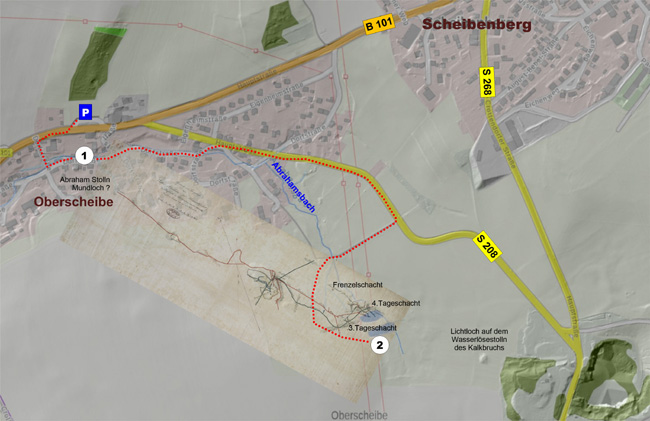 Wir versuchen wieder, den zur Grube Vater Abraham im Bergarchiv vorliegenden Riß (Bestand 40040, Nr. K8845) in die heutige Topographie einzupassen: Hier oben müßten der verbrochene 3. Tageschacht und auf der anderen Seite der Teiche der 4. Tageschacht gelegen haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marschieren wir also durch das Quellgebiet wieder runter...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese kleine Halde ist keinem Schacht auf dem Grubenriß zuzuordnen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber die große Halde gehört zum 2. Tageschacht der Grube Vater Abraham.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein paar Lesesteine mit Brauneisenstein vom Haldenfuß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zersetzter, eisenschüssiger Glimmerschiefer.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leider auch hier diverse Ablagerungen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf der Haldenoberfläche ist auch nichts mehr von den einstigen Tagegebäuden zu sehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
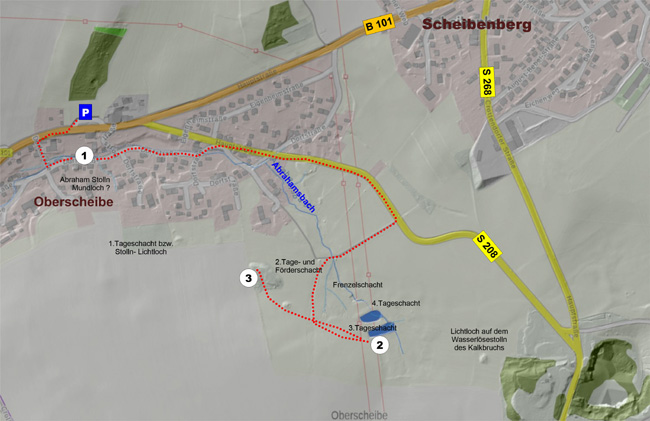 Unser jetziger Standort auf der Reliefkarte, Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
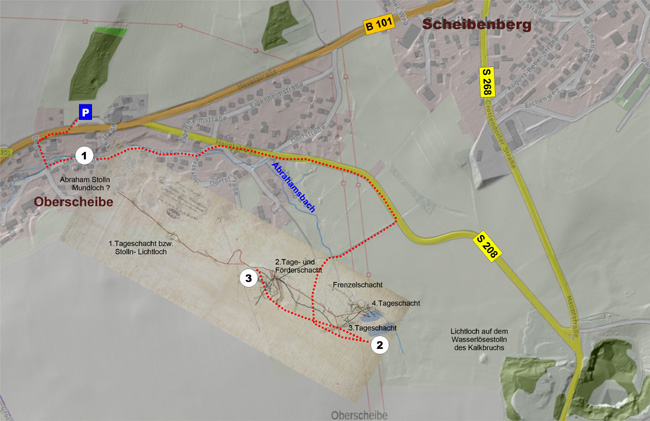 Unsere Einpassung des im Bergarchiv vorliegenden Risses (Bestand 40040, Nr. K8845) in die heutige Topographie: Wir stehen also auf der Halde des 2. Tageschachtes und über dem Kunstschacht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nördliche Haldenböschung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dort unten am Rand der Bebauung sieht man die Halde des Lichtlochs bzw. des 1. Tageschachtes auf dem Stolln. Da sie offenbar bereits im Privatgrundstück liegt, gibt es für uns hier nichts mehr zu finden und wir kehren um…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir freuen uns am Wegrand aber über die Frühlingsboten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zumindest im Straßennamen bleibt hier auch die Erinnerung an die Eisenerzgrube bewahrt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder am Parkplatz. Das Erbgericht war mal eine Gaststätte, scheint uns aber längst geschlossen zu sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruben bei
Schwarzbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nun wieder hinüber zum Emmler. Die folgenden Aufnahmen entstanden bei einer Wanderung im Frühjahr 2023, die wir am Wanderparkplatz am Emmlerweg, dort, wo er den Mühlberg quert, begonnen haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Stück weiter noch einmal der Blick nach Süden...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein wenig herangezoomt, der Scheibenberg...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und an dieser Stelle kann man auch nach Nordosten in das Schwarzbach- Tal schauen, an dessen oberem Talschluß das Städtchen Elterlein liegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehr nett - ein erster Rastplatz. Wenn man will, kann man hier wieder nach Markersbach hinunter abbiegen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das wollen wir heute nicht, sondern marschieren noch ein Stück in Richtung Scheibenberg weiter... Bei der etwas größeren Halde vorn links vom Weg handelte es sich um den Schurf 562 der SDAG Wismut. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir stehen jetzt hier, wo sich die Normalspur- Bahnlinie vom Mittweida- Tal nach Scheibenberg hinauf windet. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Glimmerschiefer in den Lesesteinen tritt von hier an nordostwärts nun zurück; stattdessen findet man vermehrt massige Quarzbrocken, manchmal mit etwas Eisenglanz auf Kristallflächen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oder auch mit Krusten von Hartmanganerz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das war gewissermaßen unsere „Anreise“ ‒ nun folgen die eigentlich interessanten Punkte. Wir durchqueren einfach den Gleisen folgend das Waldstück und dann stehen wir nördlich der Bahngleise an einem weiteren Steinbruch am oberen Talhang des Rothenbachs südlich von Schwarzbach. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Station 2 und die erste auf unserer Liste für heute... Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Steinbruch ist auch im Reliefbild des Geoportals (oben) gut zu erkennen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von hier hat man auch wieder einen schönen Ausblick über die Wiesen hinunter nach Schwarzbach und (im Hintergrund) bis nach Elterlein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Natur hat sich das meiste schon wieder zurückgeholt...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...aber der Geologe freut sich, dass noch nicht alles von Moos und Laub verdeckt ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier findet man noch einiges typisches Material des „Quarzbrockenfelses“.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wenn die Brocken nicht so groß und schwer und aufgrund ihrer Härte und Sprödigkeit kaum zu spalten wären, könnte man sich glatt noch ein Belegstück einstecken. Aber wir haben auch den ganzen Weg zurück noch vor uns...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch Krusten von Hartmanganerzen finden sich in den gewöhnlich mit Rasen kleiner Quarzkristalle ausgekleideten Zwickeln dieser Brocken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir schauen schon mal hinüber zum Richterberg am anderen Ufer des Rothenbachs...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
... halten uns zunächst aber querfeldein unterhalb der Bahngleise weiter ostwärts.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnbrücke ist ein markanter Punkt, der auch im Reliefbild leicht zu erkennen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Schatten des Bahndamms blühen sogar noch Schlüsselblumen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir schauen uns nördlich oberhalb der Gleise um...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und finden auch hier einige unnatürliche Geländekonturen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch hier - wo vielleicht einmal die „Zickelwiese“ gelegen hat, haben die Vorfahren auf ihrer Suche nach Eisenerz herumgegraben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch ein paar kleine Halden im Hochwald.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch unterhalb der Gleise schaut der Waldboden ziemlich uneben aus. Leider verdeckt hier viel junges Holz am Boden die Geländekontur. Daß sich der Bestand hier auf natürliche Weise selbst verjüngt, ist zwar schön für den Wald, aber eher hinderlich für uns...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Blick hangaufwärts mit „mobilem Größenmaßstab“. Die meisten der „Buckel“ und Pingen sind sehr klein und gehen vielleicht nur auf Erkundungsschürfe zurück. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir stehen jetzt am Südhang des Richterbergs.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Detail aus der Reliefkarte, Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jetzt hinunter ins Rothenbachtal - in seinem oberen Teil ist es ein recht steilwandiges Kerbtal.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unten plätschert der Bachlauf nordwestwärts in Richtung Schwarzbach.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uns interessieren hier einige schon im Reliefbild des Geoportals auffällige Geländekonturen, wie diese, an den steilen Hang angeschüttete, kleine Halde. Wir stehen hier nun im Bereich der Grube Johannis Reicher Segen Gottes zu Schwarzbach aus dem 18. Jahrhundert (die wahrscheinlich unter dem Namen Roter Stolln im 19. Jahrhundert noch einmal aufgenommen wurde).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Reliefbild trog uns nicht: Oben auf der Halde ist eine ziemlich große Schachtpinge...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...in deren Sohle man ein ordentlich rechteckig ausgehauenes Schachtauge findet. Über das Vorhandensein von Lichtlöchern oder Tageschächten haben wir in den Akten über den Johannis Reicher Seegen Gottes Stolln eigentlich gar nichts gelesen?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das ist aber nicht der einzige Bau hier: Nur wenig oberhalb dieses Schachtes unter einer kleinen Klippe finden wir noch ein Mundloch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der hier angesetzte Stolln hat allerdings ein äußerst schmales Profil.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die kleine Halde des Lichtlochs noch einmal von der anderen (hangaufwärtigen) Seite.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Gestein auf der Halde und am Talhang ist jedenfalls ungewöhnlich und erscheint eher wie ein Basalttuff. Dabei erinnern wir uns, daß auch der Herr Professor Breithaupt im Schwarzbachtal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann der Blick von oben hinunter ins Rothenbachtal: Das ist nicht der Bach, das ist Wasser aus dem Stolln.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das ziemlich verwachsene Stollnmundloch unterhalb der Halde...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...ist ohne Wathosen leider gerade nicht zu erreichen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So weit so gut, also weiter... Wir verlassen das Waldstück am Rothenbach wieder, nehmen die Bahnbrücke jetzt linkerhand...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...werfen noch einen Blick in die sich hier zu einem flachen Kerbtal aufweitende Aue des Rothenbachs und peilen das nächste Ziel an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruben im
Tännigwald
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schaut man sich die Reliefkarte des Geoportals genau an, so findet man in dem gesamten Wald verteilt mehr oder weniger große Pingen und Halden. Südlich des einstigen Tännigthammers hat der Abbau dann eine solche Dichte angenommen, daß das Relief hier heute eine Art Böschungskante zeigt. Nordwestlich dieser Geländestufe bis hinunter zum ehemaligen Huthaus von Wilkauer Vereinigt Feld ist alles „durchwühlt“. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch hier ist der Waldboden von zahllosen kleinen Pingen und Halden geprägt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und auch hier fällt auf dem gleichförmig dunklen Boden des Nadelwalds der Quarzbrockenfeld sofort ins Auge...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Mangan- Dendriten gleichen den „Pseudo- Fossilien“, die man auch aus anderen Gesteinen kennt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie schon gesagt: Schön für den Wald... Das junge Unterholz verdeckt auch hier an vielen Stellen die Geländekonturen, die man sonst im lichten Hochwald gut erkennt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dennoch schauen größer Haldenbuckel zurzeit noch oben heraus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir sind jetzt gleich oberhalb des alten Tännig- Gutes angekommen, wo Meyers Hoffnung Fundgrube baute.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier werden auch die Halden und Pingen größer - diese Gruben haben über längere Zeit mehr oder weniger kontinuierlich in Betrieb gestanden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier fehlt es an Jungbäumen - gleich sieht man die Halden wieder auf den ersten Blick.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch eine...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wohin man schaut: Es ist tatsächlich alles voll davon.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jetzt haben wir die Geländestufe erreicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unser Standort in der Übersichtskarte. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unsere Zulage des im Bergarchiv vorliegenden Rollrisses (Bestand 40040, Nr. L8310) in die heutige Topographie.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doch schauen wir´s uns weiter vor Ort im Gelände an...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie unser Größenvergleich zeigt, ist die Stufe schon am Anfang mehr als mannshoch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Stufe wird noch deutlich höher und zieht sich über eine ganze Strecke durch den Wald.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unterhalb wirkt der Waldboden wieder wie umgegraben: Kleine und größere Halden nebeneinander, wohin man auch schaut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir stehen hier in dem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eines fällt auf: Der Anteil des „ockerigen und dichten Brauneisensteins“ im Geröll nimmt gegenüber den weiter westlich begangenen Punkten deutlich zu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiter westwärts durch das Haldenareal.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch hier ist eine Pinge neben der anderen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es nimmt kein Ende...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch einmal mit Größenvergleich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder eine größere...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine ziemlich große Halde am oberen Waldrand und...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...darin eine beachtlich große Pinge. Sie dürfte durch den Großzecher Tageschacht verursacht sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann sind wir wieder am unteren Waldrand zum Schwarzbach- Tal, wo uns wieder ein hübscher Ausblick und ein Rastplatz erwartet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
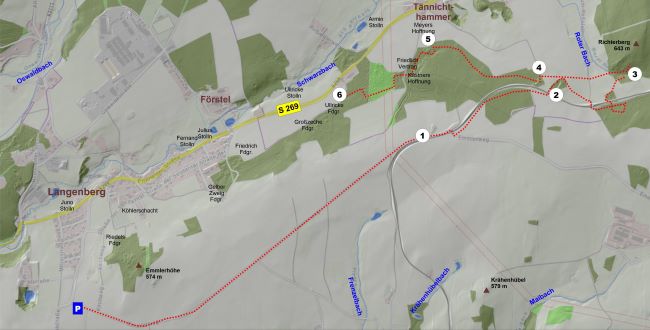 Unser jetziger Standort auf der Übersichtskarte. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unser jetziger Standort auf dem Rollriß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unterhalb befindet sich hier ein einzelnes Gehöft - recht einsam an der Straße von Langenberg nach Schwarzbach gelegen. Heute ist dort eine Bauschlosserei ansässig. Wenn auch baulich verändert, so müßte es sich doch im Kern noch um das Huthaus von Wilkauer vereinnigt Feld handeln...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Huthaus der Grube "Wilkauer vereinigt Feld" im Schwarzbachtal - so, wie es Paul Schulz 1927 noch fotografiert hat. Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das schauen wir uns genauer an: Die Straßenseite.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Front...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...mit dieser Tafel über der Eingangstür. Hatte der Name Groß nicht auch etwas mit der Großzeche zu tun?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir suchen mal nach dem richtigen Standort... Vielleicht war es dieser. Nein, doch nicht ganz - Paul Schulz stand 1927 mit seiner Kamera näher dran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Huthaus der Grube "Wilkauer vereinigt Feld" von der Landstraße aus gesehen auf einem weiteren Foto von P. Schulz, 1927. Im direkten Vergleich sieht man schon, daß das Gebäude seitdem stark umgebaut worden ist. Bildquelle: Deutsche Fotothek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da unten auf der Wiese am flachen Talhang war der
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir steigen wieder hinauf zum schattigen Waldrand und folgen nun dem Forstweg weiter in Richtung Langenberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruben am
Emmler- Rücken bei
Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damit kommen wir nun zum dritten Gebiet am Nordwesthang des Emmlerrückens, in dem intensiv nach Eisenstein und nach Braunstein geschürft worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Quarzanteil im Geröll nimmt weiter ab, Brauneisenstein und auch Braunstein ist ab und zu zu finden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei dem großen Brocken rechts hinten handelt es sich wohl um einen ausgebleichten Glimmerschiefer mit Mangan- Belägen auf den Kluftflächen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eisenstein in verschiedener Ausbildung ist ziemlich häufig zu finden. Dennoch war hier tatsächlich eine räumliche Lücke zwischen den Schwarzbach'er und Langenberg'er Bergwerken - vielleicht waren die Lager hier einfach nicht abbauwürdig, oder lagen zu tief und waren für die einfache Technologie der Altvorderen hier nicht zu erreichen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nur noch ein Stückchen Weges...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir stehen jetzt gegenüber vom Förstel- Gut. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unser jetziger Standort auf der Übersichtskarte. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Und wieder der Vergleich mit dem Rollriß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und hier ist auch das nächste Pingenfeld erreicht und am Waldrand ist derselbe auch noch licht genug, so daß die Geländekonturen sichtbar sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dasselbe Aussehen, wie schon zuvor...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zumeist sind es auch hier aber nur kleine Halden. Ganz unten am Waldrand muß Christbescherung Fundgrube gelegen haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oh - eine ist hier eingezäunt. Sie könnte zu Friedrich Fundgrube gehört haben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir halten uns nun wieder bergauf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch ein paar Impressionen aus dem Pingenfeld.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch ein paar...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und noch ein paar Buckel und Löcher... Sie dürften zu oder Gelber Zweig Fundgrube gehört haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann stehen wir am Waldrand oberhalb von Langenberg und steigen von hier aus querfeldein in Richtung Emmlerhöhe hinauf...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruben an der
Emmlerhöhe zwischen Langenberg und Raschau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der letzte Abschnitt dieser Tour: Auch hier haben Nachnutzung, Bebauung und Feldwirtschaft außerhalb der Waldgebiete alle Spuren des Bergbaus verwischt. Nur auf der Kuppe der Emmlerhöhe besteht noch eine Waldfläche und das schauen wir uns nun auch noch an...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...ist sämtlich Glimmerschiefer.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Anzahl und Größe der Pingen und Halden nimmt weiter nach Westen ab...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...aber ein Ende ist noch nicht zu finden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da kommen auch wieder größere.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese sieht wieder eher wie ein Steinbruch aus...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei diesem regelmäßigen Loch im Grund des Steinbruchs könnte es sich aber auch um einen Schacht gehandelt haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Geröll findet man zwar noch Quarzbrocken mit hämatitschen Kluftbelägen, aber auch hier ist sonst alles schon wieder Glimmerschiefer.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Blick hangaufwärts sagt uns, daß wir nun gleich den Gipfel erreicht haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da steht die Felsklippe, die den Hochpunkt des Gebirgsrückens markiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann sind wir auch schon herum und schauen auf der anderen Seite des Waldes hinaus auf die einsame kleine Halde des Schurfs 17 der SDAG Wismut...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und im Süden hinter der Halde liegt das Mittweida- Tal, rechts im Tal der Ort Raschau und links am Gegenhang der Münzerberg oder auch Pökelwald, so genannt nach dem Pökel- Gut, das einst zwischen Raschau und Markersbach gelegen hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Westen liegt der Sattel zwischen der Emmlerhöhe und dem Knochen vor uns. Dort verläuft auch der Kirchsteig, an dem 2005 und 2007 Tagesbrüche auf alten Eisensteinbergbau gefallen waren. Hier baute einst die Junge Gesellschaft Fundgrube und an der anderen Seite des Emmlerweges lagt das dritte Lichtloch des Kirchenstollns. Etwa in der Bildmitte sind die Reste des Kalkwerkes zu sehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
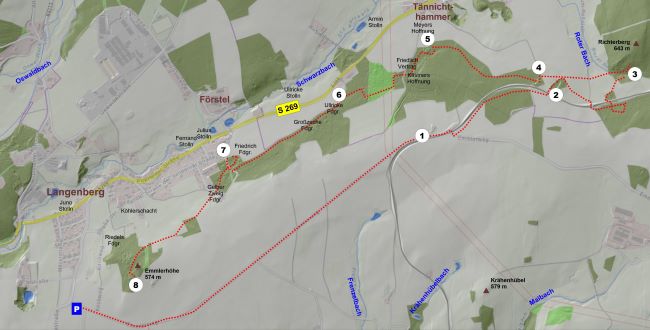 Unser jetziger Standort auf der Übersichtskarte: Jetzt müssen wir nur noch den Hang wieder hinunter und zurück zum Parkplatz. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de Diese Wanderung noch einmal nachvollziehen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im Vergleich mit dem Rollriß erkennt man, daß hier oben unterhalb der Klippe eigentlich gar kein Eisen- und Manganerzbergbau mehr umgegangen ist - die Gruben lagen weiter unterhalb am Hang in Richtung Langenberg...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruben am
Roten Hahn bei Langenberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine haben wir noch: Die Nordseite des Tals bei Langenberg am „Roten Hahn“, dem flachen Sattel zwischen dem Schwarzbach im Süden und dem Oswaldtal im Nordwesten östlich unterhalb des Grauls. Wir parken bei dieser Tour im Vorfrühling 2024 ganz unten gegenüber der heutigen Ausflugsgaststätte, die noch den Namen der früheren Erzgrube St. Katharina trägt... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
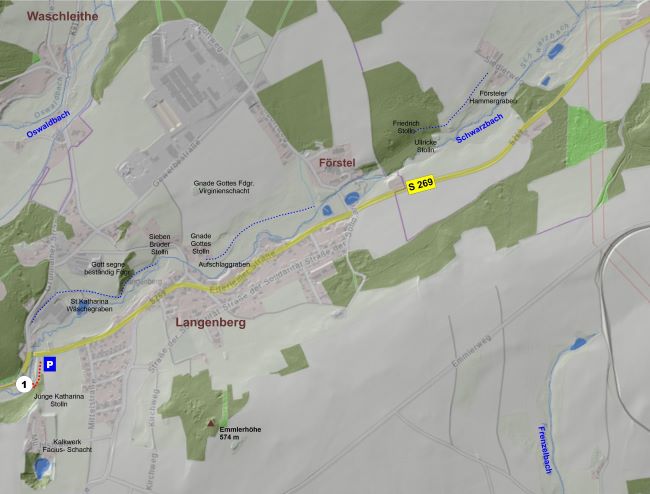 In bewährter Weise nutzen wir wieder die Kartengrundlagen vom: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
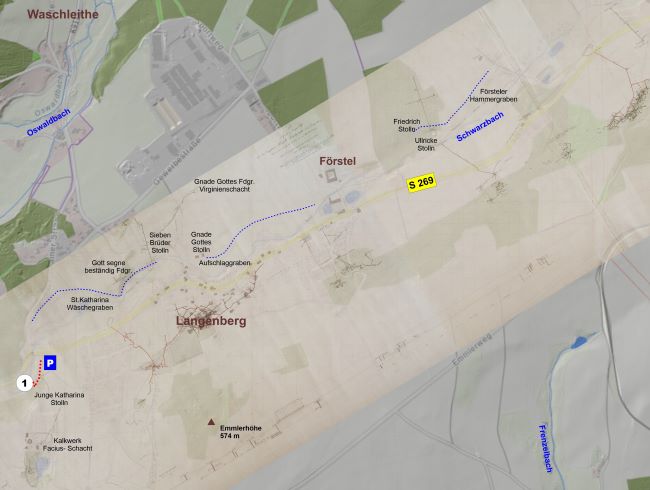 Auch hier legen wir den Rollriß von 1875 darüber und suchen nach den darin verzeichneten Grubenbauen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die „Katharina“ gegenüber vom Parkplatz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberhalb des Parkplatzes sieht man schon die Halde des Kalkwerks.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir biegen erstmal westwärts in das untere Schwarzbachtal ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Talhang haben wir diesen Geländeeinschnitt entdeckt: Vielleicht war hier das Mundloch des Junge Katharina Stollns ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Einschnitt von unten. Hier könnte es gelegen haben – zu sehen ist aber nichts mehr…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Also wenden wir uns nach Norden und klettern hinauf hinauf zum Roten Hahn, wo man unterhalb der Straße nach Waschleithe noch den Verlauf des Katharina'er Wäschegrabens erahnen kann. Wo heute rechts im Bild die Garage steht, könnte die Radstube gestanden haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir marschieren oberhalb des Industriegebietes rechts herum und ein Stück weit wieder bergab: Hier sieht man noch sehr gut den Verlauf des einstigen Kathaina’er Wäschegrabens.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schau an - auch hier... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unser Standort auf der topographischen Karte. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Nach dem Rollriß war hier gar kein Bergbau ? Zumindest kein Bergbau auf Eisen- und Manganerz, denn nur der ist auf diesem Riß dargestellt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir folgen nun dem Verlauf des Aufschlaggrabens der Katharina’er Erzwäsche...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir folgen weiter dem Grabenverlauf...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Vorfrühling geht das am besten...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…und finden oberhalb des Grabens am Hang diese Felsklippe aus Quarzbrockenfels. Unterhalb der Klippe hat die Gott segne beständig Fundgrube und Stolln am Roten Hahn gelegen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Lesesteine am Hang bestehen natürlich sämtlich aus dem uns nun schon gut bekannten Gestein...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...dem Quarzbrockenfels.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber erstmal weiter den Graben entlang...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberhalb am Hang ist der Wilhelmschacht in den Rissen verzeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erstmal gelangen wir zum Wasserteiler, wo der Wäschegraben aus dem Schwarzbach abgezweigt wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein niedriges Wehr ist noch da…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Ufermauerung ist mindestens schon ,Anno 1792' gebaut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blick in Fließrichtung: Der Anfang des Wäschegrabens ist hier zugeschüttet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
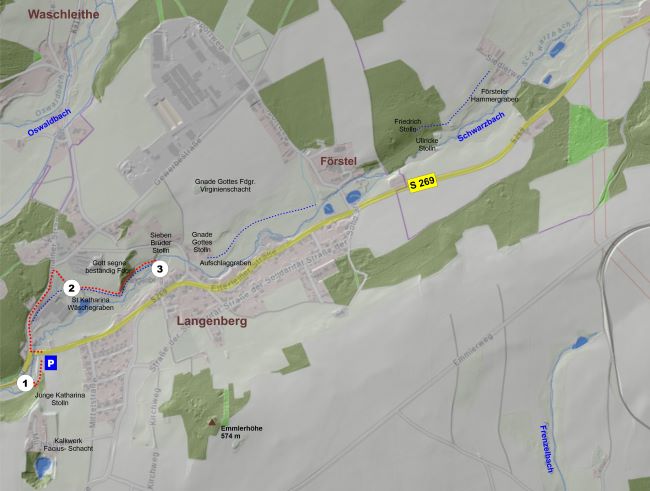 Unser momentaner Fotostandort. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
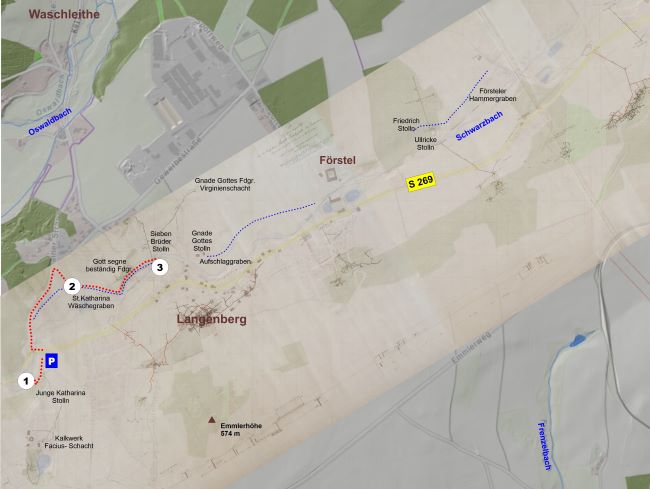 ...und der eingepaßte Rollriß dazu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unter der Felsklippe...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...findet man noch das Mundloch des Sieben Brüder Stollns.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir wandern talaufwärts weiter. Die alte Ufereinfassung am Schwarzbach ist unterspült und eingestürzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann folgen wir der alten Grünhainer Straße wieder bergauf – wie wir wissen, bildete sie ab 1783 auch die Grenze zwischen dem Scheeberg'schen und dem Scheibenberg'er (bzw. Annaberg'er) Bergrevier.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Links der Straße erreichen wir nun die Oberkante der Felsklippe.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Blick zurück in Richtung unseres Ausgangspunktes an der Katharina.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Pinge markiert wahrscheinlich die Lage des Wilhelmschachtes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch hier findet man jede Menge Brockenfels...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...auch mit Braunstein- Krusten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Blick über Langenberg und das Schwarzbachtal nach Süden zum Emmler- Rücken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zurück zum Weg und noch ein Stück weiter findet man diesen kleinen Steinbruch. Er ist auf den ersten Ausgaben der sächsischen Äquidistantenkarten bereits verzeichnet und könnte einer der Tagebaue gewesen sein, wo seinerzeit G. Zschierlich den Manganmulm noch als Farbpigment abgebaut hat. Da er heute ganz anders genutzt wird, gibt es für uns hier aber nichts mehr zu finden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unser jetziger Fotostandort. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unterhalb des Steinbruchs auf der Wiese...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da ist noch einer...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und unterhalb war doch das Mundloch des Sieben Brüder Stollns ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder hinunter - wir machen heute Höhenmeter... Gegenüber die immer noch bewaldete Emmlerhöhe.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man folgt nun ein Stück der Gewerbestraße und dann den anderen Feldweg wieder hinunter: Da drüben unter den Birken liegt die Halde des 1. Lichtlochs auf dem 1874 aufgefahrenen Flügelort vom Sieben Brüder Stolln nach Osten...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und östlich des Feldweges die Halde des Virginienschachtes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Halde aus der Nähe. Hier hat auch der Kunst- und Tageschacht der Grube Gnade Gottes gelegen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir haben die Halde des Virginienschachtes erreicht - zumindest ist er 1875 auf dem Rollriß so benannt. Wir wissen aber schon, daß hier auch die Gnade Gottes Fundgrube gelegen hat. Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
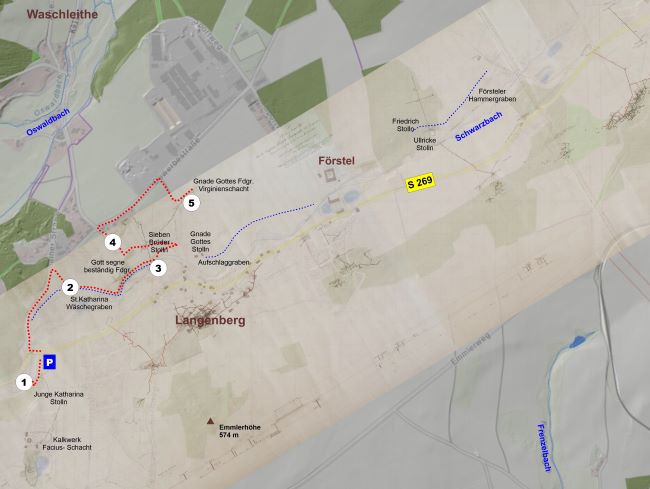 Der Standort auf dem eingepaßten Rollriß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unter den Lesesteinen findet man hier auch dichten Brauneisenstein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf der Haldenoberfläche ist nichts mehr von einstigen Tagesanlagen zu sehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber irgendwo dort unten muß der Gnade Gottes Stolln angesetzt haben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Nachsuchen finden wir diese Geländestufe am unteren Talhang.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vielleicht geht die Scheune mit dem ungewöhnlichen, fast quadratischen Grundriß ja auf die frühere Radstube vor dem Mundloch des Stollns zurück ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann könnte entlang dieser Geländestufe vielleicht der Aufschlaggraben verlaufen sein...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
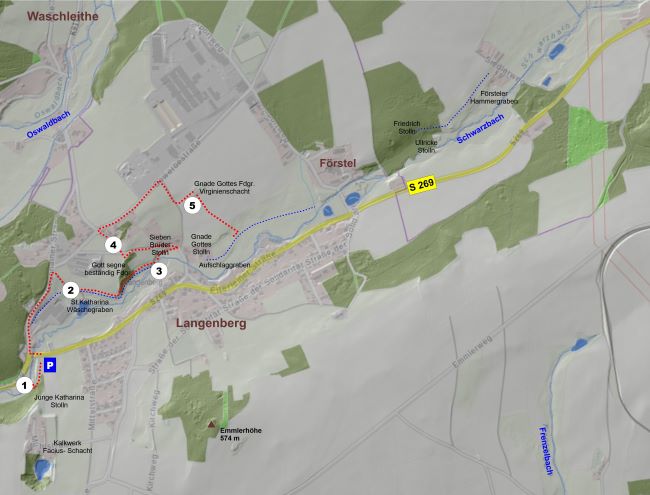 Auf dem Rollriß ist der Gnade Gottes Stolln gar nicht mehr enthalten, aber irgendwo hier unten im Tal muß er angesetzt haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch beim Blick nach Osten ist die Geländestufe schon markant.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir folgen ihr nach Nordosten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Geländestufe oberhalb des Grabenverlaufs markiert dagegen wahrscheinlich den verfüllten Rest des Förstel'er Kalkbruchs.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein Fundstück auf der Feldfläche nördlich des Förstelgutes: Schlacke unklaren Ursprungs mit zahlreichen Blasenhohlräumen. Für eine Eisenhüttenschlacke ist sie eigentlich zu hellfarbig.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Waldrand hinter dem Förstelgut fallen kleine Halden ins Auge, die nicht nur aus Lesesteinen vom Feld bestehen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innerhalb des anschließenden Waldstücks dann eine Pingenfläche.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wo das Unterholz noch nicht hochkommt, sieht man zahllose kleine Löcher.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Natürlich auch hier: Quarzbrocken und eisenschüssiger Hornstein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch ein paar kleine Pingen und Haldenreste am östlichen Waldrand.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann sind wir wieder unten im Tal und finden die Stollnhalde des Friedrich Stollns. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
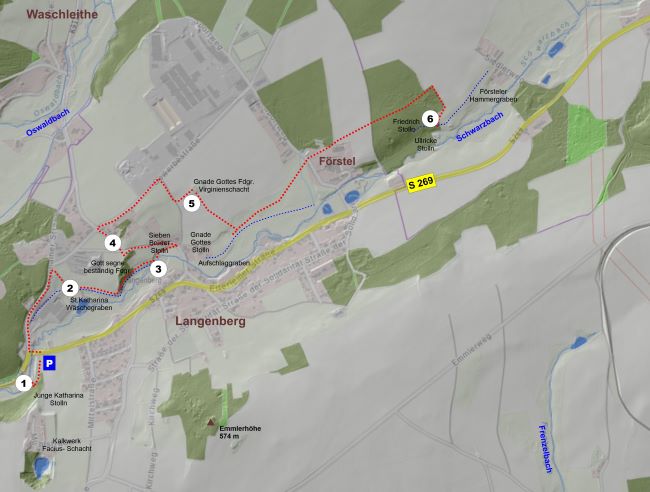 Unser jetziger Standort in der topographischen Karte.... Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
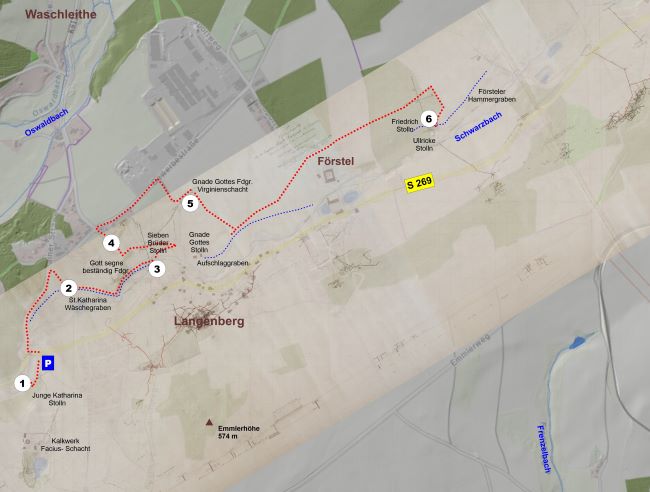 ...und im Rollriß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Lage des einstigen Stollnmundlochs finden wir im Gelände aber keine sicheren Indizien mehr...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...nur ein paar Rinnsale im sumpfigen Talgrund.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder etwas weiter oben entdeckt man noch den Verlauf des einstigen Hammergrabens des Förstelgutes - aus der Zeit, als es noch ein Hammer gewesen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier ist der Verlauf des Grabens im Relief des Abhangs noch gut zu erkennen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Kühe nutzen den verfüllten und ebenen Grabenverlauf als Wanderweg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiter östlich wird er aber durch die Bebauung am Fahrweg zum Hasengut abgeschnitten und ist dahinter nicht mehr aufzufinden...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Fahrweg nutzen wir auch, um wieder ans andere Ufer des Schwarzbaches zu gelangen: Diese Geländeeinschnitte im Wald – gegenüber des ehemaligen Huthauses von Wilkauer vereinigt Feld, unterhalb der Staatsstraße nach Elterlein – erscheinen uns zu groß für den hier üblichen Bergbau – vielleicht war hier aber ein Steinbruch oder Schichtmeister Heß ließ hier 1858 tatsächlich einen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch mal von oben betrachtet...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann geht´s ein Stück die Straße entlang zurück in Richtung Langenberg bis zu dem Tagebruch auf dem Ullricke Stolln auf der Wiese unterhalb der Straße.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der ist schon wieder zugewachsen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber die Stollnhalde ist noch zu finden und entspricht mit ihrer zungenförmigen Schüttung noch der Darstellung im alten Rollriß von 1875. Irgendwo rechts am Bildrand muß das Mundloch des Ullricke Stollns gelegen haben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
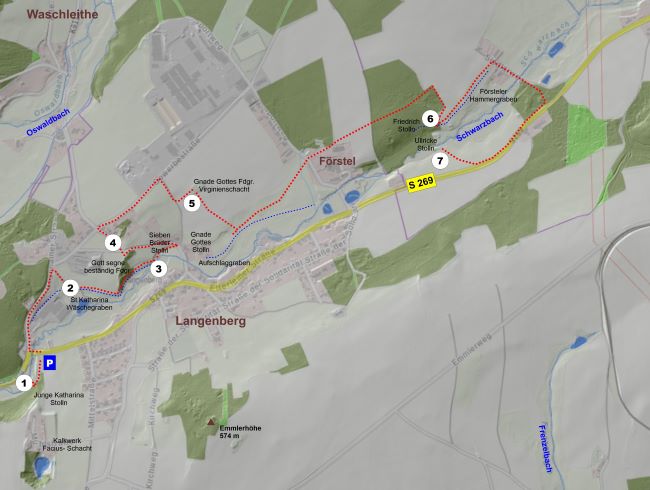 Der letzte Punkt vor dem Rückweg.... Kartengrundlage: geoportal.sachsen.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
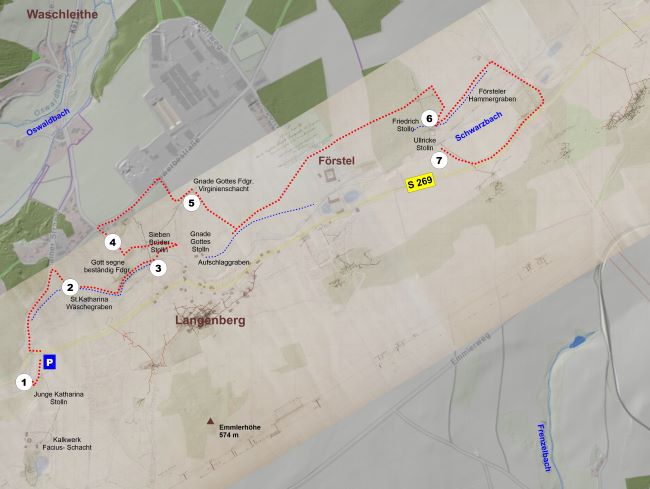 Und ein letztes Mal der Standort auf dem Rollriß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blick von der Halde über den Bach zur Halde des Friedrich Stollns.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Blick in Richtung des Tagesbruchs zeigt etwa den Verlauf des Stollns und die Lage der Ullricke Fundgrube oben am Waldrand.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die „Zungenspitze“ der Halde...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und nochmal mit etwas Abstand.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann geht es am Förstelgut vorbei wieder in Richtung Parkplatz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vom Dorf aus verdecken die noch unbelaubten Gehölze leider einen Rückblick hinüber zur Halde des Virginienschachtes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Schluß...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Beitrag wird vielleicht der umfangreichste bleiben, den ich je geschrieben habe. Und dennoch bin ich mir der Lücken bewußt. Nur zum Beispiel habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, wer eigentlich den Fernand Stolln (oder Ferdinand Stolln) angehauen hat. Auf einem der überlieferten Risse zur Friedrich Fundgrube (40036, Nr. C11851) aus dem Jahr 1883 ist er schon verzeichnet, aber nur bis zu einem ersten Lichtloch getrieben. Auf einem anderen der alten Risse (40040, Nr. L8310) ist vermerkt, daß ihn von einem schon weit ferneren Punkt seiner Erlängung weg Herr Zschierlich weiter getrieben habe... Wir haben glücklicherweise unheimlich viel Material zu diesem Thema ausgraben können und einiges auch im Gelände noch wiedergefunden. Auf die Geschichte von mehr als 65 einzelnen Gruben sind wir gestoßen und haben das in den Akten dazu zu findende hier zusammengetragen. Was hat es uns gebracht ? Versuchen wir, das Wichtigste davon in wenige Sätze zu fassen: Betrachtet man zunächst die Besitzverhältnisse, so unterschieden sich Gruben wie Vater Abraham bei Oberscheibe im Osten und Gnade Gottes am Roten Hahn ganz im Westen des in diesem Beitrag betrachteten Gebietes von den zahlreichen Eigenlehnergruben zwischen Langenberg und Schwarzbach von letzteren dadurch, daß die erstgenannte von Anfang an, die zweite ab 1808 im direkten Besitz von Hammerherren gewesen sind. Dieser finanzielle Hintergrund erlaubte es diesen beiden Gruben schon früh, ihren Betrieb durch die Heranbringung von Stolln und die Errichtung von Wasserkünsten auf den technischen Stand der Zeit zu heben. Auch durch die deutlich größere Belegung von 8 bis 16 Mann wurde ein kontinuierlicher Betrieb und ein stetiges Ausbringen ermöglicht. Bereits in den 1830er Jahren hatte Vater Abraham eine Teufe von 56 m (8 Lachter unter der Stollnsohle) und Gnade Gottes von 54 m (6 Lachter unter der Stollnsohle) erreicht. Dies gab es bei den Eigenlehnern, die teils nur allein in Weilarbeit, sonst aber mit höchstens 3 bis 4 Mann Belegschaft auf ihren Gruben arbeiteten, lange Zeit noch nicht. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eigenlehner erlaubten es ihnen nicht, aufwendige Ausrichtungsbaue aufzufahren und teure Technik anzuschaffen. Das Braunstein- Trockenpochwerk bei Gelber Zweig Fundgrube kann hier nur die Ausnahme darstellen, welche die Regel bestätigt. Dementsprechend erfolgte auch der Abbau auf den Langenberg’er und Schwarzbach’er Gruben noch bis in die 1840er Jahre hinein nur in Teufen von wenigen Lachtern (bis 16 m unter Oberfläche). Frühe Versuche, Stolln anzulegen, scheiterten in dem wenig standfesten Gebirge namentlich am Aufwand für Ausbauholz. Selbst bei Wilkauer vereinigt Feld nahm die Unterhaltung des Armin Stollns nach 1844 die noch anfahrende Mannschaft die meiste Zeit in Anspruch. Eine Ausnahme bildete in dieser Hinsicht Meyers Hoffnung Fundgrube bei Schwarzbach. Diese Grube wurde seit dem Ende des 18. Jahrhunderts stets durch die Besitzer des Hammergutes Tännicht betrieben – allerdings war dieses längst kein Eisenhammer mehr, sondern ein Landgut geworden, dessen Besitzer die Erzgewinnung gewissermaßen im Nebenerwerb betrieben. Wie beim Förstelgut (durch die Klinger’s einst ebenfalls als Eisenhammer gegründet) brach man auch hier vor allem Kalkstein und brannte den auf dem Landgut benötigten Kalk selbst. Der Versuch der Besitzer des Förstelgutes, am Eisenstein- und Braunsteinbergbau auf ihren Fluren teilzuhaben, scheiterte dagegen. Auch bei Meyers Hoffnung wurde der Erzabbau schließlich in den 1860er Jahren eingestellt, der Abbau des Kalksteins dagegen mit einigen Unterbrechungen noch bis in die 1920er Jahre fortgeführt. Überhaupt zog mit der Gründung von Wilkauer gemeinschaftliches Feld durch die Sächsische Eisen- Compagnie 1839 erstmals eine systematische Untersuchung und Aufschließung durch ein kapitalstarkes Unternehmen in das Langenberg’er und Schwarzbach’er Revier ein, auch wenn die Aktivitäten der von Arnim‘schen Berg- und Hüttenverwaltung aufgrund der hier gegebenen Lagerstättensituation und der Entwicklung des Erzbedarfs der Königin Marienhütte schon nach nur fünf Jahren wieder drastisch abflauten. In den Folgejahren, beginnend mit der Konsolidation von Friedlich Vertrag und Kästners neue Hoffnung 1841 unter Steiger Vulturius, wurden aber nun auch hier die einzelnen Eigenlehnergruben sukzessive zu größeren Einheiten zusammengelegt, die sowohl hinsichtlich des ihnen zur Verfügung stehenden Grubenfeldes, als auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Kraft weitaus bessergestellt waren. In der Zeit zwischen 1850 und dem Ende der Gründerzeit 1873 wurden mehrere Stollnprojekte begonnen und umgesetzt, wie Ulricke Stolln, Friedrich Stolln, Juno Stolln, Fernand Stolln und Jung Katharina Stolln. Auch Gewinnung und Aufbereitung änderten sich: Wurde bis dahin brauchbares Erz bereits untertage ausgeklaubt und übertage nur ausgeschlagen und sortiert (gewöhnlich vollständig von Hand), so kam nun auch flächenhafter Pfeilerbruchbau, verbunden mit der Gewinnung der gesamten Gesteinsschicht des erzführenden „Mulms“ und dessen Aufbereitung übertage durch Sieben und Waschen zur Anwendung. Allerdings war bei der geologischen Situation dieser Lagerstätte ein wirklich profitabler Abbau der irregulär verteilten und stets nur begrenzten Linsen und Nester kaum möglich. Die leicht zu erreichenden Ausbisse des Quarzbrockenfelses hatten schon die Vorfahren – sicherlich schon mit der Gründung der Eisenhämmer Tännicht und Förstel beginnend, worauf die frühen Bergordnungen aus dem 16. Jahrhundert verweisen – abgebaut und ihren Nachfolgern nur noch Restpfeiler stehengelassen. Es ist schon erstaunlich, in welcher Flächenausdehnung sie die Lagerausbisse untersucht haben und wie oft die Nachfahren immer wieder in alten Mann einschlugen. Wie wir auch gelernt haben, taten sie das teils ganz bewußt, um aus den Versatzkästen den früher nicht wertgeschätzten Braunstein wieder auszuklauben. In der Betriebsphase im 19. Jahrhundert waren es Unternehmer, wie die Kaufleute Merkel aus Raschau und Fabrikant Zweigler aus Wildenau, welche die Gruben aufkauften und bis ans Ende der Gründerzeit weiter betrieben. Doch bildete der technische und unternehmerische Aufschwung im Revier zugleich den Anfang seines Unterganges. Die großräumigen Zusammenlegungen durch auswärtige und teils sogar bergbaufremde Unternehmer, wie den Zement- und Tonwarenfabrikanten Fikentscher aus Zwickau, den Vitriol- und Farbenhersteller Zschierlich aus Geyer und schließlich H. Gruson aus Magdeburg konnten keinen wirtschaftlichen Erfolg mehr haben, was letztlich auch die in den 1930er Jahren noch nachfolgenden Untersuchungen durch die Lagerstättenforschungsstelle des sächsischen Oberbergamtes bestätigten. Davon unbenommen hat der Abbau der hiesigen Erzlager den Bewohnern der Landschaft über mehrere Jahrhunderte Arbeit und Brot gewährt. Das geförderte Eisenerz bildete (neben Brennholz und Wasserkraft) eine unverzichtbare Grundlage für den Betrieb der Eisenhämmer und für die Entstehung einer Kleinindustrie in dieser Region, in der für die landwirtschaftliche Nutzung schwierige Bedingungen bestanden. Der hier außerdem ausgebrachte Braunstein bildete schon im 17. Jahrhundert ein besonders gefragtes Handelsgut und ermöglichte den Betrieb einiger Gruben noch bis hinein in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts. Während aber zum Abbau des Eisensteins bereits ab dem 16. Jahrhundert ‒ wenn auch sehr lückenhaft ‒ Unterlagen erhalten geblieben sind, so taucht der Braunstein erst ein Jahrhundert später überhaupt in den Akten und Unterlagen auf. Trotz der im 17. und 18. Jahrhundert erteilten Handelsmonopole für dieses Material ließen sich diese offenbar nie wirklich durchsetzen. Nicht zuletzt ist durch die bergmännischen Aufschlüsse hier auch, wie wohl nirgendwo sonst im Erzgebirge, der stratigraphische Leithorizont des „Emmler- Quarzits“ innerhalb der Raschau'er Folge umfänglich untersucht und durch die alten Geologen immer wieder mit Erstaunen beschrieben worden. Bis heute ist es nicht so richtig klar, wie diese im Glimmerschiefer eingebettete Brekzie des „Quarz- Brockenfelses“ eigentlich entstanden ist. Die alten Geologen ordneten den Quarzbrockenfels den Ganggesteinen zu oder umgingen die Frage nach seiner Genese meist ganz. Möglicherweise stellt dieser Horizont auch eine Überschiebungsfläche des varistischen Faltengebirges dar. Die Anreicherung der Eisen- und Manganminerale darin ist dagegen leicht durch intensive Verwitterung, Auslaugung und Umlagerung der leicht löslichen Metallionen unter den humid- tropischen Klimabedingungen nach der Heraushebung und Freilegung der Gesteinsschicht in Folge der alpidischen Gebirgsbildung im Tertiär zu erklären.
So manche Episode aus der Geschichte bringt uns
heute zum Schmunzeln, wie etwa die Ohrfeige und das
Uns bleibt beim Blick auf die heute nur noch unscheinbaren Hinterlassenschaften dieses Bergbaus zum Schluß dieses Beitrages nur die Verwunderung über das Gottvertrauen und der Respekt vor der Arbeitsleistung unserer Vorfahren. Glück Auf! J. B.
PS.: Was wir hier noch anfügen, haben wir noch in keinem
anderen Beitrag getan ‒ aber es ist uns ein Bedürfnis, die vielen im Text
gefallenen Namen von Bergarbeiterfamilien, Steigern und Schichtmeistern an
dieser Stelle auch noch einmal in einem alphabetischen ,Namensregister'
anzufügen. Die Bergbeamten haben wir schließlich
Vielleicht wird der eine oder andere Leser aus Raschau oder Langenberg erstaunt sein, wie lange manche Familie schon hier ansässig und in den Akten des sächsischen Staatsarchives wiederzufinden ist und wie viele Bergmannsfamilien darunter gewesen sind. Vielleicht können auch örtliche Heimatfreunde einmal in den Kirchenbüchern nachschauen, ob und wie die Männer gleichen Namens untereinander vielleicht verwandt gewesen sind oder auch nicht und ob es sich um zufällige Namensgleichheit handelte... Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit ‒ wir würden uns deshalb über jede Ergänzung in unserer Liste freuen !
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
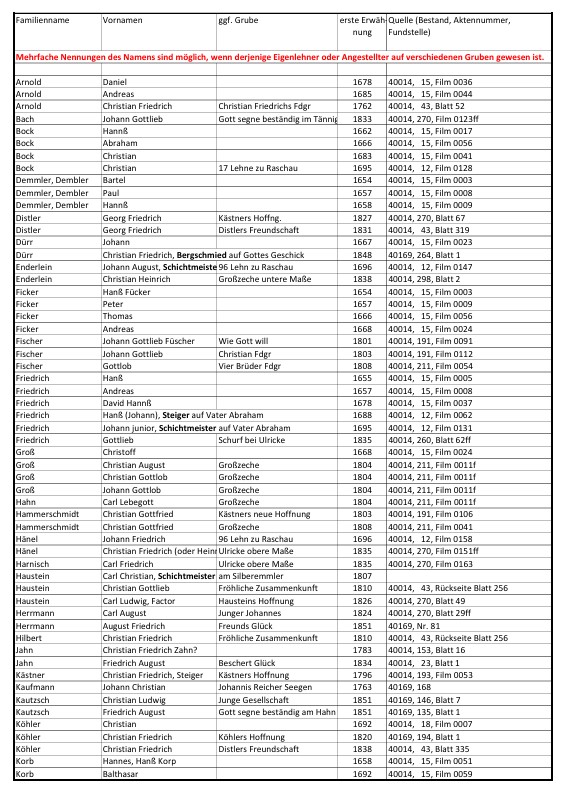 Die Grafik ist zu klein, aber durch einen Klick darauf kommen Sie zur vollständigen Liste in einem neuen Fenster und können sich die PDF gern auch herunterladen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Quellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die verwendeten Digitalisate des
Sächsischen Staatsarchives stehen unter einer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Quellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Staatsarchiv Leipzig
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Staatsarchiv Chemnitz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bergarchiv Freiberg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||