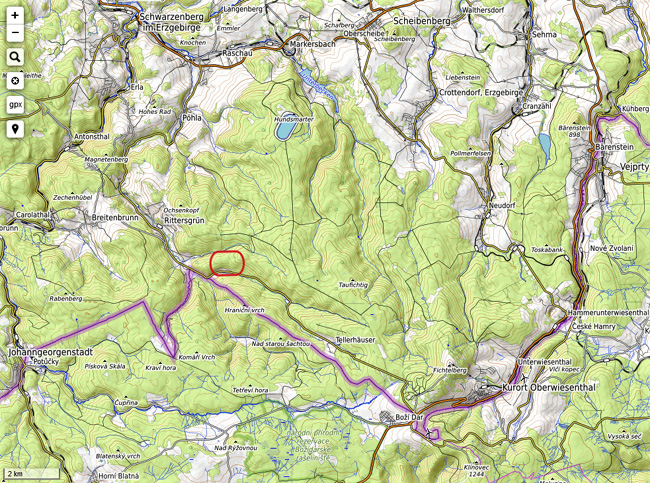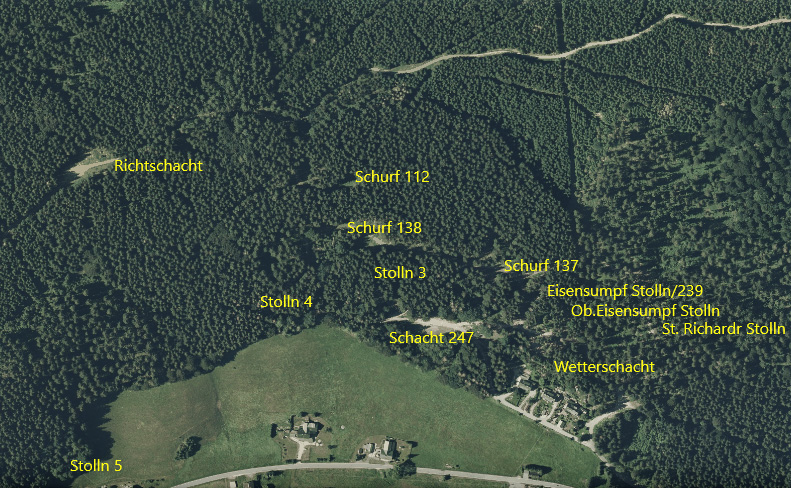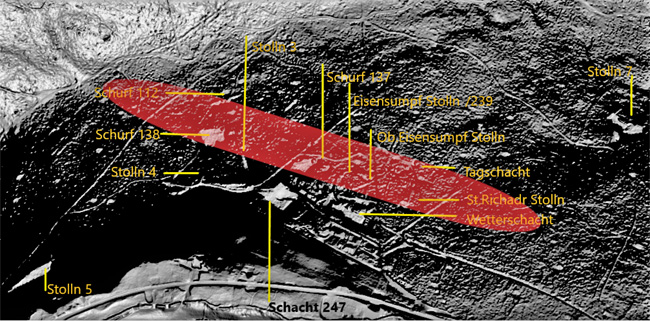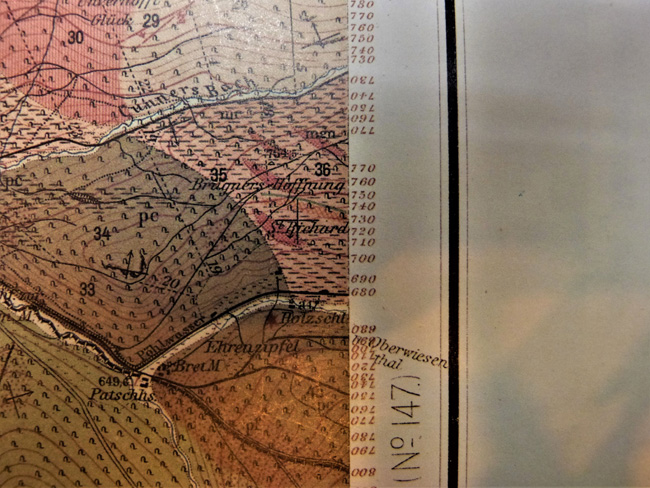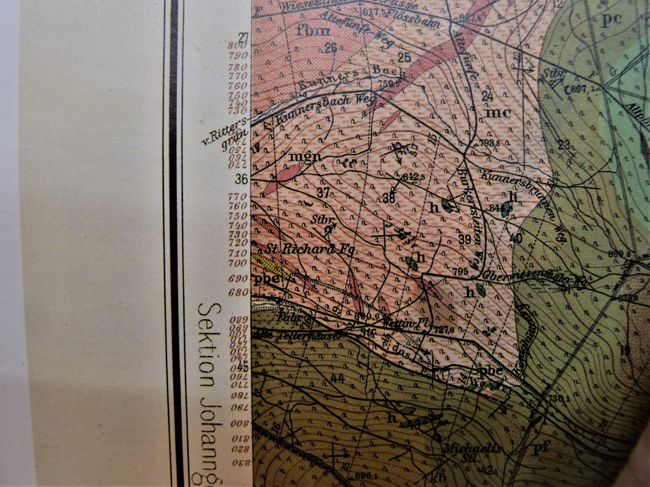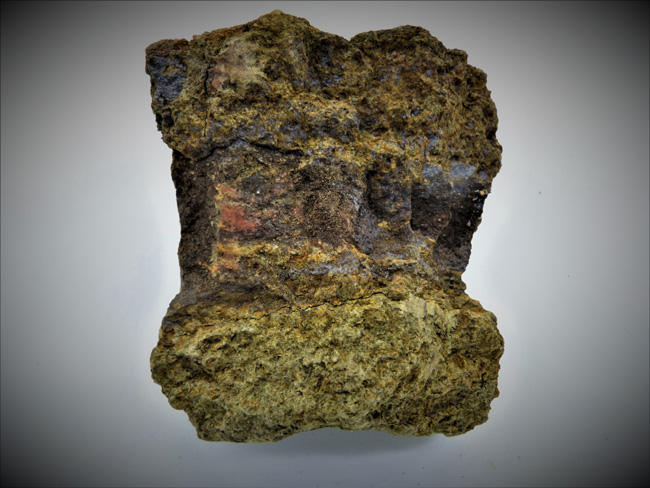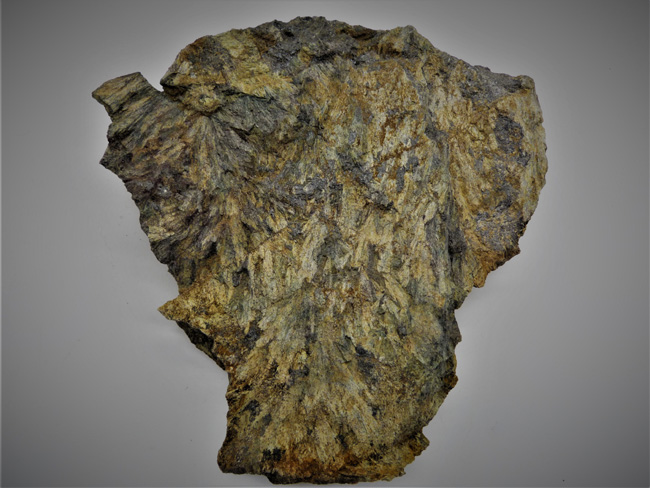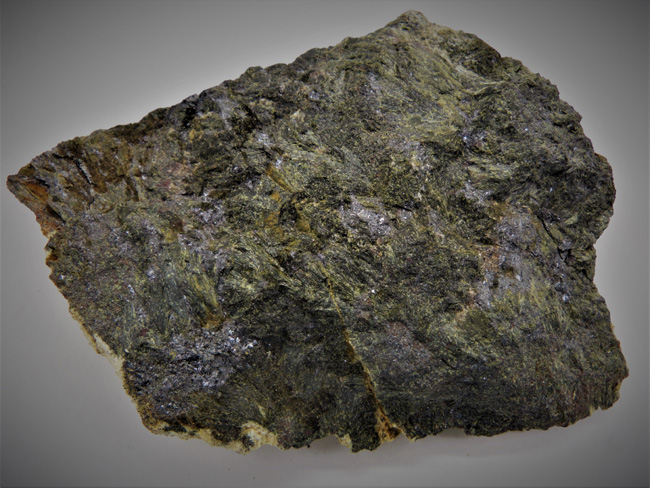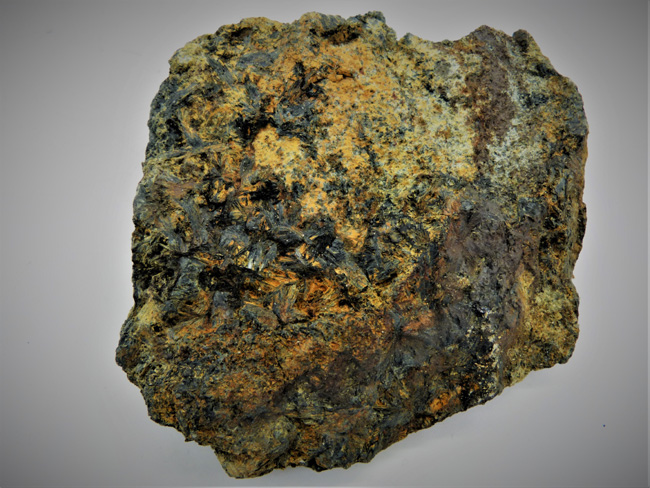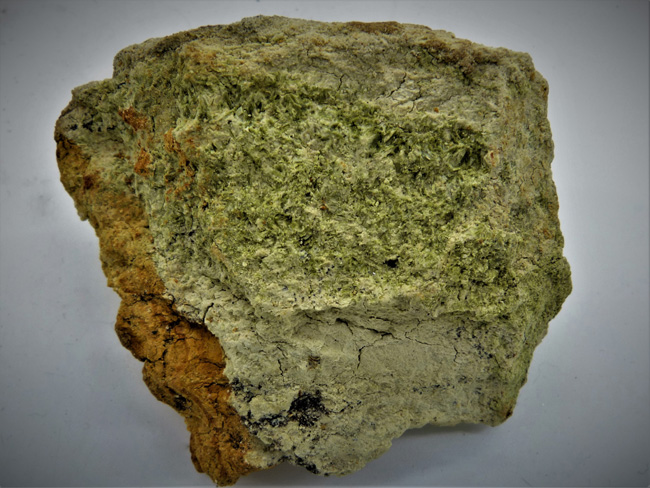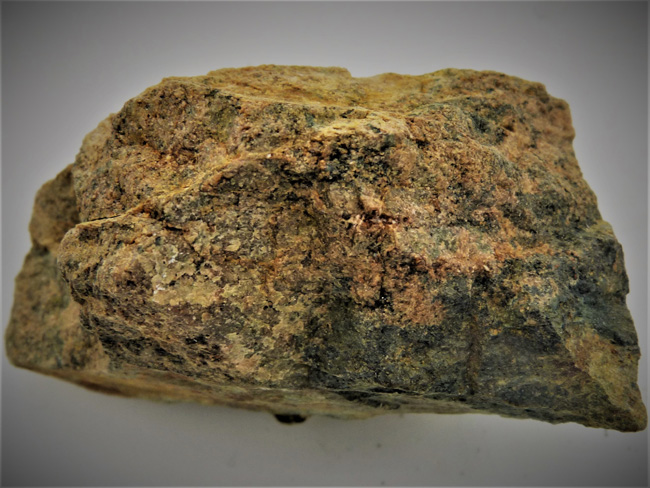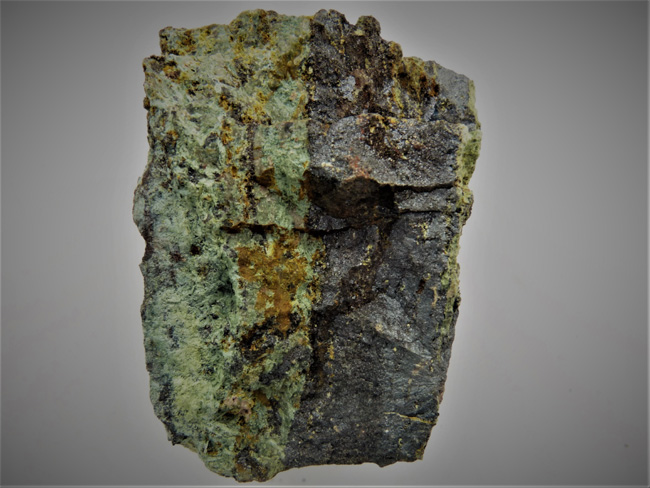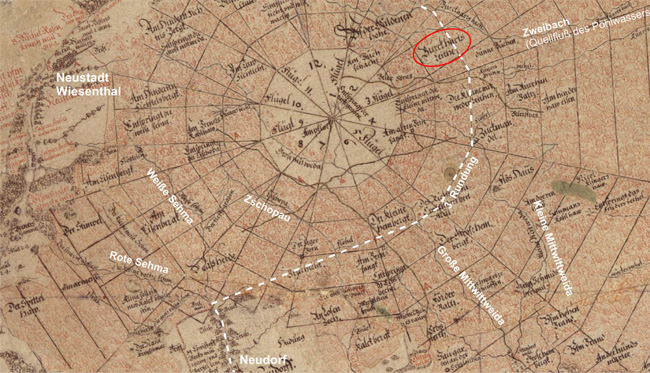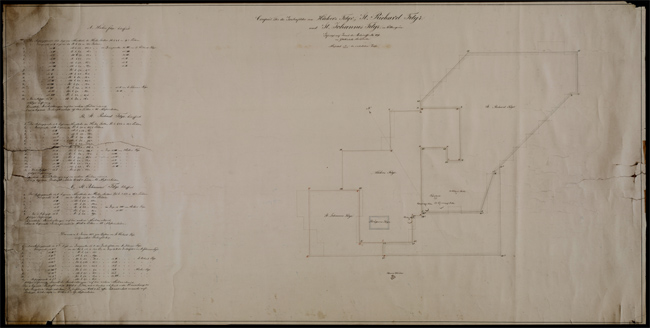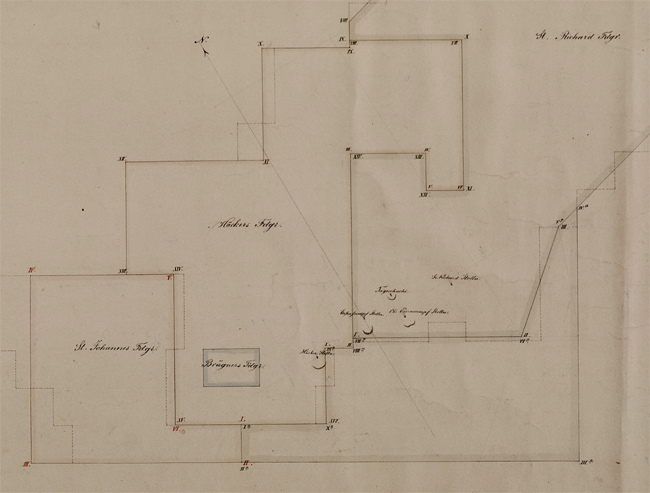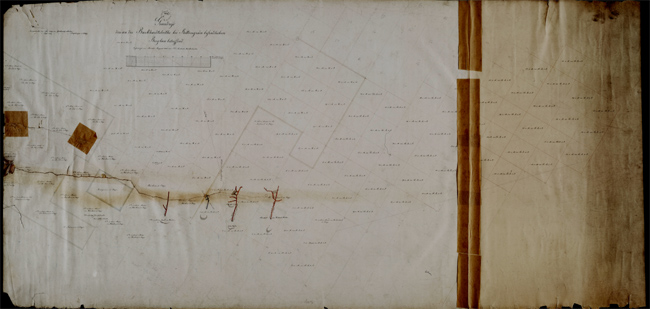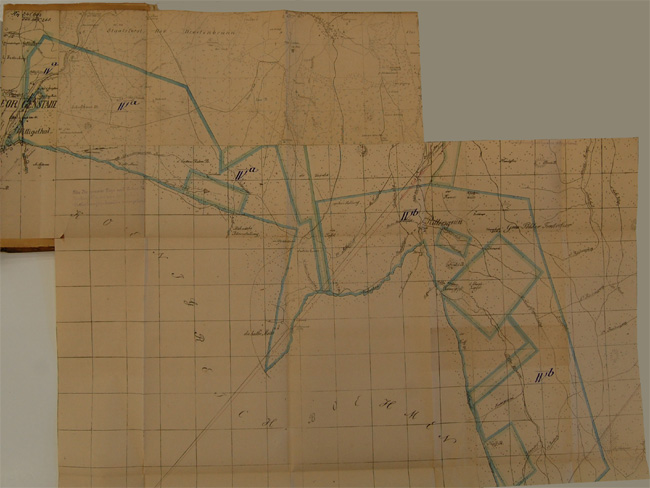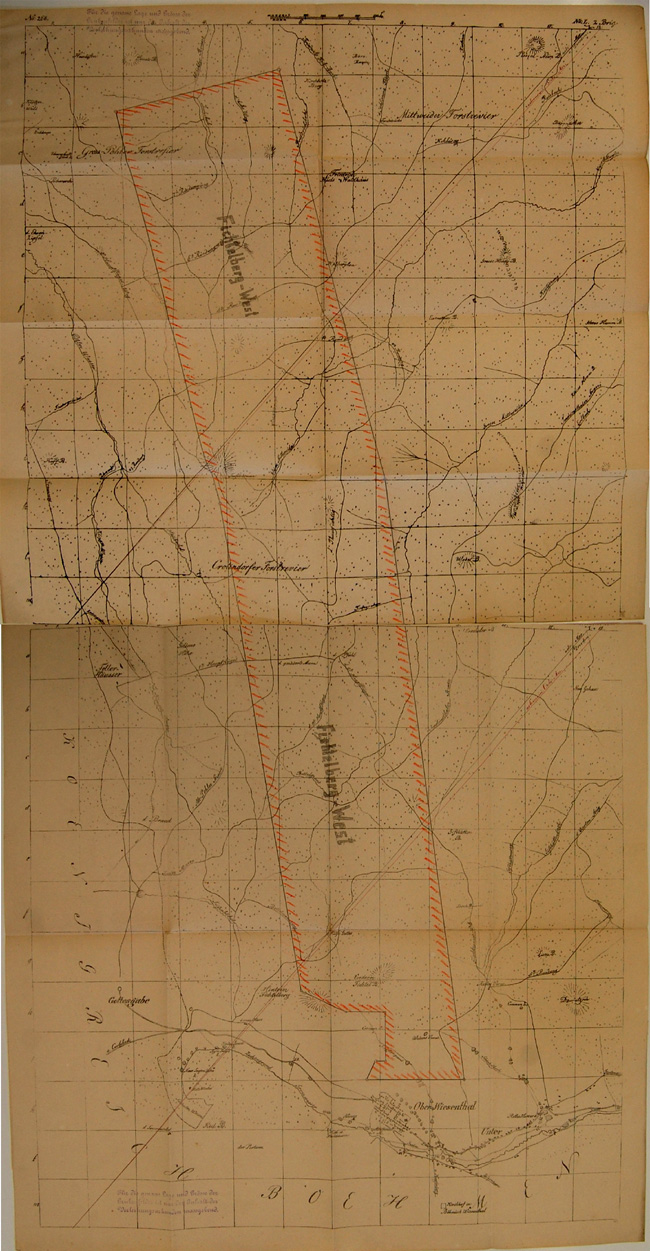|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein vergessenes Revier in einem Hochtal hinter
dem Fichtelberg: Zum Bergbau bei Ehrenzipfel Dieser Beitrag basiert auf einem Manuskript von Herrn J. Stark, Bernsbach, aus dem Jahr 2021. Es wurde von uns in enger Zusammenarbeit mit dem Autoren hinsichtlich der Quellen aus dem Bergarchiv ‒ weil wir da schlicht räumlich näher dran sind ‒ noch ergänzt, ansonsten aber nur geringfügig redaktionell bearbeitet. Soweit nichts anderes angegeben ist, wurden alle Fotos im Zeitraum 2014 bis 2019 vom Autoren aufgenommen. Wir bedanken uns auch beim Ingenieurbüro TABERG- Ost GmbH, Chemnitz, daß wir Bildmaterial aus der Bauphase verwenden durften.
Die letzten Ergänzungen erfolgten im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einführung
und Anlaß
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ehrenzipfel - eine Ortsbezeichnung, die auf irgendeine Weise im Gedächtnis
verankert bleibt, ähnlich anderen, etwas seltsamen Ortsbezeichungen wie
Oberpfannenstiel oder Gotthelffriedrichsgrund. Man fragt sich unwillkürlich,
woher dieser Name stammt und was er wohl bedeuten mag. Ehtymologisch wird
Ehrenzipfel auf das dem westerzgebirgischen / obererzgebirgichem Dialekt
entstammende „er(r)n Zibbel“ zurückgeführt, also „einen Zipfel“,
in diesem Zusammenhang einen abseits liegenden Ort.
In einer Verleihurkunde von 1668 wird den Besitzern dreier alten Zechenhäuser je ein Acker bewilligt, sie werden somit rechtlich Eigentümer von Grund und Boden. Das in dieser Urkunde drei „alte Zechenhäuser“ erwähnt werden, beweist, daß schon vordem Bergbau in dieser Ortslage betrieben worden ist. Womit wir schon bei unserem Thema, dem Bergbau, angekommen sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
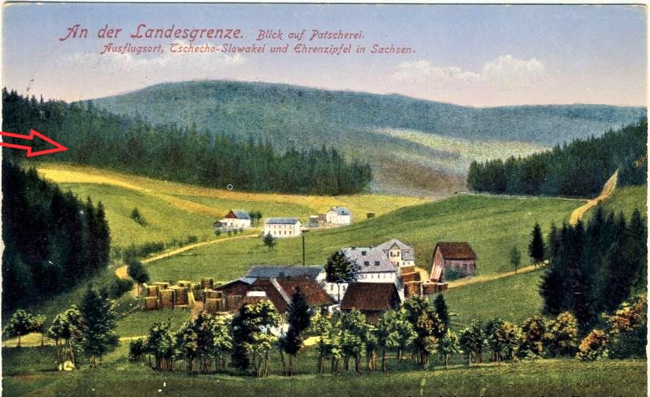 Historische Postkarte, Blick auf Ehrenzipfel, der rote Pfeil markiert das Bergbaugebiet, Quelle: Sammlung J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Blick heute von der Burkertsleithe auf Ehrenzipfel im Tal des Pöhlwassers.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch zu Sanierungsmaßnahmen im Bergbau gehört natürlich eine Bautafel, welche die Beteiligten nennt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Jahren 2015 bis 2019 fanden in der Ortslage Ehrenzipfel umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, um die gefahrenträchtigen Hinterlassenschaften eines über Jahrhunderte gehenden Bergbaugeschehens dauerhaft zu sichern und das Gelände zu rekultivieren. Nun, über den Umfang und die Art dieses Geschehens mag man unterschiedlicher Meinung sein; über die Notwendigkeit, akute Gefahren abzuwenden, kann es jedoch keinen Zweifel geben. Diese Arbeiten stellten aber auch eine Möglichkeit dar, sich nicht nur noch einmal mit dem Bergbau dieser Lokalität zu beschäftigen, sondern ‒ in einigen Fällen nämlich letztmalig ‒ die Gelegenheit zur Dokumentation der zuvor noch vorhandenen Grubenbaue zu nutzen. Im Folgenden sollen die Resultate der Nachforschungen sowie einige Impressionen von der Sanierung der Folgeschäden des Bergbaus dargestellt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Lage und Geschichte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Topographische
Lage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ehrenzipfel, heute ein Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn, liegt im Tal des
Pöhlwassers oberhalb von Rittersgrün. Durch den Ort führt die Staatstraße N° 271
von Schwarzenberg nach Oberwiesenthal bzw. dem Grenzübergang in die Tschechische
Republik in Richtung Joachimsthal. Das Pöhlwasser hat hier zwischen Kaffberg in Süden und Strobelberg im Norden ein recht steiles Kerbtal ausgewaschen. Die Talsohle liegt im Ortbereich zwischen 660 und 680 m über NN, der Rücken des Strobelberges steigt bis weit über 800 m an. Das rechte Gehänge des Pöhlwassers wird als „Burkertsleithe“ (auch Burkersleithe, Burkhardtsleithe) bezeichnet, und ganz überwiegend in diesem Gebiet spielten sich die bergbaulichen Aktivitäten ab. Bis auf eine hauptsächlich als Weideland genutzte landwirtschaftliche Fläche in der Tallage um die wenigen Häuser herum ist das Gebiet von Nutzwald bestanden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geschichtlicher Überblick
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevor die
Rede auf das letzte „Berggeschrei“ kommen soll, sei die Frage gestellt: Warum
war die „Wismut“ eigentlich hier ?
Natürlich gab es auch hier alten Bergbau und genau an diesen Stellen im Erzgebirge hat auch die damalige SAG Wismut wieder nachgeschaut, ob nicht auch Uranerz da zu finden ist. Die Anfänge dieses Bergbaues liegen, wie bei so vielen Lokalitäten, jedoch tief im Dunkel der Geschichte verborgen. Beigetragen zu dem Mangel an Kenntnissen über die Frühzeit des Bergbaus in dieser Region hat sicher auch der verheerende Stadtbrand 1709 in Schwarzenberg, bei welchem der ganze Bestand des dortigen Bergamtsarchives vernichtet wurde. Durch die in der Einführung erwähnte Urkunde wissen wir aber zumindest, daß schon lange vor Mitte des 17. Jahrhunderts auch dort Bergbau betrieben wurde. Ein wesentlicher Anreiz zur Aufnahme bergbaulicher Aktivität war wohl immer die Hoffnung auf das damalige Wertmetall schlechthin, das Silber. Silbererze fanden sich in erster Linie in hydrothermal geprägten Gangstrukturen, aber auch silberhaltiger Bleiglanz und Zinkblende in stratiformen Lagern (Skarnvererzungen) wurden genutzt. Allzu oft erfüllte sich diese Hoffnung jedoch nicht. Doch andere Rohstoffe wurden bei der Suche gefunden und auch verwertet. Im hier behandelten Gebiet waren dies vor allem Eisenerze, später Zink- und zuletzt Uranerze, worauf wir noch zurückkommen werden. Auch unter bergrechtlichen Gesichtspunkten ist hinsichtlich der bescheidenen Kenntnisse über die der letzten vorangegangenen Bergbauphasen aber noch zu bemerken, daß das Eisenerz nicht unter das höhere Bergregal fiel, sondern über lange Jahrhunderte ein grundeigener Rohstoff gewesen ist. Erst ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts begannen die kursächsisch- königlichen Bergbehörden überhaupt, sich auch dem Abbau von Eisenerzen überhaupt zuzuwenden. Auch dieser Umstand führt nun leider dazu, daß wir über den Eisenerzbergbau in den ersten Jahrhunderten seit der Besiedlung des Erzgebirges nur sehr wenig wissen. Klar ist aber, daß Eisen ein höchst begehrter Rohstoff gewesen ist, den auch schon die ersten Siedler im Erzgebirge nur allzu gut zu gebrauchen wußten. Belegt ist jedenfalls, daß der Abbau von Eisenerzen im Schwarzenberger Raum (auf dem Ausbiß des Erla- Crandorfer Eisenstein- Ganges) bis auf das letzte Viertel des 14. Jahrhunderts zurückgehen soll! Seit wann auch die kleinen Lagerstätten in den abgelegenen Hochtälern entdeckt und genutzt worden sind, wird sich dagegen wohl nicht mehr herausbekommen lassen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Zuge
eines wirtschaftlichen Aufschwunges Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts
setzte aber wieder eine rege Bergbautätigkeit ein; alte Gruben wurden
aufgewältigt und neue erschlossen. Die letzte, Eisenerz fördernde Grube im
oberen Erzgebirge stellte ihren Betrieb erst 1927 ein! An der Burkertsleite
dagegen erfolgte dies schon wesentlich eher, da es sich hier um recht kleine und
weniger reich ausgebildete Vorkommen handelt. Der Weiterbetrieb war völlig
unrentabel geworden. Bergbau auf Roteisenerz erfolgte an der Burkertsleithe
zuletzt in den Grubenfeldern Brügner und St.Johannes, also in westlichen
Bereich. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ruhten wieder alle Bergarbeiten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein
erneutes „Berggeschrei“ mußte nach dem Ende des Eisensteinabbaus reichlich 50
Jahre auf sich warten lassen. Erst nach dem Ende des 2.Weltkrieges begann Ende
der 40er Jahre eine beispiellose Renaissance durch den Uranerz- Bergbau der SAG
/ SDAG Wismut, dem wir uns in einem der folgenden Kapitel noch zuwenden werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückblick
auf die Situation
Übertage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrachten wir die Situation vor der Sanierung, ergibt sich folgendes Bild. Der
Altbergbau an der Burkertsleite konzentrierte sich auf die Fundgruben St.
Richard, Häcker Fundgrube, Brugners (Hoffnung) Fundgrube und
St. Johannes Fundgrube. Alle bauten auf ein und demselben Lager oder
Teillagern eines Lagerzuges.
Die bekannteste Grube ist sicher St. Richard, zu welcher der St. Richard Stolln, der Obere Eisensumpf Stolln und der Eisensumpf Stolln mit ihren kleinen Halden gehören. Zwischen den drei Stolln zieht sich ein Streifen kleiner Halden und Pingen entlang, der die Ausbißlinie des Erzlagers am Hang in OSO-WNW- Richtung markiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der St. Richard Stolln
ist der am weitesten im Osten gelegene Stolln des Altbergbaus, weiter östlich verliert sich das Lager. Angeschlagen ist er in 726 m ü NN. Vor dem Mundloch ist eine etwa 15 x 10 Meter große Halde mit etwa 3 m Höhe als Hangschüttung gelegen. Links und rechts des ehemaligen Mundloches zieht sich ein Streifen kleiner Pingen und Halden entlang, der die Ausbißlinie des Skarnlagers am Hang markiert. Etwa 90 m oberhalb der Halde befand sich vor der Sanierung ein auffälliger Bruchtrichter von etwa 3 m Tiefe, umgeben von einer Randhalde. Bei den jetzigen Sanierungsarbeiten wurde nach Erreichen des anstehenden festen Gebirges ein exakt geschlägelter rechteckiger Schacht freigelegt. Er liegt aber nicht direkt auf der Stollnauffahrung, sondern zirka 2 Meter daneben. Es kann deshalb vermutet werden, daß dieser Schacht schon vor Einkommen des Stolln als kleiner Tages- und Förderschacht in das Lager geteuft wurde und nicht nur als Lichtloch des Stolln vorgesehen war (Akte 40196/281). Seltsamerweise ist dieser Schacht auf keinem der vorhandenen Risse eingezeichnet. Der St. Richard Stolln ist auf einem NNO-SSW streichenden Gang etwa 80m (von der Rösche gerechnet) aufgefahren und folgt dem nahezu waagerecht liegenden Lager. Der Abbau des Lagers erfolgte überwiegend im Feld der St. Richard gevierte Fundgrube. Das der Grube verliehene Feld wurde durch Nachmutung am 3.1.1857 auf beträchtliche 88.746 Quadratlachter erweitert. Bei der Gewältigung eines Stollnbruches bei etwa 30 m hinter dem Mundloch bot sich ein erster Blick in die Auffahrung. Es zeigte sich, daß das hier in der Stollfirste anstehende Lager bei ca. 40 cm Mächtigkeit völlig zersetzt und fast von plastischer Konsistenz ist. Da die darüberliegende Bedeckung zur Oberfläche nur knapp 2 m betrug, erklärt sich der Tagesbruch hier von selbst. Weiter in Vortriebsrichtung des Stolln sind Lager und Deckgebirge zunehmend standfester, der Stolln konnte ohne zusätzlichen Ausbau gehalten werden. Hier konnte auch der in etwa Morgengang-Richtung streichende Gang betrachtet werden, welchem der Stolln folgt. Er fällt mit ca. 70° nach W ein und hat eine Mächtigkeit von 10-20 cm. Die Gangfüllung besteht durchweg aus Nebengesteinszersatz, besonders am liegenden Salband sind fettige Letten ausgebildet, die ein Auslaufen des Ganges begünstigen. So kommt es auch fast zwangsläufig bei etwa 60 m zu einem völligen Verschluß des Stollns. Bei ca. 40 m Stollnlänge gehen je eine Strecke nach Ost und West ab. Die Funktion der nach Osten angeschlagenen Strecke kann als Suchstrecke gedeutet werden. Darauf deutet auch ein Hochbruch in der Strecke hin. Wahrscheinlich ist das Lager durch den Stollngang verworfen worden und die Alten hofften, es mit dieser Auffahrung wiederzufinden. Das traf allerdings nicht ein, die Strecke steht ganz in Gneisglimmerschiefer und Muskovitgneis ohne eine Lagerspur. Das relativ große Profil der Auffahrung und vorhandene Bohrspuren deuten auf eine relativ späte Auffahrung hin. Die nach Westen führende Strecke ist eine Ausfahrung im Lagerstreichen. Sie konnnte reichlich 50 m weit befahren werden, ehe ein totaler Verbruch einsetzt. Diese Strecke ist offensichtlich nur in Schlägel- und Eisen-Arbeit aufgefahren; ihr Profil ist klein, kastenartig und deutlich geschrämt. Auf dieser Länge ist ein stetiges Anschwellen der Lagermächtigkeit von etwa 5 cm bis auf nahe einem Meter festzustellen. Bei etwa 20 m ist ein kleiner Versuchsabbau zu sehen, in dem Reste einer schönen Zinkblende-Kupferkies-Vererzung anstehen. Bei 35 m Strecke beginnen die Hauptabbaue, zuerst durch exakte Bruchsteinmauern gesichert, danach lose versetzt und bald völlig verbrochen. Obwohl man also die ehemaligen Abbaue nicht befahren kann, ist das Lager durch die Strecke im Bereich der Stützmauern gut aufgeschlossen. Das Hüllgestein im Hangenden ist unveränderter Gneisglimmerschiefer. Darauf folgt eine Bank von blockigem, äußerst hartem Muskovitgneis (20 cm), danach Granatskarn und verskarntes Nebengestein (20 cm), dann Eisen- und Zinkblende-reicher Skarn (20 cm), zuunterst granatführender Skarn (20 cm). Im Liegenden steht wieder Gneisglimmerschiefer an, leicht überprägt. Am rechten Stoß der Ausfahrungsstrecke ist eine ganz kleine Linse Magnetitskarn eingeschoben. Da der Stolln, wie bereits erwähnt, bei 60 m verschlossen ist, war eine Befahrung des hinteren Teiles nur über den Tagesschacht möglich. Dieser Schacht scheint zum Aufschluß des Lagers geteuft zu sein, da er nicht auf denStolln trifft und somit wohl nicht als Lichtloch geplant war. Der Schacht geht bis auf das Lager nieder, südlich und westlich stehen versetzte Abbaue an, die wohl eine Fortsetzung der Abbaue aus der Ausfahrungsstrecke West sind. An einem stehengelassenen Pfeiler haben sich intensiv grüne Ausblühungen gebildet, dies deutet auch kupferhaltige Mineralien (Chalkopyrit) hin. Überraschend ist das Auffinden einer nach NW vom Schacht abgehenden Strecke, die auf keinem Riß verzeichnet ist. Profil der Auffahrung und Versatzkästen aus Holz, die zum Lager hin stehen, sind offensichtlich Wismut-typisch. Ebenso ein hier stehengelassener Schubkarren aus Eisenblech. Die Strecke endet nach ca. 50 m vor Ort. Aufgefahren ist sie auf einem NW-SO streichenden und 70° nach SW einfallendem Gang. Er ist 10-30 cm mächtig und führt hornsteinartigen Quarz, stark kaolinisiertes Material, Hämatit und Letten. Der St. Richard Stolln wurde auf seine gesamte Länge über Versatzbohrungen mit Beton verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Obere Eisensumpf Stolln
Dieser Stolln liegt etwa 80 m westlich vom St. Richard Stolln. Die spezielle Bezeichnung „Oberer“ ist eigentlich nicht einleuchtend. Dazu müsste ein „Unterer“ Stolln vorhanden sein, die Existenz eines solchen ist aber nirgends belegt oder ersichtlich. Der wenige Meter daneben liegende Eisensumpf Stolln (siehe nächstes Teilkapitel) liegt höhenmäßig gleichauf, so daß eine Bezeichnung als „Oberer Stolln“ auch in diesem Falle nicht gerechtfertigt erscheint. Das Mundloch des Stolln liegt bei 722 m ü NN. Die davorliegende kleine Stollnhalde wird auf einem Riß von 1853 als „Gelbe Halde“ bezeichnet. Tatsächlich zeigte sich das Haufwerk der Halde in deutlich gelblich-braunen Farbtönen, hervorgerufen durch die Verwitterung des eisenhaltigen Materials aus dem Lagerabbau. Ein neben dem Stolln niedergebrachter Schacht, auf dem Riß als „Tageschacht“ bezeichnet, hat keinen Anschluß an den Stolln. Vor der Sanierung war der Standort noch durch eine kleine Pinge mit Randhalde lokalisierbar. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde auch dieser Stolln kurzzeitig geöffnet. Er streicht wie der St. Richard Stolln in Richtung NNO. Im Mundlochbereich war der Stolln durch exakte Naturstein-Mauern mit aufliegenden Firstplatten gesichert. Die lichte Weite betrug nicht einmal einen Meter, als Förderweg der Wismut entschieden zu eng, er wurde also durch die Wismut nicht nachgenutzt sondern nur zur Erkundung geöffnet. Eine tektonische Spur, der dieser Stolln folgt, konnte nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Die Arbeiten wurden schon nach ca. 20 m Aufwältigung wieder eingestellt. Aufgrund des vollständigen Verbruches der alten Auffahrungen war mit keinen weiteren Bruch- bzw. Setzungserscheinungen zu rechnen und eine weitere Wältigung somit unverhältnismäßig. Der Stolln wurde nach Einbau einer wasserlösenden Leitung komplett verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Eisensumpf Stolln, Stolln 239 der Wismut
Dieser Stolln liegt wiederum westlich vom „Oberer Eisensumpf Stolln“ in etwa 50 m Entfernung. Das alte Mundloch ist bei 722 m ü. NN angeschlagen. Der Stolln folgt einen NW-SO streichenden Gang, dies ist mithin ein Flacher. Auf den alten Rissen sind im Vergleich zu den beiden vorgenannten Stolln nur geringe Auffahrungen eingezeichnet. Ein Abbau des Lagers erscheint gar nicht, er hat jedoch zweifelsfrei stattgefunden. Der historische Eisensumpf Stolln wurde durch die SAG Wismut unter der Bezeichnung „Stolln 239“ nachgenutzt und beträchtlich erweitert. Im Mundlochbereich war der Stolln 239 durch einen Ziegeldamm abgemauert. Bei der Aufwältigung wurden im vorderen Bereich (vom Mundloch bis ca 35 m) mehrfach Relikte des alten Eisensumpf Stolln sichtbar. Beindruckend der strebartige Abbau des auch hier sehr flach nach NO einfallenden Lagers, die geringe Höhe dieses „Strebes“ von weniger als einem Meter lässt erahnen, unter welch schweren Bedingungen die Bergleute damals arbeiteten. An den Stößen des Abbaus ist das Lager noch gut zu erkennen. Es hat hier eine Mächtigkeit von nur etwa 30 cm und besteht aus stark eisenschüssigem Quarz. Die geringe Lagermächtigkeit erklärt auch die geringe Abbauhöhe: man wollte möglichst wenig unproduktives Nebengestein mühevoll ausschlagen. Bei etwa 20 m Stollnlänge ist, hinter einer Art Umfahrung, der Schurf 111-2 der Wismut auf dem Gang abgeteuft und mit einem kurzen Durchhieb an den Stolln angebunden. Über diesen Schurf erfolgten wohl weiteren Arbeiten bezüglich der Auffahrung des Stolln 239. Der „neue“ Stolln folgt weiter dem schon erwähnten Flachgang auf etwa 200 m sowie abgesetzt weitere 80m. Da Uranvererzung festgestellt wurde, erfolgte eine sofortige weitere Erkundung durch Vorrichtung eines Abbaublockes. Der Abtransport des anfallenden Haufwerkes erfolgte über zwei Sturzollen bzw Gesenke (Üb. 1a und 3a), die mit der nächsttieferen Sohle (des Stolln 4) verbunden waren. Die Konstruktion der Rollen zeigt, daß der Stolln 239 nicht als Förderweg dienen konnte. Grund für diesen Förderweg über die nächsttiefere Sohle könnte der kaum vorhandene Platz für eine größere Aufhaldung am Mundloch gewesen sein. Zwischen Schurf 111-2 und der ersten Sturzrolle zieht sich in der Firste der Auffahrung das Skarnlager fast schwebend hin. Es ist nur 5-20 cm mächtig und besteht aus zersetztem eisenschüssigem Skarn, drin eingeschoben Linsen von Pyrit, Hämatit und wenig Magnetit. Abbautätigkeit der Alten ist hier nicht mehr zu finden. Oberhalb des Stolln wurde der Gang zwischen den Überhauen 1 und 3 durch eine Kopf- bzw Etagenstrecke durch Wismut weiter untersucht. Ein bescheidener Abbau erfolgte wohl nur auf wenigen m² bei Überhauen 2, wegen negativer Ergebnisse unterblieb eine weitere Löschung der Gangfläche des Blockes. In den Stolln 239 wurde bei Erreichen einer als bruchsicher berechneten Überdeckung bei 60 m vom Mundloch sowie am Mundloch selbst ein Damm eingebaut und die Hohlräume verfüllt. Ebenso verfüllte man die gesamte Etagenstrecke (obere Abbaugasse).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unterhalb
dieser drei Stolln liegt am Waldrand die größere Halde des Wetterschachtes der
Wismut als tafelartige Hangschüttung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Häcker Stolln
Der Stolln liegt etwa 100 m westlich vom Eisensumpf Stolln auf einer Höhe von 714 m über NN. Mundloch und Stollnhalde lagen am Hang nahe dem Waldrand, sie wurden bei der Teufe das Hauptschachtes 247 durch dessen Halde bzw. Betriebsfläche überschüttet. Der Ansatzpunkt des Schachtes liegt nur etwa 20 m westlich des Stollnmundloches. Über Tage lassen sich keine Nachweise mehr finden. Durch einen bei der jetzigen Sanierung angelegten Erkundungs- Schufgraben konnte der Stolln nicht aufgefunden werden – er liegt wohl etwas tiefer – so daß leider keine Nachforschungen am Objekt möglich waren. Auf einem Riß von 1853 ist der Stolln mit etwa 50 m Auffahrungslänge und einer kurzen Seitenstrecke oder einem Steigort eingezeichnet. Abbaue auf dem Lager sind nicht eingezeichnet. Die Streichrichtung des Stollns geht gegen Nord, so daß er wahrscheinlich auch auf einem meridionalen Gang aufgefahren wurde. Über den Stollnbetrieb selbst, das Ausbringen und andere Details konnte nur wenig ermittelt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Hinterlassenschaften der Suche nach Uranerz Unmittelbar beim ehemaligen Mundloch wurde der Hauptschacht 247 des Uranvorkommens Ehrenzipfel I geteuft, der die größte Halde im Gebiet schüttete (Weiteres siehe Kapitel Sanierung). 50-70 m nordwestlich vom Mundloch des Eisensumpf Stolln befinden sich zwei markante Bruchpingen, erstens die Pinge des Schurfes 137 mit Halde und zweitens die des Schurfes 111-0/1-5. Vom Schacht 247 aus etwa 130 m in westliche Richtung ist der Stolln 4 angefahren, dessen Halde als Hangschüttung am Waldrand in die Halde 247 übergeht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Stolln 4
Das Mundloch dieses Stolln liegt an dem Weg, welcher vom Schacht 247 am Waldrand in westliche Richtung führt, auf einer Höhe 719 müNN. Er wurde durch Wismut aufgefahren und hat keinen Vorgänger des historischen Berbaues. Mit dem bereits behandelten Stolln 239 bildet er eine Sohle und löst den westlichen Teil des Grubenfeldes. Ein Anschluß besteht zum Schurf 138. Der Stolln 4 wurde nach Einbau von Versatzdämmen im tagbruchgefähdetem Bereich mit Beton verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Stolln 3
In nördlicher Richtung hangaufwärts ist Stolln 3 angeschlagen, die kleinere Halde hebt sich auffällig vom Gelände ab. Ob Stolln 3 ausschließlich eine Neuauffahrung durch Wismut ist, lässt sich nicht abschließend beantworten. Aufgrund seiner Lage und den umfänglich angetroffenen Altbergbau-Spuren ist jedoch zu vermuten, daß ein Altbergbaustolln nachgenutzt wurde. Das Mundloch von Stolln 3 liegt auf +736 müNN wenige Meter südöstlich von Schurf 138. Es ist die höchstgelegene Abbausohle im Revier. Der Stolln führt vom Mundloch weg ca. 33 m in Richtung NNO, von dort führt Qu 3 in Richtung WSW bis zu einem Durchschuß nach übertage. Dieser Querschlag folgt dem Generalstreichen des Skarnlagers der Burkhardtsleithe und folgerichtig traf man bei der jetzigen Aufwältigung vielfältige Relikte des Altberbaus an. Diese wurden durch die Wismut-Grubenbaue unter-, über- und durchfahren. Bei der Planung zur Verfügung stehende Unterlagen erwähnten zwar Altbergbau, jedoch fehlten konkrete Angaben dazu völlig. So wurden die Sanierer immer wieder mit unvorhersehbaren Situationen konfrontiert, die ihr ganzes Können forderten. Querschlag 3, Stolln 3 sowie die angetroffenen Altbergbau- Hohlräume wurden vollständig mit Beton standsicher verschlossen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch
etwas weiter hangaufwärts folgt Schurf 138 mit einer doch ziemlich großen Halde
und darüber schließlich Schurf 112-0/1-1 mit mehreren Bruchstellen. Stolln 3 und
Schurf 138 liegen im Feld der alten Fundgruben Brugner und St. Johannes. Durch
die Wismut-Überprägung ist außer einigen unscheinbaren Pingen vom Altbergbau
nichts mehr zu sehen. Weit im Westen, eigentlich schon außerhalb des
betrachteten Gebietes, ist in Forstabteilung 235 der sogenannte Richtschacht
(Altbergbau) abgeteuft, mit welchen man wohl die Ausläufer des Skarnerzlagers zu
erreichen hoffte. Dieser Schacht mag mit den Untersuchungen der Königin
Marienhütte im benachbarten Feld der Grube Rother Adler in Oberrittersgrün
zusammenhängen, wo man 1883 letztmalig Schürfabeiten durchführte. Ob diese
erfolgreich waren, ist zu bezweifeln, da 1898 der Betrieb eingestellt wurde.
Der Stolln 5 liegt außerhalb des Sanierungsgebietes und wird deshalb nicht näher behandelt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Geologie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl er auf die in der
Gegend zwischen Breitenbrunn und Schwarzenberg besonders häufig auftretenden
Erzlager recht ausführlich eingeht und auch die Gruben bei Ehrenzipfel
wenigstens auf die Zeit um 1830 zurückgehen ‒ damals also sehr wahrscheinlich
schon umgängig gewesen sind ‒ finden die bei Ehrenzipfel bebauten Erzlager in
C. F. Naumann's Erläuterungen zur Geognostischen Karte Sachsens
erstaunlicherweise keine Erwähnung.
Auch Schalch geht in seinen Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte des Königreichs Sachsen, Blatt 146: Section Johanngeorgenstadt, 1. Auflage 1884, auf die Skarnlager bei Ehrenzipfel nicht ein. Dagegen findet man bei Sauer im Erläuterungsheft zum östlich angrenzenden Kartenblatt No. 147: Section Wiesenthal- Weipert, zumindest einen Hinweis auf b) Pyroxenfels- Blendelager. Er schrieb in der 2. Auflage von 1917 nämlich, man fände solche, Zinkblende- führenden Lager, immer in graphitführenden Glimmerschiefern eingebettet und im Bereich dieses Kartenblattes an drei Stellen. Gleich unter 1. führte er dann auf: „an der Burkertsleithe nahe dem Westrande des Blattes. In der Hauptmasse des Lagers, einem graugrünen Augitfels mit untergeordnetem Pistazit, ist die fein- bis grobkörnig- blättrige, dunkelrotbraune bis honiggelbe Blende in kompakten Massen, Schmitzen oder Schnüren eingewachsen oder in einzelnen Körnchen verteilt. Der Augit bildet grobstenglig- blättrige bis dichte Aggregate, die oft von Quarz mit vereinzelten mikroskopischen Einschlüssen von Apatit, Blendekörnchen und Augitkriställchen durchzogen sind. Neben Blende, welche in Stücken auf der Halde z. T. weiße Überzüge von Zinkvitriol trägt, bricht untergeordnet Zinnstein, Pyrit, Magneteisen und Kupferkies ein, von welch letzterem gelegentlich vorkommende Malachitanflüge herrühren.“ Auch am Südhang des Kaffenberges bei Goldenhöhe legten zu dieser Zeit noch zahlreiche Pingen und Schächte, sowie ausgedehnte Haldenzüge davon Zeugnis ab, wie intensiv dort einst Bergbau auf die Lager von Strahlstein mit Blende und Magneteisenerz umgegangen sei.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
Skarnlager des Altbergbaus und das Uranerz- Vorkommen Ehrenzipfel
I, die sich
überschneiden, liegen im Bereich der Gera- Joachimsthaler- Bruchzone. Das
tektonische Hauptelement ist lokal die NW-SO- streichende Rittersgrüner Störung.
Sie wird von der N-S- streichenden Hirtenberg- Störung gekreuzt. Die Nebengesteine
sind Schiefer kambrisch-ordovizischen Alters der Joachimsthler Gruppe; sie sind
durch Regionalmetamorphose mäßig verändert. Im behandelten Gebiet lassen sich
kontkatmetamorphe Glimmerschiefer (Muskovitschiefer, feldspat- und
kohlenstofführend), Muskovitgneise, Quarzitlagen und einzelne Amphibolit- und
Skarnlinsen geringerer Ausdehnung aushalten. Kohlenstofführende Phyllitschiefer
der Thumer Gruppe stehen im Randbereich an. Die Gesteinsserie fällt mit
durchschnittlich 25° flach nach NO ein, wobei lokal Abweichungen bis zu fast
horizontaler Lage auftreten.
Dieses durch tektonische
Vorgänge bedingte Abweichen bereitete schon den Altvorderen Schwierigkeiten. Da
anfangs nur ganz wenige Aufschlüsse vorhanden waren, wobei sich das Lager mit
unterschiedlichem Einfallen („wellenartig“) zeigte, war man sich nicht sicher,
ob es sich um ein zusammenhängendes Lager oder verschiedene Teillager handelt.
Im tieferen Untergrund steht der Granit des Eibenstock- Karlsbader Massives an, der als Erzgebirgsgranit definiert wird. Die mineralisierten Erzgänge streichen durchweg parallel zur Rittersgrüner Storung und können als Flache bezeichnet werden. Sie haben saigeres bis steiles Einfallen nach SW, die Mächtigkeit liegt im Zentimeterebereich und überschreitet mehrere Dezimeter kaum. Die Gangfüllung besteht über weite Strecken nur aus zerriebenem Nebengestein und Letten, als Gangarten treten Quarz und Fluorit, bisweilen Karbonate auf, Erzmineralien sind in erster Linie Sulfide wie Pyrit, Sphalerit, Galenit und Chalkopyrit sowie sporadisch Pechblende (bzw. deren Oxidationsprodukte). Die Erzführung wird entscheidend von den durchgeschlagenen Skarnhorizonten kontrolliert. Die Stolln des Altbergbaues sind teils auf NO-SW bis N-S meridional streichenden Gängen aufgefahren; erstere können als Morgengänge bezeichnet werden. Sie sind nicht bis kaum mineralisiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das im
Feld anstehende Skarnlager wird in den Quellen normalerweise als „St. Richard an der Burkertsleithe“
bezeichnet, wodurch eine Verwechselung mit dem nur wenige Kilometer entfernten
Grubengebäude bzw. Skarnlager „St. Richard im Forstwald“ bei Breitenbrunn
vermieden werden sollte.
Das Lager ist in kohlenstofführendem Glimmerschiefer und Muskovitgneis eingeschaltet. Die Mächtigkeit beträgt meist zwischen ½ und 1 Meter. Das Lager ist konkordant eingebettet und folgt in Streichen (OSO-WNW) und Fallen (NO) genau dem Nebengestein. Die durch kontaktmetamorphe Einwirkungen geschehenen Veränderungen bildeten zunächst Pyroxen- Granat- Skarne, im weiteren Verlauf des Skarnprozesses Amphibol- Magnetit- Skarne. Als nichtmetallische Bestandteile sind am Aufbau des Lagers beteiligt:
Die vorkommenden Erzminerale sind:
Dabei ist die Erzführung jedoch sehr absätzig und gewöhnlich an kreuzende Gangstrukturen gebunden. Auffällig ist die im Ostteil vorherrschende Sphaleritführung, während nach Westen hin Martit bzw. Hämatit überwiegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Reichlich Zinkblende führender Skarnzersatz mit Ausblühungen von gelbem Greenockit.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Sulfidskarn, die obere Hälfte besteht fast nur aus Zinkblende, unten ist sie eingesprengt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Sulfidskarn, der aus Pyrit beseht, welcher in zelliger- wabenartiger Struktur vorliegt. Es ist wahrscheinlich eine Verdrängungspseudomorphose.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die blau- grünen Beschläge auf dieser Skarnprobe verweisen auf sekundäre Cu-Zn-Mineralien.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch dieser zersetzte Skarn ist durch oxidierten Kupferkies intensiv grün gefärbt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
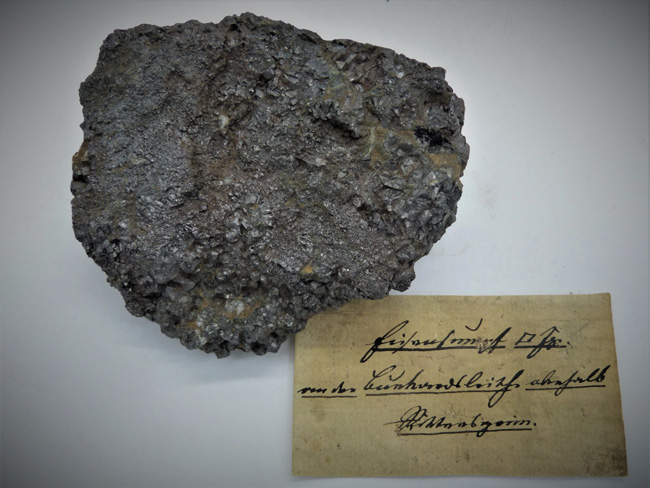 Historische Martit- Stufe mit einem alten Fundzettel: „Eisensumpf (geviert) Fgr. von der Burkardsleithe oberhalb Rittersgrün“.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
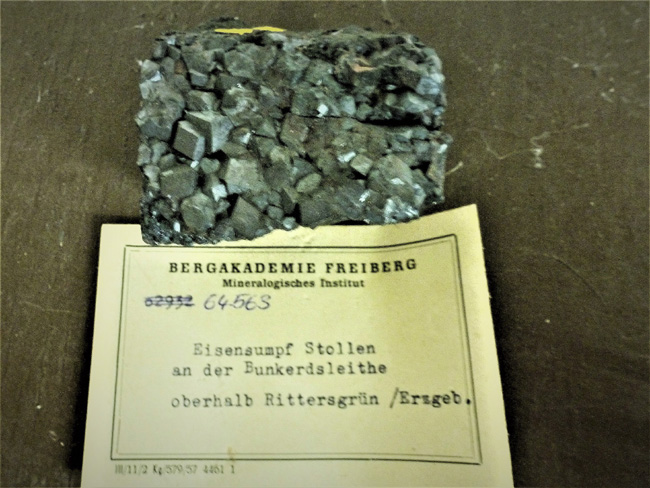 Noch eine Martitstufe aus dem Bestand der geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg) Eine nicht näher bezeichnete „Kupfererz-Probe“ aus dem Bestand der geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
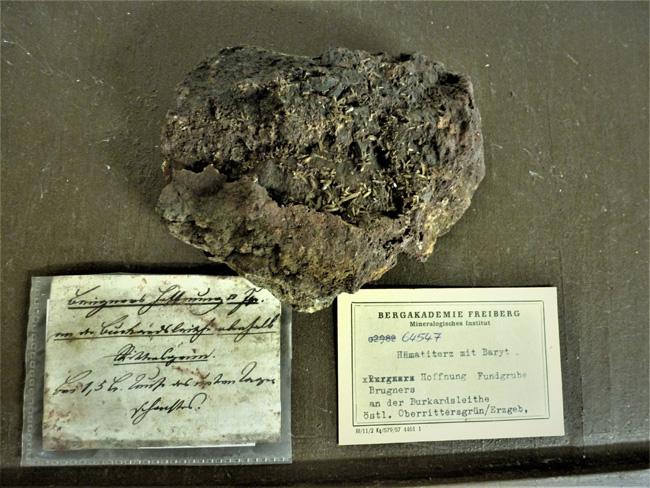 Schwerspatkristalle auf Hämatitskarn, ebenfalls aus dem Bestand der geowissenschaftlichen Sammlungen der Bergakademie Freiberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur
älteren
Montangeschichte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Studium
der Bergarchiv- Akten brachte noch eine Reihe höchst interessanter Erkenntnisse zum
Bergbaugeschehen an der Burkartsleithe, besonders im Zeitraum der vergangenen
letzten zwei Jahrhunderte, zutage. Deswegen wollen wir an dieser Stelle die
Vorgeschichte des Wismut- Bergbaus detaillierter darstellen. Und bei der
Lektüre wird der Eine oder Andere vielleicht feststellen – besonders die Begriffe
„Bürokratie“ und „Spekulation“ betreffend – Grundlegendes hat sich da bis heute
auch nicht geändert!
Die älteste erhaltene Grubenakte vom Bergbau an der Burkertsleithe stammt erst aus dem Jahr 1830. Wie bereits erwähnt, gab es vermutlich aber schon viel früher bergbauliche Aktivitäten auf benanntem Gebiet. So erwähnen die Schreiber späterer Grubenakten immer wieder, daß uralte Pingen und Halden vorhanden gewesen seien. Unter anderem berichtet der Berggeschworene Tröger im Zuge einer Schlußbefahrung auf Brügners Hoffnung Fundgrube im Jahr 1858 „Übrigens befinden sich daselbst aus der Vorzeit eine Menge alter Bingen, in denen zum Theil schlagbare Bäume zu sehen sind...“ (40040, Nr. 30). Bei schlagbaren Bäumen kann man von einem Alter von 80-100 Jahren ausgehen, somit müssen die Pingen mindestens der Zeit um 1780 entstammen, woraus aber nichts anderes zu schließen ist, als daß Bergbau dort zuvor schon umgegangen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wahrscheinlich hat der Bergbau hier aber schon lange Zeit früher begonnen, denn Petrus Albinus erwähnte den Ort bereits in seiner 1590 erschienenen Meißnischen Bergchronik gleich mehrfach. So heißt es zur Geschichte des Bergbaus im V. Titel. Von den folgenden Bergkwercken / so nach dem Schneeberg auffkommen / fürnemlich aber Annenberg und Marienbergk. auf S. 49: „Von dem Lawenstein und Bergishübel / unter welchen dieses ein Kupffer- Bergwerck / jenes ein Zienbergwerck / aber auff beyden auch das beste Eysen gemacht / und Eyserne Ofen gegossen werden / kann ich auch keinen Bericht thun. Desgleichen von dem Bergwerck umb Schwartzenburg / welches mit einem eigenen Bergampt bestellet / wie auch Grunenhayn. Es sind auch umb solche gegent zwey fürneme Eysenbrgwerck für andern beruffen / nemlich die Burgartsleiten bey dem Dorff Pela / wenn man in den Joachimsthal gehen will zur rechten seiten / darnach der Memler / zwischen Raschaw und Grüenhayn.“ Im Kapitel: Der XVI. Tittel: Von den Metallen / so im Lande zu Meysen gefunden werden. schrieb Albinus speziell zum Eisenerzbergbau (S.134): „Gleichergestalt ist derselben neben anderer Metallen herrlichen Bergwercken auch ein überfluß im Lande Meyssen / in welchem doch dieses die fürnembsten örter sein / so wegen desselben berufen. Erstlich hat man viel Eisen Hämmer nicht weit von dem Dorfe Pela (Pöhla) / auff der rechten hande der Straßen / da man in den Joachimsthal zeuhet / welches man auff der Burghartsleiten / von deme so den Eisenstein erfunden / wie Agricola meldet / und wo des orts gelegenheit / ernennet. Das ander Eisenbergwerck ist zwischen dem Dorff Rascha und Städtlein Grünhain / da vorzeiten ein stadtlich Benedictiner Kloster gewesen / dieses nennet man auffm Memmler / wie es Agricola schreibt / andre nennen es den Emmler. Das dritte und fürtrefflichste Eisen wird zum Lauenstein und Berggieshübel und Glashütten gemacht / sind alle drey nicht weit von Dresden und Pirna den Städten gelegen. Derwegen etlich das Eisen / so daselbst gemacht / Pirnisch nennen / und rühmen davon es sey geschmeidiger als das Lausitzer / so doch sonsten auch weit verführt wird. (…)“ Und noch einmal wird der Ort von Albinus genannt im Kapitel Der XIX. Titel. Von mehr köstlichen Steinen / welche zum theil zur Arzney / notturfft und zierde des Lebens dienlich / so im Lande zu Meißen gefunden werden. Wo es auf S. 149 heißt: „Es brechen sonderlich bey uns viel Magneten / zu Deudsch Segelstein / wie sie die Seewohner und Schiffleute / oder Eisenbrant / wie sie andre Deudschen nennen. Sie brechen aber gemeiniglich bey und unter dem Eisenstein / welches doch die Hammermeister nicht gerne sehen. (…) Bey Schwartzenberg im Dorff Pela / auff der rechten seiten / wenn man in Thal gehet / auf dem Eisenbergwerck die Burkartsleiten genannt. (…)“ Die Nachsuche in historischen Karten klärte schnell, daß es rechts des Pöhlwassertales stets nur die eine Burkhardtsleithe gegeben hat und zwar diejenige oberhalb von Ehrenzipfel. Wir erfahren hieraus zuletzt auch, daß magnetitreiche Eisenerze der Ausgangspunkt des Bergbaus an diesem Ort gewesen sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Albinus auf Agricola verwies, haben wir beim Nachsuchen eine ganz ähnlich lautende Erwähnung auch in Agricola’s De veteribus et novis metallis aus dem Jahr 1546 gefunden. Dort heißt es über die Vorkommen von Eisenerz im sächsischen Erzgebirge nämlich (S.58 der Übersetzung aus dem Lateinischen): „In Meißen (Erzgebirge) bricht der köstlichste Eisenstein auf Burkhardts Fundgrube, nicht weit vom Dorfe Pöhl, rechts am Wege nach Joachimsthal; ferner zwischen Raschau und dem Kloster bey Grünhayn; das allerschönste bey Lauenstein, und, nicht weit von Pirna gegen Mittag, bei Berggieshübel (…)“ Die Übersetzung aus dem Lateinischen stammt aus dem Jahr 1812 und zu dieser Zeit hatte sich schon die Schreibweise des Ortsnamens Pöhla mit einem ,ö´ eingebürgert. Auch Agricola nannte die Eisenerzgruben talaufwärts rechts der Straße nach Joachimsthal von Pöhla an erster Stelle seiner Aufzählung. Die Eisenerzförderung dort muß also im 16. Jahrhundert bedeutend gewesen sein. Anscheinend geht der Name der Burkhardtsleithe sogar auf die bereits von Agricola genannte Fundgrube dieses Namens zurück.
Leider waren bisher keine
authentischen schriftlichen Nachweise zu diesem, offenbar auch schon im 16. Jahrhundert umgängigen Bergbau zu finden.
Zu dem von beiden Autoren hier an zweiter
Stelle genannten ,Memmler' oder ,Emmler', zwischen Raschau und
Grünhain gelegen (gemeint ist der Höhenrücken zwischen dem Mittweidatal in
Raschau und dem Schwarzbachtal in Langenberg), gibt es inzwischen einen weiteren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl
die Aussicht auf das Auffinden neuer, bisher noch unbekannter Quellen aus dieser
Zeit eher gering ist, gibt es doch ab und an einen Treffer: Auch, wenn uns das
Kontraktbuch des Bergamtes Scheibenberg keine konkreten Hinweise auf einzelne, tatsächlich
im 16. Jahrhundert hier umgängige Gruben liefert, so belegt die nachstehend
zitierte, vertragliche Einigung doch, daß es an der darin ausdrücklich genannten „Bürckersleithe“
zumindest Grund zu einem Streitfall zwischen den damaligen Bergämtern zu
Scheibenberg und zu Neustadt Oberwiesenthal gegeben haben muß, respektive eben auch
Bergbau. In diesem Vertrag heißt es (40014, Nr. 2, Blatt 1ff):
„Demnach und als sich zwischen beyden Gemeinden Scheibenberg und Neustadt Ober Wiesenthal wegen des Gebürges Bürckersleithe und anderer Gebürge halber, des Verleihens und Muthens wegen, Irrungen begeben und entstanden und dießfalls in der vergangenen Bergk Rechnung Trinitatis a.c. 64 auffn Scheibenberg vor dem Ehrbarn und Hochgeachten Marcus Röhlingken, des Gebürgischen Creiß Ober Bergkmeister auff St. Annaberg, und dann Hannß Rodten, Churfürstlicher Ambtmann auf Schwarzenbergk und Crottendorff, von denen auf der Neustadt Wiesenthal ihre Beschwerungen Klagende vorgebracht worden, da dann jetzt gemeldete Beyde Herrn Ambtleute, an welche solche Klage geschehen, vors beste erkannt und angesehen, daß sich diese beyde Gemeinden eines Tages vergleichen, die Gebürge anfahrn und begingen und sich dieser irrigen Verleihung halber selbsten vertrügen, und in der Güte entschieden und zur Folge gedachter Herrn Ambtleute Befehl, haben sich beyde Gemeinden heut dato die Sache vor die Hand genommen und bis auff oben ernennter beyder Herrn Ambtleute weiter Erkenntnis (unleserlich ?) und Willen, sich dieser Irrungen wegen nachfolgender Meynung mit einander gänzlichen verglichen, als erstlich Anfang im Pöhl Waßer, da die dritte Runde in solchem Waßer überkömbt, soll daßelbe Waßer ein und ein, den Rein halten, so weit es voriger gewesener Herrschaft Schönburgk gewesen ist, biß an die Kön. Kayserl. Majest. Reinung, als was derseits nach dem Gebürge Kaff zu, auff die Neustadt Wiesenthal, jenseits nach der Rittergrün auffn Scheibenbergk gehörig, wiederumb Anfang der 3ten Runde den Rein der Verleihung und Muthung halten, über alle Hauptflügel biß an die Große Mittweyda, da die viel genannte Runde unter des Richters zu Crottendorff Bartmühl überkömt; Ausgangs dieser 3ten Runde in ernannter Mittweydaer Waßer, soll eine gerade Reinung gehalten, und von denen am Scheibenbergk auff ihre bewilligte Unkost (doch dergestalt, so ferne sich dieß Orths Bergkleute begeben würden, und auf den Kosten solche Reinung zu machen trüge, und aus keinem Neid geschehen möchte) gemachet und verfertiget werden, biß auff Barthel kemmels (?) Barthmühl oben in Neudorff an der großen Weißen Sehma gelegen, von der Barthmühl soll das Waßer Weiße Sehma reinen biß auf Mülzen (?) Reinung, da wohlgedachter Herrn von Schönburgk Rein gewendet als Klärlichen; was innerhalbe der dritten Runde des gemeldeten neuen Reines und dann der Seiz Waßers alles auff der Neustadt Wiesenthal, jenseits genannter Örther nach der Pehl und Crottendorff an Schebenbergk gehörig. Solches ist von beyden Perthen steht und fest (doch so ferne vieler gedachter Ambtleute Gunst und Willen folget und biß auff Sr. (?) des Churfürsten zu Sachsen gnädigste Veränderung) unwiederruflichen zu halten, auch solchen vollzogenen Receß auf erfolgte Gunst, in die Bergk Bücher zu verleiben bewilliget worden. Act. Neudorff, in Beyseyn Merten Rauch, Bergkmeister, Abraham Hornigk, Melchior Jeßner, Caspar Wagner und Hannß Sertell (?) von Schönburgk und dann Leonhardt P (?) Richter, Hannß Wielandt, Paul Stölzel, Matthes Nester und George (?) Thennharn von der Neustadt Wiesenthal, Matthes Waldholm, Förster daselbsten, dazu erbethen, Montag nach Johannis Baptiste, Anno Im 1564ten Jahr.“ Mit eigenhändiger Unterschrift von Marcus Röhlingk, Oberbergmeister und Hannß Rodten. Die hier zur Beschreibung der vereinbarten Grenzlage zwischen den Zuständigkeitsbereichen der beiden Bergämter mehrfach genannte „3te Rundung“ geht auf einen sogenannten ,Jagdstern' zurück, den wir auf den zwischen 1614 und 1634 entstandenen Öder- Zimmermann'schen Karten von Sachsen entdeckt haben. Dieses System von Forstwegen, die um einen zentralen Punkt herum verlaufen, ist auf den folgenden Kartenausschnitten leicht erkennbar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auf den ab 1586 entstandenen Öder'schen Kartenzeichnungen (dem sogenannten ,Ur-Öder´) ist die ,Burkhartsleithe´ schon verzeichnet - leider aber keine Hinweise auf dort umgehenden Bergbau. Bildquelle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
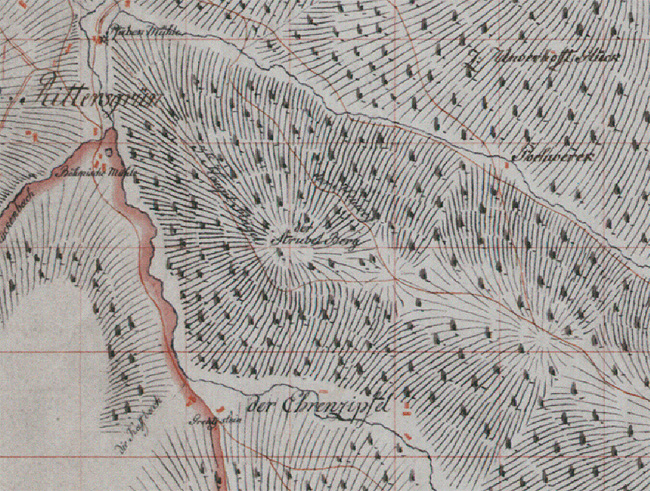 Ausschnitt aus einer Menselblattkopie des Gebietes zwischen Buchholz im Osten und Rittersgrün im Westen, datiert 1792. Einige Häuschen sind auch schon im Pöhlwassertal bei Ehrenzipfel eingezeichnet, jedoch auch hier keine Bergwerke. Nördlich des Strobelbergs, im Tal des Kunnersbachs, ist dagegen eine Grube Unverhofft Glück nebst eines Pochwerck's im Talgrund verzeichnet. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044-1, Nr. C17720, Ausschnitt, Norden ist rechts oben. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ausschnitt aus einer der im 19. Jahrhundert im Oberbergamt Freiberg geführten Stollnkarten, leider ohne Datierung. Auch hier ist bei Ehrenzipfel (im Ausschnitt rechts unten) keine einzige Grube verzeichnet, dagegen u. a. nördlich von Rittersgrün die Grube Rother Adler oder östlich von Breitenbrunn (im Ausschnitt links oben) die Unruhe. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044-5, Nr. i70, Norden ist rechts oben. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen ersten archivalischen Nachweis hier
umgehenden Bergbaus haben wir in den Fahrbögen des Vize- Berggeschworenen
Johann Paulus Bock aus den Jahren 1711 und 1712 gefunden (40014, Nr. 53). In
dessen Fahrbogen von No. 1. biß 4. Woche im Quartal Reminiscere anno 1712 im
Bergk Ambt Scheibenbergk findet man die Notizen:
„(...) weiter gefahren auffn Heiligen
Drey Königen an der Burkhartsleut, war niemandt;
Mit der Burkertsleut (die Schreibweise wechselt selbst in seinen Notizen mehrfach) ist wirklich die Burkhardtsleithe gemeint, denn aus dem gesamten Text erschließt sich, daß Herr Bock gerade zuvor in Gruben am Kaff gewesen und von dort nach Rittersgrün weitergereist ist. Bei seiner Befahrung im Januar 1712 waren beide hier genannten Gruben offenbar aber unbelegt. Der Geschworene befuhr die Gegenden regelmäßig und wir finden vom April 1712 (1. Woche Trinitatis) noch weitere Notizen; jetzt heißt es: „Weiter gefahren aufn Heiligen drey
Königen an der Burckertsleut, aber niemand; Im Folgemonat (5. Woche Trinitatis 1712) steht zu lesen: „Weiter gefahren aufn dreue Friedrich 24
Lehne an der Burckertsleut, aber niemandt,
Und noch einmal sind im Juni 1712 (9. Woche Trinitatis) diese beiden Gruben genannt: „weiter gefahren aufn Heiligen drey
Königen an der Burckertsleut arbeit in Wochen Lohn aufn Ertz ist Christian Vogel
zu 3 bauen 4 Lachter dief, Als Lehnträger der Grube Heilige drei Könige wird jetzt derselbe Christian Vogel genannt, wie zuvor bei zuvor bei Treuer Friedrich. Vermutlich hatte er als Eigenlehner also beide Gruben gemutet und in Weilarbeit abwechselnd selbst dort gearbeitet. Außer einem Bergjungen waren wohl keine weiteren Bergarbeiter angelegt. Dem Text nach waren beide Gruben „aufn Ertz“ verliehen und es wurde noch in geringer Tiefe, aber doch mit Bohren und Schießen gearbeitet. Auch hier ist schon von Gewältigung die Rede ‒ auch dieser Bergmann war folglich nicht der erste an dieser Stelle...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während des Zeitraums der ersten geognostischen Landesaufnahme, im Jahr 1836, bereiste Bernhard Cotta im Auftrag der Geognostischen Landesuntersuchungs- Kommission beim Oberbergamt die „Gegend von Schwarzenberg“ und berichtete am 2. Juli 1836 in Freiberg darüber (40003, Nr. 146, Blatt 8, Rückseite und folgende): „Der Schieferung anscheinend ziemlich parallel, ist der Glimmerschiefer (und auch der Gneis) von sehr abweichenden Gesteinen vielfach durchschwärmt, deren Hauptmasse theils grünsteinartig, theils kalkig ist, und die sich bei flüchtigem Überblick eines beschränkten Terrains anzunehmen geneigt sein könnte, ihren Halt und Werth, wenn man berücksichtigt, daß solche Granitkuppen, wie der Rackelmann, an mehreren Orten aus dem Glimmerschiefer dieser Gegend hervortreten, ohne daß sie deshalb von einem derartigen vermeintlichen Lagersysteme umgeben wären. Es steht ihnen dasselbe auf den geognostischen Karten, theils, weil der Glimmerschiefer nicht in der allerdings merkwürdigen Weise, wie es hier wirklich der Fall ist, concentrisch um sie herum aufgerichtet ist, theils weil er in ihrer Nähe zufällig weniger erzhaltige Hornblendegesteine oder bauwürdige Kalksteine enthält. Erzleere Grünsteinmassen und geringmächtige Kalksteine werden auch dort nicht mangeln, ihre geringere Mächtigkeit ist jedoch schuld daran, daß sie weniger bekannt sind. Gesteine solcher geringer Massenausdehnung, wie die meisten dieser erzführenden Grünsteine werden in der Regel der gewöhnlichen geognostischen Beobachtung entgehen, oder wenigstens wird sich ihr Streichen und Fallen nicht beurtheilen lassen, wenn sie nicht zufällig durch Bergbau aufgeschlossen sind, wie das in der Schwarzenberger Gegend an so vielen Orten der Fall ist. Könnte man all die erzleeren wie die erzhaltigen Grünsteingebilde und all die unbauwürdigen wie die bebauten Kalk- und Dolomitlager, welche der Glimmerschiefer zwischen Johanngeorgenstadt, Zschopau und Schneeberg enthält, nach ihrem Streichen und Fallen genau auf einer Karte eintragen, dann würden die scheinbaren Beziehungen der Lager zu dem Granit des Rackelmannes sogleich verschwinden, nur die auffallend genug concentrische Struktur des Glimmerschiefers mit den Lagern würde als beziehungsreich bleiben, denn der größere Erzgehalt, sowie das vielleicht etwas häufigere Auftreten um Schwarzenberg können durchaus nur als zufällige Erscheinungen angesehen werden, besonders da ersteres keineswegs für alle Lager und letzteres nicht für alle Theile der Umgebung des Rackelmann gilt. Auch schon die geringe Continuität der meisten Lagermassen läßt ihre vom Glimmerschiefer abhängige concentrische Anordnung als bedeutungslos in Beziehung auf den Granit erscheinen, da kein einziges derselben weit genug fortsetzt, um wirklichen Bogen zu bilden; jedes für sich erscheint gerad, oder regelmäßig gewunden, für jedes einzelne existiert daher keine Centricität.“ Abgesehen von den Betrachtungen Cotta's zur allgemeinen Anordnung dieser Lager in der Region lernen wir hieraus, daß die Mächtigkeit dieser „erzhaltigen Grünstein-, Kalkstein- und Dolomitlager“ gewöhnlich nur gering ist, daß sie zum Teil eben auch unbauwürdig und erzleer sind und daß ihr Aushalten ‒ die Continuität ‒ selten größere Ausdehnung erreicht. Alles keine günstigen Voraussetzungen für einen länger währenden, ertragreichen Bergbau! Eingangs seines Berichtes beschwerte sich Cotta über die bei seiner Reise Anfang 1836 leider sehr ungünstige Witterung, weswegen er nicht alle Orte selbst habe aufsuchen können, an denen entsprechende Vorkommen beschrieben worden sind ‒ offenbar auch Ehrenzipfel nicht. In den seinem Bericht beigefügten Kartenbeilagen ist jedoch an fraglicher Stelle am Südabhang des Strobelberges über dem Pöhlwassertal ein hellblauer Streifen verzeichnet. Seine Eintragung an dieser Stelle basiere auf einer Arbeit von Friedrich Wilhelm Fischer aus dem Jahr 1824, in welcher Erzlager „Am Karamberge und Strubelberge bei Rittersgrün“ angeführt seien. (Vermutlich hat Cotta hier den Kaffenberg südöstlich von Ehrenzipfel und den Strobeltberg nördlich gemeint, die Namen jedoch etwas hastig abgeschrieben...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Menselblattkopie mit eigenhändigen Eintragungen von Erzlagervorkommen B. Cotta's aus dem Jahr 1836.Rechts im Ausschnitt der Strubelberg oberhalb von Ehrenzipfel und an seinem Südabhang eine blaßblaue Markierung, deren Farbgebung nach Cotta's Legende darauf verweist, daß er diessen Lage aus anderen Quellen übetragen und die Örtlichkeit 1836 nicht selbst besucht hat. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003, Nr. 146, Blatt 51, Ausschnitt, Norden ist rechts oben. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere Nachsuche nach dem
von Cotta zitierten Arbeit von Fischer (40003, Nr. 78) ergab
leider in dessen Bericht auch keine nähere Beschreibung der Erzvorkommen an der
Burkhartsleithe; und in seiner dem Bericht beiliegenden petrographischen Karte
ist an
betreffender Position auch kein „Grünsteinlager“ eingezeichnet, lediglich
nördlich des Strobelberges, „am linken Gehänge des Kuhnersbach, etwa ¼
Stündchen oberhalb Rittersgrün“ ist ein Engelsburg Stolln vermerkt,
welcher zu seiner Zeit gerade „nach einem schon früherhin bebaut werdenden
Braunsteingange gegen SO in das Gebirge“ getrieben wurde (Blatt 5 der Akte,
Rückseite des Blatts).
Dies ist zum einen ein Hinweis darauf, daß schon früher auch in dieser Region Bergbau umgegangen sein muß, zu anderen auch darauf, daß er bis in die 1820er Jahre brach gelegen hat ‒ sonst wären Herr Fischer und später Cotta wohl hier nicht „vorbei gefahren“. Es hilft uns bei der Suche nach den Ursprüngen des Bergbaus an der Burkhartsleithe freilich auch nicht weiter... Wer mag also dort schon alles „herumgeschürft“ haben und was erhoffte man zu finden? Eisen sicher, Silber vielleicht – wir können es nur vermuten, wissen werden wir es wohl nie genau.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
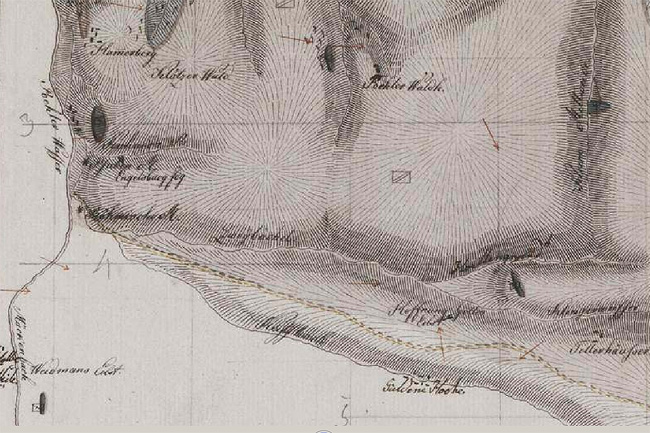 Petrographische Karte von der Gegend zwischen Groß Pöhla, Schlackenwerthe, Kloesterle und Bärenstein, entworfen im Jahre 1823 von Wilhelm Fischer, gezeichnet von Carl August Lange, Ausschnitt mit dem Tal des Zweibachs zwischen Tellerhäuser und der Böhmischen Mühle unterhalb des später Ehrenzipfel genannten Örtchens. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003, Nr. 78, Blatt 170, Ausschnitt, Norden ist rechts oben. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Neuanfänge
ab 1830 ‒
Viele Mutungen und mehr oder weniger ernsthafte Bergarbeiten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 31.7.1830
protokolliert Bergamts- Assessor Bernhard von Fromberg vor dem Bergamt
Scheibenberg eine Mutung des Christian Gottlieb Brügner aus
Oberrittersgrün über eine gevierte Fundgrube an der Burkertseithe und nennt sie
„Bürgners Hoffnung gevierte Fundgrube“ (40169, Nr.30).
Am 12.10.1839 wird ‒ nun vor dem Bergamt Annaberg ‒ betreffs „Regulirung der dasigen Eisensteintaxe“ protokolliert: „der daselbst brechende Magneteisenstein (ist) dem besten Brauneisenstein hiesiger Refier wenigstens gleich zu stellen, so wurde die Zehntentaxe ... vom Quartal Luciae an zur Förderung gelangenden Eisensteins auf 1 Thaler 11 Groschen pro Fuder bergamtlich regulirt.“ (40169, Nr.30) Es wurde also auf Eisenstein gebaut. Ein Fahrbogen der Gechworenen Schiefer und Haupt vom 8.10.1853 gibt Auskunft über das Erzlager: „...hat man in der Streckensohle einen 6 Zoll mächtigen aus Glimmerschiefer, und Rotheisenstein bestehenden Gang angefahren, welcher Std. 11 streicht und 35-40° in Abend fällt. Man ist bereits im Begriff, auf gedachtem Gang in beide Richtung auszulängen…“ (40169, Nr.30). Tatsächlich ist auch in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22, Blatt 31) diese Grube mit einem Ausbringen von 6 bis 33 Fudern Eisenstein im Jahr über den Zeitraum von 1830 bis 1850 aufgeführt. Schichtmeister Christian Gottlieb Schubert beantragt 1855 im Auftrag Brügner's eine Flächennutzung im fiskalischen Wald behufs Errichtung eines Pochwerkes „...und zwar auf dem daselbst befindlichen, alten Pochwerksplatze… zur Aufbereitung der zu gewinnenden Zinnerze“. Zwei interessante Mitteilungen: Es befand sich also hier schon früher einmal ein Pochwerk und wir haben nun Zinnerz anzubieten! Hier wurde also tatsächlich ein Wertstoff gefördert, was gar nicht so selbstverständlich ist, wie im Weiteren noch deutlich wird. Auf das Jahr 1856 heißt es: „... Ausbringen 75 Fuder Pochgänge, daraus 12 Centner Schlich und daraus 4 ⅞ Centner Zinn. Bezahlung 200 Thl 6 Gr.“ (40169, Nr.30). Diese Blütezeit war aber von kurzer Dauer. Am 3.9.1858 sagt Schichtmeister Schubert im Auftrag Brügner's die Grube los, sie fällt wieder ins Freie. In den Folgejahren erfolgt noch ein umfangreicher Schriftwechsel wegen noch ausstehender Gebühren (ist immer gut!) und wegen unerledigter Sicherungsarbeiten. Über das weitere Schicksal der Grube folgt später Näheres.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem die Fundgrube
Brügners Hoffnung 1858 ins Freie gefallen war, gab es eine neue Verleihung
unter dem alten Grubennamen an einen „Herrn Advocat Weiske von hier“ am
18.12.1858. Am selben Tag erfolgte sogleich der Weiterverkauf an den Apotheker
Johann Gottlob Schobert aus Neustädtel. Der hatte bestimmt ganz viel
Ahnung vom Bergbau und wohnte – damals noch mit der Postkutsche – fast eine
Tagesreise weit weg… Machen tut er nichts, die Grube steht in Fristen. Am
30.3.1861 zeigt Schobert dann aber dem Bergamt an, „daß er das
Berggebäude dem Bergfreien anheim gebe“ (40169, Nr.30). Es gibt noch als eine
Art Schlussregister eine
Jahresanzeige auf das Jahr 1860 vom Schobert selber aufgesetzt, der sich hier „Schichtmeisterdienstversorger“ nennt, aber natürlich alles „Vacat“. Nach einigem Hin und Her wegen der Verwahrung endet die Akte zu Brügners Hoffnung mit einem Schlußbefahrungs- Bericht vom Bergegeschworenen Tröger im Jahr 1861: „Allein, da Herr Schobert versicherte, daß er Arbeiter dahin gesendet mit der Weisung, die Schächte auszustürzen, so liegt wohl kein Grund vor, an dieser Angabe zu zweifeln… Sollten aber auch später… Brüche entstehen, so bleibt Herr Schobert ja immer verantwortlich, so lange … die Grube nicht in anderen Besitz übergeht.“ (40169, Nr. 30). Na dann… Hat der Tröger den ersten Satz jetzt wirklich ernst gemeint oder war das pure Ironie? Hiermit endet die Akte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In östlicher
Nachbarschaft von Brügners gevierte Fundgrube lag das Feld von
Eisensumpf Stolln & Fundgrube. Die Mutungsbestätigung erging am 27.9.1837 an
Johann Friedrich Lang aus Oberrittersgrün, protokolliert vom Bergamts-
Assessor Friedrich Wilhelm Lange (40169, Nr. 67). Die Mutung umfaßte einen Stolln und eine Fundgrube auf dem mit dem Stolln überfahrenen Eisenstein- Lager.
Ausweislich der Erzlieferungsextrakte (40166, Nr. 22, Blatt 36) wurden im
Quartal Luciae 1837 auf Eisensumpf Fdgr. und Stolln 13 Fuder Eisenstein
Eisenstein gefördert. Weitere Fördermengenangaben gibt es freilich nicht.
Eine Neumutung erfolgte bereits am 8.7.1841 durch Carl Gottlob Flemming aus Rittersgrün, diesmal als Eisensumpf gevierte Fundgrube. Diesem muß die Angabe in den Erzlieferungsextrakten an oben schon genannter Stelle zuzordnen sein, daß im Quartal Crucis 1841 wieder 28 Fuder 3 Tonnen Eisenstein ausgebracht worden seien. Auch jetzt gibt es nur diese eine Angabe ‒ das Ausbringen hielt offenbar nicht an. Die nächste Mutung erfolgte am 29.10.1842 durch Carl Heinrich Härtel aus Rittersgrün, diesmal wieder den Stolln betreffend und „...eine gevierte Fundgrube nebst zwei oberen Maßen auf dem mit dem Stolln bei 13,5 Lachter vom Mundloche überfahrenen, Stunde 5 streichenden, und 20 Grad in Mittag fallenden, Blende und Kupfererze führenden Lager“ (40169, Nr. 67). Auch dazu findet sich genau eine Fördermengenangabe in Höhe von 3 Fudern Eisenstein aus dem Quartal Crucis 1842. Offenkundig wiederholte sich die Geschichte... Außerdem gibt es noch eine Nennung von 2 Fudern, 2 ½ Tonnen Eisensteinausbringen im Quartal Luciae 1842 in den Erzlieferungsextrakten unter der allerdings wenig hilfreichen Benennung „Burkhartsleithe bei Rittersgrün“. Welcher der Gruben diese Angabe zugeordnet werden muß, werden wir kaum herausbekommen können. Der rasche Besitzerwechsel deutet auf wenig Ausdauer und Zuversicht hin, und schon am 4.11.1843 wagt der Nächste sein Glück: Bäckermeister (Aha!) Christoph Heinrich Lein aus Oberrittersgrün mutet erneut! In einem Fahrbericht des Geschworenen Schiefer vom 28.11.1843 berichtet dieser eigentlich recht zuversichtlich über die mit 3 Mann belegte Grube. Er schreibt unter anderem, man habe „...einen Stunde 10 streichenden, einige 60 Grad in Abend fallenden, 4 bis 6 Zoll mächtigen Gang durchfahren, in welchem ... Nester mit derbem Buntkupferkies und Kupferglas sich zeigen“ (40169, Nr. 67), und man solle sich wegen des hohen Kupfergehaltes der Erzproben (schwer leserlich: 43 Pfund im Centner?!) zunächst diesem widmen. Nichtsdestotrotz sagte auch Lein die Grube am 30.3.1844 wieder los. Doch der Nächste steht schon bereit: Am 25.9.1844 wird Johann Gottlieb Tauchmann aus Rittersgrün der Stolln und eine Fundgrube auf dem überfahrenen Lager verliehen; sowie am 1.4.1846 eine weitere Fundgrube „...auf einem bei 8 Lachter Entfernung vom Mundloche überfahrenen, Stunde 10,6 streichenden und 80 Grad in Abend fallenden, flachen Gang“ (40169, Nr. 67) unter dem Namen Tauchmann Fundgrube & Maßen. Dieser Gang dürfte der später von Wismut als Gang 111 bezeichnete uranerzführende Gang sein. Auch Tauchmann hat keine Ausdauer, er sagt die Grube am 11.11.1846 wieder los. Weiter geht`s danach mit dem Schuhmachermeister (Aha!) Gottlieb Heinrich Tauchmann aus Scheibenberg (ob das die liebe Verwandtschaft ist??); dieser mutet am 10.11.1847 erneut. Und er läßt auch arbeiten, so wird der Gang (Tauchmann Flacher) mit 2 Arbeitern immerhin auf 18,3 Lachter erlängt. Der „Kupferreichtum“ scheint aber von kurzer Dauer gewesen zu sein, denn am 24 1.1849 sagt auch dieser Besitzer die Grube wieder los. Nochmals erfolgt ein Neuverleihung (ohne Datum) an den Steiger Gottlob Heinrich Schulz aus Breitenbrunn. Gemacht hat der wohl auch nicht viel, in den folgenden Jahren heißt es nur wieder, die Grube hat nicht in Betrieb gestanden. Eine etwas kuriose Angelegenheit ist die Besitznahme der Grube durch den Zwickauer Fabrikanten Fikentscher. Dieser erwarb selbige am 13.8.1853. Das Bergamt bekam davon aber erst viel später etwas mit. In einem Schreiben der Königlichen Berginspektion in Schwarzenberg an das Bergamt Marienberg vom 11.12.1859 steht dazu Folgendes: „Wie sich erst jetzt herausgestellt hat...“, gehöre die Eisensumpf Fundgrube inzwischen dem Herrn Fikentscher aus Zwickau. Wenn er das Grubengebäude verkauft hat, hat der Vorbesitzer Schulz uns das doch aber gar nicht angezeigt! Man bitte um Prüfung der Angelegenheit… Die Prüfung ergab letztenendes, daß die Verleihung an Fikentscher nun doch nachträglich am 13.8.1853 erfolgte, er aber seitdem noch nichts unternommen habe. Er solle „...binnen 4 Wochen“ den Betrieb aufzunehmen und einen Betriebsplan für die Folgejahre 1861-1863 einreichen. Der zuständige Schichtmeister E. Cloether schickt daraufhin – wohl im Auftrage Fikentscher's – ein Schreiben an das Bergamt mit der Bitte um Auskunft, „...welcher der Stolln sei.“ Der Besitzer hatte offensichtlich keine Ahnung, was er besitzt! Antwort des Bergamtes an Cloether: Er solle sich an den Verkäufer wenden, der müsse ihm doch den ihm zuvor verliehenen Stolln genau bezeichnen können. Heißt wohl, wir im Bergamt haben auch keine Ahnung. Letztlich geschieht aber nichts und am 25.7.1861 fällt die Fundgrube wieder ins Freie (40169, Nr. 67). Friedrich Christian
Fikentscher ist uns eigentlich als Tonwarenfabrikant und Ziegeleibesitzer
aus Zwickau bekannt und schon
Fikentscher war aber daneben auch bei Häckers Fundgrube involviert. Dieser Grubenname geht eventuell auf den Bergmann Heinrich Häcker zurück, der sie ursprünglich als Eigenlehner unter dem Namen „Häckers gevierte Fundgrube und Maßen“ gemutet hatte und auch später noch selbst hier angelegt war. Dies muß vor 1853 gewesen sein, da die Akte der Häcker Fundgrube mit der Verleihung am 15.10.1853 an Gottlob Heinrich Schulz aus Breitenbrunn beginnt. Unter dem Grubennamen Häcker Stolln und gevierte Fundgrube bei Rittersgrün ist in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22, Blatt 60) für die Quartale Crucis und Luciae 1850 tatsächlich ein Ausbringen von 25 bzw. 15 Fudern Eisenstein ausgewiesen und wieder ist dies die einzige Eintragung. Wohl aus Mangel an Betriebskapital wurde die Grube 1855 an den Fabrikanten Fikentscher verkauft. Laut den Rechenschaftsberichten 1856 bis 1858 war die Grube mit 4-6 Mann belegt und man erlängt hauptsächlich den Stolln. Ein Erzlager konnte nicht angefahren werden. Auch mehreren angelegten Schurfschächtlein im vermutetem Lagerausbiß war kein Erfolg beschieden. Von diesen Schächtlein wissen wir nur, da bei Nachbefahrungen die offenstehenden Grubenbaue bemängelt wurden. Am 23.10.1861 fällt das Grubenfeld ins Freie (40169, Nr.148).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Bereich des heutigen
Oberen Eisensumpf Stolln mutete Friedrich Härtel aus Rittersgrün
eine Fundgrube, die Mutungsbestätigung erfolgte am 18.4.1840 durch den
Bergschreiber Friedrich Wilhelm Lange vom Bergamt Annaberg. Protokolliert
wird „...eine gevierte Fundgrube... in 20 Lachter östlicher Entfernung von
Eisensumpf Fundgrube“ auf ein „bei 4 Lachter untertage entblößtes, 20° in
Südost fallendes Magneteisensteinlager unter dem Namen Gelbe Halde gevierte
Fundgrube“.
Zur „Gelbe Halde gevierte Fundgrube an der Burkhardtsleite im Ehrenzipfel bei Rittersgrün“ existiert eine Grubenakte, nach der jedoch nur auf einen sehr kurzen Betriebszeitraum um 1840 zu schließen ist (40169, Nr. 107). In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22) ist sie auch nur einmalig im Quartal Trinitatis 1840 mit einer ausgebrachten Menge von 27 Fudern Eisenstein aufgeführt. Härtel scheint aber auch nicht viel gemacht zu haben, denn schon am 1.8.1840 wurde nach Lossagung das Grubenfeld aus den Büchern gelöscht (40169, Nr.107).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
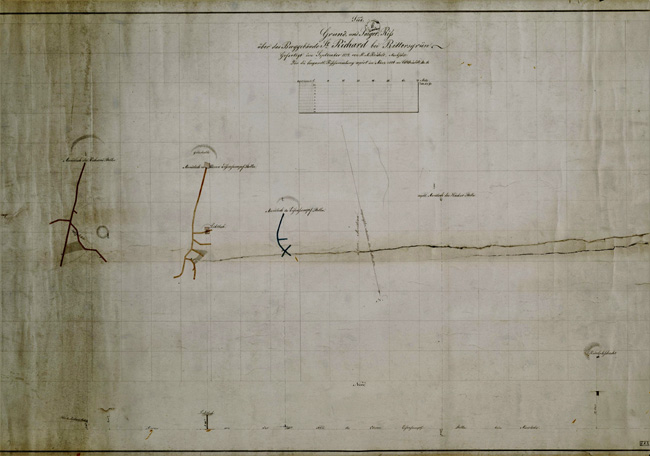 Grund- und Saigerriß über das Berggebäude St. Richard Rittersgrün, gefertigt im September 1874 von H. M. Reichelt, Markscheider, für die bergamtliche Rißsammlung copirt im März 1876 von W. Weinhold, Markscheiderassistent. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040, Nr. K8396, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß unten. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
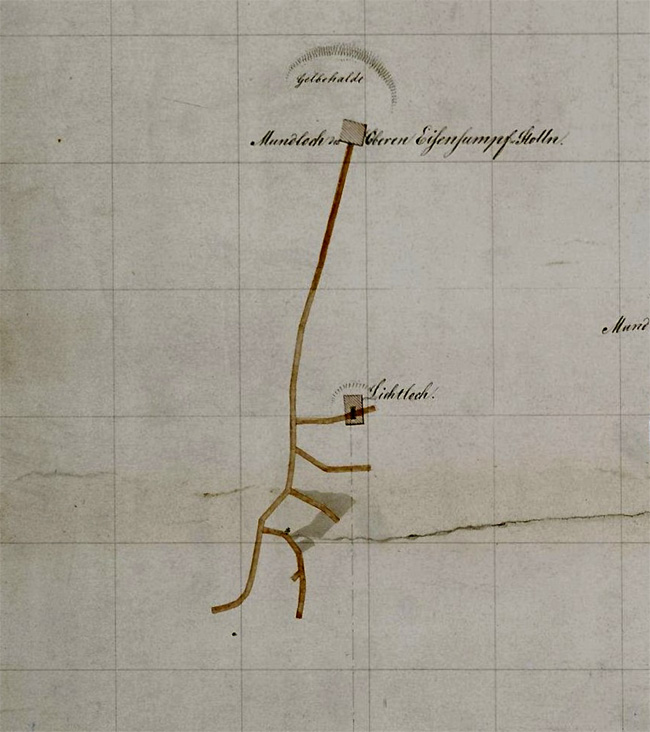 Ausschnitt aus obigem Riß mit dem Grundriß des Oberen Eisensumpf Stollns, Norden ist unten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
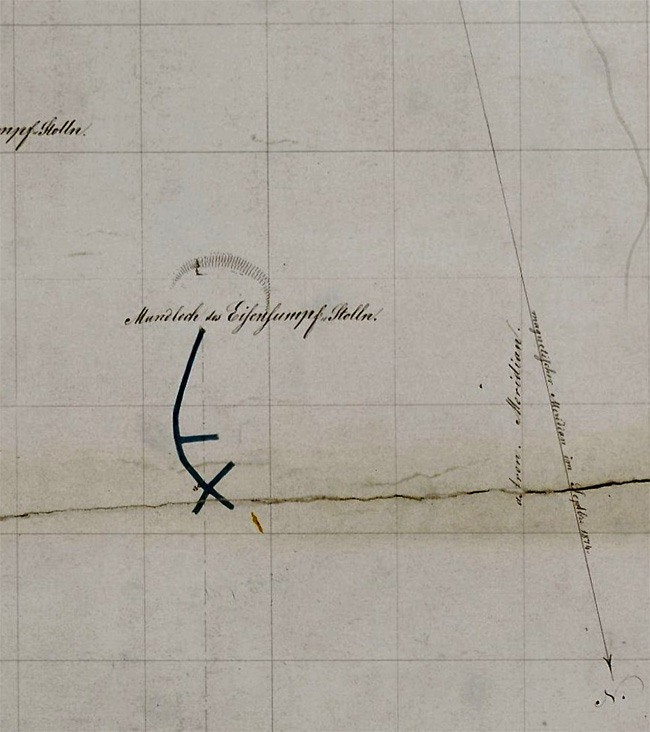 Ausschnitt aus obigem Riß mit dem Grundriß des Eisensumpf Stollns, Norden ist unten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Schreiber'schen
Bergbauunternehmungen ab 1853
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir sind uns nicht so
richtig sicher, ob die Grubenbezeichnung „Sankt Richard“, die sich in der
Literatur eingebürgert hat, wirklich zutreffend ist. Heilige mit diesem
Namen gibt es nämlich nur in der anglikanischen Kirche (Richard von
Chichester und Richard von Wessex). Die Seligsprechung des deutschen
Pallottinerpaters Richard Henkes erfolgte erst 2019 ‒ dieser kommt
folglich als Namenspatron für den Grubennamen nicht infrage (wikipedia.de).
Vielleicht geht er deshalb einfach nur auf ein missverständliches Kürzel für „Stolln Richard“ zurück. Viel wahrscheinlicher erscheint es uns, daß der Name der Grube auf deren Besitzer in den 1850er Jahren, den Bankier Richard Schreiber aus Breslau / Wroclaw in der heutigen Republik Polen (40169, Nr. 170), zurückgeht. Ursprünglich fehlte nämlich das ,St.´ davor auch auf dem Aktentitel und wir haben bislang keine Ahnung, wie es später dahin gekommen ist, denn der Bankier Richard Schreiber wurde sicherlich nie selig gesprochen. Eine weitere, fast namensgleiche Richard Fundgrube, jedoch „am Hirtenberg bei Breitenbrunn“ gelegen, war schon ab 1854 im Besitz desselben Bankiers Richard Schreiber aus Breslau / Wroclaw. Aus Akten zu allgemeinen Angelegenheiten (40171, Nr. 228) ist zu erfahren, daß besagter Herr Schreiber zwischen 1857 und 1861 neben oben schon genannter Richard Fundgrube auch noch die Christoph Hoffnung bei Breitenbrunn, sowie eine zweite Grube namens Richard und die Gruben Katharina und Johannes „zu Rittersgrün“ in seinem Besitz hatte. Außerdem taucht der Name Richard Schreiber auch in Grubenakten von Zweigler Fundgrube bei Wildenau (40169, Nr. 355), von Wolfgang Stolln am Henneberg bei Schwarzenberg (40169, Nr.362) sowie der Herkules Fundgrube samt Frisch Glück und Khiesels Hoffnung Stolln in Waschleithe (40169, Nr.161) auf. Herr Schreiber war offensichtlich recht gut situiert, denn sonst hätte er nicht mit so vielen Gruben gleichzeitig spekulieren können ‒ viel mehr als das war es nämlich tatsächlich nicht: Für die Schreiber'schen Gruben bei Breitenbrunn ist 1876 ein Ausbringen von immerhin 1 Zentner, im Folgejahr von 6 Zentnern und 1878 nochmals von 2 Zentnern Zinkblende in den Jahrbüchern vermerkt. Das war´s aber auch...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Richard Fundgrube
im Ehrenzipfel jedenfalls wurde 1853 mit 10 unteren und 10 oberen Maßen an ihn
verliehen, 1854 wurden noch 45 obere Maßen hinzu verliehen, 1856 kamen noch die 56
bis 75. Maß dazu!
Im Betriebsbericht von 1855 ist von einem Stolln zum Anna Schacht die Rede, ebenso 1856: „...Das bei 11 Ltr. vom Mundloch des Anna Stollns angehauene Streichort wurde 5 Ltr. fortgebracht.“ „...Der zum Anna Schacht führende Stolln wurde wiederum 10 ½ Ltr. in frischem Gestein fortgebracht…hat nun Gesamtlänge von 30 ½ Lachtern“. „Belegung 5 Mann, nämlich 1 Zimmerling, 1 Bergknecht, 3 Doppelhäuer.“ (40169, Nr. 281). Dieser aus dem Nichts auftauchende Anna Stolln, dessen Name auch bald wieder verschwindet, ist nach meinen Dafürhalten der jetzt als „Oberer Eisensumpf Stolln“ bekannte Grubenbau. In den Jahresberichten 1857 bis 1861 wird vom Vortrieb des St. Richard Stolln bis zu 40,3 Lachter berichtet, ebenso von Flügelörtern auf dem Lager und dem Ausringen von Lagermasse. Bei 50 Lachtern vom Mundloch des Richardstolln in Nord trifft ein Schurfschacht in 3 Lachtern Tiefe auf das Lager. Dieser Schacht ist der bei den jetzigen Sanierungsarbeiten verwahrte 2. Tagebruch. Zum Schreiber´chen Besitz gehörte auch die Katharina gevierte Fundgrube „am Bärskamm zwischen Rittersgrün und Mittweida“, Schreiber sagte diese aber schon 1859 wieder los (40169, Nr. 40), während die Grubenfelder von Richard und Johannes 1861 auf sein Betreiben konsolidiert wurden (40169, Nr. 281 und 170 sowie 40040, Nr. K8393). Das Grubenfeld St. Johannes Fundgrube besaß Schreiber bereits seit dem 5.7.1953. Es stand jedoch immer in Fristen. Nach einer leider undatierten und nur abgezeichneten Croquis (40040, Nr. B7764) umfaßte das Grubenfeld von Richard Fundgrube ursprünglich 67.816 Quadratlachter oder 67 Maßeinheiten. 1857 wurden „zum Besten von St. Richard Fundgrube“ weitere 20.930 Quadratlachter hinzugemutet, wonach es nun auf insgesamt 88.746 Quadratlachter oder 89 Maßeinheiten angewachsen war. Ab 1861 kam dann noch das Feld von Johannes Fundgrube nach der Konsolidierung mit 16.856 Quadratlachtern oder 17 Maßeinheiten hinzu. Als eine der letzten hier im Revier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch (mehr oder weniger) in Betrieb stehenden Gruben sind in den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen auch zur Richard Fundgrube im (zu Rittergrün gehörenden und im „Großpöhlaer Forst“ gelegenen) Ehrenzipfel durchgängig bis zur Lossagung Angaben zu den Betriebsverhältnissen zu finden. Als die Grube 1868 erstmals in dieser Quelle aufgeführt wurde, hatte R. Schreiber als Aufsichtsbeamte Carl Wilhelm Anton Heyn als Schichtmeister, Hermann Gustav Poller als bevollmächtigten Vertreter, beide aus Johanngeorgenstadt, und den Steiger Johann Dürnbach aus Joachimsthal benannt. Die Belegung der Grube selbst wurde jedoch nur mit einem Mann (!!) angegeben. Das Folgejahr 1869 war vermutlich das letzte mit nennenswerten bergmännischen Aktivitäten: Auf dieses Jahr waren hier 10 Mann angelegt. Dennoch ist in den Jahrbüchern kein Ausbringen verzeichnet, dagegen 933 Thaler Zubußen. In den Folgejahren blieb die Grube nur mit 1 bis höchstens noch einmal 4 Mann (1872) oder meist gänzlich unbelegt. 1871 übernahm A. F. Jakob die Steigerfunktion, sonst änderte sich nicht viel. 1872, nach Schreiber's Tod, wurde Poller Bevollmächtigter der Erben. 1873 bildeten die Eigner bereits eine „Gesellschaft“, diese bildeten die Erben 1875 in eine „Gewerkschaft mit bestätigten Statuten“ um. Herr Poller wurde Grubenvorstand. Ab 1879 lag die Grube in Fristen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
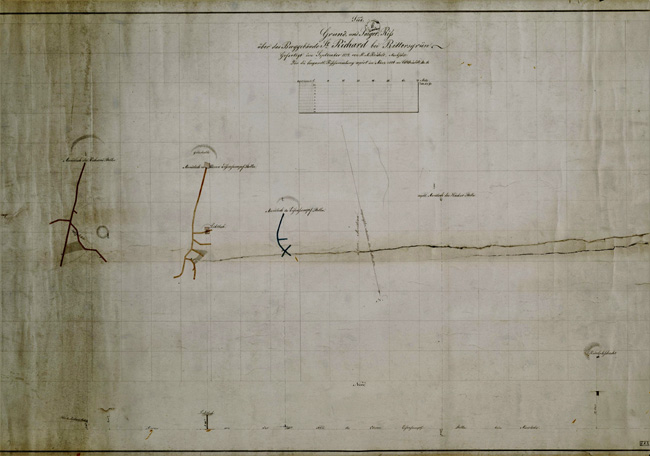 Grund- und Saigerriß über das Berggebäude St. Richard Rittersgrün, gefertigt im September 1874 von H. M. Reichelt, Markscheider, für die bergamtliche Rißsammlung copirt im März 1876 von W. Weinhold, Markscheiderassistent. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040, Nr. K8396, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß unten. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
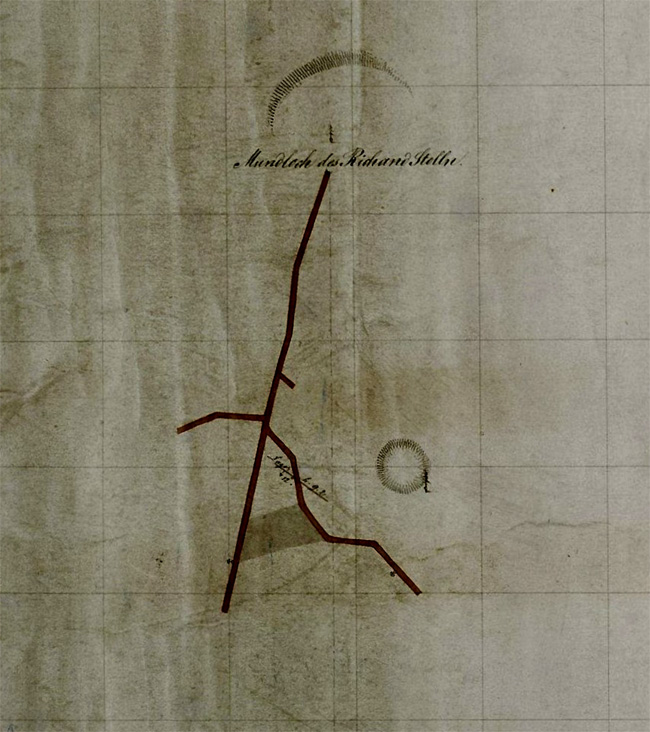 Ausschnitt aus obigem Riß mit dem Grundriß des Richard Stollns, Norden ist unten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danach wurde sie zunächst
an einen Hütteninspektor Gustav Schneider aus Gleiwitz und dann an den
Kaufmann Alexander Petzoldt aus Breslau verkauft. Beide besaßen die Grube
wohl nur kurze Zeit, denn die Namen schafften es nicht bis in die statistische
Übersicht der Jahrbücher. A. Petzold ist 1884 verstorben. In der Folge
sollte eine Zwangsversteigerung des „als wertlos erachteten Bergbaurechts“
erfolgen. Zunächst aber blieb der Besitz noch bei der Witwe Christiane
Petzold (40169, Nr. 1510).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spekulationsobjekte (1870 bis 1933)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nicht uninteressant ist, daß der schon erwähnte, weiter westlich liegende Rudolfschacht unter dem Namen „Rudolph Fundgrube bei Großpöhla“ schon zuvor ebenfalls im Besitz schlesischer Kaufleute, zunächst nämlich des oben genannten Kaufmanns Alexander Petzold aus Waldenburg / Wałbrzych gewesen ist. Die Fundgrube wurde dem Besitzer am 7.10.1869 mit 95.974 Quadratlachtern Grubenfeld verliehen. Derselbe hatte sogar dieselben Aufsichtsbeamten (H. G. Poller sen. und Steiger Jakob) angestellt, um den ‒ eigentlich ja gar nicht umgehenden ‒ Grubenbetrieb zu beaufsichtigen (40169, Nr. 280 und Nr.1510). Bis zum Jahr 1933 (!!) erfolgen nun fortlaufend Anträge auf Fristhaltung mit immer neuen oder besser neuformulierten Begründungen. Eine davon möchten wir dem Leser nicht vorenthalten. Antrag vom H. G. Poller vom 12.12.1882: „Obgleich die fortgesetzten Bemühungen und Versuche für die zweckmäßige Ausbeutung der mit den vormals Schreiber’schen, jetzt gewerkschaftlichen Gruben, sowie mit den Herrn Petzold gehörigen Gruben… theils aufgeschlossenen und bekannten, Zinkblende führenden Grünsteinlagern, insbesondere wegen der erforderlichen Concentration der Blendeerze und deren Trennung von den beigemengten Eisen- und kiesigen Erzen, soweit gelungen zu sein scheinen, daß vielleicht schon mit dem nächsten Frühjahr der Betrieb einiger… Gruben aufgenommen werden kann, so erscheint es mit Rücksicht darauf, daß die Betriebsfrist der vorgenannten Gruben schon mit Schluß des Jahres 1882 zu Ende geht, ferner nicht ausgeschlossen werden kann, daß neue unvorhergesehene Hindernisse der Betriebsaufnahme im Wege treten können, doch rathsam und wegen der ungeschmälerten Erhaltung der mit großen Geldposten erworbenen Abbau- Grund- und Wasserrechte unerläßlich, um eine weitere Betriebsfrist gehorsamst nachzusuchen.“ Kleine Anmerkung hierzu: Das ist 1 Satz, in Worten: Einer! Und da sind schon unwichtige Nebensätze durch „....“ ersetzt. Wahrscheinlich hätten sogar heutige Deutschlehrer ihre Mühe mit der Syntax. Der Schriftverkehr entsprach aber damaligen Gewohnheiten und verwirrte vielleicht auch den Gegenüber. Nun, auch im Bergamt wird man sich am Hinterkopf gekratzt haben… Nach Petzold's Tod 1884 hielt jedenfalls auch die Witwe Christiane Petzold die Grube weiterhin in Fristen. Ab 1893 war E. J. Fröbe ihr Bevollmächtigter vor Ort. Auch der Sohn K. Petzold, nach der Angabe im Jahrbuch „Fabrikant in Erdmannsdorf / Mysłakowice in Niederschlesien“, führte dies so weiter fort. 1933 zieht man schließlich im Bergamt ‒ vielleicht auch in Zusammenhang mit aufkommenden staatlichen Interessen ‒ einen Schlusstrich und entzieht das Bergbaurecht (40169, Nr. 280).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
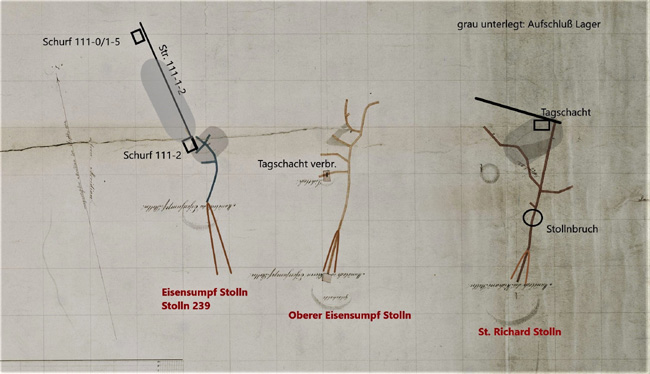 Der Grundriß von oben, um 180° gedreht, so daß Norden oben ist, wie wir das von huetigen Kartenwerken gewohnt sind, mit der Eintragung (grau hervorgehoben) angefahrener Abschnitte des Skarnlagers; rechts der Richard Stolln.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommen wir nochmals auf
die St. Richard Fundgrube zurück. 1891 erwarb A. Wiester, in den
statistischen Angaben als Bergwerksbesitzer bezeichnet und auch er aus
Breslau, die Richard Fundgrube, was ihm bergamtlicherseits im 4. Quartal
1891 auch durch eine förmliche Verleihung bestätigt worden ist. Herr Poller
blieb als Aufsicht zuständig, getan hat sich aber ‒ außer einigen
Instandhaltungsarbeiten, für die im Jahr 1892 zum Beispiel 416,- Mark Zubuße
aufzubringen waren ‒ sonst nichts.
Nur wenige Jahre später verstarb aber auch A. Wiester. Die Erben gaben das Bergbaurecht jedoch nicht auf und zahlten treu und brav jedes Jahr ihre Gebühren für die Verlängerung der Fristhaltung. Erst 1901 verkaufte Dr. jur. Rudolph Wiester aus Neudeck / Świerklaniec (wahrscheinlich dieser heute polnische Ort, denn Neudeck gibt es mehrfach, aber dieses liegt näher bei Breslau) dann die Grube an einen Dr. jur. Gustav Linnartz, der in den Jahrbüchern als Bergwerksbesitzer in Jouy aux Arches bei Metz (Lothringen) aufgeführt ist. Anstelle des Herrn H. G. Poller sen. wird als Bevollmächtigter ab 1902 der Bergverwalter E. R. Poller aus Johanngeorgenstadt ‒ wahrscheinlich der Sohn des Vorgängers ‒ angeführt. Auch dadurch änderte sich jedoch nichts. Obwohl die Grubenfeldsteuern erlassen waren, fand ein ernsthafter Grubenbetrieb offenbar nicht mehr statt. Dennoch hielt auch der neue Besitzer die Grube weiter in Fristen und spekulierte wohl auf wieder steigenden Bedarf an Eisen- und Zinkerzen. Erst nach dem Ende des 1. Weltkrieges, im Jahr 1922, sagte sein Sohn Walther Linnartz die Grube los. Ab 1923 wurde keine der vorgenannten Gruben bei Ehrenzipfel mehr in den Bergwerksverzeichnissen aufgeführt. Jedoch erfolgte nach der betreffenden Grubenakte (40169, Nr.1510) die endgültige Lossagung des Abbaurechtes für die Richard Fundgrube erst durch die nach 1926 gegründete Gesellschaft Pretzschner & Fritzsching, Erzbergwerke und Chemische Werke Aktiengesellschaft in Dresden und Spatwerke und Erdfarbenindustrie Aktiengesellschaft, mit Sitz in Dresden (11045, Nr. 1371). Diese Gesellschaft besaß ursprünglich eine Chemische Fabrik in Großenhain (11056, Nr. 0533), die nach dem 1. Weltkrieg aber nur noch eine Niederlassung im Unternehmen bildete (11056, Nr. 0716). Danach versuchte sie an vielen Stellen, u. a. auch im Freiberger Revier, an auflässige Bergwerke zu kommen. Offenbar war dies auch hier in Ehrenzipfel zwischen 1923 und 1929 noch einmal der Fall.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anhand der statistischen Angaben in den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen kann ab der 2. Hälfte des 19.Jahrhunderts und noch bis in das 20. Jahrhundert hinein die betriebliche Entwicklung gut verfolgt werden. Mit dem Jahrbuch von 1922 enden die betriebswirtschaftlichen Eintragungen in den Jahrbüchern. In diesem Zeitraum von 53 Jahren wurde kein einziges Kilogramm Erz ausgebracht, mithin keinerlei Gewinn erwirtschaftet. Aktive Bergarbeiten erfolgten nur während 6 Jahren bei kleinster Belegung, ansonsten standen die Bergwerke fast durchgehend in Fristen. Rechnet man die Angaben in den Jahrbüchern zusammen, wurden in diesem Zeitraum Zubußzahlungen von beträchtlichen 1.629 Thalern und (ab 1873) nochmals 9.303 Mark investiert, schließt man die letzten Jahre ohne betriebliche Angaben in den Jahrbüchern mit ein, waren es wohl weit über 10.000 Mark! Das war in den damaligen Zeiten ein beträchtlicher Wert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
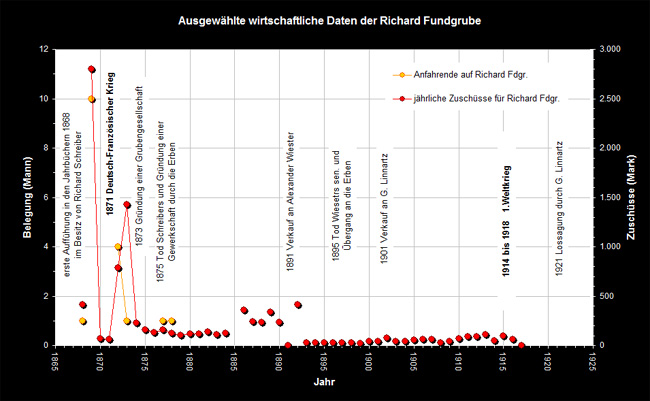 Wir haben die in den Jahrbüchern überlieferten Daten einmal graphisch aufbereitet. Die Grube war ganz offensichtlich eine reine Zubußzeche und für die wechselnden Besitzer eher kein gutes Geschäft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
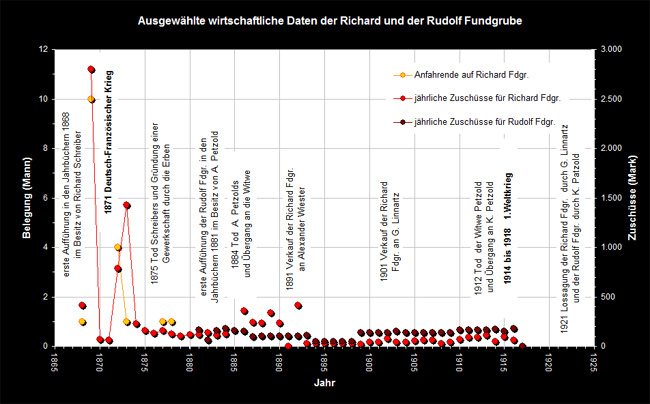 Die Grafik von oben nehmen wir noch einmal zur Grundlage und legen einmal die in den Jahrbüchern ausgewiesenen Zubußzahlungen für die Rudolf Fundgrube darüber. Wie man sieht, war die Grube unter den Besitzern ab 1881 ebenfalls nie belegt und außer zu entrichtenden Bergamtsgebühren für die wiederholte Genehmigung der Fristsetzung ist auch hier kein Umsatz bekannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ähnlichkeiten der
Abläufe verblüffen. Besonders interessant aber ist hier der Familienname
Petzold, denn dieser ist uns auch schon bei Recherchen anderenorts begegnet.
Alexander Petzold war ab 1869 nämlich auch Eigner der Gelbe Birke
Fundgrube bei Schwarzenberg (40169, Nr. 925), später noch der Fridolin
Fundgrube bei Pöhla (40169, Nr. 91) und mutete den Konrad Stolln bei
Buchholz (40169, Nr. 344).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber ganz Schluß war
immer noch nicht: 1921 mutete ein Markus Schneider aus Chemnitz nämlich
erneut eine „Markus Fundgrube im Staatsforstrevier Großpöhla bei Ehrenzipfel.“
In der diesbezüglichen Akte des Bergreviers Schwarzenberg heißt es dazu, daß „der
86jährige Grubenbesitzer und sein Sohn“ einen „alten Stolln“
auszuräumen und ein Pochwerk zu errichten beabsichtigten. Welchen der Stolln im
Revier die beiden wieder aufzunehmen gedachten, geht daraus leider nicht hervor
(40169, Nr.1200). Einer Verleihkarte aus den 1920er Jahren
zufolge (40044-7, Nr. I789) lag der besagte Stolln aber im Tal des
Kunnersbachs nördlich des
Strobelberges und näher bei Rittersgrün.
In einem Befahrungsnachweis zur Markus Fundgrube vom 7.4.1922 ist lediglich vermerkt: „kein Betrieb...“ Am 17.11.1923 wird das Bergbaurecht entzogen. Unter den Anfang der 1920er Jahre bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen war diesem Unternehmen natürlich auch nicht gerade das Glück in die Wiege gelegt. Außerdem machte nun auch der Staatsfiskus eigene Interessen geltend, womit wir zum nächsten Kapitel kommen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die staatlichen Baufelder ab 1923
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem diese letzten
bergbaulichen Aktivitäten im Raum Ehrenzipfel ihr Ende gefunden hatten, trat nun
das Land Sachsen selbst an die Stelle der früheren privaten Investoren. In einem
Schreiben des Finanzministeriums in Vertretung des Freistaats Sachsen vom
12.07.1923 (40024-10, Nr. 537) an das Oberbergamt behufs Mutung des Feldes „Johanngeorgenstadt-
Rittersgrün Vereinigt Feld“ auf alle verleihbaren metallischen Mineralien
heißt es u. a.: „Zum Nachweise des Vorhandenseins metallischer Mineralien in
den Grubenfeldern bezieht sich das Finanzministerium darauf, daß in sämtlichen
Feldern früher Bergbau umgegangen ist; das Vorhandensein ist daher offenkundig...“
Der sächsische Staat befaßte sich schon 1923 nicht mehr mit „Kleinkram“: Allein das Grubenfeld von „Johanngeorgenstadt- Rittersgrün Vereinigt Feld“ beinhaltete beträchtliche 1.804 ha, 97 ar, 4 m², was 4.513 Maßeinheiten entsprach! Wenn schon, denn schon... Man spricht hier von mehreren „Grubenfeldern“, da neben dem uns hier interessierenden Feld in der Folgezeit noch eine Vielzahl weiterer Bewilligungen im gesamten Erzgebirge zugunsten des sächsischen Staates erteilt wurden. Die südöstlich am Kaffberg gelegene Fuchsloch- Fundgrube etwa, die unter ihrem letzten Besitzer, übrigens auch hier wieder dem Herrn Walther Linnartz, in den 1920er Jahren noch mit der Richard Fundgrube konsolidiert worden ist, war aus dem Feld von „Johanngeorgenstadt- Rittersgrün Vereinigt Feld“ ursprünglich noch ausgegrenzt, gelangte aber nach ihrer Lossagung durch Linnartz am 14.7.1933 durch Neuverleihung vom 13.4.1934 ebenfalls in den Besitz des sächsischen Staates (40169, Nr. 89).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleich
nordöstlich an „Johanngeorgenstadt- Rittersgrün Vereinigt Feld“ angrenzend
wurde auf Antrag der Bergwirtschaftsstelle vom 27.7.1937 und „im Auftrag des
Reichsstatthalters in Sachsen, Ministerium für Wirtschaft und Arbeit“ dann
noch ein weiteres Abbaufeld unter dem Namen „Fichtelberg- West“ am
1.11.1937 bewilligt (40024-10, Nr. 288). Auch hier heißt es nur lapidar im
Antrag: „Das Vorhandensein wenigstens eines der gemuteten Mineralien ist beim
Oberbergamt offenkundig.“
Mit bergamtlich ermittelten 2.117 ha, 9 ar und 24 m² Fläche oder 5.293 Maßeinheiten war es noch größer, als die vorgenannten...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Übersichtskarte über die im Bergamtsbezirk Stollberg verliehenen Grubenfelder des Erzbergbaus nach dem Stande vom 1. April 1939, Ausschnitt. Die Bleistift- Nachtragungen beinhalten die Felder „Johanngeorgenstadt- Rittersgrün Vereinigt Feld“, „Fichtelberg- West“ sowie die noch bestehende „Fuchsloch Fundgrube“ samt der 1933 losgesagten Richard Fundgrube, inzwischen auch in staatlichem Besitz übergegangen. Die Markus Fundgrube war inzwischen erloschen. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044 (Generalrisse), Nr. B20658, Ausschnitt, Norden ist hier gewohntermaßen oben. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wirklich etwas geschehen ist allerdings auch in dieser Zeit hier nichts; sämtliche Bergbau- Berechtigungen wurden auch von staatlicher Seite stets nur in Fristen gehalten. Am 19.11.1925 fordert das Oberbergamt das Finanzministerium zur Betriebsaufnahme bei „Johanngeorgenstadt- Rittersgrün Vereinigt Feld“ auf. Dem daraufhin folgenden Antrag des Finanzministeriums auf Betriebsfrist wird am 21.12.1925 natürlich stattgegeben; erst einmal befristet bis 30.09.1928.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Unterlagen der
Staatlichen Lagerstättenforschungsstelle finden wir in einer Akte (40030,
Nr. 182) eine Zusammenstellung mehrerer Berichte über die Eisen- und Zinkerz-
Lagerstätten im Schwarzenberger Gebiet. Darin enthalten ist ein Bericht des
Bergverwalters Nitzsche von 1927: „Beschreibung der den Petzold`schen
Erben... gehörigen Grubenfelder...“, der jedoch lediglich ein Extrakt der uns
bekannten Aktenlage darstellt.
Desweiteren findet sich darin ein Bericht Richard Steppernacks, ebenfalls von 1927 und wie der Erstgenannte nur eine Zusammenfassung bekannter Sachverhalte. Der dritte Bericht dieser Akte reiht sich nahtlos ein: „Ergebnis der Untersuchung der uns in Option gegebenen Zinkerzfelder bei Schwarzenberg im Sächsischen Erzgebirge“ von O. Eisentraud aus dem Jahr 1928 ist eine Zusammenfassung allgemein bekannter Tatsachen. Eisentraud führt dazu noch eine Gegenüberstellung positiver und negativer Aspekte für eine Neuaufnahme des Bergbaus auf, wagt aber keine eindeutige Prognose. Interessant ist die Anlage dieses Berichtes, wo für die Fundgrube Unverhofft Glück an der Achte bei Antonsthal die Betriebsergebnisse der Jahre 1853 bis 1885 aufgelistet werden. Dabei halten sich Ausbeutezahlung (208.511 Mark) und Zubußen (209.696 Mark) fast die Waage. Unverhofft Glück war dabei noch eine der bedeutenden Gruben, einen unmittelbaren finanziellen Gewinn erwirtschaftete aber auch sie nicht. Die hier gewonnenen Rohstoffe trugen jedoch zur industriellen Entwicklung Sachsens bzw. Deutschlands bei und, was nicht zu unterschätzen ist, die Fundgrube gab Generationen von Bergleuten und Beschäftigten der nachfolgenden Gewerke Lohn und Brot. Leider geht aus den o. g. Mutungen und den daraufhin vom Bergamt erteilten Bewilligungen nun nicht hervor, welche der „verleihbaren metallischen Mineralien“ denn zukünftig hier eigentlich ausgebeutet werden sollten. Die bescheidenen und unter den neuen wirtschaftlichen Bedingungen kaum noch als bauwürdig einzuschätzenden Zinkerz- Vorkommen werden es doch wohl nicht mehr gewesen sein...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommen wir noch einmal
zum Inhalt der Akten zu den staatlichen Berechtigungen (40024-10, Nr. 537)
zurück. Über eine interessante Episode wird dort Folgendes berichtet: Am
2.4.1927 schreibt ein Ing. Georg Muziczka aus Fischern bei Karlsbad an
das Oberbergamt und beantragt die Genehmigung zur Untersuchung des südöstlichen,
gegenüber von Goldenhöhe / Zlatý Kopec gelegenen Teilfeldes: „Es besteht
nämlich die Absicht, von der böhmischen Seite aus Erzgänge, die dort zutage
treten, in ihrer östlichen Fortsetzung nach Sachsen zu, unter Verwendung
modernster geophysikalischer Schurfmethoden zu verfolgen und ihren Bestand
festzustellen…“
Muziczka weist sich dabei als Bevollmächtigter eines „Director“ Julius Weiser aus Wien und eines Herrn Karl Reichenbach in Berlin- Lankwitz aus. Das Oberbergamt sieht dies wohlwollend ‒ der Wert des Feldes könne schließlich infolge der Untersuchungen nur steigen ‒ und schlägt eine Verpachtung auf ein Jahr vor; diesem Vorschlag stimmt auch das sächsische Finanzministerium am 5.5.1927 zu. Muziczka nimmt auch tatsächlich Untersuchungsarbeiten auf, wie wir aus einem Schreiben von ihm an Weiser wissen: „Untersuchungen aufgenommen… durch 1 Geologen und 3 Spezialingenieure von der Firma Piepmeyer in Cassel“. Leider wird hier nichts über die Art der Untersuchungen und über deren Ergebnisse berichtet. Naheliegend könnten geomagnetische Untersuchungen zur Erkundung von Magnetitlagern gewesen sein. Oder wurden vielleicht schon Emanationsmessungen zum Aufsuchen radioaktiver Strukturen durchgeführt? Der Bezug auf die Erzgänge auf böhmischer Seite (Joachimsthal!) in der folgenden Übersichtskarte könnte ein Fingerzeig darauf sein...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
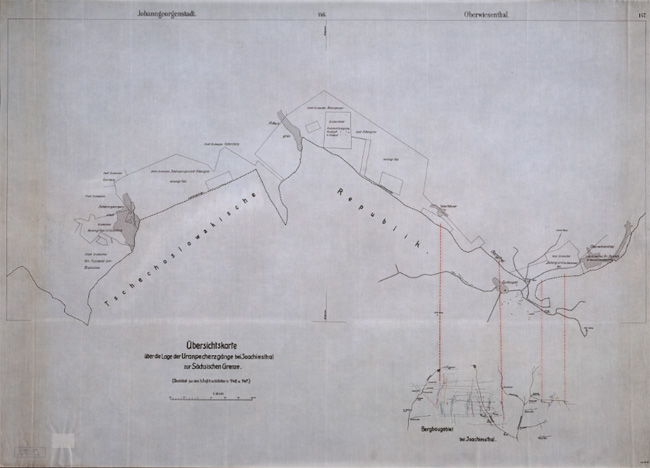 Übersichtskarte über die Lage der Uranpecherzgänge bei Joachimsthal zur Sächsischen Grenze, datiert auf den 20. Juli 1933. Links auf der Karte Johanngeorgenstadt, rechts Oberwiesenthal, südwestlich davon Gottesgab / Boží Dar und Joachimsthal / Jáchymov auf der tschechischen Seite der Grenze. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044 (Generalrisse), Nr. K19376, Gesamtansicht, Norden ist oben. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
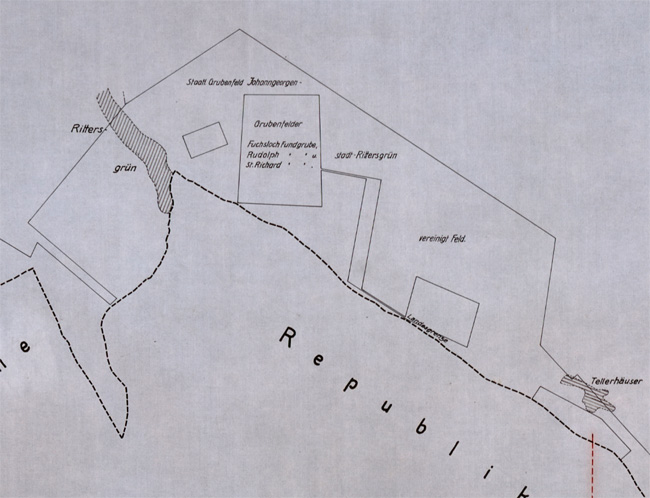 Noch einmal der Ausschnitt aus diesem Übersichtsriß mit den Grubenfeldern an der Grenze zwischen Rittersgrün und Tellerhäuser. Die zuletzt Petzold'schen Felder Rudolph und Richard Fundgrube waren zu diesem Zeitpunkt mit der südöstlich am Kaffberg liegenden Fuchsloch Fundgrube konsolidiert und von dem staatlichem Grubenfeld Johanngeorgenstadt- Rittersgrün vereinigt Feld komplett eingeschlossen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verhandlungen über die
angestrebte Erweiterung des Untersuchungsfeldes mit Muziczka kamen nicht
recht voran. Stattdessen stellte das Finanzministerium seinerseits am 31.8.1928
erneut Antrag auf Betriebsaussetzung ein, der auch bis zum 30.9.1930 genehmigt
worden ist.
Gleichzeitig erfolgte aber auch noch eine Nachmutung auf einen Feldesstreifen entlang der Staatsgrenze nach Südosten, womit sich das Grubenfeld um zusätzliche 94 ha, 22 ar, 46 m² auf nun gesamt 1.899 ha, 19 a, 50 m² = 4.748 Maßeinheiten vergrößerte. Vielleicht wollte man in Dresden ja sichergehen, daß die Pläne eines Abbaus von böhmischer Seite aus verhindert werden ? Danach enthält die Akte (40024-10, Nr. 537) nur noch fortlaufend Betriebsaussetzungs-Anträge, den letzten vom 1.9.1942 gleich über drei Jahre bis zum 30.9.1945. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem Ende des
unseligen Krieges blieben die Verwaltungsstrukturen auch des Bergbaues erst
einmal bestehen. Deswegen reicht der Akteninhalt noch ein Stück weit über das
Jahr 1945 hinaus:
Am 5.4.1948 wird der Eintrag des staatlichen Bergbaurechts im Grundbuch von Mittweida schon mal gelöscht. Am 23.7.1948 aber schreibt eine „Sonderabteilung“ bei der Verwaltung der Kohlenindustrie in Sachsen an das Oberbergamt in Freiberg, an den Revierausschuß des obergebirgischen Reviers, an die Technische Bergbauinspektion und an die betroffenen Landkreise, daß „aufgrund der SMAD- Befehle 128 und 131 das Bergbaurecht auf die UdSSR übertragen“ werde. Zugleich sollte ein neues Abbaufeld unter dem Namen „Mittelfeld“ beim Oberbergamt eingetragen werden, während das bisherige staatliche Baufeld „Johanngeorgenstadt- Rittersgrün Vereinigt Feld“ dagegen gelöscht werden könne. Mit den betreffenden Löschungseinträgen der Grundbuchämter schließt diese Akte und ein neues Kapitel beginnt, über das es in dieser Bergamtsakte freilich nichts mehr zu finden gibt... Die in diesem Schreiben genannten SMAD- Befehle Nr. 128 und Nr. 131 sind gar nicht so einfach in öffentlichen Archiven zu finden und selbst im Bundesarchiv sind die Befehle der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) heute eher ziemlich schlecht geordnet „ad acta“ gelegt (BArch, Bestand DX 1). Zudem kommt, daß es unter denselben Nummern mehrere Befehle aus verschiedenen Jahren und aus den einzelnen Länderverwaltungen der damaligen sowjetischen Besatzungszone gegeben hat. In der Chronik der Wismut ist hierzu festgehalten, daß die SMAD mit ihrem Befehl Nr. 128 vom 26. Mai 1947 „auf Grund § 1, Abschnitt IV des Befehls der Berliner Dreimächtekonferenz und der Verfügung der Regierung der UdSSR die Übergabe einer Reihe deutscher Bergwerke auf Reparationskonto“ angeordnet hat. Mit der Durchführung wurde der Chef der Sowjetischen Militäradministration für das Land Sachsen (SMA Sachsen) beauftragt. Der Befehl Nr. 131 der SMA Sachsen vom 30. Mai 1947 legte dann genauer fest: „Zur teilweisen Abdeckung der Reparationsansprüche der UdSSR sind die unten aufgeführten deutschen Bergwerksunternehmen aus dem deutschen Eigentum zu entnehmen und in das Eigentum der UdSSR zu überführen:
Also ‒ außer Freiberg und den Kohlenrevieren ‒ eigentlich alles, was noch da war... Die Schätzung der Vermögenswerte dieser Betriebe einschließlich von Grundstücken, Bergbaurechten, Schächten, Anlagen, Wohn- und Betriebsgebäuden mit den übrigen Werten, Materialien und Werkzeugen erfolgte auf der Grundlage der für Reparationsleistungen beschlossenen Schätzungsinstruktion des Alliierten Kontrollrates vom 4. Januar 1946. Durch die Hauptverwaltung des sowjetischen Vermögens im Ausland des Ministerrates der UdSSR und die Staatliche Aktiengesellschaft der Buntmetallindustrie „Medj“ (russisch медь: Kupfer) wurde daraufhin die Staatliche Aktiengesellschaft der Buntmetallindustrie „Wismut“ in Moskau gegründet. Sie errichtete ihre Zweigniederlassung in der westerzgebirgischen Stadt Aue, wo sie am 2. Juli 1947 im Handelsregister von Aue, Teil B 33, eingetragen worden ist. Die im Befehl 131 der SMA Sachsen genannten Betriebe bildeten den Kern dieses Unternehmens in der sowjetischen Besatzungszone (Chronik der Wismut).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das letzte
„Berggeschrei“
im Revier: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Teilrevier
„Ehrenzipfel
I“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
sowjetische Besatzungsmacht begann sofort nach dem
Ende des 2. Weltkriegs nahezu flächendeckend mit geologischen
Revisionsarbeiten und neuen Untersuchungen im Erzgebirge zum Auffinden
von Uranerzen.
Dabei geriet auch das Gebiet Ehrenzipfel in den Fokus. Vielleicht hatten die sowjetischen Offiziere und Geologen ja einfach die alten Akten studiert: Aus einem Antrag des Schichtmeisters der Richard Fundgrube, Hermann Gustav Poller, vom 24. September 1862 bezüglich Überlassung von fiskalischem Waldboden als Haldensturzfläche geht nämlich schon hervor, daß damals beabsichtigt war, „den im Felde liegenden Eisensumpfstolln gewältigen und forttreiben, um einen daselbst aufsetzenden Urangang (!!) näher untersuchen zu können.“ (40169, Nr. 281, Blatt 88) Schau an: Daß es hier auch Uranerz- Vorkommen gab, wußten also auch die Vorfahren schon, auch wenn sie noch nicht wirklich viel damit anfangen konnten... Letzteres hatte sich nun verändert und nachdem man knapp 90 Jahre später auf der Halde des Eisensumpf Stolln tatsächlich etwas uranerzhaltiges Haufwerk auffand, wurde der alte Stolln geöffnet und der Gang entlang der Stollnauffahrung als uranhöffig bewertet. Bis 1950 getätigte Emanations- Messungen erbrachten den Nachweis einer radioaktiven Anomalie entlang der Rittersgrüner Störung und der Aufschluß durch Schürfgräben bestätigte die Messungen. Nun wurde sofort die untertägige Erkundung des Gebietes durch die dazu geschaffene Schachtverwaltung 247 angeordnet. Das Erkundungsrevier erhielt zunächst den (Tarn-) Namen „April“, später auch „Ehrenzipfel I“ ‒ was uns nebenbei auch sagt, daß es unweit desselben Ortes noch wenigstens ein weiteres Erkundungsrevier gegeben haben muß. Der Aufschluß des Vorkommens erfolgte über mehrere Tiefschürfe, 5 Stolln und den Hauptschacht 247. Wie üblich, erhielten die Schächte der Wismut AG / SDAG Wismut einfach eine Nummer und keinen Namen oder gar eine Ortsbezeichnung, da die Rohstofflage der DDR überhaupt und bei diesem Metall natürlich ganz besonders streng geheim gewesen ist...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausrichtung
Folgende Sohlen wurden an der Burkertsleithe angelegt (Höhenangaben teils geschätzt):
*) Nach der sonst bei der Wismut gängigen Sohleneinteilung in 30-m-Abständen, hätte man eigentlich diese Bezeichnungen der Sohlen und Zwischensohlen wählen müssen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Tiefschürfe / Schurfschächte waren:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die ungewöhnlich komplexe Namensgebung
der Schurfschächte ist uns noch an anderen Standorten begegnet, etwa im
gleichzeitig in Betrieb stehenden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorrichtung
Die Vorrichtung betrifft die Auffahrung von Gangstrecken, sofern sie nicht als geologische Erkundungsstrecken bereits aufgefahren waren, und die Abbaublock-Anlage mit Überhauen und Rollen, eventuell die 1.Schwebenstrecke (sofern nötig). Dies geschah nach der damals gängigen Technologie unter Beachtung der konkreten Gegebenheiten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abbau
Der Abbau erfolgte durch Firstenstoßbau sowie durch Etagenstrecken mit Kontrollbohrungen und radiometrischer Vermessung im Gang. Im ganzen Grubenfeld wurden lediglich zwei bauwürdige Gänge gefunden. Dies war erstens der Gang 111 (der Gang, dem Stolln 239 folgte), auf dem 1.770 m² Abbaufläche 37 kg Uran (Metallgehalt) lieferten. Nach der Wismut- Chronik lieferte außerdem ein als Gang 116 bezeichneter Erzgang etwa 13 kg Uran. Aus allen anderen kleinen Betriebspunkten wurden zusammengenommen nochmals 58 kg Uran gewonnen, so daß sich für das ganze Vorkommen Ehrenzipfel I insgesamt eine Urangewinnung von gerade einmal 108 kg ergibt. Das Uranerz lag als kompakte Pechblende in schmalen Linsen geringer Ausdehnung vor, ebenfalls als Uranschwärze. Oberflächennah traten die Oxidationsprodukte Uranglimmer und Uranocker auf. Mit nur 0,016 kg U je m² Gangfläche lag das Ausbringen unter der festgelegten Bauwürdigkeitsgrenze. Da zudem keine Perspektive auf weitere Erzfunde bestand, wurde die Tiefbausohle von Schacht 247 bis auf kurze Streckenstummel nicht weiter aufgefahren und schon anfangs der 1950er Jahren alle Bergarbeiten wieder beendet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das
Uranerzvorkommen
„Ehrenzipfel
II“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da wir in den voranstehenden Kapiteln von
dem Uranvorkommen „Ehrenzipfel I“
gesprochen haben, liegt nahe, daß es auch ein „Ehrenzipfel
II“
gegeben hat. Nun, dieses existierte tatsächlich und wir wollen nicht
versäumen, auch dieses hier kurz vorzustellen.
Wie das Uranvorkommen I liegt das Vorkommen II ebenfalls am Gehänge der Burkertsleithe bei Ehrenzipfel, allerdings etwa 500 m weiter hangaufwärts in nordöstlicher Richtung. Warum dieses „Minivorkommen“ von der SAG / SDAG Wismut als gesondertes Objekt gelistet und nicht im Vorkommen I integriert wurde – was aus räumlicher und geologischer Sicht nachvollziehbar wäre – wird wohl ungeklärt bleiben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurzer
chronologischer Abriß
Mit Emanationsaufnahmen im betrachteten Gebiet wurden in Jahr 1950 radioaktive Anomalien aufgespürt, daraufhin aufgeschlossene Schurfgräben brachten jedoch keine positiven Ergebnisse. 1952 intensivierte man nochmals diese Emanationsmessungen mit einem engmaschigen Netz und weiteren Schurfgräben. Dabei wurden mehrere Gangstrukturen aufgeschlossen. Bei zwei dieser Gänge konnte eine Uranvererzung festgestellt werden. Die hier anstehenden bauwürdigen Erze wurden sofort aus den Schurfgräben heraus gewonnen, die Ausdehnung des Erzintervalls erwies sich jedoch, besonders in die Tiefe, als sehr begrenzt. Immerhin betrug der Uranmetall- Inhalt der gewonnenen Erze 33 kg. Um das angetroffene Erzintervall zu unterfahren, wurde im August 1952 auf 793 m über NN der Stolln 7 querschlägig angefahren, also etwa 40 m tiefer als der abgebaute Gang an der Erdoberfläche. Beim Vortrieb des Stollns durchörterte man insgesamt neun Gänge, vier davon untersuchte man mit Gangstrecken. Dabei konnte aber keinerlei Uranvererzung festgestellt werden, auch der Hochbruch zweier Überhauen unter dem schon bekannnten, oberflächlich vererzten Gang brachte keinen Erfolg. Die Urangehalte in entnommenen Proben lagen mit 0,001 % bis 0,009 % weit unter der Bauwürdigkeit. Drei 1953 niedergebrachte Kernbohrungen aus dem Stolln heraus erbohrten auch weder neue Gänge noch weitere Anomalien. Daraufhin stellte man im August 1953 sämtliche Arbeiten ein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergänzungen zur Geologie
Die Hüllgesteine der Gänge entsprechen denen, die im Vorkommen Errenzipfel I besprochen wurden, es sind also kontaktmetamorphe Glimmerschiefer und Gneisglimmerschiefer. Eine im Gesteinsverband eingeschaltete Skarnvererzung fehlt hier allerdings. Die aufgeschlossenen Gänge haben NW-SO- Streichen, es sind somit Flache. Das Einfallen der Gänge ist steil (60-70°) nach SW, die Mächtigkeit beträgt nur 1 cm bis 20 cm, selten in kurzen Intervallen bis 50 cm. Die Gangfüllung besteht überwiegend aus Nebengesteinszerrieb, mylonitischem Material und Gangletten. Quarz, Fluorit und Baryt treten sporadisch in Linsen auf, auffällig im Scharungsbereich des (Haupt-) Ganges „Ehrenzipfel“ mit einem etwas flacher einfallenden Gang. Das bereits erwähnte Uranerzintervall bestand aus sekundären Uranmineralien, in der Literatur werden Torbernit und „Gummit“ angegeben. Nähere Untersuchungen zum Mineralbestand des Gummits fanden sicher nicht statt. Über andere Erzmineralien, wie beispielsweise Sulfide, liegen keine Informationen vor und bei einer Inspektion der noch zugänglichen Gangbereiche fand sich auch keine Spur mehr davon.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heutiger Zustand
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten in Ehrenzipfel wurde auch der Stolln 7 sowie die Schürfe 6/67 (Ausbißlinie Gang 3) und 18A (entspricht Ü.1 der Gangstrecke 3) einbezogen. Die Schürfe sind jetzt mit Betonpfropfen dauerhaft verschlossen, die Oberfläche wurde profiliert und renaturiert. Da das Uranvorkommen Ehrenzipfel II, respektive der Stolln 7 mit seiner Halde, im Naturschutzgebiet Zweibach liegt und da der Stolln wegen des sehr standfesten Gebirges (auch im Mundlochbereich) kein Gefährdungspotential besitzt, konnten die Eingriffe hier auf ein Minimum reduziert werden. Die Wasserwegsamkeit im Mundlochbereich wurde wieder ertüchtigt und der Stolln mit einer Stahlgittertür gesichert. Darin integriert ist eine Fledermausöffnung. In diesem Zusammenhang möchten wir nochmal dringend davon abraten, den Stolln zu befahren. Der guten Standsicherheit des Gesteins und der gerade erfolgten Sanierung wegen, dürften zwar wenig Gefahren durch Steinfall o. ä. dabei auftreten. Auch fehlen hier Gesenke oder Blindschächte, aus denen Absturzgefahr resultieren würde. Jedoch sei darauf verweisen, daß die SAG / SDAG Wismut nicht ganz ohne Plan hier gewesen ist: Die Grubenwetter sind natürlich mit Radon stark belastet. Außerdem dient der Stolln sowohl als Winterquartier, als auch als sporadischer Ruheplatz der Fledermäuse im Sommerhalbjahr. Beunruhigungen können zu Streß und damit einhergehendem Energieverlust führen und den Tod der streng geschützten Tiere verursachen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Halde des Stollns 7 am steilen Talhang.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Ansatzpunkt des Stollns 7 liegt unterhalb einer kleinen Felsklippe (Zustand im Jahr 2014).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückblick auf die Situation
untertage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während der Sanierungsarbeiten machte die Auwältigung der Tagesbrüche auf den Schürfen und Stolln noch einmal einen letzten Blick in die Baue der Alten möglich. Bei der Gewältigung des St. Richard Stollns zeigte sich, daß das hier in der Stollfirste anstehende Lager bei ca. 40 cm Mächtigkeit völlig zersetzt und fast von plastischer Konsistenz ist. Da die darüberliegende Bedeckung zur Oberfläche nur knapp 2 m betrug, erklärte sich der Tagesbruch hier von selbst. Weiter in Vortriebsrichtung des Stolln sind Lager und Deckgebirge zunehmend standfester, der Stolln konnte ohne zusätzlichen Ausbau gehalten werden. Hier konnte auch der in etwa Morgengang- Richtung streichende Gang betrachtet werden, welchem der Stolln folgt. Er fällt mit ca. 70° nach W ein und hat eine Mächtigkeit von 10-20 cm. Die Gangfüllung besteht durchweg aus Nebengesteinszersatz, besonders am liegenden Salband sind fettige Letten ausgebildet, die ein Auslaufen des Ganges begünstigen. So kam es an diesem Punkt bei etwa 60 m fast zwangsläufig zu einem völligen Verschluß des Stollns. Bei ca. 40 m Stollnlänge gehen je eine Strecke nach Ost und West ab. Die Funktion der nach Osten angeschlagenen Strecke kann als Suchstrecke gedeutet werden. Darauf deutet auch ein Hochbruch in der Strecke hin. Wahrscheinlich ist das Lager durch den Stollngang verworfen worden und die Alten hofften, es mit dieser Auffahrung wiederzufinden. Das traf allerdings nicht ein, die Strecke steht ganz in Gneisglimmerschiefer und Muskovitgneis ohne eine Spur des Skarnlagers. Das relativ große Profil der Auffahrung und vorhandene Bohrspuren deuten auf eine relativ späte Auffahrung hin. Die nach Westen führende Strecke ist eine Ausfahrung im Lagerstreichen. Sie konnte noch reichlich 50 m weit befahren werden, ehe auch dort ein totaler Verbruch einsetzt. Diese Strecke ist offensichtlich nur in Schlägel- und Eisen-Arbeit aufgefahren; ihr Profil ist klein, kastenartig und deutlich geschrämt. Auf dieser Länge ist ein stetiges Anschwellen der Lagermächtigkeit von etwa 5 cm bis auf nahe einem Meter festzustellen. Bei etwa 20 m ist ein kleiner Versuchsabbau zu sehen, in dem Reste einer schönen Zinkblende- Kupfer- Vererzung anstehen. Bei 35 m Strecke beginnen die Hauptabbaue, zuerst durch exakte Bruchsteinmauern gesichert, danach lose versetzt und bald völlig verbrochen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Tagebruch hinter dem Mundloch des Richard Stolln während der Sanierung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Mit Zoom ein Blick auf die Stollnsohle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das völlig zersetzte Skarnlager im Bruchbereich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Ausfahrungsstrecke Ost steht vollkommen in Nebengestein (Gneisglimmerschiefer und Muskovitgneis).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Ausfahrungsstrecke West ist im Lagerstreichen aufgefahren, links ein kleiner Abbau.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Lager in der Strecke bei etwa 25 m, es ist hier noch fast erzleer.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hier wird das Lager erzreich, links beginnt der (versetzten) Abbau. Die rotbraune mittige Lage besteht aus stark eisenschüssigem Material.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auf den ersten Metern ist der Abbau durch exakte Bruchsteinmauern gesichert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl man also die ehemaligen Abbaue nicht mehr befahren kann, ist das Lager durch die Strecke im Bereich der Stützmauern gut aufgeschlossen. Das Hüllgestein im Hangenden ist unveränderter Gneisglimmerschiefer. Darauf folgt eine Bank von blockigem, äußerst hartem Muskovitgneis (20 cm), danach Granatskarn und verskarntes Nebengestein (20 cm), dann Eisen- und Zinkblende- reicher Skarn (20 cm), zuunterst granatführender Skarn (20 cm). Im Liegenden steht wieder Gneisglimmerschiefer an, leicht überprägt. Am rechten Stoß der Ausfahrungsstrecke ist eine ganz kleine Linse Magnetitskarn eingeschoben. Da der Stolln, wie bereits erwähnt, bei 60 m verbrochen ist, war eine Befahrung des hinteren Teiles nur über den Tagesschacht möglich. Der Schacht geht bis auf das Lager nieder, südlich und westlich stehen versetzte Abbaue an, die wohl eine Fortsetzung der Abbaue aus der Ausfahrungsstrecke West sind. An einem stehengelassenen Pfeiler haben sich intensiv grüne Ausblühungen gebildet, was auf kupferhaltige Mineralien (Chalkopyrit) hinweist. Überraschend ist das Auffinden einer nach NW vom Schacht abgehenden Strecke, die auf keinem Riß verzeichnet ist. Profil der Auffahrung und Versatzkästen aus Holz, die zum Lager hin stehen, sind offensichtlich Wismut- typisch, ebenso ein hier stehengelassener Schubkarren aus Eisenblech. Die Strecke endet nach ca. 50 m vor Ort. Aufgefahren ist sie auf einem NW-SO streichenden und 70° nach SW einfallendem Gang. Er ist 10-30 cm mächtig und führt hornsteinartigen Quarz, stark kaolinisiertes Material, Hämatit und Letten. Der
Richard Stolln wurde aufgrund der tagesnahen Lage, des kaum
standfesten Nebengesteins und der damit verbundenen latenten
Tagesbruchgefahr im Zuge der
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die geöffnete Pinge des Tagesschachtes neben dem Stollnort.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Mit Zoom: Das Profil des kleinen Schachtes ist exakt aus dem festen Gestein herausgehauen worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Schachttiefste liegt auf Stollnniveau, jedoch neben der Auffahrung. Die Versatzkästen hinter dem alten Schubkarren (links, halb im Wasser) schützen vor Hereinbrechen der Massen aus den abgebauten Lager.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der anstehende Gang in der Streckenfirste auf der Wismut- Auffahrung hinter dem Tagschacht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etwa 80 m westlich vom
Richard Stolln liegt der sogenannte Obere Eisensumpf Stolln. Die
spezielle Bezeichnung „Oberer“ ist eigentlich nicht einleuchtend, denn dann
müßte ja eigentlich auch ein „Unterer“ Stolln vorhanden sein. Die Existenz eines
solchen ist aber nirgends belegt oder ersichtlich. Der wenige Meter daneben
ansetzende „Eisensumpf Stolln“ liegt höhenmäßig annähernd gleichauf, so
daß die Bezeichnung als „Oberer Stolln“ auch dahingehend nicht gerechtfertigt
erscheint.
Das Mundloch diees Stolln liegt bei 722,5 m über NN. Die davorliegende kleine Stollnhalde wird auf einem Riß von 1853 als „Gelbe Halde“ bezeichnet. Zur „Gelbe Halde gevierte Fundgrube an der Burkhardtsleite im Ehrenzipfel bei Rittersgrün“ existiert noch eine Grubenakte, nach der jedoch nur auf einen sehr kurzen Betriebszeitraum um 1840 zu schließen ist (40169, Nr. 107). Tatsächlich zeigte sich das Haufwerk der Halde in deutlich gelblich- braunen Farbtönen, hervorgerufen durch die Verwitterung des eisenhaltigen Materials aus dem Lagerabbau. Ein neben dem Stolln niedergebrachter Schacht, auf dem Riß als „Tageschacht“ bezeichnet, hat keinen Anschluß an den Stolln. Vor der Sanierung war der Standort nur noch anhand einer kleinen Pinge mit Randhalde aufzufinden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
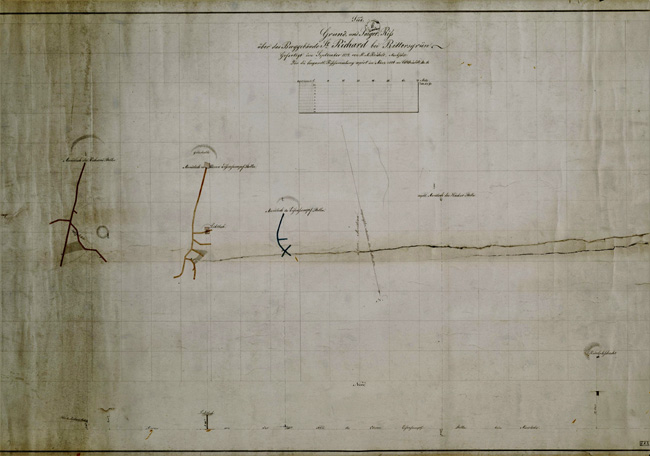 Grund- und Saigerriß über das Berggebäude St. Richard Rittersgrün, gefertigt im September 1874 von H. M. Reichelt, Markscheider, für die bergamtliche Rißsammlung copirt im März 1876 von W. Weinhold, Markscheiderassistent. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040, Nr. K8396, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß unten. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
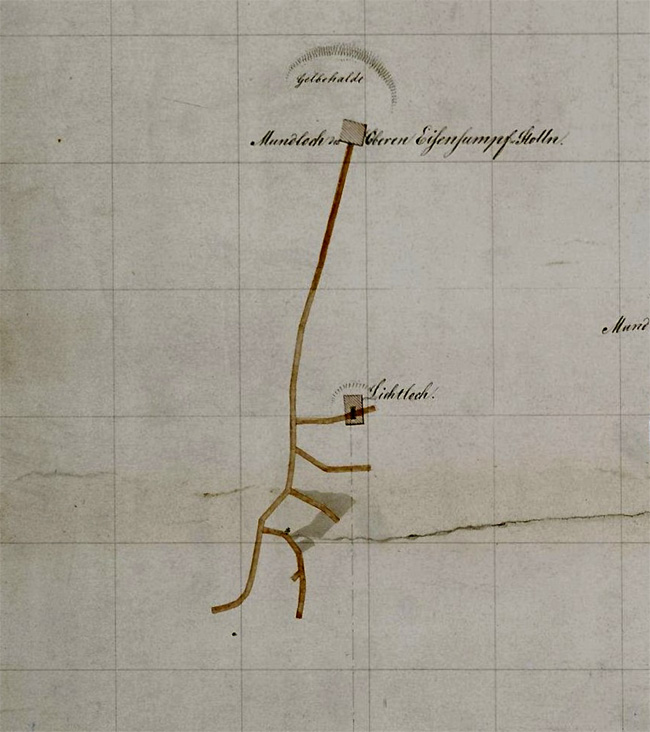 Ausschnitt aus obigem Riß mit dem Grundriß des Oberen Eisensumpf Stollns, Norden ist unten. Vor dem Mundloch des Stolln ist hier die „Gelbe Halde“ bezeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde auch dieser Stolln kurzzeitig geöffnet. Er streicht wie der Richard Stolln in Richtung NNO. Im Mundlochbereich war der Stolln durch exakte Naturstein- Mauern mit aufliegenden Firstplatten gesichert. Die lichte Weite betrug nicht einmal einen Meter ‒ als Förderweg für die Wismut entschieden zu eng ‒ er wurde folglich durch die Wismut nicht nachgenutzt, sondern nur kurzzeitig zur Erkundung geöffnet. Eine tektonische Spur, der dieser Stolln folgt, konnte nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Die Arbeiten wurden schon nach ca. 20 m Aufwältigung wieder eingestellt. Aufgrund des vorgefunden, vollständigen Verbruches der alten Auffahrungen war auch feldwärts mit keinen weiteren Bruch- bzw. Setzungserscheinungen zu rechnen und eine weitere Wältigung somit unverhältnismäßig. Der Stolln wurde nach Einbau einer wasserlösenden Leitung ebenfalls komplett verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das gesicherte Mundloch des Oberen Eisensumpf Stollns während der Sanierung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das oberflächennah stark zersetzte Skarnlager im Mundlochbereich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Obere Eisensumpf Stolln während der Verwahrung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der eigentliche Eisensumpf
Stolln liegt noch einmal weitere 50 m westlich vom Oberen Eisensumpf
Stolln. Das alte Mundloch ist bei 721,7 m über NN angeschlagen. Der Stolln
folgt einen NW-SO streichenden Gang, dies ist mithin ein Flacher.
Auf den alten Rissen sind im Vergleich zu den beiden vorgenannten Stolln nur geringe Auffahrungen eingezeichnet. Ein Abbau des Lagers erscheint in den risslichen Darstellungen gar nicht, er hat jedoch zweifelsfrei stattgefunden. Der historische Eisensumpf Stolln wurde durch die SAG Wismut unter der Bezeichnung „Stolln 239“ nachgenutzt und beträchtlich erweitert. Im Mundlochbereich war der Stolln 239 durch einen Ziegeldamm abgemauert. Bei der Aufwältigung wurden im vorderen Bereich (vom Mundloch bis zirka 35 m) mehrfach Relikte des alten Eisensumpf Stolln sichtbar. Beeindruckend war der strebartige Abbau des auch hier sehr flach nach NO einfallenden Lagers: Die geringe Höhe dieses „Strebes“ von weniger als einem Meter ließ erahnen, unter welch schweren Bedingungen die Bergleute damals arbeiteten. An den Stößen des Abbaus war das Lager noch gut zu erkennen. Es hat hier eine Mächtigkeit von nur etwa 30 cm und besteht aus stark eisenschüssigem Quarz. Die geringe Lagermächtigkeit erklärt auch die geringe Abbauhöhe: Man wollte möglichst wenig unproduktives Nebengestein mühevoll ausschlagen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
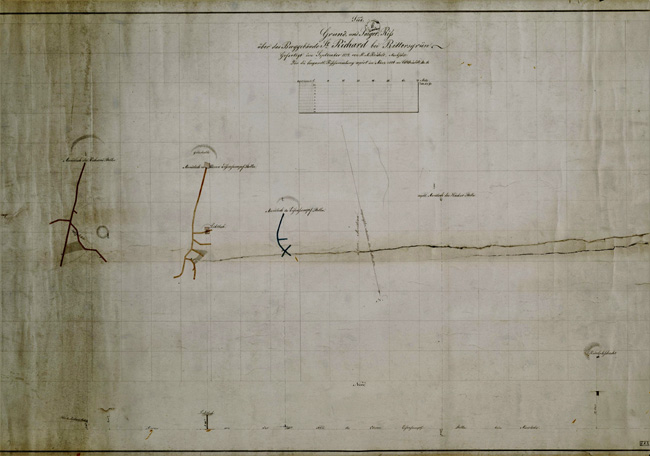 Grund- und Saigerriß über das Berggebäude St. Richard Rittersgrün, gefertigt im September 1874 von H. M. Reichelt, Markscheider, für die bergamtliche Rißsammlung copirt im März 1876 von W. Weinhold, Markscheiderassistent. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040, Nr. K8396, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß unten. Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
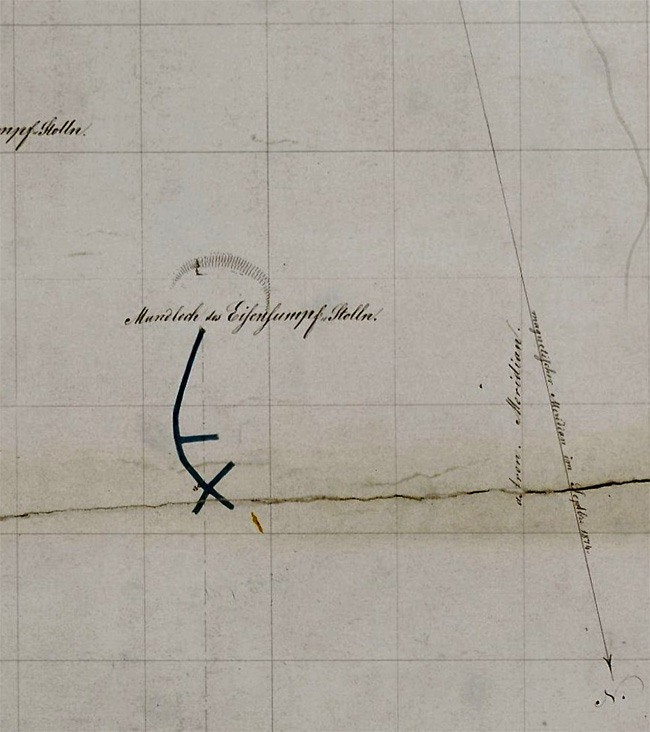 Ausschnitt aus obigem Riß mit dem Grundriß des Eisensumpf Stollns, Norden ist unten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der geöffnete Eisensumpf Stolln, bei der Wismut Stolln 239 genannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Mundlochbereich ist in Bruchsteinen gesetzt, darauf liegen große Firstplatten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Blick in den Stolln, die Türstöcke hinten stammen wohl schon aus der Wismutzeit.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hier ist in etwa anderthalb Meter Höhe das Lager von den Alten angefahren worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein Blick in den Lagerabbau offenbart die sehr geringe Abbauhöhe.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hier sieht man hinten am Stoß deutlich das noch anstehende Lager, das durch die intensiv rote Farbe der Eisenminerale ins Auge fällt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei etwa 20 m Stollnlänge ist, hinter einer Art Umfahrung, der Schurf 111-2 der Wismut auf dem Gang abgeteuft. Über diesen Schurf erfolgten wohl alle weiteren Arbeiten bezüglich der Auffahrung des Stolln 239. Der „neue“ Stolln folgt zunächst auf etwa 200 m Länge weiter dem schon erwähnten Flachgang und führt dann, abgesetzt noch weitere 80 m ins Feld. Da Uranvererzung festgestellt wurde, erfolgte eine sofortige weitere Erkundung durch Vorrichtung eines Abbaublockes und Abbau des Anstehenden im Bereich der radioaktiven Anomalien. Der Abtransport des anfallenden Haufwerkes erfolgte über zwei Sturzrollen bzw. Gesenke (Ü.1a und Ü.3a), die mit der nächsttieferen Sohle des Stolln 4 verbunden waren. Die Anlage der Rollen zeigt, daß der Stolln 239 nicht als Förderweg diente. Grund für diesen Förderweg die nächsttiefere Sohle könnte der kaum vorhandene Platz für eine größere Aufhaldung am Mundloch des Stolln 239 gewesen sein. Zwischen Schurf 111-2 und der ersten Sturzrolle zieht sich in der Firste des Auffahrung das Lager fast schwebend hin. Es ist nur 5-20 cm mächtig und besteht aus zersetztem eisenschüssigem Skarn, drin einbeschoben Linsen von Pyrit, Hämatit und wenig Magnetit. Abbautätigkeit der Alten ist hier nicht mehr zu finden. Oberhalb des Stollns wurde der Gang zwischen den Überhauen 1 und 3 durch eine Kopf- bzw. Etagenstrecke durch die Wismut weiter untersucht. Ein bescheidener Abbau erfolgte wohl nur auf wenigen m² bei Überhauen 2, wegen negativer Ergebnisse unterblieb eine weitere Löschung der Gangfläche des Blockes. In den Stolln 239 wurde bei Erreichen einer als bruchsicher berechneten Überdeckung bei 60 m vom Mundloch sowie am Mundloch selbst ein Damm eingebaut und die Hohlräume verfüllt. Ebenso verfüllte man die gesamte Etagenstrecke (obere Abbaugasse).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Eine der Rollen des Abbaublockes auf dem Gang 111, die als Sturzrollen jeweils zur nächsttieferen Sohle geführt haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein Bild dieser Rolle von der anderen Seite gesehen. Ungewöhnlich ist die zirka 1 Meter hochgebaute Verschalung. Hier konnte also keine horizontale Fahrung/Förderung erfolgen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Weil`s so selten zu sehen ist, noch ein Detailbild.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das zersetzte, fast waagerecht liegende Skarnlager in der Strecke Stolln 239.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die erzreichen Partien (Pyrit) heben sich durch ihre dunkler braune Färbung vom erzfreien Skarn ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu den
Sanierungsarbeiten im Wismut- Revier
„April“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab dem Jahr 2015 wurden in besagtem
Gebiet umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt, die bis zum Jahr 2019
andauerten. Dabei sind 35 Einzelobjekte bearbeitet worden. Ursprünglich
geplant hatte man nur mit 25 Objekten, doch wurden während der Sanierung
einige bis dahin völlig unbekannte, weder rißlich noch schriftlich belegte
Objekte aufgefunden und mußten natürlich in das laufende Verfahren
integriert werden. Nach heutigem Wissensstand gelten alle diese Objekte
nunmehr als dauerhaft standsicher verwahrt. Natürlich kann nie ganz sicher
ausgeschlossen werden, daß noch weitere, bislang unbekannte Grubenbaue
irgendwo noch vorhanden sein könnten.
Wer das Gelände der nun abgeschlossenen Vewahrungsarbeiten von früher kennt, wird nicht bestreiten wollen, daß es einige, durchaus als ziemlich „prekär“ zu bezeichnende Gefahrenstellen gegeben hat. Dies vielleicht weniger für einen montanhistorisch und mehr oder weniger risikobewußten Interessierten oder für den sich auskennenden Einheimischen, aber durchaus für ortsunkundige Touristen, Wanderer oder Pilzgänger. Nach Abschluß der Sanierung kann der Wald nun wieder gefahrlos begangen werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die auf mehrere Mater Teufe offenstehende Pinge des Schurfes 111-1/0-5 bei der Verwahrung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Um den jetzigen, berschadenkundlich
wieder sicheren Zustand zu erreichen, bedurfte es allerdings nicht gering
zu schätzender Anstrengungen, sowohl der Planer der involvierten
Institutionen Wismut GmbH, Oberbergamt Freiberg und Ingenieurbüro
TABERG-OST GmbH; als auch der Männer des ausführenden Betriebes
Bergsicherung Freital GmbH. Die zur Planung nötigen Unterlagen sind leider
allzu oft ungenau oder unvollständig, oder sie fehlen gänzlich,
insbesondere, was den Altbergbau betrifft. Daher sehen sich die
ausführenden Bergsicherungsbetriebe immer wieder unvorhergesehenen
Situationen ausgesetzt, die sie mit viel Erfahrung und Können meistern
müssen.
Um dem Laien einen kleinen Einblick in diese oft schwere und in jedem Falle verantwortungsvolle Arbeit zu geben, wollen wir nun noch einige Einzelobjekte mit einer chronologischen Bilderstrecke vorstellen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sanierung des Stollns 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob der Stolln 3 ausschließlich eine
Neuauffahrung durch die damalige SAG / SDAG Wismut gewesen ist, oder ob
auch er Vorgänger im Altbergbau hatte, läßt sich nicht mehr abschließend
beantworten. Aufgrund seiner Lage und den umfänglich angetroffenen
Altbergbau- Spuren ist jedoch zu vermuten, daß ein Altbergbaustolln
nachgenutzt wurde.
Das Mundloch von Stolln 3 liegt auf +736 m über NN wenige Meter südöstlich von Schurf 138. Es ist die höchstgelegene Abbausohle im Revier. Der Stolln führt vom Mundloch ab zirka 33 m weit in Richtung NNO, von dort führt Qu 3 in Richtung WSW bis zu einem Durchschuß nach übertage. Dieser Querschlag folgt dem Generalstreichen des Skarnlagers der Burkhardtsleithe und folgerichtig traf man bei der jetzigen Aufwältigung vielfältige Relikte des Altbergbaus an. Diese wurden durch die Wismut-Grubenbaue unter-, über- und durchfahren. Bei der Planung zur Verfügung stehende Unterlagen erwähnten zwar Altbergbau, jedoch fehlten konkrete Angaben dazu völlig. So wurde das Bergsicherungsunternehmen hier immer wieder mit unvorhersehbaren Situationen konfrontiert, die ihr ganzes Können forderten. Der Querschlag 3, der Stolln 3 sowie die angetroffenen Altbergbau- Hohlräume wurden vollständig mit Beton standsicher verschlossen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Zustand des Stollns 3 bei der ersten Kontrollbefahrung nach dem Öffnen des Mundloches... (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...und mit Sicherungsausbau in Stahl. Der hier oberhalb kreuzende Wirtschaftweg liegt nur wenige Meter über der Stollnfirste ! (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein nicht risskundlich erfaßter Altbergbau- Hohlraum, der im Zuge der Sanierungsarbeiten gefunden wurde. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Deutlich ist eine verskarnte, stark eisenschüssige Gesteinslage auszumachen, welcher die Vorfahren mit diesem kleinen Weitungsbau gefolgt sind. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sanierung des Stollns 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Mundloch dieses Stolln liegt an dem
Weg, welcher vom Schacht 247 aus am Waldrand entlang in westliche Richtung
führt, auf einer Höhe 719 m über NN. Er wurde durch Wismut aufgefahren und
hat mit ziemlicher Gewißheit keinen Vorgänger im historischen Bergbau. Er
lag zusammen mit dem bereits behandelten Eisensumpf Stolln / Stolln 239
auf einer Sohle und löste den westlichen Teil des Grubenfeldes. Ein
Anschluß und Wetterweg bestand zum Schurf 138.
Der Stolln 4 wurde nach Einbau von Versatzdämmen im tagesbruchgefähdeten Bereich mit Beton verfüllt. Der Stolln 5 war aufgrund einer dort bestehenden Stollnwassernutzung aus der Bearbeitung ausgenommen und wurde nicht angegriffen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Mundlochbereich des Stolln 4 im Jahr 2014...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...und das freigelegte und gesicherte Mundloch des Stollns 4 während der Sanierung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Eine Wettertür vor dem Zugang zum Schurf 138. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sanierung des
Hauptschachtes 247
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Situation bei Schacht 247 im Jahr 2014. Ab und zu zerschlägt mal Windbruch die Absperrungen und wer die Warnschilder aus Unkenntnis nicht beachtet...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ... läuft schnell in Lebensgefahr: Unter der alten Abdeckplatte hatte sich durch Setzung der Füllsäule im Schacht ein beträchtlicher Hohlraum gebildet. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Als erstes wird eine Zufahrt zum Baubereich hergerichtet. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Weil es sich beim Schacht 247 um das größte Einzelobjekt innerhalb des Gesamtprojektes handelte, mußte ordentlich aufgeschottert werden, um für die Belastungen während des länger andauernden Baugeschehens gerüstet zu sein. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dann wird die alte, keine 20 cm starke Abdeckplatte abgebrochen. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Beim Herstellen der Vorteufe muß der Bereich der verwitterten Bodenschicht abgefangen werden. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dann kann der Schacht selbst freigelegt werden. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Jetzt wurde das rechteckige und ziemlich große Schachtprofil - es handelte sich ja um einen ziemlich tiefen Schacht - in der Felsoberkante sichtbar. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Da hier oben im Hochtal nur wenig unterhalb des Fichtelberges mit Winter gerechnet werden muß, bekam der Schacht wieder eine neue kleine Einhausung, in der das Fördergerüst Platz fand. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die ersten Verfüllmassen aus der Schachtröhre werden ausgefördert und auch der längst faulig gewordne Holzausbau geraubt. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein Blick von der Hängebank in den Schacht. Einen solchen Greifer hatten die Großväter noch nicht - sie mußten das ausgebrochene Gestein noch mit der Schaufel in den Kübel schippen... (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Bei 9 m unter Gelände- Oberkante kam eine weitere Betonplatte zum Vorschein. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Um zu sehen, was darunter ist, wird zunächst mal eine kleine Öffnung aufgebrochen. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein erster Blick nach unten: Auch unter dieser Platte haben sich die Füllmassen gesetzt, so daß ein Hohlraum entstanden ist. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Nachdem die Betonplatte entfernt war, zeigte sich, daß darunter noch eine weitere Bühne, diesmal aus Holz, eingebaut ist. Sie diente sicher als Arbeitsplattform für die Errichtung der Betonplatte. Zwischen entfernter Betonplatte und Holzbühne ist die Verzimmerung der Schachtröhre zu sehen - durch jahrzehntelange Lage unter Wasser mir tiefroten, eisenhaltigen Ansätzen behaftet. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Blick in das Fahrtentrum des Schachtes. Die alten Holzausbauten scheinen noch gut erhalten. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Sukzessive arbeiten sich die Fachleute nun bergab. Jetzt geht es oft nur noch „händisch“ weiter... (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Holzbühne muss nun beräumt werden und scheint noch ziemlich stabil zu sein... (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Noch ein Blick in den Schacht. Inzwischen ist der Grundwasserstand erreicht und es muß gepumpt werden. Wir sehen gut die Bolzenschrot-Zimmerung mit Verzug, Balken als Einstriche zur Abtrennung der Schachttrümer voneinander. und am rechten Bildrand die Spurlatten für die Förderkörbe. Außer den beiden Abdeckplatten als Sicherung und ein bißchen Erdreich und Haldenberge dazwischen, habe die Großväter nicht wirklich aufgeräumt, als sie diesen Schacht verlassen haben... (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Diese Fahrten sind sicher wasserfest und sehen fast „wie neu“ aus – keinesfalls aber sollte man sich auf ihre Stabilität noch verlassen ! (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Gestein ist hier zum Glück so fest, daß das Widerlager für eine neue Schachtplombe aus dem Fels herausgeschossen werden muß. Die Zündkabel verraten, daß diese Aufnahme kurz vor dem Abschlag aufgenommen worden ist. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unter das Widerlager kommt dann eine neue Schalungsbühne - diesmal mit ordentlichen Stahlträgern als Armierung. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Da die Plombe unter dem Grundwasserspiegel zu liegen kommt, wird außerdem eine Steigleitung zum Ausgleich von Druckschwankungen eingebaut. Bis die Plombe fertig ist, muß auch das Grundwasser unter der Plombe gehalten werden. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein letzter Blick in den Schacht vor der Verfüllung: Ganz unten sieht man die Bühne mit der Armierung. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dann wird Beton hinuntergepumpt... (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...und Meter für Meter füllt sich die Schachtröhre im Plombenbereich. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Voll ! (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Rest wird mit Aushubmasse wieder aufgefüllt und dann wird alles wieder abgebaut. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Nach Aufbringen von Mutterboden kann hier wieder Wald wachsen. Vom Schacht 247 ist dagegen nichts mehr zu erahnen... Nur, wer die Geschichte kennt, erkennt auch noch den Rumpf der Bergehalde im Gelände wieder. (Foto: TABERG-OST GmbH)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sanierung des
Stollns 7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Zuge der Arbeiten wurde auch der einzige Stolln im Teilrevier „Ehrenzipfel II“ noch einmal geöffnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freilegung der Rösche des Stollns 7 zu Beginn der Sanierung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Zugang zum Mundloch ist beräumt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Mundloch wurde eine Stahlgittertür mit Fledermauseinflugöffnung eingebaut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zustand des Mundlochbereichs im Jahr 2021.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zustand des Mundlochbereiches im Jahr 1898.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Gangstrecke 1-1-2 am Stolln 7.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stolln 7, Gangstr. 1-1-2: dünne Quarz- Fluorit- Bestege an den Salbändern und erdig- brauner Limonit im Gangmittel, der teils ausgeschwemmt ist und daher einen Hohlraum in der Gangspalte bildet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Probe mit Kammquarz am Salband, darauf eine Lage blauer und oben gelblicher Fluorit.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf dem Stolln 7 ist hier Gang Ehrenzipfel in der Firste sichtbar, aber nur aus lettigem Material bestehend.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stolln 7, Gang Ehrenzipfel: Einschub einer kurzen Linse aus rotgefärbtem Baryt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stolln 7, Gang Ehrenzipfel: Eine kleine Aufweitung im Gangprofil mit Quarz, Letten, Hämatit und ein wenig Fluorit.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stolln 7, Gang Ehrenzipfel: Ein Scharungsbereich mit etwas mehr Fluorit.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gangprobe mit blauem und grünem Fluorit und etwas Karbonat. Mehr war hier schon damals nicht zu finden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Nachsatz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Um am Ende dieses Beitrages aber schließlich noch eine ganz subjektive Sicht hier einfließen zu lassen: Vielleicht ist man bei der Sanierung und Verwahrung der Narben, die besonders der rücksichtslose Bergbau der früheren SAG Wismut Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre auf der Suche nach Uranerz auch hier der Landschaft geschlagen hatte, sogar ab und an etwas über das Ziel hinausgeschossen und hat am Ende einen mir persönlich zu steril erscheinenden Endzustand geschaffen. In Hinblick auf die oben beschriebene Situation über Tage, die einer historisch gewachsenen Bergbaulandschaft entsprach, muß leider festgestellt werden, daß diese nach Abschluß der Sanierungsarbeiten gelitten hat. Daß Gefahrenstellen dauerhaft saniert werden müssen, bedarf wie bereits erwähnt, keiner Diskussion. Daß der Charakter der Bergbaulandschaft aber nach einer Sanierung immer weniger zu erkennen ist, müßte nicht unbedingt sein. Warum müssen Stollnröschen und Bruchtrichter nach der Sanierung völlig nivelliert werden, warum werden kleine Halden breitgeschoben? Diese genormte, geglättete Landschaft tut weder der Natur noch den interessierten Menschen gut. Das Stehenlassen kleiner Stollnöschen oder Schurftrichter mit sanfter Hangneigung und geringer Tiefe von 1 m bis 2 m, eventuell auch das Wiederaufschieben kleiner Halden, wäre unter Umständen weniger oder zumindest kaum mehr arbeitsaufwendig und auch der forstwirtschaftlichen Nutzung, wenn überhaupt, nur ein völlig vernachlässigbares Hindernis. Die „Montanregion Erzgebirge“ kann mit einem „gefegten“ Waldboden sicher nicht punkten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die mit Laubbäumen bestandene Halde des Stollns 5 im Herbst 2021. Zumindest ein Teil der Bergehalden wird auch zukünftig noch das kleine Erkundungsrevier im Gelände markieren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Abschluß soll ein kurzes Zitat aus
dem Buch „Uranmineralien in Sachsen“ folgen, um auch diesem kleinen und scheinbar
völlig unbedeutenden Uranvorkommen die ihm gebührende Wertschätzung
zuzubilligen. Im Vergleich zu den etwa 100 kg gewonnenem Uranmetall aus diesem Vorkommen und kiloschweren Pechblende- Reicherzfunden auf Wismut-
Halden nach Ende des Wismut- Bergbaues steht dort: „Welch ein ungeheurer Aufwand an Arbeit und Material, und hier im Vorübergehen (auf den Halden) aufgesammelt. Um Mißverständnissen vorzubeugen: Dies schmälert in keiner Weise die Leistungen der Menschen, die damals wirkten. Auch soll dies keinesfalls Unverständnis ausdrücken, daß diese Lagerstätte (Anmerkung: Im wirtschaftlichen Sinne war es selbst unter damaligen Verhältnissen nur ein Vorkommen !) überhaupt aufgeschlossen wurde. Historische Prozesse sind immer in ihrem Kontext zu sehen, heutige Maßstäbe dürfen nicht zurückprojiziert werden. Es unterstreicht aber eindrucksvoll, welche immense Bedeutung damals dem begehrten Rohstoff zukam und unter welch erdrückenden Zwängen die Menschen standen. Der Befehl lautete, Uran zu finden und zu fördern, koste es, was es wolle...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem bleibt uns nichts hinzuzufügen. Politische Entscheidungen sind nun mal leider nicht immer von Vernunft geprägt und auch das geologische Wissen über die Vorkommen der Uranerze mußten unsere Vorväter ja erst einmal sammeln. Glück Auf! J. Stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Quellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis:
Die verwendeten Digitalisate des Sächsischen Staatsarchives stehen unter einer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Quellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|