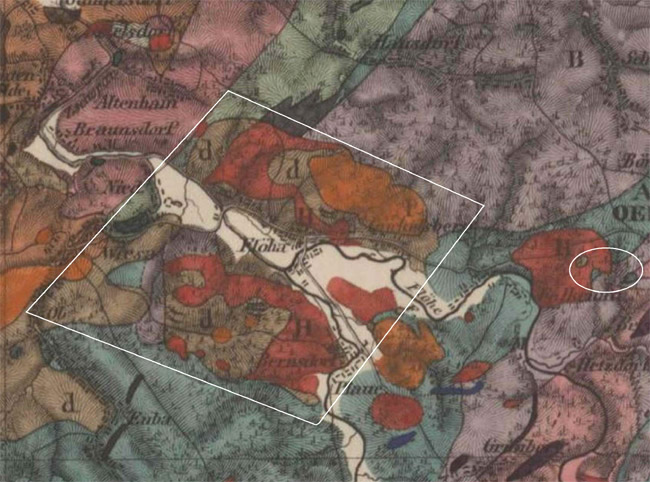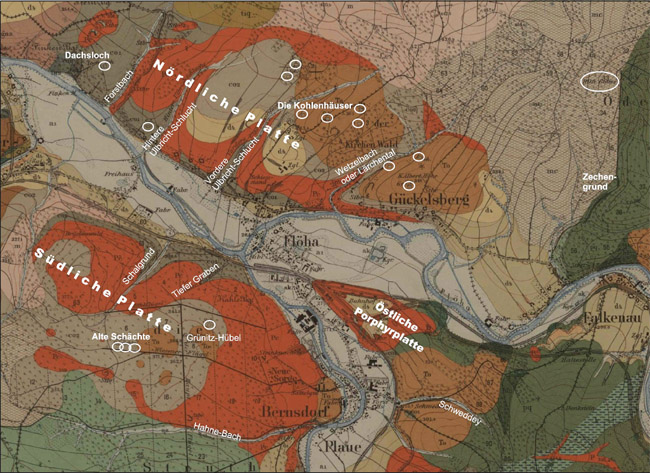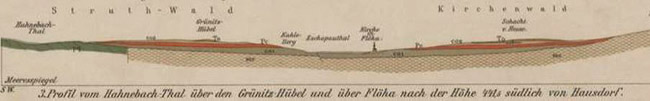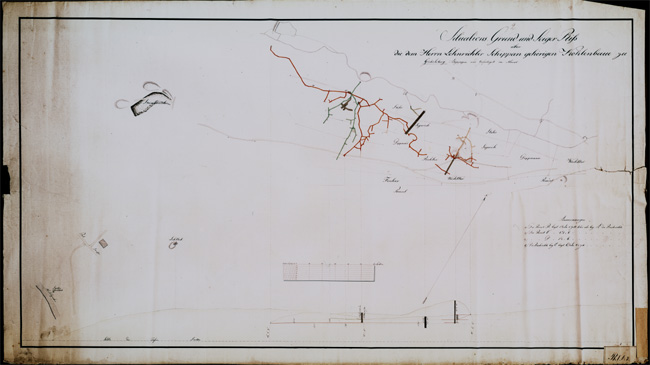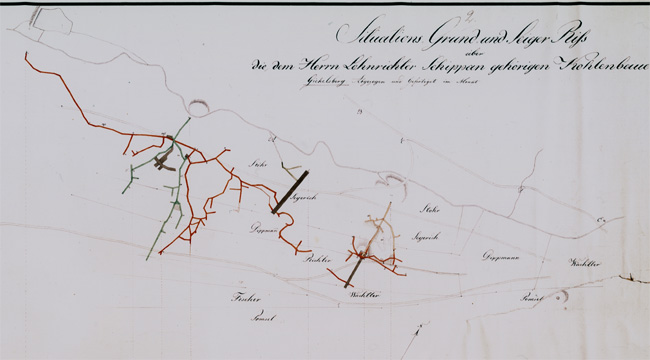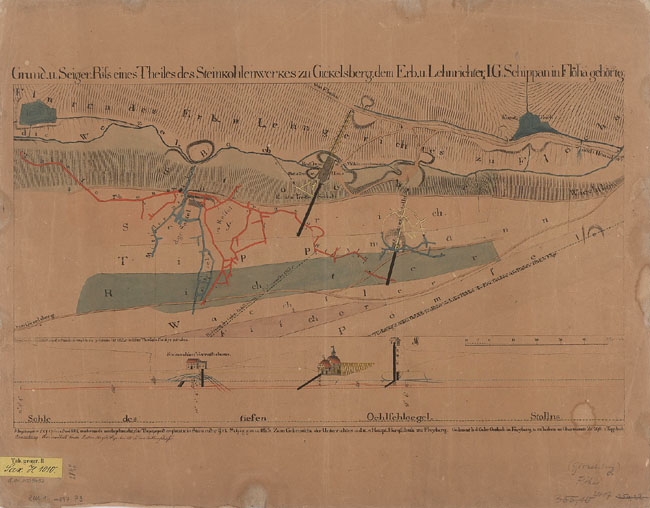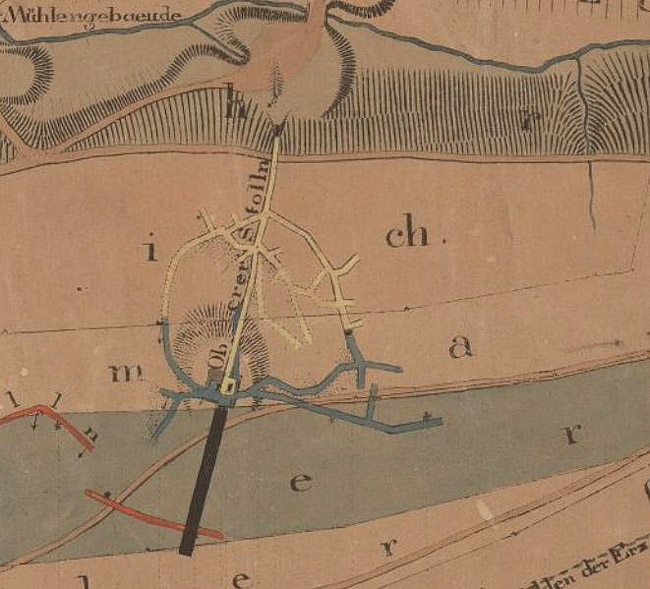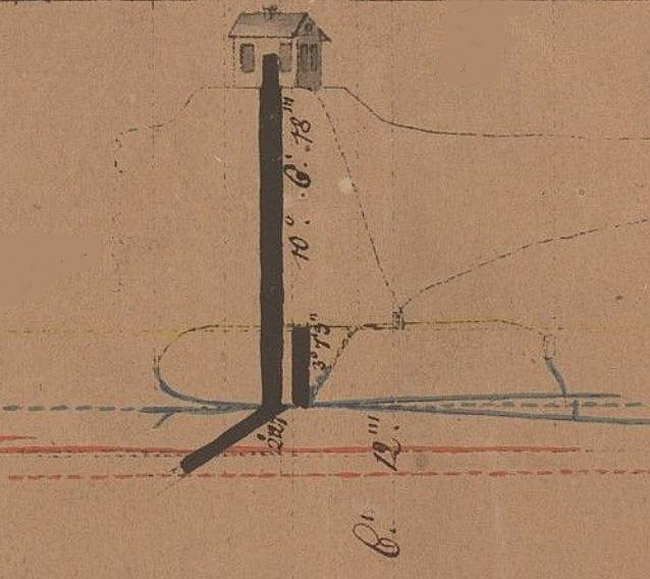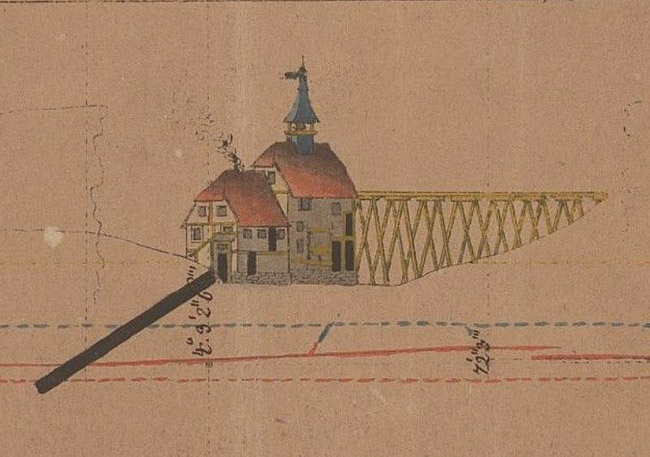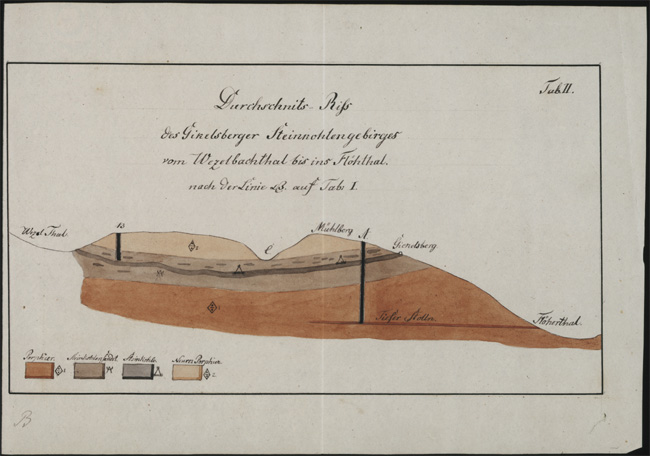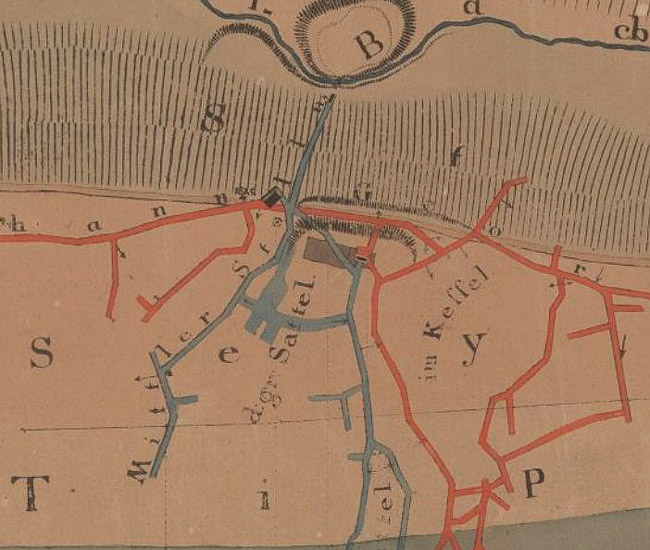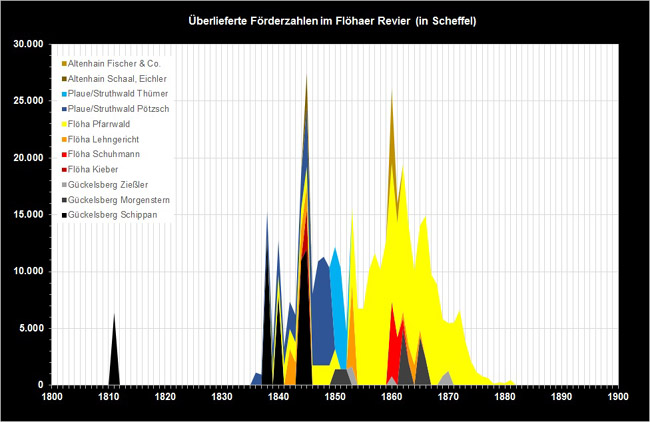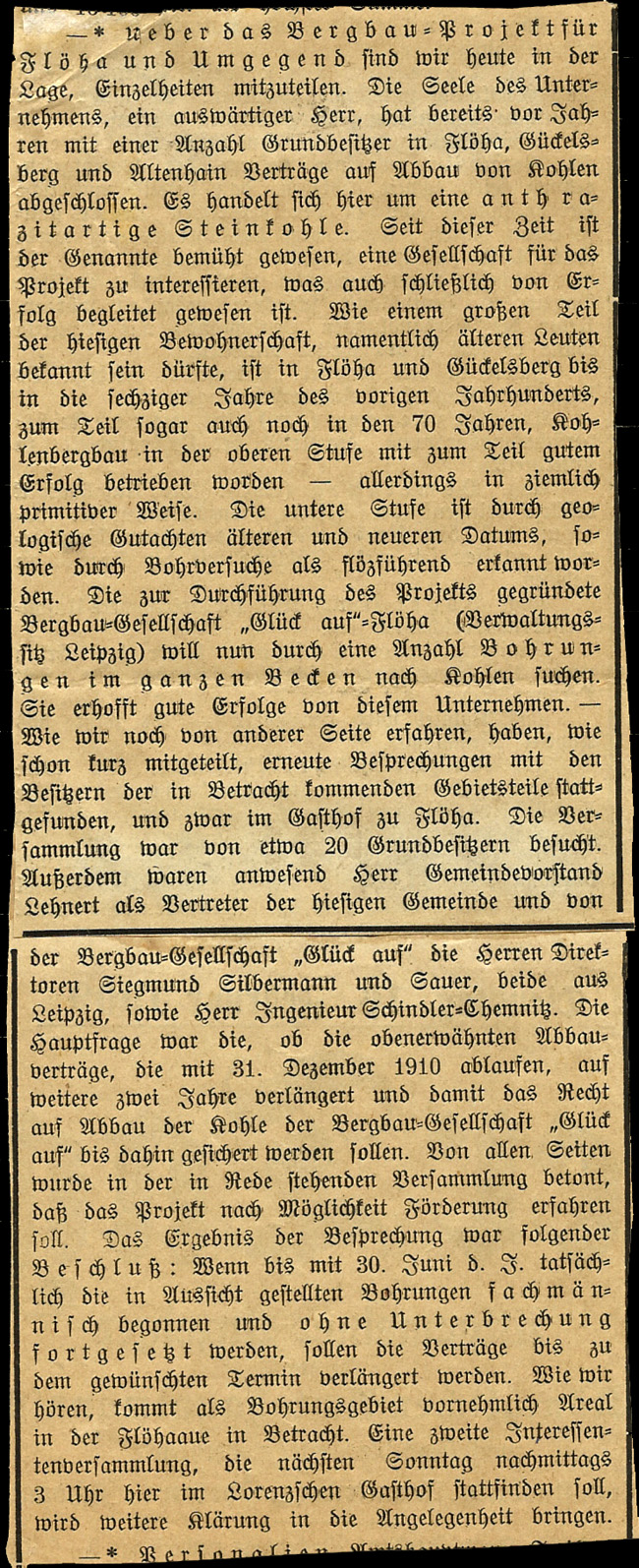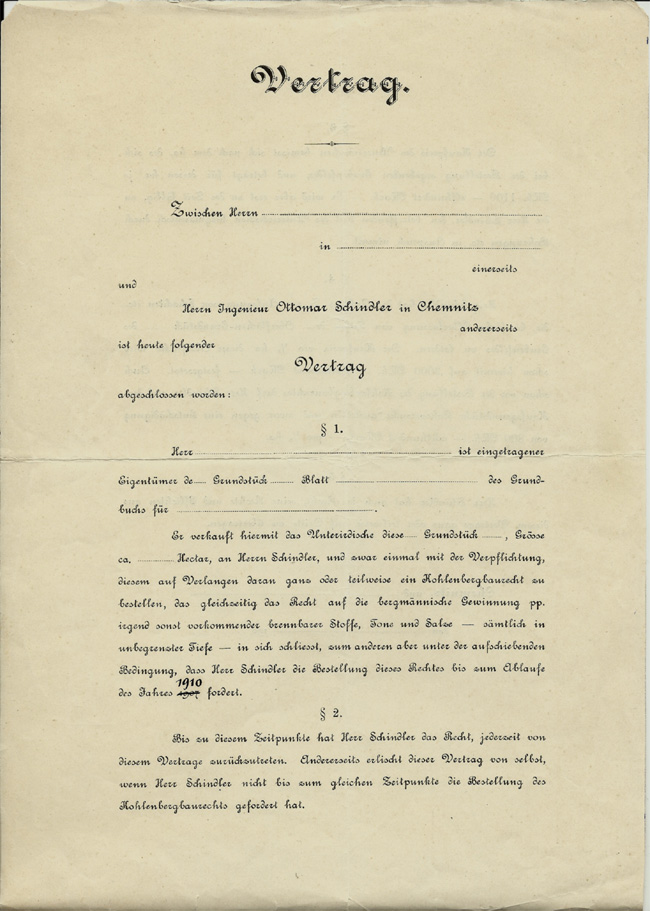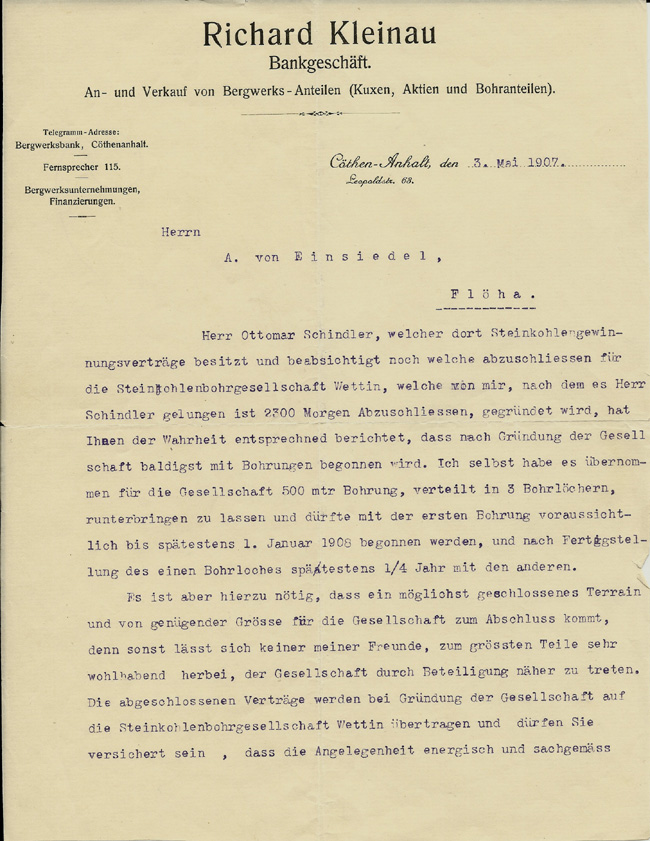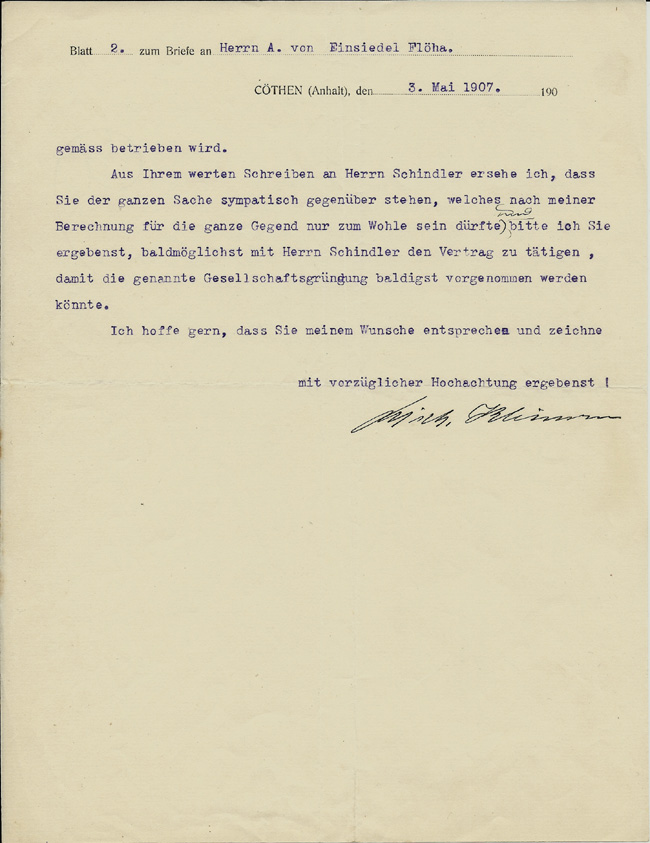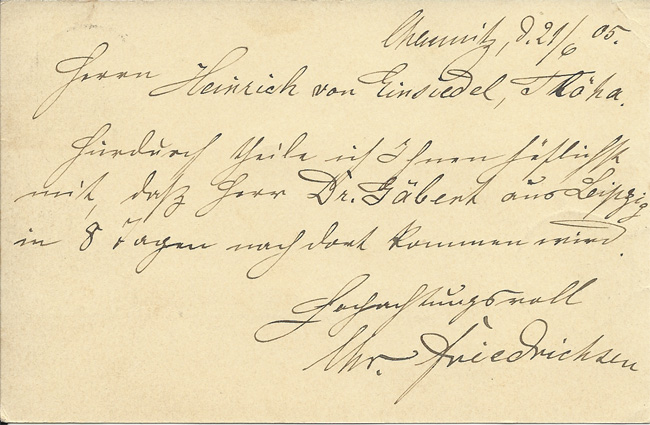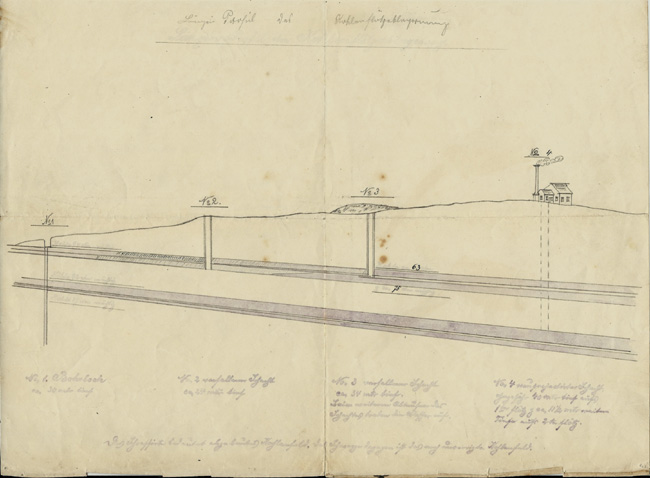|
Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom Juli 2017 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Steinkohlenbecken von Flöha in der Vergangenheit
Nach einer Dissertationsschrift von Herrn P. Kleinstäuber, Flöha. Online seit
Januar 2017, letzte Ergänzung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein
Exemplar dieser Dissertation befindet sich in Obhut des „Geowissenschaftlichen
Freundeskreises Flöha“. Wahrscheinlich ist das Original selbst bei den Luftangriffen
auf Leipzig Anfang 1945 verbrannt. Die Dissertation diente auch als wichtige Quelle
für die
1999 durch den Geowissenschaftlichen Freundeskreis zur Wiedereröffnung der
„Geologischen Sammlung“ anläßlich der 600-Jahrfeier der Flöhaer Ersterwähnung
herausgegebene Broschüre „Geologie und Bergbau im Bereich der Stadt Flöha“.
Wir
haben diesen Text in Form eines Scans (im PDF- Format) eines ‒ teils schon recht
verblichenen und zudem noch handschriftlich korrigierten, maschinengeschriebenen
Durchschlages ‒
aus dem
Nachlaß von Herrn Manfred Wild, Erdmannsdorf, erhalten. Auch das
Foto sowie die nachfolgenden Informationen zur Person P. Die außerdem im Text eingefügten Fotos von Gesteinen und Mineralien aus der karbonischen Schichtenfolge erhielten wir von Herrn Helmut Kroh, Flöha. Als Autoren des „unbekannten Bergbaus“ sehen wir diese nachfolgende Arbeit nicht nur als Materialquelle zu einem fast schon vergessenen Kapitel der sächsischen Montangeschichte an, sondern ebenso als ein authentisches Zeitdokument aus den 1920er Jahren, einer Zeit zwischen den Weltkriegen, die geprägt war durch wirtschaftlichen Wiederaufschwung, aber auch durch die Not der Wirtschaftskrisen. Dem Text ist anzumerken, daß der Autor einem anderen Berufsstand angehörte, jedoch der bergmännischen Geschichte seines Wohnortes mit großem Interesse gegenübertrat und sie mit außerordentlicher Gründlichkeit erforschte. Insbesondere hatte er in seiner Zeit noch die Möglichkeit, Zeitzeugen der Bergbauperiode persönlich zu befragen. Schon aus diesem Grund wollen wir den langen Text (im Original 187 Textseiten) hier mit nur geringfügigen redaktionellen Korrekturen und nahezu ungekürzt wiedergeben (die Tabellen im statistischen Kapitel haben wir aus Gründen der Übersichtlichkeit teils erheblich vereinfacht). Allerdings nutzen wir die heutigen technischen Möglichkeiten und ersetzen die nur noch schlecht lesbaren Abzeichnungen von Kartenwerken im Anhang des Originals durch Einfügung passender Ausschnitte derselben unmittelbar im Text. Wir freuen uns, diese inhaltsreiche Arbeit auf diesem Wege einem größeren Leserkreis bekannt machen zu können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Autoren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der
am 14.08.1890 in Gera geborene
Dr. phil. Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer und Hauptmann d. R. Paul
Kleinstäuber arbeitete ab 01.04.1920 als wissenschaftlicher Handelslehrer an
der „Verbandhandelsschule“ in Flöha. Der
am 14.08.1890 in Gera geborene
Dr. phil. Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer und Hauptmann d. R. Paul
Kleinstäuber arbeitete ab 01.04.1920 als wissenschaftlicher Handelslehrer an
der „Verbandhandelsschule“ in Flöha.
Am 29.07.1922 verteidigte er an der Universität Leipzig seine Dissertation zum Thema „Das Steinkohlenbecken von Flöha in der Vergangenheit“. In dieser, glücklicherweise erhalten gebliebenen und von ihm der „Gemeinde Flöha gewidmeten“ Dissertation sind umfassende Informationen zur Geschichte des Flöhaer Steinkohlenbergbaues zusammengetragen und bewahrt. Dem am 03.02.1986 in Geldern verstorbenen Dr. Kleinstäuber gilt deshalb ehrendes Andenken, stellt doch seine Arbeit einen äußerst wertvollen Beitrag zur Bewahrung der Heimat- und Bergbaugeschichte Flöhas dar, ohne dessen Existenz die Darstellung der Geschichte des Flöhaer Steinkohlenbergbaues sowie ihre teilweise Repräsentation in der „Geologischen Sammlung der Stadt Flöha“ wohl kaum möglich gewesen wäre.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einleitung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das gesamte Wirtschaftsleben der Staaten, die auf der Wirtschaftsstufe der Wissenschaft und Technik stehen, gründet sich, solange nicht andere Naturkräfte in genügendem Maße in Energie umgewandelt werden können, in der Hauptsache auf die Ausnützung der Kohle als Kraftquelle. Diese Abhängigkeit haben namentlich wir Deutschen in den letzten Jahren nur zu sehr am Körper unserer Volkswirtschaft, ja ganz wörtlich genommen, am eigenen Leibe fühlen müssen. Seitdem uns der Vertrag von Versailles wichtige Gebiete unserer Kohlenproduktion vorderhand ganz genommen (im Saargebiet), die dauernde Abtrennung anderer in drohenden Bereich der Möglichkeit gerückt ist (Oberschlesien) und uns der Verbrauch der restlichen Steinkohlenförderung durch das Spaaer Abkommen rationiert hat, indem wir bestimmte große Mengen an die Gegenunterzeichner desselben auf Jahre hinaus abzuliefern gezwungen sind, kommt unser Wirtschaftsleben aus der Kohlennot nicht mehr heraus. Die sozialen und wirtschaftlichen Kämpfe, die im Anschluß an die politische Revolution von 1918 eingetreten sind, haben ihr Übriges getan, um die Kohlennot nicht durch erhöhte Produktion zu beheben. Die große Wert- und Preissteigerung alle wirtschaftlichen Güter und die Unmöglichkeit einer Preissenkung bis jetzt sind zu einem großen Teile die Folge davon. Die wirtschaftliche Wiedergeburt Deutschlands ist zu einem guten Teil eine Frage der erhöhten und billigeren Kohlenproduktion geworden. So sind die kleineren Kohlenvorkommen im Deutschen Reiche wieder mehr in den Vordergrund des Interesses gerückt, deren Abbau im letzten halben Jahrhundert unwirtschaftlich geworden und liegen geblieben war, da bessere und leichter zu fördernde Kohle infolge des fortschreitenden Ausbaues unserer Verkehrsmittel (hauptsächlich Eisenbahn und Binnenschiffahrt) in genügenden Mengen überallhin billig befördert werden konnte. Schon hört man, daß einzelne dieser kleinen Kohlefelder, so im nördlichen und östlichen Westfalen und in Hannover, wieder in Abbau genommen werden sollen, da der hohe Preis der Kohle sogar die Aufwendungen für die Wiederinstandsetzung der Anlagen wieder wirtschaftlich erscheinen läßt. Eine wirtschaftsgeschichtliche Sammlung allen Materials über ein solches ehemaliges Kohlenabbau-Gebiet dürfte also nicht nur im Interesse der Wirtschaftsgeschichte überhaupt liegen, sondern auch von Vorteil für unsere praktische Volkswirtschaft sein, da sie als Grundlage für eine Entscheidung dienen kann, ob die Wiederaufnahme des Abbaus unter den heutigen Verhältnissen wirtschaftlich ist. Eine genaue aktenmäßige Darstellung der Abbaugeschichte eines solchen Gebietes kann viel zur Klärung im Voraus beitragen, unrentablen Spekulationen von vornherein die Spitze bieten und so unnötige wirtschaftliche Kräftevergeudung verhindern.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere engere Heimat Sachsen (Bereich des ehemaligen Königreichs, heutigen Freistaats) kennt neben den drei größeren Abbaugebieten von Steinkohle: dem Zwickauer oder erzgebirgischen Becken, dem zwar zum erzgebirgischen Becken gehörigen, wirtschaftlich aber selbständig zu betrachtenden Lugau-Oelsnitzer Kohlenrevier und dem Kohlenbecken des Plauenschen Grundes bei Dresden (auch Potschappler Becken genannt), noch zwei kleinere Kohlenbecken, die sich am östlichen Rande des erzgebirgischen Beckens vorfinden: die Hainichen- Ebersdorfer Mulde im sogenannten Hainichen- Frankenberger Zwischengebirge, nordöstlich von Chemnitz und das Steinkohlenbecken von Flöha, östlich von Chemnitz. Die Geschichte des Zwickauer Kohlenbergbaus ist umfassend von Emil Herzog (Geschichte des Zwickauer Steinkohlenbergbaus, Dresden 1852) dargestellt worden, die des Kohlenbergbaus im Plauenschen Grund von verschiedenen Schriftstellern und Geologen eingehender behandelt worden (besonders von Friedrich und Hoppe: Sachsens Boden, Zwickau 1887; Köttig: Geschichtliche, statistische und technische Notizen über den Steinkohlenbergbau Sachsens, Leipzig 1861) und zusammenfassend von Baehr in einer Dissertation der Philosophischen Fakultät Leipzig 1917. Über die Geschichte des Steinkohlenbergbaus in der Hainichener Mulde findet sich von A. Rothpletz in den Erläuterungen zu Sektion Frankenberg- Hainichen der geologischen Spezialkarte Sachsens, Blatt 78, Leipzig, 1881, neubearbeitet 1905, eine eingehende Darstellung, desgleichen über den Kohlenbergbau im Lugau-Oelsnitzer Gebiete von Th. Siegert in der Sektion Stollberg- Lugau (Blatt 113). Das Flöhaer Becken aber ist in wirtschaftsgeschichtlicher Beziehung noch nicht zusammenhängend und umfassend behandelt worden; Spezialwerke bestehen nur in geognostischer Richtung (von C. F. Naumann) und in paläontologischer (von Geinitz). Da ich seit 1. April 1920 an der Verbandshandelsschule zu Flöha als wissenschaftlicher Handelslehrer tätig bin, also im Centrum des alten Abbaugebietes, folgte ich nach Rücksprache mit Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. Stieda von der Universität Leipzig einer Anregung dieses meines verehrten Lehrers in Wirtschaftswissenschaften und ging an die Sammlung und Ordnung aller in Literatur und archivarischen Quellen auffindbaren Tatsachen und Beiträge zur Geschichte des Steinkohlenbeckens von Flöha... (Im Original folgt an dieser Stelle eine Aufführung der Quellen, die wir aber ans Ende des Beitrages verschoben haben.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Einsicht in die Akten dieser Archive wurde mir überall in entgegenkommender Weise erleichtert, namentlich bin ich dem Bergamte Freiberg zu besonderem Danke verpflichtet, durch dessen Unterstützung die Auffindung der für die Arbeit grundlegenden Akten ermöglicht wurde. Neben den schriftlichen Quellen wurden auch Mitteilungen älterer Einwohner von Flöha uns Gückelsberg verwendet. Herr Sparkassen-Obersekretär R. Hans, Flöha, unterstützte mich in dankenswerter Weise mit seinem reichen ortsgeschichtlichen Wissen und Material. Dadurch, daß ich im Mittelpunkt des behandelten Gebietes selbst wohne, wurde mir die gründliche Untersuchung aller archivarischen Quellen möglich; die Möglichkeit der häufigen Begehung des alten Bergwerksgeländes führte zur Rekognoszierung der meisten alten Halden, Schächte und Stollen, wie sie in den Einzeichnungen in die beigegebene geologische Karte zum Ausdruck kommen. Herr, ich habe getan, was in meinen Kräften stand. Was fehlt, möge Deine Gnade dazutun. P. Kleinstäuber.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I.
Kapitel:
Grundzüge des geologischen Aufbaus des Flöhaer Beckens
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Theorie
der Entstehung des Beckens und seiner Struktur
In geognostischer Beziehung ist das Flöhaer Becken im 19. Jahrhundert ein besonderes Lieblingsgebiet der Geologen gewesen. Naumann nennt es in seinem Spezialwerke (Geognostische Beschreibung des Kohlenbassins von Flöha) „eines der interessantesten Kohlenfelder unseres engeren Vaterlandes“. Infolgedessen ist es auch geologisch mit großer Sorgfalt erforscht und in allen Einzelheiten beschrieben worden. Die wissenschaftliche Geologie als solche ist eine vergleichsweise junge Wissenschaft, ihre Entwickelung beginnt erst um die Wende des 18. Jahrhunderts. Infolgedessen finden wir in älteren Werken und sonstigen Quellen allerhand verworrene und einander widersprechende Angaben über die geologischen Formationen und die Benennung der Schichten und Gesteine auch des Flöaher Beckens, auf die näher einzugehen sich nicht lohnt. Erst mit Charpentier‘s Mineralogischer Geographie der chursächischen Lande 1778 beginnt in Sachsen die Periode der intensiven wissenschaftlichen Erforschung der Erdrinde und ihrer Schichten, die vom merkantilistisch orientierten Staate gefördert und unterstützt wurde, so daß Sachsen das am frühesten und wohl heute noch am besten erforschte geologische Gebiet Deutschlands ist. Schon im gleichen Jahre 1778 wurde auf Veranlassung der Landes-Ökonomie-Manufaktur-Commerziendeputation ein Befehl vom Kurfürst Friedrich August erlassen zur Aufsuchung von Steinkohlen in den sächsischen Landen. Daraufhin veranstaltete das Oberbergamt zu Freiberg zunächst eine Zusammenstellung aller in den bergamtlichen Akten sich findenden Nachrichten über Steinkohlenvorkommen und stellte in dem hierzu erstatteten Bericht den Antrag, daß die beabsichtigte Untersuchung außer auf Steinkohle auch auf andere Mineralien ausgedehnt werden möchte. Zur Durchführung dieses Antrages genehmigte das sächsische Finanzministerium 1789 die erforderlichen Geldmittel auf eine Reihe von Jahren hinaus. Unter Oberleitung erster Fachmänner (Bergrat A. G. Werner, später Bergkommissionsrat C. A. Kühn) wurden nun die einzelnen Landschaften Sachsens von besonders befähigten Studierenden der Bergakademie Freiberg (gegründet 1765) untersucht und die Ergebnisse in Form geognostischer Monographien mit einer petrographischen Karte eingereicht. Sie sind im Archive der ersten geognostischen Landesuntersuchung von Sachsen bei der Bergakademie aufbewahrt und die das Flöhaer Becken betreffenden oder streifenden Nummern 8, 9, 27, 55, 99, 130 III, V boten eine gute Ausbeute für die vorliegende Arbeit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine
Ergänzung hierzu von uns: Der damalige Obereinfahrer in Freiberg, Carl
Amandus Kühn, verfaßte „auf allerhöchsten Befehl“ einen
Zwischenbericht mit Datum vom 20. August 1818 zur geognostischen Untersuchung
des Königreiches Sachsen, namentlich über die dabei „aufgefundenen
Lagerstätten gemeinnützlicher und besonders brennlicher Fossilien“ (der auch
von P. Kleinstäuber schon angeführte Bestand, heute im Sächsischen Staatsarchiv,
Bergarchiv Freiberg, Archivaliensignatur 40003, Nr. 59). In dieser
Originalquelle aus der Zeit anfangs des 19. Jahrhunderts, und zwar im dritten
Kapitel über den zwischen der Zwickauer und der Freiberger Mulde gelegenen
Teil Sachsens (Rückseite Blatt 112ff), im Abschnitt C. über Lagerstätten
brennlicher Fossilien in solchem (Rückseite Blatt 114ff) unter
I. Schwarzkohlen
(Blatt 125ff) gleich an zweiter Stelle nach Zwickau – was die Bedeutung dieses
Bergbaureviers zu jener Zeit unterstreicht – beschreibt Kühn auch das:
§51. b. Kohlengebirge bei Gückelsberg. „Der zweite Punkt in der betrachteten, großen Kohlengebirgsparthie, wo bereits Kohlenflötze ausgerichtet worden sind, ist zu Gückelsberg und Flöha. Das hier befindliche Kohlengebirge bildet die äußerste Endschaft der §48. überblickten, ausgebreiteten Kohlengebirgsparthie gegen Morgen, und zieht sich auf etwa ¾ Stunde Länge, bei 1 ½ Viertelstunde Breite, von der Zschopau weg am mitternächtlichen Ufer der Flöha hin. Die Kohlenlager, welche im Kleinen eine sehr unregelmäßige Lage haben, fallen im Großen gegen Mittag, ihre Zahl und Verbreitung ist jedoch noch nicht vollkommen ausgemittelt. Inzwischen sind durch den Herrn Erbrichter Schippan zu Flöha solche Einrichtungen getroffen, daß er mit der Zeit das ganze höffige Kohlengebirge aufgeschlossen zu (haben?) hoffen darf. Erstens betreibt derselbe nehmlich bereits mittelst angelegtem Gezeug einen Tiefbau, in welchem man 3, zusammen 1 Elle bis 1 Elle 16 Zoll mächtige, kohlenführende Flötze gemeinschaftlich abbaut. Dann läßt derselbe einen, jenen Tiefbau in 6 Ltr. Saigerteufe lösenden, im Wetzelbachthale zwischen Flöha und Gückelsberg angesetzten Stolln, der bereits auch die Kohlenflötze erreicht hat, herantreiben. Endlich beabsichtigt derselbe auch, einen, noch tieferen, sein Mundloch an der Flöha habenden, jenen ersten 14 Lr. saiger unterteufenden, Hauptstolln gegen Mitternacht Morgen in das Kohlengebirge einzubringen. Letzterer Stolln ist bereits 132 Lr. erlängt und bis zur Erbrechung der Kohlen nur noch 130 – 1340 Lr. weiter zu treiben. Mit demselben dürfte man vielleicht noch unter dem tiefsten Punkt einkommen, bis zu dem die betrachteten Kohlenflötze niedersetzen, und folglich hat man die Aussicht, diese Flötze in ihrer ganzen Verbreitung lösen zu können. Diese Verbreitung scheint aber keineswegs unbedeutend zu seyn, indem man das Ausstreichen der Kohlenflötze gegen Abend noch ⅛ Stunde unterhalb des sehr langen Dorfes Flöha, nach Bräunsdorf zu, wahrgenommen hat, und keine Ursache vorhanden ist, weshalb sie sich nicht auf der andern Seite gegen Morgen, bis jenseits Gückelsberg erstrecken sollten. Die weitere Erlängung des Stollns von den jetzt bekannten Flötzen in Mitternacht dürfte auch wohl noch zur Anfahrung mehrerer Flötze führen. Auf einem dergleichen, tiefer liegenden Flötze möchte es auch wohl seyn, auf dem der, von dem Schippan’schen weiter in Mitternacht gelegene, Kögel’sche Bau verführt wird. Hier verhaut man in 7 bis 10 Ellen Tiefe unter Tage ein zuweilen bis 1 Elle mächtiges Kohlenflötz, welches in mehrerer Teufe vielleicht zu einer mächtigen Lagerstätte werden dürfte. Mit Wahrscheinlichkeit darf man daher vermuthen, daß sich mit der Zeit in der betrachteten Gegend ein nicht unbedeutender Kohlenbergbau erheben wird.“ Unter den hier genannten Personen wird im weiteren Text von Paul Kleinstäuber insbesondere auf den Erbrichter Schippan ob seiner Verdienste um die Entwicklung des Gückelsberg‘er Steinkohlenbergbaus noch ausführlich eingegangen. Bei dem von Kühn hier noch genannten Namen Kögel dürfte es sich um den Großhändler Carl Adolph Kögel aus Altenberg handeln, der just im Jahre 1818 die Konzession erhielt, „auf dem, dem Bauern Christian Friedrich Ulbricht in Flöha gehörigen Gelände des sogenannten halben und ganzen Hofes, ein Steinkohlenbergwerk zu errichten“. Die Ulbricht’schen Felder lagen bereits auf Flöha’er Flur. Damit zurück zum Originaltext Paul Kleinstäuber's.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bis zum Jahre 1830 waren alle Vorarbeiten zu dieser ersten geologischen Landesaufnahme beendet. Es folgte nun Prüfung und Zusammenstellung der Ergebnisse, die zur Erzielung zuverlässiger Endresultate eine nochmalige Begehung des ganzen Landes erforderte und zehn Jahre in Anspruch nahm. Sie wurde durch die Professoren Naumann und Cotta, damals beide in Freiberg, durchgeführt. Diese gaben dann die in 12 Sektionen erschienene geognostische Karte des Königreiches Sachsen auf öffentliche Kosten heraus. Dieses Kartenwerk, das erste seiner Art, erschien im Jahre 1844 vollständig und bildete mit den dazugehörigen Erläuterungen die wichtigste Grundlage für alle weiteren geologischen und bergmännischen Untersuchungen der sächsischen Kohlengebiete, insbesondere auch des Flöhaer Beckens.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diesen Arbeiten folgte auf Ministerialverordnung vom 8.4.1852 ein größeres Spezialwerk über die sächsische Steinkohle: „Die Steinkohlen Sachsens in ihrem geognostischen und technischen Verhalten geschildert“, wovon Prof. Geinitz den geognostischen, Prof. Stein den chemischen, Techniker Hartig den technischen und Kohlenwerksinspektor Köttig den geschichtlichen und statistischen Teil der Bearbeitung übernahm. Dieser umfassenden Arbeit gingen spezielle geognostisch-petrographische Untersuchungen voraus, aufgrund deren es Geinitz gelang, die schon von Naumann angenommene Altersungleichheit zwischen den Hainichen- Ebersdorfer Kohlenlagern einerseits und denen des erzgebirgischen Beckens mit seinen Nebenbassin von Flöha andererseits durch Vergleich der fossilen Pflanzen auf das Vollständigste nachzuweisen (in der von der Jablonowski- Gesellschaft, Leipzig, gekrönten Preisschrift). Die vier Bände der „Steinkohlen Sachsens“ erschienen 1856 bis 1861; die darin über Sachsen gewonnenen Resultate sind auch in das große Werk von Geinitz, Falck und Hartig: „Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder“ übernommen worden. Die erste geognostische Karte Sachsens von Naumann und Cotta war sowohl nach ihrem Maßstabe als ihrer ganzen ursprünglichen Anlage und Vorbereitung bei fortschreitender geologischer Erkenntnis nur als eine vorläufige Lösung einer genauen geologischen Landesaufnahme anzusehen. Seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde an einer für praktische Zwecke wirklich brauchbaren, zweiten geologischen Landesaufnahme gearbeitet. Sie wurde schon von Naumann durch geognostische Spezialkarten einzelner, besonders interessanter Landesteile mit erläuterndem Text vorbereitet. Die erste davon lieferte 1864 das Bild des Kohlenbeckens von Flöha. Auf solchen speziellen Vorarbeiten bauten sich dann die „Geologischen Specialkarten des Königreichs Sachsen“ mit Erläuterungen zu jeder Sektion auf, die unter Leitung von H. Credner in den 70er, 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom sächsischen Finanzministerium auf Meßtischblättern 1:25.000 herausgegeben wurden. Die Sektion Schellenberg- Flöha, später Augustusburg- Flöha, wurde dabei nach vorläufigen Aufnahmen von A. Jentzsch von 1873/1874 durch A. Sauer, Th. Siegert und A. Rothpletz in den Jahren 1879 und 1880 bearbeitet. 1905 erfolgte eine Nachprüfung und Neubearbeitung der ganzen Sektion durch Th. Siegert und C. Gäbert. Auf dieses Spezialwerk, sowie auf Credner's „Erzgebirgisches Faltensystem“ und „Geologische Landesuntersuchung des Kgr. Sachsen“, ferner auf die bis heute noch nicht veraltete geognostische Monographie Naumann's über das Kohlenbassin von Flöha gründet sich in der Hauptsache die nachfolgend gegebene Übersicht über die Entstehung und den Aufbau des Flöhaer Beckens, wobei die allgemeine tektonische Kenntnis der Erdrinde bis zu einem gewissen Grade vorausgesetzt, auf genaue petrographische Beschreibung der Formationen als zu weitgehend verzichtet wurde. Zur Veranschaulichung der Darlegungen benütze man das beigegebene Blatt 97, Sektion Augustusburg-Flöha, der geologischen Spezialkarte, in welchem der rhomboidale Umriß des Flöhaer Haupt-Kabongebietes schwarz eingezeichnet wurde, die östlichen und die westlichen Fortsetzungen des Beckens gestrichelt angedeutet wurden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Vorkommen von Steinkohle ist bekanntlich an eine bestimmte geologische Formation gebunden, an das Karbon- oder Steinkohlengebirge. Dieses gehört der paläozoischen Erdperiode an, also dem Weltalter, das auf das archäische folgte. Die archäischen Formationen bestehen in der Hauptsache aus Gneisen, Glimmerschiefern und Phylliten (Urtonschiefern), die als Erstarrungskruste der Erde und Ursedimentgesteine anzusehen sind und in denen keinerlei organische Reste gefunden werden. (Auf die neuere Streitfrage über die teilweise eruptive Entstehungsart der Gneise kann ich als Nichtfachmann nicht eingehen.) Für die Entstehung des Erzgebirges hat man nach der bisherigen Theorie die Ursache in der Abkühlung der Erde zu suchen, die zur Faltenbildung führte (neuerdings stellt man auch eine Theorie des magmatischen Druckes auf.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Erzgebirge stellt geologisch keinen selbständigen Gebirgszug dar, sondern bildet, wie dies die geologische Landesuntersuchung nachgewiesen hat, die südlichste Welle eines Faltensystems, dessen Bildung durch einen einseitigen Druck in der Richtung aus Südost verursacht wurde. Dieses „erzgebirgische Faltensystem“ nimmt fast den ganzen westlich der Elbe gelegenen Teil Sachsens ein und besteht aus drei Hauptfalten. Die höchste bildet das Erzgebirge im Süden, die mittlere das Granulit- oder sächsische Mittelgebirge und die unbedeutendste, nördlichste ist das Strehlaer oder nordsächsische Gebirge. Alle drei Falten haben übereinstimmenden geologischen Bau, gleiche nordöstliche Streichrichtung und ähnliche Ablagerungen jüngerer Schichten in den zwei, von ihnen eingeschlossenen Mulden. Der Anfang der Faltung fällt in die Zeit kurz nach Ablagerung der Phyllite, ins Silur und Devon. Zunächst war die Faltung noch gering, genügte aber, um schließlich die drei Sättel als flache, langgezogene Inseln aus dem Urmeer hervorzuheben. Die nachfolgenden Ablagerungen der paläozoischen Periode konnten daher nur in den noch von Wasser bedeckten Mulden vor sich gehen, von denen die südlichere, zwischen Erzgebirge und Mittelgebirge, das sogenannte erzgebirgische Becken mit dem Nebenbassin von Flöha bildete. Da die Sedimentbildungen der paläozoischen Schichten naturgemäß horizontal erfolgten, liegen diese Ablagerungen diskordant zu den aufgerichteten Schichten der archäischen Formation. Die Ablagerungen in der langen paläozoischen Periode erfolgten einesteils unter verschiedenen Verhältnissen, andernteils erfuhren die Bildungen im Laufe der Zeit je nach ihrem Alter mancherlei Umwandlung. So treten in den einzelnen Schichtenkomplexen charakteristische, sowohl petrographische, wie geologische und paläontologische Verschiedenheiten auf, nach denen man die paläozoischen Bildungen dem Alter nach in eine Cambrium-, Silur-, Devon-, Kulm- oder ältere Kohlenformation, eine jüngere oder produktive Steinkohlenformation und die Formationen des Rotliegenden und des Zechsteins gliedert. Von diesen haben sich im erzgebirgischen und Flöhaer Becken die silurischen und devonischen Schichten, sowie die der Kulmformation die horizontale Lage aber nicht erhalten, sie sind vielmehr im weiteren Verlaufe des Faltungsprozesses ebenfalls aufgerichtet worden und lehnen sich mit ihren steilen Rändern an die Wellen des erzgebirgischen Faltenwurfs an. Auf ihnen hat sich dann, natürlich wieder horizontal und also auch diskordant, die produktive Steinkohlenformation mit ihren Kohlenflözen abgelagert. Diese, sowie die später noch auf ihr entstandenen Formationen haben im großen erzgebirgischen Becken keine wesentliche Veränderung ihrer Lage mehr erfahren; im großen und ganzen muß also die Faltung des erzgebirgischen Systems in der jüngeren Steinkohlenperiode ihren Abschluß erfahren haben. Daß die Erdtätigkeit aber auch in den folgenden Perioden nicht ganz geruht hat (ja sich bis heute noch in gelegentlichen Beben bemerkbar macht) beweist das im ganzen Gebiet zahlreiche Auftreten von Eruptivgesteinen, die aus den bei und nach der Faltung durch Zerreißen der gespannten Gesteinsschichten entstandenen Spalten hervorbrachen und den verschiedensten Perioden angehören. Zu diesen Eruptivgesteinen gehören die Vorkommen von Granit, Syenit, Glimmer-Diorit, Porphyr, Basalt und Tuff in den verschiedensten Teilen des erzgebirgischen Faltensystems.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu den Wirkungen des Faltungsprozesses in paläozoischer Zeit gehört auch das Emporquetschen eines Urgesteinskeils mitten zwischen dem erzgebirgischen und mittelgebirgischen Sattel, von den Geologen das Frankenberg- Hainichener Zwischengebirge genannt, dessen Hebung der Zeit nach zwischen Kulm- und Steinkohlenformation fällt. Es setzt sich von Frankenberg noch über Altenhain-Braunsdorf bis nach Wiesa fort (vgl. die Karte) und hat dadurch eine Teilung der großen südlichen Karbonmulde in ein größeres westliches Becken, das eigentlich erzgebirgische, und in ein kleines östliches, das Flöhaer Becken, hervorgerufen. Zum erzgebirgischen Becken rechnet man auch noch seine Fortsetzung in der nordöstlichen Ecke, die Hainichen- Ebersdorfer Mulde, während das Flöhaer Becken als selbständiges Bassin anzusehen ist. Zum
Steinkohlenbergbau in diesem Becken gibt es bei uns einen weiteren
Die im erzgebirgischen, wie im Flöhaer Becken zur Ablagerung gelangten Schichten der Steinkohlenformation (und später des Rotliegenden) haben, wie schon oben angeführt, nur noch geringe Störungen erfahren, denn sie besitzen entweder eine horizontale oder doch nur wenig geneigte Lage nach der Beckenmitte. Wenn auch somit der Faltungsprozeß des erzgebirgischen Systems vor Ablagerung der jüngeren Steinkohlenformation in der Hauptsache beendet gewesen zu sein scheint, so kann man doch, wie schon oben gesagt, ein gänzliches Aufhören des „erdperipherischen Druckes“ nicht annehmen. Derselbe war zwar in der Folgezeit nicht stark genug, um Kohlenformation und Rotliegendes aus ihrer horizontalen Lage aufzurichten, genügte aber, um am Rande der südlichen Karbon- Mulde tiefgehende Spalten zu erzeugen, aus denen unter Ascheregen und Auswerfen von Schuttmassen mächtige eruptive Massen glutflüssigen Gesteins sich über die Schichten der Sedimente ergossen, die zur Bildung ausgedehnter Porphyrdecken und mächtiger Tufflagen führten. Während der jüngeren Steinkohlenzeit ist von diesen eruptiven Störungen in der südlichen Mulde jedoch nur das Flöhaer Becken betroffen worden, im erzgebirgischen Becken herrschte vollkommene Ruhe, daher konnte sich hier in den sumpfigen Niederungen und Rändern des Beckens ungestört eine üppig wuchernde Vegetation entwickeln und so das Material zur Bildung mächtiger Steinkohlenflöze liefern. Die gleiche Flora hatte sich anfänglich im Flöhaer Becken angesiedelt und die Bildung von Steinkohle eingeleitet, durch eine mächtige Porphyr- Eruption trat jedoch hier in der Mitte der produktiven Steinkohlenzeit eine Vernichtung der Vegetation und längere Unterbrechung der Kohlenbildung ein. In der Folgezeit hat sich dann die Flora zwar von neuem entwickelt, ist aber nicht zu solcher Üppigkeit gelangt, wie im erzgebirgischen Becken. So finden wir im Flöhaer Becken zwei durch eine mächtige Porphyrplatte getrennte Stufen der jüngeren Steinkohlenformation, eine vorporphyrische untere und eine nachporphyrische obere Stufe. In der Formation des Rotliegenden, die auf die Steinkohlenformation folgt, fanden an vielen Stellen des ganzen erzgebirgischen Beckens erneut heftige vulkanische Ausbrüche statt, die zu eingelagerten Decken von Porphyr und mächtigen Lagern von Tuff führten. Die üppige Sumpfvegetation der Steinkohlenzeit wurde zerstört oder doch in ihrer Entwickelung gehemmt; jedenfalls sind die Vorbedingungen für die Bildung von Kohlenflözen, namentlich auch der sumpfige Charakter der Erdoberfläche nicht mehr vorhanden gewesen, denn nur die untersten Schichten des Rotliegenden führen noch schwache Kohlenschmitzen, wie überhaupt die Sedimente des Rotliegenden arm an organischen Resten sind. Eine solche Eruptionsstelle im Zeitalter des Rotliegenden nimmt man im Zeisigwalde zwischen Chemnitz und Flöha an, weil dort der Porphyrtuff der Gegend seine größte Mächtigkeit hat. Von hier haben sich die ausgeworfenen Aschemengen nach allen Seiten, besonders aber nach Ost und West verbreitet, so daß auch das ganze Flöhaer Becken damit bedeckt wurde. An der Ausbruchstelle des Zeisigwaldes selbst wurde dabei das ganze Steinkohlengebirge zerstört, so daß hier von der Steinkohlenformation des erzgebirgischen beckens der östlichste Zipfel abgetrennt wurde, den man nun mit zum Flöhaer Beckens im weiter gefaßten Sinne rechnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Anfange der paläozoischen Periode hat die Mulde zwischen Erzgebirge und Mittelgebirge mit dem Meere, das sich westlich anschloß, noch in engster Verbindung gestanden, das beweist der marine Charakter des silurischen Kieselschiefers, in welchem sich Graptolithen, Radiolarien, Diatomeen und Algen finden. Je mehr aber im Laufe der Zeit dieser Meeresbucht durch den Strom fließenden Wassers die Zersetzungs- und Verwitterungsprodukte der sie umgebenden Bergsättel zugeführt wurden und sie dadurch verflachte, desto mehr trat das Meerwasser gegenüber dem zuströmenden Süßwasser in den Hintergrund. In der so allmählich entstehenden, sumpfigen Niederung siedelte sich eine eigentümliche Flora an, die im Kulm noch in wenigen, einfachen Arten auftritt, in der produktiven Steinkohlenperiode aber zur größten Entfaltung gelangt. Nach Geinitz herrscht in der Steinkohlenformation des erzgebirgischen Beckens und seiner Nebenbassins schon gänzlicher Mangel an Meerespflanzen, so daß die Steinkohlen derselben wahrscheinlich Produkt einer Süßwasser-Vegetation sind. Vielleicht ergoß sich das Süßwasser der Becken erst in der Gegend von Zwickau an einer schmalen Stelle in das sächsisch-thüringische Karbon-Meer (später Zechsteinmeer). Die Pflanzen des Kulms und der produktiven Steinkohlenperiode stimmen zwar im großen überein, indem sie hauptsächlich Gefäßkryptogamen sind, dennoch weist jede Formation bestimmte Pflanzen auf, die bei der Bildung der Schichten und Flöze überwogen haben und die man Leitfossilien nennt. Nach dem Vorkommen dieser Leitfossilien bestimmt man die Zugehörigkeit der Steinkohlenflöze zu den Formationen und Unterstufen derselben. Geinitz, der sich als Paläontologe der Steinkohlenformation größte Verdienste erworben hat, gibt (in den „Steinkohlen Deutschlands“) folgende chronologische Übersicht über die Steinkohlenablagerungen in Sachsen:
*) Farre… veraltet für „Farne“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dieser Übersicht ist die lange ungestörte Entwickelung der Steinkohlenformation des erzgebirgischen Beckens von der Sigillarienzone bis zur Zone der Farren ersichtlich, während im Flöhaer Becken die Calamitenzone (Zwickauer Schichtkohlenflöz) mit der Zeit der eruptiven Porphyrbildung zusammenfällt, während welcher sich keine Kohle bilden konnte. Auch die obersten Schichten der Sigillarienzone wurden hier durch den Porphyrausbruch zerstört und kamen nicht zur Entwickelung, denn ein Gegenstück zu dem der oberen Sigillarienzone angehörigen Rußkohlenflöz von Zwickau ist im Flöhaer Becken nicht vorhanden. Infolge der Beckennatur der ganzen südlichen Mulde zwischen Zwickau und Flöha siedelte sich die Vegetation zuerst an den seichteren Rändern an und drang mit zunehmender Verflachung durch Anschwemmungen nach der Mitte vor. So gelangten die tieferen Kohlenflöze mehr an den Rändern der Mulde (Zwickauer, Würschnitzer, Flöhaer Gebiet) zur Entwickelung, die höhern mehr längs der Mitte der Mulde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)
Geologische Verbreitung des Flöhaer Karbons
Die Ablagerungen der produktiven Steinkohlenformation des Flöhaer Beckens im weiteren Sinne erstrecken sich von schmalen Anfängen im Oederaner Wald (östlich von Flöha) aus nach Westen mit zunehmender Breite über die Fluren der Gemeinden Falkenau, Flöha – Gückelsberg, Plaue – Bernsdorf, Altenhain, Niederwiesa, Oberwiesa, Euba bis gegen den Zeisigwald bei Gablenz und den Imsberg bei Lichtenwalde. Hier wurden sie durch die im vorangegangenen Abschnitt erwähnten Eruptionen in der Periode des Rotliegenden zerstört und von den Ablagerungen im erzgebirgischen Becken, die westlich von Chemnitz wieder beginnen, getrennt. Sie ruhen im Osten auf den archäischen Gesteinen des Erzgebirges (Glimmerschiefer und Phyllite), nach Westen hin auch auf Gneisen und älteren Formationen des Hainichen- Frankenberger Zwischengebirges (Silur, Devon und Kulm).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durch das Zutagetreten von zwei Gesteinsriegeln dieser älteren Formationen wird das Steinkohlengebirge des Flöhaer Beckens (im weiter gefaßten Sinne) in drei verschieden große und ungleich entwickelte Gebiete zerlegt, nämlich in
Zwischen dem eigentlichen Becken von Flöha und dem östlich davon gelegenen des Oederaner Waldes zieht sich eine mindestens 1.700 m breite Zone von archäischem Gestein durch (Phyllite und Glimmerschiefer), so daß ein ehemaliger Zusammenhang zwischen beiden Becken nicht wahrscheinlich ist. Der Teil des Karbons im Oederaner Wald wird vielmehr ein kleines Becken für sich gebildet haben, das seicht und durch Anschwemmungen bald ausgefüllt war; die Ablagerung von Kohlenflözen mußte also unbedeutend bleiben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von den Ablagerungen des westlichen Teils ist aber das eigentliche Becken nur durch eine schmale, stellenweise kaum 200 m breite Zunge älteren Grundgebirges getrennt (südlich der Zschopau, zwischen dem Struthwald und Wiesa: Glimmerschiefer, nördlich der Zschopau bei Braunsdorf und Altenhain: Devon, Gneis und Hornblendeschiefer). Dieser schmale Gebirgsriegel hat das Steinkohlengebirge des Flöhaer Hauptbeckens nur so lange von dem des großen erzgebirgischen Beckens geschieden, bis dessen ältere Schichten von dem erwähnten Porphyrerguß überdeckt wurden, also während der Ablagerung der unteren, vorporphyrischen Stufe, während die Bildungen der oberen, nachporphyrischen Stufe sich über die trennende Schranke hinweg in das große erzgebirgische Becken erstreckten, bis sie im Rotliegenden durch die Eruptionen im Zeisigwald teilweise zerstört und wieder von denen des erzgebirgischen Beckens getrennt wurden. So finden sich im Westen nur die jüngsten Schichten der oberen Stufe, im Osten, im Oederaner Wald, nur die älteren Schichten der unteren Stufe des Flöhaer Karbons, während im Hauptbecken beide Stufen vollständiger entwickelt und mit stärkeren Flözen ausgestattet sind, so daß Steinkohle nur hier abbauwürdig gefunden worden ist. Dieses Hauptbecken von Flöha hat ungefähr die Gestalt eines Rhomboids, dessen längste Seite sich nördlich der Flöha und Zschopau von der östlich Gückelsberg herabkommenden Schlucht in westnordwestlicher Richtung bis zum nordwestlichen Rande des Frauenholzes bei Altenhain erstreckt. Die gegenüberliegende, annähernd parallele Seite auf dem südlichen Ufer der Zschopau zieht sich von der Mündung des Schwarzbaches in die Zschopau (südlich von Plaue- Bernsdorf) durch den Hahngrund des Struthwaldes in westnordwestlicher Richtung bis an den westlichen Abhang der höchsten Porphyrkuppe des Struthwaldes. Diese beiden Seiten bilden die nördliche und südliche Begrenzung des Beckens; die östliche Grenze läuft als Verbindungslinie dieser Seiten vom Schwarzbach in nordöstlicher Richtung quer durch die Zschopau und Flöha nach der Schlucht östlich von Gückelsberg, die westliche in fast genau nord-südlicher Richtung vom Frauenholz bei Altenhain über die Zschopau bei Niederwiesa nach der Porphyrkuppe des Struthwaldes. Die längere Diagonale von Südost nach Nordwest mißt ungefähr 7 km, die kürzere von Südwest nach Nordost etwa 5 km.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese geometrischen Grenzlinien stimmen natürlich nicht überall genau mit den wirklichen Beckengrenzen überein, da einmal der Beckengrund von Anfang an unregelmäßig geformt war und weil durch spätere Erosion diese Unregelmäßigkeit noch vergrößert wurde. Als hauptsächliche Abweichungen finden sich:
Das Hauptbecken wird durch das breite Tal der Flöha und (nach deren Mündung in die Zschopau) durch das Zschopautal in eine nördliche und südliche Hälfte zerschnitten, die südliche Hälfte durch die Zschopau bis zur Aufnahme der Flöha nochmals in einen kleinen Teil zwischen beiden Flüssen und in einen größeren, der in der Hauptsache durch den Struthwald bedeckt ist. Die in der Geschichte des Kohlenbergbaus wichtigere nördliche Hälfte umfaßt hauptsächlich die Fluren von Gückelsberg, Flöha und Altenhain. Die Täler der Zschopau und Flöha haben das ganze Steinkohlenbecken tief durchschnitten und dabei einen großen Teil des Steinkohlengebirges wieder vernichtet und weggeschwemmt, so daß die einst einheitliche Ablagerung in die genannten Teile zerlappt worden ist. Der südliche Teil (Struthwald) liegt infolge einer Verwerfung, die ungefähr die Richtung des Zschopautales einhält, etwa 50 m höher, als der nördlich der Flöha und Zschopau gelegene (vergleiche Profil der geologischen Karte). Außer dieser größeren Verwerfung haben noch einige kleinere, fast rechtwinkelig darauf gerichtete Spalten geringere Niveauunterschiede erzeugt, so am nördlichen Gehänge der Zschopau am sogenannten Forstbachgraben und zwischen der vorderen und hinteren Ulbrichtschlucht, ferner in der Nähe des Flöhaer Bahnhofs und bei Bernsdorf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im allgemeinen zeigen die Schichten des Karbons im Flöhaer Becken ein schwaches Einfallen nach der vertieften Beckenmitte, daneben noch eine geringe Neigung nach Osten, da die Ostseite der Ablagerungen später eine Senkung erfahren hat. Die nördlich der Flöha und Zschopau gelegene Hälfte des Beckens, die wir kurz die nördliche Platte nennen wollen (bei Naumann: „Nördliches Plateau“) wird im Westen durch ein kleines, aber tief eingewühltes Tal begrenzt: das sogenannte „Dachsloch“ an der Finkenmühle von Niederwiesa, die östliche Grenze bildet die schon genannte zwischen Gückelsberg und Falkenau herabkommende Mulde. Außerdem wird die Platte noch durch vier kleine, von Nordost nach Südwest verlaufende Täler zerschnitten, die von Westen nach Osten Forstbachgraben, hintere Ulbrichtschlucht, vordere Ulbrichtschlucht, Wetzelbachtal (auch Lärchental) heißen. Den westlichen, größeren Teil der südlichen Beckenhälfte, den also die Zschopau vom Becken abschneidet, wollen wir entsprechend südliche Platte nennen. Sie wird bis auf die nähere Umgebung von Bernsdorf vom Struthwalde bedeckt. Ihre östliche Grenze bilden Zschopau und Schwarzbach, die westliche der Erlbach. Auch sie wird außerdem von vier Tälern zerschnitten, wenigstens teilweise, die von West nach Ost die Namen Schalgrund, Tiefer Graben, Sattelgutsbach und Hahnebach führen. Letzterer bildet im Mittellauf zugleich die südliche Begrenzung gegen den Tonschiefer. Durch den Struthwald führen drei Hauptwege: der Wiesaer oder Wiesener Flügel, der von Bernsdorf aus ziemlich genau auf die Kammlinie der Platte nach Oberwiesa läuft; der Mühlflügel, fast parallel dazu 60 m nördlicher; der Hauptflügel, der die beiden erstgenannten in genau nord-südlicher Richtung schneidet. Die höchste Erhebung bildet die Porphyrkuppe nahe der südwestlichen beckengrenze, außerdem ragt zwischen Wiesener und Mühlflüger der Grünitz- (früher auch Krienitz-) Hübel ziemlich steil auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der kleine zwischen der Flöha und Zschopau eingeschlossene Teil des Steinkohlenbeckens, den wir mit Naumann „die östliche Porphyrplatte“ nennen wollen, läßt an der Oberfläche hauptsächlich Porphyr erkennen, indem durch starke Denudation die obere Stufe des Steinkohlengebirges fast gänzlich zerstört worden ist. Diese Platte trägt heute die Anlagen des Flöhaer Bahnhofs und hat für die Geschichte des Kohlenbergbaus die geringste Bedeutung. Wie schon im vorigen Abschnitt bei der Entstehung und Struktur des Flöhaer Steinkohlenbeckens berührt, gliedert sich das Flöhaer Karbon in drei Abteilungen:
Die obere und die untere Stufe haben etwas abweichende petrographische Zusammensetzung, ihre Ablagerungsbezirke decken sich auch nicht überall genau.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.)
Die untere,
vorporphyrische Stufe (in der Karte
co1)
... besteht vorherrschend aus Konglomeraten (von unten Quarz, Gneise, Glimmerschiefer, Phyllit, Kiesel-, Quarzit- und Hornblendeschiefer, Granit), ferner aus Sandsteinen und Schiefertonen mit Steinkohlenflözen. Der Sandstein ist grau bis gelbbraun, der Schieferton hell- bis dunkelgrau. Die ganze Formation ist nördlich der Zschopau, wo sie zwischen Altenhain und dem Forstbachgrunde ihre größte Breite (über 1.200 m) und Mächtigkeit (bis 100 m) hat, in zwei Steinbrüchen sehr günstig aufgeschlossen, der eine am Wege nach Braunsdorf zwischen hinterer Ulbrichtschlucht und Forstbachgraben, der andere oberhalb desselben Weges bei der Finkenmühle, beide von Herrn Lehnert, Flöha, gepachtet und abgebaut. In beiden Brüchen sind auch zwei, bis 30 cm starke Kohlenflöze zu beobachten. Am Dachsloch und in der vorderen Ulbrichtschlucht finden sich Ausstriche der Kohlenflöze, die zu den ältesten Abbauversuchen führten. Die untere Stufe ist dann noch längs des nach der Zschopau abfallenden Südrandes der nördlichen Platte bis in die Nähe des Wetzelbachtales bloßgelegt, während sie am nördlichen und nordöstlichen Rande von den übergreifenden Lagerungen der oberen Stufe verhüllt wird.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf der südlichen Platte ist die untere Karbonstufe längs des nördlichen Randes durch die Erosion der Zschopau vom Erlbach bis über den Tiefen Graben hinaus freigelegt, dann wird sie südostwärts von der Porphyrdecke verhüllt, um erst wieder an der Straße von Bernsdrof nach Erdmannsdorf vor der Einmündung des Schwarzbaches sehr deutlich aufzutreten. Am Süd- und Westrande wird sie vollständig vom Porphyr und der oberen Stufe verdeckt. Auf der östlichen Porphyrplatte zwischen der Flöha und der Zschopau, sowie in den östlich und südöstlich davon in das Gebiet der Phyllite vorspringenden Seitenbuchten des Beckens bildet die untere Karbonstufe nur kleine, vom Porphyr und Porphyrtuff überdeckte Lappen am Plau-Berge, an der Eisenbahnlinie von Flöha nach Falkenau, bei der Schweddey und an der Eisenbahnlinie Flöha-Erdmannsdorf zwischen Flöha und der Schweddey. In dem kleinen Nebenbecken des Oederaner Waldes tritt die untere Stufe saumartig am Ostrande des Porphyrtuffs hervor, außerdem in einer kleinen, den Tuff durchragenden Kuppe im Höllengrund.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.)
Der Deckenerguß von Quarzporphyr
(in der Karte Po),
...blaßrötlich bis rötlichgrau, lagerte sich ursprünglich continuierlich 20 m bis 50 m mächtig über die untere Steinkohlenstufe, ist aber, wie diese, an vielen Stellen durch die Erosion wieder zerstört worden und durch oberes Karbon, Porphyrtuff und Lehm verdeckt. Auf der nördlichen Platte tritt die Porphyrdecke am Südabhange zwischen Forstbach und hinterer Ulbrichtschlucht über der untern Karbonstufe an die Oberfläche und ist hier in einem Steinbruch an der Frankenberger Straße (Besitzer Fr. Achsten, Pächter Gustav Grundmann) aufgeschlossen. Weiter westlich, am Steinberge, bei Altenhain, erscheint noch eine schmale, durch Erosion isolierte Strecke, in der sich auch Steinbrüche befinden. Vom obern Ende der hintern Ulbrichtschlucht zieht sich dann längs des Nordrandes der nördlichen Platte der Porphyrausstrich bis zur vorderen Ulbrichtschlucht, wird aber von hier ab wieder durch Porphyrtuff und oberes Karbon verdeckt, um erst im Oberlaufe des Wetzelbaches wieder zu erscheinen. An der Ostseite der nördlichen Platte bedeckt dann wieder der Tuff alle darunterliegenden Formationen, an dem restlichen Teil des Südabhanges aber zwischen Gückelsberg und vorderer Ulbrichtschlucht läßt sich überall der Porphyr in halber Höhe, teilweise über der untern Karbonatstufe nachweisen. In ihm befinden sich bei Flöha die Steinbrüche der Firma Helbig & Röhl und bei Gückelsberg der Herrn von Einsiedel gehörige, von derselben Firma gepachtete Bruch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Nord- und Osthange der Südplatte bildet der Ausstrich des Porphyrs einen breiten Saum vom Erlbachtale bis zum Schwarzbach, indem hier die obere Karbonstufe auf große Strecken abgewaschen ist, nach Osten hin ist er allerdings teilweise durch eine dünne Lehmschicht bedeckt. Am Süd- und Westrande der Platte tritt er in Form mehrerer Inseln durch die hier alle anderen Formationen überlagernde obere Stufe hindurch zutage. In der kleinsten dieser Inseln befindet sich auch ein nicht mehr abgebauter Porphyrbruch. In der östlichen Porphyrplatte ist der Porphyr fast ganz von der oberen Steinkohlenstufe befreit und durch die Eisenbahnlinien und die fiskalischen, früher von Liebscher & Otto abgebauten Steinbrüche gut aufgeschlossen. Auch in der östlich und südöstlich anschließenden Seitenbuchten des Flöhaer Beckens ist der Porphyr stellenweise (so auf beiden Seiten des Schweddeybaches) von Porphyrtuff überdeckt, die vorherrschende obere Formation. Der Porphyrerguß hat sich auf das eigentliche Becken von Flöha beschränkt, so finden wir ihn weder im Nebenbecken des Oederaner Waldes, noch in den westlich an das Hauptbecken sich anschließenden Teilen des Flöhaer Karbons im weiteren Sinne.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.) Die obere oder nachporphyrische Stufe
(in der Karte co2),
ist zwar ebenso, wie die untere Stufe aus Konglomeraten, Sandsteinen und Schiefertonen mit schwachen Kohlenflözen zusammengesetzt, doch herrschen hier die Sandsteine und Schiefertone vor, namentlich im Osten. In den Konglomeraten treten neu die dem karbonischen Porphyr des Flöhaer Beckens entstammenden Quarzporphyr-Gerölle auf, die der vorporphyrischen Stufe naturgemäß noch fehlen. Die Sandsteine sind gelblich bis rötlichgrau gefärbt, die Schiefertone meist hellgrau, zuweilen rötlich, besonders nach Westen zu. Mit dieser Annäherung an die Schieferletten des Rotliegenden geht eine Verringerung und Verschlechterung der Kohlenflözchen, die hauptsächlich den unteren Schichten der Stufe angehören, nach Westen zu Hand in Hand, bis sie westlich der Linie Lichtenwalde- Wiesa- Euba fast ganz aufhören. Die Mächtigkeit der oberen Stufe schwankt zwischen 20 m und 60 m, nur nach Westen zu reicht sie über die Grenze der Porphyrplatte hinaus, überschreitet damit die alte Grenze des Flöhaer Beckens und erstreckt sich in das Gebiet des großen erzgebirgischen Beckens, wo sie analog den gleichaltrigen Ablagerungen von Zwickau und Lugau- Oelsnitz die Unterlage für das später entwickelte Rotliegende abgibt. Durch den schon wiederholt angeführten eruptiven Ausbruch des Zeisigwaldes, sowie durch die im Flöhaer und erzgebirgischen Beckens sehr intensiv tätig gewesene Denudation ist jedoch der größte Teil dieser oberen Stufe später wieder zerstört und abgetragen worden, so daß von der ursprünglich von Gückelsberg und Plaue aus ununterbrochen bis über Chemnitz hinaus sich erstreckenden Ablagerung nur noch Reste übriggeblieben sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der größte, auch noch stärkere Kohlenflözchen führende Teil dieser oberen Stufe lagert sich auf der nördlichen Platte des eigentlichen Flöhaer Beckens von der hinteren Ulbrichtschlucht nach Osten zu auf der Höhe entlang bis über Gückelsberg hinaus, ist freilich nur an wenigen Stellen (so in den alten Steinbrüchen des Lehngerichtes auf der Höhe nördlich Flöha und in kleineren Brüchen und Schürfen im Wetzelbachtal) deutlich aufgeschlossen, im übrigen durch Porpyrtuff und Lehm verdeckt. Im Wetzelbachtale streicht auch an verschiedenen Stellen eines der vier Kohlenflözchen der oberen Stufe zutage und hat Veranlassung zu den frühesten Schürfversuchen in dieser Gegend des Beckens gegeben. Auf der östlichen Porphyrplatte, zwischen der Flöha und Zschopau, sind nur noch Schollen der oberen Stufe durch Verwerfung oder Einklemmen zwischen den Porphyr der Abwaschung entgangen, in den östlich und südöstlich anschließenden Seitenbuchten des Beckens sowie im Nebenbecken des Oederaner Waldes finden sich keine Spuren mehr davon. Diese Partien des Beckens mögen wohl auch zur Zeit der Ablagerung der oberen Stufe schon ausgefüllt gewesen sein und nicht mehr unter Wasser gestanden haben. Die Höhen der südlichen Platte hingegen werden im Wesentlichen von den Ablagerungen der oberen Karbonstufe gebildet. An dem Wege, der vom Wiesener Flügel südwestlich nach der Porphyrkuppe führt, sowie am Wiesener Flügel selbst kann man den Ausstrich eines der schwachen Kohlenflöze beobachten, der den Kohlenbergbau in diesem Teil des Flöhaer Beckens veranlaßte. Wie schon mehrfach erwähnt, dehnen sich die Bildungen der oberen Stufe dann über den Westrand des alten Flöhaer Beckens, namentlich der südlichen Platte, hinaus und erstrecken sich unter Überschreitung des alten Grundgebirgsriegels in zunehmender Breite bis über Euba, Ober- und Niederwiesa und Lichtenwalde aus, sind freilich oft von Porphyrtuff, Rotliegenden und Lehm unterbrochen und bedeckt, neigen sich dort auch nicht mehr nach der Mitte des Flöhaer Beckens, sondern haben sich schon den im erzgebirgischen Becken herrschenden Lagerungsverhältnissen angepaßt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da ein Eingehen auf den paläontologischen Charakter des Flöhaer Steinkohlengebirges zu weit führen würde, begnüge ich mich mit dem nochmaligen Hinweis auf die angeführte Preisschrift von Geinitz und den Aufsatz Sterzel‘s im 7. Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz von 1881. Neuerdings ist die Kenntnis der Flora der untern Stufe noch bereichert worden durch eine Anzahl Versteinerungen, die im Jahre 1902 einem 75 cm mächtigen Schiefertonflöze im Kohlensandstein des Lehnert’schen Steinbruches an der Finkenmühle entnommen wurden und in den neubearbeiteten Erläuterungen zu Sektion Augustusburg- Flöha der geologischen Spezialkarte, S. 91, neben den anderen, früher im Flöhaer Karbon gefundenen Arten aufgeführt worden sind. Die Flora des Flöhaer Karbons ist die charakteristische Flora der produktiven Steinkohlenformation, ihre Arten kommen fast sämtlich auch bei Zwickau und Lugau- Oelsnitz vor. Floristisch gehört das ganze erzgebirgische Karbon dem mittleren Oberkarbon Deutschlands an, also den mittleren und oberen Saarbrücker Schichten. ____________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Darstellung des gesamten geologischen Aufbaus des Flöhaer Beckens macht sich noch ein kurzes Eingehen auf die nicht mehr karbonischen, jüngeren Schichten desselben notwendig. Der der Periode des Rotliegenden angehörige, gelblich oder rötlichweiße Porphyrtuff (To) ist von seiner Eruptionsstelle im Zeisigwalde nach Osten bis an die östliche Grenze des Flöhaer Beckens verweht worden und bildete ursprünglich eine continuierliche, wenn auch verschieden mächtige Zunge, die sich über alle älteren Formationen hinzog, so daß wir ihre Reste heute noch sowohl auf Glimmerschiefer und Phylliten, als auch allen paläozoischen Formationen auflagern sehen, freilich nur noch in vereinzelten Lappen, die durch weite Zwischenräume voneinander getrennt sind, in denen die älteren Gesteine infolge Denudation wieder hervortreten. Die Mächtigkeit dieser Reste ist sehr verschieden. Die Gückelsberger Schächte fanden sie bis zu 50 m, die Flöhaer bis 25 m und Bohrungen im Struthwalde 2,5 m mächtig. Von diesen Lappen sind folgende die wichtigsten:
Außer diesen größeren finden sich noch verschiedene kleinere Lappen der Tuffdecke, so zwei bei Oberwiesa auf dem Mittelrotliegenden und vor allem im Struthwalde (fünf Stück) und bei Bernsdorf, wo sie der oberen Karbonstufe und dem Porphyr auflagern; schließlich noch ein ganz kleiner Rest östlich vom Flöhaer Bahnhof auf der unteren Stufe der Steinkohlenformation. Der Grünitzhübel im Struthwalde wird in der Hauptsache von diesem Tuffe, der hier besonders hart ist, gebildet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da das Flöhaer Becken in der Hauptsache jenseits der südlichen Grenze des nordischen glacialen Diluviums liegt, so finden wir fast nur jungdiluviale Terassen (d3) in den Flußtälern und Lößlehmdecken (d4) auf den Gehängen und flachen Höhen. So wird das ganze linke Gehänge der Zschopau bei Plaue und Bernsdorf von einer solchen Terrasse gebildet, die sich nach der Vereinigung der Zschopau und Flöha auf der linken Seite bis Braunsdorf fortsetzt. Auf der rechten Seite der Zschopau breitet sich bei Plaue eine schwach ansteigende Terrasse mit Lößlehmdecke aus; am Bahnhof Flöha lagern die jungdiluvialen Bildungen bis 1 m mächtig über dem Porphyr. Decken von Lößlehm innerhalb des Flöhaer Beckens finden sich ferner in lappenförmigen Resten bei Lichtenwalde, südlich Altenhain, auf den Hängen rechts und links der vorderen Ulbrichtschlucht und östlich von Gückelsberg, ferner bei Ober- und Niederwiesa. In den Tälern der Flüsse hat sich alluvialer Sand und Lehm (a1) und alluvialer Flußkies (ak) abgesetzt; die kleineren Täler werden meist von alluvialem geneigtem Wiesenlehm (a8) ausgekleidet. ____________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Kapitel: Übersicht über die Entwickelung des Steinkohlenbergbaus in
Sachsen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)
Übersicht über die Entwickelung und Verfassung des älteren
Steinkohlenbergbaus in Sachsen
Zum Verständnis der nachfolgenden Kapitel über Geschichte, chemisch-technische Untersuchung und Statistik des Steinkohlenbergbaus im Flöhaer Becken ist es nötig, eine Übersicht über die Entwickelung und Organisation des Sächsischen Steinkohlenbergbaues bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, über die gesetzgeberischen Einwirkungen des merkantilistischen Staates auf ihn und über seine technischen Mittel und Betriebsweisen zu gewinnen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus der fortlaufenden Lagerung der Kohlenflöze in ausgedehnten Becken, deren Grenzen und Abbauwürdigkeit vor Inangriffnahme des Abbaues durch Bohrversuche unter Zuhilfenahme der geologisch-wissenschaftlichen Erkenntnis der Schichtenlagerung des Gebietes ziemlich genau festgestellt werden können, ergab sich für die Entwickelung des Kohlenbergbaus im Gegensatz zur sprunghaften, vom Zufall abhängigen des Erzbergbaus eine gewisse Stetigkeit, die nur von der Entwickelung des allgemeinen Wirtschaftslebens, des Gewerbes, Verkehrs und der Bergbautechnik abhängig war und deren Schwankungen folgte. Der frühe Steinkohlenbergbau entwickelte sich in Sachsen in der Guts- und gerichtsherrlichen Zeit, vor der Reformation stand er sogar unter geistlicher Autorität. Die Gutsherren waren die Patrone in ihrem Bezirk und hielten aufgrund des Verbandes, in dem sie zu ihren Untertanen standen, sich für berechtigt und verpflichtet, alle drohenden Beeinträchtigungen und Eingriffe von diesen abzuwehren. Der auf das Lehnsverhältnis gegründete größere Grundbesitz ermöglichte oft einen rationelleren Betrieb und Unternehmung gemeinnütziger Bergwerksarbeiten, wozu namentlich die Stollenführung zur Herbeiführung der schwierigen Grubenentwässerung gehörte. Auch sorgten die Großgrundbesitzer für Absatz der Kohlen bei den verschiedenen Zweigen ihres Wirtschaftsbetriebes, wie Kalköfen, Ziegelbrennereien, Erzhütten und Erzschmieden, Glashütten, Farbwerken, Vitriolfabriken. Noch wichtiger wurde in diesem Sinne später der staatliche Fiskus, der im 18. Jahrhundert schon eine Anzahl Steinkohlengruben erwarb und den Gebrauch der Steinkohlen 1736 in den Bergschmieden des sächsischen Regalbergbaus offiziell einführte, als mit zunehmendem Schwinden des Waldreichtums die Holzkohle teuer wurde. Er ging namentlich auch auf der Bahn des technischen Fortschrittes im Steinkohlenbergbau fördernd voran (fiskalische Werke im Plauenschen Grund: 1. Dampfmaschine im sächsischen Bergbau, 1. Koksherstellung in Sachsen, 1. Knappschaftskasse, seit 1835 schon achtstündige Schicht). Im Zwickauer Kohlenbergbau, dem ältesten in Sachsen, bildete sich frühzeitig ein selbständiges Innungswesen, indem die Kohleninteressenten jedes Ortes, die die „Kohlenladung“ hatten (d. h. das Recht, Steinkohlen zu graben und zu verkaufen), sogenannte Gewerkschaften errichteten. Die Innungssatzungen dieser Gewerkschaften sind als „Kohleordnungen“ bekannt. Diese regelten in der Hauptsache die sogenannte „Reihenladung“ und „Truhenladung“. Nach der Reihenladung durften die Innungsmitglieder ihre Kohlen nur in bestimmter Reihenfolge und nicht unter einem Mindestpreis verkaufen. Durch die Truhenladung aber wurden die Eisenverarbeiter der Gegend berechtigt, von sämtlichen Kohlengruben gute Kohlen nach der Truhenmasse*) billiger als andere Käufer zu erhalten. *) Eine Truhe war ursprünglich dem Karren gleich, also (nach Christian Friedrich Schulze's Betrachtung der brennbaren Mineralien) gleich 8 Bergkörben oder Bergkübeln; 1569 wurde sie auf 7 Körbe, später sogar auf 6 ½ Körbe = 13/16 Karren herabgesetzt. Anmerkung der
Redaktion: Ganz ähnliche Regelungen enthielt auch die Satzung
der „Kalkbörner-Innung“ zu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Kohleordnungen enthielten ferner eine große Zahl von Bestimmungen, durch die der von ihnen eingeführte Zwang aufrechterhalten und Hintergehungen verhütet und bestraft werden sollten. Das schnelle Aufeinanderfolgen von neun Kohleordnungen im 16. Jahrhundert (1520, 1532, 1551, 1557, 1569, 1579, 1583, 1593 und 1597) beweist einerseits, wie Handel und Wandel vor dem 30jährigen Kriege im Aufschwung begriffen war, andererseits aber auch, wie schon damals Beschränkung des freien Wettbewerbs dem Wesen des Steinkohlenbergbaus widersprach, so daß, um sie aufrechtzuerhalten, es immer neuer Verordnungen bedurfte. Im 17. Jahrhundert, wo Deutschlands Wirtschaftsleben durch den 30jährigen Krieg völlig zusammengebrochen war, haben wir keine Kohleordnung, erst im 18. Jahrhundert die von 1740. Als dann im Zeitalter des wirtschaftlichen Liberalismus alle Beschränkung des freien Wettbewerbs fiel, wurde die Reihenladung 1823 suspendiert, die Truhenladung hörte 1830 auf, mit ihnen die Innungsgewerkschaften. Da im Flöhaer Becken der stetige Abbau im großen Stile erst nach 1800 einsetzte, kam es hier nicht zu Institutionen, die den Zwickauer Innungsgewerkschaften und ihren Kohleordnungen entsprachen. Bis 1743 (1. Kohlenmandat des chursächsischen Staates) werden allerdings die Anteilseigner an einem genossenschaftlichen Kohlenbau im Flöhaer Becken als „Gewerken“ (wie beim Erzbergbau) zusammengefaßt. Außerdem müssen alle Bergwerke der Flöhaer Gegend (Metall- und Kohlenbaue) einen „Gewerkschaft“ genannten Verband gehabt haben, denn in den Zechenregistern der „Segen des Herrn Fundgrube“ zu Altenhain findet sich quartalsweise eine Abgabe von 3 Groschen „für die Gewerkschaften“. Dieser losere Verband hatte aber kaum den öffentlich-rechtlichen Charakter wie in Zwickau. Während der Betrieb des Erzbergbaus vom Mittelalter her landesherrliches Regal war, ist der erst mit ausgehendem Mittelalter einsetzende Kohlenbergbau im Allgemeinen in Sachsen dem Privatbetrieb überlassen geblieben. Die Steinkohlen galten (und gelten noch) als freieigener Bestandteil des Grundbesitzes. Der Landesherr begnügte sich mit dem Zehnten, der 1554 eingeführt wurde und mit der Beaufsichtigung des Kohlenbergbaus und Kohlenverkehrs. Damit blieben dem Kohlenbergbau auch alle Weitläufigkeiten der Mutung und anderer bergrechtlicher Vorschriften erspart, wie überhaupt die gesamte Rechtspflege nicht durch die Bergämter, sondern durch die örtlich zuständigen Gerichte der Guts- und Gerichtsherren oder der Städte ausgeübt wurde. So stand der Zwickauer Kohlenbergbau unter dem Justizamte Zwickau, das Streitigkeiten nach der Kohleordnung entschied. Im Plauenschen Grund allerdings wurden bergrechtliche Streitigkeiten vom Bergamte Freiberg entschieden. Flöha stand unter der Gerichtsbarkeit des Amtes Augustusburg, Gückelsberg unter der des reichsgräflichen Gerichtes von Lichtenwalde, Altenhain unter dem Justizamte Frankenberg. Bei Streitigkeiten wurden Gutachten vom Bergamte Freiberg eingeholt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An vorübergehenden Versuchen, den Steinkohlenbergbau zum Regal zu machen, hat es nicht gefehlt. Solche Bestimmungen sind für den Zwickauer Bergbau von 1554, 1582 und 1717 bekannt, sie scheiterten jedoch an dem einmütigen Widerstande aller Interessentengruppen; nur im Plauenschen Grunde, der zwischen Landeshauptstadt und der Hochburg des Erzbergbaus, Freiberg, lag, gelang es den Landesherren eine Zeit lang, die Kohle den edlen Metallen gleichzustellen und sie als Regal zu behandeln. Hier wurde 1542 dem Münzmeister Hans Bienert das Abbauprivileg erteilt und 1577 wurde das „Unterirdische zwischen Dresden und Freiberg“ ganz als Regal erklärt, doch erlangten die widerstrebenden Grundbesitzer endlich 1512 zwei günstige Entscheidungen der Bergschöppenstühle in Freiberg und Joachimsthal, in denen der Kohle die Eigenschaft eines Bergregals abgesprochen wurde. Dies hatte aber die nachteilige Folge, daß der Staat das Interesse am Steinkohlenbergbau verlor und ihn seinem Schicksal überließ, wozu die nun folgenden Zeiten des 30jährigen Krieges mit ihren Nachwehen ihr übriges beitrugen. Trotz der Befreiung des Kohlenbergbaus von den Regalpflichten sind jedoch im Flöhaer Becken bis zum ersten Kohlenmandat 1743 gewerkschaftlich organisierte Kohlenbau-Unternehmungen beim Bergamte Freiberg gemutet worden, wenn sie auf fremden Boden schürften, um gegenüber den Eigentümern des Oberirdischen ihre Grubengebäude zu sichern. Die Beschränkung des freien Wettbewerbs durch Kohleordnungen und Regalisierung, wie überhaupt der ganze wirtschaftlicher Freiheit abholde Geist, der bis ins 18. Jahrhundert das Staatswohl durch Verkehrsbeschränkungen (wiederholt eingeschärfte Verbote der Kohlenausfuhr), Privilegien und Monopole am besten wahrzunehmen glaubte, hatten doch indirekt wenigstens das Gute, daß dem Raubbau und einer Verschleuderung der Kohlenschätze vorgebeugt und diese so einer späteren Zeit vorbehalten wurden, die sie erst in ihrer ganzen Bedeutung würdigen konnte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die merkantilistische Zeitrichtung des 18. Jahrhunderts suchte dann durch Gesetze dem Steinkohlenbergbau wieder aufzuhelfen. Die gesetzgeberische Tätigkeit stand vor dem Problem, den Steinkohlenabbau aus nationalökonomischen Gründen zu begünstigen und den Anforderungen derjenigen gerecht zu werden, die sich dem volkswirtschaftlich wichtigen Geschäfte des Abbaues unterziehen wollten, zugleich aber auch nicht allzu schroff in die erworbenen Rechte der Grundeigentümer einzugreifen, unter deren Besitz die Kohlen lagerten. Als sich die Gesuche um bergrechtliche Mutung von Kohlengruben mehrten, auf welche Weise Nicht-Grundberechtigte den Abbau auf fremden Grund und Boden erzwingen und sich sichern wollten, wurde 1741 an das Oberbergamt Freiberg ein churfürstlicher Befehl erlassen, Vorschläge zur gesetzlichen Regelung dieses Problems zu machen. Das Oberbergamt überreichte daraufhin 1742 zwei Gesetzentwürfe, von denen der eine die alte bergrechtliche Mutung festhielt, wie sie bisher beim Metallbergbau üblich war, der andere enthielt die Grundsätze, die in das sogenannte ältere Kohlenmandat vom 19. August 1743 aufgenommen wurden, später auch in das neuere vom 10. September 1822. Nach diesen Kohlenmandaten soll es einem jeden nach vorausgegangener technischer und obrigkeitlicher Erörterung der Abbauwürdigkeit freistehen, auf fremden Grund und Boden Steinkohlen aufzusuchen und abzubauen, wenn der Grundeigentümer des Bodens dies binnen Jahresfrist nicht selbst tut. Hierdurch war sowohl dem Unternehmer die Bahn freigemacht, als auch dem Grundeigentümer die Möglichkeit gegeben, durch eigenen Abbau dem Eindringen Fremder in sein Grundstück vorzubeugen. Für den Fall, daß der Eigentümer nicht selbst abbaute, sondern ein Unternehmer auf seinem Grundstück, wurde dem Grundbesitzer nicht nur eine Entschädigung für den zum Abbau in Anspruch genommenen Raum der Oberfläche zugesprochen, sondern auch der „Kohlenzehnte („Tonnenzins“), wenn sich Kohlen fanden.
Weitere Informationen
zur hier beschriebenen Entwicklung der bergrechtlichen Regelungen zum
Steinkohlenbergbau finden unsere Leser auch im Beitrag zum
Steinkohlenbergbau bei
Auf dieser mit den Kohlenmandaten geschaffenen Rechtsordnung baut sich der ganze Kohlenbergbau im Flöhaer Becken nach 1743 auf. Von den Schwierigkeiten der weitläufigen „Mutung“, d. h. von dem an den Bergmeister als Vertreter des Landesherrn zu richtenden Gesuches um Verleihung des Bergwerkseigentums und den Verpflichtungen der Beleihung, war also der Steinkohlenbergbau endgültig und ausdrücklich frei, doch enthielt das erste Kohlenmandat noch die Bedingungen der Entrichtung eines Grundzinses oder „Kanons“ an das churfürstliche Kammer- und Berggemach. Das neuere Kohlenmandat von 1822 (das sich auch auf die Braunkohlen- und Torfgewinnung bezieht) faßt die Vorschriften des älteren noch genauer und weiter und regelt die Anlegung und Beschaffenheit der Stollen, Rechte und Pflichten der Stollenbeistzer gegenüber fremden Grundeigentümern, Kohlengewerbe und anderen Stollenbeitzern, sowie die Gebührnisse und Vorteile der Besitzer von Dampf- und anderen Maschinen zur Grubenentwässerung und die Verhältnisse der Gewerkschaften nebst den gegenseitigen Verbindlichkeiten der Gewerken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch befreite es nunmehr den Kohlenbergbau von allen Quatember- und Fristgeldern, sowie allen übrigen bisher üblichen Abgaben, endlich bestimmte es die Ressortverhältnisse beim Kohlenbergbau; oberste Behörde sollte das Geheime Finanzkollegium nebst den Justizkollegien sein, Unterbehörden die zuständigen Bezirks-Bergämter und Ortsobrigkeiten. Die Bergämter sollten auch die polizeiliche Aufsicht über die Kohlenwerke ihres Bezirks führen und jährlich mindestens eine Besichtigung vornehmen. Durch Verordnung vom 26.6.1851 ging dann später der Stein- und Braunkohlenbergbau an das sächsische Ministerium des Innern über, das durch Verordnung vom 20.8.1851 die Kohlenangelegenheiten seinen Verwaltungsorganen und diesen sachverständige Beamte beiordnete, die die Aufsichtsfunktionen auszuüben hatten, welche nach dem Kohlenmandat bisher den Bergämtern zustanden. Mit Verordnung vom 15.3.1853 wurden zwei Inspektionsbezirke geschaffen, zu Dresden und Zwickau. Mit Inkrafttreten des Allgemeinen Berggesetzes vom 16.6.1868 wurde der Kohlebergbau Sachsens einer größeren Zahl von Berginspektionen unterstellt; das einzige damals noch im Gang befindliche Werk des Flöhaer Beckens unterstand der Berginspektion Chemnitz. Die Entwickelung des Kohlebergbaus zu immer steigender wirtschaftlicher Bedeutung setzte in Sachsen mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts ein. Dies war auch die Zeit, wo die kleineren Becken von Flöha und Hainichen- Ebersdorf zum erstenmal in Angriff genommen wurden, wie die spezielle Geschichte in Kapitel III. zeigt. Die Entwickelung geht also parallel mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung. Einerseits ging der Holzreichtum der Wälder immer mehr zurück, so daß Brennholz und Holzkohle knapper und teurer wurde, auf der anderen Seite vermehrte sich ständig die Zahl der Gewerbebetriebe, die Brennmaterial brauchten. Der mit zunehmendem Kohlenbau steigende Grubenholzverbrauch bedingte dann selbst wieder höhere Holzpreise und wurde die Ursache für vermehrte Einführung der Steinkohle als Brennmaterial, auch für andere technische Zweige als die der Schmiede und Erzgießer, die ja vom Mittelalter her schon Steinkohlen benutzt hatten. Im Jahre 1718 fand Steinkohle zum ersten Male Anwendung in den Kalkbrennereien zu Wildenfels bei Zwickau, 1736 wurde sie auf Verordnungswege für die Freiberger Bergschmieden vorgeschrieben. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann man, auch die Ziegelöfen mit Steinkohlen zu beheizen. In Ch. Fr. Schulzes „Betrachtung der brennbaren Materialien“ wird 1777 die Steinkohle angelegentlichst statt der Holzkohle zum Kalk- und Ziegelbrennen empfohlen, bei Ziegelöfen zusammen mit Holz wegen der größeren Flamme. Seit 1796 verwendete man Steinkohlen auch zur Branntweinbrennerei, um dieselbe Zeit und schon vorher für Alaun- und Farbwerke, Vitriolfabriken, Glashütten usw. Es folgte die Einführung für Stubenöfen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im 19. Jahrhundert, als die letzten einengenden Beschränkungen für Abbau und Verkehr mit Kohle fielen, nahm dann die Verwendung der Steinkohle als Feuerungsmittel rasch zu durch die Begründung größerer industrieller Unternehmungen nach Einführung der Dampfmaschine. Es kam zur Aufnahme der Koksbereitung, einer englischen Erfindung („coakes“). Sie erfolgte auf dem Kontinent zuerst 1796 in Gleiwitz/Schlesien, in Sachsen zuerst 1807 auf dem fiskalischen Steinkohlenwerke zu Zaukerode im Plauenschen Grund, für die chursächsischen Bergwerke in Mansfeld, 1830 auch in Zwickau auf dem gewerkschaftlich-fiskalischen Werke „Junger Wolfgang“. Die Flöhaer Kohle war eine Art natürlicher Koks, so daß eine Verkokung nicht nötig war. Die Dampfmaschine wurde zugleich eine wichtige Gehilfin des Kohlenbergbaus zur Wasserhaltung und Förderung. 1820 wurde die erste in Zaukerode, 1826 die erste im Zwickauer Revier auf dem oben genannten Schachte aufgestellt; ihnen folgten rasch weitere, schließlich auch auf den kleineren Kohlenwerken, im Flöhaer Becken allerdings erst 1858. Durch sie wurden die Gruben befähigt, den höheren Anforderungen zu genügen, die in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts an sie herantraten. Die Erleuchtung der Städte mit Kohlengas kam auf und die Industrie mit der Dampfmaschine als Kraftquelle entwickelte sich rasch. Die Kohlenbezirke wurden zu großen Industriegebieten, da sich die Unternehmen wegen der billigen Betriebskraft mit Vorliebe dort ansiedelten. Ein Haupthebel zum Aufschwung des Kohlenbergbaus lag in dem Fortschritt des Verkehrswesens, erst Erbauung von Chausseen, dann von Eisenbahnen, die das Absatzgebiet erweiterten und gleichzeitig selbst große Mengen Brennstoff brauchten. Der im Zeitalter des Liberalismus mächtig aufstrebende Unternehmungs- und Assoziationsgeist fand im Kohlenbergbau ein günstiges Feld. Sein erstes Lebenszeichen waren die Knappschaften und Knappschaftskassen (1808 im Plauenschen Grund, 1827 für die Oberhohndorfer und Bockwaer Grubearbeiter); dann entstanden bald überall Gesellschaften zur gemeinschaftlichen Steinkohlengewinnung (1837 der Zwickauer Steinkohlen- Aktienverein). Vor dem 19. Jahrhundert waren alle Versuche gemeinschaftlichen Abbaus von Kohlenfeldern auf gewerkschaftlicher Grundlage, an denen es im 16. und 18. Jahrhundert nicht gefehlt hatte, am Widerstande der Grundbesitzer und dem solchen Unternehmungen abholden Zeitgeiste gescheitert. Ein Schulbeispiel werden wir in der Geschichte des Flöhaer Steinkohlenbergbaus im 18. Jahrhundert zu behandeln haben. (Der auch „Gewerkschaft“ genannte innungsartige Verband der Zwickauer Kohleinteressenten, der die Kohleordnungen herausgab, fällt nicht unter den Begriff der hier gemeinten Gewerkschaften zum genossenschaftlichen Abbau.) Erst durch die Kohlenmandate bekamen die Unternehmer freie Bahn gegenüber den Grundbesitzern.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die im 19. Jahrhundert entstehenden „Aktienvereine“ konnten sich durch Vereinigung der Kapitalien bei der Steinkohlengewinnung Hilfsmittel dienstbar machen, wie sie der einzelne Unternehmer überhaupt nicht oder nur in beschränktem Umfange anwenden konnte, namentlich Anstellung technisch gebildeter Beamter, geschicktere kaufmännische und technische Leiter, Anschaffung größerer Dampfmaschinen zur Wasserhaltung und Kohlenförderung, Anlage tieferer Schächte und Stollen. Bald konnten die Vereine bei der steigenden Nachfrage nach Steinkohlen Dividende in wachsender Höhhe verteilen; das hob ihren Credit und es fiel ihnen nicht schwer, neue Kapitalien durch Prioritätsaktien und Obligationen aufzunehmen. Der im Wachsen begriffene Kapitalismus bemächtigte sich in steigendem Maße der Steinkohlengewinnung, durch Zusammenlegung verminderte sich die absolute Zahl der kleineren Werke bei steigender Produktionsziffer, Verbilligung der Produktion und, durch den Wettbewerb veranlaßt, Sinken des Kohlenpreises waren die Folge. In den kleineren Becken, wie dem Flöhaer, lohnte sich wegen der geringen Mächtigkeit und Ausdehnung der Flöze und der teilweise sehr geringen Güte der ausgebrachten Kohle ein intensiverer Abbau, als Vorbedingung für den Großbetrieb auf assoziativer Grundlage nicht, die auf dieser Grundlage arbeitende, 1858 gegründete „Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft“ arbeitete mit großen Verlusten. Aus diesem Grunde waren die Werke des Flöhaer Beckens nach dem Bau der Eisenbahn, der ihr örtliches Absatzmonopol vernichtete, nicht mehr wettbewerbsfähig und der Abbau ging zwischen 1850 und 1880 ein. Der allgemeine Aufschwung des Steinkohlenbergbaus im Zeitalter des Kapitalismus und Verkehrs wurde der Totengräber für den Steinkohlenabbau im Flöhaer Becken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)
Die Technik des
älteren Steinkohlenbergbaus, besonders im Flöhaer Becken
Die Technik des älteren Steinkohlenbergbaus hat sich aus sehr einfachen Verhältnissen entwickelt. Da überall zuerst die Ausstriche der Flöze abgebaut wurden, so arbeitete man einfach im Tagebau in sogenannten Steinkohlenbrüchen. Die älteste in den Akten auffindbare Nachricht vom Kohlenbau im Flöhaer Becken ist die von einem „Steinkohlenbruche Schwarzer Adler Erbstolln“, 1700 bei Altenhain. In derselben Weise hat mehrere Jahrhunderte vorher der Zwickauer Kohlenbergbau begonnen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem aber die Ausstriche der Flöze bald abgebaut waren, war man gezwungen, zur Erreichung größerer Tiefen die Technik des älteren Erzbergbaus mit entsprechenden Modifikationen anzuwenden. Die erste Ausrichtung der Flöze erfolgte dabei entweder durch Bohrlöcher, zu deren Niederbringung man den Freifallhammer verwandte oder sofort durch Schächte (im Hangenden auch Stollen, die namentlich in der ersten Zeit im Flöhaer Becken gern angelegt wurden), die man unter Berücksichtigung der geologischen und Oberflächenverhältnisse so ansetzte, daß ein möglichst großer Feldteil von ihnen aus abgebaut werden konnte. In den meisten Steinkohlengruben Sachsens war beim Abbau der sogenannte Pfeilerbau üblich, auf den genauer einzugehen hier nicht möglich ist, denn das Flöhaer Becken hat sein durch die besonderen Umstände der Flöz- und Gesteinslagerung bedingtes, eigenes Abbausystem: Den Strebbau, der nicht so kostspielig wie der Pfeilerbau war, bei welchem man immer ein möglichst großes Abbaufeld voraussetzen mußte. Über den Strebbau folgen weiter unten genaue Einzelheiten. Um die Grubenbaue gegen Einfallen und die Bergleute gegen sich ablösende Gesteinsschichten zu sichern, wurden alle unterirdischen Anlagen entweder mit Grubenhölzern aus Nadelholz abgezimmert oder ausgemauert. Die Art der Zimmerung in den Strecken bis zum Abbauort hing vom Gesteinsdruck ab, unter dem sie standen, und konnte einfach oder doppelt sein. Manchmal brauchte auch nur das „Dach“ – der „Först“oder „First“ – eine Unterstützung mit sogenannten Kappen. Die Zimmerung in den Abbauen bestand meist nur in runden Holzstempeln, je nach Beschaffenheit des Dachgesteins wurden dann noch Bretter (Schwarten) eingezogen. Um die Räume, in denen die Kohle abgebaut war, rasch wieder zum Einbruch zu bringen und um das eingebaute Holz wieder zu gewinnen, wurde das Rauben der Stempel angewandt, eine der schwierigsten und gefahrvollsten Arbeiten, auf deren Technik ich aber nicht näher einzugehen brauche, da sie im Flöhaer Becken, wie wir noch sehen werden, meist nicht nötig war. In den Förderschächten (nur zur Kohleförderung) waren zur Leitung der Fördergefäße besondere Streichbäume angebracht, in den Fahrschächten, in denen die Personenförderung, meist auch die Wasserhaltung erfolgte, waren Ruhebühnen und Fahrkünste eingebaut. Im Flöhaer Becken waren oft Fahr- und Förderschächte (auch „Ziehschacht“ genannt) zusammen, höchstens durch einen Verschlag aus Brettern (Vertonnung) getrennt. Die Zimmerung in den Schächten und Strecken wurde durch die Zimmerlinge im Schichtlohn (Zeitlohn) ausgeführt, in den Abbauen aber durch die Häuer selbst, die hierfür besonders entschädigt wurden (nach der Länge der Zimmerung). Die natürlichste Sicherung der Strecken wurde durch das Stehenlassen von Teilen des Gebirges (die Bergefesten) erreicht und durch den Bergeversatz, wobei man das mit abgebaute taube Gestein immer gleich zum Füllen der abgebauten Räume verwandte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das zur Zimmerung erforderliche Holz boten die Waldungen des Erzgebirges; es wurde in ganzen Stämmen oder geschnitten auf die Gruben geliefert und nahm bei stetigem Steigen im Preise einen wichtigen Platz im Ausgabe-Etat der Gruben ein. Beim älteren Steinkohlenbau hatten die zur Beseitigung der störenden Wässer getriebenen Stollen eine besondere Bedeutung. Sie stählten den Unternehmungsgeist und zwangen öfter zur Zusammenlegung von Kleinbetrieben, förderten den Gemeinschaftsgeist und eine rationellere Betriebsweise in größerem Maßstabe. Im Flöhaer Becken kennen wir den von Schippan kurz nach 1800 angefangenen, ins Gückelsberger Gebirge getriebenen und 1846 beendeten tiefen Stollen, der an der Flöha ansetzt und etwa 530 m lang war, ferner einen gleichfalls an der Flöha angesetzten und zur Schaal- Eichler’schen Grube gehörigen Stollen in Altenhain, sowie den Kieber’schen Stollen, der in der Ulbrichtschlucht mündete, und den Schippan’schen Johann Georgen- Stollen vom Wetzelbach zirka 624 m weit ins Gückelsberger Gebirge, daneben eine Anzahl weniger wichtigere, kürzere und flachere Stollen. Bis zu den vorhandenen Stollen, sonst bis zu Tage wurde vor Einführung der Dampfkraft das Wasser aus den Steinkohlengruben durch Pumpen, Schöpfwerke und Kunstgezeuge gehoben, die durch Menschenkraft, Zugtiere oder Wasserräder in Bewegung gesetzt wurden. Ein solches Kunstgezeug wurde um 1812 von dem genannten Schippan erbaut, 1851 ein gleiches zu Altenhain von Eichler. Über den speziell im Flöhaer Becken angewandten Strebbau gibt Köttig, den ich hier wörtlich zitiere, folgendes mit schematischer Skizze versehenes Bild (eine genaue Beschreibung einer Flöhaer Grube findet sich außerdem bei der Geschichte des Pfarrwald- Werkes und des Struthwald- Werkes in Kapitel IV). Anmerkung der Redaktion: „Strebbau“ im modernen Sinne meint eigentlich etwas anderes (einen flächenhaften „Pfeilerbruchbau“). Hier wird dagegen eine Art „Teilsohlenabbau mit Versatz“ beschrieben. Unlogisch erscheint die V-förmige Streckengabelung, da dazwischen ja auch Kohle ansteht oder anstehen kann. Das räumliche Vorgehen – am Schacht beginnend und in das Feld hinein – ist unter modernen Sicherheitsaspekten zudem wenig glücklich. Normalerweise würde man – ganz besonders bei Bruchbau-Methoden – zunächst das Baufeld komplett ausrichten und dann rückschreitend – zum Schacht hin – den Abbau führen. Dadurch wird die Gefahr minimiert, daß bei Verbrüchen die Fluchtwege zum Schacht beeinträchtigt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„Von dem Schachte a aus wird daselbst zumeist nur ein Feldstreifen, der in der Fallrichtung der Flöze selten über 40 Lachter, im Streichen aber 40 bis 50 Lachter mißt, abgebaut und verfährt man hierbei folgendermaßen: Ist der Schacht a bis auf die Sohle des Flözes abgeteuft, so treibt man, um sich der Wasser zu entledigen, eine Strecke b im Fallen des Flözes bis zum abgebauten Felde c und gleichzeitig eine steigende Strecke d, die sich außerhalb der Schachtbergfeste in zwei diagonale Strecken f und g teilt. Diese Strecken, welche die Basis des ganzen Abbaus bilden, gehen allen Arbeiten voran und dienen außerdem zum Aufschluß des Verhaltens der Flöze, so daß man Zeit gewinnt, dem Bedürfnisse der Förderung zu genügen, im Fall man einen Rücken oder irgend eine andere Veränderung des Flözes ausrichtet. Sind gedachte Diagonalen nun 8 bis 10 Lachter fortgebracht, so beginnt man aus ihnen, ohne deren Fortbetrieb zu unterbrechen, den Abbau, indem man nach Befinden unter Belassung einer 4 bis 6 Ellen starken Bergfeste k für die Diagonalen in den abwärts liegenden Kohlenpfeiler auf einer Länge von 8 bis 16 Zoll einbricht und von diesem Einbruche aus den Kohlenpfeiler in der Streichrichtung des Flözes zum Aushieb bringt, die Berge gut hinter sich versetzt und nur längs des oberen Kohlenpfeilers eine Strecke l behufs der Förderung der Kohlen nach den Diagonalen im Bergeversatze offen hält. Ähnlich verfährt man mit dem weiter im Felde liegenden Kohlenpfeilern und mit dem zwischen den beiden Diagonalen gelegenen Kohlenstock, den man jedoch erst dann, wenn er eine bedeutende Stärke gewonnen hat, von beiden diagonalen Strecken aus in Abbau nimmt. Dabei können natürlich vorkommende Störungen oder Zweckmäßigkeitsrücksichten insofern Veränderungen herbeiführen, als man, anstatt den Abbaupfeiler unter der Förderstrecke in Angriff zu nehmen, zunächst den darüber gelegenen zum Aushieb bringt oder auch schwebenden Abbau führt. Alle gewonnenen Berge werden wieder in der Grube versetzt und ist man namentlich bemüht, mit denselben die Bergemauern längs offen zu erhaltender Strecken besonders gut auszuführen. Bei Abbauörtern bleibt der Bergeversatz, bei der Masse der mitzugewinnenden Berge, selten mehr als 2 bis 2 ½ Ellen hinter dem Ortsstoß zurück. Diese Verhältnisse, welche ein Freilegen des Daches auf größere Flächen unmöglich machen, bedingen auch, daß das überhaupt gut stehende Sandsteindach niemals in großen Druck kommt, weshalb auch auf den Flöhaer Gruben ein nur höchst unbedeutender Holzverbrauch stattfindet. Die Förderung geschieht in Schleppkübeln und sind deshalb die Streckensohlen mit Gleitbrettern belegt.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses durch die besonderen Verhältnisse im Flöhaer Becken bedingte System des Strebbaus war also ebenso einfach wie praktisch. Die geringe Mächtigkeit der Flöze (höchstens 90 cm) brachte es mit sich, daß man große Mengen darüber und dazwischen liegenden Gesteins mit aushauen mußte, das man dann einfach „hinter sich versetzte“, so das abgebaute Feld immer gleich wieder mit Gestein anfüllend. Das überhaupt „gut stehende Sandsteindach“ brauchte dann, da der Bergeversatz selten mehr als 60 cm bis 75 cm hinter dem Abbauorte zurückblieb, nicht wie sonst durch Grubenholz gestützt zu werden. Man sparte dabei sowohl an dem teuren Grubenholz, als auch an Arbeit für das umständliche Fördern der Berge und das gefahrvolle Rauben der Stempel. Gleichzeitig wurde die Gefahr der Senkung der Erdoberfläche gebannt, die sich allenthalben zu einem großen Nachteil für den Kohlenbergbau auswuchs.
Welche Besonderheiten es beim Abbau in
den steil geneigten Flözen bei Oberberthelsdorf gegeben hat, kann man bei
uns in diesem
Die Fördergefäße wurden bei groben Kohlenstücken, wie sie im Flöhaer Becken die Regel waren, mit der Hand, bei „klaren“ Kohlen mit dem Trog und der Kratze gefüllt. Die Streckenförderung geschah entweder in Körbern, die getragen wurden, oder in Karren; im Flöhaer Gebiet jedoch meist in Schleppkübeln von 5/8 Scheffeln, die von den Arbeitern an Seilen auf Holzgleitbahnen gezogen wurden. Man benutzte diese Kübel oft auch gleich zur Schachtförderung bis zu Tage, indem man sie mit dem Bügel an das Haspelseil des Schachtes anschlaufte. Während nämlich die Bewegung der Fördergefäße in den Abbau- und Förderstrecken lediglich durch Menschenkraft ohne maschinelle Hülfe erfolgte, geschah dies in den Schächten durch Haspelwerke, die aber auch meist von Menschenhand gedreht wurden, höchstens, wo die Möglichkeit vorhanden war, durch Wasserräder, erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts durch Dampfmaschinen in den größeren Werken. Im Flöhaer Gebiet sind Dampfmaschinen überhaupt nur zur Wasserhaltung benutzt worden. Die Schleppkübel wurden entweder unmittelbar an das Haspelseil angeschlagen, wie schon ausgeführt, oder am Füllort am Grunde des Schachtes in besondere Schachtkübel umgeladen. Beide Methoden waren im Flöhaer Gebiet nach Aussage älterer Einwohner in Gebrauch (ovale Schleppkübel und viereckige Schachtkübel). Die Haspelseile waren aus Hanf, seltener aus Draht, und liefen zu Tage über die Seilwelle des Haspelwerkes, die quer über die Schachtöffnung ging. Zu Tage wurden die Kohlen mit Karren befördert und in Halden aufgeschüttet oder in Schuppen untergebracht. In der Grube erfolgte die Weiterbeförderung der von den Hauern ausgehauenen Kohle durch besondere Förderleute, zu Tage waren besondere Ausläufer eingesetzt; im Flöhaer Gebiete besorgte gewöhnlich der oder die Haspelknechte auch gleich die Weiterbeförderung der Kohle bis zur Halde. Zur Kontrolle der Fördermengen, die den Hauern im Stücklohn verrechnet wurden, gab man Marken aus, die die Hauer an den von ihnen gefüllten Förderkübeln anbrachten. Die Personenfahrung der Gruben erfolgte in den Fahrschächten auf „Fahrten“ genannten Leitern, die bei Schächten geringer Tiefe, wie im Flöhaer Gebiet, senkrecht (saiger) waren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matte, schlagende oder brandige Wetter kamen bei den Flöhaer Gruben infolge der geringen Tiefe und unterirdischen Ausdehnung fast nicht vor. Künstliche Mittel zur Abwehr, die sonst im Kohlenbergbau eine große Rolle spielen, waren gewöhnlich nicht nötig; dem häufiger auftretenden Wettermangel wurde durch Anlegen von Wetterschächten für den Luftdurchzug begegnet. Die Aufbereitung der Kohlen (Sortieren und Trennen von Steinen) fand entweder gleich an den Abbauörtern oder über Tage statt. Besonderes Personal hierfür gab es im Flöhaer Bezirk nach den Statistiken nicht, wobei allerdings berücksichtigt werden muß, daß der Flöhaer Kohlenbau schon im Verfall war, als in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts Statistiken angelegt wurden. Auch die Koksbereitung, die entweder durch die Gruben selbst oder durch besondere Unternehmer in Meilern oder kuppelförmigen Öfen von 24 bis 60 Scheffeln Inhalt vorgenommen wurde, (fand in Flöha nicht statt, denn) da die Kohlen entweder Anthrazit, also natürlicher Koks waren (die Hitze der eruptiven Porphyrmassen und Tuffablagerungen hatte sie teilweise des Bitumens beraubt) oder da sie sich wegen zu hohen Aschengehaltes nicht zur Verkokung eigneten. Die Arbeitszeit dauerte in der Regel 8 bis 12 Stunden. Gearbeitet wurde entweder im Schichtlohn (Zeitlohn) oder, und zwar meistenteils, im Gedinge, wie der Arbeitsvertrag im Stücklohn genannt wurde. Im Gedinge wurden die Hauer nach der gewonnenen Menge Kohlen bezahlt oder nach der Länge des aufgefahrenen Ortes, manchmal auch nach Förderlänge und aufgefahrener Ortslänge gleichzeitig. Das Öl zur Grubenbeleuchtung wurde meist von den Arbeitern selbst oder von den Gruben in größerer Menge angeschafft, Pulver zum Sprengen nur von den Gruben. Werkzeug (Gezähe) und Pulver wurde den Arbeitern gewöhnlich von den Gruben geliefert, aber vom Lohne abgezogen. Die Arbeiter zerfielen in Hauer (oder Häuer), Förderleute, Zimmerlinge, Haspel- und Kunstwärter, denen Unter- und Obersteiger vorgesetzt waren. Über diesen wieder standen in größeren Gruben als Beamte: Schichtmeister, Bergverwalter, Faktor, Bergdirektor. Letzterer leitete bei größeren Werken den technischen und den kaufmännischen Betrieb. Kaufmännisches und Rechnungspersonal waren: Kohlenmesser, Kohlenschreiber, Rechnungsführer, Buchhalter, Kontrolleure, Kassierer. Im Flöhaer Becken wurden die kaufmännischen Arbeiten gewöhnlich von den Steigern oder dem Besitzer des Werkes mit versorgt. Für das Vermessungswesen waren vom Oberbergamte geprüfte Geometer und Markscheider zuständig. Arbeiter und untere Beamte eines Werkes bildeten eine Knappschaft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das auf den sächsischen Gruben gebrauchte Längenmaß war bis zur Einführung des metrischen Systems die sächsische Elle = zwei Leipziger Fuß ≈ 57 cm (Anmerkung: Das war schon die erst ab 1854 normierte Dresdner Elle). Für größere Entfernungen kam außerdem das sächsische Lachter von etwa 7 Fuß ≈ 2 m in Anwendung. Als Raummaß waren bis 1806 die verschiedensten, schwer miteinander vergleichbaren Gefäße in den einzelnen Revieren in Gebrauch. Von 1806 bis 1.7.1860 war ein Scheffel = 8.121,5 Leipziger Kubikzoll wenigstens für die fiskalischen Steinkohlenwerke im Plauenschen Grund vorgeschrieben, doch wurden in anderen Revieren abweichende Maße weitergeführt, wie der alte Scheffel zu 8.124 Kubikzoll. Der im Flöhaer Gebiet gebrauchte Scheffel (oft „Tonne“ genannt) war um ein geringes kleiner als der Dresdner Scheffel. Die „Tonne“ = 2 Scheffeln wurde gewöhnlich nur als Verkaufsmaß benutzt, war mehr Begriffsmaß, da meist zwei Scheffelgefäße angesetzt wurden. Da die auf den Gruben und im Kleinhandel benutzten Gefäße im Laufe der Zeit bis zu 50% nach oben oder unten abwichen, regelte das sächsische Ministerium endlich die Raummaße im Kohlenverkehr für das ganze Land durch Verordnungen vom 20.6.1854 und vom 20.10.1859, die am 1.7.1860 in Kraft traten. Hiernach war für den Kleinverkauf ausschließlich der Scheffel zu 7.900 Kubikzoll zulässig, außerdem Maße von 2 Scheffeln = 1 Tonne, 4, 6, 10 Scheffeln oder dem Vielfachen davon und die durch fortgesetzte Halbierung entstehenden Teile vom Scheffel, also ½, ¼, 1/8, 1/16 Scheffel. Wo man sich bei den Gruben der Fördergefäße als Maße bediente, mußten diese 1/10 größer im Rauminhalte sein. Der ganze Scheffel konnte als Kasten von 19 Zoll Länge und Breite bei 21 7/8 Zoll Höhe hergestellt werden, oder als sogenannter Scheffelkarren von 14 ½ Zoll Höhe, 20 Zoll Breite und 27 ¼ Zoll Länge, oder auch als Zylinder von 22 ¾ Zoll Höhe und 21 Zoll Durchmesser. Maße von mehr als einem Scheffel mußten als rechtwinklige Kästen mit festem Boden hergestellt werden. Das Messen der Kohle hatte ohne Überhäufung zu erfolgen, der Verkauf nach Gewicht wurde nicht nur gestattet, sondern empfohlen; denn schon seit längerer Zeit fing man an, bei der Verschiedenheit der Maße das Wägen dem Messen als genauer vorzuziehen, hatte aber noch mit großem Widerstande eines Teiles der Interessenten zu kämpfen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei Gelegenheit der von der sächsischen Regierung angeordneten technischen Untersuchung der Steinkohlen Sachsens durch Hartig in den Jahren 1857/1858 ergaben sich bei unparteiischem Messen unter völlig gleichen Umständen bei großen Kohlenstücken Abweichungen von durchschnittlich 35% des Gewichts, bei kleinen Stücken von 16%. Das Messen der Kohle in kleinen Stücken war also zwei- bis dreimal so sicher, als in großen Stücken. Diese Zahlen setzten die Unzuverlässigkeit der Mengenbestimmung bei Kohle durch Messen ins hellste Licht und redeten von selbst einer allgemeinen Einführung des Wiegens das Wort. Hierzu kam, daß die Eisenbahnen nicht nach Maß, sondern nach Gewicht verfrachteten. So wurde schon vor der Gründung des Deutschen Reiches größtenteils der Zollzentner gleich 1/20 Gewichtstonne oder gleich ½ metrische Zentner von 100 kg eingeführt. Andrerseits wurden aber auch verschiedentlich nach Einführung des metrischen Systems am 1.1.1872 noch Raummaße, jetzt der Hektoliter = 0,963 Scheffel benutzt; das letzte um diese Zeit noch bestehende Werk im Flöhaer Becken rechnete sogar bis zu seinem Erliegen 1880 noch mit Scheffeln. Hartig fand bei seinen Untersuchungen das mittlere Gewicht eines nur bis zum Rande gefüllten sächsischen Scheffels durchschnittlich zu 160 Pfund; das wäre gleich einem spezifischen Gewicht der geschütteten Kohlen von 0,771. Im Dresdner und im Flöhaer Becken wog aber ein Scheffel der hier geförderten härteren und festeren Kohle 180 bis 200 Pfund (= spez. Gewicht von 0,867 – 0,963). Zum Schluß möge ein Vergleich der in den folgenden Kapiteln viel genannten Raummaße erfolgen:
____________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kapitel:
Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Flöhaer Becken bis 1800 (Zeit des
ungeregelten Abbaus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die älteste Geschichte des sächsischen Steinkohlenbergbaus ist vor dem Entstehen schriftlicher Überlieferungen in das Dunkel der Sage und Legende gehüllt. Die an den Fundorten an günstigsten Stellen zutage streichenden Flöze sind wahrscheinlich den Bewohnern längst bekannt gewesen und auch oberflächlich zur Gewinnung von Brennstoff abgebaut worden, ehe wir schriftliche Aufzeichnungen davon haben. Die Geschichte des Abbaus in Zwickau, des ältesten in Sachsen, ja in Deutschland überhaupt, reicht bis in die Zeiten der gewerbefleißigen Sorben und Wenden, etwa ins 10. Jahrhundert zurück*). *) Der Name Zwickau wird als „Aue des Zwikz“, eines slawischen Feuergottes gedeutet, da seit den ältesten Zeiten einige Kohlenflöze im dortigen Planitzer Gebiet unterirdisch brennen (Erdbrände). Auch haben dort die „Feuerarbeiter“ oder Metallarbeiter schon im Mittelalter eine große Rolle gespielt; 1348 wurden sie in den uns erhaltenen Zwickauer Schmiedeartikeln verwarnt, mit Steinkohlen innerhalb der Stadtmauern zu schmieden, weil man die damals wütenden Seuchen auf Luftverpestung durch Steinkohlenrauch zurückführte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die ersten gedruckten Nachrichten über den Steinkohlenbergbau in Sachsen gibt uns Georg Agricola, der Begründer der Metallurgie, der von 1519 bis 1522 Rektor des Zwickauer Gymnasiums war und die dortigen Kohlenschächte wiederholt befuhr, die sich schon lange vor seiner Zeit von Planitz bis Bockwa ausgedehnt hatten. In seinen Schriften „Bermannus sive de re metallica“ und andere 1530, 1544, 1546 erwähnt er außer den Kohlen von Zwickau die vom Plauenschen Grunde als bekannt und von den Schmieden benutzt. Es ginge zu weit, hieraus folgern zu wollen, daß bis dahin die Kohlen an anderen Fundorten Sachsens noch unbekannt gewesen seien, vielmehr werden auch an anderen Stellen, wie in Hainichen- Ebersdorfer und im Flöhaer Becken, wo Kohlen ausstrichen, diese örtlich bekannt und gelegentlich in kleinerem Maße ausgenutzt worden seien. Nur das Lugau- Oelsnitz- Niederwürschnitzer Kohlenrevier wurde erst 1821 entdeckt, seit 1831 abgebaut und erst auf Naumann's und Geinitz Untersuchungen hin 1854 großzügig in Abbau genommen. Diese Annahme wird gestärkt durch die Nachrichten, die Petrus Albinus in seiner „Meißnischen Bergchronik“ 1589/1590 über den Bergbau Sachsens gibt. Auch er spricht, S. 189, hauptsächlich vom Zwickauer Steinkohlenbau und von den Kohlen, die bei Dresden „eine Meile gegen Freiberg“ gefunden werden, „die sich leicht schiefern“ (Schieferkohle). Dann aber fährt er fort: „Zum dritten hat man auch Steinkohlen in einer Gruben oder Schacht bei Frankenberg umb das Jahr 1559, wie Fabricius schreibt, angetroffen.“ (Fabricius: Rerum misnicarum linbri) Das bezieht sich ohne Zweifel auf Kohlenfunde in der Hainichen- Frankenberg- Ebersdorfer Mulde oder im Flöhaer Becken bei Altenhain, wo ja der Ausstrich eines Flözes der unteren Karbonstufe im Dachsloche nur 4 km von Frankenberg entfernt ist. In derselben Entfernung von Frankenberg liegt auch das noch zum Flöhaer Karbon gehörige „Kühlloch“ bei Lichtenwalde, dessen uralte Landschaftsbezeichnung auf Kohlenfunde zurückzuführen ist; denn im sächsischen Hauptstaatsarchiv finden sich unter Lichtenwalde, Nr. 8, Loc. 38777 und 36138 Akten über Entrichtung von Zinsleihgeldern an die Ämter Lichtenwalde und Auerswald für die „Kohlungsgüter im Ambte Lichtenwalde, anno 1565“ und über die Belehnung des Chemnitzer Bürgers und Gerichtsschreibers Erasmus Löffler und Consorten und Gewerken mit dem Kohlenbau zu Lichtenwalde, Ebersdorf und Ortelsdorf anno 1571 (auch ein gewisser Eustachius von Harras auf Lichtenwalde tritt in diesem Aktenstück seine Rechte als Grundbesitzer auf Lichtenwalde an Löffler ab). Weiter unten spricht Albinus dann von „Kohlerdrich“ (Erdreich), „so man im Meissnischen Gebirge findet und zu Feuer gebraucht. Wie denn die Schmiede in gantz Meißen… der Steinkohlen anstatt der Holzkohlen brauchen“. Wenn man dann auch seine weiteren Angaben über Kohlenvorkommen „nicht weit von Falkenau, auf der Höhe, die man den brennenden Berg nennt und letztlich zwischen Falkenau und dem Dorf Kulm“ wohl nicht auf Falkenau im Flöhaer Becken, sondern auf das bei Hainichen beziehen mag, so geht aus allem doch hervor, daß schon im 16. Jahrhundert außer den Hauptkohlevorkommen von Zwickau und im Plauenschen Grunde noch eine Anzahl kleinerer Fundorte in der Gegend des Flöhaer und Hainichen- Ebersdorfer Beckens bekannt waren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestimmte Daten über den älteren Steinkohlenabbau im Bereich ds Flöhaer Beckens hat erstmalig Freiesleben in seinem „Magazin für Oryktographie von Sachsen“, 1828-1845, im 2., 4. und 11. Hefte zusammengestellt. Er schreibt Band 11, S.58: „1710 wurde das Steinkohlenwerk zu Lichtenwalde beim Bergamte Marienberg gemutet. Anhaltendere Versuche sind seit 1708 in dortigen Fluren gemacht worden.“ Da bei Lichtenwalde zwar die Ausläufer der Flöhaer Karbonschichten oberer Stufe die des Hainichen- Ebersdorfer Kulms teilweise überdecken, der Abbau von Kohle aber wohl hauptsächlich aus dem Kulm stattfand, hat A. Rothpletz in seiner Geschichte der Hainichen- Ebersdorfer Mulde (Erläuterungen zu Blatt 78 der geologischen Specialkarte) die Geschichte dieses Steinkohlenwerks zu Lichtenwalde ausführlicher behandelt, so daß hier davon abgesehen werden kann. Nach Rothpletz ist dieses Steinkohlenwerk zu Lichtenwalde dasselbe, das die Grafen von Vitzthum von 1816-1865 zwar ohne großen Gewinn, aber auch ohne Zubuße betrieben haben. Ergänzend sei hier nur erwähnt, daß aus der Mutungsakte, die sich im Mutungshauptregister des Bergamtes Marienberg, S. 523 fand, hervorgeht, daß dieses Werk zu Lichtenwalde den Namen „Gesegneter Heinrich“ trug und Herrn Heinrich von Bühnau verliehen ward. Es lag am sogenannten Galgenberge zwischen Ebersdorf und der Mühlstraße nach Lichtenwalde und wurde am 26.4.1710 „auf alles Metall, Steinkohlen und Mineralien, Flötz- oder stockweis, wie es Namen haben möge“ gemutet. In einem Nachtrage, den der Bergakademist Schmidt im Jahre 1800 zu den geognostischen Untersuchungen Engelbrecht's über die Gegend Frankenberg- Flöha als Vorarbeit für die damals im Werden begriffene erste geognostische Landesuntersuchung macht, findet sich die interessante Bemerkung, daß nach Aussage des Gerichtsdirektors zu Lichtenwalde der Betrieb dieses Steinkohlenwerks vor etwa 100 Jahren (von 1800 zurück) durch Veruntreuungen des Schichtmeisters eingegangen sei, weil dieser damals mit der Kasse durchgegangen war. Freiesleben schreibt weiter in seinem Magazin für Oryktographie, Band 11, S. 59: „Ein Steinkohlenbruch bei Altenhain wurde 1700 beim Bergamte Freiberg unter dem Namen Schwarzer Adler Erbstolln und eine andere Grube, Segen des Herrn Fundgrube, wurde 1713 auf Steinkohlen bestätigt.“ Ferner in demselben Band: „Bei Flöha wurde bereits 1741 eine Grube Licht Erbstolln auf flachfallenden Steinkohlengängen beim Bergamte Freiberg bestätigt.“ Auch kam bei den Verhandlungen der Dresdner physikalischen etc. Wissenschaften am 26.21768 zur Anzeige, daß sich Steinkohlen unweit Augustusburg „auf dem Fundo der Gräfin von Watzdorf“ fänden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf diesen Mitteilungen Freiesleben's fußen alle die kurzen geschichtlichen Angaben, die wir in der Fachliteratur über den ältesten Steinkohlenbergbau im Flöhaer Becken verstreut finden. Eingehende Nachforschungen nach den authentischen Grundlagen dieser Mitteilungen Freiesleben's im Archiv des Bergamtes Freiberg hatten Erfolg. Außer den schon zum Steinkohlenwerk Lichtenwalde gemachten Ergänzungen wurden für die von Freiesleben angeführten alten Werke im eigentlichen Flöhaer Becken von mir folgende wörtliche Einträge im Mutungsregister des Bergamts Freiberg von 1700, 1713 und 1741 gefunden: No. 10 Wo. Heinrich Schönherrn anno domini 1700, den 5ten May habe Ich, Andr. Süss, BergM. verliehen an uts. ein Steinkohlenbruch, soweit sich die Steinkohle ins Gebürge erstrecket; wie auch ein Erbstolln, mit aller seiner Gerechtigkeit, der schwarze Adler genannt, auf Christian Berger seinem Gute, zum Alten Hayn gelegen. Nr. 11 Wo. Israél Leonhardt anno domini 1713, den 4. Martii habe ich, J. CHr. B., Berg M., verliehen an uts. eine Fundgrube samt der obernächsten Maaß, geviertes Feld auf einem Flötz auf Steinkohlen, der Segen des Herrn genannt. Und soll sich die Fundgrube ganz hinausstrecken auf Christian Dietrichs Gut zu Altenhayn bei der Flöha gelegen. Hierzu ist noch eine Nachschrift vorhanden: Ao Die, 1713 den 17. Junii habe ich J. Chr. B. BM., verliehen an uts. den Erbstolln zur Fundgrube auf Steinkohlen, der Segen des Herrn genannt. Schließlich folgt unter dem Jahre 1741: Anno Domini, No.9 Woche Reminiscere den 1. Martii habe ich, Johann Andreas Wagner, Bergmeister, Otto Werner Welzmann einen tiefen Erbstolln, das Licht genannt, nebst zweien Fundgruben auf zwei diverse flach fallende Steinkohlengänge, so ihr Streichen in flacher Gangweise haben, desgl. zu jeder Fundgrube die obernächste 2. und unternächste 2. und 3. Maaß, das Wald genannt, auf Samuel Grunders (Der Name ist schlecht leserlich und kann auch anders heißen) Guthe zu Flöha gelegen; ward gemutet den 28. Januar a. c., bestätigt ut supra. Frey-Kuxe:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obgleich nach der im Kapitel II erwähnten Entscheidung der Bergschöppenstühle von 1612 im Kohlenbergbau eine bergrechtliche Mutung nicht nötig war, ist sie nach Vorstehendem im Bezirk der Bergämter Freiberg und Marienberg, wozu die Flöhaer Gegend gehörte, bis zum 1. Kohlenmandat von 1743 doch üblich gewesen, sobald ein Unternehmen auf fremden Grund und Boden schürfte. Wahrscheinlich wurde von den Kohlenbauunternehmern um der größeren Rechtssicherheit halber nachgesucht, solange keine besondere gesetzliche Regelung des Kohlenbergbaus bestand. Nach dem Kohlenmandat von 1743 finden wir keine Eintragung von Kohlengruben mehr in den Mutungsregistern zu Freiberg. Die geschichtliche Forschung wird durch diesen Umstand erschwert, indem von nun an Urkunden über den Kohlenbergbau nur zum Teil in den Akten der Bergämter enthalten sind, der andere Teil bei den örtlichen Justizämtern (Augustusburg, Frankenberg und Lichtenwalde) zu suchen ist, wo sie teilweise makuliert und nur lückenhaft erhalten sind. Vor dem Kohlenmandat konnte sich ein Kohlenbergbau-Unternehmen im Flöhaer Gebiet, wo ja keine Kohleordnungen wie in Zwickau bestanden, die Rechte auf den Bau eben nur durch bergrechtliche Mutung und die darauffolgende „Leihung“ (Verleihung des Eigentums) sichern; denn wer einen Schurf oder Versuchsbau auf fremden Grunde anlegte, erlangte erst ein Recht darauf, wenn er beim Bergmeister mutete und dann mit einem bestimmten Flächenraum (dem Lehen) beliehen wurde. Der Versuchsbau wurde damit zur „Fundgrube“, gewöhnlich mit 7 Lehen zu je 7 Quadratlachtern Flächenraum (also zirka 1.400 m²). Weder der Besitzer des Ackers, noch der Gutsherr konnten ihn dann in seinen Abbaurechten, soweit sie ihm durch die Leihung zustanden, beschränken. Der Besitzer des Grundes bekam nur einen Freikux, das „Erbtheil“ oder „Ackertheil“, das von Zubuße befreit war, an der Ausbeute aber teilnahm. Wenn er sich vor zwei Zeugen vor Beginn des Abbaus zur Teilnahme an den eventuellen Zubußen bereit erklärte, konnte er auch 1/32 Anteil an der Grube verlangen, bei gewöhnlich 128 Kuxen pro Grube also 4 Kuxe). An den Landesherrn allerdings war außer den Quatembergeldern und sonstigen Gebühren der Zehnte der Ausbeute zu entrichten. Ähnlich war die Beleihung mit den Erbstolln. Der größere Flächenraum, innerhalb dessen die Gewerken eines Stollens bestimmte Rechte hatten, hieß im Gegensatz zu den kleineren Lehen der Fundgrube „Erbe“. Ein mit einem solchen Erbe beliehener und mit verschiedenen Vorrechten ausgestatteter Stollen war ein Erbstolln (im Gegensatz zum Suchstolln). Auch er hatte als einzige größere Last den Zehnten an den Landesherrn.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es lag in der Natur des Steinkohlenbaues, daß bei ihm das Lehen der Fundgrube und das Erbe der Stollen einen größeren Flächenraums umfassen mußte, als beim Erzbergbau. So finden wir bei dem 1710 an Heinrich Schönherr verliehenen Steinkohlenbruch als Lehen besonders erwähnt: „soweit sich die Steinkohle ins Gebirge erstrecket“; und bei der Segen des Herrn- Fundgrube 1713: „samt der obernächsten Maß geviertes Feld, und soll sich die Fundgrube ganz hinausstrecken auf Christian Dietrichs Gut“. Die obernächste Maß war ein Flächenraum von etwa 4.000 m² vom Eingang der Fundgrube im Steigen der Schichten. Es konnte nämlich auch die „unternächste Maß“ verliehen werden, die kam aber hier nicht in Frage, da sich die Fundgrube wahrscheinlich in der Nähe des Kohlenausstrichs beim Dachsloch an der Zschopau befand, wo die Fluren des Dietrich’schen Gutes begannen. Von hier aus erstreckt sich die untere Stufe des Flöhaer Karbons hangaufwärts nach Nordosten, während sie hangabwärts unter die Zschopau setzt. Dem Unternehmer des Licht- Erbstollns wurden zu seinen zwei Fundgruben sogar zwei Maße im Steigen und drei im Fallen des Gebirges verliehen. Dieses Berggebäude scheint am Nordrande des Flöhaer Pfarrwaldes gelegen zu haben, wie aus der Mutungsakte hervorgeht. In den Oberbergamtsakten von 1743 und 1761 wird auch ein verfallener, 27 Ellen tiefer Schacht in dieser Gegend mehrfach erwähnt, auf dessen Halde noch Steinkohlen „in guter Menge“ umherlagen, so daß der Abbau als nicht ganz erfolglos angesehen werden kann. Der alte Stollen, dessen verfallenes Mundloch in der vorderen Ulbrichtschlucht in späteren Akten immer wieder erwähnt wird und den um 1840 das Flöhaer Lehnsgericht- Kohlenwerk zusammen mit dem Kieber’schen Werke wieder herrichten ließ, scheint der alte Licht- Erbstollen zu sein. Aus dem Umstande, daß sich vor 1700 keine Mutung von Steinkohlengruben im Flöhaer Becken in den Mutungsregistern vorfindet, kann man noch nicht schließen, daß vorher kein Abbau der zutage streichenden Flöze stattgefunden habe; vielmehr wird schon immer in „Steinkohlenbrüchen“ (mit diesem Ausdruck ist ja der Schwarze Adler- Bau noch belegt) die anstehende Kohle von den Grundbesitzern selbst gelegentlich gewonnen worden sein, erst, als das nach den Wehen des 30jährigen Krieges langsam wieder entstehende Unternehmertum auf fremden Grund und Boden an den Abbau ging, mußte es sich seine Rechte durch die Mutung sichern. Für diesen frühen Abbau durch die Grundbesitzer selbst lassen sich nur heute keine Quellen mehr finden, höchstens allgemeiner Art, wie die oben angeführten von Fabricius und Albinus. Daß aber ein Abbau schon vor 1700 stattgefunden hat, geht aus den im Folgenden behandelten Zechenregistern der Segen des Herrn- Fundgrube von 1713/1714 hervor, wo ein „alter Stolln“ aufgesäubert und fortgesetzt wurde, der schon 12 Lachter weit vorher bestanden hatte, aber verfallen war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Außer den zitierten Mutungs-Einträgen über die ältesten Kohlenbau-Unternehmungen im Flöhaer Becken gelang es nämlich, im Archiv des Bergamtes noch fünf Zechenregister der Segen des Herrn- Fundgrube aufzufinden, die wirtschaftsgeschichtlich eine gute Ausbeute ergaben. Diese Zechenregister stellen die gesamte Wirtschaftsrechnung und Buchführung alter Bergbau-Unternehmungen dar und sind meist die einzigen urkundlichen Quellen, die erhalten sind. Sie mußten für die Quartale Reminiscere, Trinitatis, Crucis und Luciae dem Bergamte zum Vergleich mit den dort geführten Gegenbüchern eingereicht werden. Von den drei alten Kohlenbau-Unternehmungen im Flöhaer Becken, deren oben zitierte Mutungen beim Bergamte Freiberg bestätigt wurden, sind nur von der Segen des Herrn- Fundgrube Zechenregister erhalten, so daß man annehmen kann, daß der Schwarze Adler- und der Licht- Erbstolln kurzlebige Unternehmungen waren, die bald wieder, wie so oft im Bergbau, aus Mangel an Erfolg und Betriebsmitteln eingingen. Auch der Segen des Herrn- Fundgrube ist kein genügender Erfolg beschieden gewesen; trotzdem ist hier der Abbau mit größerer Zähigkeit versucht worden, nämlich vom März 1713 bis mindestens Ende September 1714, so weit wenigstens gehen die Zechenregister. Im letzten derselben, Crucis 1714, ist alledings nichts davon zu lesen, daß der Bau aufgegeben werden sollte, so daß derselbe sich vielleicht noch einige Zeit hingezogen hat, wohl kaum aber sehr lange, denn es ist nirgends mehr ein Hinweis darauf zu finden; auch war bis Crucis 1714 kein wirklich abbauwürdiges Flöz Steinkohle erschlossen, so daß die Gnadensteuer, die das sächsische Oberzehntenamt an notleidende, aber aussichtsreiche Gruben zahlte, schon Ende Trinitatis 1714 wieder eingestellt worden war. Daß der Segen des Herrn- Bau ein ernsteres Unternehmen war, geht daraus hervor, daß er straff nach Art des Erzbergbaus gewerkschaftlich organisiert war. Die Zahl von 128 Kuxen, in die die Gewerkschaft nach geltendem Freiberger Bergrecht eingeteilt worden war, ist allerdings nie ganz vollständig gewesen. Die höchste Anzahl (verkaufter) Kuxe sind 96 Kuxe Crucis 1713, die niedrigste 74 Kuxe Trinitatis 1713 und Reminiscere 1714; davon gehen aber jedesmal noch die nicht zubußpflichtigen Freikuxe ab: 1 Kux Erbteil (Anteil des Grundbesitzers), 1 Kux für die Knappschaft (wobei unklar ist, ob die geringe Belegschaft der Grube oder ein gewerkschaftlicher Knappschaftsverein sämtlicher Bergleute der Flöhaer Gegend gemeint ist, wovon die meisten Mitglieder wohl die damals florierenden Eisenerzgruben von Hausdorf- Langenstriegis und Augustusburg- Grünberg, sowie die Bleiblendegruben des Oederanschen Waldes gestellt haben dürften), ferner 2 Kuxe „gemeine Stadt“ (gewöhnlich Freikuxe für die Stadt, wo sich das Bergamt befand (also Freiberg) oder wo das Bergwerk lag).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Zechenregister sind geführt von Carl Friedrich Senff, der Schichtmeister war. Diese Schichtmeister hatten gewöhnlich die privatwirtschaftliche Leitung mehrerer Gewerkschaften gleichzeitig inne, doch „sollten ihnen nicht mehr als sechs Zechen zu verwesen gestattet sein, davon höchstens zwei fündige“. Sie wurden von den Gewerken der Grube gewählt, hatten die gesamte Regelung des Kassen- und Rechnungswesens und mußten alle Quartale Rechnung ablegen, eben in den Zechenregistern. Alle Anschaffungen für die Gewerkschaft scheinen sie in eigenem Namen gemacht zu haben, denn am Schluß der Quartalsabrechnungen finden wir die Passiva angeführt als „Schulden an den Schichtmeister und seine Creditores“. Der Schichtmeister der Segen des Herrn- Fundgrube bekam für seine Tätigkeit im Quartal 7 Taler 9 Groschen (= 12 Groschen wöchentlich); es ist also sicher, daß er noch eine Anzahl Gruben mit verwaltet hat, denn der Lohn eines Bergmannes war wöchentlich 1 bis 2 Taler. An Zubuße sind von den Gewerken in den Quartalen Trinitatis 1713 bis Crucis 1714 insgesamt 229 Taler 9 Groschen gezahlt worden, sie verteilen sich auf die einzelnen Quartale wie folgt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Gewerkschaft beschäftigte anfänglich zwei Hauer, von denen der eine, Israél Lehnert, gleichzeitig der Lehnsträger war (in der Mutungsakte ist er „Leonhardt“ geschrieben). Die Hauer erhielten wöchentlich 1 Taler, 3 Groschen Schichtlohn, also pro Tagschicht 4 Groschen. Für Überschichten („Ledige Schichten“ genannt) bekamen sie weitere 4 Groschen pro Schicht, so daß sich ihr Einkommen in günstigen Wochen, wo sie drei ledige Schichten verfuhren, auf 1 Taler, 15 Groschen stellte. Israel Lehnert als Lehnsinhaber bekam außerdem am Schlusse jedes Quartals 16 Groschen „das Werk zu versorgen, auch unterschiedliche Male nach Freiberg zu gehen“, sowie in den letzten Quartalen überhaupt 1 Taler, 6 Groschen Wochenlohn; er scheint also die Geschäfte des Steigers mit besorgt zu haben. Von der 8. Woche Crucis 1713 an finden wir den Eintrag: „von dato ist ihnen das Lachter lang und ¾ Lachter hoch von Herrn Obereinfahrer vor 2 Thaler verdingt worden.“ Es wurde also Akkordarbeit eingeführt; trotzdem sind die beiden Hauer auch in der folgenden Zeit nicht über ein wöchentliches Einkommen von 1 Tlr. 3 Gr., bzw. 1 Tlr. 6 Gr. hinausgekommen, obwohl sie nun laut Eintrag im Zechenregister „im Gedinge vor dem Stollenorth“ arbeiteten. Der Obereinfahrer war ein Aufsichtsbeamter für mehrere Bergreviere, der jedes Quartal die ihm unterstellten Gruben befuhr, wofür er 8 Groschen „Fahrgeld“ bekam; außerdem standen ihm, auf jeden Arbeiter gerechnet, wöchentlich 3 Pfg. „Stufengeld“ zu. In den Quartalen Reminiscere und Trinitatis 1714 wurde außer den zwei Hauern noch ein Knecht beschäftigt, der anfänglich auch 1 Tlr. 3 Gr. Wochenlohn erhalten hat; später ist er aber wohl nicht mehr voll beschäftigt gewesen, denn er kommt höchstens auf 20 Gr. die Woche. Außer den Anschaffungen für Werkzeug und Holz und Ausgaben für Instandhaltung der Geräte an Schmied und Stellmacher finden sich folgende regelmäßig wiederkehrende „gemeine Ausgaben“ an den Quartalsschlüssen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unter den Gewerken finden wir den Schichtmeister Senff mit 12 Kuxen, jeden der beiden Hauer mit 8 Kuxen. Der Rest verteilt sich auf Handelsleute, Advokaten, Pastoren, Ärzte, herrschaftliche Grundbesitzer, Verwaltungsbeamte (Brandsteuer- Einnehmer) aus: Chemnitz, Glauchau, Lichtenwalde, Ringenwalde, Frankenberg, Eberdorf, sowie auf Bauern (Hüfner) von Altenhain und Umgebung. Auch der Kammerherr Günther von Bühnau auf Lichtenwalde hatte im Jahr 1713 4 Kuxe (ein von Bühnau war auch 1710 Lehnsträger des Steinkohlenwerkes Lichtenwalde namens Gesegneter Heinrich, wie weiter oben schon angeführt). Die Resultate der bergbaulichen Tätigkeit von Segen des Herrn finden wir jedes Quartal am Schlusse im sogenannten Aufstand verzeichnet. Diese lauten:
Man hat also einen Stolln 34 ¼ Lachter oder 68,5 m neu aufgefahren, daneben in letzter Zeit einen schon aus früherer Zeit bestehenden alten Stolln wieder 12 Lachter gesäubert und 4 Lachter weiter fortgesetzt (zusammen 16 Lachter = 32 m lang); wahrscheinlich erhoffte man dort mehr Erfolg. Vom Verkauf der Steinkohle und Erlös dafür ist nirgends die Rede, so daß wir wohl annehmen müssen, daß sich der Wunsch, der am Schluß der ersten beiden Zechenregister ausgedrückt ist: „Gott gebe, daß bauenden Herrn Gewercken von diesem Wercke reicher Überschuß überkommen möge“, nicht in Erfüllung gegangen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die drei Bergbau- Untersuchungen auf Steinkohlen im Flöhaer Becken, die beim Bergamte zu Freiberg im Jahre 1700 und 1741 gemutet worden waren, hatten zu keinem dauernden Kohlenbergbau geführt, wahrscheinlich infolge Mangels an Mitteln und besonders, weil der Absatz der nicht hochwertigen Kohle bei den damaligen Transportschwierigkeiten und der noch ungenügenden Nachfrage seitens des erst in den Anfängen stehenden Gewerbes der Gegend zu gering war. Trotzdem kam der Unternehmungsgeist nicht zur Ruhe, je weiter sich Gewerbe und Industrie entwickelte und der Holzreichtum des Erzgebirges sich verringerte. Im Jahre 1761 kam der Schichtmeister Kupffer vom Kommun- Berggebäude Neuerbaut Oederan Erbstolln beim Bergamt Freiberg um Mutung eines Steinkohlenbaus auf den Grundstücken des Joh. Gottfr. Richter und einiger anderer Besitzer in Gückelsberg, sowie des Lehnrichters Beckert in Flöha ein. Da inzwischen das erste Kohlenmandat von 1743 ergangen war, konnte seiner Bitte um Bestätigung durch das Bergamt und um Aufnahme der Kux- Übernehmer ins bergamtliche Gegenbuch nicht willfahren werden. Er mußte vielmehr an die zuständigen Justizämter zu Augustusburg, für Flöhaer Flur, und zu Lichtenwalde (Hoch- Reichsgräfliches Watzdorff'sches Gerichtsamt) für Gückelsberger Flur verwiesen werden. Kupffer hatte schon für die zu gründende Gewerkschaft Satzungen ausgearbeitet, nach denen sich die Grundbesitzer mit Anteilen am Berggebäude beteiligen sollten. Obgleich das Bergamt den Unternehmer an die örtlichen Justizämter verweisen mußte, nahm es doch großes Interesse an dem Unternehmen. Der damalige Berghauptmann Fr. W. von Oppel nahm eine Besichtigung der Gegend vor, deren Ergebnisse in dem Aktenstück No. 2077 des Bergamtes niedergelegt sind (Die auf denen Flöha und Gückelsberger Fluren in der Gegend Oederan sich findenden Steinkohlenflötze betr, anno 1761). Darnach war hauptsächlich das Gebiet des Wetzelsbaches in Aussicht genommen für den Abbau, auf Gückelsberger Seite, 500 m östlich von der Krümmung des Baches, also ungefähr da, wo später das Schippan’sche Werk entstand. Dort strichen „bis 1 Hand mächtige, recht gute Steinkohlenflötze am Fuße des Gebirges aus, worauf schon an unterschiedlichen Orten nachgegraben gewesen und zwei Steinkohlenlöcher oder Schächte von 14 bis 18 Ellen Tiefe vorgefunden wurden, aus welchen nach mündlicher Anzeige des Grundbesitzers Joh. Gottfr. Richter Steinkohlen gewonnen, gefördert und verkauft worden seien, welche viel besser als die Kohlsdrofer, Döhlischen und Pesterwitzschen (Dörfer des Plauenschen Grundes) zu gebrauchen gewesen.“ Die Wasser seien aber allzu stark gewesen und die Kosten für einen ordentlichen Bau (Stollen oder Wasserkunst) bei der damaligen „sehr geldklammen Zeit“ (es herrschte der Siebenjährige Krieg) für die Grundbesitzer als Privatleute nicht aufzubringen. Eine zweite Fundstelle von Kohlenausstrichen wurde nördlich des Wetzelbaches auf Flöhaer Gebiet angetroffen, auf der Flur des Lehnrichters Beckert. Auch hier hatte der Besitzer schon geschürft, sowohl am Berghange, als weiter nördlich auf der Höhe des Berges (also in der Gegend, wo später das Flöhaer Lehngerichtswerk Kohlen abbaute), und „hatte hier einen Schacht 2 ¾ Fahrten tief abgesunken, welcher aber gleichfalls nebst denen Versuchs-Steinkohlenbrüchen am Wetzelbach bei jetzigen Kriegs-Troublen und in Ermangelung derer Kosten eingestellt werden mußten.“ Am Schluß seines Berichts über die Ortsbesichtigung kommt der Berghauptmann von Oppel zu folgendem Befund: „daß ein guter, nutzbarer Steinkohlenbau allhier aus- und vorgerichtet werden könnte, wenn anders in der sogenannten Wetzelbach, zuvörderst aus dem Abend gegen Morgen söhlig herangeröschet und hernach ein Stolln, welcher an die 2 bis 3 Fahrten Teufe einbringen dürfte, zu treiben angefangen wird, mit welchen die Steinkohlenflötze sowohl gegen Mittag, als Mitternacht und Morgen untersucht und gewonnen werden könnten; und wenn sodann, wie es zu vermuten steht, das Lager der Steinkohlen in solcher Teufe noch nicht erlanget werden möchte, so sind die Wasser des Wetzelbachs vor hinlänglich zu achten, ein Kunstgezeuge betreiben zu können.“ Er hielt also die Kohlenflöze auf Gückelsberger Flur für die wichtigeren und leichter abzubauenden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf Grund dieses Berichtes des Berghauptmanns wurden am 29.7.1761 aus der Schürfgelder- Kasse des Freiberger Bergamts 50 Tlr. bewilligt für Versuche auf Steinkohlen in obigen Gebieten, da „bei ietztmahligen holzklammen Zeiten und denen sich mehr und mehr rar machenden, ja fast nicht mehr zu bekommenden Kohlen Allerhöchstes Landesherrliches Interesse und allgemeines Bestes“ in Frage kam. Im Zusammenhang mit dem Plan für die Versuchsarbeiten brachte schon damals das Bergamt den Bau eines tiefen Stollens in Vorschlag, der, an der Mündung des Wetzelbachs in die Flöha angesetzt, das ganze Gückelsberger Gebirge nach Norden unterfahren sollte. Es wurde ein Markscheideriß dazu gefertigt, nach welchem der Stolln bei 518 Lachter Länge (also = 1.016 m) 37 m saigere Teufe einbringen sollte. Inzwischen hatte der Schichtmeister Kupffer versucht, seine Steinkohlen-Gewerkschaft zu organisieren und mit den Grundbesitzern einen Vertrag zu schließen. Die Gückelsberger zögerten aber und wollten sich, als endlich Termin vor dem Lichtenwalder Gerichte war, die Sache erst nochmals überlegen. Der Lehnrichter Beckert erklärte sich schriftlich an den Amtmann zu Augustusburg, wo der Vertrag mit ihm für seine Kohlenfelder auf Flöhaer Flur geschlossen werden sollte, daß er sich einer Gewerkschaft nicht anschließen, sondern selbst auf seinem Grund und Boden abbauen wolle. Hierdurch zerschlug sich Kupffer's Plan, da nun auch die Geldgeber, die hinter ihm standen und Kuxe übernehmen wollten, sich zurückzogen. So wurde ein großzügig gedachtes Unternehmen durch mangelnden Unternehmungs- und Gemeinschaftsgeist der Grundbesitzer vereitelt; denn nur ein solcher Zusammenschluß aller Beteiligten und Interessenten hätte Aussicht gehabt, die Schwirigkeiten der Wasserhaltung durch großzügigen Stollnbau und Pumpwerke zu überwinden und einen gewinnbringenden Abbau der oberen Karbonstufe auf Gückelsberger und Flöhaer Flur nach gemeinsamen Richtlinien durchzuführen; und nur wenn es im Interesse der ganzen Gegend, nicht nur einzelner Grundbesitzer lag, konnte der Staat sich mit Unterstützungen und Vorschüssen für die unproduktive Zeit der Anlage der Bauten beteiligen. Das mußte später Schippan zu seinem Leidwesen erfahren, als er 1800 einen Teil des Kupffer’schen Planes auf Gückelsberger Flur zur Ausführung bringen wollte. Obwohl Kupffer's Plan scheiterte, wurden doch vom Bergamt Freiberg auf Staatskosten die beschlossenen Versuche und Bohrungen durchgeführt, da die fiskalischen Erzhütten in Freiberg in großer Not um Kohlen waren. Laut eines „Pro Memoria“ des Berggeschworenen Christ. Gottl. Borrmann hat sich dieser auf Befehl des Oberbergamtes vom 19.8.1762 mit drei Bergleuten und einem Erdbohrer ins Flöhaer Gebiet begeben und nach den Angaben des Markscheiders auf dem Beckert’schen Grundstücke ein Kohlenflöz von 30 Zoll Mächtigkeit bei 9 ¼ Ellen Teufe erbohrt. Man durchteufte dabei:
und an anderer Stelle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„Weil aber die Wütterung heftig worden, daß dabei der Erdbohrer nicht möglich zu erhalten gewesen, auch die Kriegsunruhen solches fortzusetzen nicht gestatten wollten, ist auf Hohes Anbefohlnis Ihrer Exz. des Herrn Berghauptmanns von Oppel damit wieder eingestanden worden.“ Von den 50 Tlr. Vorschuß aus der Schürfgelderkasse waren von der 13. Woche Crucis (September) 1761 bis zur 3. Woche Luciae (Ende Oktober) 1763 13 Thaler 9 Groschen verbaut worden. Das Ergebnis der Bohrungen hatte wohl die Hoffnungen, die man von fiskalischer Seite auf die Kohlenfelder des Flöhaer Beckens hatte, nicht erfüllt; denn obgleich der bewilligte Vorschuß noch nicht verbraucht war, sind die Bohrungen auch nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges nicht fortgesetzt worden. Der Schloßhauptmann von Schütz schreibt in seiner Historisch-Ökonomischen Beschreibung von dem berühmten Schlosse und Amte Augustusburg 1770, daß man „zu Flöha und Gückelsberg vor einigen Jahren nicht ohne alle Hoffnung auf Steinkohlen zu bauen angefangen habe; allein, da man die Kohle zur Zeit nur hat gangweise finden können, so ist das Hauptflöz zur Zeit noch unentdeckt geblieben.“ Immerhin war durch die amtlichen Bohrversuche das Steinkohlenbecken von Flöha weiteren Kreisen bekannt geworden, so daß nach der früher zitierten Bemerkung Freiesleben's bei den Verhandlungen der Dresdner physikalischen etc. Wissenschaften 1768 zur Sprache kam, daß sich bei Gückelsberg auf dem Gebiet der Gräflich Watzdorffschen Herrschaft zu Lichtenwalde Steinkohlen fänden. Auch Charpentier erwähnt in seiner Mineralogischen Geographie der Chursächsischen Lande 1778, daß bei Gückelsberg und Flöha sich an einigen Stellen dunkelblauer Tonschiefer fände, worunter man Spuren von Steinkohle entdeckt habe. Er fährt fort: „Man hat dieserhalb seit einigen Jahren verschiedene Versuche, besonders in der Schlucht des sogenannten Wetzelbaches zwischen Gückelsberg und Flöha teils durch Schürfen, teils durch den Betrieb eines Stollens unternommen: Es ist aber bis jetzt dadurch noch nicht bestimmt worden, inwieferne man sich gewissen Hoffnung auf bauwürdige Steinkohlenflöze zu machen habe.“ Der Stolln, den Charpentier hier erwähnt, ist nach den bergamtlichen Akten um das Jahr 1770 von der Gemeinde Gückelsberg angelegt worden und vom Grafen von Vitzthum, der inzwischen die Herrschaft Lichtenwalde übernommen hatte und dessen Nachkommen später Besitzer des Steinkohlenwerks Lichtenwalde waren, weiter fortgesetzt worden. Trotzdem er drei Fahrten tief niedergebracht worden sein soll, hatte er doch kein beträchtliches Flöz ersunken, wonach allein man suchte. Anmerkung der Redaktion: Einen Stolln hätte man wohl eher „einige Lachter fortgebracht“ – die Formulierung „drei Fahrten tief niedergebracht“ spricht hier eher für die Anlage eines Schachtes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wenn nun auch nach Scheitern des Kupffer’schen Planes und der nachfolgenden Versuche von Vitzthum's bis 1800 kein größeres Unternehmen zum Abbau der Kohlenlager des Flöhaer Beckens mehr erfolgte, so haben doch die einzelnen Grundbesitzer dauernd versucht, Kohlenausstriche und Flözchen in geringer Tiefe auf ihren Grundstücken abzubauen. Nach dem Kohlenmandat waren sie ja sogar dazu verpflichtet, wenn sie verhindern wollten, daß ein Fremder auf ihrem Grunde schürfte. Sobald aber die Kohle oberflächlich abgebaut war, reichten natürlich Mittel und Unternehmungsgeist des Hüfners nicht mehr aus und die Baue verfielen umso schneller, da sie meist mit Wasserandrang zu kämpfen hatten. Der Lehnrichter Beckert scheint unter Hinzuziehung eines Verwandten, der Schichtmeister in Ottendorf war, ernstlich versucht zu haben, Nutzen aus den Bodenschätzen unter seinen Fluren zu ziehen, und hat verschiedene Schächte bis 24 Ellen tief am Nordwestrande des Pfarrwaldes angelegt. Aber allein auf sich gestellt, war auch er nicht imstande, die Schwierigkeiten der kostspieligen Wasserhaltung zu überwinden, so daß die Schächte um 1800 längst wieder verfallen waren und voll Wasser standen. Der Bergakademist Engelbrecht, der für die erste geognostische Landesuntersuchung die Flöhaer Gegend mit bereiste, führt in seinem 1800 erstatteten Berichte aus, daß auf der Höhe westlich der Ulbrichtschlucht, 1.500 Schritt von der Chemnitzer Straße aufwärts, der Hüfner Gottfried Oehmig auf seinen Feldern an mehreren nahe beieinanderliegenden Punkten etwa 1 Elle tief gegraben habe und dann ein 1 ½ Zoll starkes Flözchen von einer zerreiblichen Steinkohle gefunden habe, und daß man im Wetzelbachtale noch mehrere alte Stollen und Schächte, die vor ungefähr 30 Jahre (also um 1770) angelegt worden sein sollten, vorfände. Dies waren wahrscheinlich die 1761 und danach angelegten Versuchsbaue. Ferner fand Engelbrecht 500 Schritt nördlich „von der bekannten Flöhaer Brücke“ in einem Steinbruch „ein dünnes Lager von Pechkohlen und 4 Ellen tiefer noch eines“. Der Besitzer des Bruches, ein Bauer namens Günther aus Flöha, hatte einen Schacht in dem Steinbruche absinken lassen, der 1800 zwar noch offen, aber ohne Fahrten und Zimmerung war. Er stand ausnahmsweise nicht unter Wasser, da ein alter verbrochener Stollen bis in diesen Schacht gehen sollte. Von einem alten Stollen, der wahrscheinlich derselbe war, spricht auch der Bergakademist Lindig in seinem Berichte 1801 zu den Vorarbeiten für die erste geognostische Landesuntersuchung. Derselbe ging von vorderen Ulbrichtschlucht ostwärts nach der Höhe des Flöhaer Gebirges, wo um diese Zeit der Lehnrichter Schippan auf Lehngerichtsflur verschiedene Schächte abteufen ließ und wo sich später das Kieber’sche Werk befand. Lindig hatte von alten Leuten gehört, daß dieser verfallene Stollen „schon vor 100 und mehr Jahren gangbar gewesen sein und viel Steinkohlen geliefert“ haben soll. Wahrscheinlich handelt es sich um den verfallenen Bau des Licht- Erbstollns von 1741, der sich nach der Mutungsakte hier befand. Dieser Stolln ist später vom Kieber’schen und Lehngerichtswerke wieder ausgebaut und benutzt worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lindig erwähnt dann noch, daß ungefähr 10 Jahre früher (also um 1790) der Gärtner Seirich in Gückelsberg in seinem Garten einen Versuch auf Steinkohlen gemacht habe, indem er 9 Ellen tief in Sandstein niederging bis auf ein ¾ Ellen mächtiges Steinkohlenflöz. Er hat auch Kohle gefördert und nach Chemnitz an einen Schmied verkauft (wie Schippan in seinem Unterstützungsgesuch 1800 ausführt); wegen des damals noch geringen Preises für Steinkohle und infolge der zudringenden Wasser hat er den Abbau aber bald wieder aufgegeben. Zusammenfassend finden wir also, daß die Kohlenlager des Flöhaer Beckens wahrscheinlich seit dem Ausgange des Mittelalters örtlich bekannt und vorübergehend von den Grundeigentümern oberflächlich abgebaut worden sind, daß aber Versuche, in größerem Maßstabe eine Verwertung derselben auf gewerkschaftlicher und genossenschaftlicher Grundlage herbeizuführen, bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts scheiterten, besonders da die Grundbesitzer nach dem Kohlenmandat leicht jedes großzügige Unternehmen vereiteln konnten, indem sie den Abbau selbst in Angriff nahmen. Da die Mittel des einzelnen jedoch zur Ausführung größerer Bauten und Hilfswerke nicht reichten, so verfielen diese Baue stets wieder nach kurzer Zeit, so bald die an der Oberfläche liegenden Kohlen abgebaut waren. So war nach den Bergamtsakten gegen Ende des 18. Jahrhunderts das ganze Gebiet des Flöhaer Beckens nördlich der Flöha und Zschopau von vielen verfallenen Versuchsstollen, Schächten und Röschen bedeckt. In den letzten Jahrzehnten hatten auch Fiskus und wissenschaftliche Geologie sich schon mit den Steinkohlen des Flöhaer Beckens beschäftigt. ____________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Kapitel:
Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Flöhaer Becken zwischen 1800 und
1880 (Zeit des geregelten Abbaus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)
Auf
Gückelsberger Flur (Schippan, Zießler, Morgenstern)
Mit dem 19. Jahrhundert tritt in der Geschichte des Abbaues des Flöhaer Steinkohlenbeckens eine entscheidende Wendung ein. War derselbe bis dahin aus dem Stadium des Versuches nicht recht herausgekommen, indem die Grundeigentümer nur die ohne große Mühe und Kosten abzubauenden Tagesausstriche in Angriff nahmen oder Unternehmer mit unzulänglichen Mitteln sich bald wieder in ihrer Hoffnung, schnell reiche Lager vorzüglicher Kohle anzutreffen, getäuscht sahen, so ließ nunmehr die bei stetiger Entwickelung von Gewerbe und Industrie rasch sich steigernde Brennmittelknappheit auch weniger lukrativen Abbau mittelmäßiger und minderwertiger Kohle noch wirtschaftlich erscheinen. Den Anfang zur ernsthaften Ausbeutung der, wenn auch nicht reichen, so doch von der aufstrebenden Industrie der Gegend unbedingt benötigten Kohlenschätze des Flöhaer Beckens machte der Lehnrichter Johann Georg Schippan zu Flöha. Dieser besaß außer seiner Landwirtschaft mit Nebenbetrieben (Dörr- und Trockenboden) die Brauereigerechtsame in Flöha, eine Anzahl von Kalkbrüchen und Brennöfen bei Plaue (an der Schweddey), sowie Eisenerzgruben (wahrscheinlich bei Hausdorf oder Grünberg). Namentlich zum Kalkbrennen brauchte er unbedingt größere Mengen Feuerungsmaterial und zu diesem Zweck war auch weniger gute Kohle vorteilhaft zu verwenden. Er versuchte deshalb schon vor dem Jahre 1800, wie im Abschnitt über das Lehngerichtswerk auf Flöhaer Flur näher dargestellt ist, die unter seinen Flöhaer Grundstücken liegenden Kohlenlager zu fördern, indem er auf der Höhe des Berges östlich der vorderen Ulbrichtschlucht drei Schächte abteufen ließ, die aber nur dünne Lager von Steinkohle erschlossen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da ihm diese Resultate nicht genügten, teufte er auf Veranlassung und in Gemeinschaft mit dem Grafen von Vitzthum auf Lichtenwalde, zu dessen Herrschaft ja die Gückelsberger Fluren gehörten, zwei Schächte auf Gückelsberger Gebiet im Wetzelbachtal ab und fand dort im ersten, 14 Ellen tiefen Schacht bei 9 Ellen Schieferkohle von 1 ¼ bis 2 Ellen Mächtigkeit (0,7 m bis 1,15 m), im anderen, der tiefer im Wetzelbachtal lag, schon bei 3 Ellen Schieferton mit Steinkohle. Da mit zunehmender Tiefe, wo erst Aussicht auf mächtigere Lager begann, die Wasserlösung schwierig wurde, faßte er den Entschluß, den schon 1761 von Berghauptmann von Oppel in Betracht gezogenen tiefen Stolln vom Flöhatale her unter das Gückelsberger Gebirge in Angriff zu nehmen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das war nun ein Werk, das auch seine verhältnismäßig größeren Mittel überstieg, besonders, da inzwischen der Graf von Vitzthum starb. Er wandte sich deshalb im Jahr 1800 durch das Bergamt Marienberg an das Oberbergamt zu Freiberg mit der Bitte um einen zinslosen Vorschuß aus Staatsmitteln in Höhe von 2.000 Talern, der aus den Erträgnissen des Steinkohlenbergbaus nach Fertigstellung des tiefen Stollens und anderer nötiger Anlagen zurückerstattet werden sollte. Falls das Ministerium darauf nicht eingehen wolle, bat er, ihm die jährlich auf seine Brauereierzeugnisse zu entrichtende Tranksteuer von ungefähr 1.000 Talern auf vier Jahre zu erlassen. Aus eigenen Mitteln wolle er freiwillig 500 Taler zu dem Werke beisteuern. Damit der Staat Garantie habe, daß das erbetene Kapital dem Zwecke gemäß angewandt werden, wollte er die Regulierung des gesamten Bergbaus, die Aufsichtsführung und Rechnungslegung dem Bergamte überlassen, ganz wie es beim gewerkschaftlichen Erzbergbaue üblich war. Zu seinem Gesuche war Schippan ermutigt worden durch ein Preisausschreiben der Landes- Ökonomie- Manufaktur- und Commerzien- Deputaton, die für Nutzbarmachung weiterer Steinkohlenlager des Landes ansehnliche Unterstützung in Aussicht gestellt hatte. In der Begründung seines Gesuches bezog sich Schippan auch auf den seit Jahrzehnten erfolgten Abbau von Kohlenausstrichen im Flöhaer Becken, insbesondere auf die bergamtlichen Untersuchungen 1761 bis 1763, die das Vorhandensein größerer Kohlenflöze als sicher vermuten ließen, so daß es im allgemeinen Interesse läge, durch Ermöglichung seines Abbaus dem Lande ein neues Brennstofflager zu erschließen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einfügung der
Redaktion: Neben den durch das
V. Kurze bergmännische Nachrichten. b. Preisaufgaben. dazu heißt: „Auf allerhöchsten Befehl Sr. Churfürstl. Durchlaucht zu Sachsen sind von der Churfürstl. Landesökonomie, Manufaktur- und Commercien- Deputation, zur Aufmunterung des Nahrungsstandes unter anderem auch nachstehende in die Bergbaukunde einschlagende Preisaufgaben auf das gegenwärtige und die folgenden Jahre 1789, 1790 und 1791, ausgesetzt worden.“ Die ausgelobten Prämien erhielt unter anderem, „Wer außer den Gegenden von Dresden und Zwickau, wo schon jetzo Steinkohlenbrüche vorhanden sind, gute Steinkohlenbrüche neu entdeckt; erhält, auf davon beschehene Anzeige und von der Güte der Kohlen sowohl als der Beträchtlichkeit des Kohlenbruchs beygebrachte Zeugnisse in der nächst darauffolgenden Oster- oder Michaelmesse, 50 Thaler. Diejenige Societät oder Gewerkschaft, welche aus einem an dergleichen Orten unentdeckten Steinkohlenbruche Steinkohlen auf ihre Kosten fördert, erhält für die ersten 100 Tonnen auf diesfalls beygebrachtes gerichtliches Verzeichnis 50 Thaler. Und wenn deshalb ein Stolln zu führen nöthig gewesen, für jedes 50 Lachter 100 Thaler. Diejenigen, welche beim Bierbrauen, Brandwein- und Ziegelbrennen bisher blos mit Holze gefeuert haben, erhalten, wenn sie ein Jahr lang bey ihren Feuerungen sich der Steinkohlen mit gutem Erfolge bedient, und die behörige Vorrichtung dazu gemacht haben, auch solches fernerhin schwunghaft fortsetzen zu wollen, durch gerichtliche Attestate erweisen können, nach Beschaffenheit des dadurch bewirkten Holzersparnisses, 10 bis 50 Thaler. Wer eine Torfgräberei anlegt, und in einem Jahre wenigstens 20.000 Stück absetzt, oder selbst in der im folgenden § bestimmten Maße verbraucht zu haben beybnbringt, erhält 30 Thaler. Wenn solcher Absatz fortdauert, nach Verlauf von sechs Jahren 50 Thaler. Wer beim Bierbrauen, Brandwein-, Kalk- und Ziegelbrennen, auch Schmieden, anstatt der vorher gebrauchten Holz- und Holzkohlenfeuerung sich erkauften Torfes ein Jahr lang bedient zu haben bescheinigt, erhält nach Beschaffenheit des dadurch bewirkten Holz- und Kohlenersparnisses 10 bis 50 Thaler... Alle churfürstl. Unterthanen in jedem Kreise… auch Ausländer, so sich in selbigen niederlassen, haben die Freyheit, bei diesen Prämien zu concurriren, …auch denjenigen, welche sich des landesherrlichen höchsten Wohlgefallens besonders würdig gezeigt, nach Befinden noch über die gesetzten Summen, Prämien- Medaillen ertheilt werden.“ (Bergmännisches Journal, Zweyter Band, Achtes Stück, in der Grazischen Buchhandlung, Freiberg, November 1788, S. 777ff)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Bergamt Marienberg unterstützte sein Gesuch und bestätigte seine Begründungen, die es durch einen Sachverständigen hatte nachprüfen lassen. Besonders wird noch das Zeugnis des Gärtners Säurich (oder Seirich ?) aus Gückelsberg angeführt, der auf seinem Grundstück 22 Tonnen guter Steinkohle gewonnen und an einen Schmied in Chemnitz verkauft hatte, ebenso, wie auch Schippan selbst schon 4 Fuder Kohle zu je 8 Tonnen für 5 Tlr. 8 Gr. pro Fuder nach Frankenstein zum Kalkbrennen geliefert habe. Ausdrücklich wird in dem Gutachten des Bergamtes Marienberg darauf hingewiesen, daß in den aufstrebenden Gewerbestädten Zschopau, Oederan, Frankenberg und Chemnitz große Nachfrage nach Industriekohle herrsche, so daß sich in Anbetracht des großen Absatzgebietes auch größere Aufwendungen rentierten. Wenn Schippan aus seinem Kohlenbau Nutzen ziehe, würden auch die anderen Grundbesitzer der Gegend ihre Grundstücke auf Kohlen abbauen lassen, und diese Baue können dann als Flügelörter an den geplanten tiefen Stollen angeschlossen werden. Schließlich dürfe man seitens der Bergbehörden die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, da sich Schippan unter Kontrolle des Bergamtes stellen wolle, Einfluß auf den Steinkohlenbergbau zu gewinnen, indem man diesen sonst den Bergämtern entzogenen Teil des Bergbaus durch richtige bergbauliche Grundsätze berate und überwache, denn es sei bekannt, daß der Mangel an Steinkohlen in Sachsen nicht durch das Fehlen an Steinkohlenlagern an sich bedingt sei, sondern weil nach dem Kohlenmandat die Grundbesitzer jeden unternehmenden sachverständigen Bergmann mit leichter Mühe vom Bergbau ausschließen und ihren kleinlichen Abbau ohne großzügige Gesichtspunkte sachverständiger Beratung und Überwachung betreiben konnten. Sie trieben gewissermaßen Raubbau am Nationalvermögen, da sie nur wertvollere und ohne große Mühe erreichbare Kohle förderten, die übrige verschütteten und liegen ließen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei der Weitergabe des Schippan’schen Gesuches an das Ministerium weist das Oberbergamt zwar nochmals auf alle Einzelheiten eines möglicherweise zu gründenden Kohlenbergbaus im Flöhaer Becken hin, von dem auch der Fiskus Nutzen haben könnte, da sich die Kohlenlager wahscheinlich bis unter das Revier des fiskalischen Waldes bei Plaue erstreckten, hält aber die Frage der Abbauwürdigkeit noch nicht für genügend geklärt, um ohne weiteres eine so beträchtliche Unterstützung eines einzelnen Unternehmens zu rechtfertigen, sondern schlägt vor, die schon 1761 begonnenen Untersuchungen des Flöhaer Steinkohlengebirges durch planmäßige Bohrarbeiten fortzusetzen, um Lage, Ausdehnung und Bauwürdigkeit der Flöze durch Sachverständige genau feststellen zu lassen. Daraufhin bewilligte das Miinisterium die Mittel zur Fortsetzung der geologischen Untersuchungen und stellte Umfang und Durchführung derselben ganz in das Ermessen des Oberbergamtes. Dem Gesuchsteller Schippan sollte vorläufig entsprechender Bescheid gegeben und seine Grundstücke bei den Untersuchungen besonders mit berücksichtigt werden. Die Untersuchung wurde im Jahre 1801 vom Markscheider Oelschlägel unter Leitung des Bergrates von Oppel vorgenommen. Oelschlägel vermaß dabei das Gebirge nördlich von Flöha und Gückelsberg aufs genaueste, ließ Bohrungen vornehmen und Schürfe anlegen und trug alles auf einem Geländeriß ein, der im Rißarchiv des Bergamtes Freiberg noch heute erhalten ist. Dünne Steinkohlenflöze traf er allenthalben an, besonders an den Stellen, wo schon früher geschürft worden war, aber kein größeres Flöz – das „Hauptflöz“ – worauf man damals allgemein hoffte. Am stärksten war noch ein Flöz auf des Hüfners Wächtler‘s Grund und Boden in Gückelsberg, das eine Elle mächtig und mit einem Stollen vom Flöahtale gut zu lösen war. Die Untersuchung wurde dann im Jahre 1802 fortgesetzt und beendet. In seinem endgültigen Bericht ist der Bergrat von Oppel der Ansicht, daß in Gückelsberger und Flöhaer Steinkohlengebirge hauptsächlich zwei größere Flöze bestehen, die zusammen abgebaut werden könnten, so daß sich in der dortigen holzarmen und gewerbereichen Gegend ein Abbau bei der geringen Tiefe der Kohlen wohl lohne. Da nach seinen Feststellungen über das Streichen und Fallen der Flöze diese im mittleren Wetzelbachtale eine Mulde bilden, genüge es, den bei der Flöha bei der Gückelsberger Mühle anzusetzenden Stollen 294 Lachter (also 588 m) weit zu treiben, wo er einige 20 Lachter Tiefe einbringen und beide Flöze trocknen würde, später müßte er dann noch nach Nordwesten verlängert werden, um das Steinkohlengebirge auf Flöhaer Flur bis über die Ulbrichtschlucht hinaus trocken zu legen. Ebenso könnte er – nach Nordosten verlängert – von großem Nutzen für die Erzgruben im Oedeeranschen Walde werden, ja sogar für die Hülfe Gottes Zeche in Memmendorf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der benannten Gegend befand sich eine größere Zahl damals noch nicht ganz aufgegebener Erzzechen. Auch Schippan besaß in den 1790er Jahren eine Erzgrube im Zechentale des Oederaner Waldes, in dem er nach Kaden‘s Bericht vom Jahre 1810 zur ersten geognostischen Landesuntersuchung Spat, Bleiglanz und Rotgültigerz abbaute. Dieses durch Wasserzudrang auflässige Werk hoffte er bei Verlängerung des tiefen Stollens mit zu lösen. Oppel fährt fort: Auf fiskalischem Grund und Boden (also bei Plaue und im Struthwalde) sei zwar Steinkohlengebirge, aber noch kein Flöz entdeckt worden; und da man notwendigerweise zuerst von den bekannten Flözen ausgehen müsse, sei es einer späteren Zeit vorbehalten, an den Abbau auf fiskalischem Gebiet heranzugehen, falls sich die Flöze dann erkanntermaßen bis dorthin erstreckten. Auch eigne sich der Steinkohlenbergbau, da die Flöze nicht über 42 Zoll (98 cm) mächtig wären, wohl für kleinere Unternehmungen einzelner oder mehrerer Privateigentümer und sei zur Abhilfe des Holzmangels wohl zweckmäßig und gemeinnützig, würde aber seiner Natur nach für ein großes fiskalisches Unternehmen kaum Überschuß versprechen. Es sei also das richtigste, zunächst die Schippan’sche Unternehmung durch Unterstützung mit öffentlichen Mitteln in Gang zu bringen und das weitere abzuwarten; Schippan habe auch schon mit den benachbarten Grundbesitzern Verträge abgeschlossen, daß der planmäßige Abbau der Kohlenfelder nicht behindert werden konnte und sei bereit, den tiefen Stollen zu beginnen, wozu er allerdings staatliche Unterstützung nötig habe. Schippan hatte bei seinen weiteren Schürfungen entdeckt, daß das eine Flöz auf Gückelsberger Flur bis fast 1 m mächtig war, davon etwa der vierte Teil beste Schmiedekohlen, der Rest Schieferkohle, zum Kalkbrennen brauchbar. Nach abgeschlossener Untersuchung und dem günstigen Bericht des Bergrats von Oppel wiederholte dann Schippan sein Gesuch um Vorschuß von 2.000 Talern oder Erlaß der halben Tranksteuer. Der Gesamtkostenaufwand für den Stollen war auf 3.300 Taler geschätzt worden. Er verpflichtete sich, die Unterstützung durch Abgabe von 6 Pfennigen auf jede Tonne geförderter Kohle zurückzuerstatten. Den tiefen Stollen nahm er schon jetzt in Angriff.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Erbrichter von Gückelsberg, Friedr. Eilh. Berger, den Gärtnern Joh. Karl Wächtler und Joh. Gottl. Richter, dem Schmiedemeister Joh. Michael Hofmann und den Hüfnern Joh. Christ. Pomsel, Karl Gotthelf Seirich, Friedrich Wächtler, Christian Gottlob Richter, Joh. Gotl. Wächtler, Daniel Fischer, Joh. Georg Uhlig, Joh. Gottl. Anke, Joh. Karl Lange, ferner dem Mühlenbesitzer Joh. Friedr. Stähr und dem Häusler Carl Gottl. Seyrich, alle aus Gückelsberg, schloß er vor dem Reichsgräflichen Vitzthum’schen Gericht zu Lichtenwalde einen Vertrag, wonach diese Grundbesitzer ihm alle Rechte auf die unter ihren Grundstücken liegenden Steinkohlenlager übertrugen gegen Entrichtung von 6 Pfennigen auf die Tonne Kalkkohlen und 1 Groschen auf die Tonne Schmiedekohlen, die auf ihrem Grunde gefördert würden. Wenn Flöze über 6 Ellen Schmiedekohle entdeckt würden (was nie eintrat), wäre 1 Gr. 6 Pfg. pro Tonne abzugeben. Wenn auf eines dieser Besitzer Flur Schächte geteuft werden müßten, ohne daß dieser Tonnengeld zu beanspruchen habe, so sollte diese Benutzung der Erdoberfläche besonders vergütet werden. Auch der Mühlenbesitzer Stähr, auf dessen Grundstück schon der tiefe Stollen begonnen worden war, sollte eine Entschädigung erhalten. Durch diesen „Akkord“, wie der Vertrag genannt wurde, war fast die gesamte Gückelsberger Flur nördlich der Landstraße an einen Unternehmer zur Ausbeute auf Steinkohlen übergeben worden. Der Abbau des „Akkordfeldes“ deckt sich infolgedessen im großen Ganzen mit dem Abbau der Gückelsberger Flur überhaupt. Nur ein kleiner Grundeigentümer, Morgenstern, hat in Zukunft auf Gückelsberger Flur außerhalb des Akkordfeldes auf seinem Grundstück vorübergehend noch abgebaut. Wenn Schippan oder sein Rechtsnachfolger in Zukunft den Abbau zwei Jahre lang brach liegen lassen sollte, würde der Vertrag null und nichtig werden. Dieser letzte Punkt führte gegen Ausgang des 19. Jahrhunderts zu einem Prozeß mit Schippan's Nachfolger, auf den wir noch zurückkommen werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Ministerium in Dresden ließ sich in der Folgezeit zwar noch eingehende Vorschläge machen, inwiefern durch den tiefen Stollen bei Gückelsberg außer den Steinkohlenlagern gleichzeitig der schon damals auflässige Bergbau auf Erzgängen im Oederaner Walde vom Wasser gelöst und wieder in Gang gebracht werden könne, lehnte dann aber doch im Jahre 1803 jede Unterstützung Schippan's ab, da der Plan, den Stollen bis zum Oederaner Wald fortzuführen, zu kostspielig geworden wäre und ein kürzerer Stolln zu einseitig dem Privatinteresse des Flöhaer Lehnrichters entgegenkommen würde, der dadurch nur wohlfeile Feuerung für seine Kalköfen und seine Brauerei bekäme, welch letztere ohnehin so blühend ging, daß sie in den letzten zwei Jahren 2.000 Taler allein an Tranksteuer hatte abführen müssen. So nahm der tatkräftige Schippan den Bau des Stollens auf eigene Kosten vor, trotzdem es einige Jahrzehnte dauern mußte, bis dieser fast 600 m lang getrieben war und seine Aufgaben erfüllen konnte. Nach des Bergakademisten Lindig bereits erwähntem Berichte arbeiteten schon 1801 zwei Mann täglich 1 ½ Schicht = 12 Stunden daran und hatten ihn bereits 16 Lachter (32 m) weit getrieben. Ende 1802 war er 88 Ellen (zirka 50 m) lang, wie aus den Akten hervorgeht; er war beim Bergamt als Erbstolln gemutet worden. Schippan hatte sich damit, was seinen tiefen Stolln anbetraf, den Pflichten des Bergrechts unterworfen, dadurch aber auch den bergrechtlichen Schutz seiner Rechte auf den Stolln erlangt. Hierdurch und weil Schippan überhaupt immer in einer gewissen Fühlung mit dem Bergamt Freiberg blieb, sind wir über die Entwickelung dieses ersten und wohl größten Steinkohlenwerks im Flöhaer Becken aktenmäßig besser unterrichtet, als über die meisten anderen, später gegründeten. Es kann deshalb auch hier genauer auf Einzelheiten eingegangen werden, die oft typisch für den Steinkohlenbau im Flöhaer Becken während des 19. Jahrhunderts sein werden und sich bei den anderen Werken wiederholt haben. In Fühlung mit Freiberg blieb Schippan schon deshalb, weil er die Hoffnung auf staatliche Unterstützung zu seinem tiefen Stolln nicht aufgab. Ferner hat ein Sohn von ihm von 1811 bis 1817 die Bergakademie besucht. Wir finden ihn später als vereidigten Geometer in Freiberg angestellt. Durch ihn hat die Akademie wohl auch den Grund- und Saigerriß eines Teiles des Steinkohlenwerkes zu Gückelsberg erhalten, der dieser Arbeit beigefügt ist und auf den wir weiter unten noch zu sprechen kommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Deutsche Fotothek
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahre 1811 hatte Schippan aufs neue ein Gesuch um Vorschuß – diesmal von 6.000 Talern – bei der Landes- Ökonomie- Manufaktur- Deputation eingereicht, den er zu 2% verzinsen und im Laufe von sechs Jahren zurückzahlen wollte. Obgleich das inzwischen königliche Ministerium „bei den gegenwärtigen Zeit- und Kassenumständen“ (es war die napoleonische Zeit) auf dergleichen Gesuche nur dann eingehen konnte, wenn der dadurch zu befördernde und ohne besondere Unterstützung nicht zu erreichende Zweck einen ganz ausgezeichneten Nutzen entweder für das gesamte Land oder wenigstens doch für eine ganze Gegend desselben verspricht, so forderte es doch das Oberbergamt zur Berichterstattung über den derzeitigen Stand des Schippan’schen Steinkohlenwerkes und des tiefen Stollens auf. Die hierzu nötige Lokalbesichtigung wurde vom Obereinfahrer Wagner vorgenommen, dessen Bericht folgendes Bild über den Stand des Gückelsberger Steinkohlenwerkes im Jahre 1811 ergibt: Ohne daß der tiefe Stollen auch nur annähernd durchschlägig war, förderte Schippan doch Steinkohle auf einem Werke, das ungefähr 700 m nordöstlich der Gückelsberger Mühle im Wetzelbachtale lag. Durch einen dem Wagner’schen Bericht (Oberbergamtsakte Nr. 10007) beigelegten Riß läßt sich ziemlich genau feststellen, daß es am Osthange des Wetzelbachtales sich befand, da, wo in dessen Oberlauf das Tellenbächlein aus dem Pfarrwalde einmündet, dessen Wasser später in einem Kunstteich egsammelt und zum Antrieb für ein Kunstrad für die Wasserpumpen verwandt wurde. Es bestand aus einem Stollen A, in der Sohle des Wetzelbaches angesetzt, der gleich vom Mundloch herein ein oberes Kohlenflöz angefahren hatte. Dieser Stolln ging 50 m weit ins Gebirge, wo dann ein Tagesschacht B (später Tippmann- Schacht genannt, da er auf dessen Grund ansetzte) auf ihn getrieben war, der von der Hängebank bis zur Stollnsohle 21 ½ m tief war. Der Schacht ging aber noch 8 m tiefer bis zu einem unteren Flöz, so daß seine gesamte Teufe 29 ½ m war. Ungefähr von der Mitte des Stollens A ging ein Fallort C schräg abwärts bis zum tiefsten Punkte des Tagesschachts B; aus diesem war das untere Flöz abgebaut worden. Das Fallort war dann vom Tagesschacht auf dem fallenden unteren Flöz noch weiter gegen Süden getrieben worden, stand aber um 1811 unter Wasser. Vom Stollen wie auch vom Tagesschacht gingen dann noch verschiedene Strebbau-Örter im Steigen und Fallen des oberen Flözes ab, aus denen gefördert wurde. Das hier abgebaute Flöz war 0,28 m bis 0,42 m mächtig und bestand größtenteils aus Kalkkohle. Von 50 Tonnen Förderkohle konnten 1 bis 2 Tonnen Schmiedekohle gewonnen werden. Das unter Wasser stehende tiefere Flöz soll nach Angabe des angestellten Steigers Langhammer bedeutend mächtiger und aus besserer Kohle gewesen sein, aber die Wasserhaltung durch Pumpen bis auf die Stollnsohle war so kostspielig, daß der Abbau trotz der Güte der Kohle aufgegeben wurde. In dem noch in Abbau stehenden oberen Flöz arbeiteten unter einem Steiger vier Hauer im Gedinge, die wöchentlich zirka 50 Tonnen Kohle förderten und für die Tonne inklusive Förderung durch den Schacht 3 (alte) Groschen bekamen. Der Wochenlohn eines Hauers im Gedinge betrug bei 12 ½ Tonnen Förderung zu je 3 Groschen etwa 50 Groschen, also über 2 Taler.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gelb: Sohle des oberen; blau: Sohle des mittleren und rot: Sohle des Johann Georgen Stollns.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von den 50 Tonnen wöchentliche Förderung wurden nach Auslese der Schmiedekohlen etwa 10 Tonnen der besten Schieferkohle auf dem Flöhaer Landgericht zum Branntweinbrennen, Mälzen und Bierbrauen verwandt, der Rest aber zum Kalkbrennen benützt und verkauft. Auch auf dem oberen Flöz mußte das Wasser an den Örtern, die im Fallen des Flözes lagen, durch Pumpen auf den Stollen gehoben werden, doch brauchte die Pumpe bloß in 24 Stunden 4 Stunden in Gang erhalten zu werden, so daß die Wasserhaltung in 8 Tagen ungefähr einen Taler kostete. Der zur Wasserhaltung benötigte tiefe Stolln war 1811 erst 264 m lang und hatte noch nicht die Hälfte der Entfernung bis zum Werke zurückgelegt. Er ging vom Mundloch bei der Gückelsberger Mühle 24 m lang in einfacher Türstock-Zimmerung, 1,75 m hoch; so war er 1802 begonnen worden, als man noch auf staatliche Unterstützung rechnet; dann aber war er 202 m lang bis zu einem auf ihn abgesunkenen Tagesschacht G kaum 1,50 m hoch. Schippan hatte, ohne Unterstützung gelassen, bei dem kostspieligen Werke sparen müssen. Der Tagesschacht ist nach Wagner's Riß etwas unterhalb des Höhenpunktes 348 der heutigen Karte gewesen, nördlich von Gückelsberg; er war etwa 64 m tief. Von ihm ging der Stolln 1811 noch 38 m weiter, immer in der geringen Höhe von 1,25 m bis 1,5 m. Er hatte wenig Zimmerung, da er durchweg in Porphyr verlief. Seit einem halben Jahr war an ihm nicht mehr gearbeitet worden, da die Kapitalanlage, die sich, wenn überhaupt, so erst nach langen Jahren bezahlt machen könnte, für den Lehnrichter zu groß wurde. Deshalb hat er auch das neuerliche Gesuch um Vorschuß eingereicht. Nach Naumann (Geognostische Beschreibung des Kohlenbassins zu Flöha) durchsank dieser erste Stollnschacht (später folgte noch ein zweiter): 60 Ellen Tonstein (= 34 m Porphyrtuff), 20 Ellen Sandstein und Schieferton (= 12 m), ein oberes Kohlenflöz von 12 bis 14 Zoll (= 0,28 bis 0,33 m), 6 Ellen Sandstein und Schieferton (= 3,05 m), ein mittleres Kohlenflöz von 6 bis 8 Zoll (= 0,14 bis 0,19 m), 10 Ellen Sandstein und Schieferton (5,7 m), ein unteres Kohlenflöz von 3 bis 4 Zoll (= 0,07 bis 0,10 m), 1 Elle Sandstein (= 0,57 m), 13 Ellen Felsitporphyr bis zur Stollensohle (= 7,4 m). Wagner berechnete, daß ein Lachter dieses Stollens in der geringen Höhe von 1,25 m aufzufahren, einschließlich Werkzeug auf 13 Taler zu stehen kam, die Tagesförderung des gelösten Gesteins bis zum Schacht und durch diesen zutage weitere 5 Taler, zusammen 18 Taler pro Lachter. Bei einer Belegung von 4 Mann konnten in 4 Wochen etwa 2 Lachter aufgefahren werden. Da das Steinkohlengebirge (Wagner kannte bloß die obere Stufe) auf dem Porphyr aufliege, würde der Stollen, der bisher ganz im Porphyr verlief, wahrscheinlich alle Flöze des Gückelsberger Kohlengebirges unterfahren, so daß zur Erreichung des Zweckes, die Wasser von den Flözen zu zapfen, der Stollen bis unter das Schippan’sche Werk geführt und dort auf ihn ein Schacht abgeteuft werden müßte. Das bedeutete noch 196 Lachter (392 m) weitere Länge des Stollens. Würde dieser aber in der geringen Höhe wie jetzt fortgesetzt, so würde er bald Luftmangel bekommen. Er müßte vielmehr 2 m hoch aufgefahren werden und dies vom Tageschacht an noch nachgeholt werden. Dieses nachträgliche Erhöhen von ungefähr 60 m Stollnlänge auf 2 m Höhe schlägt er zu 210 Taler an. Das Neuerrichten der verfallenen Zimmerung im Tagesschacht, der der Luftzuführung wegen nicht zu entbehren sei, würde bei den hohen Holzpreisen der Flöhaer Gegend etwa 200 Taler kosten. Dann käme die Hauptausgabe: 196 Lachter in einer Höhe von 2 m aufzufahren mit Förderung des Gesteines zutage und Ausgabe für Gezähe und Pulver, zu 25 Taler je Lachter = 4.900 Taler; dann müßte der Schacht im Steinkohlenwerk noch 32 m bis zum tiefen Stollen abgesenkt werden. Ein Lachter dieses Niederbringens einschließlich der benötigten Wasserhaltung zu 35 Taler gerechnet würde einen Aufwand von 476 Taler ergeben. Das wäre also ein Gesamtaufwand für die restlose Lösung des Gückelsberger Steinkohlenwerkes von 5.786 Talern.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann gibt Obereinfahrer Wagner noch eine Übersicht über Verbrauch und Absatz der Gückelsberger Kohle. Der Lehnrichter Schippan hatte schon seit einer Reihe von Jahren am Kuhstein hinter Plaue einen Kalkbruch auf fiskalischem Grunde gepachtet. In dem dabei errichteten Kalkofen mit zwei Kesseln wurde jährlich ½ Jahr Kalk gebrannt und dabei wöchentlich 80 Tonnen Steinkohle verbraucht, also im Jahr 2.080 Tonnen. Seit 1810 hatte Schippan einen weiteren Kalkofen in Rottluff bei Chemnitz. Dort wurden wöchentlich bei nur einem Kessel 20 Tonnen Kohle, also bei halbjährigem Brennen 520 Tonnen im Jahre verbraucht. Das waren zusammen 2.600 Tonnen, oder 5.200 Scheffel zum Kalkbrennen. Weitere 10 Tonnen der besten Schieferkohle wurden wöchentlich in der Bier- und Branntweinbrauerei des Lehngerichts, sowie zum Malzdörren aussortiert, jährlich also 520 Tonnen oder 1.040 Scheffel. Der jährliche Gesamtverbrauch von Kohlen aus dem Gückelsberger Werke betrug also – die geringfügigen Mengen aussortierter Schmiede- oder Pechkohle ungerechnet, die ab und zu verkauft wurden, 6.240 Scheffel. Zum Brennen von 100 Scheffel Kalk brauchte man 50 bis 60 Tonnen Steinkohle. Vorher, als man die Kalköfen noch mit Holz speiste, waren zum selben Zwecke 9 Klafter Scheitholz nötig. Es wurden also allein dadurch, daß die beiden Schippan’schen Kalköfen mit Kohle beschickt wurden, durch die verbrauchten 2.600 Tonnen etwa 465 Klafter bestes Scheitholz erspart. Nimmt man dazu eine Ersparnis von 92 Klaftern Holz durch die 520 Tonnen Kohle, die die Schippan’sche Brauerei brauchte, so gab das insgesamt eine jährliche Holzersparnis von 560 Klaftern allein durch die in einem kleinen Privat-Kohlenwerk gewonnene Steinkohle für das Gebiet von Flöha. Auf Grund seiner Untersuchung und Berechnungen kommt Wagner schließlich zu folgendem Gutachten: Die große Wohltat, die durch den Steinkohlenbau der Flöhaer Gegend erwiesen werde, sei offenbar bei dem dortigen Holzmangel und der Tatsache, daß sich die Industrie in den umliegenden Städten Chemnitz, Frankenberg, Oederan, Zschopau täglich vergrößere. Infolgedessen hätten in letzter Zeit Chemnitzer Fabrikanten selbst Versuche auf Steinkohlen bei Flöha unternommen. Für den Dransdorfer Kalkofen seien in diesem Herbst allein bei Schippan 1.000 Tonnen Kohle bestellt worden. Ohne den tiefen Stollen sei jedoch ein vorteilhafter und zweckmäßiger Abbau der Steinkohlen des Flöhaer Beckens unmöglich, das sei nun bereits aktenkundig. Auch das seit 1801 betriebene Schippan’sche Werk werde ohne den Stollen schließlich wieder zum Erliegen kommen, da die Flöze von oben herein bereits abgebaut seien und die Wasserhaltung bei Abbau der tiefen Flöze, obgleich diese nach der Tiefe zu besser würden, zu schwierig und kostspielig würde. Der bereits 264 m ins Gückelsberger Gebirge getriebene Stollen dagegen würde auch nach Abrechnung des langsamen Anlaufens noch 32 m saigere Teufe unter den jetzigen Tiefbauen des Steinkohlenwerkes einbringen, würde also eine vollkommene Lösung der Wasserhaltungsfrage und einen reinen Abbau der Flöze gewährleisten, da diese wahrscheinlich nicht bis zur tiefen Stollnsohle niedergehen würden. So vorteilhaft nun aber auch dieser Stollen sei, so würde er wohl schwerlich von Schippan allein durchgeführt werden können, da der noch erforderliche Aufwand nach obiger Berechnung mindestens 5.786 Taler erfordere und die Arbeit daran, selbst wenn er ununterbrochen mit 4 Mann belegt wäre, noch 8 bis 9 Jahre dauerte. Schon habe Schippan auch die Arbeit daran seit einem halben Jahre eingestellt und ohne Unterstützung aus öffentlichen Mitteln dürfte dies gemeinnützige Unternehmen wohl kaum zum Ziel kommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dennoch scheint der nachgesuchte Vorschuß auch jetzt nicht gewährt worden zu sein, denn inzwischen kamen die Wirren der Befreiungskriege heran, bei denen Sachsen besonders in Mitleidenschaft gezogen war. Der sächsische Staat und seine Regierung waren bei der erfolgenden Umgestaltung der europäischen Machtverhältnisse zu sehr in außenpolitische Sorgen verwickelt, um sich den inneren Bedürfnissen einen Landesteiles widmen zu können. Inzwischen hatte der tatkräftige Schippan, da er nicht warten konnte, bis nach einer Reihe von Jahren der tiefe Stollen endlich durchschlägig war, eine wenigstens teilweise Abhilfe des Wasserandrangs erreicht, indem er ein Kunstgezeug anlegte, d. h. ein Wasserrad zum Antrieb der Pumpen, das er durch das Wasser des zu einem Teich gestauten Tellenbächleins und des Wetzelbaches treiben ließ. 1813 war das Kunstgezeug schon in Betrieb. Nach dem Weygandt- Eydam’schen Tagebuche hatten Einwohner von Flöha und besonders von Gückelsberg beim Herannahen der französischen und österreichischen Kriegsscharen ihre Habe in Schippan's Stollen und Schächten versteckt. Das Unglück wollte es aber, daß einem französischen Offizier beim Besichtigen des Kunstgezeugs die Zehen weggerissen wurden, worauf der Steiger (jetzt Hinkelmann) flüchten mußte; das versteckte Gut wurde von den Franzosen aufgefunden und weggenommen, auch sonstiger Schaden an dem Werke angerichtet. In der schlimmsten Zeit, im Oktober 1813, mußte Schippan mit den Seinen sich sogar eine Zeitlang verborgen halten. 1814 hatte er aber sein Werk wieder in Betrieb.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gelb: Sohle des oberen; blau: Sohle des mittleren und rot: Sohle des Johann Georgen Stollns.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Markscheider Martini, der im Auftrage des Oberbergamtes 1814 die Karbonschichten des Oederaner Waldes untersuchte (in Sachen Lichtenberger, s. u.), berichtet über den Kohlenabbau bei Gückelsberg und Flöha folgendes: Außer dem Hauptwerk mit dem früher genannten Tagesschacht hatte Schippan den Wetzelbach abwärts noch eine Anzahl Versuchsschächte angelegt, die ein allmähliges Mächtigerwerden der Kohlenschichten bis zu 3 Ellen dartaten. Die Tiefbaue des Werkes, die 1811 noch unter Wasser standen, waren durch das neue Pumpwerk wieder betriebsfähig und in ihnen wurde hauptsächlich abgebaut, nachdem das obere Flöz in diesem Teil des Feldes ziemlich erschöpft war. Die Gewinnung der Kohle selbst wurde durch öfteres Verdrücken des Flözes erschwert und dadurch sogar die gewöhnliche Steinkohle oft so verunreinigt, daß eine genaue Scheidung und Aufbereitung eintreten mußte. Wie nach Süden, so wurden die Kohlenflöze auch nach Westen hin auf Flöhaer Flur besser, so daß hier ein Bauer aus Flöha abbaute (wahrscheinlich der Vizerichter von Flöha, Richter, der seit 1814 durch Pötzsch auf seinen Feldern Kohle gewann, später Kieber‘s Werk). Aus den Martini's Berichte beigefügten geognostischen Karten (Oberbergamtsakten Nr. 10476, Vol. I) geht hervor, daß der tiefe Stolln von Gückelsberg zwischen 1811, wo man seinen Betrieb eingestellt hatte und Ende 1814 nicht weitergekommen war. Und dies blieb auch die nächsten Jahre so, da Schippan keine Unterstützung bekam, die Wasser seines Werkes aber vorläufig durch das Kunstgezeug gelöst waren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach 1822 ist auf einem von Markscheider Gündel gefertigtem Riß (gelegentlich des Erwerbs der Abbaurechte im Flöhaer Pfarrwalde durch Fiedler) ersichtlich, daß zwar Schippan's Werk sich jetzt mit drei Stollenmundlöchern am Wetzelbach abwärts zieht, der tiefe Stollen aber noch nicht weitergekommen ist. Die nächsten ausführlichen Aufschlüsse über den Fortgang des Gückelsberger Werks gibt uns der in der Freiberger Akademie erhaltene (oben gezeigte) „Grund- und Saigerriß eines Theiles des Steinkohlenwerks zu Gückelsberg“. Nach diesem Riß bestanden 1823 außer dem früher genannten Stollen mit dem darauf abgesunkenen Tagesschacht (auch Tippmann- Schacht genannt, da er auf dessen Grund ansetzte) noch zwei weitere Stollen bachabwärts, im Grundriß mittlerer Stollen und tiefer Johann Georgen Stollen genannt. Mit letzterem, der ungefähr 300 m bachabwärts vom oberen Stollen angesetzt war, suchte man, soweit es möglich war, die Grubenwässer abzuleiten, nachdem der tiefe Stollen von der Flöha her mangels staatlicher Unterstützung seit 1811 nicht weiter geführt worden war. Aus den tieferen Abbauen, die dieser Stollen noch nicht löste, wurde das Wasser durch das Kunstrad auf den Stollen gehoben. Für die Wasserkunst waren zwei Tagesgebäude errichtet: Die Radstube und das Treibehaus, das zugleich als Huthaus und Wohnung des Steigers diente. Das Antriebswasser lieferte der Kunstteich, der vom Tellenbächlein und Wetzelbach gespeist wurde. Es wurde in einem hölzernen Viadukt über das Wetzelbachtal in die am anderen (Ost-) Ufer des Baches gelegene Radstube geleitet. Die meisten Abbaue befanden sich südlich des vom Treibehaus niedergehenden Kunstschachtes, im sogenannten großen und kleinen Sattel, bis zum mittleren Stollen hin. Beim großen Sattel ging noch ein weiterer, zirka 15 m tiefer Schacht nieder, neben dem sich das Steinkohlenvorratshaus befand. Der Abbau hatte sich also vom ersten, oberen Stollen mit Tippmann- Schacht seit 1811 südwärts gezogen und dehnte sich nun deutlich nach Südosten aus, wo später der Pomsel- Schacht abgeteuft wurde, durch den in den 1840er Jahren die Hauptförderung erfolgte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gelb: Sohle des oberen (hier nicht vorhanden); blau: Sohle des mittleren und rot: Sohle des Johann Georgen Stollns.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts begann eine Blütezeit für den Steinkohlenbergbau Sachsens, auch in den kleineren Becken wie im Flöhaer. Sachsens Bergbau, Hüttenwesen und vorallem die Industrie blühten mit Einführung der Dampfmaschine mächtig auf, die Beschaffung von Brennstoffen konnte kaum Schritt halten, so daß das 1. Landesdirektorium 1832 zur Ermunterung der Privat- Initiative Prämien auf das Auffinden von Kohlenfeldern aussetzte. Der Kohlenpreis stieg lokal oft über die Maßen, solange Eisenbahnen zur Heranführung fremder Kohle noch nicht bestanden. Besonders der gewerbefleißige Chemnitzer Bezirk, dessen Textil- Industrie jetzt allenthalben zum Fabrikbetrieb überging, litt unter der Not an Brennmaterial. Die verhältnismäßig schlechte Schieferkohle des Hainichen- Ebersdorfer und des Flöhaer Beckens wurde mit bis 11 Groschen der Scheffel gehandelt, an der Grube mit 8 (alten) Groschen (= 100 Pfg.) bezahlt, so daß sich deren Abbau jetzt sehr wohl verlohnte. Überall in diesen Becken entstanden infolgedessen neue Kohlenbaue: Über die Bergämter erging zwischen 1820 und 1840 eine förmliche Flut von Gesuchen um Konzessionsbewilligung auf allerhand kleinen, oft ganz isolierten Kohlenvorkommen in ganz Sachsen. Auch im Flöhaer Becken mehrte sich die Zahl der kleinen Steinkohlenwerke in dieser Zeit außerordentlich. Waren bisher Schippan und Flöhaer Grundbesitzer (Richter und Anke) die einzigen Abbauenden gewesen, so suchten sich jetzt Unternehmer und Spekulanten, wie Kögel, Grumbach; Kieber und Fiedler aus Oederan, möglichst große Gebiete des noch freien Areals rechtzeitig durch Verträge mit den Grundbesitzern zu sichern. Andererseits fingen unternehmungslustige Grundbesitzer selbst an, auf ihren Grundstücken nach Kohlen einzuschlagen. Anmerkung der
Redaktion: Herr Fiedler aus Oederan hatte wohlmöglich noch ganz andere
Hintergedanken; betrieb er doch selbst ein Steinkohlenwerk in
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die in jener Gründerzeit herrschende Rücksichtslosigkeit sind die Prozesse über widerrechtliches Ausbauen von Kohle aus fremden unterirdischen Feldern bezeichnend. Im Flöhaer Becken hatte Schippan 1825 einen solchen Raubbau- Prozeß gegen Kieber zu führen, der im Abschnitt zum Lehngerichtswerk noch genauer behandelt ist; im Hainichener Becken führte Fiedler 1835 gegen einen Nachbarn im Bereich seiner Berthelsdorfer Gruben einen ähnlichen. Unter dem Einfluß dieser Hochkonjunktur entschloß sich auch Schippan, den tiefen Stollen seines Gückelsberger Werkes wieder fortzusetzen, da er nach Abbau der oberen Flöze die Lösung der Wasser in den Tiefbauen unbedingt brauchte, denn die Wasserhaltung durch Kunstrad und Pumpen war kostspielig. Um das Jahr 1830 war daher die Arbeit am tiefen Stollen flott im Gange. Naumann berichtet davon in seinen 1834 erschienenen Erläuterungen zu Sektion XV der geognostischen Karte des Kgr. Sachsen, daß man in letzter Zeit häufig Fragmente von Urgestein, wie Gneis, Quarz, Ton- und Glimmerschiefer, ja zum Teil förmliche Konglomerate davon mit porphyrischer Grundmasse beim Bau des tiefen Stollens gefunden habe, woraus sich schließen ließ, daß man mit dem Stollen, der bisher ganz in der Porphyrplatte verlaufen war, dem Liegenden dieser Platte nahegekommen sein müsse.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man kann sich bei der
Deutschen Fotothek hineinzoomen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die paläontologische Forschung erlangte der tiefe Gückelsberger Stolln ziemliche Bedeutung dadurch, daß beim Abteufen des Lichtschachtes im Porphyrtuff ein ausgezeichneter verkieselter Stamm von Tubicaulis primarius und mehrere Bruchstücke von Tubicaulis sclenites durch den Freiberger Ratsgeometer Schippan (den Sohn des Lehnrichters) gefunden wurden, die in Cotta's „Dendrolythen“ 1832 als einzige aufgefundene Vertreter dieser Spezies beschrieben sind. Da es aber noch Jahre dauern konnte, bis der tiefe Stollen durchschlägig war, wurde der Johann Georg Stolln, der im Grunde des Wetzelbachtales angesetzt war, bei zunehmender Ausdehnung des Abbaus nach Osten und Süden immer mit verlängert und die Wasser aus den tiefer gelegenen Örtern und Strecken durch Pumpen auf ihn gehoben. In den südlichen Abbauen zeigte sich teilweise die Kohle von hervorragender Güte, indem sie fast reiner Anthrazit war. Noch weiter südlich hat auch später Morgenstern den Anthrazit gefördert, dessen Analyse in Kapitel V enthalten ist. Im Jahre 1838 erschien im „Gewerbeblatt für Sachsen“ ein Aufsatz „Das Gückelsberger Steinkohlenwerk bei Chemnitz“, der ein Beweis von dem inzwischen erfolgten, großen Aufschwung von Schippan‘s Werk ist. Dasselbe hatte jetzt fünf Schächte, bis 40 m tief. Es wurden drei Flöze von 14, 20 und 44 cm abgebaut. Augenblicklich arbeitete man daran, im tiefen Stollen eine Bohrkaue auszusetzen in der Hoffnung, unter dem Porphyr noch stärkere Flöze anzutreffen. Die geförderte Kohle, die sich oft dem Anthrazit näherte, brannte schwer, nur bei gutem Luftzug und mit kleiner Flamme, sollte jedoch lang anhaltende Glut geben und bei einem Preise von 11 Groschen pro Scheffel gegenüber Fichtenholz, die Klafter zu 6 ½ Taler, immer noch die Hälfte Geld ersparen lassen. Das Werk war mit 12 Bergleuten und dem Steiger belegt, die wöchentlich 250 Scheffel förderten (also jährlich 13.000 Scheffel). Das Vierfache könnte gefördert werden, heißt es in dem Aufsatze, wenn der Absatz vorhanden wäre, der durch die große Zahl der inzwischen im Flöhaer und Hainichen- Ebersdorfer Becken entstandenen Gruben eingeengt würde. Wegen der schweren Verbrennbarkeit der Gückelsberger Kohle brauchte man eine engere Konstruktion des Feuerraums der Öfen und etwas Übung beim Anfeuern. So zogen die Chemnitzer ihr immer noch Holz und Zwickauer Kohle für den Stubenbrand vor. Der Aufsatz im Gewerbeblatt enthält deshalb Belehrungen, wie man Gückelsberger Kohle vor dem Gebrauch in kleine haselnußgroße Stücke zerkleinern und den Feuerraum des Ofens umbauen müsse, um einen tadellosen Brand gleich festem Buchenholz zu erzielen. Man solle bei einer Rostgröße von 6 Quadratzoll mit 6 Stäben und ¼ Zoll Rostöffnung sollte man eine halbe Metze zerkleinerter Kohle aufschütten, einen 3 Zoll hohen schrägen Rand von Lehm um den Rost bauen und den Raum zwischen Rost und Ofenplatte 7 Zoll hoch wählen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Steiger Schramm des Werkes brauchte für den Koch- und Heizofen seiner großen Stube aller 8 Tage 1 ½ Scheffel, erzielte dabei eine größere Hitze, als mit gewöhnlichen Steinkohlen und brauchte den Ofen bloß aller drei Monate von Ruß zu reinigen, da kaum Rauch entstand. Dann wird in dem Aufsatze noch ein Maurer aus Schönerstadt empfohlen, der sich aufs Umbauen der Öfen für Gückelsberger Anthrazitkohle verstehe und in letzter Zeit viele Öfen der Gegend zur Kohlenfeuerung eingerichtet habe. Die Gückelsberger Kohle sei nicht zu verwechseln mit der Flöhaer, welch letztere sich bloß zum Kalkbrennen eigne. Sie ergeben kaum Rauch, enthalte keinen Schwefel und würde sich zur Heizung von Lokomotiven und im Hochofenprozeß als natürlicher Koks eignen. Dieser Aufsatz in dem vielgelesenen Gewerbeblatte dürfte von Schippan nahestehender Seite lanciert worden sein, einmal, um den Absatz bei der Konkurrenz der damals zahlreichen Schieferkohlenwerke im Flöhaer und Hainichen- Ebersdorfer Becken zu heben, und dann, um das Interesse der Öffentlichkeit auf das Werk wegen eines eventuellen Verkaufes zu lenken; denn der geschäftstüchtige Schippan wurde alt, wußte auch wohl, daß er die besten Kohlen seines Akkordfeldes schon annähernd abgebaut hatte und sah voraus, daß der Preis der Kohle in absehbarer Zeit sinken würde, wenn durch den damals einsetzenden Bau von Eisenbahnen der Wettbewerb der Zwickauer und Dresdner Kohle sich in der Chemnitzer Gegend fühlbar machen würde. Im nächsten Jahre, 1839, findet sich ein zweiter Artikel in dem genannten Gewerbeblatt, in dem auch eine Analyse des Gückelsberger Anthrazits von Dr. Stöckhardt enthalten ist, wonach aus 100 Gramm erhalten wurde (genaue Einzelheiten finden sich in Kapitel V):
Die Anthrazitkohle enthielt demnach 87% Kohlenstoff, 5% flüchtige Substanzen, 8% Asche, war also ein sehr hochwertiges Brennmaterial.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In dem Aufsatz wird dann auf die neuesten Entdeckungen in der Verwertungsmöglichkeit des Anthrazits für den Hochofenprozeß in England und im Elsaß hingewiesen und wörtlich hinzugefügt: „Nun liegt in unserem Sachsen an den Ufern der Zschopau in den Bassins von Ebersdorf, Hainichen, Flöha und Gückelsber eine mehr oder minder vollkommen ausgebildete Anthrazit-Glanzkohle, die wegen ungeeigneter Feuerungsanlagen eine sehr unvollkommene Verwendung findet und auf deren Förderung man keine entschiedenen Aufmerksamkeit wendet. Wollte die königliche Bergbehörde, in deren Ressort es schlägt, die unterirdischen Schätze so viel als möglich zur Anschauung und Würdigung bringen, damit die Industrie weiß, wohin sie ihre Blicke wenden soll, wenn alte Industriezweige verdorren und sich der Sache annehmen, so sind wir gewiß, daß durch ihre ruhige, prüfende Untersuchung sich herausstellen würde, daß es nicht zu den Unmöglichkeiten gehört, eine Eisenproduktion im Zschopautale und in Chemnitz hervorzurufen, in deren Nähe sich ebenfalls Eisenstein vorfindet, wie z. B. in Hermersdorf, Weißbach etc. Da der Anthrazit sich, weil er schwer brennt und hohe Temperatur verlangt, zu vielen häuslichen Zwecken nicht eignet, so ist er umso mehr qualifiziert bei der Eisenerzeugung eine Rolle zu spielen, der in der Tat ein Impuls nötig tut; denn die Wälder werden licht und die Zwickauer Eisenwerke sind noch in weiter Ferne.“ Man hoffte, daß Schippan zunächst ein Depot zerkleinerter Kohlen nach Chemnitz legen würde. Zu der Stöckhardt’schen Analyse wird dann in einer Fußnote des Aufsatzes die skeptische Ansicht eines hervorragenden Hüttenmannes mitgeteilt, daß sich einzelne Stücke der Gückelsberger Kohle zwar wie die Analyse verhalten mögen, daß sie im Ganzen aber unbrauchbar zu den angeführten Zwecken sei, infolge ihrer starken erdigen Beimischungen und aus Gründen der geringen und kostspieligen Förderung. Trotzdem erreichte Schippan, daß sich die Fachpresse mit dem Gückelsberger Anthrazit beschäftigte. In den „Mitteilungen des Industrievereins für das Kgr. Sachsen“ von 1839 findet sich wiederholt ein Eingehen auf seine Eigenschaften, ebenso in Freiesleben‘s „Magazin für Oryktographie“ (Band 2 von 1845).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem er die Öffentlichkeit so vorbereitet hatte, besonders mit dem geschickten Hinweis auf die Möglichkeit einer Eisenverhüttung in Chemnitz, bot dann im Jahre 1840 der jetzt 80 Jahre alte Schippan (Das Flöhaer Lehngericht hatte er schon 1828 an Moritz Schippan übergeben,.um sich nur noch seinen Kohlenunternehmungen und Spekulationen zu widmen. 1836 hatte er Versuche bei Gablenz, 1840 noch bei Altenhain und Ebersdorf anstellen lassen.) sein Gückelsberger Werk im Gewerbeblatt zum Verkaufe aus. Die Anzeige lautet wörtlich (Gew. Bl. 1840, S. 119): Verkauf eines
Steinkohlenwerkes und Sämtliche Steinkohlenreviere zu Gückelsberg, die mir am 17. Juni 1802 von den Reichsgräflichen Gerichten zu Lichtenwalde gegen einen Tonnenzins von 9, respektive 1 Gr. 6 Pfg. eigentümlich überlassen wurden, bin ich gesonnen zu verkaufen. Sie umfassen 4 Scheffel Steinkohlenfeld, von welchen ein genauer, durch einen verpflichteten Geometer aufgenommener Plan bei Unterzeichnetem einzusehen ist. Dieses große Steinkohlenfeld hat einen flachen Stollen von 1.094 Ellen Länge und einen tiefen von 820 Ellen Länge. Ersterer ist beim Förderschacht 98, letzterer 115 Ellen tief bis auf die Stollensohle. Die Wasser sind auf lange Jahre gelöst. Die ersten 4 bis 5 Flöze Kohlen geben in einer Quadratlachter oder 3 ½ Elle 18 Tonnen oder 36 Scheffel Kohlen. Wie groß nun die Tonnenzahl im ganzen Kohlenfelde, oder nur in den oberen Flözen sein muß, ist zu ermessen. Die Stärke der niederen Flöze kennt man noch nicht, weil sie mit dem Stollen noch nicht angefahren sind. Ungefähr 8.000 Scheffel Steinkohle sind jährlich gefördert worden, die meistenteils beim Kalkbrennen, Malzdörren, zum Heizen in dazu eingerichteten Öfen, auch zum Kochen und Trocknen verwendet werden. Diese Kohle brennt zu weißer Asche und hält bei weitem länger im Brennen aus, als jede andere. Der Absatz mehrt sich von Jahr zu Jahr infolge des wachsenden Holzmangels. Auch bin ich gesonnen, meine zwei Eisenerzgruben, die hier ganz in der Nähe sind, mit zu überlassen. Die eine hat reinen Eisenstein über einen Lachter stark, die andere ist rücksichtlich der Mächtigkeit nicht viel geringer. Flöha bei Chemnitz, im März 1840. Johann George Schippan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hiernach war der Johann Georgen- Stolln 1840 also zirka 625 m lang, der tiefe Stollen erst 469 m. Im Übrigen erscheint das Angebot etwas günstig gefaßt zu sein, denn die Wasser waren noch nicht für immer vollkommen gelöst, da der tiefe Stollen noch keine Verbindung mit den Flözen hatte; auch ist völlig verschwiegen, wieviel des Kohlenfelds in den letzten 40 Jahren schon abgebaut worden war, und um die bereits abgebaute Kohlenmenge kleiner erscheinen zu lassen, ist die Jahresförderung nur mit 8.000 Scheffel angenommen; sie hatte aber nach den früheren Quellen oft 13.000 Scheffel betragen. Es ist denn auch zu keinem Verkaufe gekommen, vielmehr lesen wir aus den Akten, daß man sich 1844 mit dem Gedanken der Vergewerkschaftung der Grube trug. Zu diesem Zwecke fertigte der Sohn des bekannten Markscheiders Franke im Auftrage des Besitzers der Gückelsberger Steinkohlenbaue, Herrn J. G. Schippan zu Flöha, ein Gutachten mit Ertragsberechnung an, daß auf einem vom Ingenieur H. A. Schippan 1835 entworfenen Risse des Werkes fußt. Das gesamte Akkordkohlenfeld wird darin, wie in der obigen Verkaufsanzeige, zu 400 Scheffeln Kornaussaat von je 150 Quadratruthen angenommen, begrenzt im Norden und Nordosten von Flöhaer, im Südosten von Falkenauer Flur. Die zwei oberen der vier Flöze hatten 0,15 m bis 0,30 m Stärke, das erste der unteren zwei Flöze 0,38 m bis 0,42 m und das unterste 0,22 m bis 0,24 m Mächtigkeit. Die Flöze waren gewöhnlich nur durch ein bis 0,57 m starkes Zwischenmittel getrennt und konnten gemeinsam abgebaut werden. Stellenweise hatten beide Doppelflöze, nur von einer dünnen Lettenschicht getrennt, eine Gesamtmächtigkeit von über 0,65 m, so auf den Rücken beim Pomsel- Schacht. In der Nähe des Kunstschachtes wuchs die Mächtigkeit auf über 1,15 m. Die fünf vorhandenen Förderschächte waren der Tippmann- Schacht, der Kunstschacht, der Pomsel- Schacht, das erste und zweite Lichtloch des tiefen Stollens und der Gerichtsschacht (140 m südöstlich des Pomsel- Schachtes). In dem Gutachten wird nochmals die über 40 Jahre alte Geschichte des Werkes kurz aufgerollt: Vom Ausstrich der Kohle am Wetzelbach war man in einem Stollen mit Tagesschacht niedergegangen, hatte später als ersten Hauptschacht den Kunstschacht auf dem Fallen des Flözes abgesunken und von ihm aus Strecken gegen Ost und West nach dem Streichen der Flöze getrieben. Gleichzeitig wurde etwa 260 m bachabwärts der flache Stollen zur Entwässerung immer mit ins Feld getrieben, der beim Pomsel- Schacht eine saigere Tiefe von über 41 m einbrachte und von da zur Untersuchung der Flöze noch über 115 m verlängert worden war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Kunstschacht war jetzt 70 m tief, stand aber die letzten 30 m unterhalb der flachen Stollnsohle unter Wasser. Der Hauptförderschacht war schon seit mehreren Jahren der Pomsel- Schacht, bis zum flachen Johann Georgen Stolln 41 m tief. Abbaue im wahren Sinne des Wortes waren 1844 nicht in Betrieb. Es wurden nur nach dem Streichen des Flözes söhlige Örter 10 bis 12 m voneinander mit 2 ½ bis 3 m Weite betrieben (Strebbau) und zum besseren Wetterwechsel ab und zu ein Steigort nach einer oberen Strecke angelegt. Bei dieser Streckenweite gewann man so viel Raum, daß das gewonnene taube Gestein versetzt werden konnte und noch Raum zum Fördern blieb. Der Förderschacht stand auf einem Punkte, wo das Flöz gerade einen Rücken bildete, auf dem es 80 m nach Südwest und 54 m nach Ost untersucht war. Nach dem Fallen und Streichen der Flöze zu urteilen, bildeten diese Strecken den östlichen Umfang einer Mulde, deren beide lange Seiten nördlich durch das Kunstschachtfeld, südlich durch den genannten Rücken bezeichnet waren. Von der Sohle des Johann Georgen Stollns beim Pomsel- Schacht ging ein Fallort in 30° Neigung 36 m tief hinunter zur untersten söhligen Strecke und vor zwei im Streichen des Flözes gehauene Örter. An diesen tiefsten Stellen bestand das Flöz aus zwei Schichten fast reinen Anthrazits, die obere 0,35 m bis 0,47 m, die untere 0,14 m bis 0,24 m stark, getrennt durch eine Letten- und Sandsteinschicht von 0,07 m bis 1,15 m. Nach der Tiefe zu schien es mächtiger zu werden. Dieses Pomselschachter Fallort ging noch 8 m unter die tiefste Streckensohle, stand aber da unter Wasser. Vom 2. Lichtschacht des tiefen Stollens, der zirka 420 m westlich des Pomsel- Schachtes lag und 63 m tief war, war bei 45 m Tiefe das hier getroffene Doppelflöz (nach Naumann erst bei 90 Ellen, also 51 m) mit mehreren Örtern untersucht worden, eins davon war gegen 100 m lang. Die beiden Teile des Flözes waren hier durch 0,12 m bis 0,45 m starke Zwischenmittel getrennt; die obere Schicht war 0,22 m bis 0,45 m stark, die untere 0,18 m. Die nachporphyrische Stufe des Gückelsberger Steinkohlengebirges, die nach dem 1. Lichtschacht fast 22 m dick war, hatte beim 2. Lichtloch schon derart abgenommen, daß alle Flöze innerhalb 2 m zusammen lagen (nach Naumann). Etwa 80 m² Feld war vom 2. Lichtschacht aus abgebaut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das tiefe Stollnort selbst war jetzt 520 m lang, stand aber schon wieder einige Jahre unbelegt. 6 m vor dem Stollnorte war das im Gewerbeblatt von 1838 genannte Bohrloch 18 m tief niedergestoßen worden, hatte aber keine neuen Flöze erschlossen, da es immer noch in der Porphyrplatte stand. Von der früheren Gückelsberger Mühle, jetzt längst zur Heymann’schen Spinnerei umgewandelt, ging der Stollen bis zum 2. Lichtloch hor 3 ¾ gradeaus, dann bog er etwas gegen Osten ab. Am genannten Schachte hatte er fast 63 m saigere Tiefe, wenn er bis zum Pomsel- Schacht, dem gegenwärtigen Hauptförderschacht fortgesetzt würde, brächte er sogar 71 m Teufe ein. Er lag noch immer 17 ½ m tiefer als der tiefste Abbau. Es folgen Einzelheiten über die Technik der Gewinnung. Sie erfolgte mit Keilhaue, Schrämmspieß und eisernen Treibekeilen. Schacht- und Streckenzimmerung war, wie überall im Flöhaer Becken, nicht kostspielig, da dem Druck des gutstehenden Sandsteines mit 0,10 m bis 0,14 m starken Türstöcken, etwa 1,75 m auseinander, hinlänglich begegnet wurde. Der First war mit dünnen Schwarten verkleidet. Die Schächte brauchten überhaupt nur so viel Zimmerung, als zum Befestigen der Fahrten nötig war. Die Förderung geschah auf den söhligen Strecken mittels Karren (eine Ausnahme im Flöhaer Becken, wo meist Schleppkübel verwendet wurden), auf dem Fallorte durch kleine, zwei Kübel fassende Tonnen, die auf Straßbäumen fortbewegt wurden. Die Schachtförderung erfolgte mittels Kübel und Seil durch gewöhnliche Ziehschächte. Die Wasserhaltung war, als man noch im nördlichen Grubenfelde abbaute, durch das oft genannte Kunstgezeug geschehen, daß die Wasser auf den Johann Georgen Stolln hob. Gegenwärtig (1844) hatte man, da man mehr im südlichen und östlichen Feldteile baute, nur noch in dem genannten Fallort beim Pomsel- Schacht Grundwasser zu halten, wofür aber täglich 2 bis 4 Stunden Pumparbeit genügte. Durch eine Saugpumpe mit vierzölligem Durchmesser wurde das Wasser 14 m unter einem Winkel von 20° bis auf eine höher gelegene Stelle gehoben, von wo aus aber noch eine Hebung von 4 m nötig war bis zum Johann Georgen Stollen. Dies geschah durch eine gewöhnliche Drückelpumpe. Die zwar unbedeutende Wasserhaltung konnte erst ganz überflüssig werden, wenn mit dem tiefen Stolln die Flöze angefahren waren. Alle Arbeiten, wie Gewinnung der Kohle, Streckenzimmerung, Schacht- und Streckenförderung waren verdungen und zwar mußte jeder Hauer für den Gedingpreis pro Tonne gewonnener Kohle noch seine Strecke in Zimmerung unterhalten, die Grundwasser bewältigen, die Kohle bis zutage fördern (40 m bis 55 m Streckenförderung, 40 m Schachtförderung) und sie dort nötigenfalls noch ausscheiden. Dafür bekam er pro Tonne Kohle (= 2 Scheffel) je nach Lage seines Abbauortes 4, 4 ½ oder 5 alte Groschen = 63 Pfg. Er mußte zwölfstündige Schichten verfahren, um es auf einen Wochenlohn von 2 bis 2 ½ Taler zu bringen (Im Plauenschen Grunde herrschte seit 1845 erstmalig die 8-Stunden-Schicht (ohne An- und Ausfahren) auf den fiskalischen Werken.) Die jährliche Fördermenge war 1844 10.000 bis 12.000 Scheffel. Die Aufsicht im Werke führte ein Steiger, der auch die geförderten Kohlen vermessen, die vorhandenen Strecken befahren und faul gewordene oder zusammengebrochene Zimmerung wieder herstellen mußte. Außerdem leitete er den Verkauf der Kohle an die Abnehmer. Er hatte dafür freie Wohnung auf dem Huthaus, den Genuß der Holzabfälle und 14-tägig 5 Taler Gehalt. Zur Ertrags- und Wertberechnung des Gückelsberger Werkes wird von Franke aufgrund des Risses von 1835 der Raum, über den sich die Kohlenflöze auf dem Akkordfelde erstreckten, auf 300 Scheffel Kornaussaat angenommen, für die Berechnung jedoch vorsichtigerweise nur 265,713 Scheffel zugrundegelegt, da die Flöze nach den Rändern zu an Mächtigkeit abnahmen. (Diese Fläche soll auf dem leider nicht mehr auffindbaren Riß nach Franke mit blauer Linie umrandet sein.) Der Scheffel Kornaussaat zu 150 m² gerechnet, ergab das somit einen abbauwürdigen Gesamtflächenraum von 39.856,95 Quadratruthen oder, die Ruthe zu 7 Ellen 14 Zoll, von 1.320.221.611,8 Quadratzoll (etwa 72 Hektar). Die Mindeststärke der Flöze mit 15 Zoll = 35 cm angenommen, würde sich daraus ein Rauminhalt der Kohle von 19.803.324.177 Kubikzoll oder 2.437.632,22 Scheffeln zu je 8.124 Kubikzoll oder 1.218.816,111 Tonnen ergeben. Als abgebaut wurden (trotz des 44jährigen Betriebes) nur 450 Quadratruthen (etwa 0,8235 Hektar) angegeben, gleich etwa 60.000 Scheffel Kohle, so daß noch 1.188.816,111 Tonnen angestanden hätten. Zum durchschnittlichen Verkaufspreis von damals 16,3 Neugroschen pro Tonne wäre ein Wert von 645.923 Talern, 10 Ngr. 8 Pfg. entstanden. Als davon abzuziehende Gewinnungskosten wurden gerechnet:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinzugefügt wird, daß die Flözstärke mit 15 Zoll (0,35 m) sehr gering angeschlagen sei, da oft ein Flöz allein diese Mächtigkeit habe; daß ferner bei schwunghaftem Betriebe sich die Unkosten pro Tonne verringerten und daß die Eigenschaften der anthrazitischen Steinkohle immer mehr anerkannt würden, so daß eine Absatzsteigerung sehr wahrscheinlich wäre. Schon jetzt erstrecke sich der Absatz des Anthrazits bis in die Nähe Zwickaus, da er anhaltendere Glühhitze erzeuge als langflammige Zwickauer Kohle. Wir hören hier das erste Mal, daß der Absatz von Kohle aus dem Flöhaer Becken über die nähere Umgebung des Produktionsgebiets hinaus sich erstreckte; die gewöhnliche Flöhaer Schiefer- und Kalkkohle vertrug nicht die Transportkosten über den Kreis der umliegenden Städte Chemnitz, Frankenberg, Oederan und Zschopau hinaus. Für die Fortentwicklung des Werkes waren nach Franke folgende Pläne ins Auge gefaßt: A.) den tiefen Stollen endlich zum Ziele zu bringen. Nach weiteren 8 m bis 10 m müßten die Flöze, nach ihrem Fallen in 20 m höherer Lage gerechnet, erschlossen werden. Das war ein Trugschluß, denn dabei trug man dem Umstand nicht Rechnung, daß der tiefe Stollen bisher ganz in Porphyr verlief und daß nach der geologischen Feststellung der Schichtenfolge der Flöze der oberen Karbonstufe den Porphyr nicht durchsetzten. Aus demselben Grunde war auch der nächste Entwurf hinfällig, nämlich B.) den tiefen Stollen als Abbaustrecke nach dem Fallorte zu verlängern, von da einen Querschlag zum Pomsel- Schacht zur bequemeren Förderung anzulegen oder auch ein Steigort nach der oberen Strecke, um einen kürzeren Förderweg als bis zum 2. Lichtschacht zu haben. Der Pomsel- Schacht wäre in diesem Falle noch 14 m abzuteufen. C.) Am rentabelsten wurde folgender Plan angesehen: In der Mitte zwischen Wetzelbach und der Linie Pomsel- Sschacht – 2. Lichtloch bildeten die Flöze eine von Ost nach West verlaufende Mulde. Darin sollten, nach den anstehenden Kohlen im Kunst-, wie auch im Tippmann- Schachte zu urteilen, die Flöze 2 Ellen (1,17 m) stark werden und an Reinheit zunehmen. Wenn man den tiefen Stollen nach dieser Mulde triebe, würde man 19 m saigere Teufe darunter erreichen und alle Wasser abzapfen zum ungehinderten Abbau dieser reichen Lager, außerdem die jetzt aufgegebenen tiefen Abbaue im Kunst- und im Tippmann- Schacht vom Wasser befreien. D.) Zur Verkürzung der Förderstrecke und Verbesserung der Wetter wäre dann inmitten obiger Mulde auf Wächtler‘s oder Fischer‘s Grundstück ein Hauptförderschacht abzusinken, der auch den Vorteil hätte, daß die Förderstrecken zu ihm hin fallend würden. Die Kosten des unter A. und B. genannten Planes würden durch die gleichzeitig gewonnene Kohle gedeckt (war nach dem oben Gesagten ein Irrtum). Für den unter C. genannten Betrieb des tiefen Stollens nach der Mulde, sowie das unter D. genannte Niederbringen des neuen Schachtes wären die Kosten mit 1 Tlr. pro Elle Schacht abzuteufen, auszuzimmern und zu fördern als genügend anzusehen, für das Lachter Stollenort inkl. Förderung dagegen 6 Tlr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Freiberger Berggeschworene Kind, der zur amtlichen Prüfung dieses Gutachtens eine Befahrung des Werkes vornahm, kam 1846 in seinem Bericht nach eingehender Beschreibung seiner Fahrt durch die Baue, die Franke's Angaben über die vorhandenen Anlagen bestätigten, zu folgenden Schlüssen: 1.) Die angenommene Durchschnittsmächtigkeit von 15 Zoll (35 cm) ist gering, es hätten gut 20 Zoll (47 cm) genommen werden können. 2.) Der Flächeninhalt des Flözes ist noch gut 10% größer, da er nicht eben, sondern wellenförmig verläuft. 3.) Da die anstehende Kohle sich zu gebrochener im Volumen wie 1 : 1,5 verhält (nach anderen Erfahrungen allerdings bloß 1 : 1,37), so beträgt das Volumen statt der angenommenen 1.188.816 Tonnen 1.783.224 Tonnen. 4.) Gewinn-, Förder- und Wasserhaltungskosten bis zur Verladung betragen tatsächlich 69 Pfg. je Tonne; auch die angesetzten Summen für Stahl, Eisen und Holz seien ausreichend; auch für Steigerlohn schließlich, obgleich dieser mäßig sei. 5.) Betr. Anfahren der Flöze durch den tiefen Stollen in höchstens 10 m war Kind (mit Recht) anderer Meinung. Die in Franke‘s Gutachten angeführten Gründe genügten ihm nicht für diese Behauptung. Er schlug vor, ehe man den tiefen Stollen fortsetze, erst Streichen und Fallen der Flöze auf den Fallörtern vom Pomsel- Schacht weiter zu verfolgen. 6.) Wenn nach erfolgter Klärung der tiefe Stollen glücklich das Flöz an der tiefsten Stelle erreicht habe, fiele in der Tat alle Wasserhaltung weg (jetzt täglich 2 Mann 3 Stunden lang an den Pumpen) und die Kosten der Förderung würden bedeutend vermindert. 7.) Wenn wirklich bei stärkerem Absatze die Förderung auf den jetzigen Schächten nicht genügte, könnten weitere in der Mulde des Kohlenfeldes abgeteuft werden. Da diese keine größere Tiefe als 40 bis 60 m brauchten, das Gestein gut haltbar und doch nicht hart sei, deshalb wenig Zimmerung erfordere, so sei das Schachtabteufen bei 5 bis höchstens 6 Taler Kosten pro Lachter billiger als weite Streckenförderung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diesen recht günstigen Befund des Berggeschworenen über das Gückelsberger Werk schwächte ein Zusatzschreiben des Bergamtes einigermaßen ab, welches besagte, beim Bergamte herrsche die Überzeugung, daß das Gückelsberger Werk zur Vergewerkschaflichung in Form einer Aktiengesellschaft nur in Frage kommen könne, wenn der Absatz der Gückelsberger Kohle namhaft gesteigert werden könne, da der im Gutachten errechnete Ertrag bei angegebenem jetzigen Debit erst in einem Zeitraum von 237 Jahren zu erzielen sei, vorausgesetzt, daß das Areal, unter dem Steinkohlen sich befinden sollten, sowie die übrigen der Ertragsberechnung zugrunde gelegten Daten richtig angenommen wären; (und das war z. B. betr. der Größe des bereits abgebauten Feldes nicht der Fall). Zur Herbeiführung einer Absatzsteigerung sei aber zu berücksichtigen, daß der bevorstehende Bau einer Eisenbahn von Zwickau nach Chemnitz die Konkurrenz vermehren und den hohen Preis für die Kohle in der Chemnitzer Gegend herabdrücken werde. Die Mitbenützung des Kind’schen Gutachtens bei Gründung einer Aktiengesellschaft wurde infolgedessen vom Bergamte nur gestattet unter der ausdrücklichen Bedingung, daß auch das Zusatzschreiben des Amtes mit vorgelegt würde, andernfalls erfolge Veröffentlichung desselben durch das Bergamt. Durch diese mit Recht sehr skeptische Haltung des Bergamts wurde das geschickt frisierte Gutachten Franke‘s, der das wirklich abbauwürdige Areal zu groß und die bereits abgebaute Fläche zu klein angenommen hatte, für die in Aussicht genommene Gründung einer Aktiengesellschaft ziemlich entwertet; die Gründung unterblieb dann auch und wir hören nichts wieder von einer Vergewerkschaftlichung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schippan starb im Anfang des Jahres 1846. Er war der Pionier des geregelten Steinkohlenabbaues im Flöhaer Becken gewesen. In einem Gesuch von 1836 in Angelegenheit seiner damaligen Pläne, auch bei Gablenz und Ebersdorf Steinkohlengruben zu gründen, bezeichnet er sich auch als den eigentlichen Veranlasser des von Vitzthum’schen Steinkohlenwerks Lichtenwalde- Ebersdorf. Sein Gückelsberger Werk ist das bedeutendste des gesamten Flöhaer Beckens gewesen, sowohl hinsichtlich seiner Ausdehnung, als seiner Förderung, Arbeiterzahl und technischen Anlagen. Die Förderung hat von den 1820er Jahren bis 1845 sehr oft über 12.000 Scheffel, mindestens aber 10.000 Scheffel jährlich betragen. Noch für 1845 wird sie in der ersten statistischen Aufnahme, die über die sächsischen Kohlengruben überhaupt gemacht worden ist und die sich in den Freiberger Bergamtsakten 4081/IV befindet (Sie fand 1846/1847 auf Anordnung des Finanzministeriums in Form einer Generalrevision der sächsischen Stein- und Braunkohlenwerke durch den Freiherrn von Herder statt, veranlaßt durch die Zunahme der Unglücksfälle in den Kohlengruben.), mit 12.000 Scheffeln angegeben, obwohl sie in diesen letzten Jahren Schippan's infolge Absatzschwierigkeiten schon zurückgegangen war. Anmerkung der Redaktion: Der oben schon erwähnte A. G. Fiedler aus Oederan produzierte in seinem Berthelsdorfer Kohlenwerk (auch ein Randbecken der großen Kohlenreviere) im gleichen Zeitraum zwischen 25.000 und 35.000 Scheffel Kohle jährlich. Im Vergleich dazu erweist sich selbst das Schippan'sche Werk – als eines der größten im Flöhaer Kohlenfeld – immer noch also als ein mengenmäßig eher unbedeutenderer Produzent.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Preis der Gückelsberger Kohle war wegen ihrer besseren Qualität stets etwas höher als der Kalkkohlenpreis im Flöhaer Becken (genauere Zahlen sind in Kapitel V angegeben). Die Arbeiterzahl war 1846: 19 Mann, 1 Steiger. 1845 bekam endlich der tiefe Stollen Verbindung mit den tiefsten Abbauen und Strecken, so daß der Betrieb sich um vieles gebessert hatte. Die Wasserpumpen und das Radkunstgezeug waren nunmehr überflüssig und wurden abgeworfen. In der genannten Statistik von 1845 lesen wir als Bemerkung zum Gückelsberger Werk: „Nachdem durch die tiefe Stollnlösung dem Werke hinlänglich Wasserabzug und auch bessere Wetter verschafft worden sind, ist dessen Betrieb, obschon er in technischer Hinsicht manches zu wünschen übrig läßt, besser geworden. Der verführte Abbau ist leidlich.“ Das bedeutet im Munde des Bergbeamten, der vorher die fiskalischen Musterwerke im Plauenschen Grund besichtigt hatte, ein relatives Lob, denn den Betrieb der übrigen Werke im Flöhaer Becken nennt er nur „mangelhaft“ und „ärmlich“. Der tiefe Stollen war Schippan‘s Lebenswerk. Von 1800 bis 1846 hat er mit Unterbrechungen daran gearbeitet; seine Vollendung fällt mit seines Erbauers Tod zusammen, wo er eigentlich keinen allzu großen Nutzen mehr bringen konnte, denn die bauwürdigsten Lager auf Gückelsberger Flur waren schon abgebaut. In der bergmännischen Fachliteratur finden man den Gückelsberger tiefen Stolln verschiedentlich unter den großen Stollenbauten erwähnt, die der sächsische Bergbau geschaffen hat, bevor Dampfmaschinen zur Wasserhebung verwendet wurden. Er war zirka 530 m lang, ganz im Porphyr gehauen und brachte in der Gegend des Pomsel- Schachtes über 70 m saigere Teufe ein. Er lag noch 17 m tiefer (nach einer anderen Angabe des Bergmeisters Fischer von 1850 sogar 23 m) als der tiefste Abbau, was den Nachteil hatte, daß er mit dem Grubengebäude erst wieder durch einen Schacht in Verbindung gesetzt werden konnte. Nach Schippan‘s Tode schränkten dessen Erben den Betrieb des Gückelsberger Werkes ein, nachdem die Pläne einer Vergewerkschaftlichung aussichtslos geworden waren; schließlich kam das Werk vorübergehend ganz zum Erliegen, bis es im Jahre 1850 der Mühlenbesitzer Zießler in Hausdorf mit allen Gerechtsamen erwarb.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bergmeister Fischer und Berggeschworener Kind aus Freiberg, die im Jahre 1850 eine Revision der Gruben im Flöhaer Becken aufgrund des Kohlenmandats und ausdrücklicher Weisung des Finanzministeriums vornahmen, berichteten über das nunmehr Zießler’sche Werk, daß es sehr abwechselnd betrieben werde. Im Sommer 1850 hatte es ganz stillgestanden, in nächster Zeit sollte es aber mit 6 Mann wieder in Betrieb genommen werden. Man hatte bisher nur einen 58 m tiefen Tagesschacht wieder fahrbar gemacht, wahrscheinlich den Pomsel- Schacht, denn die Wasserlösung sollte durch den tiefen Stolln erfolgen, der nach Fischer‘s schon oben erwähnter Angabe noch 23 m tiefer liegen sollte; bis dahin war aber der Schacht augenblicklich nicht fahrbar. In bergpolizeilicher Hinsicht fanden die Revisoren an dem Betriebe nur auszusetzen, daß Schachtdeckel und ordentliche Hängebank, ein Abstreicheisen und Ruhebühnen in den Fahrten fehlten. An manchen Sprossen der Fahrt mußte der Halt für den Fuß verbessert werden, dagegen waren Fahr- und Ziehschacht voneinander getrennt, was bei anderen Werken im Flöhaer Becken vorschriftswidrig nicht der Fall war. Die Grubenrisse des Werkes waren schon damals nicht mehr beim neuen Besitzer Zießler, sie sind bis heute leider nicht wieder auffindbar gewesen trotz eifriger Nachforschung im Rißarchiv des Bergamtes Freiberg und im Hauptstaatsarchiv Dresden. Unter Zießler‘s Leitung wollte das Gückelsberger Werk nicht wieder recht in Schwung kommen. Die Konkurrenz der Werke im Flöhaer und Hainichen- Ebersdorfer Becken war groß und der fortschreitende Ausbau des Eisenbahnnetzes brachte bessere Kohle aus Zwickau heran. Geinitz, der Zießler‘s Werk 1853 zwecks Ausbeute für seine „Flora“ besuchte, sagt, daß die Kohlenausbeute auf diesem Werk im Gegensatz zu seiner Vergangenheit jetzt nur noch gering sei.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Förderung betrug 1853 nur noch 1.655 Scheffel, wie aus den Akten zur Erhebung statistischer Nachrichten de anno 1853 von den Kohlenwerken der Zwickauer Kohlenwerks-Inspektion hervorgeht. (Seit 1851 unterstand der Kohlenbergbau in Sachsen dem Ministerium des Innern, welches 1853 zunächst zwei Inspektionsbezirke – Dresden und Zwickau – eingerichtet hatte.) Gangbar war bis 1854 nur der Pomsel- Schacht, auch er stand aber seit Anfang 1855 in Fristen; so gibt das Verzeichnis der Kohlenwerke des Zwickauer Inspektionsbezirkes Auskunft. Von 1855 bis 1859 ruhte der Abbau ganz, wahrscheinlich, weil vom Pomsel- Schacht aus alles erreichbare Feld abgebaut war; denn 1860 ließ Zießler durch den Steiger Carl August Schramm zwei Schächte neu aufgewältigen (einen „flachen“ von 16 ½ m flacher Tiefe und 35° Fallen südöstlich und einen saigeren südlich vom alten Kunstschacht). Da aber Schramm Weihnachten 1860 starb, ruhte der Betrieb, der nur zu einer Förderung von 800 Scheffeln geführt hatte, wieder, bis im Jahre 1862 Zießler seine Abbaurechte an den Stellmacher Gottlob Morgenstern aus Gückelsberg verpachtete, der das Abteufen der zwei neuen Schächte fortsetzte und einen Stollen dazu trieb. Morgenstern hatte schon früher, in den Jahren 1852 bis 1854 auf seinem Felde, das sich in einem schmalen Streifen am rechten, östlichen Rande des unteren Wetzelbaches hinzog, Abbau betrieben. Den ersten Schacht (nahe dem Felsitporphyr nach Geinitz) mußte er schon 1852 wegen Wasserandrangs wieder aufgeben. Den zweiten legte er deshalb in etwas größerer Höhe am Hange an. Das in beiden Schächten abgebaute Flöz war 0,5 m bis 0,6 m mächtig und enthielt die beste Kohle, die jemals im Flöhaer Becken gefunden worden ist, Anthrazit mit starken Pechkohlenschichten und geringer Verunreinigung. Ihr durchschnittlicher Aschegehalt war nach Stein‘s Untersuchung (siehe Kapitel V) nur 10% bis 12%, der Gehalt an Kohlenstoff über 82%, ein ausgewählt anthrazitisches Stück, das Professor Geinitz mit untersuchen ließ (als „Gückelsberger Anthrazit“ in Kapitel V angeführt), hatte sogar nur 4,135% Aschegehalt und 87,422% Kohlenstoff. Geinitz suchte die Ursache hierzu in der teilweise anderen Flora als sonst im Flöhaer Becken, die zur Entstehung der Kohle an dieser Stelle Veranlassung gab, nämlich in der Hauptsache Alethopheris lonchitides Sternb. und Alethopheris serlii Brongn. und ferner in dem Umstand, daß der Porphyrtuff von dieser Fundstelle weiter entfernt ist. Fast scheine es auch, als habe man es hier mit einem tieferen Flöze zu tun, als in den Werken auf Flöhaer Flur.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Fragebogen zur Erhebung statistischer Nachrichten, den Morgenstern 1854 ausfüllen mußte, geht hervor, daß sein zweiter Schacht 1/8 Meile von der Chemnitz-Dresdener Straße entfernt lag, daß die Förderung im Winter 1852/1853 aus dem ersten Schacht und 1853/1854 aus dem zweiten Schacht zusammen 4.300 Scheffel, also 8.600 Zentner betragen hatte, daß der zweite Schacht nur 18,4 m tief war (der erste noch geringer) und daß der gesamte Materialaufwand in beiden Schächten 250 Taler betragen hatte. Morgenstern hatte nur 2 Arbeiter beschäftigt, die tägliche Arbeitszeit betrug 10 Stunden; für die Schicht, die aber zu 12 Stunden gerechnet wurde, zahlte er 10 Neugroschen. Infolge der geringen Ausdehnung von Morgenstern‘s Feld lohnte sich eine Wasserhaltung durch Stollenbau nicht, so daß 1854 auch der zweite Schacht infolge Wasserandrangs wieder aufgegeben werden mußte. Da er dies vorausgesehen hatte, war Morgenstern schon 1853 um Erteilung der Konzession zum Abbau im Flöhaer Pfarrwald eingekommen. Als Kaution hatte er eine Hypothek auf sein unbelastetes, mindestens 2.000 Tlr. wertes Anwesen in Gückelsberg angeboten, da aber inzwischen schon diese Konzession an Hesse sen. aus Jägerhof, verliehen worden war (vergleiche Abschnitt zum Pfarrwald), wurde er abschlägig beschieden. Dadurch, daß im Jahre 1862 Zießler seine Abbaurechte auf dem Gückelsberger Akkordfelde pachtweise Morgenstern überließ, lohnte sich für diesen die Aufnahme seines Unternehmens in größerem Stil, besonders das Herantreiben eines Stollens vom Wetzelbachtale her. Er legte zwei neue Schächte an, einen auf seinem eigenen Grundstück, einige 100 Schritt südöstlich vom alten Schippan’schen Kunstschacht am östlichen Hange des Wetzelbachtales, und einen zweiten etwa 30 m südlich davon, auf einem anderen Gückelsberger Grundstück, das zum Akkordfelde gehörte. Beide hatten nur etwa 12 ½ m Tiefe. Das Flöz war 0,35 bis 0,40 m stark und führte dieselbe gute Kohle, die die früheren Morgenstern’schen Baue ausgezeichnet hatte. Dach und Sohle bestanden aus Sandstein, das Fallen der Schichten war 10° nach Südost. Morgenstern baute hier 1862 mit 5 Mann etwa 60 Scheffel wöchentlich ab. Die Arbeiter bekamen im Gedinge pro Scheffel 30 Pfg., dazu mußten 9 Pfg. an den Grundeigentümer und 16 Pfg. an Zießler für das Abbaurecht gezahlt werden. Die Rohgestehungskosten kamen also einschließlich des Materialverbrauchs von zirka 6 Pfg. pro Scheffel schon auf 61 Pfg. pro Scheffel, so daß Morgenstern bei einem Verkaufspreis von 75 Pfg. mit Verlust arbeitete, wie in Kapitel V nachgewiesen ist; denn die Förderungs-, Zimmerungs- und Wasserhaltungskosten waren nicht gering.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der schon erwähnte, neu gebaute kleine Stollen vom Grunde des Wetzelbachtales führte nach dem nördlichen der beiden Schächte und war 26 m lang; später wurde er auf 50 m verlängert. Da er am Ausgehenden des Flözes angesetzt war und dieses, wie erwähnt, nach Südost fiel, so mußte das Wasser aus den Abbauen immerhin noch einige Meter gehoben werden. Man baute zunächst bis 1863 die oberhalb der Stollnsohle liegenden Pfeiler ab und ließ, da die Wasserhaltung dann bei der ohnehin großen Belastung des Betriebes zu kostspielig wurde, die Schächte bis 1864 wieder liegen. Bei der Wiederaufnahme des Betriebs im November dieses Jahres teufte man den südlichen Schacht noch etwa 4 ½ m weiter unter das Kohlenflöz ab und richtete dieses durch einen zirka 11 m langen Querschlag nach Osten wieder aus. Die zum Glück nicht starken Wasser mußten aber nun im Schachte bis zutage gehoben werden, da die nach dem Entwässerungsstollen geführte Strecke mit den tiefen Bauen in Verbindung stand und das nur bis zu ihr gehobene Wasser deshalb wieder in die neuen Abbaue gelaufen wäre. Die Beschaffenheit der Kohle war hier sogar noch etwas besser, als in den früheren Örtern; man hatte 0,2 bis 0,25 m reine Pechkohle und Anthrazit im Flöz. Die Gewinn- und Förderkosten bis zum Schacht betrugen jetzt aber sogar 35 Pfg. und der Betrieb wäre wohl aus Mangel an Rentabilität bald wieder zum Erliegen gekommen, wenn nicht das Flöz in nordöstlicher Richtung sich so verbessert hätte, daß man 1866 zirka 0,45 m vollständig reine Kohle abbauen konnte. Nach Südosten allerdings nahm die Mächtigkeit des Flözes wieder ab, so daß, als das Feld in nordöstlicher Richtung abgebaut war, Morgenstern den Betrieb 1867 endgültig aufgab. (Die entsprechende Mitteilung Morgenstern's an den Kohlenwerksinspektor datiert vom 23.3.1867.) Die Förderung hatte betragen:
oder 25.794 Zollzentner (die Morgenstern’sche Anthrazit- und Pechkohle wog ausnahmsweise bloß 180 Pfund der Scheffel). Die Arbeiterzahl betrug 1862 fünf, später vier Arbeiter (3 Hauer, 1 Haspler) außer Morgenstern selbst. Der Verkaufspreis der Kohle konnte sich infolge ihrer Güte durchweg auf 75 Pfg. pro Scheffel halten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Jahren 1869 und 1870 hat dann Zießler selbst nochmals einen Versuch gemacht, den Abbau wieder aufzunehmen, wohl hauptsächlich, um seine Gerechtsame nicht zu verlieren; denn nach dem seinerzeit von Schippan geschlossenen Vertrage, in welchen Zießler als Rechtsnachfolger eingetreten war, erlosch das Abbaurecht, wenn der Betrieb zwei Jahre still lag. In den Jahresberichten der Handelskammer Chemnitz und im Jahrbuch für das berg- und Hüttenwesen für das Kgr. Sachsen ist zu finden, daß Zießler auf dem Gückelsberger Werk 1869 mit 3 Arbeitern 833 Scheffel im Werte von 194 Talern und 1870 1.277 Scheffel im Wert von 298 Talern förderte. 1870 ist dann der Abbau auf Gückelsberger Flur endgültig eingegangen. Nach mündlicher Mitteilung des Herrn Gemeindevorstandes a. D. Ranft, Gückelsberg, haben die Gückelsberger Grundbesitzer in den 1870er Jahren mit dem Mühlenbesitzer Zießler, Hausdorf, einen längeren Prozeß über Löschung der auf ihre Grundstücke eingetragenen Abbaurechte auf Steinkohlen geführt, der zu ihren Gunsten entschieden ward, da einmal in dem oben angeführten Vertrage vereinbart war, daß die Abbaurechte verfielen, wenn zwei Jahre lang kein Abbau stattgefunden hatte, und da auch nach dem Kohlenmandat von 1822 dieselben Folgen eintraten, wenn der Abbau auch nur ein Jahr lang völlig geruht hatte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)
Der Abbau
auf Flöhaer Flur
1.) Auf Ulbricht's und Lange's Feldern. (Pötzsch und Kögel) An vorübergehenden Versuchen auf Flöhaer Flur hatte es im 18. Jahrhundert nicht gefehlt, wie aus Kapitel III hervorgeht. Der Licht- Erbstolln 1741 zeugt davon. Besonders um die Wende des 18. Jahrhunderts hatte fast jeder Flöhaer Grundbesitzer, der Felder nördlich der Chemnitz – Dresdner Straße besaß, versuchsweise auf seinen Grundstücken eingeschlagen und die Kohle da, wo sie leicht zu gewinnen war, abgebaut, um den Bau wieder liegen zu lassen, sobald sich Schwierigkeiten einstellten (Wasser). Namentlich der Lehnrichter Schippan hatte, bevor er 1800 die Abbaurechte auf Gückelsberger Flur erwarb, nacheinander drei Schächte auf seinen Flöhaer Feldern abteufen lassen. Die gefundenen Flöze hatten ihm aber nicht genügt, denn auf Gückelsberger Flur war deren Mächtigkeit fast die doppelte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der erste Unternehmer, der auf Flöhaer Flur nach 1800 über Versuchsbauten hinaus zum stetigen Abbau von Steinkohlen schritt, war der Steiger Johann Gottfried Pötzsch (auch Petzsch), Häusler in Oberwiesa, nicht der Kaufmann Fiedler aus Oederan, wie Köttig in seinen geschichtlichen Notizen angibt. Genannter Pötzsch war von 1807 bis 1812 Steiger auf Schippan‘s Gückelsberger Werk gewesen; im Jahre 1812 schloß er einen Vertrag mit dem Gutsbesitzer Ulbricht aus Flöha zum Abbau der Steinkohlen auf dessen, in und westlich der vorderen Ulbrichtschlucht liegenden Feldern; ebenso mit dem Bauern Lange aus Flöha. Das Lange’sche Feld zog sich in einem schmalen Streifen in die Sohle der genannten Schlucht hinab; Ulbricht‘s Grundstücke lagen in der Hauptsache am westlichen Hange und auf der Höhe der hinteren Ulbrichtschlucht. Als im Jahre 1813 die französischen Truppen die Zschopau- und Flöha- Übergänge gegen die Österreicher zu verteidigen suchten (Gefecht bei Flöha), hatten sie Pötzsch’ens Baue mit den dazugehörigen Holzschuppen samt Arbeitsgeräten zerstört, so daß Pötzsch dadurch einen großen Teil seines Vermögens einbüßte. Nach Beendigung der Napoleonischen Kriege verkaufte er deshalb sein Abbaurecht an die Grundbesitzer zurück, um auf den Feldern des Vizerichters Richter aus Flöha für diesen ein Steinkohlenwerk einzurichten (vgl. den nächsten Abschnitt).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ulbricht seinerseits verkaufte die Abbaurechte nun an den Großhändler Carl Adolph Kögel aus Altenberg, der im Jahre 1818 auch die offizielle Konzession vom Ministerium bekam, „auf dem dem Bauern Christian Friedrich Ulbricht in Flöha gehörigen Gelände des sogenannten halben und ganzen Hofes ein Steinkohlenbergwerk zu errichten“. In der Konzessionsurkunde wurde er ausdrücklich von dem Kanon, den er nach dem ersten Kohlenmandat von 1743 zu entrichten gehabt hätte, befreit. Man wollte damit das Unternehmertum ermutigen, in der weiteren Umgebung von Chemnitz Kohlen zu schürfen, denn die in jenen Jahren in unmittelbarer Nähe von Chemnitz von dem Chemnitzer Steinkohlengbau- Verein unternommenen Versuche bei Gablenz, Furth und Borna hatten zu keinem Ergebnis geführt und die aufblühende Industrie von Chemnitz und Umgebung brauchte dringend Brennmaterial, das nur ungenügend von den bisherigen Werken bei Lichtenwalde- Ebersdorf und Flöha- Gückelsberg geliefert werden konnte. Deshalb auch die anhaltenden Bemühungen des Fiskus in jener Zeit, brauchbare Kohle im Struthwalde zu finden (siehe nachfolgende Abschnitte), die seit 1816 begonnen hatten. Es war die schon in den vorangegangenen Kapiteln beschriebene Zeit, wo der sächsische Staat, durch den Wiener Vertrag in seiner räumlichen Gebietsausdehnung arg beschnitten, sich die größte Mühe gab, alle Hilfsmittel des Landes für die aufblühende Industrie zu erschließen. In dem bald folgenden, zweiten Kohlenmandat von 1822 fiel dann der für Steinkohlen- Konzessionen an den Staat zu entrichtende Kanon ganz weg. Nach der in den Oberbergamtsakten 10476, Vol. I, vorhandenen Vertragsabschrift erwarb Kögel gegen die Abfindung von 105 Talern und einen jährlichen Zins von 18 Talern von Ulbricht das Recht, auf dessen Grundstücken von der vorderen bis zur hinteren Ulbrichtschlucht Steinkohlen abzubauen, den bereits von Pötzsch angelegten Bau fortzusetzen und alle zum Betriebe eines Steinkohlenwerkes nötigen Anlagen einschließlich eines Huthauses auszuführen. Kögel hat dann sein Unternehmen in relativ großzügiger Weise ausgebaut und eine größere Zahl Arbeiter beschäftigt. Nach der Weygandt- Eydam’schen Tagebuch-Chronik sind im Jahre 1821 auf Kögel‘s Schächten zweimal Bergleute verunglückt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnitt aus dem Meilenblatt (Freiberger Exemplar, Blatt 193: Flöha, Grundaufnahme 1788, Nachträge bis 1876). Hier sind beiderseits der Ulbrichtschlucht „Kohlwerke“ eingetragen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kögel erwarb auch die Abbaurechte auf die an sein Gebiet anschließenden und teilweise hineinragenden Lange’schen Felder aus spekulativen Gründen und hat dann in den 1820er Jahren sein Werk dem Fiskus, der im Struthwalde keinen rechten Erfolg mit seinen Versuchen auf Steinkohle hatte, für 19.500 Taler zum Kaufe angeboten. Nach dieser für damalige Verhältnisse großen Summe zu urteilen, muß Kögel‘s Werk nicht unbedeutend gewesen sein, oder er verstand es, die noch abzubauenden Steinkohlenlager in übertrieben günstiges Licht zu setzen. Das Ministerium hielt die Angelegenheit für wichtig genug (es hatte damals die fiskalischen Werke im Plauenschen Grund bei Dresden angenommen), um Kögel‘s Angebot durch den Faktor Lindig von den fiskalischen Werken nachprüfen zu lassen. Dessen Bericht über die Besichtigung und Begehung des Kögel’schen Werkes enthält eine Ertrags- Berechnung und eine Nachhaltsberechnung. Er wurde dem Ministerium zusammen mit Kögel‘s Angebot nebst Beilagen und einem Riß von 1820 (durch Markscheider Franke gefertigt) vom Oberbergamte eingereicht. Trotz vielseitiger Nachforschungen ist es mir nicht gelungen, die betreffenden „K. und Ch. Gt.“ gezeichneten Akten aufzufinden. Nach einem Hinweis in den Oberbergamtsakten haben sie sich 1830 bei der Steinkohlen- Kommission befunden, von der aber nirgends Akten, auch nicht im Hauptstaatsarchiv zu finden sind. Diese Kommission war eigens zur Förderung des Steinkohlenbergbaus in Sachsen eingesetzt worden. Auf ihre Anregung sollte eine Karte angefertigt und darin alle bisher bekannten Daten über Abbau und Versuche auf Steinkohlen eingetragen werden, um eine Übersicht über die einzelnen in sächsischen Steinkohlenrevieren gemachten Versuche und Beobachtungen zu ermöglichen. Erst dann könnten größere gemeinnützige Versuche richtig geleitet, eventuell vom Fiskus übernommen werden, wie im Plauenschen Grund. In Zusammenhang mit dieser kartographischen Aufnahme und verschiedenen vorliegenden Verkaufsangeboten (darunter auch Kögel‘s) schlug das Bergamt Freiberg vor, statt der fiskalischen Erwerbung einzelner kleiner Werke ein zweckmäßige Untersuchung der ganzen in Frage kommenden Gegend einzuleiten und die Einzelbesitzer darnach fachmännisch zu beraten, nötigenfalls auch gemeinnützige Hilfsbauten, zu denen jenen die Mittel und Fachkenntnisse fehlten, von Staats wegen durchzuführen, bis dahin aber den Erwerb von Privatwerken aufzuschieben. Das Ministerium ging darauf ein und befahl 1822 eine Aufnahme der Steinkohlenwerke und Versuche in der Chemnitz- Flöha- Hainichener Gegend in die große Ingenieurkarte von Sachsen (durchgeführt von Marksch. Bergner unter Hilfe des Bergakademisten Pilz sen.).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Arbeit dauerte infolge der teilweise nötigen Neuvermessungen bis 1829, dadurch ging für Kögel die günstige Gelegenheit, seine Steinkohlenfelder und Werke mit großem Gewinn an den Fiskus zu verkaufen, vorüber. Zu der endlich entstandenen Steinkohlenrevierkarte von Chemnitz und Umgebung erstattet Bergkommissionsrat Kühn ein Gutachten (Oberbergamtsakten, 10476, Vol. II), in welchem er sagt, alle in dieser Gegend geförderten Kohlen hätten so hohe Produktionskosten, daß bei dem derzeit in Gang befindlichen Ausbau der Landstraßen (an Eisenbahnen war noch nicht zu denken) die Dresdner Kohle in absehbarer Zeit in Wettbewerb treten könnte. Er rät deshalb entschieden vom fiskalischen Erwerb von Steinkohlengruben bei Flöha ab, insbesondere von Kögel’s Werk, da die Flöze dort 12 bis 16 Zoll (0,3 m bis 0,4 m) nicht überschritten und nur mit geringem Vorteil abgebaut werden könnten, wenn mehrere Flöze gemeinschaftlich ausgehauen würden. Eine Hoffnung auf Besserwerden der Flöze sei auch nicht vorhanden, da sie bereits fast bis zu ihrem Tiefsten aufgeschlossen wären. Die dortigen Grubenbesitzer holten bei privatwirtschaftlichem Betriebe kaum ihre Produktionskosten heraus. Nachdem auf diese Weise Kögel’s Spekulation fehlgeschlagen war; nach Erwerb der Kohlenfelder und Einrichtung eines scheinbar lukrativen Abbaues das Werk und die Gerechtsame an den Staat mit großem Gewinn zu verkaufen, scheint der Abbau auf diesem Teil der Flöhaer Flur schnell zurückgegangen zu sein, umso mehr, als die dünnen Flöze allmählig sich erschöpften. Im Jahre 1835 bewirbt sich Kögel um Konzession zum Abbau im Struthwalde, nachden die fiskalischen Versuche hier endgültig eingestellt worden waren. Er erwähnt in diesem Gesuche in keiner Weise, daß er noch auf Flöhaer Flur Steinkohle abbaut, so daß anzunehmen ist, daß Kögel’s Werk auf Ulbricht’s und Lange’s Feldern schon vor 1835 wieder eingegangen ist. Lange hat dann nach 1830 noch selbst etwas Abbau auf seinem Grundstücke vollführt. Seine Grube war aber bald wegen Wettermangels nicht mehr zu befahren. In einem Anhang zur Abschätzung der Flöhaer Lehngerichtsfelder von 1841 sagt der Berggeschworene Kind, daß man seit 1812 (Pötzsch) die Ulbricht’schen Felder abgebaut habe, zu einem kleineren Teil auch die Lange’schen. Die Kohlen seien „auf rein abgebaut“ worden, so daß in Zukunft hier nichts mehr zu erwarten sei.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.) Auf Richter's
Feldern. (Pötzsch, Kieber, Schuhmann als Pächter) Als Pötzsch seine im Jahre 1813 von den Franzosen zerstörte Steinkohlengrube samt den Abbaurechten auf Ulbricht's und Lange's Feldern an diese Grundbesitzer zurückverkauft hatte, legte er für den Flöhaer Vizerichter und Gutsbesitzer Richter auf dessen Feldern ein Steinkohlenwerk an. Richter’s Fluren zogen sich längs des Flöhaer Pfarrwaldes und der Hausdorfer Straße nach Norden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem durch Anlegung zweier Schächte am Hausdorfer Wege der Abbau durch Pötzsch in Schwung gekommen war, trat Richter 1819 sein Werk gegen Tonnenzins an den damaligen Bürgermeister, späteren Stadtrichter von Oederan, Carl Gottlieb Kieber ab. Dieser verfügte über reichliche Betriebsmittel und legte sich mit verhältnismäßig großem Eifer auf den Abbau. 1822 stand schon neben dem Tagesschacht am Hausdorfer Wege ein Huthaus, das der Steiger Hesse bewohnte, der nachmals für den Abbau im Pfarrwalde eine Rolle gespielt hat. (Kohlenwerksinspektor Köttig schreibt in seinen Geschichtlichen Notizen, daß Kieber das Abbaurecht 1817 erworben habe. Aus den Oberbergamtsakten Nr. 10656 geht aber hervor, daß bis 1819 Pötzsch auf Richter's Feldern für eigene Rechnung abgebaut hat.) Von diesem ersten Tagesschacht am Hausdorfer Weg zog sich in der 1820er Jahren der Abbau hauptsächlich nach Norden und Nordosten. Genaueren Aufschluß über den Stand von Kieber’s Werk um das Jahr 1825 bieten die Akten über einen Raubbau-Prozeß, den der Lehnrichter Schippan als Flurnachbar Kieber’s (Flöhaer Lehngerichtsfelder) in diesem Jahre beim Bergamte Freiberg anstrengte. Schon im Sommer 1824 hatte Schippan bemerkt, daß ein Stück seines Feldes in der Nähe der Rainung mit Richter’s Grundstücken unfern der auf diesen angelegten Kieber’schen Schächte sich ungefähr eine halbe Elle gesenkt hatte. 1825 hatte ihm nun sein Steiger Schaal angezeigt, daß er von einem Bergmann Berger aus Hausdorf, als er ½ Jahr auf Kieber’s Schächten gearbeitet hatte, erfahren habe, wie weit seit langem von Kieber Steinkohlen unter Schippan’s Lehngerichtsfeldern gebrochen würden, obwohl dieser seit 25 Jahren etwa 400 Schritt von der Grenze mit Richter’s Flur selbst einen Schacht besaß, aus dem zeitweise gefördert worden war, bevor Schippan die Gückelsberger Felder erwarb. Dem Sohne Schippan’s, der in Freiberg verpflichteter Geometer war, hatte Kieber’s Steiger Hesse das Befahren des Werkes verweigert, als er den Tatbestand feststellen wollte. Kieber selbst, der in Oederan wohnte, hieß das Benehmen seines Steigers gut. Da trieb Schippan an der Grenze seiner Flur mit Richter’s Feld einen Untersuchungsschacht und entdeckte zunächst, daß ihm tatsächlich die Steinkohlen, die gerade hier von hoher Güte sein sollten, auf mehr als 60 Ellen Länge und 17 bis 30 Ellen Breite geraubt worden waren. Die ausgehauenen Räume waren wieder mit Schutt und Steinen ausgefüllt. Ferner waren Kieber’s Grubenwässer in die Steinkohlenlager des Lehngerichtes abgeleitet worden, um den Untersuchungsbau Schippan’s zu verhindern oder zu erschweren, so daß dieser sehr kostspielig wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu einer vergleichsweisen Entschädigung war bisher Kieber nicht bereit gewesen und so beantragte Schippan Untersuchung des erfolgten Raubbaus durch einen Bergsachverständigen und Feststellung des zugefügten Schadens. Auch an einer anderen Stelle nämlich, 600 Schritt weiter an der Rainung, hatte sich Schippan’s Feld schon vor vier Jahren (also um 1821) auf 2 m Breite einen Fuß tief gesenkt, so daß auch hier Verdacht auf Raubbau bestand. Da nach dem Kohlenmandat Streitigkeiten im Kohlenbau von den örtlichen Justizämtern erledigt werden mußten, verwies das Bergamt Freiberg Schippan mit seiner Klage an das Augustusburger Gerichtsamt, beauftragte aber den vereidigten Markscheider Franke, den Tatbestand durch einen Markscheiderzug zu klären. Auf dem Grundriß, den dieser anfertigte (Bergamtsakten 4081, Vol. I), ist Kieber’s Werk mit zwei Tagesschächten B und C aufgeführt, die unweit der Rainung mit den Lehngerichtsfeldern liegen. Vom Schachte B aus überschreiten die Kieber’schen Strecken zweimal die Feldergrenze und teilen sich dann in eine Anzahl Abbaustrecken im Streichen und Fallen des Flözes auf Schippan’s Boden. Einer dieser Abbaue wird von Schippan’s Untersuchungsschacht, bzw. der von ihm aus getriebenen Strecke angeschnitten. Zur Feststellung des ganzen Umfangs der Schädigung wurde Kieber von Gerichts wegen aufgetragen, die von ihm mit Steinen und Schutt versetzten Abbaustrecken und Örter auf Schippan’s Kohlenfelde wieder öffnen zu lassen. Nachdem dies geschehen, fand 1825 eine nochmalige genaue Aufnahme aller auf Schippan’s Boden widerrechtlich abgebauten Flächen des 7 Zoll starken Kohlenflözes durch den Markscheider Franke und eine Schätzung der ausgehauenen Kohlen unter Zuziehung eines Berggeschworenen statt. Nach dem in den Bergamtsakten 4081, Vol. I erhaltenen, genauen Grundriß wurde von dem Sachverständigen das widerrechtlich abgebaute Feld auf 116,668 Quadratlachter (etwa 467 m²) gerechnet. Auf Grund dieser Schätzung des Sachverständigen endigte dann der Streit 1826 mit einem Vergleich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trotz der geringen Flözstärke auf Kieber’s Bauen von 0,35 m im Höchstfalle entwickelte sich das Werk gut. Außer dem genannten Huthaus, in dem der Steiger wohnte, entstanden bald weitere Bauten über Tage, die zum Teil heute noch stehen, „die Kohlenhäuser“ genannt. In einem derselben richtete Kieber eine Schankwirtschaft ein, zu der er am 16. April 1831 durch allerhöchstes Rescript Konzession erhielt „zum Bier- und Branntweinausschank für die Arbeiter auf seinem Kohlenwerk und die Kohlenfuhrleute, ingleichen die das Werk besuchenden Fremden, sowie zur Beköstigung dieser Personen“. Den Betrieb dieser im Volksmund „Tangelschenke“ genannten Wirtschaft führte der Steiger Hesse mit; die Konzession ging aber mit dem Erliegen der Kohlenschächte, für die sie erteilt war, nach 1863 wieder ein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahre 1838 kam das Kieber’sche Werk einmal vorübergehend zum Stillstand, wahrscheinlich wollte man wegen mangelnden Ertrags und Absatzes nur im Winterhalbjahr abbauen, wo die Nachfrage gewöhnlich größer war. Der Grundbesitzer Richter (von 1839 bis 1850 erster Gemeindevorstand von Flöha nach Einführung der sächsischen Landgemeindeordnung von 1838) kam dadurch um seinen Tonnenzins und wollte 1840 den Abbau auf eigene Rechnung fortführen, da er seine Rechte nur verpachtet gehabt hätte. Durch die drohende Gefahr, seine Baue zu verlieren, in die er viel Geld gesteckt hatte, ging Kieber auf einen Vergleich ein, nach welchem er den Betrieb sofort wieder aufnehmen mußte. Der Betrieb wurde dann ohne großen Gewinn, aber wohl auch ohne Verlust weitergeführt, denn als ums Jahr 1846 der Stadtrichter und Senator Kieber starb, führte seine Witwe, in den Akten „Madam Kieber“ genannt, das Werk weiter. Ums Jahr 1846 bekamen die Kieber’schen Baue auch eine endgültige Wasserlösung, indem man durch einen Vertrag Anschluß an den Stollen gewann, den das Flöhaer Lehngerichtswerk von 1838 bis 1845 aus der vorderen Ulbrichtschlucht herangeführt hatte und der nun unter Kieber’s Baue verlängert wurde. Nach der Herder’schen Statistik von 1846 wurden auf Kieber's Werk zwei Flöze von 0,15 m bis 0,25 m abgebaut, die durch sandige Lagen von Schieferton getrennt waren. Die Förderung geschah durch einen 36 m tiefen Tagesschacht mittels Haspel und Kübel, in der Grube selbst durch Karren, und betrug 1845 etwa 3.500 Scheffel, bei 5 Arbeitern ohne den Steiger. Für die zum Kalkbrennen taugliche Kohle wurde ein Verkaufspreis von 72 Pfg. pro Scheffel erzielt (in Gückelsberg kostete der Scheffel in dieser Zeit noch 75 Pfg.). Der Betrieb war nach Herder’s Gutachten etwas besser als auf den anderen Flöhaer Werken, doch maß man schon damals (1846) dem Werke keine große Bedeutung für die Zukunft mehr bei. Es würde wohl eher zurück als vorwärts gehen. 1850 wurde das Werk mit anderen des Flöhaer Beckens durch Bergmeister Fischer und Berggeschworenen Kind von Freiberg revidiert. Aus dem Besichtigungsprotokoll geht hervor, daß es jetzt mit 7 Mann und einem Aufseher, namens Schuhmann, der im Huthause wohnte, belegt war. (Der frühere Steiger Hesse hatte sich inzwischen zusammen mit seinem Sohne im Struth-, später im Pfarrwalde selbständig gemacht.) Der mit den Lehngerichtsbauen gemeinsame Stollen brachte bei dem saigeren Tagesschacht 35 m Teufe ein. Der Abbau richtete sich von diesem Schacht nach Norden und Nordost. Das Flöz war zwar im ganzen 0,7 m bis 1,15 m stark, enthielt aber nur zwei Schichten von 0,2 m bzw. 0,25 m bis 0,35 m brauchbare Kohle. Alle freien Räume wurden durch den reichlich fallenden Abraum gleich wieder versetzt, das Beckengestein hielt außerdem gut. Der Schacht war 1,75 m weit, so daß natürlich keine Trennung von Fahr- und Förderraum möglich war, auch Ruhebühnen in den Fahrten fehlten. Die Fahrten selbst schwankten zwar nicht wie in anderen Flöhaer Werken, da sie an Jochen befestigt waren, aber infolgedessen konnten man meist den Fuß nicht bequem auf die schlüpfrigen Sprossen aufsetzen. An einer Stelle mitten im Schacht hörte die Fahrt plötzlich auf und ging daneben weiter, ohne daß der geringste Abtritt oder eine Ruhebühne vorhanden war. Dem Aufseher Schuhmann wurde daher aufgegeben, diese Fahrtunterbrechung unverzüglich abzuändern, eine Ruhebühne einzubauen, eine Hängebank, eine Handhabe für Ausfahrende, eine Wehrstange an den Haspelstützen, sowie einen Schachtdeckel anzufertigen und die Schachtjoche soweit auszumeißeln, daß der Fuß bequemen Halt hat. Man sieht, daß das Werk, um nicht mit Verlust zu arbeiten, den Ausbau seiner Betriebsanlagen bis auf ein vorschriftswidriges Minimum beschränkt hatte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als im Jahre 1853 auch Frau Kieber gestrorben war, verpachteten die Erben (Advokat Dr. Kieber, Dresden) das Werk an den Aufseher Schumann, der den Betrieb durch Abteufen zweier neuer Schächte zu erweitern suchte. Es gelang ihm, dadurch die Lebensdauer des Werkes noch um eineige Jahre zu verlängern. Die Produktion stieg unter seiner Leitung aufs doppelte, aber nach 1861 konnte er sie nicht mehr auf ihrer Höhe halten. Da es mit dem Kieber’schen Werke abwärts ging, pachtete Schuhmann 1861 auch noch das Lehngerichtswerk hinzu und überließ die Leitung der Kieber’schen Baue seinem Sohne. Bis zum Jahre 1861 waren nach den Akten des Kohlenwerksinspektors über Schuhmann’s Werk auf Richter’s Feldern von einem Gesamtkohlenfelde von 6 Ackern 150 Quadratruthen im ganzen abgebaut: 5 Acker und 90 Quadratruthen. Im Abbau waren zwei Flöze von jeweils zirka 22 cm Stärke. Die Förderung geschah durch einen Ziehschacht von 26 m Teufe, die Wasserlösung durch einen Stollen von zirka 35 m Tiefe am Schacht. Der Stollen war je einen Meter hoch und weit, 156 m lang (gemeint ist hier wahrscheinlich bloß die Länge unter Richter’s Feldern), davon standen 36 m in Zimmerung. Tagesgebäude waren: ein Huthaus, ein Holzschuppen, ein Kellergebäude, Wert je 300 Taler (die „Tangelschänke“ ungerechnet). Die Förderung betrug 1860 immerhin noch 6.564 Scheffel von einem Werte von 1.531 Tlr. 18 Ngr. Der Verkaufspreis war auf 70 Pfg. pro Scheffel gefallen. Der Materialverbrauch war 152 Tlr. An Löhnen wurden gezahlt 1860 für 5 Arbeiter 1.040 Tlr. (bei 12 Stunden Arbeitszeit und Schicht 15 Ngr. pro Schicht, bei wöchentlich 6 Schichten durch das ganze Jahr). Dazu kamen 150 Tlr. Gehalt für einen Beamten (Schuhmann), so daß dem Gesamtverkaufserlöse von 1.531 Tlr. 18 Ngr. die Rohproduktionskosten mit 1.342 Tlr. – Ngr. gegenüberstehen. Im Jahr 1861 fiel die Förderung auf 4.223 Scheffel im Werte von 933 Tlr. 10 Ngr. Die Materialausgaben waren zusammen 282 Tlr., die Löhne für 4 Arbeiter 650 Tlr. Betrug die Spannung zwischen Produktionsaufwand und Verkaufserlös 1860 immerhin noch 189 Tlr. 18 Ngr. (wovon noch der Tonnenzins, dessen Höhe aus den Akten leider nirgends hervorgeht, bei den auf anderen Werken üblichen 6 Pfg. pro Scheffel etwa 131 Tlr.) abzuziehen war, so zehrten 1861 die Rohproduktionskosten allein den ganzen Verkaufserlös auf, ohne daß noch der Tonnenzins an den Grundbesitzer bezahlt war. Dieses Mißverhältnis wurde infolge der Erschöpfung der bisherigen Abbaue im Jahre 1862 ganz kraß, so daß es nicht Wunder nimmt, wenn bei diesen Rentabilitätsverhältnissen der Eigentümer, Dr. Kieber, das Werk eingehen lassen wollte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch einmal zwar überredete ihn Schuhmann, nachdem der Betrieb 1862 im Sommer schon geruht hatte, im Winter 1862/1863 einen neuen Schacht im südlichen Teil des Feldes abteufen zu lassen, wo man noch abbaufähige Lager vermutete. An ihm wurde bis Ostern 1863 mit 3 Mann bei Tage und 2 Mann bei Nacht gearbeitet (zum Schichtlohn von 15 Ngr.), als er aber wegen Wasserzudranges ohne Resultat wieder aufgegeben werden mußte, ließ Dr. Kieber 1863 das Werk endgültig eingehen. Zwar schrieb Schuhmann 1863 in einem Briefe an den Kohlenwerksinspektor, daß das Werk noch zwei Jahre lang mit Vorteil hätte betrieben werden können, wenn sich Dr. Kieber zum Bau eines neuen Stollens bequemt hätte; doch kann er damit bei den oben geschilderten Verhältnissen unter sinkender Tendenz des Kohlepreises (1863 erzielte die Kieber’sche Kohle beim Restverkauf nur noch 55 Pfg. pro Scheffel) höchstens seinen eigenen Vorteil als Aufseher gemeint haben; denn eine neue größere Kapital- Investierung durch einen neuen Stollen vertrug das Werk bei den fast völlig abgebauten Kohlenfeldern vom privatwirtschaftlichen Standpunkte aus nicht mehr. Nach einer Notiz im Fahrjournal des Kohlenwerks-Inspektors vom Jahre 1865 hat Dr. Kieber nach dem Erliegen des Werkes im Jahre 1863 dasselbe an den Besitzer des Oberirdischen, Richter, verkauft. Den Abbau hat dieser aber nicht wieder aufgenommen. Wahrscheinlich hat er den Rückkauf bloß vorgenommen, um eine Löschung der Gerechtsame auf das Unterirdische seines Grundstückes herbeizuführen. In Stein’s Analysen über Kohle aus dem Flöhaer Becken ist die Kohle aus Kieber’s Werk merkwürdigerweise nicht mit aufgenommen. Sie wird aber in ihrer Beschaffenheit der auf Anke’s Grube gefundenen (Analysen 2 und 3 in Kapitel V) geähnelt haben, wie überhaupt die auf Flöhaer Flur in der oberen Karbonstufe gefundenen Kohlen auf den Feldern von Anke, Kieber und des Lehnsgerichtes einander sehr ähnlich waren. Geinitz, der 1853 die dortigen Gruben für seine „Flora“ besuchte, sagt, daß auf dem (dem Lehngerichtswerk) benachbarten Kohlenwerke der Madam Kieber nicht nur die Beschaffenheit der Kohle selbst und die Verbreitung der in ihr enthaltenen Flora genau dieselbe war, sondern auch die Mächtigkeit der Flöze und Lagerungsverhältnisse derselben im allgemeinen nicht voneinander abwichen. Der geringe Gehalt der dortigen Kohlen an Wasserstoff und Sauerstoff, wodurch sie eine anthrazitähnliche Beschaffenheit erhalten haben, die häufig hier erscheinenden Rutschflächen und verschobenen und zerbrochenen Schiefertone machen es vorallem hier sehr wahrscheinlich, daß der die Kohlen überlagernde Tonstein (Porphyrtuff) eruptiver Natur sein möge.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.) Auf Anke's
Feldern und Sandsteinbrüchen. (Pötzsch, Anke, Thümer) Auch auf einer dritten Stelle der Flöhaer Flur ist der Unternehmer Pötzsch der Begründer eines stetigen, nachhaltigen Abbaus geworden: Auf den Feldern und Sandsteinbrüchen des Flöhaer Bauern Carl David Anke. Pötzsch hatte den Abbau auf Ulbricht’s und Lange’s Feldern begonnen, hatte das Werk auf Richter’s Fluren eingerichtet und baute nun, nachdem letzteres 1819 an Kieber aus Oederan übergegangen war, von 1820 ab auf Anke’s Besitztum. Nimmt man hinzu, daß Pötzsch auch der Begründer des Abbaues im Struthwalde wurde (ab 1836), so kann man ihn wohl mit Recht als einen Pionier der Erschließung der Steinkohlenlager im Flöhaer Becken neben Schippan nennen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anke’s Felder lagen am oberen Ausgange der vorderen Ulbrichtschlucht, waren zum Teil, wie auch heute noch jene Gegend, mit Wald bedeckt und stellten keinen besonders guten Ackerboden dar. Der Besitzer hatte darauf mehrere kleine Steinbrüche im Kohlensandstein der oberen Stufe, die zum Teil schon vor seiner Zeit angelegt worden waren und in denen schon immer ein schwaches Kohlenflöz bemerkt und mit abgebaut worden war. Es war etwa 0,2 m stark, aber einschließlich der Lettenschichten, die es verunreinigten. Pötzsch bekam schon 1819 die Konzession auf Anke’s Besitz, „dem sogenannten alten Fels- und Holzboden gegen Entrichtung eines Tonnenzinses oder Abgabe eines Quantums Kohle in natura“ abbauen zu dürfen und zwar unter Befreiung vom Kanon an den Staat, wie sie schon Kögel erhalten hatte. Den schon vorhandenen Steinkohlenbruch durfte er fortsetzen und alle sonstigen zum Betrieb nötigen Anlagen einrichten; etwa gebaute Bretterhütten aber waren bei Aufgabe des Betriebes wieder abzubrechen. Von 1820 bis 1835 mühte sich nun Pötzsch schlecht und recht ab, aus dem Abbaue des schwachen Flözes seinen und seiner Familie Lebensunterhalt zu gewinnen. Er wird in der Hauptsache sein eigener Arbeiter gewesen sein, denn in den Akten findet sich nirgends ein Hinweis, daß der Betrieb irgendwelche Bedeutung angenommen habe. Außer in dem Steinbruche suchte Pötzsch im Laufe der Jahre auf dem ganzen Anke’schen Besitz an den verschiedensten Stellen nach abbauwürdigen Flözen, aber ohne nachhaltigen Erfolg. Geinitz spricht 1853 in seiner „Flora“ von mehreren alten Halden von Schieferton im nordöstlichen Teile der vorderen Ulbrichtschlucht, die Zeugnis ablegten „von der Unermüdlichkeit des früheren Unternehmers Pötzsch, hier brauchbare Steinkohle finden zu wollen.“ Und Naumann stellt in seiner Monographie des Kohlenbassins von Flöha fest, daß der westliche Rand der oberen Ulbrichtschlucht „durch eine Menge verlassener kleiner Schächte und Pingen zu einer wilden Bergwüstung zerwühlt ist.“ Die Spuren von Pötzsch’s Unermüdlichkeit kann man heute noch an der Oberfläche jener Gegend deutlich wahrnehmen. Was einigermaßen abbauwürdig war, hatte Pötzsch bis 1835 erschöpft, so daß er, als er sich in diesem Jahre um die Konzession im Struthwalde bewarb, mit seiner Familie erwerbslos war. Nach 1835 hat dann Anke gelegentlich mit seinem Steinbruch auch das darin enthaltene Kohlenflöz weiter abgebaut. Um das Jahr 1852 hatte der Abbau seitens Anke’s sogar wieder größere Intensität angenommen, da sich die Kohle verbesserte. Geinitz nennt die in diesem Jahre dort abgebaute Kohle „ziemlich weich und mild, indem sie durch Einwirkung der Atmosphärilien sehr verändert war.“ (Sonst war Härte ein besonderes Kennzeichen der Flöhaer Kohle.) Nach Geinitz ist auch damals in zirka 2,5 m Tiefe noch ein zweites, angeblich stärkeres Flöz nachgewiesen worden, das im Jahre 1853 zu einem bergmännischen Versuche veranlaßte, der auch zu einer vorübergehenden Förderung führte. Doch war dieser Bau schon im August 1853 infolge „Ansammlung der Gewässer“ wieder aufgegeben. Wenn dieses zweite Flöz wirklich auf größere Ausdehnung hin abbauwürdig gewesen wäre, hätte es sicher Pötzsch schon in Angriff genommen gehabt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von allen im Flöhaer Becken im Laufe des 19. Jahrhunderts in Betrieb gewesenen Werken ist sicher das auf Anke’s Feldern das unbedeutendste, weil unergiebigste, gewesen. Der Anwesenheit Geintz haben wir zu verdanken (er war 1852/1853 im Flöhaer Becken), daß die Kohlen des Anke’schen Werkes von Stein mit analysiert worden sind, und zwar sowohl die des oberen (Haupt-) Flözes als auch gemischt mit solchen des unteren Flözes (Analysen 3 und 4, Kapitel V). Daraus geht hervor, daß tatsächlich die Kohle des unteren Flözes etwas besser gewesen sein muß; denn während die Kohle des oberen Flözes allein einen Aschegehalt von 43,923 % bis 58,0 % (durchschnittlich also 51,5 %) und einen Kohlenstoffgehalt von 37,772 % bis 41,991 % (durchschnittlich also kaum 40 %) hatte, erreichte sie mit Kohle vom unteren Flöz vermischt, wie sie auch verkauft wurde, fast 43 % Kohlenstoffgehalt und einen Aschegehalt von nur 50,5 %. Nach 1853 finden wir in keiner Quelle mehr etwas vom Abbau auf Anke’s Grundstück erwähnt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.) Auf
den Fluren des Lehngerichts. (Schippan, Kluge (Fink), Schuhmann)
Auf den Fluren des Flöhaer Lehngerichtes, soweit sie auf der nördlichen Platte des Steinkohlengebirges lagen, begrenzt im Süden und Osten von Richter’s Feldern mit Kieber’s Werk und im Nordwesten von Ulbricht’s Grundstück, wo vermutlich schon 1741 der alte Licht- Erbstolln gegraben worden war, hatte der Lehnrichter Johann George Schippan schon kurz vor 1800 versucht, die darunterliegenden Kohlenschätze zu heben, wie aus den Oberbergamtsakten und den schon in Kapitel III erwähnten Engelbrecht’schen und Lindig’schen Berichten zu den Vorarbeiten für die erste geognostische Landesuntersuchung hervorgeht. Schippan teufte zunächst auf der Höhe des Berges östlich der vorderen Ulbrichtschlucht, wo die Straße nach Hausdorf eine Krümmung macht und eine jetzt nicht mehr vorhandene Ziegelei stand, einen annähernd 14 m tiefen Schacht ab, in welchem er aber nur dünne Lager von Steinkohle vorfand. Er legte deshalb 300 Schritt nordwestlich davon, wo ein alter verfallener Stolln aus der Ulbrichtschlucht hinführte (wahrscheinlich der alte Licht- Erbstolln), zwei weitere Schächte ab, von denen der eine etwas über 25 m tief war und bei zirka 5 m eine über 2 m starke Schiefertonschicht mit Lagen von Steinkohle durchsetzte. Der andere Schacht war bloß gegen 7 m tief.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnitt aus dem Meilenblatt (Berliner Exemplar, Blatt 204: Flöha, Oederan, Hausdorf, Breitenau, datiert 1788) mit der Lage der „Flöhaer Ziegelscheune“ am Nordwesthang von „Pfarrholz oder Kirchenwald“. Kohlenschächte sind hier noch nicht eingetragen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die gewonnenen Resultate hatten Schippan nicht genügt, worauf er seit 1800 seine Aufmerksamkeit den Gückelsberger Steinkohlenlagern zuwandte und den Abbau auf seinen eigenen Feldern ruhen ließ, bis er im Jahre 1824 aus der Senkung von Teilen der Oberfläche seiner Felder, die an die Richter’schen grenzten, den später begründeten Verdacht schöpfte, daß der auf Richter’s Feldern abbauende Bürgermeister Kieber aus Oederan unter der Flurgrenze hinweg Raubbau auf seinem Felde betrieb. Zur Feststellung des Tatbestandes trieb er deshalb an der Grenze mit Richter's Feld einen Untersuchungsschacht und entdeckte dadurch, daß ihm tatsächlich in einem Umfange von zirka 467 m² die Steinkohlen ausgehauen worden waren. Seine Klage gegen Kieber endete mit einem Vergleich und der Abbau auf den Lehngerichtsfeldern ruhte wieder bis 1837. Damals war Moritz Schippan, ein Sohn des Johann George, schon Lehnrichter in Flöha, während der Vater sich ganz seinem Gückelsberger Steinkohlenwerk widmete. Genaue aktenmäßige Nachrichten über das seit 1837 betriebene Werk finden sich erst 1845 in den Bergamtsakten Nr. 4081, Vol. III, als infolge des Todes des Moritz Schippan der Wert des Flöhaer Lehngerichts samt Nebenbetrieben abgeschätzt und der Berggeschworene Kind, Freiberg, beauftragt wurde, ein Gutachten mit Wertbestimmung über die auf den Lehngerichtsfluren liegenden Steinkohlenwerke abzugeben. Er tat dies nach Besichtigung am 29.10.1845 anhand eines den genannten Akten beiliegenden Grundrisses des Lehngerichtswerkes vom Markscheider Pilz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abbauwürdig waren nur zwei Flözchen, von höchstens einmal bis 0,37 m, meist geringerer Mächtigkeit. Der Abbau war 1845 noch im Gange und fand nach der südöstlichen Feldgrenze hin statt, in einiger Entfernung von der heute noch stehenden Ziegelei. Kind befuhr zunächst den Schacht F des Risses, der ziemlich in der Mitte zwischen den zwei langen Grenzen des Feldes etwa 156 m nordöstlich der Ziegelscheune lag. Dieser durchsank bis zum ersten Flöz 10 m Porphyrtuff und 7,2 m Kohlensandstein, dann weitere 1,4 m Sandstein bis zum zweiten Flöz, zusammen also 18,6 m, und war erst 1845 niedergebracht worden. Das obere Flöz war hier 3 m nach Westen und 2 m nach Süden abgebaut und nur 0,1 m stark, darin noch bis ¾ cm starke Schiefertonschichten. Das andere Flöz war 0,2 m stark und reiner; teilweise war es mit dem oberen zusammen abgebaut worden. Über und unter dem Flöz stand noch 0,15 m bis 0,17 m äußerst unreiner „Kohlenbrand“ an, mit Sand und Schieferton gemischt. Zwischen, über und unter den beiden Flözen fanden sich meist noch eine ganze Anzahl bis höchstens 1 ¼ cm starker Kohlenschmitzen. Im Schachte B, 1842 abgesunken, etwa 70 m südlicher, bis zum unteren Flöz 23 ½ m tief (16,8 m Tuff; 6,6 m Sandstein) war das Kohlenfeld nördlich und nordöstlich 40 m weit abgebaut. Das untere Flöz stand hier mit 0,2 m Kohle und 5 cm Kohlenbrand an; nach Südwesten war es bloß auf 13 m Länge abgebaut, weil es sich dort rasch unter 0,2 m verschlechterte und unreiner wurde. Das obere Flöz war hier überhaupt nur 0,1 m bis 0,15 m stark und völlig unrein. Vom Schachte B führte eine 70 m lange Strecke südöstlich unter den Schacht E. Das Flöz war auf dieser Strecke 0,25 m bis 0,37 m mächtig, aber sehr unrein und kaum abgebaut. Von E aus bestanden Abbaustrecken von 24 m nach Süden, 28 m nach Norden und eine Fallstrecke von 25 m nach Osten. Der hier ziemlich ergiebig gewesene Abbau hatte 1845 aufgehört, nachdem ringsum gegen 40 m weit alle Kohle ausgeschlagen war und dieselbe im Süden schon durch den sogenannten Raubschacht (zu dem Raubbau-Streit mit Kieber) 1825 bis an die Grenze mit dem Richter’schen Felde abgebaut worden war. Nur auf der östlichen Fallstrecke sah man noch das Flöz mit 0,18 m Stärke anstehen, aber wegen des bedeutenden Wasserzudrangs hatte auch hier der Abbau 1843 aufgehört. Ein vierter Schacht C lag weiter nordwestlich gegen die Ulbrichtschlucht hin und diente als Wetter- und Förderschacht für den von dieser Schlucht herangeführten Stollen. Er war gegen 22 m tief und stand 12 m im Porphyrtuff, 5,4 m im Sandstein und Kohlenschiefer bis zum ersten Flöz, 2,6 m weiter bis zum zweiten Flöz und von da noch gegen 2 m bis zur Stollnsohle gleichfalls in Sandstein. Das obere Flöz war hier nur 0,15 m stark und sehr unrein, das untere zwar bis 0,4 m, aber mit kaum 0,12 m brauchbarer Kohle. Da beim Abbau hier Gewinn- und Förderkosten nicht gedeckt waren, war derselbe bald wieder verlassen worden. Ein fünfter Schacht A war 1837 an der Grenze mit Richter’s Flur abgeteuft worden, mußte aber der zudringenden Wasser wegen bald wieder verlassen werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wegen der schwierigen Wasserhaltung war dann von 1838 bis 1845 der oben genannte Stolln von der Ulbrichtschlucht her getrieben worden. Etwa 240 m nördlich von der Ziegelscheune, der bis zum Schacht C, als dessen ersten Lichtloche, 100 m in südöstlicher Richtung ging, dann 134 m bis unter den Schacht B, der 1842 erst bis zum untern Flöz abgesunken war, dann noch 5,40 m weiter bis zur Stollnsohle verlängert wurde. Von D aus ging der Stolln noch 62 m in Richtung auf Schacht A weiter und war im Oktober 1845 noch mit 5 Mann belegt, denen er bei 1,30 m Höhe und 1 m Weite aufzufahren für 5 Taler verdingt war. Der Stolln stand ganz in Sandstein. Er wurde noch bis zum Schachte A durchgeführt, der an der Grenze mit Richter’s Feld lag und von hier aus gewannen dann im nächsten Jahre Kieber’s Baue Anschluß und gemeinsame Wasserlösung mit dem Lehngerichtswerk. Beim Bau des Stollns war teilweise der alte Licht- Erbstolln durch Aufgewältigung wieder benutzt worden. 52 m und 62 m vom Mundloche hatte man mit dem Stollen zwei Flöze von 0,25 m bis 0,3 m unbrauchbarer Schieferkohle überfahren, die mit einer Neigung von 10° bis 15° aufstiegen. Ein Teil der Flöze lag also noch unter der Stollnsohle. Überhaupt hatte es sich, ebenso wie beim Gückelsberger Bergbau, herausgestellt, daß die Flöze wellenförmig und sehr unregelmäßig verliefen. Das obere Flöz war größtenteils völlig unbauwürdig. Nach angestellten Schürfen konnte man die Grenze der Kohlenablagerungen auf den Lehngerichtsfluren ungefähr durch eine rhomboidale Figur bestimmen, deren Grundlinie die Rainung mit dem Richter’schen Gute bildete und deren größte Länge etwa 650 m, größte Breite etwa 400 m war, ungefähr 170.000 m² (oder zirka 60 Scheffel Kornaussaat) an Fläche enthaltend. Wirklich abbauwürdig war davon nur ein Teil, der sich in etwa 200 m Länge an das Richter’sche Grundstück anschloß und 400 m breit war, etwa 67.000 m² Fläche, von der aber schon 7.000 m² abgebaut waren, so daß 60.000 m² verblieben oder gar nach Abrechnung von ¼ für Verdrückungen nur 45.000 m². Da ein Quadratmeter 7-zölliges (= 0,17 m) Kohlenflöz erfahrungsgemäß reichlich 2 Scheffel Kohle abwarf, berechnete Kind 1845 den abbauwürdigen Kohlenvorrat auf Lehngerichtsflur mit zirka 93.800 Scheffeln. Bei dem damaligen Verkaufspreise von 75 Pfg. für den Scheffel Flöhaer Kohle konnte man 7-zöllige Kohlenflöze gerade noch ohne Verlust abbauen; wenn sie besonders rein waren, sogar mit kleinem Gewinn. Kind berechnete die Arbeitslöhne für den Abbau von einem Quadratlachter (zirka 4 m²) 7 Zoll stark anstehender Kohle folgendermaßen: Um 1 Quadratlachter abzubauen, verfuhr ein Hauer drei 12-stündige Schichten, zu je 10 Ngr. = 1 Taler. Die Förderkosten hierfür betrugen, da die Hälfte der gehauenen Berge wieder in die abgebauten Räume versetzt wurde und ein Tagelöhner gewöhnlich für 90 Kübel täglich zu fördern 85 Pfg. erhielt, 71,9 Pfg. Die Arbeitslöhne für 1 Quadratlachter Kohle (das Quadratlachter zu 8 1/3 Scheffel gerechnet) betrugen also:
Da aber gewöhnlich zur besseren Übersicht und Ersparnis der Aufsicht die Kohlengewinnung den Hauern verdingt wurde, für 37,5 Pfg. pro Scheffel Kohle, so stellten sich die Arbeiterlöhne pro Scheffel geförderter Kohle (8,6 Pfg. für Förderung zutage gerechnet) sogar auf 46,1 Pfg., wonach gegen den Verkaufspreis von 75 Pfg. nur ein Reingewinn von 28,9 Pfg. pro Scheffel verblieb. Laut Kohlenverkaufsregister waren in den letzten Jahren verkauft worden:
...zusammen 7.980 Scheffel oder im jährlichen Durchschnitt 2.660 Scheffel. Der Rohgewinn hierfür nach obigen Rechnungen war 256 Tlr. 7 Ngr. 4 Pfg. gewesen, pro Jahr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Summe war aber noch um den Unterhaltungsaufwand des Werkes, Anschaffung von Gezähe, Absinkung neuer Schächte und den Stollnbau, namentlich im Jahre 1844 bedeutend vermindert worden, so daß nach den Wirtschaftsrechnungen der Reinertrag des Werkes
betragen hätte.
Die noch anstehende
abbauwürdige Kohlenmenge von 93.800 Scheffeln konnte bei jährlichem
Absatze von 2.600 Scheffeln in 35,8 Jahren gewonnen werden. Dabei bliebe
zu berücksichtigen, daß durch einen tüchtigen Wirtschafter der Absatz
bedeutend erhöht werden könnte, daß auch in Zukunft die großen Kosten
ersparte blieben, die der Bau des Stollens sowie das Niederbringen der
Schächte A und F, in deren Bereich noch gar nichts abgebaut worden war,
gekostet hatten, das ferner die früher kostspielige Wasserhaltung
wahrscheinlich in Zukunft gänzlich wegfallen würde, wenn der Stollen den
Schacht A erreicht hätte. Es war dann nach Kind’s Ansicht wohl möglich,
einen Reingewinn von einem Neugroschen pro Scheffel zu erzielen, da kein
Tonnenzins an den Grundbesitzer in Frage kam. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das wären bei 2.600 Scheffeln jährlich
Diese Summe sei aber ausreichend, da das Gebirge gut stehe, die geringe nötige Zimmerung nicht schnell stockig werden und überhaupt nur 5 bis 7-zölliges Holz verwandt zu werden bräuchte, so daß man
Dieser Betrag von 133 Tlr. 11 Ngr. 6 Pfg. sei als Steigerlohn bei einem gewöhnlichen Wochenlohn von 2 ½ Talern ausreichend. Der Steiger hätte die geringen Reparaturen und das Messen der Kohle mit zu besorgen, in der freien Zeit noch Kohle mit zu hauen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine weitere besondere Erleichterung für das Lehngerichtswerk mußte in Zukunft die teilweise Übernahme des Stollenbetriebes durch das Kieber’sche Werk bringen, mit dem in dieser Hinsicht schon ein Vertrag geschlossen war, wonach 1.) Kieber alle Kosten für den Bau des Stollens vom Schachte B des Lehngerichtes bis nach A (an der Richter’schen Rainung) übernahm; 2.) Jede Partei die Hälfte der Kosten zur Unterhaltung des ganzen Stollens trug (namentlich die Zimmerung); 3.) die Wasser die Wasser von Kieber’s Werk in den Stollen geleitet werden durften; 4.) von Lehngerichtsseite der Schacht A noch bis zur Stollnsohle niedergerbacht werden mußte (B war schon so weit); 5.) Kieber die Schächte A und B des Lehngerichts zur Förderung während des Stollenbaus innerhalb der Lehngerichtsgrenzen benutzen durfte; 6.) die beim Stollenbau etwa ausgerichtete Kohle auf Lehngerichtsflur zwischen beiden Parteien zu teilen war. Obwohl unter diesen Umständen der Reinertrag des Lehngerichtswerkes sich in Zukunft steigern mußte, nimmt der Berggeschworene Kind doch Abstand, hierfür eine feste Summe aufzustellen, da auch der bisherige hohe Verkaufspreis der Kohle wesentlich fallen konnte (was ja tatsächlich schon vom nächsten Jahre ab eintrat), wenn durch neu entdeckte Kohlenlager in der Umgegend von Chemnitz oder durch wohlfeileren Transport von Zwickauer Kohle ins Chemnitzer Gebiet durch die schon geplante Eisenbahn die Konkurrenz größer und das Absatzgebiet kleiner würde. Nahm man daher vorsichtigerweise nur einen jährlichen Reingewinn von 80 Tlr. an, so entsprach dies bei 3 ½ % Verzinsung und entsprechender Amortisation der Kaufsumme in einigen 30 Jahren einem Barwerte des Werkes von 1.200 Tlr. im Jahre 1845.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob der Vize-Lehnrichter Kluge das Steinkohlenwerk zu diesem Preise übernommen hat, ist ungewiß; jedenfalls hatte er als Nichtfachmann kein besonderes Interesse dafür und verpachtete es bald an einen gewissen Carl Gottlob Fink (oder Finke). Die Förderung erhöhte sich zunächst nicht; für 1845 wird sie mit zirka 2.000 Scheffel angegeben, doch es sank der Verkaufspreis der Kohle auf 72 Pfg. (nur die Gückelsberger hielt sich auf 75 Pfg.). Abgebaut wurde wahrscheinlich hauptsächlich ab dem Schachte A, der zirka 35 m, nach seiner Verlängerung bis zur Stollnsohle 40 m tief war. Bei dem Betrieb war bei der im Jahre 1850 erfolgten Revision durch den Freiberger Bergmeister mancherlei umzusetzen. Er wird in der Herder’schen Statistik von 1846 schon „wohlmöglich noch mangelhafter, als bei Kieber“ genannt. Abstellung folgender Mängel des Betriebes wurde 1850 von Bergmeister Fischer aufgegeben: 1.) Einbau von Ruhebühnen in den Fahrten des Schachtes; 2.) Ausmeißelung der Fahrtjoche zum besseren Aufsetzen des Fußes; 3.) Einrichtung einer richtigen Hängebank und 4.) eines Schachtdeckels, sowie 5.) eines Streicheisens. Trotzdem brachte Fink das Werk in den nächsten Jahren auf eine gewisse Höhe. Schon 1850 beschäftigte er 9 Mann. Das Flöz hatte jetzt an den Abbaustellen 0,7 m bis 0,95 m Mächtigkeit, enthielt aber nur zwei Brandschieferschichten von 0,15 m bis 0,3 m mit einzelnen Lagen guter Kohle darin. In den nächsten Jahren von 1850 ab, hob sich die Förderung unter Fink's Leitung zu einer bisher nicht erreichten Höhe. In den Akten zur Erhebung statistischer Nachrichten, die der Kohlenwerksinspektor 1853 anlegte, findet sich ein von Fink selbst augefüllter Fragebogen, aus dem folgendes hervorgeht: I.) Örtliche Lage: Fluren des Lehngerichts Flöha und des daran liegenden Beigutes; ¼ Stunde von der Chemnitz-Dresdner Chaussee, 2 Stunden vom Bahnhof Oberlichtenau entfernt II.) Räumliche Ausdehnung: 20 Acker; bereits aufgeschlossen 350 Quadratlachter (1.400 m²) III.) Besitzverhältnisse: Werkseigentümer und Unternehmer: Carl Gottlob Finke. Besitzer der Oberfläche: Lehnrichter Kluge; bekommt für den Scheffel 13 Pfg. Grundzins. Im Jahre 1853 ergab der Grundzins 311 Tlr. 15 Ngr. 7 Pfg. bei einer Förderung von 7.189 Scheffeln IV.) Beschaffenheit der Lagerstätte: zwei Flöze, das erste 15 Zoll, das untere 8 Zoll stark; beide werden abgebaut. Zwischenmittel selten über eine Elle V.) Beschaffenheit des Werkes: Ein Fahr- und Förderschacht, 24 Lachter (48 m) tief, in Zimmerung stehend; ein Stollen, 16 Lachter Teufe (32 m) einbringend, ½ Lachter weit, 1 Lachter hoch, 250 Lachter (500 m) lang.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Lehnrichter Kluge verdiente also bei einer Verpachtung des Werkes mehr, als Berggeschworener Kind 1845 für eigene Bewirtschaftung, allerdings bei ganz vorsichtiger Schätzung, herausgerechnet hatte, nämlich 13 Pfg. statt 10 Pfg. pro Scheffel. Die Verhältnisse mußten sich als recht günstige gestaltet haben; die Flöze waren stärker geworden (0,37 m und 0,2 m) und konnten infolge geringen Zwischenmittels immer zusammen abgebaut werden. Der genannte 48 m tiefe Schacht war wahrscheinlich neu angelegt und der Stollen bis zu ihm verlängert worden, so daß dessen Länge jetzt mit 500 m angegeben wird. Außerdem stand jetzt nach der Statistik ein Huthaus auf dem Werke. An Materialverbrauch wird für 1853 folgende Zusammenstellung gegeben:
Die anfahrende Mannschaft bestand bei gewöhnlichem Betrieb aus 8 Mann bei der Gewinnung und 1 Mann bei der Förderung, zusammen 9 Mann ohne Aufseher, welche Funktion Fink selbst versah. Der Lohn betrug für 12stündige Schicht ohne Abzug 10 Ngr., bei wöchentlich gewöhnlich 6 Schichten durch das ganze Jahr. Hierbei hatten die Arbeiter ihr Leuchtmaterial zu stellen, aber nicht das Gezähe und Pulver. Andere Begünstigungen, insbesondere eine Knappschaftskasse, bestanden nicht, wie überhaupt nirgend im Flöhaer Becken. Der Gesamtbetrag der 1853 gezahlten Löhne betrug 931 Tlr. 27 Ngr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit Hilfe dieser Zahlen läßt sich Fink’s Reingewinn für 1853 an seinem Pachtwerke berechnen. Der Verkaufserlös für die Förderung von 7.189 Scheffeln zu 72 Pfg. ergibt:
oder, abgerechnet die Vergütung für seine Arbeitsleistung als Aufseher (nach Kind’s Berechnung 2 ½ Taler pro Woche = 130 Taler jährlich), noch 234 Taler Unternehmergewinn.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei Gelegenheit der Statistik von 1853 erfahren wir einmal die genauen Absatzgebiete eines Flöhaer Werkes. Es ist klar, daß der Absatz der teuern und minderwertigen Kohlen des Flöhaer Beckens nicht weit über die Umgebung hinausgehen konnte: Chemnitzer, Frankenberger, Oederaner und Zschopauer Gegend. Nur die Gückelsberger Anthrazitkohlen gingen gelegentlich weiter, Schippan spricht von Konkurrenz mit Zwickauer Kohle bis in die Zwickauer Pflege. Außerdem war der Transport in der Hauptsache immer noch auf Landstraße und Geschirr angewiesen, was ihm für größere Strecken unmöglich machte. Das Lehngerichtswerk Flöha hat im Jahre 1853 aber immerhin auf nicht unbedeutende Strecke geliefert, bis 7 Wegstunden weit; nämlich:
Der Hauptabnehmer war also das fiskalische Kalkwerk zu Raitzenhain. Ältere Einwohner sagen aus, daß von dort die Wagen mit Kalk beladen das Gebirge herunter kamen und als Rückfracht in Flöha Kohle luden. Anmerkung der
Redaktion: Genauso lief der Handel zum Beispiel zwischen den Pottschappler
Glaswerken und dem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Lehngerichtswerk unter Fink’s Leitung ist bis 1857 in Betrieb gewesen, von da an fehlt es im Verzeichnis der abbauenden Werke der Kohlenwerksinspektion Zwickau. Innerhalb der alten Anlagen war das Flöz, soweit es bauwürdig war, inzwischen wohl erschöpft, so daß Fink bei dem außerordentlich hohen Grundzins den Betrieb, als er unrentabel wurde, einstellte. In den nächsten Jahren trat im Flöhaer Lehngericht wieder Besitzwechsel ein, indem Rittergutsbesitzer Opitz es erwarb. Von ihm pachtete im Jahre 1861 der Steiger und Leiter des Kieber’schen Werkes, Schuhmann, die Abbaurechte auf Kohlen unter den Lehngerichtsfluren. Das Kieber’sche Werk näherte sich damals der Erschöpfung und so sah sich wohl Schuhmann rechtzeitig nach weiterer Betätigung um. Da das Lehngerichtskohlenfeld in der Gegend der alten Baue zwischen Ziegelei und Richter’s Feldern gänzlich von Fink abgebaut war, teufte Schuhmann mit 2 Mann Belegung einen neuen Schacht am Ostrande der vorderen Ulbrichtschlucht in der Nähe des alten Stollenmundloches ab. Das ganze Unternehmen kostete viel Geld, das Schuhmann nicht wieder herauswirtschaften konnte. Die zu durchsinkende Porphyrtuffdecke erwies sich als ungewöhnlich stark, so daß man 1861 überhaupt noch nicht auf Kohle stieß. Erst 1862, nachdem man 28 ½ m Tuff und nahezu 6 m Kohlensandstein durchsunken hatte, traf man auf das hier 0,2 m starke Kohlenflöz. Unter dem Flöz fand man bei versuchsweisem Weiterschürfen nach tieferen Flözen noch 4 Ellen schwarzen Schieferton, dazu roten Sandstein. Von dem angetroffenen Flöz wurden 1862 in Örtern nach Nord und Süd ganze 600 Scheffel á 70 Pfg., mit 140 Tlr. Wert abgebaut, wobei die Arbeitslöhne für 6 Mann im Jahre 1862 allein schon 962 Tlr., zuzüglich der Materialkosten von 120 Tlr. und im Jahre vorher (1861) 106 Tlr. betragen hatten, sa. also 1.188 Tlr. Dabei fehlen noch die Arbeitslöhne für 2 bis 4 Mann von 1861, die in den statistischen Notizen des Kohlenwerksinspektors nicht angegeben sind. Im Jahre 1863 blieben die Flözverhältnisse weiterhin ungünstig, so daß östlich vom Schacht aller Betrieb aufgegeben wurde (das Flöz verdrückte sich) und der Abbau nur in westlicher und nordwestlicher Richtung erfolgte. Hier trat jedoch bald Wettermangel ein, so daß Schuhmann den alten verbrochenen Lichtschacht des Stollens (in Kind’s Gutachten von 1845 C genannt) wieder instandsetzte, um von diesem eine Wetterverbindung mit dem Förderschachte herzustellen. Nach Süden, in der Fallrichtung des Flözes, besserten sich diese etwas; einn Vorgehen in diese Richtung war aber namentlich durch die sich im Fallen sammelnden Wasser ausgeschlossen. Beim Arbeiten im Wetterschacht verunglückte 1863 der Bergarbeiter Steyer. Die Förderung im Jahre 1863 deckte mit 1.384 Scheffeln mit 322 Tlr. 28 Ngr. Wert noch immer nicht den Aufwand von 284 Tlr. an Löhnen für 4 Arbeiter und 65 Tlr. für Material, sa. 349 Tlr. Zwar stieg die Förderung 1864 auf 1.813 Scheffel = 423 Tlr. 1 Ngr. (á 70 Pfg. der Scheffel), aber da die Flözverhältnisse nach dem Steigen und Streichen hin immer ungünstiger wurden, stellte Schuhmann den Betrieb im Frühjahr 1865, wo er mit 2 Arbeitern noch 586 Scheffel gefördert hatte, endgültig ein. In den Analysen Stein’s (siehe Kapitel V) ist die Kohle des Lehngerichtswerkes nicht mit enthalten; sie hat aber größtenteils zu den schlechtesten des Flöhaer Beckens gehört. Geinitz sagt in seiner „Flora“, daß sie eine magere, ziemlich unreine Schieferkohle war, aus welcher gewöhnlich die härteren Zwischenlagen ziemlich mühsam ausgeschieden werden mußten. Trotzdem erlangte man damit nur eine Kalkkohle. Die darin enthaltenen dünnen Pechkohlenschichten waren sehr spröde und von einer sich dem Anthrazit nähernden Beschaffenheit. Dazwischen fanden sich zuweilen rosafarbener Braunspat und Kupferkies, sowie auch quarzharte Schieferstücken oder Brand, die verkieseltem Holze sehr ähnlich waren. Gerade der Reichtum dieser Kohle an dünnen Schieferlagen aber, der ihre Güte herabsetzte, erlaubte Geinitz einen sicheren Einblick auf die organischen Einschlüsse, die diese Kohlen geschaffen hatten (vorallem Noeggerathia palmaeformis Goepp. und Noeggerathia crasza Goepp.).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.) Im Flöhaer
Pfarrwald. (Fiedler, Vogel, Hesse)
Vom gesamten Gebiet der nördlichen Karbonplatte des Flöhaer Beckens, wo auf Fluren von Flöha und Gückelsberg sich die leicht abzubauende obere, nachporphyrische Stufe erstreckt, war um das Jahr 1820 der zum Flöhaer Kirchlehen gehörige sogenannte Pfarrwald die einzige Flur, auf der Kohlenflöze noch nicht nachgewiesen und die Abbaurechte infolgedessen noch nicht vergeben waren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kein Wunder, daß sich
der Spekulations- und Unternehmergeist numehr auch mit diesem noch freien
Areal beschäftigte. Und zwar war es der Kaufmann und Fabrikbesitzer
Fiedler, Oederan, der schon die Gruben bei
Der Pfarrer Merkel gab das Gesuch an den Superintendenten in Chemnitz weiter mit dem Bemerken, daß nach dem Kohlenmandat der Grundbesitzer selbst abbauen müsse, wenn er fremde Unternehmer fernhalten wolle. Da ersteres für ihn als Pfarrer unmöglich sei, wäre es immer noch am besten, einem solche Garantien bietenden Unternehmer, wie dem Großkaufmann Fiedler die Konzession erteilt zu sehen, als einem anderen. Im übrigen könne die Flöhaer Pfarre, die im Kriegsjahr 1813 so stark ökonomisch gelitten, einen Zuschuß, wie den von Fiedler zu entrichtenden Tonnenzins sehr gut gebrauchen. As Oberkonsistorium Dresden war damit einverstanden, daß mit Fiedler weitere Verhandlungen gepflogen werden, wünschte aber, daß von den Forst- und Bergbehörden Gutachten hierzu eingeholt würden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So kam am 23. Juni 1822 zur vorläufigen inoffiziellen Lokal-Erörterung eine Kommission im Pfarrwalde zusammen, bestehend aus dem Superintendenten Unger von Chemnitz, dem Pfarrer Merkel, Flöha, dem Förster Lüttich, Plaue, dem Bergamtsassessor Haupt und Fiedler’s Sohn. Die zum ersten Einschlag ausersehene Stelle war neben dem Fahrweg des Richter’schen Gutes, der sich am Nordwestrande des Pfarrwaldes hinzieht, in der Nähe der Kieber’schen Baue. Dort befanden sich zwei lichte Stellen im Walde, so daß kein allzu großer Schaden durch die Halden entstehen konnte. Als Schippan durch die Anwesenheit der Kommission von den Verhandlungen hörte, teilte er sofort dem Justizamte Augustusburg mit, daß er auch Reflektant auf das Unterirdische des Pfarrwaldes sei und bat um eine Abschrift des Fiedler’schen Angebotes, um sein Angebot für den Abbau darnach zu stellen. Man ging aber nicht darauf ein, sondern beließ es bei den einmal eingeleiteten Verhandlungen mit Fiedler. Nach der stattgefundenen Lokalerörterung erstattete Bergamtsassessor Haupt ein bergmännisches Gutachten über die wahrscheinlichen Kohlenlager unterm Pfarrwald an das Justizamt Augustusburg, das zusammen mit der Superintendentur die Aufsichtsbehörde für das Pfarrlehen darstellte. Haupt begründet in dem Gutachten nochmals die Vermutung auf Fortsetzung der Kohlenflöze unter dem Pfarrwald, da dieselben schon auf der Nordseite des Waldes von Kieber, auf der Südseite von Schippan erschlossen waren und abgebaut würden. Eine gewinnbringende Förderung der dünnen Flöze, die oft getrennt abgebaut werden müßten, sei aber nur durch allerwirtschaftlichstes Gebahren zu erzielen. Es seien zunächst zwei Tagesschächte, wegen der Wetterzufuhr, abzusinken und dann nach genauer Untersuchung der Lage der Flöze ein Stollen heranzubringen. Später würden allerdings zum Abbau des ziemlich großen Feldes noch weitere 4 bis 8 Schächte nötig werden. 1/8 Scheffel Land würde dann durch jeden Schacht und dessen Halde allerdings bedeckt werden, doch habe die Ortsbesichtigung ergeben, daß an drei Punkten diese Schächte ohne großen Nachteil für die Forstwirtschaft möglich seien. Für die übrigen könnten die Einschlagstellen unter forstmännischer Beratung wohl so gefunden werden, daß nur wenige Stämme ausgehauen werden müßten; und die Abfahrwege könnten auf die für Windbruch ungefährliche Seite des Waldes verlegt werden. Im Freiberger Revier sei dieser Ausgleich mit den Forstinteressen schon oft mit Erfolg gefunden worden. Da der Flächeninhalt des Pfarrwaldes ungefähr 400 x 800 m war, so berechnete Haupt den Kubikinhalt an Kohle auf etwa 20.000 Kubiklachter (160.000 m³) für beide Flöze, die Flözstärke zu 25 cm angenommen. Nach vielseitiger Erfahrung ergab das 1.500.000 Scheffel Kohle (1 Kubiklachter = 8 m³ zu 75 Scheffeln gerechnet, unter Abzug aller tauben Mittel). Wenn man wegen unvorherzusehender Lagerungsstörungen zur Sicherheit die 500.000 Scheffel wegließ, so ersetzte die restliche Million Scheffel immerhin noch 100.000 Klafter Holz (10 Scheffel = 1 Klafter 1 ½- elliges Scheitholz). Dieser große volkswirtschaftliche Gewinn stand aber in keinem Verhältnis zu den geringen Verlusten an Holz und Waldboden durch die Halden, selbst wenn ein Windbruch, wie die Forstbehörde fürchtete, unvermeidlich war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diesen Standpunkt mußte denn auch der Revierförster Lüttich als Vertreter der Forstpolizei über den Pfarrwald anerkennen, nur machte er in seinem Anschlußgutachten zur möglichsten Vermeidung von Forstschäden folgende Vorschläge: 1.) Der Bau möge zunächst in dem sogenannten hinteren Teile des Pfarrwaldes (im Nordosten) begonnen werden, wo sich die drei für Schachtanlagen günstigen, lichten Stellen im hohen Baumbestand befanden. 2.) Wenn nötig, möchte sich der Abbau dann vom hinteren Teile nordöstlich nach der Hausdorfer Grenze hinziehen, da nach Süden zu junger Wuchs anstand, der durch die Halden schwer geschädigt werden und außerdem dem gefährlichen Südwestwinde ausgeliefert würde, wenn durch leere Stellen und Abfuhrwege sein Zusammenschluß zerstört sei. 3.) Es müßte darauf geachtet werden, daß der Unternehmer genau die Vorschriften des neuen Kohlenmandats von 1822 betr. Schadenersatz für Feldbenutzung übertage einhielte. 4.) Holz für den Bergbau könnte zur Zeit nicht aus dem Pfarrwalde geliefert werden. Nach diesen Vorschlägen der Forstbehörde hat dann im großen ganzen der später einsetzende Abbau auch stattgefunden. Am 10.3.1823 fand dann die im Kohlenmandat verlangte amtliche Erörterung der Abbauwürdigkeit von Seiten des Bergamts Freiberg und in Anwesenheit von Vertretern der genannten Kirchen- und Forstbehörde, sowie des Amtmannes von Augustusburg und Fiedler statt. Die Bauwürdigkeit der Flöze konnte natürlich nicht endgültig festgestellt werden, da weder Bohrungen noch Schürfe gemacht worden waren. Die genauen Konzessionsbedingungen sollten daher erst festgesetzt werden, wenn nach Einschlag in die Kohlenlager ein Urteil möglich war. Vorläufig wurde Fiedler nur das Recht eingeräumt, Versuche auf Steinkohlen im Pfarrwald anzustellen; dafür mußte er sich auch nur allgemein verpflichten, den Zehnten der Förderung an den Nutznießer des Pfarrwaldes, den Flöhaer Pfarrer, abzugeben und Anzeige zu erstatten, sobald er den wirklichen Abbau in Angriff genommen habe.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das bergamtliche Gutachten über diese erste offizielle Erörterung (später war noch eine zweite nötig) ist von Vizemarkscheider Gündel und einem Berggeschworenen verfaßt. Als Grenzen des Pfarrwaldes werden darin genannt: im Süden die Felder des Lehngerichts Flöha, im Westen solche des Pfarrgutes Flöha, im Norden Richter’s Grundstücke und im Osten Hausdorfer Flur. Daß die südlich und nördlich des Pfarrwaldes abgebauten Flöze auch das als solches erkennbare Steinkohlengebirge des Pfarrwaldes durchsetzten, wird nicht mehr in Zweifel gezogen. Zwar waren diese Flöze auf Kieber’s und Schippan’s Bauen sehr unregelmäßig (bei ersterem 25 bis 30 cm, bei letzteren bis 50 cm stark), wenn man aber für die zunächst liegenden Kieber’schen Baue ein Streichen von hor. 8,6 mit 10° bis 15° südwestlichem Fallen annahm, so folgte daraus, daß sie das Pfarrholz auf über 100 Ruthen Breite durchsetzten Zwar war die Kohle nach den ziemlich großen Vorräten auf den anliegenden Bauen nur Kalkkohle, aber der Abbau war ziemlich leicht und die Wasserhaltung gerade im Pfarrwald wohl nicht teuer; nötigenfalls konnte zur Entwässerung ein Stollen aus dem Grunde des Tellenbächleins oder vom Wetzelbach herangetrieben werden. Mit Berthelsdorfer Kohle gemengt, sollten die Flöhaer Kalkkohlen übrigens einen guten Brennstoff für Kalköfen abgeben, weshalb sich der Abbau für Fiedler als Besitzer der größten Berthelsdorfer Werke sehr gut eignete. Die Vorschläge Förster Lüttich’s betr. die Stellen für die ersten Schächte und die Richtung des Abbaues wurden für geeignet erklärt. Diesem Gutachten des Bergamts in den Akten des Justizamtes Augustusburg No. 46, Vol. I (jetzt bei der Amtshauptmannschaft Flöha) liegt auch eine Karte des Pfarrwaldes und der angrenzenden Grundstücke mit Einzeichnung von Kieber’s und teilweise Schippan’s Bauen bei. Indessen hatte es Fiedler mit dem Abbau der Pfarrwaldkohlen nicht eilig; es scheint ihm mehr darauf angekommen zu sein, sich das Gelände für später oder zu Spekulationszwecken zu sichern, denn in den nächsten Jahren erfolgte kein Einschlag darauf. Infolgedessen entstanden auch wieder andere Interessenten für die Pfarrholz-Kohlenlager. Hatte schon 1822 Schippan versucht, die Gerechtsame zu erwerben, so trat im Jahre 1829 Kieber mit dem Plane hervor, zu seinen Kohlenbauen auf Richter’s Flur einen Stollen von einem zum Pfarrgut gehörigen Felde aus zu treiben und dabei die bei der Durchquerung des Pfarrwaldgeländes etwa angetroffenen Kohlenflöze mit abzubauen. Es gelang zwar, den Kirchen- und Justizbehörden, die den Abbau im Pfarrwalde im Einverständnis mit Fiedler solange als möglich hinauszuschieben suchten, Kieber durch mündliche Rücksprache vorläufig von seinem Vorhaben abzubringen, aber im Jahre 1837 trat Kieber, dessen Kohlenfelder schon ziemlich weit abgebaut waren, aufs Neue und Bestimmteste mit demselben Ersuchen an die Behörden heran. Jetzt mußte Fiedler, um seine früheren Rechte zu erhalten, Ernst machen und den Beginn des Abbaues binnen Jahresfrist versprechen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 6.9.1838 kam dann nochmals eine Kommission der beteiligten Behörden und Personen im Pfarrwalde zusammen und bestimmte endgültig die Einschlagstelle, die jetzt weiter nördlich als vor 15 Jahren bei der ersten bergamtlichen Erörterung zu liegen kam, noch oberhalb des Tellenbächleins, 15 m seitwärts des sogenannten Pfarrweges. Da auch jetzt wegen endgültiger Konzessionserteilung noch keine Entscheidung getroffen werden konnte, mußte sich Fiedler, vertreten durch seinen Sohn, nur, wie seiner Zeit schon verpflichten, Anzeige zu machen, falls in dem an obiger Stelle begonnenen Schachte ein Flöz angetroffen wurde oder wenn er an anderer Stelle weiterschürfen bzw. das Unternehmen ganz aufgeben wollte. Im Übrigen sollten neben den Bestimmungen des Kohlenmandats die im Jahre 1823 getroffenen vorläufigen Vereinbarungen gelten. Mit Verordnung vom 7.11.1838 gab die Kgl. Kreisdirektion zu Zwickau ihre Zustimmung zu dem getroffenen vorläufigen Abkommen, behielt sich aber Prüfung der noch zu treffenden endgültigen Konzessionsbedingungen vor. Vom Jahre 1838 an baute nun Fiedler ohne besondere Intensität im Pfarrwalde ab; an Kalkkohle war in der ganzen Gegend jetzt kein Mangel und bessere Kohle fand sich nicht. Die in dem einzigen, 1838 begonnenen Schachte geförderte Kohle verbrauchte er fast ganz in seinem Kalkofen zu Memmendorf. Erst im Jahre 1841 machte sich das Abteufen eines zweiten Schachtes unbedingt erforderlich, da die Wetter in der einschächtigen Grube so schlecht wurden, daß das Grubenlicht nicht mehr brannte. Fiedler scheint das Gesuch um Genehmigung dieses zweiten Schachtes absichtlich möglichst lange hinausgeschoben zu haben, denn damit wurde bei den Behörden die Frage der endgültigen Regelung wieder akut, die ja eintreten sollte, sobald der Versuchsbau ein Kohlenflöz erschürft hatte. Fiedler förderte aber schon seit drei Jahren Kohle und hatte ohne Kontrolle den Zehnten an den derzeitigen Pfarrer von Flöha, Walter, abgeliefert, nach dessen Ableben aber in der Zeit der Pfarrer-Vakanz die Entrichtung ganz eingestellt. Auf eine behördliche Anfrage gab er die in dieser Vakanzzeit vom November 1839 bis Juli 1841 geförderte Menge auf nur 814 Scheffel an; für vorher geförderte 1.272 ¼ Scheffel hatte er den Zehnten mit 127 Scheffeln in natura an Pfarrer Walter abgeführt, der sie zu 6 Groschen pro Tonne (gleich 31 Tlr. 18 Gr.) verkauft hätte. Fiedler wollte auch jetzt noch seinen Bau als Versuchsbau angesehen wissen, da der Wert der Förderung die Abbaukosten noch nicht übersteige. Dieser Ansicht trat mit Verordnung vom 23.6.1842 die Kgl. Kreisdirektion Zwickau entgegen, indem sie gleichzeitig bestimmte, daß nunmehr endgültige Regelung der Konzession und der Abgaben einzutreten habe. Der noch nicht entrichtete Zehnt für die 814 Scheffel Förderung seit Ableben des Pfarrers Walter sollte als Grundstock für ein zu bildendes Pfarrkohlenkapital dienen, dem alle zukünftigen Abgaben für geförderte Kohle zuzufließen hatten, während der jeweilige Pfarrer von Flöha nur den Zinsgenuß dieses Kapitals hatte und zwar ungekürzt nach Abzug der Regiekosten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die endgültige Regelung der Konzession Fiedler’s fand am 20.9.1842 nach mündlichen Verhandlungen zwischen seinem Bevollmächtigten und den beteiligten Behörden statt. Es wurde bestimmt, daß die Kirchenvorsteher der Ephorie über das zu entrichtende Kohlenzehntel Kontrolle und besondere Rechnung zu führen hatten, die als Anhang der Pfarrholzkassen-Rechnung erschien und uns größtenteils erhalten ist. Die Förderungsstatistik des Pfarrwaldes konnte infolgedessen ziemlich lückenlos aufgestellt werden. Die Kirchenvorsteher hatten auch für die jeweilige zinsbare Unterbringung des Pfarrkohlenkapitals zu sorgen und die eingehenden Zinsen an den Pfarrer abzuführen. Fiedler mußte sich zu folgenden Bedingungen verstehen: 1.) Einen Nachweis für die seit November 1839 geförderten Kohlenmengen, für die er den Zehnten nicht abgeliefert hatte, zu den Akten zu geben. 2.) Wegen Kontrolle der Förderung sollte der jeweilige Pfarrer von Flöha jederzeit Einsicht in den diesbezüglichen Teil der Fiedler’schen Buchführung haben, auch Auszüge daraus verlangen dürfen. Weitere Kontrollbestimmungen behielt man sich vor, falls in Zukunft ein anderer als der in seiner Solidität auch höheren Ortes anerkannte Kaufmann Fiedler den Abbau übernehme. 3.) An Stelle der Naturalabgabe in Kohlen sollte das Äquivalent in Geld treten unter Zugrundelegung des jeweilgen ortsüblichen Kohlenpreises für die verschiedenen Kohlenarten. 4.) Für den dem Pfarrwaldboden zugefügten Schaden nußten 8 Tlr. für jeden Acker (zu 300 Quadratruthen) der Pfarrholzkasse ersetzt werden. Der bisherige Schaden wurde auf 4 Tlr. geschätzt. 5.) Zu den Unterhaltungskosten des von Fiedler als Abfuhrweg benutzten sogenannten Grenzweges, der auf der Flur des Pfarrgutes und des Flöhaer Lehngerichtes verlief, hatte Fiedler ⅓ beizutragen. 6.) Für neuangelegte Abfuhrwege mußte noch eine besondere Entschädigung nach Ermittelung durch die Forstbehörde gezahlt werden. 7.) Fiedler war haftbar für allen Schaden, den die bei seinem Kohlenbergbau beschäftigten Personen dem Pfarrlehen zufügten. 8.) Das Abteufen neuer Schächte und die Anlage sonstiger wesentlicher Hilfsmittel für den Abbau durfte nur im Einverständnis mit der Forstbehörde geschehen, die auch weiterhin die unbeschränkte Aufsicht über den Pfarrwald führte. 9.) Der Zehnte war halbjährlich Ende Juni und Dezember an den Kirchenvorsteher mit Lieferschein abzuführen. Der Vertrag wurde von der Kreisdirektion und dem Kultusministerium am 21.9.1843 in der Hauptsache genehmigt, nur wegen der Kontrolle der Förderung wurde bestimmt, daß Fiedler bei Abführung des Zehnten dem Pfarrer und dem Kirchenvorstand einen Auszug aus der Betriebsrechnung vorzulegen hatte. Ferner war die Entschädigung von 8 Tlr. für jeden Acker Holzboden, der dem Pfarrlehen entzogen wurde, jährlich zu entrichten, auch mußte Fiedler, oder wer in Zukunft an seine Stelle trat, sich verpflichten, bei etwaigem Erliegen des Abbaues alle Halden und Pingen auf eigene Kosten wieder einzuebnen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als Fiedler im Jahre 1850 starb, wurde der Abbau im Pfarrwalde vorläufig sistiert. Es war inzwischen ein dritter Schacht gesenkt worden, dagegen der von Fiedler bei den Verhandlungen früher in Aussicht gestellte Stollen vom Wetzelbach her, der die Waldkultur schonen sollte, noch nicht in Angriff genommen. Durch diese drei Schächte, ihren Halden und durch zwei neu angelegte Abfahrwege waren im ganzen 130 Quadratruthen Waldboden in Mitleidenschaft gezogen, also noch nicht ½ Acker. Da Fiedler’s Erben erklärten, den Abbau im Pfarrwalde unter den von ihrem Vater eingegangenen Bedingungen fortsetzen u wollen, traten sie nach einer am 7.2.1851 stattgefundenen Verhandlung in Fiedler’s Konzessionsrechte ein. Trotzdem wurde von ihnen der Betrieb nicht wieder aufgenommen; denn bei Nachprüfung der Bücher hatte sich ergeben, daß das Werk in der Hauptsache ohne Gewinn, manchmal mit Verlust gearbeitet hatte; und da man zur Fortsetzung des Abbaues nun endlich einen Stollen heranfahren mußte, war in den nächsten Jahren mit größeren Kapitalaufwendungen zu rechnen, deren Rentabilität bei der geringen Qualität der Kohle und dem auf dem Kohlenmarkt in dieser Zeit des Eisenbahnbaus drohenden Preissturz sehr fraglich war. Fiedler’s Erben wollten daher ihre Konzessionsrechte samt allen Verpflichtungen an den Steiger Vogel in Gückelsberg abtreten, dem das Werk schon in den letzten Jahren Fiedler’s pachtweise überlassen gewesen ist und der als Eigenlöhner schließlich zufrieden war, wenn er nur eine Vergütung für seiner Hände Arbeit beim Abbau herausschlug. Trotzdem sich dessen Ehefrau zur Eintragung einer Kautions-Hypothek von 250 Tlr. auf ihr Gückelsberger Grundstück bereit erklärte, trug die Kreisdirektion Zwickau Bedenken, Vogel die Konzession zu übertragen, da er bei Unglücksfällen, oder wenn der beabsichtigte Stollenbau unvorherzusehende Schwierigkeiten ergebe, nicht Garantie biete. Um ein fachmännisches Urteil über die Aussichten des Kohlenabbaus im Pfarrwalde zu haben, wandte man sich an den Markscheider Dietrich von der Kohlenwerksinspektion Dresden, der ohnehin auf Grund einer allgemeinen, im Jahre 1850 erschienenen Verordnung mit der Anfertigung eines Grubenrisses des Pfarrwaldwerkes beauftragt war. Nach Dietrich’s Gutachten vom 15.10.1852 war der am tiefsten nach dem Wetzelbach hin liegende Schacht des Werkes etwa 17 m tief, die beiden anderen je 24 m. In dieser Tiefe erreichten letztere das Flöz, während der erstere schon bei 14 m dasselbe durchfuhr, also noch 3 m tiefer ging und sich dann in einem angeblich 60 m tiefen Bohrloche fortsetzten, das bis 3 m unter den Flöhaspiegel reichte. Das Flöz war nur 0,14 m bis 0,19 m stark, bestand aus schwer brennender Kalkkohle mit schwachen Schnüren von Pechkohle, war kurzklüftig und enthielt viel Eisenkies. Verwerfungen und „Kämme“ störten häufig die regelmäßige Lagerung; Streichen hor. 5,4; Fallen 10° bis 15° in Süd. In dem dunklen bituminösen Schiefer, der das Deckgebirge bildete, befand sich zuweilen noch ein zweites Flözchen von 5 cm bis 7 cm Stärke. Mit dem erwähnten tiefen Bohrloche war keine weitere Kohlenlagerung entdeckt worden. Die geringe Mächtigkeit des Flözes an dieser Stelle und die Qualität der Kohle machten nach Dietrich’s Meinung einen größeren Aufschwung des Werkes unwahrscheinlich; denn obgleich die Kohle von den zahlreichen Kalkbrennereien der Umgegend gern und ziemlich teuer gekauft wurde (ein Scheffel immer noch zu 75 Pfg.), so wäre das Flöz doch zu schwach, um selbst bei wirtschaftlichstem Bau größeren Gewinn abzuwerfen. Die umliegenden Werke arbeiteten selbst bei einer Flözstärke von 0,5 m bis 0,6 m ohne großen Nutzen, da man bei dem Mangel an vorgebildeten Arbeitern in dieser Gegend hohe Arbeitslöhne (bis 3 Tlr. wöchentlich) zahlen müsse. Zudem wäre eine energische Wiederaufnahme des Abbaus, der nun bald drei Jahre ruhte, nicht ohne einen etwa 140 m langen Stollen vom Wetzelbach her bis zu diesem zunächst liegenden Schachte möglich. Infolge der Lage des Werkes am Berghange, und weil wahrscheinlich schon ein größerer Flächenraum abgebaut war, zeigten sich nämlich mit der Zeit große Wasserzugänge, die schließlich ein Ersaufen des Werkes herbeiführen mußten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trotz der nach Dietrich’s Gutachten wenig günstigen Aussichten des Pfarrwaldwerkes fanden sich doch noch andere, bessere Garantie leistende Unternehmer als der Steiger Vogel, die den Betrieb wieder aufnehmen wollten, in Person des Wirtschaftsbesitzers Christian Friedrich Hesse jun. zu Jägerhof, unterstützt von seinem Vater Chr. Gottl. Hesse zu Oederan. Beide besaßen zusammen in Breitenau ein Kalkwerk, zu dessen Betrieb sie jährlich 3.000 bis 4.000 Scheffel Kohle brauchten. Für die wirtschaftliche Unabhängigkeit dieses Werkes konnte der Bezug des nötigen Brennstoffes aus eigener Grube sehr wichtig werden. Vater und Sohn waren praktische Bergleute; Hesse sen. besonders war 30 Jahre lang Kohlensteiger gewesen (auf dem Kieber’schen Werk in Flöha); Hesse jun. hatte die letzten Jahre seit 1845 verschiedene Versuche gemacht, im Struthwalde Kohlen zu finden, aber ohne genügenden Erfolg. Da sie sich zudem zu jeder gewünschten Kaution in bar oder Hypothek verpflichteten (beide waren ansässig und begütert), sowie zur Fortsetzung des Abbaus nach bergmännischen Grundsätzen, entschied die Kreisdirektion Zwickau mit Verordnung vom 31.12.1852, daß die an Fiedler’s Erben übergegangene Konzession nach dem Kohlenmandat von 1822 durch mehr als einjährigen Nichtgebrauch erloschen sei, schlug das Gesuch um Übertragung desselben an den Steiger Vogel ab und genehmigte dafür das von den beiden Hesse’s. Da letzterer bald darauf seinen Anteil an der Konzession auf seinen Sohn übertrug, wurde mit diesem am 24.2.1853 der endgültige Vertrag abgeschlossen. Außer zu allen früheren Bedingungen mußte sich Hesse zu bergmännisch richtigem Betrieb verpflichten, ferner zu Schadenersatz an das Pfarrlehen, falls er den Abbau ein Jahr lang unterlassen sollte, für den entgangenen Zehnten. Die auferlegte Kaution betrug 500 Tlr. Nachdem Hesse noch eine alte, für die Konzession zum Abbau im Struthwalde auf seinem Grundstück lastende Sicherheitshypothek von 200 Tlr. hatte löschen lassen, erfolgte die endgültige Bestätigung seiner Abbaurechte zum 24.2.1855, aber bereits seit April 1853 hatte er in tatkräftiger Weise des Abbau im Pfarrwalde aufgenommen, nachdem ein in letzter Stunde aufgetretener Mitbewerber um die Konzession in Person des Wirtschaftsbesitzers Morgenstern, der auf eigenem Grundstück in Gückelsberg bereits auf Kohle baute, von der Kreisdirektion abschlägig beschieden worden war. Prof. Geinitz, der im Sommer 1853 auch Hesse’s Werk zur Sammlung paläontologischen Materials für seine Preisschrift besuchte, bemerkt darin anerkennend, daß der Betrieb wieder lebhaft im Gange war. Aus einer Anzeige der Forstbehörde über Holzdiebstahl im Pfarrwalde durch die Bergarbeiter des Hesse’schen Werkes geht hervor, daß 1855 sogar ununterbrochen Tag- und Nachtschichten verfahren wurden. Die Förderungsziffer hob sich infolgedessen bald auf eine Höhe, wie sie unter Fiedler unbekanntt war. Dieser hatte in den 12 Jahren seines Abbaus von 1838 bis 1850, wie in Kapitel V berechnet, nur 20.534,37 Scheffel abgebaut, also 1.600 bis 1.700 Scheffel im jährlichen Durchschnitt. Nach der Herder’schen Statistik hatte die Produktion im Jahre 1845 gar nur zirka 400 Scheffel mit 2 Arbeitern und einem Steiger (Vogel) betragen, so daß dabei die Bemerkung steht: „ein sehr unbedeutendes und mangelhaft betriebenes Werk, das sich nur notdürftig hinfristet und kaum Aussicht auf günstigeren Erfolg verspricht.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hesse dagegen förderte, nachdem er 1853 das Werk wieder instandgesetzt hatte, 1854 schon 5.810 Scheffel und teilte dabei dem Kohlenwerksinspektor mit, daß er an einer Mehrförderung nur durch das eindringende Wasser behindert worden sei; infolgedessen habe er nur ½ Jahr lang arbeiten lassen können. Um die Wasser zu bewältigen, nahm er schon in diesem Jahre den langgeplanten Stollen in Angriff. Im Jahre 1856 erhielt er die Erlaubnis, einen neuen Schacht abzuteufen und von diesem Jahre an steigt die Förderung auf über 10.000 Scheffel jährlich und hält sich auf dieser Höhe 10 Jahre lang, oft 12.000 Scheffel überschreitend. Eine 1856 vorgenommene Vermessung des Pfarrwaldes ergab, als für den Steinkohlenbau in Anspruch genommene Oberfläche 295 Quadratruthen, auch der äußere Umfang des Werkes hatte sich also seit Fiedler’s Zeiten mehr als vedoppelt (1850 noch 130 Quadratruthen). Um sich ganz seinem Werke widmen zu können, verlegte Hesse 1857 seinen Wohnsitz von Jägerhof, wo er Gemeindevorstand gewesen war, nach Flöha. Auch hier ist der tatkräftige und unternehmende Mann von 1863 bis 1868 Gemeindevorstand gewesen. 1858 bekam Hesse aufs Neue Erlaubnis, einen weiteren Schacht zu senken, 1859 wurden ihm sogar zwei neue Schächte genehmigt „wegen der schwierigen Zutageförderung der Kohlen.“ Sie lagen an schon bestehenden Wegen im Pfarrwald, so daß keine neuen Abfuhrwege nötig wurden, doch mußte Hesse zur Instandhaltung dieser mitbenutzten Wege beitragen. Durch die neuen Anlagen stieg die benutzte Fläche im Pfarrwald auf 1 Acker 89 Quadratruthen, von 1863 an aber wurden die alten Halden wieder bepflanzt, so daß Ende 1864 die benutzte Oberfläche wieder auf zirka ½ Acker gesunken war. Nach einer Statistik von 1858 beschäftigte Hesse bei 4 gangbaren Förderschächten 18 Arbeiter und einen Beamten; die Mächtigkeit der abgebauten Flöze hatte sich auf zusammen 1 Elle (0,57 m) gehoben, 1860 und 1861 gibt der Kohlenwerksinspektor die Stärke des oberen Flözes sogar bis 0,4 m, die des unteren mit 0,34 m an, zusammen 0,74 m. Das erste Flöz war durchweg anthrazitisch, während das untere viele Pechkohlenschichten führte. Die Kohle konnte monatelang an Luft lagern, ohne sich zu verändern. Die Zwischenmittel waren gewöhnlich zusammen nicht über 1 m stark. Wenn sie stärker waren, als die reine Kohle, so mußten zuweilen noch etwas Berge zutage gefördert werden, sonst wurden diese gleich wieder versetzt. 1861 waren 9 Örter gangbar. Die Flözverhältnisse waren übrigens sehr wechselnd, die Unregelmäßigkeit in der Lagerung sehr groß. 1862 hatten sich die bisherigen zwei Flöze in nördlicher Richtung in vier von derselben Gesamtstärke (bis 0,75 m) zerlegt, von denen aber mehrfach eins bis zum Verschwinden zusammengedrückt war. Ein besonders markantes Beispiel der Flözlagerung ist im Fahrjournal des Kohlenwerksinspektors von 1862 skizziert. Man sieht vier verschieden gekrümmte Flöze von 8 bis 10 Zoll Stärke übereinander liegen mit Zwischenlagen von 10 Zoll. Die beiden Hauptschächte waren 36 m und 40 m tief und standen von Tage nieder in Zimmerung (Bolzenschrot). Zu bergpolizeilicher Ausstellung gab das Werk im Gegensatz zu den Nachbargruben keinen Anlaß. Dieser günstige Befund des Werkes seitens der Bergpolizei wiederholt sich in den Berichten des Kohlenwerksinspektors viele Jahre lang, bis in den 1870er Jahren mit sinkendem Kohlenpreis und mangelhafter Ergiebigkeit auch die Einrichtungen dieses Baus mehr vernachlässigt und deshalb beanstandet wurden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1860 war auch der Entwässerungsstollen fertig; er war 160 m lang und brachte nach der Statistik von 1860 60 m Tiefe ein, auf 20 m Länge stand er in Zimmerung. Die Arbeiterzahl hielt sich bis 1865 druchweg auf 15 bis 20 Mann ohne den Besitzer als Aufseher und Leiter. Die Hauer standen im Gedinge und erhielten im Durchschnitt 4 Ngr. pro Scheffel, wobei der Besitzer die Förderungskosten zutage und den ganzen übrigen Aufwand trug. Nachdem im Jahre 1863 das Geschäft noch mittelmäßig stattgefunden hatte, hören wir 1864 zum ersten Male eine Klage gegenüber dem Kohlenwerksinspektor über mangelnden Absatz. Es war die kritische Zeit nach Einführung des Pfennigtarifs auf den Eisenbahnen, in der alle übrigen Werke des Flöhaer Beckens eingingen, außer dem Pfarrholzwerk. Die Hauptabnehmer der Flöhaer Kohle, die Kalköfen der nähern und weiteren Umgebung gingen mehr und mehr zur Anwendung von Koks aus dem Zwickauer, westfälischen und oberschlesischem Revier über. Schon von der über 13.000 Scheffel betragenden Förderung von 1862 waren zirka 2.000 Scheffel Vorrat übrig geblieben, so daß Hesse 1863 die Förderung auf zirka 10.500 Scheffel, 1864 sogar auf 8.250 Scheffel heruntergehen ließ, indem er die Arbeiterzahl auf 15 verringerte. Erst dadurch, daß er von 1865 ab den Verkaufspreis für die sclechtere Kohle bis auf 7 Neugroschen herabsetzte, konnte er vorübergehend wieder größere Mengen fördern; zudem ließ 1865 infolge des amerikanischen Bürgerkrieges die Konkurrenz der englischen Kohle in Deutschland nach, was einen allgemeinen Aufschwung aller deutschen Gruben bewirkte. Nur kam aber für das Pfarrwaldwerk hinzu, daß sich das Feld in der bisher bebauten nördlichen Richtung allmählig erschöpfte, so daß schon 1865 Hesse 300 m südlich vom bisher südlichsten Schacht neue Versuche anstellen ließ, mit denen man aber nur ein Flözchen von kaum 0,15 m Stärke ausrichtete. Nach dem Fallen in Richtung auf den Wetzelbach verschwand dies bald ganz, im Steigen wurde es kaum besser, so daß Hesse von 1866 ab den Abbau wieder nördlich der alten Schächte fortsetzte, aber nicht mehr in Richtung Nordost, sondern Nordwest. Als Folge des geringeren Ertrags des Werkes und des gesunkenen Verkaufspreises waren auch die Löhne im Gedinge herabgesetzt. Seit 1863 finden wir nur 35 Pfg. für Gewinn und Förderung eines Scheffels bis zum Schacht angegeben (vorher 40 Pfg.). Die Förderung erreichte 1866 nochmals die alte Höhe; im Zehntverzeichnis des Pfarrkohlen- Kapitals wird sie mit 12.575 Scheffeln angegeben, der Kohlenwerksinspektor beziffert sie auf 400 Scheffel pro Woche. Trotzdem fiel von nun an die Produktion infolge zunehmender Erschöpfung der Lager.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von 1867 ab war das Pfarrwaldwerk das einzige, das im Flöhaer Becken noch abbaute (abgesehen von Zießler’s vorübergehendem Versuche 1869/1870 auf dem Gückelsberger Werk). Der Kohlenwerksinspektor unterwarf deshalb 1868 das Werk einer speziellen Untersuchung, die wegen ihrer typischen Bedeutung hier wiedergegeben sei. Hesse’s Schächte hatten einen Querschnitt von 1 Elle 4 Zoll Breite bei 4 Ellen, 10 bis 12 Zoll Länge, wobei von der langen Seite zirka 1 Elle der Fahrschacht, zirka 3 Ellen der Ziehschacht einnahm. Die Teufe der jetzt gangbaren zwei Schächte lag bei 34 m, in Bolzenschrot stehend. Die einzelnen, in den kurzen Stößen auf Tragstempeln ruhenden Baufelder waren 3 Ellen hoch (1,7 m) und es gehörten zu jedem derselben zwei Geviere von Rundholz (Fichte), dessen Stärke beim älteren Schachte 5 bis 6 Zoll, beim anderen 6 bis 7 Zoll betrug. In den Schachtecken waren die Geviere durch 4 bis 5 Zoll starke Bolzen gegeneinander abgebolzt. Hinter dem Schrote waren die Stöße mit zölligen, nötigenfalls abgepfändeten Schwarten verzogen, jedoch nicht so dicht, daß nicht die Beschaffenheit des Gebirges dahinter zu untersuchen gewesen wäre. Der Fahrschacht war von Ziehschacht durch Einstriche, die bei jedem Geviere lagen und einen Bretterverschlag trugen, getrennt. Die saigeren Fahrten waren an dem einen der langen Stöße angebracht und zwar in solcher Entfernung von demselben, daß überall ein bequemes Auftreten auf die Fahrtschwingen (Sprossen?) möglich war und zugleich bei der geringen Weite des Schachtes jedes Joch des gegenüberliegenden Stoßes zum Sitzen benutzt werden konnte, ohne daß die Hand die Fahrtschwingen losließ. An der Haspel, gewöhnlich von nur einem Mann bedient, fehlte noch die durch die neueren Vorschriften bedingte, über die Hängebank hervorragende Hängekappe, ferner die Wehrstange und die Larve, auf welcher beim Bruche des Wehres der Rundbaum sich auflegen sollte. Die Rundbäume selbst lagen etwas niedriger als gewöhnlich; infolgedessen war es dem Haspler bei jeder Stellung des Horns möglich, dieses zu halten und gleichzeitig mit der anderen Hand den Förderkübel aus dem Schacht auf die Hängebank zu ziehen. Füllörter waren nicht vorhanden, das Anschlagen erfolgte von der am kurzen Stoße des Ziehschachtes abgehenden Strecke aus. Von verschließbaren Kauen waren die Schächte nicht umgeben, wohl aber von zirka 2,9 m hohen Halden. Nachts wurden sie zugedeckt. Die Hauptstrecke des neuen Schachtes von 1858 sollte in Bergmauerung versetzt werden, da man mit dem Schachte aus Versehen auf schon abgebautes Feld gekommen war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von 1869 an wurde bei zunehmendem Ausbau des Eisenbahnnetzes die Konkurrenz der westsächsischen Steinkohle aus Zwickau und Lugau-Oelsnitz sehr drückend für das letzte Werk im Flöhaer Becken. Waren 1867 immerhin noch 14 Arbeiter und ein technischer Leiter (der Sohn des Besitzers, Steiger Linus Hesse) beschäftigt, so war 1869 die Belegung auf 4 Mann gesunken. Hesse erklärte dem Berginspektor Förster aus Chemnitz (1868 war in Chemnitz eine selbständige Berginspektion eingerichtet worden, der die Werke im Flöhaer Becken mit unterstellt waren), daß er trotz der im allgemeinen dem Kohlenbergbau günstigen Absatzverhältnisse nicht mehr mit Gewinn zu arbeiten vermöge. Trotzdem versuchte er 1871 nochmals, günstigere Kohlenlager wieder im Nordosten des Pfarrwaldes zu finden. Nach dieser Richtung zeigte sich das Flöz des 1868 geteuften Schachtes eine Verbesserung. Dieser letzte Schacht des Pfarrwaldwerkes lag etwa 50 m nordöstlich des Schachtes von 1868, war 31 m tief und in Bolzenschrot, wie üblich. Die Entfernung der Tragestempel betrug 1,6 m, Bühnenloch und Anfall derselben waren bis auf 0,8 m in die langen Schachtstöße hineingelegt. Durch diesen neuen Schacht stieg die Förderung des Werkes vorübergehend nochmals 1871 und 1872 bis auf 6.000 Scheffel, ging aber dann schnell zurück. Für den Niedergang des Werkes zeugt, daß in diesen Jahren im Fahrjournal der Berginspektion Chemnitz (auszugsweise im Archiv des Bergamtes Freiberg erhalten) dauernd Ausstellungen des Berginspektors an dem Flöhaer Werk sich finden, was früher nie der Fall gewesen war. Oft mußte Hesse durch wiederholte Erinnerungen und Fristsetzung zur Einhaltung der bergpolizeilichen Vorschriften angehalten werden; diese waren allerdings jetzt auch viel weitergehend und verlangten, buchstabengemäß angewandt, zu viel von dem jetzt kleinen, unbedeutenden Werke. Im Sommer 1877 stellte Hesse zum ersten Male denn Betrieb bis zum Winter ein, wo der Absatz regelmäßig etwas besser wurde. Aber es kam zu keinem geregelten Abbau wieder. Nur noch wenige 100 Scheffel wurden in den Wintern bis 1880/1881 gefördert, am 30.6.1881 wurde das Werk als letztes im Flöhaer Becken endgültig auflässig.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Pfarrwaldwerk hat alle anderen im Flöhaer Becken um fast zwei Jahrzehnte überdauert, da es verhältnismäßig spät (1838) begründet worden war und weil die Kohlenlager teilweise stärker und besser als sonst auf Flöhaer Flur waren, besonders im nordöstlichen Teil des Feldes. Nur das Gückelsberger Werk war in dieser Beziehung noch günstiger gestellt gewesen. Dazu kam der tatkräftige wirtschaftliche Betrieb durch Hesse seit 1853, der das Werk auf eine Höhe brachte, die im Flöhaer Becken überhaupt nur von Schippan auf dem Gückelsberger Werk erreicht und in der besten Zeit wohl auch übertroffen worden ist. Die in Kapitel V über das Pfarrwaldwerk angegebenen Förderzahlen nach der Pfarrkohlenkasse aus den Akten der Ephorie Flöha sind oft niedriger, als sie der Kohlenwerksinspektor in seinen statistischen Notizen von 1860 bis 1867 und das Jahrbuch für Berg- und Hüttenwesen 1869 bis 1877 angeben. Das mag daran liegen, daß in den Abrechnungen mit der Pfarrholzkasse nur das wirklich verkaufte Quantum angegeben ist und ein Rest der Förderung als Vorrat ins nächste Rechnungsjahr übernommen wurde. Nach den statistischen Angaben ds Kohlenwerksinspektors hat die Förderung wiederholt 13.000 Scheffel jährlich überschritten. Über die Rentabilität des Werkes in seiner besten Zeit gibt folgende Ertragsrechnung Auskunft, die auf Grund der statistischen Angaben der Kohlenwerksinspektion Zwickau von 1862 aufgestellt ist (genauere Einzelheiten siehe Kapitel V).
...als Unternehmensgewinn einschließlich Vergütung für Arbeitsleistung des Besitzers als Steiger und Aufseher verblieben (das Steigergehalt hätte sonst etwa 150 Tlr. betragen.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu den Angaben über die Tiefe der verschiedenen, im Laufe der Zeit entstandenen Schächte des Pfarrwaldwerkes und die Stärke der dabei durchsunkenen Gebirgsschichten sei ergänzend hinzugefügt, daß nach Naumann 1864 ein Schacht etwa 17 m Tuff, dann 14 m durch Sandstein ging, bis er das Flöz erreichte, das in drei Bänken zusammen etwa 0,58 m Kohle führte. Die Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte geben summarisch die Stärke des Tuffs in Hesse’s Schächten mit 6 m bis 25 m, die des Sandsteins und Schiefertons mit bis zu 40 m an, nach den Akten, die sich mit Naumann’s Angaben decken, ist der tiefste Schacht nur zirka 40 m durch Tuff und Sandstein gegangen. Da das Pfarrwaldwerk gerade von 1850 bis 1852 stilstand, ist dessen Kohle bei Stein’s Untersuchungen nicht mit analysiert worden, doch gibt uns Hartig über ihre Zusammensetzung aufgrund der Analyse, die er vor seinen heizteichnischen Versuchen mit Hesse’scher Kohle vornahm, folgende Auskunft (in den Steinkohlen Sachsens, 3. Abteilung) über wasser- aber nicht aschefreie Kohle:
Die Pfarrwaldkohle war also von Durchschnittsqualität der Kohlen des Flöhaer Beckens. Weitere ausführliche Untersuchungsergebnisse der Pfarrwaldkohle in heiztechnsicher Beziehung, worin sie die einzige untersuchte des Flöhaer Beckens ist, siehe im Kapitel V. Im Pfarrwalde sind von 1838 bis 1881 zirka 211.000 Scheffel Kohle gewonnen worden, der entrichtete Zehnt beträgt 15.532,92 Mark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c)
Der Abbau
im Struthwald
1.) Fiskalische Versuche 1816 bis 1835 Schon gelegentlich der Schippan’schen Unterstützungsgesuche 1800 und 1811 war bei Besichtigung des Flöhaer Steinkohlengebirges von Geologen und Sachverständigen festgestellt worden, daß sich das Karbon nicht auf die Höhen der nördlichen Platte beschränkte, sondern südlich der Flöha und Zschopau weiterging in den Bereich des sogenannten Struthwaldes, der zum Plauer Revier der Augustusburger Amtswaldungen gehörte. Auch der Bergakademist Kaden, der für die erste geognostische Landesuntersuchung die Flöhaer Gegend bereiste, schloß sich dieser Ansicht über die Ausdehnung des Flöhaer Karbons an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als er 1816 in
amtlichem Auftrage wieder in dieser Gegend weilte (es sollten Alaunlager
bei Wiesa und Erdmannsdorf erschlossen werden; um Alaun war Sachsen damals
in Verlegenheit, da es nach dem Wiener Vertrag die
Dieses beauftragte den Vizemarkscheider Gündel mit einer näheren Untersuchung. Unter dessen Leitung wurde in der Nähe der Kohlenausstriche am Mühlflügel ein zirka 7,45 m tiefes Bohrloch angelegt und bei 2,30 m Tiefe ein 0,45 m starkes, bei 3,45 m Tiefe ein 0,87 m starkes Kohlenflöz erbohrt. Eine 40 m davon etwas tiefer angelegte Rösche legte das letztere Flöz bloß und zeigte, daß es hauptsächlich aus Kohlenschiefer mit eingeschlossenen Lagen von Steinkohle bestand. Da es in der Rösche, nur 1,15 m unter dem Rasen, 0,57 m stark war, beim Bohrloche aber in 3,45 m Tiefe schon 0,85 m, konnte man den Schluß ziehen, daß es nach der Tiefe zu mächtiger wurde. Da Gündel außerdem Kohlenausstriche südlich des Grünitzhübels am Wiesener und Hauptflügel, sowie am Fuße des Berges am Zschopauufer entdeckte, hielt man die Gegend für sehr aussichtsreich, indem man annahm, daß die Flöze am Zschopauufer ausstrichen, also durch Stollenbetrieb sehr gut abgebaut werden könnten. Daß die Ausstriche am Zschopauufer zur unteren Karbonstufe gehörten, war noch nicht erkannt. Wenn man, wie ernstlich erwogen wurde, bei Niederwiesa ein Alaunwerk anlegte, konnten die Kohlen des nur ¾ Stunde entfernten Struthwaldes gut gebraucht werden, zumal eine Anfrage beim Lehnrichter Schippan ergab, daß er für den Scheffel guter Schmiedekohle, wie sie in Brennereien nötig war, einschließlich Anfuhr bis Wiesa 1 Tlr. verlangte, einen ganz außerordentlich hohen Preis.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahre 1817 ließ das Oberbergamt die Gegend des Struthwaldes vom Markscheider Gündel aufnehmen. Der Riß ist in der Oberbergamtsakten No. 10556 erhalten, er zeigt einen Kohlenausstrich am Mühlflügel und drei solche in der Gegend der Kreuzung von Wiesener und Hauptflügel. Gündel hielt das im Vorjahr erbohrte Flöz am Mühlflügel für am bauwürdigsten und schlug vor, dort zunächst einen Schacht von 8 bis 10 m anzulegen und dann vom tiefen Graben oder auch vom Zschopauufer einen Stollen heranzubringen, wenn sich Bauwürdigkeit zeigte. Vorher ließ aber das Oberbergamt die Gündel’schen Ergebnisse vom Obereinfahrer Carl Amandus Kühn nachprüfen, der sie im allgemeinen bestätigte, aber vorschlug, daß man das Gebirge erst durch weitere Bohrungen an sechs bis acht Stellen vom Grünitzhübel bis zum Zschopauufer untersuchen sollte, ehe man zu großen Unternehmungen schreite. Höchstens zum Zwecke des Aufschlusses über die Qualität der Kohle könne man vorher am Mühlflügel, wie am Wiesener Flügel kleinere Versuchsschächte anlegen. Falls die Kohle brauchbar sei, wäre es allerdings für die ständig wachsende Industrie bei Chemnitz und Frankenberg, sowie für die vielen Kalköfen der Gegend, die noch größtenteils ihre Kohle aus dem Hainichener Becken beziehen müßten, sehr von Vorteil, die Lager abzubauen; ganz abgesehen davon, daß die Anlage eines Alaunwerkes bei Wiesa von Kohlenfunden in der Umgebung abhängig sei. Die Erfahrungen im Gückelsberger Steinkohlenwerk und im Hainichener Becken hätten bestätigt, daß Kohlenflöze von 0,57 bis 0,85 m Stärke in nicht zu großer Tiefe noch mit Nutzen abgebaut werden könnten. Daraufhin bewilligte das Kgl. Ministerium einen Vorschuß von 100 Tlr. zur Fortsetzung der Versuche im gedachten Sinne. Noch im Herbst 1817 und weiter im Frühjahr 1818 arbeitete man dann an dem Versuchsschachte am Mühlflügel, ohne jedoch auf das erbohrte 0,87 m starke Flöz zu stoßen, nur eine ganze Anzahl dünner Kohlenschmitzen durchsank man bis 16 ½ m Tiefe, nämlich bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da das zur Verfügung gestellte Geld fast verbraucht war, ohne daß man das erbohrte stärkere Flöz gefunden hatte, wurde erst weitere Anweisung beim Ministerium eingeholt. Diesem lag viel an der Klärung der Lage und so bewilligte es weitere Mittel, mit denen zunächst der angefangene Versuchsschacht weiter abgeteuft und ein zweiter am Wiesener Flügel begonnen werden sollte. Zur weiteren Erforschung der geologischen Verhältnisse sollte auch das von Kühn vorgeschlagene Nivellement mit einer Reihe von Bohrlöchern von der Höhe des Gebirges bis zum Zschopauufer vorgenommen werden. Die ganze Untersuchung wurde dem Oberbergamt unterstellt, das die spezielle örtliche Beaufsichtigung dem Bergamte Freiberg übertrug. Die Leitung erhielt Markscheider Gündel, der gleichzeitig ähnliche Versuche bei Ebersdorf leitete, die damals zur Wiederaufnahme des alten Steinkohlenwerkes Lichtenwalde durch die Grafen von Vitzthum führten. Der Versuchsschacht am Mühlflügel wurde im Sommer 1818 bis insgesamt 21 m abgeteuft und dann durch Bohrungen weitere 19 m fortgesetzt, da der Wasserandrang die Teufarbeiten erschwerte und sehr kostspielig machte. Hierbei fand man noch eine Schicht von 1,70 m Schieferton mit Lagen schlechter Kalkkohle; die letzten 5,70 m bohrte man in Porphyr, worauf man mit Recht den immer teurer werdenden Versuch einstellte, denn die obere Karbonstufe war damit schon bei 34 m durchsunken. Da der erhoffte Erfolg ausgeblieben war, ruhten die Versuchsarbeiten bis 1822, denn die Flözchen waren zu schwach und die Zwischenmittel zu stark, um Bauwürdigkeit zu ermöglichen. Die gefundene Kalkkohle stand außerdem noch hinter der Gückelsberg- Flöhaer zurück und war trotz aller Versuche nicht für Stubenfeuerung, noch weniger für feuertechnische Arbeiten zu gebrauchen. Außerdem sank gerade in jener Zeit der hohe Preis der Kalkkohle etwas, da jetzt auf Flöhaer Flur mehrere Unternehmer (Kögel, Kieber, Anke, Pötzsch) abbauten, so daß das Angebot größer war, als vorher, wo Schippan auf dem Gückelsberger Werk allein förderte. Hinzu kam noch das neue Werk der Grafen von Vitzthum auf Lichtenwalde, dessen Kohle zum Teil besser als die Flöhaer war. Bis Ende 1821 hatten die Versuchsarbeiten dem Staate 235 Tlr. (6) Ngr. 3 Pfg. gekostet. Nach den in den Bergamtsakten No. 3948 enthaltenen Abrechnungen und Lohntabellen waren bei den Arbeiten außer dem Versorger („Unterschichtmeister“) bis zu 7 Bergleute und Tagelöhner beschäftigt. Der Versorger bekam 12, später 16 alte Groschen pro Tagesschicht, ein Bergmann 10 Gr., ein Tagelöhner 8 Gr. Reichlich ein Jahrhundert früher hatte die Segen des Herrn- Fundgrube zu Altenhain ihren Hauern 4 Gr. Schichtlohn gezahlt; also eine Steigerung des Arbeitslohnes (und wohl damit verbunden Sinken des Geldwertes) um 150% von 1713 bis 1815. Die Stelle, wo der Versuchsschacht angelegt wurde, ist heute noch (um 1920) an einem ringförmigen Erdwall zu erkennen, der sich etwa 100 m südlich des Mühlflügels im Fichtenhochwald befindet, hart an der ersten Waldschneise, die östlich des Wegekreuzes Mühlflügel- Hauptflügel von ersterem nach Süden geht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1822 bewilligte das Ministerium erneut 500 Tlr. zur Fortsetzung der Untersuchungsarbeiten und zwar sollten nun ernstlich die von Kühn 1818 vorgeschlagenen Bohrungen vom Grünitzhübel bis zum Zschopauufer vorgenommen werden. Mitbestimmend für diesen Entschluß war ein Gutachten des Faktors Lindig, Zaukerode, der auf Grund geognostischer Untersuchungen mutmaßte, daß unter den bisher abgebauten und erbohrten Kohlenflözchen des Flöhaer Beckens in größerer Tiefe noch ältere Karbonschichten lägen, die, wenn nicht stärkere, so doch bessere Kohlenflöze enthielten. Zur wirklichen Ausführung der Bohrungen kam es jedoch erst 1827, nachdem im Jahre 1825 in einem Steinbruche am Fuße des Struthwaldes, der zum Bau der Flöhaer Brücke angelegt wurde, an der Vereinigungsstelle von Flöha und Zschopau eni bituminöses Schiefertonlager entdeckt worden war, von dem Amtsinspektor Kaden zu Augustusburg dem Ministerium Mitteilung gemacht hatte. Dieses bis 0,29 m mächtige Kohlenschieferflöz sollte Schichten guter, fetter Steinkohle enthalten haben und wurde auf Grund seines Streichens und Fallens mit den 1818 gefunden Flözen am Mühlflügel in Beziehung gebracht. Dadurch erwachte wieder die Hoffnung auf endlich doch günstige Resultate der jahrelangen Versuchsarbeiten. Man bohrte zunächst das Bohrloch I am Mühlflügel, also in der Nähe des Versuchsschachtes, 28 ½ m tief, jedoch lediglich im Porphyr ohne die geringste Spur von Kohle oder kohlebegleitenden Gesteins. Da man beim Bohrloch II in nordöstlicher Richtung am Berghange abwärts wieder 4 m tief nur Porphyr traf, legte man an den hangabwärts weiter projektierten Stellen für die Bohrlöcher III, IV, V und VI vorerst nur Schürfe an, die natürlich alle wieder auf Porphyr trafen, denn die Porphyrplatte erstreckt sich von dort fast bis zum Zschopauufer hinunter. Das Bohrloch VI, in 45 m söhliger Entfernung vom Zschopauufer, nahm man aber doch in Angriff, weil sich unterhalb desselben der 1825 entdeckte Schiefertonausstrich befand. Bei 25 m Tiefe hatte man den Sandstein (der unteren vorporphyrischen Karbonstufe) erreicht, aber noch nicht das den Ausstrich hervorrufende Flöz. Im Sommer 1828 setzte man hier die Bohrung noch bis 29 m Tiefe fort, aber ohne das Schiefertonflöz aufzufinden, so daß die Arbeiten wieder eingestellt wurden. Dafür begann man ein Bohrloch VII etwa 70 m südlich des Versuchsschachtes am Grünitzhübel, mit dem man nach 2,3 m Tuff den Kohlensandstein erreichte, der von der 54. bis zur 56. Elle (zwischen 30 und 32 m) Spuren von Kohle aufwies, womit man anscheinend die Flözchen erreicht hatte, die die Kohlenausstriche am Wiesener und Hauptflügel hervorrufen. Das Bohrloch wurde noch bis 44,5 m im Sandstein fortgesetzt, ohne daß man wieder auf kohlenführende Schichten stieß. Dann erreichte man die Porphyrplatte und gab das Bohren nach weiteren 2,3 m auf. Gesamtteufe des Bohrlochs mithin zirka 47 m. An keiner Stelle hatte man also das 1,70 m starke Kohlenschieferlager wieder feststellen können, das man 1818 beim Bohren im Versuchsschachte getroffen hatte; ebenso wenig die Kohlenflöze des Bohrlochs von 1817.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahre 1829 begnügte man sich, um doch endlich Klarheit über Ausdehnung und Bauwürdigkeit der Flöze im Struthwald zu erhalten, mit dem Anlegen von drei Schürfen, je 60 m auseinander, vom Versuchsschachte am Mühlflügel nach Südosten zu. In den ersten beiden traf man auf Porphyrtuff, im dritten auf Kohlensandstein mit Kohlenschmitzen. Bei Begehung des Geländes fand der Markscheider Franke, der seit 1828 die Arbeiten leitete, an dem vom Wiesner Flügel abzweigenden Eubaer Wege einen neuen Kohlenausstrich von fast 2 Ellen (1,14 m) Mächtigkeit, und nunmehr wandte sich das Interesse mehr dem westlichen und südwestlichen Teil des Struthwaldes zu, nachdem die Versuche nördlich und östlich des Grünitzhübels kein praktisches Resultat gezeitigt hatten. Zwar wurde im Jahre 1830 noch ein vierter Schurf in der Nähe des sogenannten Knochenhauses bei Bernsdorf angelegt. Da auch er auf Kohlensandstein stieß, wurde es klar, daß der Tuff des Grünitzhübels eine auf dem Kohlensandstein aufsitzende Kuppe war und daß sämtliche am Wiesener, Mühl- und Hauptflügel gefundenen Kohlenausstriche ein und derselben karbonischen Sandsteinschicht angehörten, die nach Westen zu wahrscheinlich stärkere Kohlenflöze führte, als im Osten. Infolgedessen verlegte man das Arbeitsfeld nunmehr in den westlichen Teil der Struth, wo man zunächst 1830 bis 1831 140 m südlich der Abzweigung des Eubaer Weges vom Wiesener Flügel ein im ganzen 73 Ellen (42 m) tiefes Bohrloch stieß, das folgende Schichten durchsank:
Obgleich man damit die Etage des Karbons noch nicht durchstoßen hatte, gab man die mit der Tiefe kostspieliger werdende Arbeit auf, da keine großen Resultate mehr zu erwarten waren; denn die Flöze, die die Ausstriche in der Nähe hervorriefen, mußten, nach ihrem Einschießen zu urteilen, längst durchsunken sein und waren wohl identisch mit den in der 22 ½ Ellen mächtigen Schiefertonschicht gefundenen verschiedenen Kohlenschmitzen. Die Hoffnung auf stärkere, abbauwürdige Lager von guter Kohle hatte sich also auch hier nicht erfüllt. Bergkommissionsrat Kühn und Prof. Naumann, die im Jahre 1833 die Örtlichkeit dieses Bohrloches besichtigten, hielten es nicht für unwahrscheinlich, daß das Bohrloch im Liegenden der ausstreichenden Flöze angesetzt war, da von den Ausstrichen bis zum Bohrloch das Gebirge schnell abfällt, so daß also die Flöze, deren Ausstriche sichtbar waren, gar nicht getroffen werden konnten. Jedenfalls waren aber die mit den fiskalischen Versuchsarbeiten erreichten Resultate von 1815 bis 1831 nicht derart, daß daraufhin ein gewinnbringender fiskalischer Kohlenbergbau wie im Plauenschen Grunde hätte eingerichtet werden können. Da auch fernerhin nach den eingehenden Untersuchungen und dem Urteil der Sachverständigen keine wesentlich günstigeren Ergebnisse in der Struth zu erwarten waren, verfügte das Ministerium Ende 1831 die Einstellung der Versuchsarbeiten. Allein die Versuche der letzten Jahre (1827 bis 1831), die bloß in Bohrungen und Schürfen bestanden, hatten 744 Tlr. 17 Gr. 9 Pfg. gekostet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nochmals aufgenommen wurden die Arbeiten allerdings im Jahre 1834 auf eine Anregung Prof. Naumann's. Dieser hatte bei seinen Revisionsarbeiten zur ersten geognostischen Landesuntersuchung im westlichen Teil des Wiesener Flügels nahe der Rainung mit dem Lichtenwalder Herrschaftsrevier, das sich an die Struth gegen Nordwesten hin anschloß, einige neue Kohlenausstriche entdeckt, die er wegen ihrer Breite und Güte der darin enthaltenen Kohlen für untersuchungswürdig hielt. Da zudem westlich dieser Ausstriche die hochkrystallinischen Sandsteine von Euba und Wiesa auftreten, über deren Zugehörigkeit zum Rotliegenden oder Karbon man nicht klar war, beantragte er erneutes Abteufen eines Versuchsschachtes in der Nähe der Kohlenausstriche am westlichen Rande des Wiesener Flügels und eines Schurfes noch weiter westlich davon, letzteres aus rein wissenschaftlichen Gründen zur Untersuchung der Kontaktverhältnisse des dortigen Tuffs und krystallinischen Sandsteins. Der Antrag wurde genehmigt und die Überwachung der Arbeiten dem Bergamts-Auditor Haupt übertragen, der Naumann’s Hilfsarbeiter bei der Erforschung des Gebietes gewesen war. Aus dessen umfänglichen Berichte über die im Sommer 1834 vorgenommenen Arbeiten geht folgendes hervor: Haupt fand schon vier, von dem Unternehmer und Bergmann Pötzsch, der uns wohlbekannt ist, in der fraglichen Gegend abgeteufte, aber wieder zugeworfene Schächte vor. Diese Versuche hatte Pötzsch kurz vorher eigenmächtig unternommen. Mit den drei westlichen Schächten war er bald auf die sich dort einschiebende Grundgebirgszunge (die Westgrenze des Flöhaer Beckens im engeren Sinne) gestoßen, der östlichste aber ging 8,50 m tief durch Steinkohlengebirge und hatte eine Kohlenschicht von 5 cm durchsunken. Um zunächst die Fallrichtung der austreichenden Flöze festzustellen, wurde ein 2,3 m tiefer Schurf angelegt, der ergab, daß das bis 0,57 m starke Flöz langsam nach Osten, also auf fiskalisches Gelände hin, einfiel. Es bestand aus Schichten von Brandschiefer, Schieferkohle, mineralischer Holzkohle und Pechkohle in geringer Menge. Daraufhhin wurde etwa 70 m östlich davon ein Schurf angefangen, der aber auf einen der hier auflagernden Tuff-Lappen stieß; als der Tuff bei 1 ½ m noch nicht durchsunken war, gab man die Arbeit auf und teufte etwa 30 m westlich davon einen Schacht. In diesem zweiten fiskalischen Versuchsschacht im Struthwald wurden folgende Schichten durchsunken:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem Fallwinkel der Schichten von etwa 10° in dem zirka 40 m westlicheren Schurfe hätte zwischen 11 und 12 Ellen Tiefe das 0,57 m mächtige Kohlenflöz des Schurfes wieder getroffen werden müssen. Stattdessen fand man nur zwei dünne Kohlenschmitzen in der 11. Elle. Man setzte nun die Untersuchung im Grunde des Schachtes noch 7 Ellen (4 m) durch Bohrung fort, fand aber nur Sandstein ohne Kohle. Das im Schurfe aufgedeckte Kohlenflöz mußte sich also in 40 m Entfernung schon zu den in 11 Ellen Tiefe des Schachtes gefundenen Kohlenschmitzen ausgekeilt haben, oder es hatte ein stärkeres Einschießen nach der Tiefe, als im Schurfe ersichtlich war. Haupt schlug daher vor, das Kohlenflöz unmittelbar vom Schurfe aus im Streichen und Fallen zu verfolgen und glaubte, daß durch die dabei abgebaute, verhältnismäßig gute Kohle die Kosten der Versuchsarbieten ganz oder teilweise gedeckt würden. Durch den 2. Teil der Haupt’schen Arbeiten, Schürfe am Abhange des Wachtelberges nach Oberwiesa, war unter anderem endgültig festgestellt worden, daß das Rotliegende auf dem Porphyrtuff aufliegt und daß die Katastrophe, die den Porphyrtuff gestaltete (Zeisigwald-Eruption), gewaltsamer Art gewesen sein mußte und zwar im Anfang der Periode des Rotliegenden. Da diese Untersuchungen nicht mehr streng in den Rahmen unserer Abhandlung gehören, beschränke ich mich auf diese Anführung der Hauptresultate, die heute ein feststehender Teil unserer geologischen Erkenntnis dieses Gebietes geworden sind. Die Verfolgung der Kohlenflöze in dem von Haupt aufgeworfenen Schurfe wurde noch im Herbst 1834 unter Anleitung von Prof. Naumann vorgenommen. Das Flöz, das erst 1 Elle (0,57 m) mächtig war, verschmälerte sich innerhalb der nächsten 7 m auf 13 Zoll (etwa 0,3 m), dafür trat aber etwa ½ m darüber ein neues, ebenso starkes auf. In den nächsten 5 bis 6 m sank die Mächtigkeit der Flöze auf 10 Zoll (24 cm). Sie bestanden aber aus sehr reiner, guter Kohle. Nach weiteren 3 ½ m hatten sich beide Flöze in einer Tiefe von 3 bis 4 m zu einem einzigen, 23 Zoll (0,64 m) starken Flöz vereinigt, das nun stark mit Schieferton verunreinigt war und sich rasch verschmälernd auskeilte, so daß einige Meter weiter keine Spur mehr zu finden war. Aufgrund der Akten über alle seit 1816 im Struthwalde unternommenen Versuchsarbeiten und der dadurch geförderten geognostischen Erkenntnis des Gebietes gaben dann Prof. Naumann und Bergkommissionsrat Kühn ein endgültiges Gutachten über das Steinkohlengebirge der nachporphyrischen Stufe im Struthwalde und seine Bauwürdigkeit ab, das in folgenden Hauptpunkten zusammengefaßt sei: Aus den letzten Versuchen im westlichen Teil des Struthwaldes gehe hervor, daß nach Norden und Osten hin rasche Verdrückung, Auskeilung und Heraushebung der verschiedenen Kohlenflöze stattfinde. Erwäge man indessen, daß der letzte Schurf ziemlich auf dem höchsten Punkte des Struthwaldes liege und daß das allgemeine Einfallen des Kohlensandsteines und der darunterliegenden Porphyrplatte nach Osten gerichtet sei, so könne es sich hier um eine örtliche Anomalie handeln; denn das Wiederauftreten eines Flözes nach seiner Verdrückung gehöre zu den häufigsten Erscheinungen. Da nun 1816 bis 1818 in der Nähe des Grünitzhübels an zwei Punkten ein 0,45 m bzw. 0,90 m starkes Flöz festgestellt worden sei, da ferner an verschiedenen Stellen des Wiesener und des Hauptflügels weiter östlich Kohlenausstriche liegen, die mit den Flözen am Grünitzhübel im Zusammenhange stehen dürften, so erscheine es immerhin möglich, daß zwischen der westlichsten Höhe des Struthwaldes und dem Grünitzhübel nach bauwürdige Kohlenlager seien, wenigstens in demselben Maße, wie nördlich Flöha und Gückelsberg. Die im letzten Schurfe gewonnene Kohle sei jedenfalls der Flöha- Gückelsberger gleichwertig. Andererseits ließe sich aus allen Versuchen schließen, daß die vorhandenen Flöze sehr unregelmäßig seien und daß die Resultate desto ungünstiger würden, je tiefer man in das Gebirge eindringe, so daß ein lohnender und nachhaltiger Abbau, wie er für fiskalische Werke nur in Frage käme, nicht zu erwarten sei. Die beiden einzigen nahe beisammenliegenden Versuche, welche etwas übereinstimmende Resultate lieferten, waren das 1817/1818 vom Markscheider Gündel am Mühlflügel niedergestoßene Bohrloch, das in 2,3 m Tiefe ein 0,45 m starkes, in 3,4 m Tiefe ein 0,9 m starkes Kohlenflöz erreichte, und der 46 m davon abgeteufte Versuchsschacht, der wenigstens bei 16 m ein 0,45 m starkes Flöz entblößte. Wenn man dartun könne, daß längs des Mühlflügels bis zum Hauptflügel ein Flöz von 0,45 m Stärke sich fortsetzte und nach dem Fallen zu zirka 60 m weit aushielte, so würde dies eine Kohlenmasse von zirka 360.000 Kubikfuß ergeben, die bei der geringen Tiefe, bei dem haltbaren und dorch nicht harten Gestein und der Trockenheit des Gebirges vielleicht von einem Unternehmer als Eigenlöhner noch mit Vorteil abgebaut werden könnten. Sollten also überhaupt noch Versuche in der Struth gemacht werden, so müßte man in dieser Gegend Bohrungen und Schürfe vornehmen, wogegen die Versuche im westlichen Teil der Struth als abgeschlossen gelten könnten. Auf dieses Gutachten hin wurden die fiskalischen Versuche auf Steinkohlen im Struthwalde 1835 endgültig eingestellt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die bei dem letzten Schurfe gewonnenen zirka 30 Tonnen Kohle wurden dem Kalkwerks- und Gutsbeistzer Kämpe in Erdmannsdorf für 3 Tlr. überlassen, da sie den Gebilden der Witterung und nächtlicher Entwendung sehr ausgesetzt waren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.) Privatuntersuchungen im Struthwalde (Pötzsch, Pötzsch’ens Witwe, Hesse, Thümer) Das Einstellen der Versuche auf Steinkohlen seitens des Staates im Jahre 1835 zerstörte die Hoffnung auf bauwürdige Kohlenlager in der Struth durchaus nicht, vielmehr wandte nun das Privatunternehmertum dieser Gegend besonderes Interesse zu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch im Jahr 1835 richtete der Großhändler Kögel, der uns vom Abbaue auf Ulbrichts’s Feldern in Flöha her bekannt ist, ein Gesuch an das Oberbergamt, die Versuche im Struthwalde in Gemeinschaft mit einigen anderen Unternehmern fortsetzen zu dürfen. Aufgrund des Mißerfolges der fiskalischen Versuchsarbeiten wurde vom Finanzministerium sein Gesuch abgeschlagen. Auch einem zweiten Gesuche Kögel's gegenüber blieb das Finanzministerium bei seiner ablehnenden Haltung, obgleich er darin geltend machte, daß zwar die Versuche von 1816 bis 1835 dargetan hätten, daß die Struthwaldkohlenlager für fiskalischen Abbau nicht in Frage kämen, daß aber ihre Bauwürdigkeit für einen Privatunternehmer nicht ausgeschlossen sei; denn dieser könne billiger fördern, da er keinen großen Beamten- und Verwaltungsapparat nötig habe. Daß der Abbau eventuell nur von kurzer Dauer sein könne, ein Hauptgrund, von einem staatlichen Unternehmen abzusehen, mache ihm wenig aus. Die Flöze seien zwar nicht stark und die Kohle keine der besten, aber für Kalköfen usw. gebe sie ein gutes Brennmaterial ab, ja nach genaueren Untersuchungen habe sich gezeigt, daß sie einen höheren Bitumengehalt habe, als die Flöha- Gückelsberger. Der geringe Schaden, der den fiskalischen Waldkulturen aus dem Abbau erwachsen könne, stehe in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, der der ganzen Gegend daraus erwachsen würde; denn die Werke nördlich der Flöha und in Gückelsberg hätten inzwischen die dortigen Flöze schon soweit abgebaut, daß sie jeden Tag verlassen werden könnten (damit meinte er wohl hauptsächlich sein eigenes Werk auf Ulbricht’s Feldern). Die Kohlen des Struthwaldes würden übrigens billiger verkauft werden können, da sie in außerordentlich geringer Tiefe lagerten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fast genau die gleichen Gründe machte Pötzsch in seinem auch 1835 an das Oberbergamt gerichteten Gesuche um Abbaukonzession geltend. Pötzsch ist der uns schon vom Flöhaer Kohlenbergbau her wohlbekannte Unternehmer, der schon von 1807 bis 1812 Steiger bei Schippan auf dem Gückelsberger Werke gewesen war, dann selbständig auf Ulbricht’s Feldern abbaute, aber in den Kriegswirren 1813 seine Grube von den Franzosen zerstört bekommen hatte; dann hatte er für den Vizerichter Richter von Flöha auf dessen Fluren ein Steinkohlenwerk eingeerichtet, das 1819 an Kieber aus Oederan überging, worauf Pötzsch seit 1820 auf Anke’s Feldern Kohle baute. Diese Lager waren nun aber erschöpft und Pötzsch mußte sich nach neuer Betätigung umsehen. Er hatte deshalb schon auf eigene Faust im westlichen Teil des Struthwaldes 1834/1835 vier kleine Versuchsschächte angelegt, bevor dort die letzten fiskalischen Versuche unter Haupt und Prof. Naumann einsetzten. Hier wollte er auch nach seinem Gesuche weiter arbeiten, denn die in dem letzten von Haupt angelegten Schurfe ausgebrachten Kohlen waren nach Aussage des Kalkofenbesitzers Kämpe, Erdmannsdorf, dem sie verkauft worden waren, recht brauchbar gewesen. Seine Eignung zum Bergmanne, seine Zuverlässigkeit und Unbescholtenheit, sowie seinen ehrlichen, friedsamen Charakter ließ sich Pötzsch durch Zeugnisse des Flöhaer Landgerichtes, der Amtshauptmannschaft Chemnitz und des Bauern Anke, für den er zuletzt gearbeitet hatte, bescheinigen; und da auch der Plauer Revierförster sowie das Forstamt Augustusburg Fürsprache für ihn einlegten und erklärten, daß für die Waldkultur in der von Pötzsch in Aussicht genommenen Gegend keine Gefahr vorliege, da der dortige Bestand ohnehin auf Abhieb angesetzt sei, daß es vielmehr wünschenswert sei, wenn die noch offenen Schürfe und Schächte der letzten fiskalischen Untersuchungen durch Pötzsch wieder zugeworfen würden, so ließ sich das Finanzministerium endlich 1836 herbei, die Konzession zur Fortsetzunbg der Versuche in der Struth Pötzsch in Aussicht zu stellen, wenn der zeitlich frühere Gesuchsteller Kögel seinen Anspruch auf Berücksichtigung zurückziehe. Zu diesem Entschlusse hatte auch das inzwischen abgegebene Gutachten von Prof. Naumann und Kühn beigetragen, das am Schlusse des vorangegangenen Abschnittes angeführt ist und wonach der Abbau im Struthwalde für einen Eigenlöhner wohl möglich war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Kögel sich seines Rechtes, von der Erlaubnis des Finanzministeriums Gebrauch zu machen, zu Gunsten Pötzsch’s begab, wurde dann zwischen letzterem und den Forst- und Verwaltungsbehörden ein provisorischer Vertrag abgeschlossen, wonach er die ihm zu seinen Zwecken eingeräumte Fläche ohne Genehmigung nicht überschreiten durfte, von jeder Tonne (hier = ein Scheffel) Steinkohle 6 Pfg. Grundzins bei vierteljährlicher Abrechnung zu entrichten und deshalb über die Fördermenge Buch zu führen hatte; alle nicht mehr benötigten Schächte waren sofort wieder zuzuwerfen und für alle Schäden, die durch den Betrieb oder seine Arbeiter der Waldkultur zugefügt wurden, haftete Pötzsch. Die Abbaurechte sollten nicht vererbbar sein, vielmehr ihr Ende finden, wenn die Versuche ohne Aussicht auf Erfolg waren. Für den Fall einer besonders großen Ergiebigkeit wurde Schließung eines neuen Vertrages mit anderen Bedingungen vorbehalten. Schließlich mußte Pötzsch noch eine Kaution von 50 Tlr. für Erfüllung des Vertrages stellen, die hypothekarisch auf sein Haus in Wiesa eingetragen wurden und sich der Aufsicht des Bergamtes unterwerfen. Später, im Jahre 1838, stellte noch der Besitzer des Pfarrkohlenwerkes, Fiedler, sowie eine Gruppe von drei Einwohnern aus Niederwiesa, Flöha und Gückelsberg an die Forstbehörde Gesuche um Konzession zum Abbau in der Struth (besonders in der unteren Karbonstufe an der Prallstelle von Flöha und Zschopau), die aber nicht genehmigt wurden, da Pötzsch schon die Konzession innehatte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch im Jahre 1836 begann Pötzsch den Abbau im westlichen Teile der Struth, indem er drei kleine Tagesschächte senkte, aus denen er auf einer Fläche von zirka 1 Acker über 1.500 Scheffel förderte. 1837 konnte er wegen Wassers nicht weiter, bis ihm ein neuer Schacht gestattet wurde. Bis zum Jahre 1840 baute er dann jährlich im Durchschnitt über 2.000 Scheffel ab, so daß er die Aufmerksamkeit der Forstbehörde erregte, die entsprechend weiter berichtete und seinen Betrieb als Raubbau bezeichnete. Da der Fall des Vetrages von 1836 gegeben schien, daß bei wider erwarteten reichlichem und anhaltendem Abbaue ein neuer Kontrakt geschlossen werden könne, ließ das Oberbergamt eine Besichtigung von Pötzsch’s Werk vornehmen. Hierüber gab der Berggeschworene Hoffmann folgendes Gutachten ab: Von 1836 bis Mitte August 1840 hatte Pötzsch 8.519 Tonnen Kalkkohle verkauft, wobei noch einmal darauf hinzuweisen ist, daß unter „Tonne“ das hier ortsübliche Maß, das ungefähr einem Dresdner Scheffel entsprach, zu verstehen ist. Der Abbau umfaßte eine Fläche von zirka 4 Acker. Der Scheffel Struthwaldkohle wurde mit 62 ½ Pfg. verkauft, einem immer noch hohen Preise in Anbetracht des damaligen Verkaufspreises von 25 Pfg. für Kalkkohle im Plauenschen Grunde; aber das Fehlen billiger Beförderungsgelegenheiten hielt den Kohlenpreis der industriereichen Gegend auf dieser Höhe, bis Eisenbahnen gebaut wurden, ja ließ ihn in der Folgezeit noch steigen. Um den Reinggewinn Pötzsch’s zu ermitteln, stellte Hoffmann folgende Berechnung auf: Die Kohlen kamen gewöhnlich in zwei sehr veränderlichen Flözchen vor, von denen das obere 7 cm bis 14 cm, das untere 17 cm bis 24 cm stark war. Bei gelegentlich größerer Mächtigkeit nahm gewöhnlich die Verunreinigung mit Schieferton so zu, daß man mit einem Durchschnitt von 0,3 m rechnen konnte. Die Förderkosten einschließlich Wasserhaltung nahm Hoffmann auf Grund der genau untersuchten örtlichen Verhältnisse mit 2 Tlr. im Gedinge für das Lachter bei 3 Fuß Ortsweite und 4 Fuß Ortshöhe an, also für eine Förderung von ungefähr 11 Tonnen bis zu Tage. Da der Verkaufspreis für 11 Tonnen zu 5 alte Gr. (zu 12 Pfg., 24 Gr. = 1 Tlr. = 3,02 Mark) 55 Gr. ergab, wovon noch der Grundzins von 11 x 6 Pfg. = 5 Gr. 6 Pfg. abging, so bedeutete das einen Rohgewinn von 1 Gr. 6 Pfg. für 11 Tonnen oder von 1,7/11 Pfg. pro Tonne. Davon waren die Anschaffung und Unterhaltung des Gezähes, der Fördergefäße, Seile, Pumpen usw., sowie die allerdings geringen, aber doch ab und zu vorkommenden allgemeinen Unkosten zu bestreiten, so daß Pötzsch außer Vergütung der Arbeitskraft für sich und seine Familienangehörigen, die mitarbeiteten, kaum ein Unternehmensgewinn übrig blieb. Selbst um diesen Arbeitslohn herauszuwirtschaften, konnte Pötzsch nur einen höchst mühseligen und ärmlichen Bau unterhalten. Da die Flöze äußerst unregelmäßig waren, sich häufig sogar innerhalb kurzer Strecken mehrmals ganz verdrückten, waren in den meist sehr nahe unter Tage liegenden Bauen nie lange Strecken getrieben, sondern in kurzer Entfernung voneinander Schächte abgeteuft. Auf diese Weise brauchte man nicht viel Zimmerung einzubauen, lange auf Strecken zu fördern, hohe Halden aufzustürzen, beim Auffüllen die Berge auf Strecken weit fortzuschaffen, Vorkehrungen für die Wetterregelung zu treffen oder die verdrückten Flöze durch Querschläge zu suchen. Pötzsch durchwühlte so allerdings einen großen Teil der Oberfläche, aber das war ohne großen Nachteil, da sich in der Gegend seiner Baue mehrere unbepflanzte Blößen befanden, die er ausnutzte, ohne das Holz geschlagen werden mußte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnittsvergrößerung aus obigem Riß mit der Eintragung mehrerer „alter verbrochener Schächte“ südlich und der 1845 aktiven Tagesschächte und „Kohlenstrecken“ nördlich des Wiesner Flügels. Unten ein Saigerriß, aus dem hervorgeht, das in der Sohle des nördlicheren der beiden alten Schächte südlich des Wiesner Flügels noch ein Bohrloch gestoßen, mit diesem das in den aktiven Kohlenbauen nördlich des Wiesner Flügels abgebaute Flöz aber offenbar nicht angetroffen und eingezeichnet wurde. Der kleinräumige unregelmäßige Abbau durch Pötzsch, welcher der Bauwürdigkeit des Flözes folgte, ist im Grundriß gut zu erkennen. Abgebaute Bereiche wurden schnell wieder liegen gelassen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoffmann nennt die Betriebsart Pötzsch’s zwar erbärmlich, aber sie war nach seinem Urteil auch die einzig mögliche, um die nach Menge und Güte geringwertige Kohlenablagerung in dieser Gegend noch wirtschaftlich abzubauen. Sie war auch im bergmännischen Sinne nicht schlechthin Raubbau, da damit in keiner Weise ein augenblicklicher Vorteil einem für kommende Generationen möglichen größerem vorgezogen wurde. Der ausgebrachte Schieferton verwitterte übrigens bald und zeigte schon nach kurzer Zeit wieder Vergetation. (Wie P. Kleinstäuber hier in einer Fußnote vermerkt, war zu seiner Zeit das ganze Gelände wieder mit jungen Fichten und Kiefern bepflanzt, die allerdings nicht besondere Kräftigkeit aufgewiesen hätten.) 1840 waren durch Pötzsch die Kohlenflözchen nördlich des Westteils des Wiesener Flügels bis auf geringe Reste abgebaut. Ein Schacht war noch im Gange, die anderen meist wieder zugeschüttet, der Abbau zog sich nun nach Süden und Südwesten, wo bereits zwei neue Schächte – nur 8 bis 9 m auseinander – angelegt waren, der eine 7 ½ m, der andere 10 m tief; in letzterem war das Flöz erreicht. Infolge größerer Tiefe und Festigkeit des Deckengebirges, meint Hoffmann, würde es hier nicht mehr so leicht möglich sein, Schächte in solcher Anzahl wie nördlich des Weges abzuteufen und da auch hier einige Waldblößen vorhanden waren, konnte der Abbau noch einige Jahre ohne größeren Schaden für die Waldkultur fortgesetzt werden. Einen großen, nachhaltigen Umfang würde er aber kaum jemals annehmen, in dieser Beziehung hätten Pötzsch’s Arbeiten nur die früheren Versuche des Fiskus bestätigt. Zum Herantreiben eines tiefen Stollens oder zu einer anderen größeren bergmännischen Anlage konnte nicht geraten werden, zumal alle Versuche ein umso ungünstigeres Resultat geliefert hatten, je tiefer sie ins Gebirge eingedrungen waren. Auch stand jetzt geologisch ziemlich fest, daß die ganze obere Karbonstufe von der bekannten Porphyrplatte unterlagert wurde. In den nächsten Jahren ging die Aufsicht über den Kohlenbergbau im Struthwalde an das Bergamt Marienberg über. Die diesbezüglichen Schriftstücke sind am Aktenstück Lit.St.Nr. 3292 des Bergamts Marienberg, jetzt im Freiberger Archiv, aufbewahrt. Im Jahre 1842 teufte Pötzsch nach den Akten der Oberforstmeisterei Zschopau weitere zwei Schächte in der Unterabteilung 15e an der Schneise 5 des Struthwaldes ab, aber ohne Kohle zu finden. Er versuchte es dann in der Abteilung 6e mit besserem Erfolge. Hier war schon in 2,85 m Tiefe ein Kohlenflöz von 0,18 m bis 0,22 m Stärke. Im Oktober 1842 beschäftigte Pötzsch 5 Arbeiter bei steigender Fördermenge. Da wurde er plötzlich geisteskrank. Er befahl seinen Arbeitern trotz ausdrücklichen Verbots der Forstbehörde, anstehenden Wald in größerem Umfange umzulegen. Zur Rechenschaft gezogen, beging er allerhand Exzesse und starb dann im Frühjahr 1843 im Irrenhaus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seine Witwe hatte große Schwierigkeiten, die Erlaubnis zur Weiterführung des Baues zu bekommen. In einem ihrer Gesuche darum gibt sie an, daß Pötzsch den Rest seines Vermögens in den Steinkohlenbergbau gesteckt habe. Die Wechselfälle des Abbaus und die damit verbundenen Gemütserregungen hätten wahrscheinlich seinen Geist zerrüttet und die Krankheit gerade in dem Augenblick ausbrechen lassen, wo er durch Auffinden besserer Flöze seine jahrelangen Bemühungen belohnt gesehen hätte. Nach wiederholten dringenden Bittgesuchen, in denen sie auf ihre völlige Mittellosigkeit hinwies, da alles Vermögen in dem Steinkohlenbau steckte, wurde dann der Johanna Dorothea, verw. Pötzsch trotz anderer, kapitalkräftigerer Mitbewerer (darunter schon damals Hesse) der Weiterbau gestatttet, der nun zu einer bisher nicht erwarteten Höhe in der Förderung anwuchs. Schon im Jahre 1843 hatte die Witwe Pötzsch 6 Arbeiter, 1844 überschritt die Förderung zum ersten Male 3.000 Scheffel, um später bis fast auf 10.000 Scheffel zu steigen. Diese Erfolge bewirkten, daß die Forstbehörde schon 1843 durch Sachverständige des Bergamts Marienberg erneut ein Gutachten über die Ertragsfähigkeit und Aussichten des Steinkohlenbergbaus in der Struth, eventuell bei fiskalischem Betriebe, anfertigen ließ, aus dem folgendes hervorgeht: Der Abbau wurde in der Parzellennummer 6e (die ist noch heute – 1920 – dieselbe) unmittelbar neben dem Wiesener Flügel betrieben, gewöhnlich durch 4 bis 7 Arbeiter. Der zuletzt zur Förderung benutzte Haspelschacht stand unter einem Bretterdach und war bis zur Abbaustrecke nur etwa 7 ½ m tief, ging allerdings noch 3 m tiefer, da man infolge einer Verwerfung das Flöz beim Niederbringen des Schachtes erst in 10 ½ m Tiefe angetroffen hatte. Die in 7 ½ m Tiefe abgehende Strecke konnte man 30 m weit befahren, dann war sie wieder durch Abraumberge versetzt. Von ihr aus war das Flöz durch Steig- und Fallörter abgebaut worden. Die zuletzt abgebauten Steigörter befanden sich 16 m und 30 m vom Schacht entfernt. Bei 23 m zweigte sich von der Hauptstrecke eine zweite Strecke ab, die 24 m weit befahrbar war. Beide Strecken waren im Norden durch Abbaue verbunden gewesen, jetzt aber wieder versetzt. Außerdem ging bei 12 m Entfernung vom Schachte noch eine dritte Strecke von der Hauptstrecke ab, die wieder zugeworfen war. Das Kohlenfeld war von diesen drei Strecken aus so weit abgebaut, daß nur noch längs der beiden offenen Strecken schmale Streifen von 2 m bis 3 m anstanden. Alle abgebauten Räume waren durch Bergeversatz oder Stehenlassen von Pfeilern hinlänglich verwahrt. Das ungefähr 0,7 m bis 0,9 m starke Kohlenschieferflöz enthielt zwei bis drei Kohlenschmitzen in der Gesamtmächtigkeit von etwa 0,3 m größtenteils ziemlich unreiner Kalkkohle, nur ab und zu dünne Schichten von Pechkohle. Die Kohle zerbröckelte bei der Gewinnung gewöhnlich zu kleinen Stücken und brannte fast ohne Flamme. Nach dem Fallen des Flözes sollte es mächtiger und besser werden. Dieses Fallen betrug 10° bis 15° nach Westen, mit wechselndem Streichen zwischen hora 11 und 2, so daß das Flöz eine sich nach Westen verflachende Wanne bildete. Über die ganze Anlage des Baues befindet sich eine Skizze im Aktenstück Nr. 3292. Die Arbeiter bekamen für die Förderung von drei Kübeln = 1 Scheffel bis unter den Schacht 19 Pfg. und erreichten bei 5 bis 6 Scheffeln Förderung einen Tagelohn von etwa 1,0 Mark. Der Schichtlohn für Schachtabteufen, auch für die Arbeit des Haspelknechtes betrug bloß 87 Pfg. (7 alte Groschen). Holz, Schmiedekosten und alles sonstige Material trug die Besitzerin. Um die Kohlen wegen des zu zahlenden Grundzinses zu messen, befand sich über Tage ein großer Kasten von 56 Scheffeln Inhalt, in den die Kohlen gestürzt wurden. Der Verkaufspreis pro Scheffel am Platze war 6 bis 7 ½ Neugroschen. Auf Grund ihrer Besichtigung gelangten die Marienberger Sachverständigen zu folgendem Gutachten: Ein Abbau der schwachen Kohlenflöze durch die Forstbehörde selbst war nicht anzuraten, da die ungleich größeren Verwaltungskosten nicht gedeckt würden. Bei der Unregelmäßigkeit und geringen Ausdehnung der Flöze war vielmehr das Überlassen des Abbaus an Privatunternehmer der einzige ratsame Weg, diese Kohlen für den Fiskus als Grundbesitzer nutzbringend zu machen, zumal der Grundzins von 6 Pfg. beinahe den Zehnten des Verkaufspreises betrug. Ein Schaden für den Wald durch Senkung war bei den getroffenen Vorsichtsmaßregeln nicht zu befürchten. Wenn der Grundzins erhöht werde, dürfte sich kaum noch ein Unternehmer für den Abbau finden, der dann sicher unlohnend wäre.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf dieses Gutachten hin mußte die Forstbehörde ihre Absicht, den Kohlenabbau im Struthwald in eigene Regie zu nehmen, zurückstellen. Trotzdem wurde die Frage nochmals aufgerollt, als die verwitwete Pötzsch 1845 um Erlaubnis zum Abteufen zweier neuer Schächte nachsuchte. Eine gemischte Kommission aus dem Bergmeister Hering von Marienberg, seinem Bergschreiber, dem Oberforstmeister Freiherr von Manteuffel aus Zschopau und dem Revierförster Lüttich aus Bernsdorf, sowie dem Rentamtmann Kaden, Augustusburg, nahm am 12.11.1845 nochmals eine eingehende Lokalerörterung vor. Aus dem Protokoll hierüber geht hervor, daß in letzter Zeit durch Versuchsarbeiten zwei neue Kohlenausstriche bloßgelegt waren. Der eine befand sich auf Grund und Boden des Försters Lüttich in Bernsdorf am linken Zschopauufer mit einem Streichen von hora 8 und Fallen von 40° nach Nordost, 60 m nordwestlich davon war ein 8 ½ m tiefer Schurfschacht von Lüttich darauf gesenkt worden, der aber, angeblich in Porphyr verlaufend, das Flöz noch nicht erreicht hatte. Dieses war am Ausstrich 1 m stark, bestand aus Schieferton und Sandstein und hatte im Hangenden Porphyrtuff. Der zweite Kohlenausstrich war durch einen Sandsteinbruch bloßgelegt worden, der am selben Zschopauufer weiter abwärts gegenüber der Hauss’schen (?) Spinnerei lag. Er bestand bei etwas geringerer Mächtigkeit nur aus schwarzem Schieferton mit Fallen nach Südwesten hora 3, sein Hangendes soll Sandstein, sein Liegendes Porphyrtuff gebildet haben. Die Anlage der Pötzsch’schen Baue und auch der beabsichtigten neuen Schächte gab den Bergsachverständigen Anlaß zur Kritik. Der unsachgemäße Betrieb führte zu schlechtem Wetterwechsel, schwieriger Wasserhaltung und unbequemer Förderung, mithin zu vermindertem Abbau.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trotzdem ergaben angestellte Berechnungen, daß der Gewinn der Witwe Pötzsch jetzt größer war, als man bisher angenommen hatte. Nach den Angaben des Steigerdienstversorgers Albrecht kostete nämlich das Absinken der zwei neuen Schächte einschließlich Wasserhaltung und teilweiser Zimmerung nicht mehr als 50 Tlr. Angenommen, daß mit Hülfe dieser beiden Schächte ein Feld von wenigstens 120 m Länge und 60 m Breite, also von 7.200 m² abgebaut werden könnte und daß je 4 m² etwa 10 Scheffel verkäufliche Kohle enthielten, so ergab obiges Feld eine Förderung von 18.000 Scheffeln. Die Förderkosten pro Scheffel waren unterhalb der Hauptstrecke (also mit Wasserhaltung) 2 Neugr. 5 Pfg., oberhalb dieser Strecke, wo die Wasserhaltung wegfiel, nur 1 Ngr. (?) Pfg., im Durchschnitt also 2 Neugroschen 2 Pfennige pro Scheffel. Das ergab für obige 18.000 Scheffel 1.320 Tlr. Gewinnungskosten bis zum Schacht. Bei 12-stündiger Schicht konnten zwei Mann etwa 40 Scheffel zu tage ziehen. Bei 8 Ngr. 7 Pfg. Schichtlohn pro Mann (insgesamt 271 Taler) und einem angenommenen Aufwand von 15 Tlr. für Instandhaltung der Kübel und Seile, ferner von 15 Talern Schmiedekosten (bei 7 bis 8 Hauern 3 Jahre lang) und 261 Talern für Wasserhaltung (1 Mann 300 Arbeitsschichten 3 Jahre lang an der Pumpe zum Schichtlohn von 87 Pfg.), schließlich Unterhaltungskosten für Pumpen, Fahrten, Strecken- und Schachtzimmerung einschließlich Material in drei Jahren = 100 Talern, Aufsichtsgebühren für den Steigerversorger, der neben seiner Häuerarbeit die Unterhaltung der Zimmerung und die Kohlenvermessung zu besorgen hatte und dafür wöchentlich 10 Ngr. extra erhielt (= 52 Taler), würden also die Gesamtgewinnungskosten für 18.000 Scheffel Kohlen 2.074 Taler betragen Zur Sicherheit für außerordentliche Ausgaben nach 25 Taler hinzugeschlagen, ebenso den Grundzins von 6 Pfg. pro Scheffel, ergäbe immerhin erst 2.459 Taler. Der Verkaufserlös von 7 ½ Ngr. pro Scheffel betrug aber 4.500 Taler, es blieb also ein Reingewinn für die Unternehmerin von 2.041 Talern in drei Jahren, oder 680 Tlr. (?) Ngr. jährlich. Wenn auch beim Betriebe des Abbaues durch den Fiskus selbst noch die Aufsichts- und Verwaltungskosten erhöhen würden, vielleicht auch die sonstigen Betriebskosten, da der Staat bei Anlegung und Unterhaltung der Baue und Hülfsbaue vorsichtiger zu Werke gehen mußte, so wäre nach dieseer Berechnung doch das eine gewiß, daß der Fiskus bei eigener Regie mindestens etwas mehr Gewinn als bei der jetzigen Verpachtung aus dem unter seinem Grunde liegenden Steinkohlen ziehen würde und außerdem den Vorteil hätte, daß das abzubauende Kohlenflöz besser untersucht und vollständiger ausgenützt würde und daß man auf diese Nutzung einen Voranschlag auf längere Zeit machen könnte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf Grund dieses Sachverständigenurteils beantragten die bei der Lokalerörterung anwesenden Forstbeamten, der Witwe Pötzsch den Kontrakt sofort zu kündigen und von 1846 an den Kohlenbau für fiskalische Rechnung unter Oberaufsicht und Rechnungsführung des Försters Lüttich zu betreiben; da man aber die Übernahme ohne einen Betriebsplan nicht gut vornehmen konnte, dieser sich wegen der Mangelhaftigkeit der vorhandenen geognostischen Karten und Risse nicht so schnell aufstellen ließ, kam man überein, vorderhand der Witwe Pötzsch den Abbau noch zu belassen und erst einen genauen Markscheiderplan über die wichtigsten Punkte der im Struthwalde stattgefundenen Untersuchungen aufnehmen zu lassen. Erst daraufhin konnte man bestimmen, von welcher Seite man am leichtesten, sichersten und schnellsten einen Stolln heranbringen könnte, der wenigstens die Wasserhaltung über der Grundstrecke ersparte und gleichzeitig bessere Wetter zuführte als die bisher geplanten zwei neuen Schächte in geringer Entfernung voneinander und in fast gleicher Höhe. Aus der Beschreibung der Pötzsch’schen Baue, die bei dieser Lokal-Expedition unter Leitung des Steigers Albrecht befahren wurden, ergeben sich folgende Veränderungen und neue Tatsachen seit 1843: Nachdem das geringe 1843 noch anstehende Feld abgebaut war, hatte man nordwestlich am Wiesener Flügel, etwa 50 m und 60 m vom alten Schachte entfernt, zwei neue Schächte auf das Flöz abgeteuft, 14 m bis 15 m tief. Sie verliefen 3,5 m im Porphyrtuff mit Zimmerung, dann in Kohlensandstein, hatten Fahrten, aber keine Streichbäume für die Tonne, da sie vollkommen saiger waren und waren mit einem leichten Bretterdach überbaut. Auf dem Sturzplatz waren ungefähr 300 Scheffel Kohlen in Vorrat. Von dem einen neuen Schachte ging eine 35 m lange Strecke erst hora 9, dann hora 12 ab, die mit einem Hauer belegt war, der Kohlen in Richtung West aushieb. Man war hier schon zienlich an der nordwestlichen Grenze des Struthwaldes und durfte in dieser Richtung wegen der Konzession nicht weitergehen. Der Arbeiter fürchtete, bald zu Ende mit dem Aushieb zu kommen, da sich nach Westen zu das Flöz schnell verdrückte, wie sich in dem anderen Schachte gezeigt hatte, wo es schon nach 8 ½ m westlicher Entfernung aufgehört hatte. Das Flöz war an diesem Abbauorte noch bis 0,43 m stark und bestand aus 0,14 m Kalkkohle, 0,06 m Ton, 0,04 m Pechkohle, 0,06 m hartem Ton und Brandschiefer und wieder 0,05 m Kohle. Während nach Westen zu das Feld vom zweiten Schachte aus ziemlich abgebaut war, stand es nach Osten in der Hauptsache noch an und zwar mit besserer Kohle; die Kalkkohle allein oft bis 0,2 m stark. In den nach Osten von der Hauptstrecke abzweigenden Örtern arbeiteten weitere drei Mann, von denen einer immer an der Pumpe stehen mußte. Bis zum Jahresschluß 1845 glaubte man, auch nach Osten zu das anstehende Feld abgebaut zu haben. Die Strecken waren krumm und niedrig, notdürftig mit Brettern für den Schleppkübel belegt, die Zimmerung durch den Bergeversatz fast überflüssig. Da man sich bei der zu bemerkenden Verdrückung des Flözes höchstens noch ein halbes Jahr in den jetzigen Bauen halten konnte, war die Witwe Pötzsch gesonnen, falls ihr die Erlaubnis zum weiteren Abbau erteilt würde, weiter nordwestlich einen neuen Versuchsschacht abzuteufen. Die Kohlen des Struthwaldes, deren Förderung in den letzten Jahren dauernd gestiegen war, hatten bisher immer guten Absatz gehabt. Jenseits der Grenze zwischen fiskalischem Struthwald und Niederwiesaer Flur hatten verschiedene Wiesaer Grundeigentümer Schurfschächte angelegt, um Kohlen zu finden. Da sich das Flöz, wo es erreicht wurde, aber nirgends abbauwürdig zeigte, waren die Anlagen wieder verlassen worden und standen unter Wasser.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durch Anfertigung der bei der letzten Lokalerörterung 1845 für nötig erachteten markscheiderischen Aufnahme (die vom Schichtmeister und verpflichteten Feldmesser Pilz angefertigt wurden und unter No. 92 und 93 im Rißarchiv des Bergamtes erhalten sind) kam der Sommer 1846 heran, ohne daß eine Entscheidung über die künftige Regie des Kohlenbergbaus in der Struth getroffen war. Ein sehr umfangreicher Bericht des Bergmeisters Hering aus Marienberg zu dieser Frage an das kgl. Finanzministerium vom 15. August 1846 wiederholt nochmals die Hauptabschnitte der Geschichte des Struthwalder Kohlenbaus von 1817 bis 1845 und die Fortschritte in der geologischen Erkenntnis dieses interessanten Gebietes, wie wir sie in diesem Kapitel kennengelernt haben. Er kommt zu dem Schlusse, daß trotz aller ungünstigen theoretischen Ergebnisse der Untersuchungen die Praxis des von Pötzsch und seiner Witwe betriebenen Abbaus bessere Resultate gezeitigt habe. Vorallem sei aber die Region des unteren vorporphyrischen Steinkohlengebirges noch gar nicht genügend durch Bohrungen erforscht, so daß man mit einem abschließenden Urteil über die Kohlenführung der tieferen Schichten vorsichtig sein müsse, seien doch auch die neuesten Ergebnisse bei Oberwürschnitz im Lugau- Oelsnitzer Revier in größeren Tiefen höchst befriedigend, trotzdem man mit früheren Bohrversuchen 1830/1831 keine bauwürdige Kohle gefunden hatte. Hering machte dann eine Anzahl Vorschläge zur Untersuchung der tieferen Schichten des Steinkohlengebirges in der Struth; insbesondere wollte er auch die 1827 angelegten Bohrlöcher No. VI (dicht oberhalb des Zschopauufers) und No. VII (am Grünitzhübel) auf drei- bis vierfache Tiefe fortgesetzt wissen, ferner Versuchsschächte und Stollen an allen Kohlenausstrichen anlegen lassen. Diese Vorschläge hätten aber dem Staate nach den beigegebenen Kostenanschlägen sehr viel Geld gekostet, so daß es nicht zu verwundern ist, daß das Finanzministerium nicht darauf einging. Auch der Vorschlag zur Übernahme und Weiterführung des Struthwaldwerkes durch den Fiskus war, wenn ein einigermaßen geregelter Betrieb und gründlicher Abbau erfolgen sollte (vorallem wurde dazu das Heranbringen einens Stollens vom Zschopauufer oder Schaalgrund, am besten aber vom Hahnebach für unumgänglich gehalten), so kostspielig, daß sich das Finanzministerium am 16. September 1846 endgültig dagegen aussprach. Es erteilte vielmehr der Witwe Pötzsch die nachgesuchte Erlaubnis zum Einschlag zweier weiterer Schächte und gab sogar Anweisung, daß auch jedem weiteren Unternehmer die Konzession im Struthwalde unter ähnlichen Bedingungen wie der Witwe Pötzsch erteilt werden solle. Auch der Grundzins von 6 Pfg. durfte nicht erhöht werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infolgedessen finden wir in den nächsten Jahren neben dem Pötzsch’schen Werke Versuchsbaue Hesse’s, der nachmals in der Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Flöhaer Becken eine Rolle spielte, indem er von 1853 an im Pfarrwalde zu Flöha mit Erfolg abbaute. Seine Versuchsbaue in der Struth befanden sich in den Unterabteilungen 7b und 7d, nördlich des Wiesener Flügels, von Pötzsch’s Bauen – wie aus den Pilz’schen Rissen hervorgeht – nur wenige 100 Schritt entfernt. Er beabsichtigte auch, bei erwiesener Bauwürdigkeit einen Stolln vom Zschopauufer heranzuführen. Außer Hesse bewarb sich 1847 auch der Rittergutsbesitzer von Einsiedel auf Scharfenstein um Konzession, ohne indessen Versuchbauten angelegt zu haben. Zur Abgrenzung der Kohlenfelder zwischen Hesse und der Witwe Pötzsch (und weil letztere auch wieder neue Schächte einschlagen wollte), fand am 11. Dezember 1849 eine Lokalerörterung zwischen allen beteiligten Personen und Behörden unter Leitung des Vizebergmeisters Graff aus Marienberg statt. Da einige Tage vor diesem Termin die Witwe Pötzsch plötzlich verstorben war, brauchte man aber bloß noch mit Hesse verhandeln. Dieser wollte in der Unterabteilung 7b, 30 Schritt westlich des Hauptflügels, neu einschlagen und bei günstigem Ergebnis in 7d, etwa 300 Schritt in nördlicher Richtung bergab, einen zweiten Schacht absinken, der zugleich als Wetterschacht dienen sollte. Vom Zschopauufer, aus Abteilung 3e, wollte er im günstigen Falle den schon erwähnten Stolln heranbringen. Er bekam die Konzesion auf alleiniges Abbaurecht in der Unterabteilung 7 des Struthwaldes. Da mit dem Ableben der Witwe Pötzsch deren Konzession erloschen war, beantragte Hesse Übertragung derselben in Abteilung 6b auf ihn, da das dortige Feld entgegen der Behauptung der verstorbenen Besitzerin durchaus noch nicht völlig abgebaut sei. In den letzten zehn Wochen noch habe sie daraus 1.025 Scheffel gefördert. Als Kaution für den Abbau in Abteilung 7 bot Hesse eine Hypothek von 200 Talern auf sein Besitztum an, von 400 Talern, wenn ihm auch die erloschene Konzession in Abteilung 6 übertragen würde. Diese erhielt er aber nicht, sondern Heinrich Christian Thümer (oder Thiemer; aber nicht Thieme, wie Naumann und Geinitz irrtümlich schreiben), der die verw. Pötzsch kurze Zeit vor ihrem Tode geheiratet hatte und nun Pötzsch’s Werk bis 1852 fortsetzte. Hesse hatte mit seinen Versuchsbauten in Abteilung 7b und 7d wenig Erfolg, so daß er sie bald wieder aufgab. Er hatte auch in den Sandstein der unteren Stufe am Zschopauufer eingeschlagen, aber auch ohne genügenden Erfolg. Thümer, der nun von 1850 bis 1852 den Rest des Kohlenfeldes in Pötzsch’s Bauen in Abteilung 6b und 6c abbaute, hat in der Literatur unverdient größere Beachtung gefunden als Pötzsch, der eigentliche Pionier des Kohlenabbaus im Struthwalde. Geinitz und Naumann und auf Grund ihrer Berichte auch die Erläuterungen zu den späteren geologischen Spezialkarten reden nur von Thümer’s Abbau im Struthwald. Das mag daran liegen, daß diese Berichte alle erst nach 1850 entstanden, wo das Pötzsch‘sche Werk in Thümer's Besitz übergegangen war. Am 30. September 1852 stellte auch Thümer den Abbau im Struthwald nach völliger Erschöpfung der abbauwürdigen Lager ein. Dank des Umstandes, daß der von jedem Scheffel erhobene Grundzins durch die Forstrechnungen gehen mußte, die im Hauptstaatsarchiv in Dresden aufbewahrt sind, war es möglich, die im Struthwald geförderte Kohlenmenge in Höhe von fast 80.000 Scheffeln (oder noch mehr) ähnlich wie im Pfarrwalde genau zu erfassen (vergl. Kapitel V).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prof. Geinitz hat 1853 noch die dortige Kohlenschieferhalde auf Pflanzenreste untersucht. Durch Geinitz sind die Kohlen des Struthwaldes auch in die Stein’schen Analysen der sächsischen Steinkohlen aufgenommen worden. Die Analyse in Kapitel V zeigt, daß die Kohle des Struthwaldes recht verschieden in der Güte gewesen ist. Der Aschegehalt schwankt zwischen 59,5% und 71,5%, im Mittel 51%; der Gehalt an Kohlenstoff zwischen 14,8% und 50,8%, im Mittel 47,7%, direkt gefunden aber bloß 38,2%. Die Struthwaldkohlen glichen also ungefähr denen auf Anke’s Grube in Flöha und gehörten zu den geringwertigeren im Flöhaer Becken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d)
Der Abbau
in der unteren Karbonstufe auf Altenhainer (und Flöhaer) Flur (Schaal, Eichler, Fischer & Co. und Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft) Im Gebiet des Kohlensandsteins der unteren, vorporphyrischen Stufe zwischen dem Dachsloch und dem Forstbachgraben, also auf Altenhainer Flur, wo anfangs des 18. Jahrhunderts die ersten größeren Versuche zum Kohlenbergbau im Flöhaer Becken stattgefunden hatten (Schwarzer Adler Erbstolln 1700, Segen des Herrn Fundgrube 1713/1714), ist im 19. Jahrhundert der Abbau am spätesten wieder aufgenommen worden. Erst in den 1820er Jahren wurde man auf die Kohlenausstriche auf den Feldern des Dietrich’schen Gutes (das sich schon zur Zeut der Segen des Herrn Fdgr. 1713 im Familienbesitz befand) westlich des Forstbaches und auf die alten verfallenen Anlagen der Segen des Herrn Fundgrube wieder aufmerksam.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Großkaufmann Fiedler aus Oederan, dem die Berthelsdorfer Werke gehörten und der 1823 die Abbaurechte im Flöhaer Pfarrwald erwirben hatte, trug sich in demselben Jahre 1823 nach den Bergamtsakten No. 4081 auch mit der Absicht, versuchsweise auf Dietrich’s Feldern zu Altenhain einschlagen zu lassen. Er hatte aber wohl keinen genügenden Erfolg, sonst hätte er sich sicher die Abbaurechte gesichert, wie er dies um diese Zeit an verschiedenen Orten tat. Auch Schippan machte nach Freiesleben's Magazin für Oryktographie ums Jahr 1840 einen versuchsweisen Einschlag auf Altenhainer Gebiet und fand kleine Schmitzen guter Kohle. Aber auch ihm scheint ein Abbau nicht aussichtsvoll genug erschienen zu sein. Annmerkung der Redaktion: Beide betrieben ja eigene Steinkohlenwerke. So also nicht Aussicht auf größere Gewinne bestanden hat, ist stets zu vermuten, daß sie mit den Versuchen an anderen Orten in erster Linie zu verhindern gedachten, daß Dritte in den Markt drangen und ihnen den Absatz streitig machen konnten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den 1830er Jahren nahm dann der Steiger Carl Friedrich Schaal, der bis dahin auf Schippan’s Werk in Gückelsberg angestellt gewesen war, den Abbau auf. Geinitz berichtet in seiner „Flora“ von einem Stollen, in welchem Schaal 1834 das schwache Kohlenflöz abzubauen versuchte. In der diesem Werk beigefügten Tafel B, von einem seiner Freunde skizziert, ist das Mundloch dieses Stollens zu sehen. Nachdem Schaal diesen Stollen, der wahrscheinlich der alte, wiederhergestellte Erbstolln der Segen des Herrn Fundgrube war, aus Mangel an Erfolg wieder verlassen hatte, wurden unter seiner Leitung vom Grundbesitzer Dietrich selbst in größerer Höhe des dortigen Berghanges nahe am Forstbachgraben mehrere Kohlenschächte angelegt, die gewöhnlich nach einiger Zeit wegen Wasserandrangs wieder aufgegeben werden mußten. Man stieß darin auf zwei schwache Kohlenflöze, die gemeinschaftlich kaum 0,3 m Kohle enthielten. Dieselbe war aber besser als die Flöhaer Kohle, nach der Herder’schen Statistik von 1846 wurde sie zu 11 Neugroschen pro Scheffel verkauft, während es die Flöhaer und Gückelsberger Kohle damals höchstens auf 7 ½ Ngr. brachte. Mit der Zeit war auch das Flöz stärker geworden; die genannte Statistik gibt es auf 0,39 m bis 0,58 m an. Die Wasserlösung erfolgte zum Teil noch durch den bekannten Stollen; wo dieser nicht mit den Schächten in Verbindung stand, durch Pumpen. Zur Förderung wurde sowohl der Stollen, als auch ein Tagesschacht benutzt. 1845 wurden zirka 3.000 Scheffel gefördert durch 4 Arbeiter und Schaal, der selbst mitarbeitete. Die Statistik bemerkt zu dem Werke: „Das isolierte Auftreten der Kohlen, die jedenfalls zu denen von Flöha gehören, und die mehr butzenförmige Ablagerung derselben lassen keine bedeutende Erhebung des Werkchens erwarten, dessen Betrieb überhaupt mangelhaft ist, zumal dasselbe in der Folge viel mit Grundwasser zu kämpfen haben wird. Es ist ein echter Eigenlöhner-Bergbau, da der Besitzer selbst mitarbeitet.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man schien hiernach noch nicht recht erkannt zu haben, daß die Flöze der unteren Stufe des Flöhaer Karbons angehörten und die Lager deshalb durchaus nicht isoliert und butzenförmig zu sein brauchten. Das Unternehmertum hatte denn auch mehr Vertrauen auf die zukünftig reichere Bauwürdigkeit des Flözes, so daß im Jahre 1848 der Begüterte Johann Georg Eichler aus Grumbach, Besitzer eines Kalkwerkes und eines Braunkohlenbaues in Ottendorf, das Werk von Schaal kaufte und es mit seinen größeren Mitteln in erweitertem Maße fortführte. Trotzdem nahm das Werk zunächst keinen rechten Aufschwung. Bei der Besichtigung durch Bergmeister Fischer im Jahre 1850 war an dem Betriebe allerhand auszusetzen. Das Werk bestand aus dem jetzt 164 m langen Stollen, der am rechten Zschopauufer etwas unterhalb des Floßrechens angesetzt war, 1,4 m bis 1,6 m hoch und 0,8 m breit, fast durchgängig in Gestein mit wenig Zimmerung. Es wurde darin ein 20° nach Südwesten einschießendes, hor. 8,4 streichendes Flöz von ungefähr 0,7 m bis 0,75 m Stärke, aber keinesfalls reine Kohle, abgebaut. Bei 164 m Entfernung vom Mundloch des Stollens kam ein 36 ½ m tiefer Schacht ein, der zu Aussetzungen besonders Anlaß gab, da sämtliche Fahrten bloß durch Haken miteinander verbunden waren und schwankten. Zwischen Fahr- und Ziehschacht war infolge der geringen Weite von nur 2 m x 0,75 m kein trennender Verschlag, jede Ruhebühne fehlte. Beim Aussteigen fehlte jede Handhabe, indem die letzte Leiter mit der Schachtöffnung abschloß. An den Haspelstützen fehlte die Wehrstange, auf dem Schachte der Deckel, sowie das nötige Abstreicheisen und die Hängebank, um das Hineingleiten zu verhindern und das Herüberziehen der Kübel zu erleichtern. Zur Zeit war dieser Schacht der einzige gangbare; er stand neben dem Dietrich’schen Steinbruche (jetzt von Herrn Lehnert, Flöha, gepachtet), ziemlich in gerader Richtung über dem am Steinbruch gebauten Huthause, welches der Steiger Schaarschmidt bewohnte; es gehörten aber noch zwei alte Schächte zu dem Werke. Eichler wollte an dem Schachte nicht mehr viel tun, weil er einen neuen Plan hatte: Am Fuße des Berges, dicht neben der Wohnung des Steigers und unweit des Stollneingangs, sollte ein neuer Schacht geteuft werden, dessen voraussichtlich starke Wasser durch ein Kunstrad gehoben werden sollten. Zu dessen Antrieb wurde schon 1850 ein über 1.700 m langer, 3,4 m breiter Graben in angriff genommen, der das Aufschlagwasser für das Rad von der Zschopau heranführen sollte und der fast 2 m Gefälle einbrachte. Der Bergmeister ordnete an, diesen Schacht mindestens 2,6 m x 1,15 m weit anzulegen und Fahrraum von Förderraum zu trennen. 1850 war das Werk mit 4 Mann und dem Steiger belegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1852 war dieser geplante Schacht mit Kunstrad im Gange. Schon in 8 ½ m Tiefe wurde ein Kohlenflöz von 0,65 m bis 0,7 m Stärke getroffen. Die hier abgebaute Kohle war nach Geinitz weit besser, als die in den älteren, höher gelegenen Schächten zuletzt gewonnene, die fast nur auf des Besitzers Kalkofen in Ottendorf verwendet worden war, denn selbst der Steiger Schaarschmidt mußte zur Stubenfeuerung früher die Hälfte der Kohle aus Zwickau zusetzen. Die jetzt geförderte Kohle bedurfte dieses Zusatzes nicht oder kaum; sie war Schieferkohle mit einer ziemlichen Menge dünner Pechkohlenschichten. An späterer Stelle vergleicht Geinitz diese Altenhainer Kohle sogar mit der von Morgenstern in Gückelsberg gefundenen – der besten, die im Flöhaer Becken je abgebaut wurde. Die hervorragende Güte der Altenhainer Kohle kann aber nur vorübergehend gewesen sein, das Flöz war wahrscheinlich außerordentlich wechselnd in seiner Qualität; denn die von Stein 1853 analysierte Kohle aus Eichler’s Werk ist die schlechteste der von ihm untersuchten Kohlen des Flöhaer Beckens. Ihr Aschegehalt war im Durchschnitt 57% bis 63%, der Gehalt an Kohlenstoff schwankt zwischen 29,7% und 38,4%. Diese Verschlechterung des Flözes dürfte der Grund gewesen sein, daß Eichler’s Werk 1853 vorläufig wieder eingestellt wurde. Im Übrigen genügte auch das Kunstrad nicht zur Bewältigung des starken Wasserzudranges, da die Schachtsohle unter dem Zschopauspiegel lag. Über den Umfang des Werkes bei der Sistierung besitzen wir folgende statistische Angaben des Kohlenwerks-Inspektors: Kohlenfeld 234 Acker 260 Quadratruthen, davon aufgeschlosse und abgebaut: 2 Acker. Der Grundbesitzer Dietrich bekam für den Scheffel geförderter Kohle einen Neugroschen Tonnenzins. Das abgebaute Flöz war 0,24 m bis 0,85 m stark, größtenteils Anthrazit („Kohlenblende“) und eignete sich angeblich zum Kalkbrennen besser als Zwickauer oder Dresdner Kohle. Das Werk bestand aus einem Kunstschacht von 8 m Tiefe und zwei Fahrschächten (wahrscheinlich den alten, bereits abgeworfenen) von 40 m Tiefe, die von oben in Zimmerung, unten in Sandstein standen; ferner aus zwei Stollen von 28 ½ m und 74 m Länge (diese Angaben stehen in Widerspruch mit denen des Bergmeisters Fischer von 1850), welche 51 m Teufe einbrachten. Ferner waren vorhanden: 1 Huthaus (Wert 500 Tlr.), 1 Arbeiterhaus (Wet 500 Tlr.), 1 Schmiede (200 Tlr. Wert) und 1 Wasserrad mit zugehörigem Graben. Das Eichler’sche Werk stand still von Ende 1853 bis zum Winter 1859/1860.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit 1858 machte ganz in der Nähe von Eichler’s Schächten, auch auf Dietrich’s Flur, eine Döbelner Gesellschaft, Fischer & Co., später sich Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft nennend, mit größeren Mitteln Versuche auf Kohle der unteren Flöhaer Karbonstufe, die zur Wasserhaltung eine Dampfmaschine aufstellte. Dadurch wurden die Wasser in Eichler’s alten Schächten mit weggezogen. Diesen günstigen Umstand nützte Eichler aus, indem er auf seinem unteren (Kunst-) Schachte 1859 wieder abbaute. Er trieb neue Strecken in einem Abstand von nur 5 m von dem inzwischen neu angelegten Zschopau-Mühlgraben. Dies veranlaßte Fischer & Co. zu einem Einspruch vor dem Gerichtsamt Frankenberg; denn wenn die Wasser des Mühlgrabens die geringe Bergfeste von 5 m durchbrachen, mußte auch Fischer’s Maschinenschacht, der nur etwa 40 m von Eichler’s Kohlenschacht entfernt war, ersaufen. Dabei standen hohe Anlagewerte auf dem Spiel. Auf den Einspruch von Fischer & Co. hin wurde Eichler im Jahre 1860 durch die Kohlenwerksinspektion Zwickau aufgegeben, unverzüglich jeden Grubenbau innerhalb einer geringeren Entfernung als 16 m von dem Zschopau-Mühlgraben zu unterlassen, die bisher von seinem Schachte aus gefahrenen Strecken und Abbaue binnen 4 Wochen zu Riß zu bringen und diesen dann der Kohlenwerksinspektion einzureichen, ferner alle Strecken und Abbaue, soweit sie innerhalb des 16 m breiten Sicherheitspfeilers lagen, binnen einer weiteren vierwöchigen Frist gut mit Bergen versetzen zu lassen. Zur Überwachung seiner Anordnungen besuchte der Kohlenwerksinspektor Kühn in den nächsten Monaten wiederholt die Altenhainer Steinkohlengruben und erweiterte bei örtlicher Besichtigung die Sicherheitsfeste auf 40 m. Bei diesen Besichtigungen ergaben sich auch sonstige Mängel an Eichler’s Schacht. Es wurde ihm deshalb aufgegeben: 1. Den Schacht übertage mit einer Sicherung zu versehen, die bei Abwesenheit der Arbeiter (gewöhnlich zwei Mann, aber in unregelmäßigem, oft ausgesetzten Betriebe) den Zutritt zum Schachte und Unglücksfälle verhinderte (verschließbare Kaue). Bisher stand nur eine offene, mit Stroh gedeckte Scheune über dem Schachte. 2. Die derzeitigen Haspelstützen durch stärkere zu ersetzen, 3. Die senkrechten Fahrung des Schachtes vom kurzen Schachtstoß weg auf einen der langen zu verlegen und dafür zu sorgen, daß sie niemals überhänge und durchgängig so viel Abstand von der Zimmerung habe, um ein gehöriges Durchtreten der Fahrenden zu gestatten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei einer weiteren Revision am 10. September 1860 stellte sich heraus, daß den Anordnungen in obigen Punkten 1 und 3 noch nicht nachgekommen worden war. Außerdem arbeiteten Eichler’s Arbeiter in der Grube trotz Wettermangels, solange sie atmen konnten; im Finstern, denn das Grubenlicht verlosch infolge Sauerstoffmangels. Eichler wurde wegen Renitenz zu 5 Taler Strafe verurteilt und mit weiteren 10 Talern bedroht, wenn er nicht binnen 14 Tagen für Abstellung der Mißstände sorgte. Den Arbeitern wurde das Einfahren in die Grube nur mit brennendem Grubenlicht erlaubt. Vorher sollte durch Herablassen eines Lichtes an einem Faden geprüft werden, ob die Luft brauchbar sei. Wenn sich durch Verlöschen des Lichtes Sauerstoffmangel kundtat, sollte die Befahrung ganz unterlassen und erst für frische Wetter gesorgt werden, entweder durch Herstellen eines wetterdichten Schachtscheiders oder durch zeitweilige Anwendung eines Feuerkübels, am sichersten aber durch einen saugenden Ventilator, der bis ins Tiefste des Schachtes führte. Da Eichler durch den Umbau der Fahrung, Bau einer verschließbaren Kaue und Anwendung von neuen Hilfsmitteln zur Wetterführung große Ausgaben entstanden deren Ersatz durch die geringe Kohleförderung bei fallenden Kohlenpreisen und teurer Wasserhaltung sehr unwahrscheinlich war, zog er es vor, den Abbau im Oktober 1860 wieder einzustellen. Die Schachtöffnung wurde nur mit starken Pfosten zugedeckt, um unter günstigeren Umständen den Betrieb vielleicht doch wieder aufnehmen zu können. Zweimal noch suchte Eichler um Erlaubnis zur Wiederaufnahme seines Betriebes nach, 1862 und 1866, als Fischer & Co. ihre Arbeiten eingestellt hatten, ihr Schacht also durch Eichler’s Baue nicht mehr gefährdet werden konnte. Da ihm trotzdem jedesmal der Abbau nur in gewisser Sicherheitsentfernung vom Zschopau-Mühlgraben gestattet werden konnte (in den betreffenden Entscheidungen wurden jetzt 34 m Sicherheitsfeste verlangt), hätte er seine alten Baue nicht wieder benutzen können, sondern hätte neue anlegen müssen. Diese Neuinvestierungen von Kapital hätten aber von vornherein den Betrieb unwirtschaftlich gemacht und so unterblieb die Wiederaufnahme der Eichler’schen Gruben endgültig. Die Schächte sind dann in den 1880er Jahren von dem Steinbruchbesitzer Lehnert aus Flöha, dessen Sohn und Nachfolger den unteren Kohlensandstein an der Finkenmühle heute (1920) noch abbaut, verfüllt worden, ebenso wie die des Fischer’schen Unternehmens daneben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fischer & Co. (Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft). Die Tatsache, daß auf Dietrich’s Feldern in Altenhain bis 1853 von Eichler Kohle abgebaut worden war und zwar zuletzt von oft sehr guter Qualität in einem Flöz von 0,65 m Stärke, was im Flöhaer Becken eine Seltenheit war; und daß Eichler nur durch die schwierige Wasserhaltung den Abbau ausgesetzt hatte, veranlaßte im Jahre 1858 den Schmiedemeister und Besitzer eines Braunkohlenwerkes zu Skoplau, Johann Heinrich Fischer aus Döbeln, mit Dietrich einen Vertrag auf Abbau des Unterirdischen auf dessen Altenhainer Besitz abzuschließen (am 10. Mai 1858). Eichler’s frühere Rechte waren durch Nichtgebrauch seit 1853 erloschen. Es gelang Fischer, eine Anzahl von Kapitalisten zur Mitbeteiligung zu veranlassen und die Gesellschaft machte als Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft eine rührige Reklame in der Öffentlichkeit. Geinitz nimmt in den „Steinkohlen Deutschlands“ 1864 darauf Bezug, bemerkt aber, daß sich die in den öffentlichen Blättern 1859 verbreitete Nachricht vom Auffinden eines besonders mächtigen Kohlenflözes leider nicht bestätigt habe. Da bekannt war, daß Eichler in seinem Schachte an der Finkenmühle mit außerordentlichem Wasserandrang zu kämpfen gehabt hatte, den er nicht einmal mit Hilfe eines Wasserrades für die Pumpen hatte bewältigen können, ging die neue Gesellschaft mit für Flöhaer Verhältnisse außergewöhnlichen Hilfsmitteln an die Aufnahme des Abbaues, indem sie für die Wasserhaltung eine Dampfmaschine von 10 PS aufstellte. Der erste Schacht wurde 1858 am Wege nach Braunsdorf östlich der Finkenmühle, noch ohne Wasserhaltung durch die Dampfmaschine abgeteuft; er war über 38 m tief und hatte so gewaltigen Wasserandrang, daß er wieder verlassen wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man sank nun westlich davon, also näher an der Finkenmühle und nur 40 m von Eichler’s Kunstschacht entfernt, einen zweiten Schacht ab, zu dessen Wasserhaltung man die Dampfmaschine verwandte. In einer Tiefe von nahezu 30 m traf man, durch einen in 14 m Tiefe einkommenden Stollen von nur 16 m Länge begünstigt, auf ein Flöz von 0,6 m bis 0,65 m anthrazitischer Kohle. Der Schacht wurde dann noch zirka 4 m durch Konglomerat fortgesetzt und hierauf noch fast 6 m tiefer gebohrt. Bei dieser Gesamttiefe von etwa 39 m traf man auf das silurische Grundgebirge, weißgrauen, aufgelösten Tonschiefer (Naumann und nach ihm die Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte geben die Mächtigkeit des Steinkohlengebirges an dieser Stelle bloß mit 34 m an, das Fahrjournal der Kohlenwerks-Inspektion Zwickau spricht aber von 67 Ellen, einschließlich 10 Ellen Bohrung, also etwa 39 m). Das von Südwest nach Nordost streichende und mit 10° bis 15° nach Südost fallende Flöz wurde 105 m weit im Streichen nach Nordosten erschlossen und durchaus regelmäßig gelagert bei o. a. Stärke gefunden; westlich der Finkenmühle am Dachsloch rief es die seit Jahrhunderten bekannten Ausstriche hervor; in größerer Entfernung vom Schachte wurde es unbauwürdig, da es zuletzt nur noch 10 cm bis 20 cm brauchbarer Kohle mitführte. Man baute nun 1859 bis 1861 die bauwürdigen Mittel über der Schachtsohle ab, unter die Sohle konnten die Baue der Wasser wegen nicht ausgedehnt werden. 1860 förderte man 6.342 Scheffel Kohle, bei 75 Pfg. pro Scheffel mit einem Verkaufswert von 1.637 Taler, 7 Ngr., 5 Pfg. bei einem Materialverbrauch von 1.503 Tlr., so daß die Löhne für 24 Arbeiter und einen Obersteiger fast ganz als Verlust zu buchen waren. Sie sind leider in der Statistik des Kohlenwerksinspektors nicht angegeben. In der hohen Summe für Materialverbrauch steckten allein 1.208 Tlr. für Steinkohle; man konnte nämlich die eigene, geförderte Kohle nur mit Würschnitzer Kohle zusammen in der Dampfmaschine verfeuern bei gleichzeitiger Einführung von etwas Dampf unter den Kesselrost. Unter diesen Umständen schränkte man bald den Betrieb ein. 1861 hatte man außer dem Steiger nur noch 10 Arbeiter, aber die nur noch in den ersten Monaten des Jahres mögliche Förderung von 1.636 Scheffeln (=409 Tlr.) deckte noch lange nicht den Materialverbrauch von 713 Tlr. 22 Ngr. 5 Pfg. (darunter wieder 581 Taler 22 Ngr. 5 Pfg. für fremde Kohle), sowie die Löhne und Gehälter, die uns auch in diesem Jahre nicht angegeben werden. Außerdem mußte noch der Zehnte an den Grundbesitzer abgegeben werden. Der Wasserandrang war sehr stark, wurde jedoch von der Dampfmaschine bei einer Hebung von 30 Kubik-Fuß pro Minute glatt bewältigt. Die Förderung geschah in der Grube durch Schleppkübel, die am Füllorte gleich an das Haspelseil angequenzelt wurden. Die Nachfrage nach der Altenhainer Kohle ließ auch zu wünschen übrig. Zudem lag ein Teil der Strecken und Abbaue innerhalb der Sicherheitsfeste, die der Kohlenwerksinspektor in 40 m Entfernung vom Zschopau-Mühlgraben gezogen hatte, auf Fischer’s eigene Beschwerde hin, daß Eichler zu nahe an diesem Wasser abbaue und dadurch beide Werke in Gefahr des Ersaufens brächte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Akten des Gerichtsamtes Frankenberg No. 55 über die im Bezirk gelegenen Kohlenwerke (aufbewahrt beim Bergamt Freiberg) ist in einem Riß die Situation von Eichler’s und Fischer’s Schacht am Wege nach Braunsdorf dargelegt. Südlich des Weges, direkt an der östlichen Ecke der Finkenmühle, ist Eichler’s Schacht zu sehen, nur 5 m vom Mühlgraben entfernt, also noch innerhalb der Sicherheitsfeste. Von seiner Sohle war in hora 6,3 nach Osten eine Grundstrecke getrieben, von der bei 4,8 m Entfernung vom Schachte das erste Steigort abging, welches hora 12 16 ½ m weit nach Norden führte und sich dann in zwei diagonale Örter (nach der hier üblichen Art des Strebbaus) teilte; das linke davon war in hor 7,3 22,5 m weit fortgebracht und hier auf alte Baue gestoßen (wahrscheinlich von Eichler’s Kunstschacht, wodruch dessen Wasser gelöst worden waren). Auch die rechte Diagonale, die hora 2 9 m weit führte war auf alte Baue durchschlägig geworden. Der Schacht, 6 m der Grundstrecke, das ganze erste Steigort mit der linken Diagonale lagen innerhalb der Mühlgrabenfeste und mußten auf Anordnung des Kohlenwerksinspektors 1860 bei Strafandrohung von 50 Tlr. verfüllt oder gut versetzt werden. Inzwischen hatte Fischer in dem ersten, weiter östlich liegenden Schachte, den man 1858 wegen der Wasser aufgegeben hatte, ein Bohrloch gestoßen und mit diesem das Flöz in 64 m Tiefe fast 0,85 m mächtig gefunden. Daraus ging hervor, daß das Flöz in der Fallrichtung nach Osten mit zunehmender Tiefe auch mächtiger wurde; und da vom Maschinenschacht an der Finkenmühle aus das Feld oberhalb der Schachtsohle abgebaut war, so weit es bauwürdig war, man aber unter die Schachtsohle der Wasser wegen nicht gehen konnte und außerdem ein Teil des Grubengebäudes mit dem Schacht in die Mühlgrabenfeste fiel und auf bergpolizeiliche Anordnung verfüllt werden mußte, beschloß die Gesellschaft, weiter östlich, wo das Flöz noch stärker sein mußte, einen neuen Schacht abzuteufen. Man wählte das westliche Gehänge am Ausgange der hinteren Ulbrichtschlucht, also schon Flöhaer Flur, weil durch die dortige Verwerfung an dieser Stelle der untere Kohlensandstein heraufgehoben war. Schon 1858 hatte nämlich Fischer vorsorgend auch mit einer Anzahl von Grundbesitzern in Flöha, die Felder zwischen Forstbach und hinterer Ulbrichtschlucht besaßen (namentlich David Endig, Carl Friedrich Gottlieb Liebert, Carl Richter, Carl David Anke, Johann Gottlob Herrmann und Johann Leberecht Ulbricht), einen Vertrag auf Überlassung der Abbaurechte auf´s Unterirdische abgeschlossen. Der Vertrag enthält neben den üblichen Bedingungen folgende Regelungen: Außer dem Zehnten mußte ein Grundzins von 2 Neugroschen pro Quadratruthe benutzter, leerer Oberfläche bezahlt werden, für anstehende Feldfrucht besondere Entschädigung. Zur Kontrolle der Förderung durfte sich jeder Grundbesitzer einen Arbeiter des Werkes auswählen, außerdem war Einsicht in die Förderbücher zu gestatten. Wenn der Erwerber der Abbaurechte oder dessen Rechtsnachfolger über ein Jahr lang gänzlich den Abbau ruhen ließ, konnten die Grundbesitzer den Vertrag aufheben. Fischer’s Gerechtsame mußten die Grundbesitzer als Last auf ihre Grundstücke im Grund- und Hypothekenbuch eintragen lassen, sie gingen mit auf einen neuen Besitzer des Grundstücks über.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch im Jahre 1861 begann man mit dem Abteufen des neuen Schachtes auf Flöhaer Flur und zwar auf Liebert’s Felde, unter Leitung des Obersteigers Sommerschuh; aber man hatte aus dem verlustreichen bisherigen Betriebe die betriebswirtschaftliche Folgerung gezogen, daß ein intensiver Abbau im Flöhaer Becken unrentabel war. Auf die teure Betriebskraft der Dampfmaschine verzichtete man. Die Arbeiterzahl wurde auf 6 im Jahr 1862, schließlich nur noch auf 3 im Jahre 1863 herabgesetzt. Der Schacht war ziemlich weit für Flöhaer Verhältnisse angelegt, nämlich ungefähr 5 m x 1,9 m und mit ganzem Schrot von geteilten Hölzern verzimmert. Die Betriebskosten waren denn trotz des extensiveren Betriebes auch 1862 noch sehr hoch: 850 Tlr. für Material (darunter allein 600 Tlr. Holz), 400 Tlr. für den technischen Leiter, Obersteiger Sommerschuh, 936 Tlr. Arbeitslöhne. Der Erfolg der Versuchsarbeiten entsprach aber nicht den Erwartungen. Bis 20. Mai 1862 durchsank man folgende Schichtenfolge nach dem Fahrjournal des Kohlenwerksinspektors: 3,05 m Ton und Sand, 8,05 m Gneis-Konglomerat, 0,30 m Porphyr-Tuff (?), 12,… (?) sandsteinähnliches Konglomerat, 2,0 m Porphyr-Tuff (?) 26,3 m, dann stand wieder das letztgenannte Konglomerat an. Bei 22 m war man auf ein Flözchen von 0,04 m Kohle gestoßen. Bis Ende 1862 war der Schacht 36,5 m tief, hier traf man wieder ein schwaches Flözchen an. Während man anfangs gar kein Wasser im Schacht hatte, wurde dieses jetzt so stark, daß man die Aufstellung der Dampfmaschine zur Wasserhaltung beabsichtigte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es kam aber nicht dazu, wohl, weil den Gesellschaftern die Geduld und das Geld ausgingen. Im Jahre 1863 trieb man nur noch vier Wochen lang ein Bohrloch von etwa 3,5 m Tiefe, so daß die erreichte Gesamttiefe jetz 40 m war. Obgleich man damit das Steinkohlengebirge noch nicht durchbohrt hatte und das Hauptflöz in dem alten Schachte zwischen Forstbach und Finkenmühle ja auch erst bei 64 m Tiefe erreicht worden war, gab man die Versuchsarbeiten auf, da die bisherigen Resultate zu sehr entmutigten. Außer den beiden Kohlenschmitzen in in 22 m und 36,5 m Tiefe erwähnen die Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte noch ein Flözchen von 7 cm Stärke in 26 m Tiefe, worüber aber in den Akten nichts zu finden war; vielleicht ist das zweite Flözchen in 36 m Tiefe damit gemeint. Fischer selbst konnte sich auch nach Auflösung der Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft mit der Erfolglosigkeit der nicht zu Ende geführten Versuchsarbeiten nicht abfinden. Seit 1866 suchte er einen Käufer für seine Schächte oder einen bemittelten Teilhaber zur Fortsetzung der Versuche. Es gelang ihm, sich mit einem gewissen Jahn unter der Firma Fischer & Jahn zu assoziieren, die den Schacht auf Liebert’s Grundstück an der hinteren Ulbrichtschlucht unter Zuziehung Sommerschuh’s nochmals wieder herrichten ließ. Zu einem Abbau aber ist es nicht gekommen, wohl infolge der Schwierigkeit und Kostspieligkeit der nötigen Wasserhaltung. Die Gebäude und Anlagen des Altenhainer Maschinenschachtes, der sich seit 1858 nach dem Fahrjournal des Kohlenwerks-Inspektors „in wandelbarem Zustande“ befand, sind in den 1870er und 1880er Jahren auf Abbruch verkauft und abgetragen, die Schächte verfüllt worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e)
Versuche auf Steinkohlen an anderen Stellen des Flöhaer Beckens im
weiteren Sinne.
Wie in Kapitel I dargelegt, rechnet man die Steinkohlenformation, die östlich der Linie Plaue-Falkenau und im Oederaner Walde, sowie westlich der Linie Dachsloch-ERlbach vorkommt, auch noch zum Flöhaer Becken im weiteren Sinne. Es konnte nicht ausbleiben, daß man auch in diesen Gebieten nach Steinkohle suchte, als im Laufe des 19. Jahrhunderts die große Nachfrage nach Brennstoffen einsetzte und man im eigentlichen Flöhaer Becken Steinkohle zeitweise nicht ganz unrentabel abbaute.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.) Im Oederaner Walde hat schon im Jahre 1814 der Oederaner Arzt Dr. Gottlob Leberecht Lichtenberger ein Flözchen in dem den Porphyrtuff durchragenden Küppchen der unteren Stufe im hinteren Höllengrunde erschürft und beim Oberbergamt um Erlaubis zum Abbau nachgesucht. Dieses ließ die Fundstelle vom Markscheider Martini am 4. Dezember 1814 untersuchen, der im Januar darauf folgenden Bericht erstattete (Oberbergamtsakten No. 10476, Vol. I): Auf Grund der in Schippan’s Werk in Gückelsberg gebotenen Aufschlüsse war an große Kohlenflöze innerhalb der kleinen, lappenartigen Kohlengebirgskuppe des Höllengrundes nicht zu denken, da ringsum in geringer Entfernung Urgebirge anstand und im Porphyr als dem Liegenden des fraglichen Küppchens Kohle noch nie gefunden worden war. Er hatte mit seinem Gutachten wohl im großen ganzen recht, obwohl das, was er für Porphyr ansah, eigentlich Porphyrtuff ist und das Karbonküppchen somit nicht dem Porphyr aufsitzt, wie er analog den Verhältnissen im eigentlichen Flöhaer Becken annahm, sondern der Porphyrtuff durchragt und zur unteren Stufe des Flöhaer Karbons gehört, die wahrscheinlich den ganzen größeren Tufflappen im Oederaner Walde unterlagert, denn an seinen südlichen Rändern tritt sie mehrfach zu Tage. Trotz der geringen Aussichten empfahl Martini, dem Dr. Lichtenberger den Abbau der von ihm erschürften Kohlenschieferausstriche zu gestatten, da diese nach Gückelsberger Erfahrung immerhin in größerer Tiefe sich zu Steinkohle verbessern könnten und Lichtenberger die Kohle nur zum Brennen von Kalk aus gleichfalls von ihm entdeckten Lagern von Urkalk in der Nähe benutzen wollte. Dr. Lichtenberger bekam denn auch die Konzession zu einem Versuchsbau, stellte aber 1816 seine Arbeiten wieder vollständig ein, da sich die Kohlenschieferschichten als nicht bauwürdig erwiesen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lichtenberger’s Mißerfolg verhinderte nicht, daß bald wieder Berufene und Unberufene sich mit den angeblichen Kohlenschätzen im Oederaner Walde beschäftigten. Im Jahre 1825 ergingen gleich zwei Gesuche an das Bergamt Freiberg um Konzessionserteilung. Erstens bat der Bergmann Carl Gottlieb Küttner aus Oederan durch Vermittlung des Forstamts Augustusburg um Überlassung eines Platzes im Höllengrund zum Versuchsbau auf Steinkohlen und im zweiten ersuchte der Schneider Johann Georg Schneider zu Schönerstadt um dieselbe Erlaubnis. Letzterer hatte sogar schon, ohne die Genehmigung abzuwarten, angefangen zu schürfen. Das wurde ihm bald verwiesen unter der Verpflichtung zum Ersatz des verursachten Schadens. Dann nahm das Bergamt die erforderliche Lokalerörterung durch den Markscheider Gündel und einen Berggeschworenen im Beisein Küttner's, Schneider's, Vertretern des Justizamtes Augustusburg sowie der Forstverwaltung vor. Küttner gab an, einen Stollen nach Südosten in das Karbonküppchen des Höllengrundes treiben zu wollen. Schneider hatte ziemlich auf der Höhe desselben den unerlaubten Schurf angelegt, etwa 2,90 m tief, und dabei wirklich ein 4 cm starkes Kohleschmitzchen gefunden. 12 m tiefer am Hange befand sich der von Dr. Lichtenberger 1816 erfolglos abgeteufte, 11,5 m tiefe Schacht. Daß Schneider bessere Resultate erzielen können, als Lichtenberger, war nach Prüfung der Verhältnisse nicht zu erwarten, denn nach damaliger geologischer Ansicht saß das Karbonküppchen ja nur auf dem angeblichen Porphyr auf, mußte also durch Lichtenberger’s Schacht fast durchsunken sein. Auf Grund dieser Anschauung mußte auch Küttner's Stollen von der Sohle des Höllengrundes nicht in, sondern unter das Steinkohlengebirge in dessen Liegendes gehen, war also völlig aussichtslos. So wurde beiden Gesuchstellern die Erlaubnis zu Versuchsbauten im Oederaner Walde verweigert. Sie ließen sich aber so leicht nicht von ihrem Plane abbringen und mußten erst durch Strafverfügungen dazu gezwungen werden, ihre Versuche einzustellen und die Baue zuzuwerfen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trotzdem versuchten es im Jahre 1825 die Bergleute Christian Gottl. Böhme und Christian Friedrich Buch, beide aus Oederan, auf´s Neue, Konzession zum Bau auf Steinkohlen im Oederaner Walde zu bekommen. Sie stützten sich darauf, daß Küttner angeblich gleich unter der Dammerde 12 cm bis 15 cm mächtige Kohlenschichten gefunden hätte. Auf Grund sorgfältiger Beobachtungen wären sie zu der Überzeugung gekommen, daß sie mit einem vom Höllengrund etwa 30 m nach Nordwest getriebenen Stollen auf Steinkohlengebirge treffen müßten. Sie hatten es demnach nicht auf die bekannte, durchragenden Kuppe abgesehen, sondern wollten den Porphyrtuff unterfahren. Es wäre möglich, daß sie hierbei auf die darunterliegende untere Karbonstufe gestoßen wären und einigen Erfolg gehabt hätten, aber auf Grund des Gündel’schen Gutachtens von 1823, das von einer unteren Stufe des Flöhaer Karbons noch nichts wußte (erst Naumann’s Untersuchungen in den 1830er Jahren klärten die Verhältnisse im Flöhaer Becken) wurden sie mit ihren Gesuchen abgewiesen, obgleich sie sehr eindringlich auf den Brennholzmangel der Umgegend hingewiesen hatten, der schon dazu führte, daß die dortigen Fabriken (Manufakturen) von weit her geschwemmtes Flößholz verwenden mußten. Naumann erwähnt in den Erläuterungen zur geognostischen Karte 1834 außer den Versuchen im Höllengrund des Oederaner Waldes solche zwischen Plaue und Falkenau, an der östlicheren der dort vorkommenden, zwei unbedeutenden Partien von Kohlensandstein am Rande des Porphyrs, die aber völlig erfolglos waren und in den Akten keinen Niederschlag hinterlassen haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.) In der westlichen Fortsetzung des eigentlichen Flöhaer Beckens von dem Grundgebirgsriegel Dachsloch- Erlenbach über Ober- und Niederwiesa, Euba, Lichtenwalde bis zum Zeisigwald und Gablenz, sind schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts immer wieder in gewissen Zwischenräumen Versuche auf Steinkohlen gemacht worden, die wohl Kohlenschmitzen, zum Teil schon in der Formation des älteren Rotliegenden, angetroffen haben, jedoch von geringer Ausdehnung, aber nie zu regelmäßigem Abbau geführt haben. In Schulze’s Mitteilungen von 1762 und in einem Berichte des Bergamtes Marienberg vom 7. Juli 1767 finden sich solche Versuche erwähnt, wo mit einem Stollen angeblich gute Kohlen „in der Gablenz“ gefunden worden sein sollten. 1816 wurde durch Bergmeister Becker und verschiedene Geologen eine Untersuchung auf Steinkohlen im Tuff des Zeisigwaldes gemacht, die völlig erfolglos war, weil hier wahrscheinlich das Karbon durch die Eruptionen des Beuthenberges vollständig zerstört ist. Der Bergakademist Lange bespricht 1818 in seinem Bericht für die erste geognostische Landesaufnahme (Archiv in der Bergakademie Freiberg, No. 55) eine große Zahl von gefundenen Kohlenschmitzen bei Chemnitz, insbesondere zwischen Oberwiesa und dem Zeisigwald, im Chemnitzer Ratswald usw. 1818 gründete sich ein Verein zur Aufsuchung von Steinkohlen bei Chemnitz unter Leitung des Vizebergmeisters Haupt, der, auf die Dauer aber erfolglos, Versuche bei Gablenz und Borna vornehmen ließ. Im Gewerbeblatt für Sachsen von 1818, No. 11, berichtet ein gewisser Fr. Borchard Geschichtliches über diese Versuche. Bis 1820 hat der Verein bei Borna am Schloßteich 103 m tief gebohrt, nach den Oberbergamtsakten No. 10476, Vol. II, später sogar bis 114 m, wobei man bei etwa 100 m ein Flöz von zirka 42 cm Stärke getroffen haben soll.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahre 1836 ließ der Besitzer des Gückelsberger Steinkohlenwerks, Schippan, durch seinen Sohn, den Geometer Heinrich Adolph Schippan, neue Versuche auf Steinkohlen bei Gablenz, auf Stein- und Braunkohlen bei Ebersdorf anstellen. Man hatte damals große Hoffnung auf Auffindung bauwürdiger Flöze in größerer Tiefe unter dem Rotliegenden, nachdem seit 1831 bei Würschnitz- Lugau- Oelsnitz und bei Hohenstein-Ernstthal gute Flöze unter dem Rotliegenden abgebaut wurden. Das hatte dem Spekulations- und Unternehmertum neue Impulse gegeben. Der damals schon 76 Jahre alte Schippan hatte bis August 1836 bei Gablenz schon 600 bis 700 Taler verbaut, da die Schächte durch dicke Schichten Rotliegendes abgeteuft werden mußten, als er endlich auf Steinkohlengebirge mit sieben bis acht dünnen Kohleflözen, höchstens einen Elle stark, stieß. Ihr Abbau lohnte sich aber bei dem kostspieligen Betrieb der tiefen Gruben nicht. (Aus einem Gesuch Schippan's aus dieser Zeit um Überlassung einer Kopie der großen Ingenieurskarte über die Chemnitzer Gegend (Oberbergamtsakten 10476, Vol. II), geht hervor, daß er für seine Person nicht nur die Entdeckung der Gückelsberger Kohlenlager in Anspruch nahm, sondern auch Veranlassung zur Auffindung der Kohlenlager auf dem von Vitzthum’schen Werke zu Lichtenwalde- Ebersdorf gegeben haben will.) Zu seinem beabsichtigten Ebersdorfer Unternehmen schloß Schippan 1836 mit elf Grundbesitzern der im Nordwesten von Ebersdorf gelegenen Felder, die der Graf Vitzthum sich noch nicht verpflichtet hatte, Verträge zum Abbau von Stein- und Braunkohle ab. Bei den bergamtlichen Erörterungen standen Bedenken wegen der Bauwürdigkeit nicht entgegen, doch hat Schippan den Abbau wahrscheinlich nie aufgenommen, in Akten und Literatur fanden sich jedenfalls keine Hinweise darauf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch bei Gablenz wurde in den nächsten Jahren wieder auf Steinkohle gebohrt. Nachdem laut Borchards geschichtlichen Notizen im Gewerbeblatt „die Bohrungen im Jahre 1820 ohne genügenden Erfolg“ gewesen waren (Man habe 58 m tief gebohrt, nach den Oberbergamtsakten 10476, Vol. II, sogar 69 m und zwar 46 m im Fallen eines Kohleausstriches am Gablenzbach „in der Nähe der steinernen Brücke, ohnweit der Ziegelscheune“. Bei 51 m hatte man das austreichende Flöz mit einer Stärke von 4 cm wieder getroffen.), gründete sich 1838 der Chemnitzer Steinkohlenbau- Verein, um Bohrungen in der Chemnitzer Gegend vorzunehmen. Er hatte 450 Mitglieder und 650 sogenannte Aktienzeichnungen zu je 4 Gr. monatlich. Der Verein bohrte zunächst bei Gablenz, wo er, dem Rotliegenden eingelagert, einige Kohleschmitzen fand. Da diese aber unbauwürdig waren und auch Prof. Geinitz von weiteren Versuchen bei Gablenz mehrfach abriet und ein Gutachten für den Verein über die Gablenzer Versuchsarbeiten verweigerte, wurden dann Bohrungen im Zeisigwald „bei der roten Pfütze“ ausgeführt. Später arbeitete man bei Hilbersdorf und traf hier nahe unter Tage ein Flöz von 12 cm bis 17 cm guter Kohle an, 1843 noch zwei andere, von denen das untere 85 cm mächtig gewesen sein soll, aus Pech- und Rußkohle bestehend. Man machte sich hier allerhand Hoffnungen, aber eine nähere Untersuchung unter Prof. Naumann, den man zu Rate zog, führte zu der Überzeugung, daß man es mit einem Stück Kohlengebirge zu tun hatte, welches bei Bildung des Rotliegenden aus dem Karbon der Umgegend weg- und hier angeschwemmt worden war. Über seine sekundäre Ablagerung konnte kein Zweifel sein, da es auf dem Rotliegenden aufsaß. Es war eine ganz isolierte Parzelle regenerierten Kohlengebirges. Auf Naumann's Anraten setzte man dann die Versuche westlich von Chemnitz fort, bei Glösa, Alt-Chemnitz, Markersdorf, wo man die Fortsetzung des Flöhaer Karbons im erzgebirgischen Becken, wenn auch erst in größerer Tiefe, treffen konnte, während es östlich Chemnitz durch den Ausbruch des Beuthenbergs größtenteils zerstört war. In dieser Richtung hat man dann auch später Erfolge erzielt, die aber außerhalb des Rahmens unserer Arbeit fallen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Jahren 1843 und 1844 haben dann nach dem Gewerbeblatt für Sachsen vier arme Bergleute aus Freiberg auf Meinert’s Gut in Hilbersdorf einen über 17 m tiefen Schacht geteuft, in dem sie ein ungefähr 24 cm starkes Flöz, später noch ein zweites Flözchen fanden. Die Kohle war zwar „von schiefriger Beschaffenheit, aber doch mit schöner Pechkohle und glänzender Rußkohle durchzogen“. Diese Flözchen entsprachen aber nicht den Hoffnungen und besonders denen ihrer Geldgeber, so daß sie 1844 ihre Arbeit wieder einstellten, „zwar erst dann“, sagt das Gewerbeblatt im Jahre 1844, „nachdem sie einigen Chemnitzer Fabrikanten einige 100 Taler verbaut hatten.“ Das zitierte Blatt fährt fort: „Nachdem alles fehlgeschlagen war und niemand mehr Lust bezeugte, für Haufen grauer Letten Geld zu bezahlen, wollten jene Bergleute einen Aktien-Verein gründen, um beim Roten Vorwerk einen 300-elligen Schacht (171,5 m) abzuteufen. Es gelang ihnen aber nicht, den Verein zusammen zu bekommen. Somit ist nun wieder ein Versuch auf Steinkohlenabbau bei Chemnitz verpufft, vielleicht der fünfte oder sechstein einer kurzen Reihe von Jahren“, sind die Schlußworte des Gewerbeblattes 1844. Trotzdem kamen die Hoffnungen, auf der Ostseite der aufblühenden Industriestadt Chemnitz abbauwürdige Kohlenfelder zu finden, nicht zur Ruhe bis zur Einführung des Pfennigtarifes für Kohlen auf den preußischen Bahnen und der angleichenden Frachtermäßigung auch auf den sächsischen, die billige Kohlen von anderen Revieren nach Chemnitz brachte. Noch in den Jahren 1859 bis 1861 finden wir in den statistischen Angaben der Kohlenwerksinspektion Zwickau einige Versuchsbaue des Gablenzer Steinkohlenbauvereins erwähnt. Die Erläuterungen zur Sektion Chemnitz der geologischen Spezialkarte bringen eine Zusammenstellung von Versuchen auf Steinkohle in der Chemnitzer Gegend, so daß hier auf weitere Ausführungen verzichtett werden kann, zumal keiner der Versuche brauchbare Resultate geliefert hat. ____________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V.
Kapitel:
Statistisches über die Kohle und den Kohlenbergbau im Flöhaer Becken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)
Chemische und heiztechnische Untersuchungen
Schon im vorigen Kapitel wurde bei Gelegenheit der Geschichte des Gückelsberger Werkes die Stöckhardt‘sche Analyse des Gückelsberger Anthrazits aus dem Jahre 1838 angeführt. Sie ist die erste Analyse, die von Kohle des Flöhaer Beckens vorgenommen wurde und deckt sich im Allgemeinen mit den später von Stein gefundenen Resultaten über die in Morgenstern's Schächten in Gückelsberg gefundene Kohle; besonders der Kohlenstoffgehalt wurde beide Male zu 87% gefunden. Diese vorzügliche Kohle war aber nur unregelmäßig in kleinen Lagern auf Gückelsberger Flur im Karbon der oberen Stufe vorhanden und zwar im westlichen Teil des Kohlenfeldes am Rande des Wetzelbachtales.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ich lasse hier die Analyse Dr. Stöckhardt's im vollen Wortlaut folgen, wie er im Gewerbeblatt für Sachsen 1839, Seite 359, abgedruckt ist: „Glanzkohle (Anthrazit) aus Gückelsberg. Sie ist deutlich geschichtet, eisenschwarz, metallisch glänzend, auf dem Bruche matt und rauh, auf dem Querbruche abwechselnd stark und schwächer glänzende Schichten, außerordentlich und sehr regelmäßig zerklüftet und auf den Kluftflächen mit weißen Letten durchzogen. Diese wechseln fast mit jeder Schicht und zerschneiden die Kohle gleichsam in lauter rhomboedrische Prismen; dabei ist sie sehr hart, fest und spröde. Sie zeigt viel Analogie mit der Pechkohle vom tiefen Flöz vom linken Muldeufer im Planitzer Revier und Bockwaer Gemeindegut. Auch sind dünne Lagen von Faserkohle zu bemerken, aber ebenfalls in Glanzkohle umgewandelt. Aus 100 Gran wurde erhalten:
Sie enthält sonach
Diese Kohle zeigt sich frei von allem Bitumen; sie brennt nur bei hoher Temperatur und starkem Luftzuge und ohne Flamme, gibt aber dann vemöge ihrers großen Gehalts an Kohlenstoff eine bedeutende und anhaltende Hitze. Hauptsächliche Anwendung findet sie beim Kalk- und Ziegelbrennen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eingehende chemische und heiztechnische Untersuchungen der Kohlen des Flöhaer Beckens fanden auf Grund der Ministerialverordnung vom 8. April 1852 statt und sind in dem großen Spezialwerke über die sächsischen Steinkohlen von Geinitz, Stein, Hartig und Köttig niedergelegt. Die chemischen Untersuchungen bilden die zweite Abteilung dieses Werkes, die heiztechnischen Hartig's die dritte Abteilung. Nach Stein's chemischen Untersuchungen sind zwei Hauptarten von Kohle zu unterscheiden, welche die Praxis schon vorher auf Grund ihrer Struktur und Eigenschaften auseinandergehalten hatte. Die Zwickauer Formation nämlich besteht vorwiegend aus Kohlen mit muscheligem Bruch, aus sogenannten Pechkohlen, mit Rußkohlen durchzogen. Sie haben geringen Aschegehalt und viel flüchtige Destillationsprodukte, eignen sich also vorzüglich zur Gasbereitung und zur Feuerung mit langer Flamme, sind überhaupt spezifisch wertvoller. Die Kohlen des Plauenschen Grundes und des Flöhaer und Hainichener Beckens dagegen lassen sich leicht nach zwei Dimensionen in Stücke mit vorherrschend ebenen Flächen spalten. Sie sind Schieferkohlen, mit hohem Aschegehalt, also spezifisch geringwertiger. Die Kohlen der Flöhaer Formation stimmen im schiefrigen Bruche wie im Aschegehalt mit den Dresdnern vollkommen überein, ein Teil derselben ist jedoch des Bitumens beraubt und zu Anthrazit mit geringem Asche- und hohem Kohlenstoffgehalt verwandelt. Bei der Bildung dieser Kohlenarten spielte außer der Struktur der Pflanzen, aus denen sie vorwiegend entstanden, die Mitwirkung von Hitze eine Rolle. Wirkt auf die fettige Kohle, das heißt in der letzten Bildungsperiode, eine über die normale zur Verkohlung nötige Temperatur hinausgehende Hitze ein, so entsteht anthrazitische Kohle; während Hitzeeinwirkung in der ersten Bildungszeit ein Zusammenbacken der Teile, also Pechkohle im allgemeinen, herbeiführte. Alle Anthrazite unterscheiden sich von den Steinkohlen nicht durch das Alter, als vielmehr dadurch, daß sie der Wirkung einer höheren Temperatur ausgesetzt gewesen sind. Einen deutlichen Beweis hierfür lieferte die Analyse der anthrazitischen Kohlen von Gückelsberg. Diese hatten sicherlich kein höheres Alter als die übrigen Kohlen des Flöhaer Beckens, sind aber nach ihrer Zusammensetzung ein vollkommener Anthrazit. Die Anthrazite besitzen eine ähnliche Zusammensetzung wie Holzkohle, die auf 1.100°C bis 1.500°C erhitzt wurde, nämlich 83% bis 96% Kohlenstoff, 0,6% bis 2,7% Wasserstoff und 0,9% bis 13% Sauerstoff. Alle Steinkohlen, so kann man nach Stein annehmen, die mehr als 4% Wasserstoff enthalten, sind einer höheren Temperatur während ihrer Bildung nicht ausgesetzt gewesen. Dieser Wasserstoffgehalt entspricht nämlich einer Holzkohle, die bei 300°C dargestellt wurde; bei keiner der untersuchten Kohlen aus dem Flöhaer Becken ging der Wasserstoffgehalt über 3% – ein Beweis, wie die eruptiven Umwälzungen (der Porphyrausbruch, später die Tuffablagerungen) die Kohlenbildung beeinflußt haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ich lasse nun die Analysen Stein's über Kohlen des Flöhaer Beckens von fünf verschiedenen Gruben, sowie seine aus den Resultaten zusammengestellten Tabellen folgen. In den Tabellen sind zum Vergleiche die Durchschnittszahlen der analytischen Ergebnisse der Zwickauer, Plauenschen, Lugau-Oelsnitzer und Hainichen-Berthelsdorf-Ebersdorfer Kohlen hinzugefügt. Eine Tabelle über die Gasausbeute ist weggelassen; die Flöhaer Kohlen waren darin nicht behandelt, da sie wegen ihres geringen Bitumengehaltes für die Gaserzeugung nicht in Frage kamen. Im Folgenden sind Stein's Nummern für die untersuchten Kohlenarten (7C, 5, 2, 3, 4) beibehalten worden. Um Zufallsergebnisse zu eliminieren, hat Stein seine Untersuchungen mit größeren Mengen, als sie sonst zur Analyse genommen werden, ausgeführt (immer mehrere Pfund gleichzeitig) und stets zwei- bis fünfmal wiederholt. Hierdurch sind die von Stein unter den Nummern 1 bis 5 angegebenen Einzelergebnisse für Kohlenstoff und Wasserstoff entstanden. Aus den Einzelzahlen hat er dann das Mittel gezogen, das noch durch ein direkt gefundenes Mittel ergänzt wird, aus vereinigten Teilen der zu jeder Einzeluntersuchung genutzten Mengen. (Das würde man heute eine Mischprobe nennen). Über die von Stein gefundene auffällige Geringwertigkeit der Eichler’schen Kohle aus der unteren Karbonstufe (No. 4 der Analysen), die Geinitz ganz im Gegensatz dazu fast dem Gückelsberger Anthrazit gleichstellte, vergleiche den betreffenden Abschnitt in Kapitel IV. Anmerkung der Redaktion: Die Analysenergebnisse werden von Kleinstäuber im Weiteren zitiert. Wir reduzieren diese recht umfangreiche, letztlich aber nur aus anderen Veröffentlichungen übernommene Darstellung auf die Mittelwerte der aschenhaltigen Kohlen (und Streubereiche einiger wesentlicher Daten der Einzelproben), also so, wie die Kohle im Flöz anstand und gefördert wurde; zum einen, da Kleinstäuber keine ausführlichen Angaben übernommen hat, in welcher Weise die Proben während der Analyse im Einzelnen weiter präpariert wurden; zum anderen, weil hier in erster Linie eine Übersicht über die Varietäten der Kohlenlager gegeben werden soll.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. 7C: Kohlen vom Gückelsberg, aus C. G. Morgensterns Werk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anthrazitische Kohle von der Grube Morgenstern, Gückelsberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. 2: Kohle vom oberen Flöze aus dem Sandsteinbruche von C. Anke.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. 3: Kohle von beiden Flözen zusammen, wie sie von C. Anke abgebaut und verkauft wurden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. 4: Kohle aus dem Flöze im unteren Kohlensandstein des Forstbachgrabens von J. G. Eichler.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. 5: Kohlen vom Struthwalde, aus Thiemes Werk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle I: Vergleich der Zusammensetzung der trockenen, aschenhaltigen Kohlen.
Alle Angaben verstehen sich in Prozenten. Die Vergleichszahlen aus den anderen Kohlenbecken sind abgerundet. Anmerkung der Redaktion: Die folgende Tabelle wiederholt noch weitere Angaben aus obigen Analysen, die wir der Übersichtlichkeit halber aber weglassen. Obwohl der Durchschlag teilweise stark verblichen und unleserlich ist, scheinen uns auch einige Zahlen nicht mit den vorher angeführten übereinzustimmen. Wo es uns richtig erschien, haben wir sie daher nach bestem Wissen und Gewissen korrigiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle II: Vergleich der Zusammensetzung der trockenen, aschenhaltigen Kohlen und ihres praktischen und pyrometrischen Heizeffektes.
*) Angaben verstehen sich in Prozenten. Die Vergleichszahlen aus den anderen Kohlenbecken sind abgerundet. 1) Berechnet aus der Zusammensetzung nach Wärmeeinheiten (Anmerkung: Es ist unklar, welche Einheit dieser Zahlenwert hat. Am ehesten ist diese Angabe wohl heute mit dem Brennwert zu vergleichen, welcher im Internet z. B. für Steinkohle mit 8,0 – 9,2 kWh/kg bzw. 6.020 kCal/kg, für Braunkohle mit 5,8 – 6,2 kWh/kg bzw. 4.588 kCal/kg und für Buchen-Scheitholz mit 4,3 – 4,6 kWh/kg bzw. 2.245 – 3.509 kCal/kg (je nach Feuchtegehalt) angegeben wird.) 2) Ist zu verstehen als die Wassermenge von 0° in Pfund, die durch 1 Pfund Kohle in Dampf von 100° verwandelt wird. 3) Berechnet nach der Zusammensetzung in Centesimalgraden (Anmerkung: Zehntel-Grade sind eine hier völlig unklare Einheits- Angabe.) 4) angenommen als ⅔ des theoretischen Heizeffektes, in Pfund Wasser ausgedrückt. Anmerkung der Redaktion: Die einzelnen Zahlenangaben müssen wohl unterschiedlichen Analysen entstammen, denn die im Weiteren angeführten Zahlenwerte gleichartiger Meßgrößen weichen zum Teil von den oben zuerst angeführten Werten deutlich ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle III: Vergleich der spezifischen Gewichte und Porositätsgrade.
Diese Zahlen weichen von denen der anderen sächsischen (Stein-) Kohlen nicht wesentlich ab (außer im Aschegehalt). In der aschefreien Substanz ist die mittlere Dichtigkeit (Anmerkung: Wir sprechen heute kurz von der „Dichte“, wenn das spezifische Gewicht gemeint ist.) der Flöhaer Kohle von allen sächsischen am größten. Anmerkung der Redaktion: Wie weiter unten noch zu lesen ist, ist mit dem Porositätsgrad nicht die Porosität im heutigen Sinne (der Anteil des Porenvolumens in % des Gesamtvolumens), sondern eine „Luftmenge in cm³, die 100 Gramm Kohle enthält“ gemeint.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle IV: Koksausbeute und Beschaffenheit des Kokses.
1) Berechnet nach der Annahme, daß der Schwefelkies in Einfach-Schwefel-Eisen übergeht. Von den anderen sächsischen (Stein-) Kohlen verhält sich bei der Verkokung die Ebersdorfer Kohle so wie die Flöhaer, alle anderen backen und sintern. In der Koksausbeute ist die Flöhaer Kohle höher als alle anderen (diese bleiben alle unter 75%). Im Aschegehalt des Kokses haben die Flöhaer, Dresdner und Ebersdorfer Kohlen zirka gleiche Zahlen, meist höher als die Zwickauer und Lugau- Oelsnitzer. Im Schwefelgehalt ist Flöhaer Kohle geringer als alle anderen sächsischen Kohlen, die bis 5% aufweisen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle V: Über die Flammbarkeit der Kohlen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle VI: Über die Beschaffenheit der Aschen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemerkungen Stein's zu den Analysen und Tabellen.
A) Für die Bestimmung des Wassergehaltes sind die Kohlen bei 100°C bis 105°C in einem Luftbade solange getrocknet worden, bis keine Gewichtsabnahme mehr wägbar war. Im allgemeinen lassen die ausgeführten Wassergehalts-Bestimmungen erkennen, daß der Wassergehalt nicht abhängig ist vom Aschegehalt oder vom spezifischen Gewicht; dagegen enthalten Pechkohlen im allgemeinen mehr hygroskopisches Wasser als die Kohlenschiefer und Rußkohlen. B) Die Bestimmung des Kohlenstoffs, Wasserstoffs und der Asche wurde durch Verbrennen der Proben im Sauerstoffstrom ausgeführt. Die Bestimmung der löslichen Bestandteile der Asche wurde vorgenommen, um zu erkennen, ob eine Benutzung der Asche zu technischen Zwecken zu erwarten sei und die Schmelzbarkeit sollte Andeutungen über das Verhalten auf dem Roste geben. C) Der Stickstoff spielt in der Zusammensetzung der Kohle nur eine untergeordnete Rolle; er ist ein rein zufälliger Bestandteil derselben. Er wurde bestimmt, um eine Grundlage zur Beurteilung der Ammoniakausbeute bei der trockenen Destillation der betreffenden Kohle zu geben. D) Die Bestimmung des Schwefelgehaltes soll hauptsächlich Aufschluß geben über die schädliche Wirkung, die die Kohle beim Verbrennen auf die Heizflächen der Kessel ausübt. Enthält eine Kohle kohlensaure Erden in ihrer Asche, so wird sie bei gleichem Gehalte an Schwefel weniger schädliche Wirkungen auf die Heizflächen ausüben, als eine, die keine oder weiger kohlensaure Erden in der Asche enthält. Der Schwefel, der in der Asche zurückbleibt, wirkt nicht schädlich. Deshalb wurde bei der Untersuchung nicht nur die Gesamtmenge des Schwefels bestimmt, sondern auch der in der Asche zurückbleibende; die Differenz wurde als „schädlicher Schwefel“ aufgeführt. E) Der Aschengehalt der Kohlen aus der Zwickauer Formation beträgt im Durchschnitt 5,75%, der aus der Plauenschen 22,3%, der von Flöha und Gückelsberg 44,87%. Der durchschnittliche Kohlenstoffgehalt der trockenen und aschefreien Zwickauer Kohle ist 83,5%, der der Dresdner 80,4%, der Flöha- Gückelsberger 88,3%. Der Wasserstoffgehalt der aschefreien Kohle beträgt bei den Flöhaer Kohlen 3,32%, bei den Dresdner 4,6%, bei den Zwickauer 4,8%. Sehr wahrscheinlich steht seine Menge im umgekehrten Verhältnis zur Kohlenstoffmenge, wie es für den Sauerstoff sehr deutlich hervortritt, denn der Sauerstoffgehalt der Flöhaer Kohlen ist 8,28%, der der Zwickauer 11,3%, der der Plauenschen 14,5%. Bei Berechnung dieser Durchschnittszahlen sind die Waschkohlen unberücksichtigt gelassen worden. F) In der Tabelle III findet man neben dem volumetrisch ermittelten auch das wirkliche spezifische Gewicht der aschen- und wasserfreien Kohle… (Anmerkung: Wir haben nur die Spalte mit dem „wirklichen“ übernommen.) …und die Luftmenge, welche 100 Gramm Kohle in ihren Zwischenräumen enthalten in cm³ als „Porositätsgrad“. Die mittlere Dichtigkeit (Gemeint ist „Dichte“) der reinen Kohlensubstanz ist für die Kohlen von Flöha und Gückelsberg mit 1,359 am größten, die Zwickauer Kohle hat 1,240; die Plauensche 1,142. G.) Die Heizkraft der Kohle muß unter dem doppelten Gesichtspunkt der Wärmemenge und der Temperatur, die sie zu erzeugen fähig ist, betrachtet werden. Die Wärmemenge ist abhängig von der Menge brennbarer Elemente, die enthalten sind. Bei den Berechnungen ist der absolute Heizeffekt des Kohlenstoffs zu 8.080, der des Wasserstoffs zu 34.462 (Hier fehlt wieder die Angabe einer Einheit) angenommen. Da nun für den in den Kohlen enthaltenen Sauerstoff eine gewisse Menge an Kohlenstoff oder Wasserstoff, mit denen er chemisch verbunden gedacht werden muß, in Abzug zu bringen ist, so wurde, um ein möglichst genaues Resultat zu erzielen, für den Kohlenstoff ¼, für den Wasserstoff ¾ des Sauerstoffs berechnet, weil die Sauerstoffmengen, mit denen ein Gewichtsteil Kohlenstoff und Sauerstoff sich verbinden, wie 1 : 3 sich verhalten. Mit den auf solche Weise gefundenen Wärmeeinheiten wurde dann die Wassermenge in Pfund berechnet, welche ein Pfund Kohle von 0°C auf 100°C zu erwärmen imstande ist. Die beim Verbrennen von Kohle erzeugte Temperatur ist wieder abhängig von der Menge und Wärmekapazität der Verbrennungsprodukte und des gegenwärtigen Stickstoffs in der Luft, sowie der latenten Wärme des Wasserdampfes. Hiernach ist der „pyrometrische Effekt“ der Kohlen in Tabelle II berechnet worden unter Zugrundelegung der aus den absoluten Effekten berechneten Zahlen: 2.482°C für den Kohlenstoff und 2.316°C für den Wasserstoff. Allerdings darf bei Benutzung der Angaben über den pyrometrischen Effekt nicht übersehen werden, daß die Porosität einer Kohle nicht ohne Einfluß auf ihre pyrometrische Wirkung sein kann; denn die Temperatur, welche sie bei ihrem Verbrennen erzeugen kann, ist nicht ganz allein bedingt durch die vorangeführten Ursachen, sondern auch durch die Schnelligkeit ihres Verbrennens. Sie ist ja nichts anderes, als die Wärmemenge, welche in jedem Augenblick entwickelt und nach außen abgegeben wird. Sie muß sich notwendigerweise erhöhen, wenn eine größere Menge des wärmeerzeugenden Materials in jedem Augenblick verbrennt. Der pyrometrische Effekt bedeutet daher auch keineswegs, daß man mit zwei Kohlen von verschiedenem pyrometrischem Effekte absolut gesprochen nicht gleich hohe Temperaturen erzeugen könnte, sondern er drückt nur das umgekehrte Verhältnis der Mengen aus, die von beiden Kohlen in derselben Zeit verbrannt werden müssen, um dieselbe Temperatur zu erhalten. Was übrigens die Verschiedenheiten in den Heizeffekten der Plauenschen, Zwickauer und Flöhaer Kohlen betrifft, so sind sie in der Hauptsache nur im Aschengehalt begründet. Der mittlere Aschengehalt der ersteren beträgt 5,78%, der zweiten 22,3%, der letzteren 44,87%. Daraus berechnet sich der Heizeffekt der aschenfreien Kohlen von Zwickau zu 7,3; der der Plauenschen zu 7,07 und der Flöhaer zu 6,9. Die aschenfreien Kohlen besitzen demnach nahezu denselben Heizeffekt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem ich hiermit die Bemerkungen Stein's zu seinen Untersuchungensergebnissen im Auszug mit Rücksicht auf die Eigenart der chemisch-technischen Darstellungsweise als Nichtfachmann größtenteils wörtlich angeführt habe, lasse ich hier noch eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und Urteile Stein's über die Kohlen des Flöhaer Beckens folgen. Flöhaer Kohlen enthalten verhältnismäßig wenig hygroskopisches Wasser, sie sind trockener als die Zwickauer Kohlen. Die Aschen der Flöhaer Kohlen stehen bezüglich der löslichen Bestandteile teils in der Mitte zwischen Zwickauer Kohlen, die mehr, und Plauenschen, die weniger lösliche Teile enthalten. Mit 44,87% ist der Aschengehalt der Flöhaer Kohlen der höchste durchschnittliche aller sächsischen; eine Ausnahme bilden die Gückelsberger Anthrazitkohlen, die besten Zwickauer Pechkohlen gleichstehen. Die Schieferkohlen des Hainichener Beckens, wie die des Plauenschen Grundes sind größtenteils nicht viel besser im Aschegehalt, einzelne Sorten übertreffen sogar darin die schlechtesten Flöhaer Kohlen. Der Gehalt an „schädlichem Schwefel“ ist bei den Flöhaer Kohlen geringer, der durchschnittliche Kohlenstoffgehalt der aschefreien Substanz größer, als bei allen sächsischen Kohlen; dafür ist ihr Gehalt an Wasserstoff und Destillationsprodukten gering, zur Leuchtgaserzeugung eignet sie sich gar nicht. Das spezifische Gewicht kann dazu benutzt werden, die relative Größe und Dauer des Druckes anzudeuten, dem die betreffende Steinkohlenart ausgesetzt war und noch ist. In praktischer Beziehung leitet sich daraus die größere oder geringere Entzündlichkeit und die Verbrennungsweise der Kohle ab. Ihre große spezifische Dichte ist die Ursache der notorisch schweren Entzündbarkeit der Flöhaer Kohle, ihre geringe Porosität zusammen mit dem hohen Aschegehalt macht sie zur Erzeugung augenblicklich hoher pyrometrischer Heizeffekte ungeeignet, doch darf man in allen Fällen, wo es sich nur um eine möglichst vollkommene Ausnutzung der erzeugten Wärme bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen handelt, im langsamen Verbrennen und in der großen Aschemenge ein Wärme-Magazin sehen, welches die Ausnützung begünstigt. In solchen Fällen kann eine dichte, aschenreiche Kohle wie die Flöhaer, wenn sie im Verhältnis zu ihrem Aschengehalt billiger ist, größere ökonomische Vorteile bieten, als eine aschenarme, aber teurere. Infolge der großen spezifischen Dichte enthält auch ein Hohlmaß mit Flöhaer Kohle immer mehr Substanz, als ein solches mit poröser Kohle; man rechnet deshalb den Scheffel Flöhaer Kohle zu 180 bis 200 Pfund (Zwickauer nur 160 Pfund). Zur Ermittlung der praktischen Verdampfungskraft in Tabelle II hat Stein ein Mittel der berechneten theoretischen Verdampfungskraft genommen. Die dadurch gewonnenen Zahlen für Pfunde Wasser, die 1 Pfund Steinkohle imstande ist, von 0°C auf 100°C zu erwärmen, entsprechen im großen Ganzen den weiter unten angeführten Zahlen, die Hartig bei seinen praktischen Heizversuchen ermittelte, wobei er aber eine Erwärmung bzw. Verdampfung von 0°C auf 150°C zur Norm genommen hat. Nach Stein ist die praktisch nutzbare Verdampfungskraft der untersuchten…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ziehen wir aus Stein's Untersuchungen die Nutzanwendungen für die praktische Eignung der Flöhaer Kohlen, so ergeben sich folgende Urteile: 1.) Für Benutzung als Hausbrand: Bevorzugt wird zwar in erster Linie ein billiges Heizmaterial, man wird aber eine höhere Ausgabe nicht scheuen, wenn man dafür eine Kohle bekommt, die am wenigsten lästige Eigenschaften aufweist, also geringer Aschengehalt und Schwefelgehalt, leichte Brennbarkeit und wenig Ruß. Die Flöhaer Kohle besitzt ganz geringen Schwefelgehalt und erzeugt infolge ihrer Armut an Destillationsprodukten wenig Ruß, ihr Aschengehalt ist aber zum größten Teil sehr groß, sie brennt infolge geringerer Porosität schlecht an und fort. Sie ist also zum Hausbrand normalerweise nur bedingt geeignet. 2.) Für Anwendung zu technischen Zwecken: Wenn es sich um technische Zwecke handelt, bei welchen es auf die Erzeugung einer nur mäßigen, aber anhaltenden Hitze ankommt, wie zur Heizung von Trocken- und Verdampfungsräumen, Kalköfen usw. ist die Flöhaer Kohle bei entsprechend niedrigem Preise vorzüglich geeignet, da sie möglichst vollständige Ausnutzung der erzeugten Wärmemenge gestattet. Die Aschenmenge ist hierbei nicht nur unschädlich, sondern unter Berücksichtigung des Preises sogar vorteilhaft. Selbst das Sintern der Asche tritt unter den hier vorausgesetzten Verhältnissen gegen die angeführten Gründe in den Hintergrund, weil das Reinhalten des Rostes leicht ausgeführt werden kann und ein fortwährend starker Luftzug entweder nicht nötig ist oder leicht durch Errichtung eines Schornsteins erzeugt werden kann. Anders verhält es sich bei Kesselfeuerungen von Dampfmaschinen und Lokomotiven. Bei diesen wird nicht nur eine bestimmte Wärmemnge überhaupt, sondern in möglichst kurzer Zeit verlangt. Bei Lokomotiven kommt noch hinzu, daß sich die Roste nicht verstopfen dürfen. Für diese Zwecke ist Flöhaer Kohle infolge ihres hohen Aschegehaltes im allgemeinen ungeeignet, abgesehen von den anthrazitischen Kohlen. 3.) Für Benutzung als Heizmaterial für technische Zwecke, die eine sehr hohe Temperatur bei langer Flamme erfordern, also für die eigentlichen pyrotechnischen Arbeiten, sowie zur Darstellung von Gas, wie überhaupt zur Gewinnung von Destillationsprodukten ist die Flöhaer Kohle völlig ungeeignet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Resultate werden im Wesentlichen bestätigt durch die Untersuchungen, die Hartig über die praktische Heizkraft der Steinkohlen anstellte (3. Abteilung der „Steinkohlen Sachsens“). Er benutzte bei seinen etwas später gemachten Versuchen von Flöhaer Kohlen nur solche von den Werken C. F. Hesse's aus dem Pfarrwalde, also nicht gerade die besten Kohlen des Flöhaer Beckens, die er unter dem Kessel einer Chemnitzer Maschinenfabrik verbrannte. Nach seinen Untersuchungen kann man anehmen, daß bei praktischer Verwendung der Steinkohle immer etwa 3% ‒ 4% der brennbaren Substanz unverbrannt in den Rückständen bleiben; dieser Verlust scheint sogar bei Kohlen von sehr großem Aschengehalt, wie bei den Kalkschieferkohlen des Plauenschen Grundes und des Flöhaer Beckens, bis zu 10% und darüber zu steigen. Es zeigte sich bei solchen Kohlen, daß die Schlacken in Form harter unschmelzbarer Steine, die sich nur schwer durch den Rost drücken ließen, und nur ungenügend ausbrannten, übrigblieben. Als Aschegehalt bezeichnet Hartig infolgedessen die Summe aller unverbrennlichen Rückstände der vom Rost gezogenen Aschen und Schlacken, sowie des Aschenfalles („praktischer Aschengehalt“). Dieser gibt zur Beurteilung der Kohlen eine viel sicherere Grundlage, als die in kleinen Proben festgestellten „theoretischen Aschengehalte“, weil er sich auf die ganze, zum Versuch benutzte Kohlenmenge bezieht. Bei den meisten Torf-, Braun- und Steinkohlen übersteigt die Aschenmenge das Quantum der unlöslichen Bestandteile, wie es in der Asche von Pflanzen auftritt; es ist also anzunehmen, daß diese Verunreinigung aus dem mechanischen Einfluß von Schlammwässern während der Bildungsperiode der Kohle herrührt, von denen besonders die Flöhaer Kohlenschichten durch die eruptiven Störungen heimgesucht worden sind. Die vor den heiztechnischen Versuchen vorgenommene Analyse der Hesse’schen Kohle, die unter Stein's Versuchen nicht enthalten ist, ergab folgende Zusammensetzung:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wasser-, aber nicht aschefreie Kohle:
Brennbare Substanz (aschefrei):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei den damaligen praktischen Heizveruchen zeigte sich für die Hesse’sche Kohle als einzige Vertreterin von Kohle aus dem Flöhaer Becken folgende nutzbare Verdampfungskraft: Es wurde Wasser von 0° in Dampf von 150°C verwandelt:
Zum Vergleich die entsprechenden Werte für 1 Pfd. …
(Beim Vergleich mit Stein's Resultaten muß beachtet werden, daß dieser Dampf von 100°C als Norm nahm.) Die Flöhaer Kohle schnitt also äußerst ungünstig ab. Für rohe, wasserhaltige Kohle gibt Hartig die unverbrennbaren Teile (den praktischen Aschengehalt) bei 4,88% Wassergehalt zu 63,4% an. Hartig gibt selbst folgende Bemerkungen zu seinem Versuch mit Flöhaer Kohle: „Diese Kohle liefert die größte Menge unverbrennlicher Rückstände; ihre Behandlung im Feuer wird dadurch überaus beschwerlich. Von allen sächsischen Kohlen besitzt sie den geringsten Heizwert, doch verbrennt sie vollkommen rauchfrei. Nach vor dem Versuch gemachter Probe brennen diese Kohlen sehr schwer an, deshalb wurde mit Pechkohlen vorgefeuert. Die Schlacken sind von weißer bis grauer Farbe, an der Oberfläche porzellanartig geschmolzen, im Innern teilweise noch unverbrannt und schwarz. Beim zweiten Versuch wurde die Kohle in kleine Stücke geschlagen, trotzdem waren auch diese nicht vollständig ausgebrannt, aber sehr lange im Glühen.“ Bei diesen Versuchen Hartig's wurden auch vergleichende Beobachtungen über die Größe der Anstrengung gesammelt, die bei den einzelnen Kohlenarten die Bedienung des Feuers vom Heizer verlangt. Sie hängt ab von der Verdampfungskraft, vom Aschengehalt, von dem Grade der Zerkleinerung der Kohlen, ferner davon, ob diese zusammenbacken oder nicht, ob die schlacken sintern, ob sie sich leicht entfernen lassen oder den Rost häufig verstopfen. Je nach diesen Eigenschaften war eine verschieden hohe Zahl von Beschickungen und Schürungen des Feuers nötig, wenn eine bestimmte Dampfmenge entwickelt werden sollte. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über diese Zahlen, die bei den verschiedenen Kohlenarten zur Verdamfung von 10.000 Pfd. Wasser von 0° erforderlich waren (das Gewicht einer Beschickung zu 60 Pfg. auf den ganzen Rost gerechnet).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Reihenfolge in der Übersicht geht nach der Größe der Anstrengung. Die Hesse’sche Kohle ist die letzte, vorher kommt die Kalkschieferkohle des Plauenschen Grundes. Sogar die böhmische Braunkohle (allerdings eine der besten bekannten Braunkohlenarten) gibt günstigere Resultate.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Unterhaltung eines regelmäßigen Feuers mit den Schieferkohlen des Plauenschen Grundes erfordert also nach dieser Aufstellung zwei- bis dreimal, mit Kohle aus dem Flöhaer Becken 4 ½ mal soviel Anstrengung, als mit Kohlen aus dem erzgebirgischen Becken. Mildernd für die Beurteilung der Flöhaer Kohlen ist der Umstand, daß nur Kohle von einem Werke benutzt wurde, welches nicht gerade die besten Kohlen förderte. Mit Gückelsberger Kohle oder auch mit der besseren Kohle der unteren Karbonstufe bei Altenhain, wie sie zeitweise gefunden worden ist, wäre das Ergebnis wohl günstiger geworden. Hartig hat bei seinen Versuchen auch die Gewichte eines Scheffels Kohle ermittelt. Die Flöhaer Kohle weist dabei die höchsten Gewichtszahlen auf. Es betrug das mittlere Gewicht eines Scheffels Flöhaer Kohle in großen, plattenförmigen Stücken 171,2 Pfund, in kleinen Stücken 197,6 Pfund, ohne Überhöhung des Meßgefäßes. Bei späterer Umrechnung statistischer Zahlen ist deshalb das durchschnittliche Gewicht für einen Scheffel Flöhaer Kohle mit 180 bis 200 Pfund angenommen worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)
Statistik des Kohlenbergbaus im Flöhaer Becken
Statistische Nachrichten über die Entwickelung des sächsischen Kohlenbergbaus überhaupt sind bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts gering und unvollständig. So liegen auch vom Bergbau im Flöhaer Becken gerade über seine Blütezeit bis 1850 nur lückenhafte statistische Zahlen vor. Als die statistische Erfassung des sächsischen Kohlenbergbaus amtlich geschah, waren die meisten Werke des Flöhaer Beckens schon eingegangen oder standen kurz davor. So mußte ich mich bei den meisten Werken darauf beschränken, gelegentliche Zahlen aus den durchgearbeiteten Akten und anderen Quellen zusammenzustellen und soweit dies bei der Lückenhaftigkeit derselben möglich war, allgemein gültige Schlüsse und Folgerungen daraus zu ziehen suchen. Genauere und vollständigere Zahlen können nur für den Abbau im Pfarrwald, wie er aus den Akten der Forstverwaltung und des Forstrentamtes ersichtlich wird, gegeben werden und ferner für das Pfarrwaldwerk, über welches einmal die Pfarrkohlenkasse der Superintenditur Flöha Auskunft gibt und das auch für die letzten zwei Jahrzehnte (1860 bis 1880) teilweise von der amtlichen Statistik noch erfaßt worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst seit 1853 flossen dem statistischen Büro des Kgl. Sächs. Ministeriums des Innern in Dresden statistische Einzelheiten von den Kohlenwerksinspektionen gleichmäßiger zu und wurden von den Zeitschriften dieses Büros von Zeit zu Zeit zusammengestellt und veröffentlicht. Die in den Jahrgängen 1855, 1857, 1860, 1864 und 1867 der Zeitschrift des statistischen Büros enthaltenen Veröffentlichungen, der 4. Band der schon öfters erwähnten Monographie über die Steinkohlen Sachsens von Köttig und der 3. Band der „Steinkohlen Deutschlands“ von Fleck und Hartig sind denn auch bei den folgenden Darstellungen neben den Akten als Unterlagen mit benutzt worden; doch war hierbei eine gewisse Vorsicht nötig, da unter „Flöhaer Revier“ meist das Flöhaer und das Hainichen- Ebersdorfer Becken zusammengefaßt waren. Eine Ergänzung bildeten die seit 1865 veröffentlichten Berichte der Handelskammer Chemnitz. Fassen wir zunächst die wichtigsten statistischen Daten, wie sie sich aus den genannten Quellen von 1856 bis 1880 ergeben für die einzelnen Abbaugebiete des Flöhaer Beckens zusammen, so finden wir…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.) Abbau auf Gückelsberger Flur: a.) Grubenfeld und Besitzverhältnisse: Das sogenannte „Akkordfeld“ umfaßte 450 Scheffel Kornaussaat, davon waren abbauwürdig 265 Scheffel; es wr der größte Teil der Gückelsberger Flur nördlich der Chemnitz-Dresdener Landstraße. Kohlenzins durchschnittlich 9 Pfg. pro Scheffel (6 Pfg. für Kalkkohle, 12 Pfg. für Schmiedekohle). Außerdem baute Morgenstern auf seinem eigenen Grundstücke, nicht zum Akkordfeld gehörig, aber von geringer Ausdehnung, ab. Unternehmer:
b.) Hauptbaue: Auf dem Akkordfeld drei flache Stollen (oberer, mittlerer und Johann Georgen Stolln), letzterer 1840 mit einer Länge von 624 m, brachte 41 m Teufe am Pomselschacht ein. Ferner ein tiefer Stollen (Oehlschlägel-Stolln), dieser...
1802: 50 m aufgefahren, Für Förderung und Fahrung 5 Hauptschächte:
Tippmann- Schacht, flache Gesamttiefe 29,5
m, Über die große Zahl kleinerer Schächte und Stollen vrgleiche den geschichtlichen Abschnitt in Kapitel IV. Auf Morgensterns Felde drei kleine Schächte, zwischen 11 und 18 m tief.
c.) Flözverhältnisse: Auf dem Akkordfelde zwei bis vier Flöze, Gesamtstärke 0,3 m bis 1,0 m, stellenweise bis 1,15 m. Schieferkohle mit Pechkohlenschichten; Zwischenmittel 0,5 m bis 6,0 m stark. Auf Morgenstern's Felde nur ein Flöz, 0,5 m bis 0,6 m stark, anthrazitische Kohle. Allgemein schwache Neigung der sehr unregelmäßigen Flöze nach Südost.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d.) Förderung:
Mit Hülfe der vorangehenden bekannten Fördermengen für einzelne Jahre ist unter Berücksichtigung der übrigen Umstände, wie sie im geschichtlichen Abschnitt Kapitel IV dargestellt sind, versucht worden, eine vorsichtige Schätzung der Gesamtförderung auf Gückelsberger Flur zu erstellen… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demnach sind also auf Gückelsberger Flur von 1800 bis 1870 zirka 400.000 Scheffel Steinkohle aus der oberen Karbonstufe abgebaut worden oder ungefähr 800.000 Ctr. (oder 40.000 Tonnen).
e.) Arbeiter- und Lohnverhältnisse:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taler und alte Groschen sind in
folgender Zusammenstellung in Mark umgerechnet.
(auf Morgenstern's Feld)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(auf Morgenstern's Feld)
Wenn zwischen den Arbeiterkategorien kein
Unterschied aus den Quellen hervorging, ist in den Aufstellungen ihre
Gesamtzahl unter Hauer eingesetzt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f.) Gestehungskosten für den Scheffel Kohle: Schippan 1844
(nach Franke's Ertragsberechnung, vgl. geschichtlichen Abschnitt):
ohne
Berücksichtigung der allgemeinen Verwaltungskosten, Verzinsung des
angelegten Kapitals und der Arbeitsvergütung für den Unternehmer als
Leiter.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Morgenstern 1862
(nach den Angaben des Kohlenwerksinspektors berechnet):
Hierzu kämen noch die Kosten für Schachtförderung, Zimmerung, Wasserhaltung; ferner allgemeine Unkosten und Morgenstern's Arbeitsvergütung (er hatte keinen Steiger), so daß Morgenstern sicher mit Verlust arbeitete, denn nach den statistischen Notizen des Kohlenwerksinspektors betrugen… die Gesamtkosten bei 4.985 Scheffel Förderung über 1.425 Tlr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g.) Preise der Gückelsberger Kohle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B.) Abbau auf Flöhaer Flur: 1.) auf Ulbricht's und Lange's Feldern. Auf Ulbricht's Feldern und ganzem Hofe von der vorderen bis zur hinteren Ulbrichtschlucht und auf Lange's Feld in der vorderen Ulbrichtschlucht bauten ab:
Flöze: zwei von 0,3 m bis 0,4 m Stärke. Im Übrigen fehlen alle zahlenmäßigen Unterlagen. Kögel zahlte an Ulbricht für das Unterirdische eine Abfindung von 105 Tlr. und einen jährlichen, festen Zins von 18 Tlr. Bis 1840 waren die Kohlenfelder restlos abgebaut. Im Jahre 1832 ereigneten sich zwei Unglücksfälle auf dem Bau. Die Gesamtförderung kann man unter Berücksichtigung des Umstandes, daß das Grubenfeld ungefähr die halbe Größe des Gückelsbergers hatte und die Flöze nur halb so mächtig waren als dort und infolge geringer Bauwürdigkeit die wirkliche Abbauzeit bloß zirka 25 Jahre dauerte, auf vielleicht rund 50.000 Scheffel (zirka 10.000 t) schätzen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.) auf Richter's Feldern, östlich der
vorderen Ulbrichtschlucht, a.) Grubenfeld und Besitzverhältnisse: Insgesamt 6 Acker und 150 Quadratruthen. Bis 1863 waren davon abgebaut 5 Acker und 90 Quadratruthen. Der Abbau umfasste 1860 noch eine Fläche von 50 Quadratruthen, 1864 noch von 40 Quadratruthen. Unternehmer:
b.) Hauptbaue: Im Laufe der Zeit
bestand eine große Anzahl von Schächten, von denen aber gewöhnlich immer
nur einer gangbar war; 1825 waren zwei Schächte vorhanden.
c.) Flözverhältnisse: Zwei Flöze von je 0,2 m bis höchstens 0,35 m Stärke; Zwischenmittel gewöhnlich nicht über 1 m.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d.) Förderung:
Gesamtförderung: …Auf Richters Feldern sind also von 1812 bis 1863 rund 200.000 Scheffel (etwa 40.000 t) abgebaut worden. Die Schätzung von 3.500 Scheffel jährlich bis 1853 dürfte eher zu niedrig als zu hoch sein, da besonders um das Jahr 1850 auf Kieber’s Werk die Arbeiterzahl 7 beträgt, während sie 1845, wo uns die Förderung mit 3.500 Scheffel angegeben wird, nur 5 betrug. Das Kieber’sche Werk wird zudem als eins der bedeutendsten auf Flöhaer Flur genannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e.) Arbeiter- und Lohnverhältnisse: Taler und alte Groschen sind in
folgender Zusammenstellung in Mark umgerechnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f.) Gestehungskosten für den Scheffel Kohle (2 Ctr.): 1860:
Bei 6.564 Scheffel Förderung liegen sie bei 61 ⅓ Pfg. pro Scheffel; hierzu käme noch der leider nicht bekannte Grundzins an Richter, so dass der Selbstkostenpreis den Verkaufspreis von 70 Pfg. pro Scheffel erreicht oder ihm sehr nahe kommt, ohne daß auch nur eine Kapitalverzinsung herausspränge.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1861:
Bei 4.223 Scheffel Förderung liegen sie bei 65 1/5 Pfg. pro Scheffel; so daß, zuzüglich des Grundzinses, schon mit Verlust gearbeitet wurde bei einem Verkaufspreise von 70 Pfg. pro Scheffel.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1862:
bei 935 Scheffel Förderung, das ist 73 ⅓ Pfg. pro Scheffel bei 70 Pfg. Verkaufspreis. Außer dem Grundzins ist hierbei noch das Gehalt Schuhmann's als Aufseher weggelassen, das in diesem Jahre in die Statistik des Kohlenwerksinspektors nicht eingesetzt ist (Schuhmann leitete jetzt Kieber's Werk und arbeitete wahrscheinlich als Hauer mit.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1863: wurde mit 6 Arbeitern in Tag- und Nachtschicht ein neuer Schacht geteuft, der aber wegen Wassers Ostern 1863 wieder verlassen werden mußte. Die Aufwendung waren … zusammen 262 Taler, abgebaut wurden dabei 54 Scheffel zu einem Verkaufspreis von 85 ½ Pfg. = 10 Tlr., so daß ein Rohverlust von 252 Tlr. blieb.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g.) Kohlepreise auf Kieber's Werk:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.) Abbau auf Anke's Feldern und
Steinbrüchen, Unternehmer:
Flözverhältnisse: Zwei Flöze von ungefähr 0,2 m Stärke, Zwischenmittel 2,5 m. Weitere Unterlagen zur Statistik sind leider nicht vorhanden; Analyse der Kohle beider Flöze siehe Abschnitt a) dieses Kapitels.
Förderung: Die Gesamtförderung sei mit Rücksicht auf die geringe Flözstärke und darauf, dass der Abbau außer von 1820 bis 1835 nur mit Unterbrechungen stattfand, auch sich hauptsächlich auf das obere Flöz beschränkte und nur 1850 bis 1853 auch auf das untere mit ausgedehnmt wurde, mit etwa 50.000 Scheffel (etwa 10.000 Tonnen) angenommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.) Abbau auf den Fluren des Lehngerichts. a.) Grubenfeld und Besitzverhältnisse: Lehngerichtsflur und das daran liegende Beigut, zwischen Richter's Feldern im Süden und Osten und Ulbricht's im Nordweten. Kohlenführendes Areal nach Kind 1845: 50 Scheffel Kornaussaat oder 170.000 m², davon abbauwürdig 57.000 m²; nach Fink's Angabe von 1853: 20 Acker. Abgebaut waren bis 1843: 7.000 m²; bis 1853: 8.400 m². Unternehmer:
Grundzins bei Verpachtung an Fink 13 Pfg., bei Schuhmann unbekannt.
b.) Hauptbaue: Schächte um 1800: drei mit 7 m bis 25 m Teufe bis zum Flöz, 1837 bis 1845: vier Schächte A bis F mit Teufen von 18 m bis 40 m bis zur Stollnsohle bzw. bis zum Flöz (nur Schacht F war nicht auf die Stollnsohle durchschlägig). 1853: ein Schacht mit 48 m Teufe, 1862: ein Schacht mit 36 m Teufe bis zum Flöz. Ferner ein Stollen von der Ulbrichtschlucht, etwa 500 m lang mit 32 m Teufe (seit 1846 gemeinsam mit Kiebers Werk).
c.) Flözverhältnisse: Zwei Flöze, Höchststärke je bis 0,27 m, oft unbauwürdig, sich bis auf 0,1 m verschmälernd; Zwischenmittel selten über 0,5 m. Über und unter den Flözen oft noch eine Anzahl Kohlenschmitzen bis 1,4 cm stark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d.) Förderung:
Gesamtförderung: …Unter Berücksichtigung der kleinen Mengen, die J. G. Schippan um 1800 und 1824/1825 abbaute, kann man die Gesamtförderung des Lehngerichtswerks vielleicht auf 75.000 Scheffel (etwa 15.000 t) schätzen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e.) Arbeiter- und Lohnverhältnisse: Taler und alte Groschen sind in
folgender Zusammenstellung in Mark umgerechnet.
*) außerdem 5 Mann beim Stollenbau.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f.) Gestehungskosten für den Scheffel Kohle (185 – 200 Pfd.): Moritz Schippan 1845:
(nach Kind's Angaben)
Grundzins war nicht nötig, solange der Lehnrichter selbst abbaute. Die Gestehungskosten vor 1845 waren höher gewesen, da von 1837 bis 1845 vier Schächte neu abgeteuft worden waren und der Stollen gebaut wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pächter Fink 1853: (nach den Akten zur Erhebung statistischer Nachrichten der
Kohlenwerksinspektion Zwickau)
bei 7.189 Scheffel Förderung, oder für 1 Scheffel 56 ¾ Pfg. bei einem Verkaufspreise von 72 Pfg. Trotz des hohen Grundzinses holte Fink in diesem Jahre also noch einen Reingewinn von 15 ¼ Pfennig pro Scheffel heraus, oder bei 5 ¼ Pfg. Vergütung für seine Aufsichts- und Steigertätigkeit (150 Tlr. bei 7.189 Scheffel) immer noch einen Unternehmergewinn von 10 Pfg. pro Scheffel.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pächter Schuhmann 1863:
(über die verlustreiche Wiederaufnahme des Werkes vgl. Kapitel
IV)
für 1.384 Scheffel Förderung, oder pro Scheffel 72 ⅔ Pfg. ohne Grundzins und Vergütung für die Unternehmertätigkeit. Wenn der Grundzins, was uns leider nicht übermittelt wird, noch 13 Pfg. betragen hätte, ständen 85 ⅔ Pfg. Gestehungskosten einem Verkaufspreis von 70 Pfg. gegenüber. Für die Folgejahre fehlt uns zur Unterlage der Berechnung der Materialverbrauch, da aber die Arbeitslöhne zur Förderung proportional blieben, werden bei gleichbleibendem Materialaufwand und Verkaufspreis die Gestehungskosten und der Verlust nicht niedriger gewesen sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g.) Verkaufspreis der Kohle des
Lehngerichtswerks:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.) Abbau im Flöhaer Pfarrwald. a.) Grubenfeld und Besitzverhältnisse: im Besitz des Flöhaer Pfarrlehens; Areal zirka 106 Acker, 278 Quadratruthen; davon etwa ⅓ kohleführend. Grundzins: ein Zehntel der Förderung, abzuführen an die Pfarrholzkasse Flöha, wo das Pfarrkohlenkapital gebildet wurde, dessen Zinsen dem jeweiligen Pfarrer zustanden. Unternehmer:
b.) Hauptbaue: 1852 bestanden ein Schacht von 17 m Tiefe, 14 m bis zum Flöz und zwei weitere Schächte von je 24 m Tiefe bis zum Flöz. Weitere Schächte wurden geteuft 1856, 1862, 1871, die 31 m bis 40 m tief waren. Dazu ein Stollen, 160 m lang, 60 m Tiefe.
c.) Flözverhältnisse: Zwei bis vier Flöze von 0,05 m bis 0,40 m Stärke, Gesamtmächtigkeit bis 0,75 m; Zwischenmittel gewöhnlich nicht über 1 m. Streichen hor. 5,4, Fallen 10° bis 15° in Süd, aber sehr wechselnd in dieser Beziehung.
d.) Förderung: Der Umstand, daß Eigentümer des Pfarrwaldes eine Behörde war, deren Akten über Abbau und dafür abgelieferten Zehnten erhalten sind, ermöglichte es, ebenso wie später beim Bergbau im fiskalischen Struthwald, die Förderung fast bis auf den Scheffel genau zu erfassen. Die folgenden Produktionsziffern bis 1855 sind nach den Akten des Justizamtes Augustusburg No. 46 und der Flöhaer Ephoralakten berechnet. Für die Förderung von 1855 bis 1881 waren die genauen Zahlen für jedes Jahr im Anhang über das Pfarrkohlenkapital bei der Pfarrholzkasse zu finden. Letztere Zahlen stimmen nicht immer mit
denen überein, die die Kohlenwerks-Inspektion Zwickau und später die
Berginspektion Chemnitz in ihren statistischen Angaben führen. Das mag
daran liegen, daß sie nur den wirklichen Verkauf angeben, jene anderen die
ganze Jahresförderung. Für das Endergebnis der Gesamtproduktion gleichen
sich diese Unterschiede jedoch aus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Förderung im Pfarrwalde betrug laut nachfolgender Übersicht:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ganz genau genommen kann sich die Produktionsziffer noch um einige Hundert Scheffel erhöhen, da das Förderquantum von 1839 bis 1850 nach den abgeführten Zehnten bei einem angenommenen Verkaufspreise von 75 Pfg. berechnet wurde, der Verkaufspreis aber nicht immer diese Höhe hatte, z. B. 1846 nur 72 Pfg. Von der Oberfläche waren nach den Vermessungen der Forstbehörde durch den Abbau im Pfarrwald benutzt (laut Akten des Justizamtes Augustusburg No.46 Vol. II):
e.) Arbeiter- und Lohnverhältnisse: In unserer Kopie fehlt leider die erste Spalte der Tabelle mit den Jahreszahlen. Insgesamt waren zwischen 3 und maximal 21 Arbeitern beschäftigt, davon zwischen 2 und 4 Förder- und Zimmerleute. Der durchschnittliche Wochenlohn eines Arbeiters schwankte zwischen 6 Mark und 11,50 Mark, also einem Jahresverdienst von 312.- bis 598,- Mark. Der Wochenlohn des Steigers lag zwischen 8,75 und 12,- Mark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f.) Gestehungskosten für den Scheffel Kohle (nach Angaben der Kohlenwerksinspektion): 1852, Hesse:
für
geförderte 13.086 Scheffel,
also für einen Scheffel 68 1/5 Pfg, bei einem Verkaufspreis von 75 Pfg. Im Jahr 1863 hatten sich die Gestehungskosten nach gleicher Rechnung auf 66,87 Pfg. erhöht, zuzüglich Grundzins von 7,5 Pfg. = 74,37 Pfg. pro Scheffel. Bei einem Verkaufspreis von 75 Pfg. pro Scheffel blieb also in diesem Jahre kein Unternehmergewinn, denn durch die geringe Differenz von 0,63 Pfg. pro Scheffel war noch nicht einmal die Vergütung für Hesse’s Tätigkeit als Aufseher gedeckt. 1863 war ein kritisches Jahr für den Bergbau im Flöhaer Becken, das zur Stillegung aller anderen Werke führte; nur das Pfarrwaldwerk kam ohne allzugroßen Verlust davon.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g.) Verkaufspreis der Kohle des
Lehngerichtswerks:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.) Abbau im fiskalischen Struthwald. a.) Grubenfeld und Besitzverhältnisse: Der einzige abbauwürdige Teil des Kohlenfeldes im Struthwald (obere Karbonstufe) ist in den Unterabteilungen 6b, 6c und 6e gewesen, nördlich und südlich des Wiesener Flügels. Der Fiskus als Besitzer der Oberfläche verlangte als Grundzins 6 Pfg. vom Scheffel geförderter Kohle. 1840 werden etwa 4 Acker bebauten Areals angegeben. Unternehmer:
b.) Hauptbaue: Infolge der geringen Tiefe der Kohlenflözchen sind im Laufe der 17 Jahre des Abbaus eine sehr große Zahl kleiner Schächte geteuft worden, deren Tiefe von 3 m bis 15 m schwankte. Stolln und feste Tagesbauten bestanden nicht, nur Brettergebäude.
c.) Flözverhältnisse: Meist zwei, manchmal drei Flözchen von 0,07 m bis 0,24 m Stärke, gewöhnlich innerhalb eines Meters zusammenliegend, mit einer durchschnittlichen Gesamtmächtigkeit von 0,5 m.
d.) Förderung: Aus den Forstrechnungen des Amtes
Augustusburg, jetzt im Hauptstaatsarchiv aufbewahrt, ließ sich die
Förderung aus den aus den unter Forstnebennutzung im Plauer Struthwald
angeführten Tonnenzins-Summen rekonstruieren. Die aus dem Tonnenzins
solcherart errechneten Fördermengen stellen aber Minimalzahlen dar, denn
es sind bei der mangelnden Aufsicht sehr häufig Unterschleife zum Schaden
des Fiskus vorgekommen. Namentlich während des Betriebs durch die Witwe
Pötzsch wurden solche mehrfach entdeckt, indem der angeblich 53 Scheffel
fassende Kohlenmeßkasten an der Grube ohne Anzeige an die Aufsichtsbehörde
(Förster Lüttich) geleert und die Kohlen verkauft worden waren. Auch
stellte sich später heraus, daß der Meßkasten nicht 53, sondern 62
Scheffel faßte, so daß die Förderung in Wirklichkeit fast
1/6
größer war, als in den Forstregistern angegeben. In den Akten der
Oberförsterei Zschopau (Lit. A, Kap. Vb, No. 15) findet sich auch ein
Bericht, wie entdeckt worden war, daß die Arbeiter bei mangelnder Aufsicht
durch die verwitwete Pötzsch sich unrechtmäßig einen Nebenverdienst
verschafften, indem sie Förderkohle unter Umgehung des Meßkastens auf den
Abfuhrhaufen fuhren und verkauften. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach den Forstrechnungen betrug:
Aus dem Felde, das Pötzsch abbaute, hatte schon 1834 Prof. Naumann bei seinen Schurfarbeiten 30 Scheffel gefördert, so daß zahlenmäßig genau die Gesamtförderung 78.644 ⅔ Scheffel während 17 Jahren betrug oder mit der oben begründeten Korrektur von zirka 90.000 Scheffel (etwa 18.000 t).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e.) Arbeiter- und Lohnverhältnisse: In unserer Kopie fehlt leider auch hier die erste Spalte der Tabelle mit den Jahreszahlen. Bei einer Arbeiterzahl von 4 bis 7 Mann, zuzüglich ein Fördermann, lag der Schichtlohn der Hauer bei 87 Pfg., der Lohn im Gedinge zunächst bei 55 Pfg. pro Scheffel, bei Förderung bis zu Tage. 1843 hatte sich die Fördermöglichkeit bei stärkeren Kohlelagern so verbessert, daß täglich 5 bis 6 Scheffel von einem Hauer ausgehauen werden konnten statt bisher bloß 2 Scheffel, daher sank der Gedingelohn auf 19 bis 25 Pfg., allerdings auch bei Förderung nur bis zum Füllort des Schachts. Der Steigerdienst wurde durch einen Hauer mit versorgt, der dafür wöchentlich noch 1,- Mark zusätzlich erhielt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f.) Gestehungskosten für den Scheffel Kohle (nach dem Gutachten des Berggeschworenen Hoffmann): 1840 Pötzsch: baute damals noch die weniger ergiebigen Flözchen ab.
Dies wurde anders, als im Jahre 1843 Pötzsch’s Witwe: die 1842 von Pötzsch gefundenen stärkeren Kohlenlager abbaute. Die Förderkosten bis zum Schacht betrugen bloß noch 19 Pfg., mit Tonnenzins 25 Pfg., so daß ein nicht ganz unbedeutender Unternehmergewinn vom Verkaufspreis zu 60 bis 75 Pfg. übrig blieb, auch wenn man die Kosten für Förderung zu Tage, Materialverbrauch und Wasserhaltung noch hinzurechnen muß. Eine Möglichkeit, diese Gestehungskosten genauer zu berechnen, bietet das Gutachten des Bergmeisters Hering, nach den Angaben des Pötzsch’schen Steigers aufgestellt, aus dem Jahre 1845. Er veranschlagte die…
also auf rund 41 Pfg. Gesamtgestehungskosten bei einem Verkaufspreis von jetzt 75 Pfg. pro Scheffel.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g.) Verkaufspreis der Kohle des
Lehngerichtswerks:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.) Der Abbau in der unteren Karbonstufe auf Altenhainer Flur. a.) Grubenfeld und Besitzverhältnisse: Das vom Besitzer des Oberirdischen zwischen Dachsloch und Forstbachgraben, dem Altenhainer Bauern Dietrich, an Schaal und seinen Nachfolger Eichler gegen 10 Pfg. Tonnenzins zum Abbau abgetretene Kohlenfeld wird zu 234 Acker 260 Quadratruthen angegeben; davon waren bis 1855 lediglich 2 Acker abgebaut. Für das Kohlenfeld von Fischer & Co. auf Altenhainer Flur findet sich in den Akten die Angabe von 385 Acker, 190 Quadratruthen (zusammen mit dem Abbaufeld auf Flöhaer Flur war das Areal der Altenhainer Steinkohlenbau-Gesellschft 650 Acker groß). Die Flöhaer Besitzer sind im Kapitel IV angeführt, eingeschlagen wurde nur auf Bauer Liebert's Feld. Förderung erfolgte aber nicht. Die Flöhaer Grundbesitzer hatten sich den außerordentlich hohen Tonnenzins von 20 Pfg. pro Scheffel ausgedungen. Unternehmer:
b.) Hauptbaue: Schaal hatte zwei Schächte von 36,5 m und 40 m Tiefe und einen Stollen. Eichler als sein Nachfolger außer diesen Schächten einen Kunstschacht, 8 m tief, dazu einen Stollen, der 1850 angeblich 240 m lang war. Für 1853 lauten die Angaben: zwei Stollen, 28,5 m und 74 m lang, 51 m Teufe. Der scheinbare Widerspruch in den Angaben über den oder die Stollen wird vielleicht dadurch gelöst, daß in der zweiten Angabe der alte, von Schaal schon aufgewältigte Segen des Herrn- Erbstolln mit enthalten ist; an der Finkenmühle haben ja schon seit Jahrhunderten alte Stollen bestanden, die von späteren Werken angefahren und wieder mitbenutzt wurden. Fischer & Co.: 1. Schacht 1858: 38 m tief, 2. Schacht 1859: 30 m tief, aber später um 4 m vertieft, 3. Schacht 1861: 36,5 m tief, auf Flöhaer Flur. Ein Stollen, 16 m lang, 14 m tief.
c.) Flözverhältnisse: Außer dem Hauptflöz, das am Dachsloch ausstreicht und bei einem Streichen von Südwest nach Nordost im Fallen von 10° bis 15° in Südost, mit zunehmender Tiefe mächtiger werdend angetroffen wurde, 0,65 m bis 0,85 m stark, noch einige dünne Flözchen darüber liegend mit 4 cm bis 7 cm Mächtigkeit.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d.) Förderung: Von dem Schaal- Eichler’schen Werke ist uns bloß die Fördermenge von 1845 von 3.000 Scheffel bekannt.Schätzt man vorsichtig die von Schaal geförderte Menge von 1838 bis 1844 = 11 Jahre zu je 2.500 Scheffel, also 27.500 Scheffel, und 4 Jahre bis zum Verkauf an Eichler zu 3.000 Scheffel = 12.000 Scheffel; Eichler’s Förderung aus dem doppelt so starken Flöz beim Kunstschacht 5 Jahre lang (bis 1853) zu 6.000 Scheffel, also 30.000 Scheffel, so ergibt sich für dieses Werk eine Gesamtförderung von 69.500 Scheffel oder rund 70.000 Scheffel in 19 Jahren, wobei die geringe Förderung Eichler’s 1859/1860 nicht mit berücksichtigt ist. Dies entspricht ungefähr der Tatsache, daß bis 1853 zwei Acker abgebaut waren, bei einer Flözstärke von 0,24 m bis 0,65 m, durchschnittlich 0,45 m. Fischer & Co. haben nur von 1859 bis 1861 wirklich Förderung gehabt; die Jahre 1858 und 1862/1863 waren mit Schachtabteufen und Versuchsarbeiten ausgefüllt. Die uns übermittelten Zahlen für Förderung sind:
zusammen 8.178 Scheffel, so daß man einschließlich der uns unbekannten Förderung von 1859 insgesamt 10.000 Scheffel annehmen kann. Die Gesamtmenge der im 19. Jahrhundert aus der unteren Karbonstufe auf Altenhainer Flur geförderten Kohle wäre hiernach rund 80.000 Scheffel (16.000 t) gewesen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e.) Arbeiter- und Lohnverhältnisse:
Der durchschnittliche Wochenlohn eines Arbeiters bei Fischer & Co. war 9,- Mark, also Jahresverdienst 468,- Mark. Der Obersteiger Sommerschuh von Fischer & Co. bekam ein Jahresgehalt von 400 Tlr., also wöchentlich über 23,- Mark, somit das Doppelte eines gewöhnlichen Steigers im Flöhaer Becken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f.) Die Gestehungskosten für den Scheffel Kohle lassen sich weder für das Schaal- Eichler’sche Werk, noch für die Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft rechnerisch bestimmen. Von dem ersteren fehlen alle Unterlagen, von letzterer sind nie alle Unterlagen für ein Jahr vollständig. So fehlen 1860 und 1861 die gezahlten Arbeitslöhne in der Statistik der Kohlenwerksinspektion. 1862 ist zwar beides gegeben, nämlich:
Aber da in diesem Jahre nur Abteufarbeiten, keine Förderung erfolgten, lassen sich die Aufwendungen nicht auf die Förderung verteilen. 1863 bei den letzten Versuchsarbeiten findet sich nur angegeben das Gehalt des Steigers mit 400 Tlr. gezahlter Lohn für 3 Arbeiter 36 Tlr., keine Materialkosten angegeben. Förderung erfolgte auch in diesem letzten Jahre der Gesellschaft nicht. Aus dem geschichtlichen Abschnitt im Kapitel IV geht im übrigen schon hervor, daß die für Flöhaer Verhältnisse betriebstechnisch viel zu großzügig arbeitende Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft nur mit Verlust, und zwar ziemlich bedeutendem, gearbeitet hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g.) Preise der Altenhainer Steinkohle:
Die Flöze der unteren Stufe waren stellenweise von vorzüglicher Güte, deshalb der außergewöhnlich hohe Preis ums Jahr 1845.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der nun folgenden Tabelle VII ist versucht worden, auf Grund der vorangehenden statistischen Angaben über die einzelnen Werke, die im Flöhaer Becken von 1800 bis 1881 abgebaut haben, eine zusammenfassende Übersicht über das gesamte Ausbringen im genannten Zeitraume zu geben. Da bis 1845 nur ganz vereinzelte Angaben aus dem bearbeiteten Quellenmaterial hervorgehen, so daß man schon bei den vorangegangenen Einzelstatistiken über die Förderung auf Schätzungen angewiesen war, konnte der Zeitraum von 1800 bis 1845 nur in drei auf Grund der Geschichte des Flöhaer Bergbaus zusammengefaßten Spannen behandelt werden, nämlich erstens von 1800 bis 1820, wo Schippan mit dem Gückelsberger Werk dominierte und nur im zweiten Jahrzehnt auf Ulbricht's, Richter's und Anke's Feldern in geringem Maße den Abbau begann; zweitens von 1821 bis 1840, wo sich die Zahl der in Abbau stehenden Werke auf acht erhöhte (namentlich im dritten Jahrzehnt); und drittens von 1841 ab, wo die Blüte des Kohlenbergbaus im Flöhaer Becken einsetzte, Ulbricht's Felder aber schon erschöpft waren. Das Jahr 1845 wurde einzeln hervorgehoben, weil in diesem Jahre für alle gangbaren Werke genaue Fördermengen aus der Herder’schen Statistik bekannt sind. Ebenso konnte mit dem Jahre 1853 verfahren werden, in welchem der damals neu ernannte Kohlenwerksinspektor eine Statistik der ihm unterstellten Werke aufnahm. Die Förderung für die dazwischenliegenden Jahre 1846 bis 1852 mußte wieder für die Baue außer dem Pfarrwaldwerk und dem Struthwaldwerk geschätzt und daher zusammengefaßt werden. Daß die vorgenommenen Schätzungen sehr vorsichtig und nicht zu hoch sind, erhellt sich daraus, daß die aktenmäßig genaue Förderung von 1845: 26.130 Scheffel beträgt, ein Maximum gegenüber den geschätzten durchschnittlichen Jahresfördermengen von 1841 bis 1844 von 22.112 Scheffel und 1845 bis 1852 mit 23.348 Scheffel; es liegt aber kein Grund vor, anzunehmen, daß die Förderung 1845 besonders hoch gewesen sei, sie ist vielmehr von 1842 bis 1852 ziemlich gleichmäßig gewesen, erst von 1853 ab sinkt sie infolge Ausscheidens des Struthwaldwerkes und Anke’s Bauen, sowie der vorübergehenden Sistierung des Pfarrwaldwerkes auf 15.344 Scheffel. Endlich mußte noch das Ausbringen 1854 bis 1859 mangels genauer Unterlagen für alle Werke außer dem Pfarrwaldwerk geschätzt und zusammengenommen werden. Alle Schätzungen erfolgten auf Grundlage der vereinzelten aktenmäßigen Handhaben, wie sie in vorangehenden Spezialstatistiken der Gruben schon benutzt worden sind. Von 1860 ab konnten dann die eingangs des Kapitels benannten Quellen benutzt werden und so genaue Zahlen pro Jahr angeführt werden. Trotzdem wurde 1870 bis 1875 und 1876 bis 1881 wieder zusammengefaßt, da in diesen Jahren das Pfarrwaldwerk das einzige gangbare war und dessen genaue Förderziffern schon in der Spezialstatistik einzeln angegeben sind. Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß das Gesamtausbringen an Kohle im Flöhaer Becken innerhalb von 80 Jahren rund 1.156.000 Scheffel oder, nach dem durchschnittlichen Gewicht der Flöhaer Kohle (1 Scheffel = 2 Zentner) 2.312.000 Zentner (oder 115.600 t) betragen hat. Die durchschnittliche Förderung pro Jahr erreicht, im dritten Jahrzehnt schnell steigend, ihren Höhepunkt von 1840 bis 1860, mit einer Unterbrechung im Jahre 1853, wo zwei Werke ganz und eins vorübergehend zum Stillstand kamen. In den 1860er und 1870er Jahren, besonders nach 1866, nachdem das Lehngerichtswerk ganz und das Gückelsberger vorläufig ausgeschieden waren, so daß das Pfarrwaldwerk allein förderte, sinkt die Förderziffer schnell.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Angaben über die Verkaufspreise der Steinkohlen des Flöhaer Beckens an der Grube waren zum Teil recht auseinandergehend; insbesondere hat die Gückelsberger Kohle infolge ihrer besseren Beschaffenheit immer einen höheren Preis erzielt, als die Flöhaer und die des Struthwaldes, während die Altenhainer Kohle von so wechselnder Güte war, daß sie manchmal als fast reiner Anthrazit zu qualifizierter Verwendung tauglich, einen ganz außergewöhnlich hohen Preis erreichte (1845: 110 Pfg. = 1,10 Mark pro Scheffel), andererseits wieder sehr verunreinigt (mit dem höchsten Aschegehalt der Kohlen des Flöhaer Beckens nach Stein’s Analysen) kaum der Flöhaer Kohle im Preise gleichkam. In den ersten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, wo die Gückelsberger Kohle im Flöhaer Becken dominierte, war der Preis pro Scheffel rund 100 Pfg. (Der Handelspreis für Gückelsberger Kohle im Wiederverkaufe wird im Gewerbeblatt für Sachsen 1838 mit 11 alten Groschen = 1,37 Mark angegeben!); in den 1830er Jahren fiel er für die geringeren Qualitäten bis auf 60 Pfg. pro Scheffel, stieg aber in den 1840er Jahren wieder und hielt sich bis 1858 durchschnittlich auf 75 Pfg. pro Scheffel. Nach 1858 fiel die sächsische Kohle allgemein im Preise infolge des Wettbewerbs der Werke unter sich und der Einführung des Pfennigtarifes auf den Bahnen des Norddeutschen Eisenbahnverbandes, wodurch Ruhrkohle und schlesische Kohle in scharfen Wettbewerb traten. Während dieser Preissturz aber bei Zwickauer und Lugau-Oelsnitzer Fettkohle innerhalb weniger Jahre 30% bis 50% betrug, fielen die Schiefer- und Kalkkohlen des Plauenschen Grundes und des Flöhaer Beckens geringer, letztere höchstens um 10% und auch erst in den 1860er Jahren. Nach einer Statistik der Handels- und Gewerbekammer Chemnitz soll der Preis für Flöhaer Kohle von 70,4 Pfg. im Jahre 1858 aus 32 Pfg. im Jahre 1862 gesunken sein. Dem widersprechen aber alle aktenmäßigen Quellen. Die Kohle des eigentlichen Flöhaer Beckens ist (abgesehen vom Restverkauf auf Kieber’s Werk, bei dessen Stillegung mit 55,5 Pfg. pro Scheffel) nur bis auf 68,5 Pfg. im Preise gefallen. Die genannte Statistik der Handelskammer bezieht sich wahrscheinlich auf die Kohlen des Flöhaer Beckens zusammen mit denen des Hainichen- Ebersdorfer Kohlenbassins. Die Widerstandsfähigkeit des Flöhaer Kohlenpreises ist wohl auf die monopolartige Stellung zurückzuführen, die die Flöhaer Kalkkohle in den an Kalkbrennereien reichen Bezirken von Augustusburg, Zschopau, Oederan und Frankenberg innehatte. Man findet immer wieder die Ansicht vertreten, daß sie sich infolge ihrer lang anhaltenden Glut (von ihrer Härte und den starken mineralischen Beimengungen herrührend) zum Kalkbrennen besser eignete, als jede andere Kohlenart. Von 1873 ab, wo nur noch das Pfarrwaldwerk in sinkender Menge förderte, ist der Preis der Flöhaer Kohle sogar wieder gestiegen, im Jahre 1874 vorübergehend bis auf 85 Pfg. pro Scheffel. In der folgenden Tabelle ist der Versuch gemacht, den ungefähren Wert der im Flöhaer Becken von 1800 bis 1881 geförderten Kohle zu bestimmen mit Hilfe der in Tabelle VII gefundenen Zahlen für die Produktion in den einzelnen Zeiträumen und den entsprechenden Verkaufspreisen. Der so ermittelte Gesamtwert von 892.350,30 Mark stellt den Mindesterlös dar, den die Gruben des Flöhaer Beckens für ihre Kohle erzielten; unter Berücksichtigung der in den Einzelstatistiken der Gruben begründeten Abrundungen für die Fördermengen würden sich etwa 920.000,- Mark ergeben. Der für die volkswirtschaftliche Bewertung in Betracht kommende Handelswert der Kohle am Konsumptionsplatze (also einschließlich der Distributionskosten) wäre ungefähr ⅓ höher anzusetzen. Bei unseren heutigen Papierwährungsverhältnissen ist es wohl angebracht, darauf hinzuweisen, daß es sich bei den Summen um Goldwerte handelt mit einer der Zeitspanne 1800 bis 1880 entsprechenden höheren Kaufkraft der Goldmark ums 2,3fache gegenüber der heutigen Goldmark.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die nächste Tabelle gibt in Spalte 1 bis 3 eine Übersicht über die im Flöhaer Becken von 1845 biss 1875 in Betrieb stehenden Werke und ihre Belegschaft, soweit für einzelne Jahre vollständige Daten vorlagen. Unter „Beamten“ in Spalte 3 sind die angestellten Steiger zu verstehen, die die technische und zum Teil die kaufmännische Leitung hatten. Wenn der Unternehmer selbst diese Tätigkeiten ausübte und keinen Steiger angestellt hatte, wurde er in die Zahl einbezogen. Die Zahlen sind niedriger, als in den amtlichen Statistiken der betreffenden Jahre, da letztere regelmäßig unter „Flöha“ die Werke des Hainichen- Ebersdorfer Beckens mit registrieren (Fiedler in Berthelsdorf, Graf Vitzthum in Lichtenwalde- Ebersdorf); die vorliegende Arbeit aber ihrem ganzen Aufbau nach eine Monographie des Flöhaer Beckens der produktiven Steinkohlenformation, nicht auch des Hainichen- Ebersdorfer Kulms sein will. In Spalte 5 ist dann die durchschnittliche, auf einen Arbeiter entfallende Jahresleistung in Scheffeln berechnet. Dieselbe hat sich in normalen Jahren des fünften und sechsten Jahrzehnts auf 600 bis 700 Scheffel belaufen. Durch Hinzutreten der Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft mit ihrer dem Ausbringen gar nicht entsprechenden, hohen Arbeiterzahl wird die Jahresleistung eines Arbeiters von 1860 bis 1863 auf 400 bis 500 Scheffel herabgedrückt. Die von dieser Gesellschaft aufgestellte Dampfmaschine und ihr ganzer intensiver Betrieb hat also im Flöhaer Becken die umgekehrte Wirkung gehabt als sonst im Kohlenbergbau, wo um die Mitte des 19. Jahrhunderts die auf einen Arbeiter entfallende Fördermenge durch Einstellen moderner technischer Hilfsmittel überall da stieg, wo Intensivierung des Betriebs durch die Stärke der Flöze angebracht war. Nach Ausscheiden der Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft steigt von 1864 ab wieder die durchschnittliche Jahresleistung eines Arbeiters auf 600 bis 700 Scheffel, 1865 und 1869 sogar auf über 800 Scheffel, bis sie dann von 1873 ab infolge Erschöpfung der Lager schnell sinkt. Spalte 6 und 7 geben Anhalte über das Steigen des Arbeitslohnes im 19. Jahrhundert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der jährliche Verdienst eines Arbeiters im Flöhaer Kohlenbergbau selten über 100 Tlr oder 300,- Mark hinausgegangen, während um 1850 ein Arbeiter im Lugau- Oelsnitzer Revier schon 150 Tlr. (450,- Mark), im Dresdner Becken 163 Tlr. (489,- Mark) und im Zwickauer gar 170 Tlr. (510,-Mark) verdiente. Erst in den 1850er Jahren stieg auch im Flöhaer Becken infolge Arbeitermangels der Jahreslohn auf zirka 400,- Mark. In den Krisenjahren 1863/1864, wo der Kohlenpreis sank und alle Baue außer dem Pfarrwaldwerk den Betrieb einstellten, sank auch der Arbeitslohn vorübergehend wieder auf zirka 350,- Mark, um sich erst von 1865 an wieder auf 400,- Mark (in Ausnahmenfällen noch darüber hinaus) zu erheben. Der Lohn des gewöhnlichen Steigers war in der Regel um 10% bis 25% höher, als der des Arbeiters; nur der Obersteiger Sommerschuh, technischer Leiter der Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft, bekam das ausnahmsweise hohe Gehalt von 400 Tlr. = 1.200,- Mark jährlich. Teilt man den Jahreslohn eines Arbeiters durch die in Spalte 5 angegebene Jahresleistung eines Arbeiters in Scheffeln, so ergibt sich der Anteil des Arbeitslohnes an den Gestehungskosten pro Scheffel in Pfennig. Derselbe betrug normal bis zum Eintritt der Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft 40 bis 50 Pfg. pro Scheffel, also ½ bis ⅔ des Verkaufspreises. Durch Einbeziehung der genannten, mit großen Verlusten arbeitenden Gesellschaft in die Statistik steigt der Anteil des Arbeitslohnes an den Gestehungskosten auf 80 bis 90 Pfg. pro Scheffel, während der Verkaufspreis in den Krisenjahren nach 1860 teilweise auf 70 Pfg. fiel. Die Flöhaer Werke arbeiteten zwar in diesen Jahren alle ohne Gewinn, aber die Statistik wird durch die Altenhainer Gesellschaft übermäßig nach der Verlustseite entstellt. Nach ihrem Ausscheiden haben wir dann auch in den Jahren 1864 bis 1872 wieder normale Ziffern. Immerhin stehen diese jetzt auf 50 bis 60 Pfg. pro Scheffel, wobei gegenüber den Verkaufspreisen von 68,5 bis 80 Pfg. nur geringer oder gar kein Unternehmergewinn übriggeblieben sein wird. Doch muß das Pfarrwaldwerk, um das es sich jetzt hauptsächlich noch handelt, immerhin bis 1872 ohne direkten Verlust gearbeitet haben, sonst wäre es wohl früher zum Erliegen gekommen. Von 1873 ab hat aber auch dieses Werk sicher mit Verlust gearbeitet und nur die vorübergehend steigende Tendenz des Kohlepreises wird Hesse veanlaßt haben, den Betrieb mit Unterbrechungen noch einige Jahre fortzusetzen. Die außergewöhnlich hohe (Durchschnitts-) Zahl von 208 Pfg. Arbeitslohn pro Scheffel im Jahre 1875 kann nur dadurch veranlaßt sein, daß Hesse seine volle Belegschaft (6 Mann) nicht das ganze Jahr über beschäftigt hat; wie überhaupt wohl der in den Akten oft erwähnte Umstand, daß die Werke im Sommer, wo die Nachfrage nach Kohle geringer war, ihren Betrieb einschränkten, die errechneten Zahlen für den Anteil des Arbeitslohnes an den Gestehungskosten durchweg etwas in die Höhe getrieben haben wird…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
____________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI.
Kapitel:
Neuere Versuche, den Kohlenbergbau wieder aufzunehmen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem 1881 mit dem Pfarrwaldwerk der Kohlenbau im Flöhaer Becken erloschen war, herrschte die nächsten 25 Jahre Ruhe in allen den Bergbau betreffenden Fragen. Die alten Schächte und Stollen waren verfüllt worden oder zusammengebrochen, nur die Abraumhalden erinnerten noch an die Vergangenheit. Die Einwohner, die die letzten Jahrzehnte des Kohlenabbaus miterlebt hatten, bewahrten hauptsächlich die Erinnerung an die Unwirtschaftlichkeit desselben in den letzten Jahrzehnten und waren voll Mißtrauens gegen jede Regung zur Wiederaufnahme. Und mit Recht; denn die verhältnismäßig leicht abzubauenden Flözchen der oberen Karbonstufe waren bis auf wenige geringfügige Reste erschöpft, soweit sie überhaupt abbauwürdig waren; und betreffend der unteren Stufe war das verlustreiche Fiasko der Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft eine Warnung. Dazu kam die sinkende Tendenz des Kohlenpreises in den nächsten Jahrzehnten. Als aber im Anfang des 20. Jahrhunderts bei immer zunehmender Industrialisierung Sachsens und Deutschlands die Steinkohlenpreise wieder anzuziehen begannen, da der Kohlenbergbau im Zwickauer, Lugau- Oelsnitzer und Dresdner Revier in immer größere Tiefen vordringen mußte und kostspieliger wurde, und als die Wissenschaft feststellte, daß Sachsens Steinkohlenbergbau überhaupt seinen Höhepunkt zu überschreiten begann und man in absehbarer Zeit mit der Erschöpfung der sächsischen Lager rechnen mußte, machte sich das Bestreben bemerkbar, neue Lagerstätten zu erschließen oder den Abbau in alten, liegengebliebenen wieder aufzunehmen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch des Flöhaer Beckens bemächtigte sich der Spekulationsgeist. Ein Ingenieur, Ottomar Schindler aus Chemnitz, der selbst Grundbesitz in der Aue bei Flöha besaß, entfaltete 1907 eine rührige Tätigkeit, gewisse Kreise für das Flöhaer Becken zu interessieren. Er schloß mit verschiedenen Grundeigentümern Verträge über das Abbaurecht des Unterirdischen ihres Besitzes ab, und es gelang ihm, die Gründung einer Bergbaugesellschaft „Glück Auf Flöha“ in die Wege zu leiten. Im Gesellschaftervertrag vom 19. Juni 1908 brachte Schindler seine Verträge mit Flöhaer Grundbesitzern in die Gesellschaft ein, er selbst wurde neben einem Hernn Siegmund Silberstein, einem Direktor A. Sauer, Leipzig, und einem angeblichen Rittergutsbesitzer Kurt Schneider, Zeisau, in den Vorstand der Gesellschaft aufgenommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
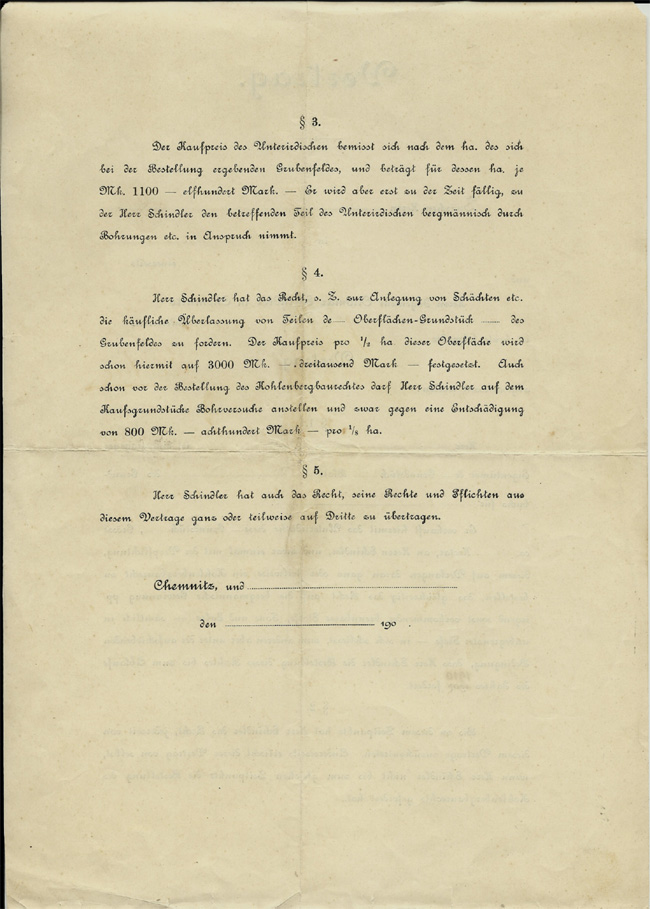 Rückseite des noch unbenutzten Vordruckes für einen Verkaufsvertrag über Kohlenbaurechte in Flöha an Herrn Ingenieur Ottomar Schindler. Zur Verfügung gestellt von Flöhaer Heimatfreunden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser benutzte ein von Dr. C. Gäbert, Leipzig, Sektionsgeologe an der Kgl. Geologischen Landesanstalt, im August 1905 angefertigtes Gutachten als Grundlage, das die in den Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte, Sektion Augustusburg- Flöha enthaltenenen Tatsachen über die Verbreitung der karbonischen Ablagerungen im Flöhaer Becken, ihre Gliederung in die bekannten drei Stufen und ihre Lagerungsverhältnisse auszugsweise wiedergibt und dann auf den früheren Kohlenbergbau eingeht: Im Gebiet der oberen Stufe hat eine schwache, aber zeitweise nicht unrentable Kohlenförderung stattgefunden; die Kohlenführung auch der unteren Stufe ist als sicher nachgewiesen, etwa anzustellende neuerliche Abbauversuche müßten sich mit Aufschließung dieser befassen und die obere – wenigstens vorläufig – außer Acht lassen. Das von der unteren Stufe geführte Flöz ist durch die früheren Versuche der Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft mit der Tiefe an Mächtigkeit zunehmend befunden worden, so daß anzunehmen ist, daß es vom Forstbachgrund nach Südosten weiter anschwellen wird. Dr. Gäbert empfiehlt dann in diesem Gutachten die Anlage von Bohrlöchern entweder a.) in der Nähe des Ausgangs der hinteren Ulbrichtschlucht oder b.) zwischen der hinteren und vorderen Ulbrichtschlucht (aber im Liegenden der dortigen Verwerfung) oder c.) am Zugang der vorderen Ulbrichtschlucht, also etwas weiter südöstlich. Da die untere Karbonstufe unter der Aue der Zschopau hinwegstreiche, so könne das Bohrloch auch in dieser Aue (in der Nähe der genannten Punkte) angesetzt werden. Ein weiteres Bohrloch empfiehlt Gäbert in der Flöha-Aue, nördlich vom Flöhaer Bahnhof, wo nachgewiesenermaßen die untere Stufe von den Flöha- Auswaschungen noch nicht erreicht ist. Das erste Bohrloch würde vielleicht 100 m tief werden, das zweite und dritte zwischen 100 m und 200 m. So mächtige Flöze, wie bei Zwickau könnten bei der Kleinheit des Beckens nicht gefunden werden, ein Anschwellen des schon mit 0,85 m Stärke bestätigten Flözes und das Vorhandensein weiterer Flöze sei aber möglich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die hier angenommene Ausdehnung der Flöze nach Norden und deren Mächtigkeitszunahme mit der Teufe ist allerdings völlig hypothetisch. Gäbert selbst schließt sein Gutachten mit den Worten: „Über die Rentabilität des Kohlenbergbaues lassen sich genauere Angaben erst nach erfolgten Bohrungen machen. Maßgebend sind hierfür u. a. die Kosten der Erwerbung des Unterirdischen sowie die Wasserverhältnisse der Schächte, die Beschaffenheit der Kohle und der für dieselbe zu erzielende Verkaufspreis. Über diese, den Geologen nicht speziell berührende Fragen würde sich wohl Herr Bergingenieur Landgraf äußern.“ Im Übrigen enthält das Gutachten mangels neuer Aufschlüsse im Wesentlichen nur das Bekannte und oben schon Gesagte. Die stark verblichenen Beschriftungen auf dem Schnitt lauten:
Der größte Teil der beiden oberen Flöze zwischen dem zweiten Schacht (No.3) und ihrer Ausbißlinie im Flöha- Tal (links) ist durch Schraffur als bereits „abgebautes Kohlenfeld“ gekennzeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daß die Flöhaer Kohle hauptsächlich zum Kalkbrennen benutzt worden war, weil sie angeblich größere Hitze als gewöhnliche Steinkohle erzeugte, sei bei ihrem anthrazitischem Charakter durchaus glaubwürdig. Als Hausbrand fand sie deshalb keine Verwendung, weil man Anthrazit-Öfen noch nicht kannte. Nach Naumann und Geinitz sei übrigens die Kohle der unteren Stufe besser als die der oberen (was nach den Ergebnissen der Analysen (Kapitel V) nur partiell so gewesen ist). Heutzutage, so schließt Gäbert sein Gutachten, würde wohl die Kohle des unteren Flözes nicht allein zum Kalk- und Ziegelbrennen, sowie zu Schmiedefeuer, sondern auch in Anthrazitöfen und für andere Zwecke verwertet werden können. Die Rentabilität des Abbaues hinge von den Erwerbungskosten des Unterirdischen, den Wasserverhältnissen und der Beschaffenheit der Kohle ab. Die neue Gesellschaft legte, ohne vorerst irgendwelche bergmännischen Arbeiten zu beginnen, 1.000 Anteile auf, die von den Gründern übernommen wurden und weitergegeben werden sollten. Da letzteres wohl nicht so glatt vonstattenging, nahm man eine Umbildung der Gesellschaft vor, nach welcher im Jahre 1909 „Glück Auf“ als eine Tochtergründung der „Gesellschaft für Montanindustrie m.b.H.“, Verwaltungssitz Leipzig, und als Bohrgesellschaft nach dem BGB erscheint. Man verzichtete auf die von Ingenieur Schindler eingebrachten Abbauverträge und schloß selbständig mit den Besitzern von annähernd 4 Mio. m² Oberfläche auf Flöhaer, Gückelsberger, NIederwiesaer sowie Altenhainer Flur Abbauverträge auf das Unterirdische ab. Als Grundbesitzer sind im Vertrag genannt: Ernst Haubold, Rob. Pfeiffer, Emil Endig, Bruno Förster, Bruno Scheffler, Frdr. Agsten, Osw. Opitz, Max Herold, Ernst Höppner, Anton Trübenbach, Theod. Lange, Bruno Pomsel, Oskar Ranft, Otto Lange, Otto Irmscher, Paul Rabe, Friedr. Wächtler, Hermann Anke, Hermann Günther, Richard Axt als Vertreter des Pfarrlehens. Die Grundbesitzer sollten den Zehnten vom Geldwert der geförderten Kohle und Ersatz des Oberflächenschadens, sowie 50,- Mark für jedes auf ihrem Grund angelegte Bohrloch bekommen. In einer außerordentlichen Generalversammlung am 2. März 1909 legten Ingenieur Schindler und Herr Silberstein ihr Amt als Vorstandsmitglieder nieder, dafür wurden neu in den Vorstand gewählt, um dem Unternehmen mehr Vertrauen zu schaffen: Berg-Ing. E. Gramann, Hannover, Dr. Gäbert, Leipzig, Gemeindevorstand Lehnert, Flöha, Hofrat Ritter, Leipzig, Syndikus K. Kaiser, Berlin. Es ist fraglich, ob diese Herren die Wahl annahmen; Gemeindevorstand Lehnert jedenfalls lehnte sie nach Rücksprache mit den vorgesetzten Behörden ab, da über Charakter und Grundlagen der Gesellschaft noch völlige Dunkelheit herrschte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Grubenvorstand, speziell der Vorsitzende Sauer, wurde in dieser Generalversammlung ermächtigt, endlich Bohrarbeiten aufzunehmen und zur Bestreitung aller bis zum Schachtbau nötigen Kosten von jedem Gesellschafter für jeden bis jetzt verkauften Anteil ein Darlehen von 100,- Mark zu erheben. Gleichzeitig wurde eine Zubuße von 50,- Mark beschlossen. Die bisher im Namen der Gesellschaft für Montanindustrie abgeschlossenen Verträge mit den Grundbesitzern sollten von „Glück Auf Flöha“ erworben und in Form eines Reverses übertragen werden. Erstgenannte Gesellschaft blieb aber weiterhin ermächtigt, zu jeder Art der Vertretung von „Glück Auf Flöha“. Dann wurde als Nächstwichtigstes die Remuneration für den Gesamtvorstand von 5.000,- auf 10.000,- Mark erhöht und – solange kein kaufmännischer Leiter bestellt war – dem Direktor A. Sauer monatlich 500,- Mark Vergütung für Führung der Geschäfte zugesprochen. Nun entfaltete man eine eifrige Propaganda für die Gesellschaft. Geschickt wurden Sensationsnachrichten in die Presse lanciert, um Stimmung für Flöhaer Bohranteile zu machen. „Das Flöhaer Becken – ein neues sächsisches Kohlenrevier“, so waren die Aufsätze gewöhnlich überschrieben. Sie endeten mit der gewagten Behauptung, daß „der Steinkohlenmangel Sachsens durch das neue Becken auf Jahrzehnte behoben sei.“ Die Börsenblätter brachten Notizen über den Wiederbeginn des Flöhaer Bergbaus durch die neue Gesellschaft und bald regnete es Anfragen von interessierten Kreisen bei der Gemeinde Flöha über den Stand und die Aussichten des Unternehmens. Vertreter von Industriewerken für bergmännische Anlagen und Ausrüstungen kamen nach Flöha und fragten, wie Herr Hans berichte, „nach dem Bergwerk“, von dem keine Spur vorhanden war. Im Vertrag zwischen den Grundbesitzern und der Gesellschaft war nämlich ausgemacht, daß letztere bis zum 31. Dezember 1912 Zeit hatte, das Angebot der Grundbesitzer auf Abbau des Unterirdischen ihres Grundstückes anzunehmen oder abzulehnen. Vorher sollten Versuche und Bohrungen vorgenommen werden. Die Bohrarbeiten mußten bis zum 30. September 1909 begonnen sein. Die Gesellschaft nutzte den gestellten Termin bis zum letzten Augenblick aus: Am 30. September 1909 wurde mit den Bohrungen angefangen und zwar auf Parzelle 11 des Flurbuchs Flöha, dem Gutsbesitzer Opitz gehörig und an der Chemnitzer Landstraße in der Zschopau-Aue gelegen, dicht neben dem Scheffler’schen Anwesen. (Aber nicht auf Scheffler’s Grund und Boden, wie oft angenommen wird. Dieser hatte sich vertraglich vorbehalten, daß auf seinem Grundstück nicht gebohrt werden durfte.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bohrunternehmer war eine Firma aus Halle a. d. S. (Carl Hofmann). Am 5. November 1909 war man 12 m tief, am 10. Dezember 31 m tief vorgedrungen, immer in der Porphyrplatte. Die Bohrungen geschahen mit Handbetrieb. Die Bohranteile von „Glück Auf Flöha“ wurden schon seit Juni 1909 überall zum Kaufe angeboten, auch im Ausland (Böhmen). Der Emissionspreis der Anteile war 500,- Mark. Zeichnungen nach Maßgabe, daß 300,- Mark pro Anteil sofort, 100,- bis zum 30. Juni 1909, 100,- bis zum 30. Juli 1909 zu zahlen waren, nahmen entgegen (außer der Gesellschaft für Montanindustrie selbst) eine Anzahl sächsischer und thüringischer Bankgeschäfte in Crimmitschau, Frankenberg, Freiberg, Gera-R., Hartmannsdorf, Rochlitz, Werdau, Lichtenstein-Callnberg, Kirchberg, Zwickau, später eine Firma „Merkur“, Bank-Kommissions- und Finanzierungs-Institut, Berlin. Den Prospekten der Gesellschaft lag ein neues Gutachten von Dr. Gäbert vom 24. März 1909 bei, in welchem dieser von dem lebhaften Interesse spricht, daß sich seit zwei bis drei Jahren in Sachsen für noch nicht aufgeschlossene Steinkohlenfelder bemerkbar mache, da die sächsischen Steinkohlenwerke den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit erreicht oder überschritten hätten. Bei der rapiden Abnahme seines ohnehin nicht großen Steinkohlenvorrats müsse daher Sachsen in nicht ferner Zeit aus der Reihe der steinkohlenproduzierenden Länder ausscheiden, wenn es nicht gelänge, neue Felder aufzuschließen. Nach dem geologischen Bau des Landes sei dies aber nur an ganz wenigen Stellen möglich. Ein solches noch der Aufschließung harrendes Steinkohlenterrain sei das Becken von Flöha. Es folgt dann in dem Gutachten die bekannte Beschreibung des Flöhaer Karbons mit Karte und die Bemerkung, daß die Mächtigkeit der unteren Stufe mit den bei der Finkenmühle, also sehr nahe der westlichen Grenze des Beckens, angesetzten beiden früheren Kohlenschächten mit 34 m bzw. 70 m ermittelt worden sei. Während am südlichen Beckenrande im Struthwalde die Mächtigkeit dieser Stufe auf 20 m und weniger heruntergeht, dürfte sie im zentralen Teil des Flöhaer Beckens auf über 100 m anstehen. Der weitere Teil des Gutachtens ist dann eine Wiederholung des schon angeführten Früheren von Gäbert. Trotz der großangelegten Propaganda wollte es mit der Zeichnung von „Glück Auf“- Anteilen nicht recht vorwärts gehen. Verschiedene Zeitungen warnten namentlich das kleine Kapitalisten-Publikum vor dem Ankauf, solange es nicht genau über alle einschlägigen Verhältnisse orientiert sei und kein größeres Risiko übernehmen wolle. Es handele sich um ein ausgeprägtes Spekulationspapier, denn der Schachtbau seit noch gar nicht in Angriff genommen und vorläufig seien nur Zubußen für die Bohrkosten zu erwarten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur allgemeinen Klärung hielten es das Bergamt Freiberg und das Sächs. Finanzministerium im Mai 1910 für nötig, ein Gutachten des Direktors der Geologischen Landesanstalt, Geheimrat Dr. Credner, einzuholen. Dieser bezeichnet darin die angenommene Mächtigkeit von 100 m der unteren Stufe des Flöhaer Karbons als ganz hypothetisch. Beim Ausstrich am Nordabhange der Struth sei sie höchstens 50 m stark und verrate hier nirgends das Vorhandensein eines Kohlenflözes; auch die Annahme der zunehmenden Mächtigkeit des Flözes von der Finkenmühle nach Südosten soll nach Credner durch nichts begründet und bei den geringen Horizontal- und Vertikalmaßen des Beckens unwahrscheinlich sein. Sie müßte erst durch Bohrungen nachgewiesen werden; auch die Qualität der Kohle müßte für einen Abbau sich bessern. Solange diese Nachweise fehlten, habe das neue Unternehmen keine Aussicht auf Prosperität. Die Drohung der Gesellschaft, daß sie, „um ihre Rechte zu verwerten, sich bei der geringen Anteilnahme des sächsischen Publikums gezwungen sehen könnte, ihre Rechte an ein ausländisches Konsortium abzutreten“, könne getrost hingenommen werden. Auch wenn unerwarteterweise die Bohrungen günstige Resultate ergäben, würde der Betrieb sehr kostspielig sein, denn die Flöha- und Zschopau-Aue sei dicht bevölkert und mehrere große Fabriken nutzten die Wasserkraft aus. Wenn nun die unangenehmen Erfahrungen in neuerer Zeit in der Gegend von Zwickau und Oelsnitz gezeigt hätten, in welch hohem Maße ein in großer Tiefe umgehender Bergbau noch auf die Oberflächenverhältnisse wirke, so wäre solches noch viel mehr von einem relativ flach untertage betriebenen Steinkohlenbergbau bei Flöha zu erwarten. Es würden nicht nur die dortigen Gebäude und Staatsbahnlinien gefährdet, sondern sich auch die Gefälleverhältnisse der fließenden Wasser ändern und damit dem Bergbau kaum erschwingliche Kosten erwachsen. Diesen Bedenken schloß sich das Bergamt Freiberg an und wies noch besonders auf den Wettbewerb der Zwickauer und Lugau- Oelsnitzer Kohle hin. Zwar würde es zur Verminderung der befürchteten Bodensenkungen und Oberflächenschäden nach dem neuzeitlichen Stand der Versatzmethoden technisch genügende Mittel geben, doch würde aus wirtschaftlichen Gründen der hierzu allein in Frage kommende Spülversatz undurchführbar sein. Bis jetzt (8. Mai 1910) sei das Bohrloch 46 m tief, ohne ein Kohlenflöz erreicht zu haben. Seit Anfang Januar hatte der Bohrbetrieb eine Unterbrechung erfahren, weil angeblich ein entlassener Schichtführer aus Rache gebrochenes Bohrgezähe und andere Eisenabfälle ins Bohrloch geworfen hatte, deren Beseitigung angeblich bis jetzt noch nicht gelungen war. Von einem zweiten Bohrversuch war nichts bekannt. Das Bergamt habe die Arbeiten bisher nur mit Rücksicht auf die zu erwartenden geologischen Ergebnisse mit Interesse verfolgt, stehe aber im übrigen der Bergbaugesellschaft „Glück Auf Flöha“ nicht ohne Mißtrauen gegenüber. Dieses Mißtrauen scheint nicht unbegründet gewesen zu sein, denn einige Tage nach diesem Gutachten, am 14. Mai 1910, stellte die Gesellschaft die zuletzt äußerst lässig betriebenen Bohrarbeiten ganz ein, ohne einen Erfolg abzuwarten und seitdem wurde nichts wieder von „Glück Auf Flöha“ gehört. Gegen einige bei der Gründung beteiligte Mitglieder schwebten später gerichtliche Verfahren, so daß die Staatsanwälte von Dresden und Leipzig wiederholt die Akten über die Gesellschaft von der Gemeinde Flöha einforderten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als nach Einstellung der Bohrungen im Mai 1910 von „Glück Auf Flöha“ nichts mehr zuu hören war, nahm der Ingenieur Schindler, der geistige Urheber der Bewegung zur Wiederaufnahme des Kohlenbergbaus, in den Jahren 1911 und 1912 erneut Fühlung mit Kapitalistenkreisen, diesmal Zwickauern, um sein Pläne zur Durchführung zu bringen. Im Juli 1912 hatte er wieder eine Gruppe Kapitalisten zusammen, die sich mit der Gesellschaft „Glück Auf Flöha“ auseinandersetzten und deren Abbaurechte übernehmen wollten. Aber es war niemand aufzufinden, der zur Vertretung der spurlos verschwundenen Gesellschaft berechtigt war. So wartete man, bis zum Jahre 1913, da mit dem 31. Dezember 1912 die Abbaurechte von „Glück Auf Flöha“ von selbst verfielen, nachdem sie nicht benutzt worden waren. Wieder setzte ein Pressefeldzug ein, um weitere Kreise für das Flöhaer Becken zu interessieren. Zur Begegnung der viel zu viel versprechenden Anpreisungen in auswärtigen Tages- und Börsenblättern ließ der Gemeinderat Flöha halbamtlich durch den Sparkassensekretär und Ortschronisten, Hernn R. Hans, Flöha, einen umfänglichen Bericht über die geologischen Verhältnisse und den Abbau im Flöhaer Becken, soweit letzterer bekannt war, im Flöhaer Tageblatt erscheinen. Derselbe wurde allen Interessenten, die bei der Gemeinde anfragten, zugesandt und hatte ernüchternde Wirkung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trotzdem fand sich Ende 1913 ein kapitalkräftiger Unternehmer: Joh. Dreverhoff aus Zwickau, der, auf einige kapitalkräftige Hintermänner gestützt, energisch und auf soliderer Grundlage an die Wiederaufnahme des Kohlenbergbaus herangehen wollte. Er war sich darüber klar, daß bei der geringen Qualität und Flözstärke der Flöhaer Kohle ein Abbau nur wirtschaftlich sein konnte, wenn die Kosten der Felder nicht zu hoch waren. Er wollte deshalb den Besitzern des Oberirdischen nicht den Zehnten von der Förderung zugestehen, sondern nur 10% vom Reingewinn, wie dies in den Zehnten-Verträgen im Zwickauer Bergbau üblich sei. Um den üblen Eindruck zu verwischen, den „Glück Auf Flöha“ großtönenden, aber leeren Zahlen für Grundkapital (1.000 anteile á 500 Mark = ½ Million Mark) und ähnlichem hinterlassen hatte, gab die Gesellschaft in einer Art Prospekt an, daß nur mit größter Sparsamkeit und solider Vorsicht vorgegangen werden sollte. Für die ersten Bohrungen sollte nur ein Bohrverein mit 300 Bohranteilscheinen á 100 Mark gegründet, im übrigen erst das Ergebnis der Bohrungen abgewartet werden. Dem neuen, auf soliderer Grundlage aufgebauten Unternehmen stand man zwar seitens der Gemeindebehörden in Flöha symphatisch gegenüber, denn die Vorteile für die Gemeinde konnten bei günstigem Ausgang der Bohrungen groß sein, aber man lehnte es ab, sich irgendwie aktiv zu beteiligen und auch die Verhandlungen mit den Grundbesitzern, die durch den „Glück Auf“-Rummel mißtrauisch geworden waren, stießen auf Schwierigkeiten. Vorallem verlangten letztere, daß die neue Gesellschaft erst die alten Abbaugerechtsame, die von der Altenhainer Steinkohlenbau- Gesellschaft (Fischer & Co.) aus Döbeln noch auf den meisten Grundstücken lasteten, löschen lassen sollte, was nach Dreverhoff's Ansicht erhebliche Kosten oder Prozesse mit den Erben von Fischer & Co. bedeutete (in Wirklichkeit waren diese alten Rechte nach dem damaligen Vertrage erloschen, wenn der Abbau ein Jahr lang ausgesetzt hatte). So zogen sich die Verhandlungen in die Länge, bis die Zwickauer Unternehmer das Interesse an dem riskanten Geschäft wieder verloren, dessen Rentabilität, so wie die Verhältnisse im Flöhaer Becken lagen, äußerst fragwürdig war. Der ausgebrochene Krieg 1914 machte schließlich allen Verhandlungen ein schnelles Ende.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interessant ist noch, daß die Zwickauer Gesellschaft in ihrem Prospekt darauf hinweist, daß die Steinkohle, besonders minderwertiger, wie der von Flöha, ein großer Konkurrent in den Braunkohlen-Briketts heranwachse, die sich infolge Billigkeit und bequemer Handhabung den Industriemarkt immer merh eroberten, soo daß allerorten Braunkohlenfelder neu erschlossen würden (der sächsische Staat hatte allein für 500 Mio. Mark Felder erworben). Wenn daher die Flöhaer Kohle nicht in allernächster Zeit zum Aufschluß gelänge, rücke der Zeitpunkt näher, wo eine Verwertung unmöglich würde. Dieses Argument scheint für die heutige Zeit, wo viele Fabriken infolge der durch den Versailler Vertrag hervorgerufenen Steinkohlennot ihre Roste und Heizanlagen für Braunkohlenbefeuerung umbauen, von besonderer Bedeutung zu sein.
____________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schlußbetrachtungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Überblicken wir zum Schluß nochmals die wirtschaftsgeschichtliche Stellung, die das Steinkohlenbecken von Flöha in der Vergangenheit innegehabt hat, so ist zu sagen, daß bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts von einem geregelten Abbau nicht die Rede sein kann; bei der geringen Rolle, die bis dahin die Kohle überhaupt in der Volkswirtschaft spielte, waren die bei zahlreichen Abbauversuchen gemachten Resultate bei der Geringwertigkeit der Kohle und der geringen Stärke der Flöze nicht genügend, um einen dauernden Abbau mit Vorteil zu ermöglichen. Erst der schwindende Holzreichtum des Erzgebirges zusammen mit der fortschreitenden Industrialisierung des Gewerbes machten am Anfang des 19. Jahrhunderts die Gewinnung der Kohlenlager vorteilhaft. Der Abbau war in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht unrentabel. In dieser Zeit wurde der Hauptstock der leicht zu gewinnenden Kohle aus der oberen Karbonstufe abgebaut. Die zunehmende Erschöpfung dieser Lager, die zur Arbeit auch an weniger bauwürdigen Teilen des Kohlenfeldes führte, zusammen mit dem durch den Ausbau der Eisenbahnen hervorgerufenen Wettbewerb auswärtiger Kohlen, die bei intensiv technischem Abbaubetrieb geringere Produktionskosten hatten und ein allgemeines Sinken des Kohlenpreises bewirkten, machte dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Abbau der Flöhaer Kohle immer unwirtschaftlicher, so daß die meisten Werke bis 1870, das letzte 1881, eingingen, nachdem sie in den letzten Jahren gewöhnlich mit Verlust gearbeitet hatten. Immerhin sind in dem Zeitraum von 80 Jahren trotz der Kleinheit des Beckens und der Schmächtigkeit der Kohlenflöze über 2.300.000 Zentner Kohle ausgebracht worden und eine nicht unbedeutende Kalk- und Ziegelbrennerei in der nähern und weiteren Umgebung des Beckens basierte auf Flöhaer Kohle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neuere Versuche, den Kohlenbergbau wieder aufzunehmen, gründeten sich auf den Umstand, daß die untere Stufe des Flöhaer Karbons nur in ganz geringem Maße bisher abgebaut worden ist (zirka 100.000 Zentner), nämlich zwischen Dachsloch und Forstbachgraben auf Altenhainer Flur, wo die Schichten dieser Stufe zutage streichen und das darin enthaltene Flöz noch in geringer Tiefe zu erreichen war. Daß die untere Stufe auf Altenhainer Flur ein bauwürdiges Flöz führt und zwar von größerer Mächtigkeit, als die der oberen je gewesen sind (bis 0,95 m) steht fest, nicht aber, ob und wie weit es diese Stufe durchsetzt; am Fuße des Struthwaldes gefundene Ausstriche eines Flözes der unteren Stufe erwiesen sich als nicht bauwürdig, da sie nur aus ganz unreinem Kohlenschiefer bestanden. Es müßte erst durch ausgedehnte Bohrungen festgestellt werden, wie weit das oder die Flöze der unteren Stufe in bauwürdiger Qualität reichen. Die in dieser Richtung bisher gemachten Ansätze sind nicht zu Ende geführt worden, indem die Bohrungen abgebrochen wurden, ohne daß die Schichten der unteren Stufe ganz durchsunken gewesen wären. Vor dem Kriege dürfte das Credner’sche Gutachten von 1910 unbedingt zutreffend gewesen sein, das auch bei günstigen Resultaten der Bohrungen ein Abbau im Flöhaer Becken infolge seiner besonderen Verhältnisse unwirtschaftlich gewesen wäre; inwieweit sich bei der heutigen Wirtschaftslage mit Kohlenmangel und relativ, nicht nur infolge der Geldentwertung absolut gestiegenem Kohlenpreis diese Verhältnisse geändert haben, wäre Gegenstand einer montantechnisch-privatwirtschaftlichen Rentabilitätsrechnung, solange nicht allgemein volkswirtschaftliche Gründe dazu zwingen, auch die letzten, privatwirtschaftlich vielleicht unrentabel abzubauenden Kohlenvorräte unseres Landes zu erfassen. Ich hoffe jedenfalls, mit vorliegender Sammlung und Zusammenstellung allen erreichbaren Materials über das Flöhaer Steinkohlenbecken und seinen Abbau in der Vergangenheit eine Grundlage und Erleichterung der Beurteilung für in Zukunft auftauchende Pläne betreffend der Wiederaufnahme des Flöhaer Kohlenbergbaus geboten zu haben. Die in den Archiven der verschiedenen Behörden noch aufbewahrten Akten können, wie mir gesagt wurde, früher oder später der Makulierung anheimfallen, und damit würden die Grundlagen für den zwar kleinen, aber nicht uninteressanten Abschnitt in der Wirtschaftsgeschichte Sachsens, den der Steinkohlenbergbau im Flöhaer Becken darstellt, wegfallen.
____________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quellenangaben Wir führen im Folgenden die Quellen in der Reihenfolge auf, wie sie P. Kleinstäuber in seiner Einleitung benannt hat; ergänzen die Aufführung jedoch durch einige aktuelle Quellensignaturen, wo sie uns z. B. aus dem Quelleninventar zum Steinkohlenbergbau des Sächs. Staatsarchives bekannt sind.
Hinweis: Die verwendeten Digitalisate des
Sächsischen Staatsarchives stehen unter einer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.) Allgemeine, ganz Deutschland oder Sachsen betreffende Werke.
B.) Specialwerke über das Flöhaer Becken
oder Einzelheiten desselben und der angrenzenden Landschaften.
C.) Aufsätze und Berichte aus periodischen
Schriften mit Bezug auf das Flöhaer Becken und seine Umgebung.
D.) Nicht veröffentlichte Quellen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||