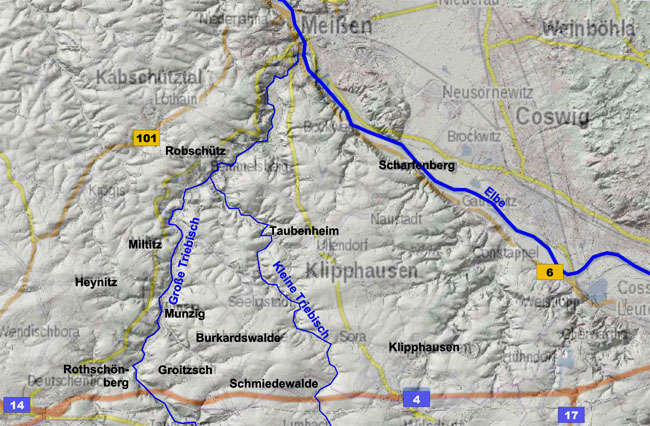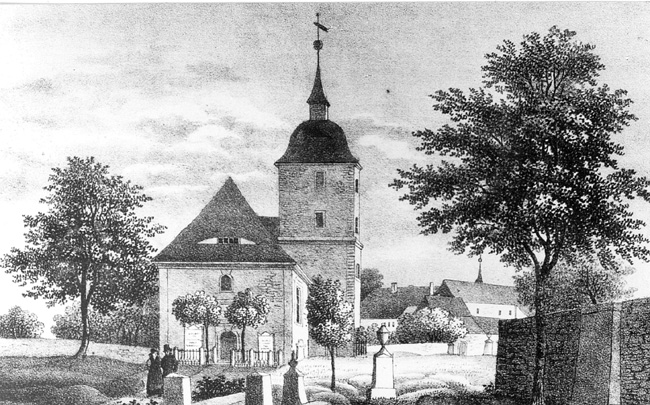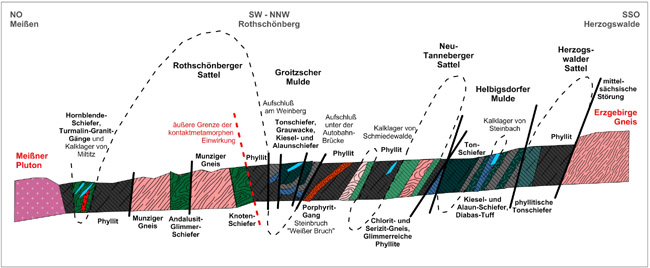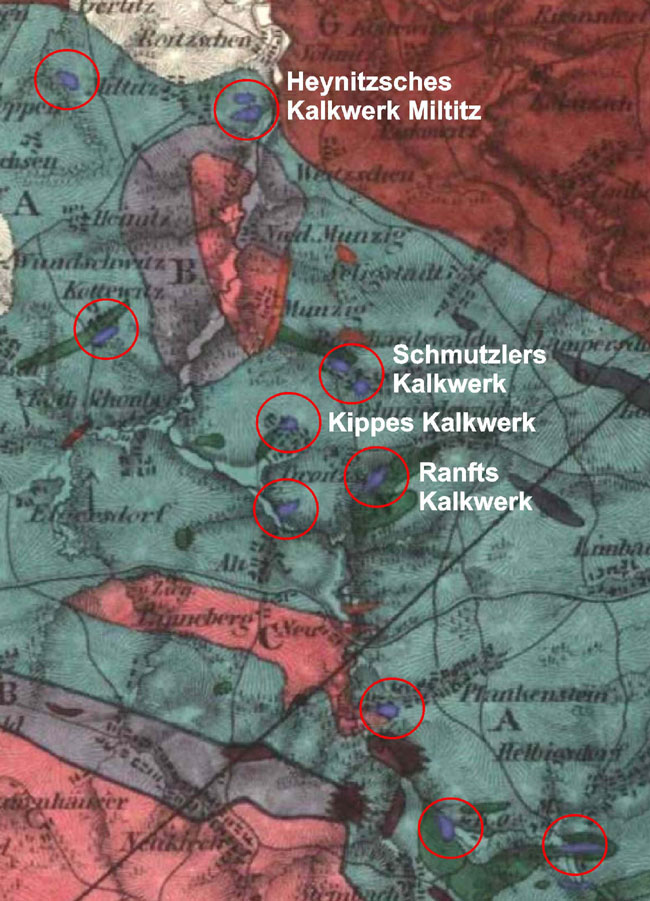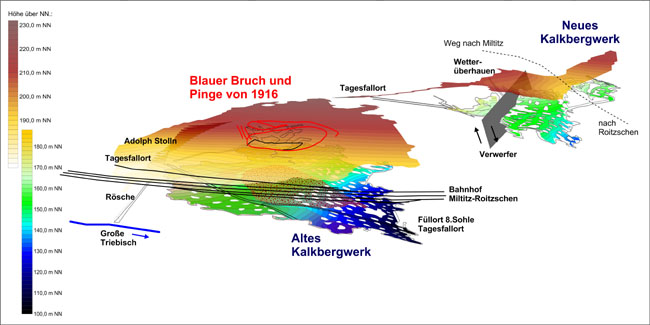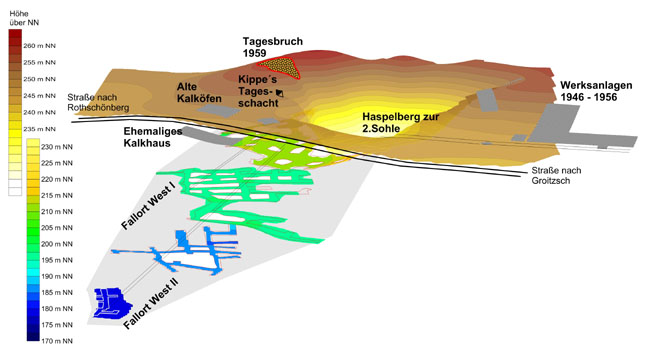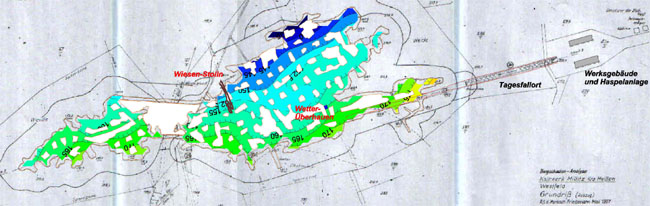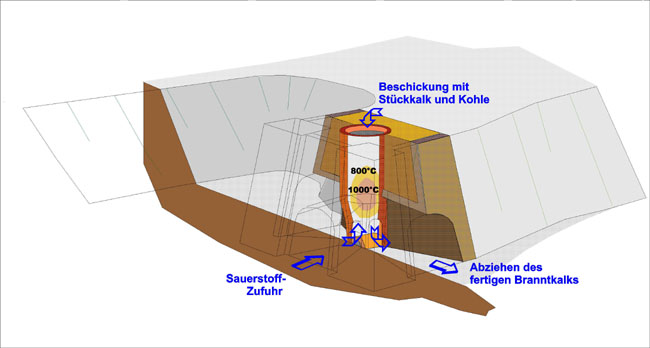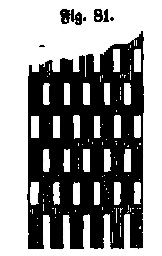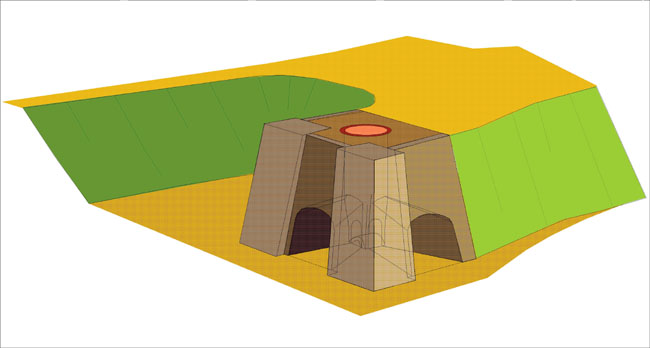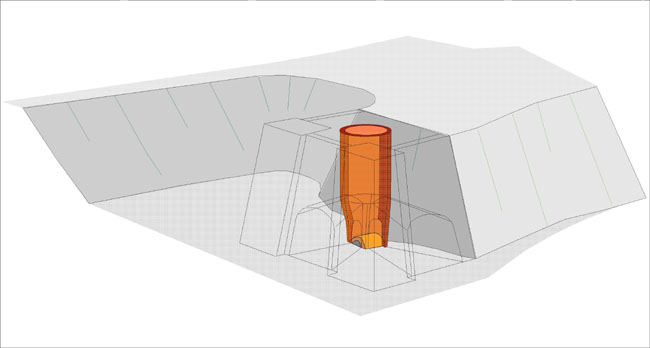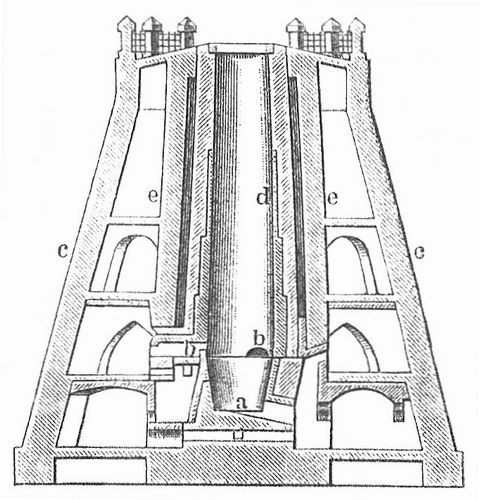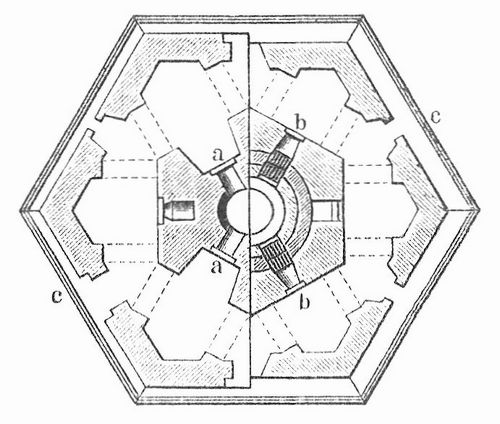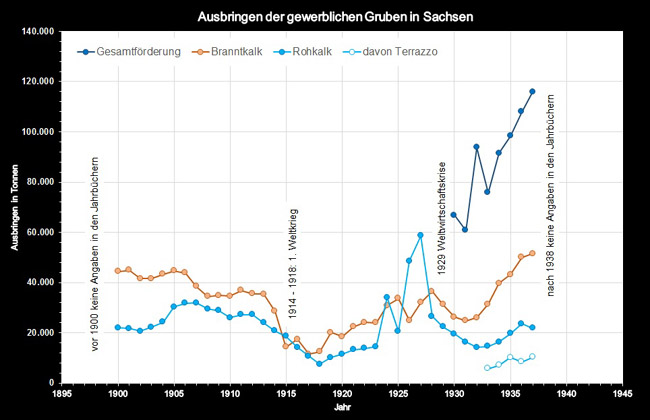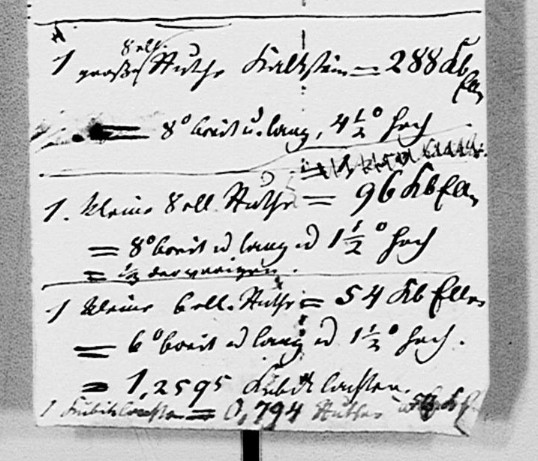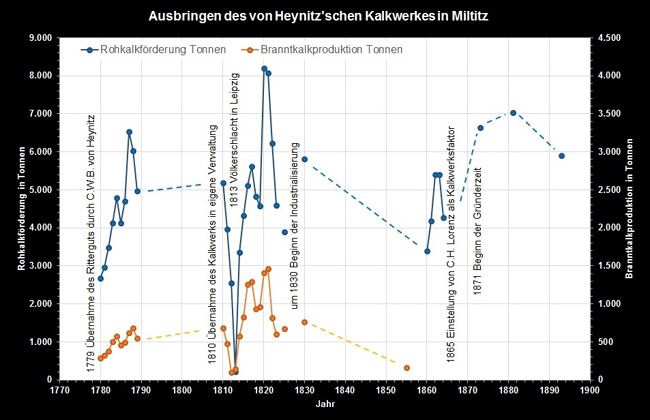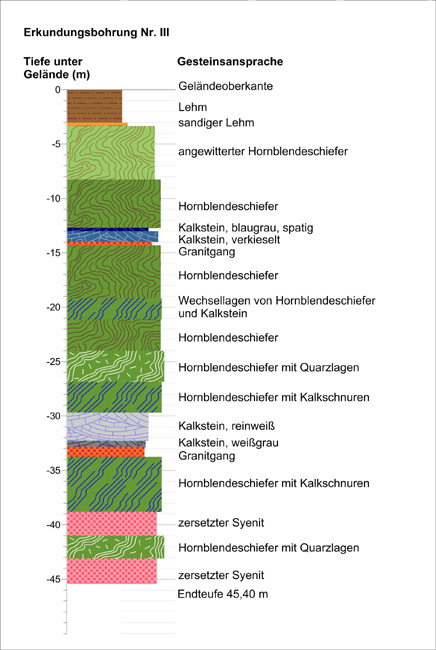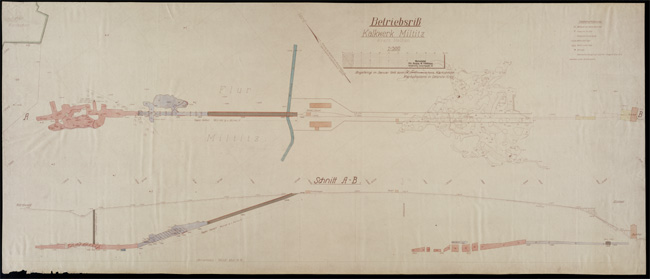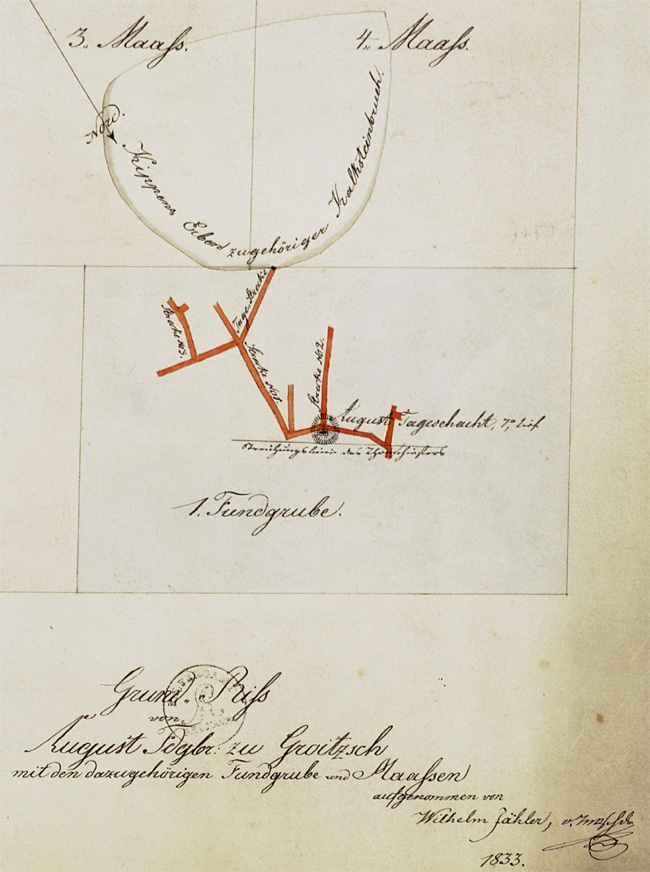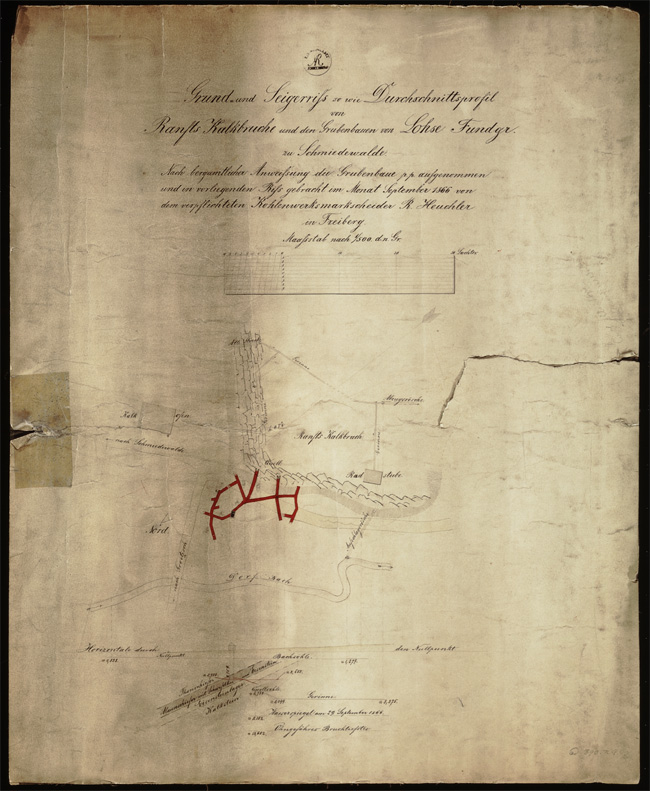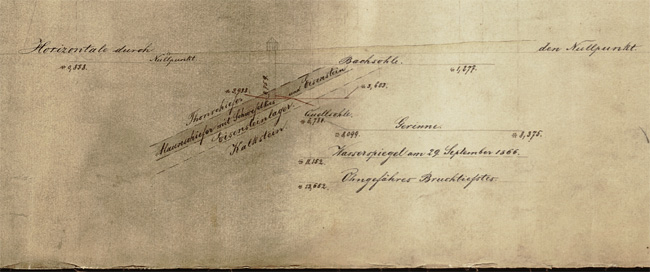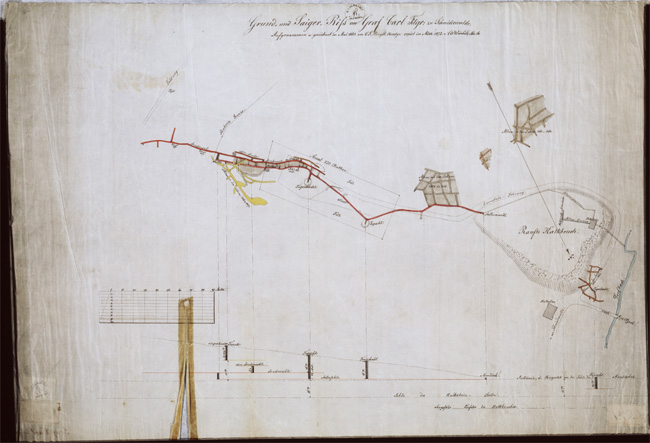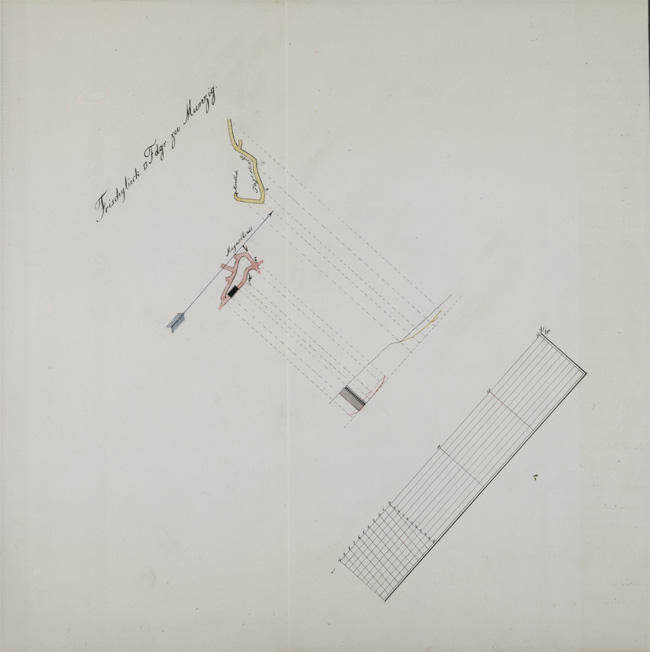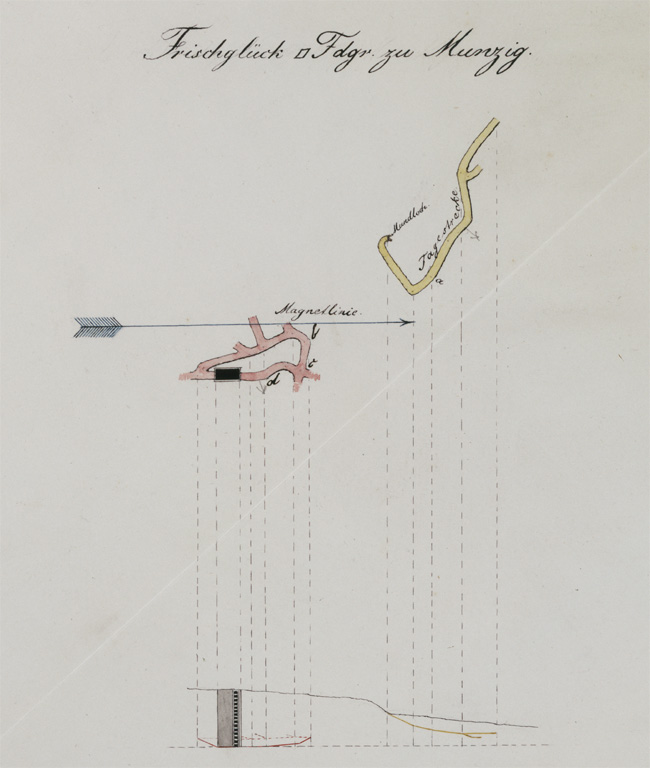|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Kalkbergbau im Nossen- Wilsdruffer Schiefergebirge: Teil 1: Von Miltitz bis Schmiedewalde
Online seit April 2016, letzte Ergänzungen: Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom Oktober 2016 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen.
Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrages bei:
für die Unterstützung bei den Recherchen, zahlreiche Ergänzungen unseres ersten Textes sowie Bildbeiträge.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Lage und Regionalgeschichte der Triebischtäler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Quelle der Großen Triebisch befindet sich im Tharandter Wald zwischen Klingenberg- Colmnitz und Grillenburg. Sie fließt in einem gewundenen und landschaftlich reizvollen Tal zunächst in nordwestliche, ab Rothschönberg dann in nordöstliche Richtung und mündet schließlich in Meißen in die Elbe. Bei Rothschönberg nimmt die Triebisch aus dem hier angesetzten Rothschönberger Stolln auch die Grubenwässer des Freiberger Bergbaureviers auf. Der Höhenunterschied zwischen der Fähre Gauernitz/Kötitz an der Elbe mit zirka 106 m NN und der als trigonometrischem Punkt bekannten, markanten Baeyerhöhe südlich von Taubenheim mit exakt 320,5 m HN im Südosten des Gemeindegebietes beträgt rund 214 m. Das Tal der Großen Triebisch besitzt eine Gesamtlänge von zirka 37 km, das der Kleinen Triebisch nochmals rund 15 km – das ist zuviel für nur eine Tour... Autofahrern ist noch immer der Abschnitt des „Tanneberger Lochs“ besonders bekannt, wo früher die Autobahn 4 das Tal durchquerte und heute drei Großbrücken die Täler überspannen. Den nehmen wir als Mittelpunkt und teilen auch unseren Beitrag in zwei Abschnitte auf. Zunächst nehmen wir uns den unteren Teil des Triebischtals von Rothschönberg aus vor. Er bildet ein steilwandiges, teils recht breites Sohlental. Von der Damm-Mühle unterhalb der Brücke der BAB 4 aus bis nach Miltitz sind es den Fluß entlang zirka 5,6 km. Aufgrund der im Triebischtal reichlich zur Verfügung stehenden Wasserkraft ist seit Jahrhunderten verschiedenartige Kleinindustrie (vor allem zahlreiche Mühlen) ansässig. Aber auch der Kies- und Sand-, Werkstein-, Kalk- und Erzbergbau und schließlich der 1867 erbaute und 1868 dem Verkehr übergebene Bahnanschluß (Strecke von Coswig nach Borsdorf bei Leipzig) haben das untere Triebischtal geprägt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Offenlandschaften zwischen Elbe und Saale besiedelten nach der Völkerwanderung etwa ab 600 n. C. slawische Stämme. In der fruchtbaren Lommatzscher Pflege war vorrangig der Stamm der Daleminzier ansässig. Der sogenannte „Burgser“ bei Robschütz, aber auch Wallreste bei Groitzsch sowie Doppelnamen wie Deutschenbora und Wendischbora zeugen noch heute von der slawischen Besiedlung. Die Slawen wurden in der Schlacht bei Oschatz 929 n. C. von König Heinrich I. unterworfen. Zur Sicherung des eroberten Landes inmitten slawischen Gebietes begründete Heinrich im gleichen Jahr die Burg Meißen. Dies war die Geburtsstunde der Markgrafschaft Meißen und des heutigen Freistaats Sachsen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Um 1150 beginnt unter dem Wettiner Konrad, dem Großen eine neue Phase der Rodung und Kolonisation des Landes zwischen Mulde und Elbe. Weil natürlich die Gegend zwischen der Burg Meißen einerseits, dem Hauskloster Altzella bei Nossen andererseits, vorallem aber dem für die markgräfliche Schatulle so bedeutsamen Freiberg im Süden das Kerngebiet der Markgrafschaft Meißen bildete, wurde es mit einem Netz von kleineren Schutzburgen gesichert, mitunter unter Ausnutzung früher slawischer Fluchtburgen. Zu diesen in dieser Kolonisationsphase angelegten Schutzburgen zählen in der Region zum Beispiel Taubenheim, Miltitz, sowie Scharfenberg. Der Ort Taubenheim, im Tal der Kleinen Triebisch gelegen, wurde bereits 1186 mit der Nennung eines „Adelbertus de Duvenheim“ urkundlich erwähnt. Im Jahre 1269 taucht ein „Heinricus de Tvbenheim“ in Urkunden auf, der wie Adalbert zu den Urahnen des meißnischen Adelsgeschlechts von Taubenheim zählt. 1551 wird Taubenheim als ein altschriftsässiges Rittergut erwähnt. Die Herrschaft übte Erb- und Obergerichtsbarkeit über Teile von Brockwitz, Burkhardswalde, Röhrsdorf, Seeligstadt und Ulberndorf aus. Von 1457 bis 1612 war Taubenheim im Besitz der Familie von Miltitz, nur unterbrochen in den Jahren 1514 und 1515, in denen Caspar von Ziegler als Besitzer nachweisbar ist. Im Jahr 1612 ging das Rittergut an die Familie von Erler über. Nach 1764 kam es mehrfach zu Besitzerwechseln. Um 1850 war das Gut im Besitz von Karl Gottlob Töpolt. Miltitz ist der Hauptort im Tal der Großen Triebisch. Der Ort wird ebenfalls bereits in einer Urkunde aus dem Jahr 1186 als Herrensitz erwähnt. Wahrscheinlich geht der Ortsname auf einen slawischen Personennamen zurück, ebenso wie beim 1334 erstmals urkundlich genannten Ort „Zcwoswicz“ - dem späteren Zwuschwitz, das auf der Hochfläche oberhalb von Miltitz lag. Beide Orte sind schon vor langer Zeit zusammengewachsen. 1457 wird Miltitz als Ritterhof und 1551 als altschriftsässiges Rittergut erwähnt. Die Herrschaft Miltitz übte Erb- und Obergerichtsbarkeit aus. Nachweislich zählte Miltitz 1334 zum Amt Meißen und seit 1696 zum Erbamt Meißen. Im Jahr 1843 lag es im Zuständigkeitsbereich des Amtes Meißen. Seit 1856 unterstand es dem Gerichtsamt Meißen und ab 1875 der Amthauptmannschaft Meißen. Das Rittergut Miltitz ist auch Stammhaus der gleichnamigen Adelsfamilie. Das ausgedehnte Rittergut der Familie von Miltitz befand sich Im Oberdorf. Die Herren von Miltitz besaßen es aber nur bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Dann ging es zunächst in den Besitz der Familie von Luckawen (Luckowien) über, der es rund ein Jahrhundert lang gehörte. Die Familie von Luckawen war schon länger mit der Familie von Heynitz liiert, denn bereits Christian von Heynitz (geboren um 1600) war mit Agnes Sophie von Luckowien verheiratet. Ab 1710 war das Rittergut im Besitz der Familie von Heynitz, der es um 1860 noch gehörte. Berühmt ist der Edelkastanienhain an der Miltitzer Kirche – der wohl größte Edelkastanienhain nördlich der Alpen. Er soll der Legende nach bereits um 1100 durch den bekannten Meißner Bischof Benno angelegt worden sein. Die Miltitzer Kirche gibt es jedenfalls belegbar seit 1372. In ihrer heutigen barocken Form wurde sie von 1738 bis 1740 errichtet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zur Originaldatei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zur Originaldatei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für Rothschönberg wurde erstmals 1254 ein Herrensitz, 1392 ein Rittersitz, 1454 ein Vorwerk und 1551 ein altschriftsässiges Rittergut erwähnt. Die Herrschaft übte ebenfalls Erb- und Obergerichtsbarkeit aus. Rothschönberg gilt als Stammsitz der Familie von Schönberg. Von 1254 bis 1945 waren Rittergut und Schloß im Besitz der Familie. Wie die Nachbarorte zählte Rothschönberg seit 1696 zum Erbamt Meißen. Im Jahr 1834 lag es im Zuständigkeitsbereich des Amtes Meißen. Seit 1856 unterstand der Ort dem Gerichtsamt Wilsdruff und ab 1875 wieder der Amthauptmannschaft Meißen. Die von Schönberg sind eines der bedeutenden und weit verzweigten thüringisch-sächsischen Adelsgeschlechter, das sich – genealogisch gesichert – bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen läßt. Angehörige der Familie bekleideten über Jahrhunderte hinweg hohe Staats- und Verwaltungspositionen, unter anderem als Bischöfe, Amtmänner und Minister. Zwischen 1542 und 1761 leiteten acht Mitglieder der Familie von Schönberg die sächsische Bergbauverwaltung als Berghauptmann bzw. Oberberghauptmann. Für Heynitz wurde erstmals 1334 ein Herrensitz und 1551 ein Rittergut erwähnt. Die Herrschaft übte Erb- und Obergerichtsbarkeit aus. Auch dieses Rittergut war altschriftsässig. Nachweislich zählte Heynitz 1378 zum castrum Meißen. Im Jahr 1547 wurde der Ort als zum Bezirk des Erbamtes Meißen gehörig ausgewiesen. Im Jahr 1843 zählte er zum Gebiet des Amtes Meißen. Seit 1856 unterstand der Ort Heynitz dem Gerichtsamt Meißen und ab 1875 der Amthauptmannschaft Meißen. Das Rittergut Heynitz war von Anbeginn im Besitz der gleichnamigen Familie von Heynitz. Sie spielte nicht nur in der Region des unteren Triebischtales eine bedeutende Rolle. Das Geschlecht erscheint erstmals urkundlich am 21. Januar 1338 mit dem Ritter Nycolaus de Heynicz. Nach E. H. Kneschke, Deutsche Grafen-Häuser der Gegenwart, Leipzig, 1852, soll sogar schon 1318 ein Nicol von Heynitz als Vogt zu Hayn (heute Großenhain) und Ortrand in Erscheinung getreten sein. Die Familie von Heynitz gehörte seit dem 15. Jahrhundert im Hochstift Meißen zu den stiftsfähigen Familien und war über 600 Jahre lang, bis zur Enteignung 1945, im Besitz ihres Stammsitzes Schloß Heynitz. Im Jahr 2004 wurden das Schloß und die umliegenden Wirtschaftsgebäude von der Familie von Heynitz (Förderverein Schloß Heynitz e.V.) gemeinsam mit Familie von Watzdorf von der Gemeinde zurückgekauft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zur Originaldatei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Familie von Heynitz umfaßte mehrere Linien und stellte hohe Bedienstete in mehreren Ländern, wie Braunschweig, Sachsen und Brandenburg-Preußen. Zu nennen ist in Sachsen insbesondere Friedrich Anton von Heynitz (*1725, †1802), welcher 1764 die Funktion des sächsischen Generalbergkomissars übernahm und gemeinsam mit Friedrich Wilhelm von Oppel die Gründung der Bergakademie zu Freiberg 1765 initiierte. Von 1777 bis 1802 war er Oberberghauptmann im Kgr. Preußen. Auf die Anregung von Carl Wilhelm Benno von Heynitz (*1738, †1801), Berghauptmann in Sachsen von 1789 bis 1801 und Kurator der Bergakademie Freiberg, geht außerdem die Einrichtung der Bergschule in Freiberg zurück, welche 1777 zunächst in einem Hörsaal der Bergakademie den Unterricht in den Fächern Religion, Schreiben, Rechnen und Geometrisches Zeichnen aufnahm. Nach Einstellung der staatlichen Gruben in Freiberg im Jahre 1913 konnten die Schüler der Bergschule aber nicht mehr hier praktisch unterrichtet werden und mußten zur Ausbildung in die Kohlenreviere Lugau- Oelsnitz oder in den Plauenschen Grund geschickt werden. Auch der Bedarf an Aufsichtspersonal für den Erzbergbau wurde zu dieser Zeit immer geringer. Daher verfügte das Finanzministerium 1921 die Schließung der Freiberger Bergschule zum 12. Juli 1924.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Namensgebend für den Adolph Stolln in Miltitz war möglicherweise Christian Gottlob Adolph von Heynitz. Er wird im Band 4 des „Vollständigen Staats-, Post- und Zeitungslexikons von Sachsen“, erschienen 1817, für das Rittergut Heynitz als „...der gegenwärtige Besitzer, seit Nicol von Heynitz der elfte dieses Stammes“ erwähnt; war jedoch selbst vermutlich auf Gut Dröschkau (heute Stadt Belgern, Landkreis Nordsachsen) ansässig, welches zur Erscheinungszeit dieses Bandes (nach dem Wiener Kongreß) aber nicht mehr zum Königreich Sachsen gehörte und daher darin keine Erwähnung findet. Ferner wird Christian Gottlob Adolph von Heynitz in der „Jubelchronik der dritten kirchlichen Säkularfeier der Einführung der Reformation in Sachsen“, erschienen 1841 in Grimma, genannt als „...der Kirchenpatron, Christian Gottlob Adolph von Heynitz auf Heynitz, Wunschwitz und Groitzsch...“ Die Güter Heynitz und Wunschwitz scheinen zu diesem Zeitpunkt verpachtet gewesen zu sein. Weil Dröschkau nach dem Wiener Kongreß 1815 unter preußischer Oberhoheit stand, ist ein Teil der verbliebenen Urkunden zu diesem Familienzweig an das heutige Landesarchiv Sachsen- Anhalt übergegangen. Demnach ist das Gut Dröschkau infolge einer Heirat 1669 an die Familie von Heynitz gefallen. Das 1815 als schriftsässig bezeichnete Rittergut hatte spätestens im 18. Jahrhundert die Patrimonialgerichtsbarkeit über den Ort inne und unterstand darin dem Amt Torgau. Zum Besitzkomplex gehörten daneben das Vorwerk Pietzsch und die Schäferei Neusorge. Dieser Zweig der Familie von Heynitz war bis zur Enteignung im Zuge der Bodenreform 1945 auf Dröschkau ansässig. Einem anderen, in Königshain in der Oberlausitz ansässigen Familienzweig entstammt Carl Christian Rudolph von Heynitz, in dessen Händen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Rittergut Miltitz lag und von dem 1874 die Erzgrube Adolph Stolln in Miltitz gemutet wurde. Rudolph von Heynitz gab aber auch seinem 1868 geborenen Sohn den Vornamen Adolph; das Namenspatronat dieses Stollens ist also ungesichert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwischen der Kleinen und der Großen Triebisch,
in einem südlichen Seitental der letzteren oberhalb von Munzig liegt der Ort
Burkhardswalde. Das Waldhufendorf wurde wohl
um 1150 durch fränkische Bauern angelegt und 1334 erstmals urkundlich erwähnt.
Im 19. Jahrhundert zählte man 17½ Hufen, die zum Teil nach Rothschönberg, zum
Teil nach Taubenheim Abgaben leisteten.
Die Schreibweise des Ortsnamens wechselte oft und lautete Burchardtswalde (1334), Borghardiswalde (1378) oder Burckartswalde (1543). 1875 schrieb man Burkhardtswalde bei Wilsdruff oder auch Burkerswalde (isgv.de). In jüngerer Zeit hat sich wieder die Schreibweise mit dem „weichen Konsonanten“ vor dem Wald, Burkhardswalde, durchgesetzt. Auffällig ist ganz besonders die stattliche und an recht exponiertem Punkt erbaute Dorfkirche, die sich über dem Ort erhebt und die schon im Mittelalter Wallfahrtskirche gewesen sein soll, wofür auch die zwei bis drei Jahrmärkte sprechen, die noch bis Anfang des 20.Jahrhunderts in Burkhardswalde als „Bauernmärkte“ stattfanden. Ablaßtage waren zu Mariä Heimsuchung und Mariä Geburt. Die Burkhardswalder Kirche gehört jedenfalls zu den ältesten Kirchen im Kirchenbezirk Meißen. Gelegen an einer Wanderroute durch das Triebischtal, ist sie bis heute ein beliebtes Ausflugsziel für Wandergruppen, Hobbyfotografen und historische Interessierte. Ihr heutiges gotisches Erscheinungsbild erhielt sie wahrscheinlich in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Holzproben im Dachstuhl haben ergeben, daß sie um das Jahr 1470 neu errichtet worden sein muß, nachdem in früherer Zeit schon ein kleinerer Vorgängerbau am selben Ort stand. Seitdem besitzt sie ein dreischiffiges Langhaus auf fast quadratischem Grundriß und einen Chor mit Netzgewölbe (klipphausen.de). Die baustilistisch in die Spätgotik eingeordnete Hallenkirche wird in der Literatur (Sächsische Kirchengalerie) als „eine der am schönsten gelegenen und am großartigsten angelegten Dorfkirchen Sachsens“ gerühmt. Ein regionaler Kirchenführer schreibt dazu: „Wer aus der Ferne das Geläut der Kirche von Burkhardswalde hört, vermutet einen Dom und nicht eine Kirche am Rande eines abgelegenen Dorfes...“ (pfarramt-burkhardswalde.de). Bemerkenswert ist auch das Steingut im Oberdorf, ein Bauernhof, der vermutlich aus einer frühen Befestigungsanlage entstand. Eine Mauer umschließt ein Geviert von ca. 9 m x 12 m, das ein U- förmiges Gebäude aufnimmt. Der südliche Teil ist ein Wohnturm vermutlich schon aus dem 14. Jahrhundert (wikipedia.de). Kirche und Steingut bieten Stoff für eine Reihe von Legenden und werfen allerlei Fragen auf. So erzählt man sich, daß ein unterirdischer Gang von der Kirche zum Steingut im Oberdorf führe und daß es in vorreformatorischer Zeit ein wundertätiges Marienbild in der Kirche gegeben habe, das viele Pilger anlockte. Wer den Kirchenraum betritt, fragt sich, warum die Kirchenbänke wie auf einem hin- und herwogenden Schiff Schlagseite haben, warum das geplante Deckengewölbe im Hauptkirchenschiff nie fertig gestellt wurde, und was es denn mit dem Wendeltreppenaufgang auf sich hat, durch den man vom Kirchenraum ins Dach gelangt (pfarramt-burkhardswalde.de).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zur Originaldatei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der kleine Ort Groitzsch zählte 1378 zum castrum Meißen, wurde aber erst 1696 als eigenständiges Rittergut erwähnt. Zu diesem Rittergut gehörten lediglich einige Häuslernahrungen des Dorfes. In den Jahren 1445 und 1447 wurde er als Pflege Groitzsch ausgewiesen. Zum Bezirk des Erbamtes Meißen gehörte er 1547. Für das Jahr 1696 ist die Zugehörigkeit zum Rittergut Rothschönberg und anteilig zum Rittergut Groitzsch nachgewiesen. Im Jahr 1764 gehörte die Ortschaft Groitzsch wieder zum Rittergut Rothschönberg und anteilig zum Rittergut Wunschwitz. Im Jahr 1765 kaufte Carl Wilhelm Benno von Heynitz das Rittergut Groitzsch. Die Herrschaft auf Groitzsch übte Erb- und Obergerichtsbarkeit aus. Die Zuständigkeit ging 1843 zum Amt Meißen. Seit 1856 unterstand Groitzsch dem Gerichtsamt Wilfsdruff und ab 1875 der Amthauptmannschaft Meißen. Erst 1428 und damit relativ spät wurde das Dorf Schmiedewalde erstmals urkundlich erwähnt. Es geht wohl ebenfalls auf eine Ansiedlung fränkischer Bauern zurück und bildete ein einseitiges Waldhufendorf. Um das Dorf herum erstrecken sich noch heute etwa 337 ha Waldfläche. Eingepfarrt war Schmiedewalde zunächst nach Blankenstein, erst seit 1877 nach Burkhardswalde. Die Grundherrschaft übten die Besitzer des Ritterguts Rothschönberg aus, die Verwaltung oblag jahrhundertelang dem Erbamt Meißen. Im Jahre 1856 gehörte Schmiedewalde zum Gerichtsamt Wilsdruff und kam danach zur Amtshauptmannschaft Meißen. Auf Grundlage der Landgemeindeordnung von 1838 erlangte Schmiedewalde Selbstständigkeit als Landgemeinde, verlor den Status jedoch am 1. Juli 1950 wieder durch die Eingemeindung nach Burkhardswalde (wikipedia.de). Am 1. Juli 1950 wurden die bis dahin eigenständigen Gemeinden Groitzsch und Schmiedewalde zunächst nach Burghardswalde eingegliedert. Am 1. Januar 1973 wurde Burkhardswalde dann zunächst mit dem Nachbarort zu Burkhardswalde- Munzig vereinigt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Munzig gliedert sich in Obermunzig und Niedermunzig, die jedoch innerhalb einer gemeinsamen Gemarkung liegen und durch die Straße „Lämmerberg“ verbunden sind. Obermunzig liegt oberhalb des aus Burkhardswalde kommenden Bach auf der rechten Seite des Talhangs. Niedermunzig befindet sich einen knappen Kilometer weiter nordwestlich im Tal der Großen Triebisch. Erstmals erwähnt wurde das Dorf 1334 als „Munczig“. Im Jahr 1340 taucht ein „Jenchin von Muncik“, 1350 ein „Ticzmannus de Munczk“ in Urkunden auf, so daß davon ausgegangen wird, daß sich in dieser Zeit ein Herrensitz im Ort befand. Im Lauf der Jahrhunderte wandelte sich der Ortsname unter anderem über die Stationen „Muntzczigk“, „Monzig“ und „Nuntzke“ hin zur heutigen Schreibweise, die ab 1791 belegt ist. Die Entwicklung des Dorfes nahm im heutigen Obermunzig ihren Ausgang. Im Jahr 1457 gab es dort ein Vorwerk. Im 15. Jahrhundert entwickelte sich daraus ein Rittergut, um das herum Munzig als Gutssiedlung mit einer 198 Hektar großen Gutsblockflur entstand. Die Grundherrschaft und mit ihr die Ober- und Erbgerichtsbarkeit übten im 16. Jahrhundert Angehörige der Familie von Miltitz als Besitzer des gleichnamigen Ritterguts aus. Das 1696 und 1764 erwähnte altschriftsässige Rittergut Munzig, dem neben Munzig selbst auch Weitzschen und Dreißig bei Mochau unterstanden, gehörte bis Anfang des 18. Jahrhunderts der Adelsfamilie von Ende. Danach war es im Besitz der Familie Kölbel, anschließend bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts des Adelsgeschlechts von Schleinitz sowie bis um 1860 des Adelsgeschlechts von Könneritz, auf das bis 1945 noch verschiedene bürgerliche Besitzer folgten (wikipedia.de). Erzbergbau wurde im nördlichen Teil des kleinen Reviers zwischen Aspengrund und Weitzschengrund ‒ zwischen Munzig und Weitzschen gelegen ‒ vermutlich bereits seit 1492 betrieben. Kurfürst Vater August ließ 1580 hier eine Schmelzhütte und ein Pochwerk errichten. Zwischen 1710 und 1744 betrug die dokumentierte Förderung aus dem „Wildemann- Erbstolln“ 16.074 Zentner Erz mit einem Feinsilbergehalt von 2.157 Mark, 14 Loth und 2 Quent gefördert (also zirka 540 Kilogramm insgesamt). Außerdem wurden hier Bleiglanz, Kupferkies und Arsenkies ausgebracht und auch untertägig Kalkstein gebrochen. Etwa ab 1514 ist auch in Niedermunzig im südlichen Teil des kleinen Reviers Erzbergbau urkundlich belegt. Dort förderte 1715 neben anderen die Grube „Freundlicher Bergmann“ Silbererz und lieferte es an die Hüttenwerke nach Freiberg. 1759 der „Johanna Erbstolln“ auf einem Morgengang vom Eingang des sogenannten Diebsgrundes her vorgetrieben, um Wasserlösung für die Bergwerke zu schaffen. Erst ab 1778 löste schließlich der „Dürrwiesner Stolln“ endlich die oberhalb gelegenen Bergwerke vom Grundwasser. Bis 1802 lieferte die Grube Freundlicher Bergmann danach noch Silbererz ‒ im Zeitraum von 1719 und 1802 mit einem dokumentierten Ausbringen von insgesamt 1.528 Mark, 13 Loth und 5 Quent, also etwa 382 Kilogramm Silber (klipphausen.de). An dieser Stelle legten die Besitzer der Pappenfabrik später einen kleinen Landschaftspark an. Die Pappenfabrik war der größte Arbeitgeber in Munzig und ein Nachfolgebetrieb besteht in anderer Form noch heute. Ihrer Stromversorgung diente die 1892 aufgekaufte und umgerüstete Munziger Mahlmühle. 1831 wurden noch einmal Wiederbelebungsversuche des Erzbergbaus aufgenommen. Von 1838 bis 1856 wurde der zuletzt 429 m lange „Hilfe Gottes Stolln“ unter die Abbaue der Altvorderen vorgetrieben, aber mangels bauwürdiger Erzvorkommen bereits 1859 endgültig aufgegeben. Erst beim Bau der Miltitzer Schule im Jahr 1956 entdeckte man diesen Stolln wieder (klipphausen.de). Der Erzbergbau in der Region allein liefert jedenfalls genug Geschichte für einen eigenen Beitrag... Wir wollen in diesem Beitrag aber beim Abbau des metamorphen Kalksteins bleiben, wohl wissend, daß beides oftmals gemeinsame Ursprünge oder auch geologische Zusammenhänge aufweist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Gemeinde Triebischtal entstand am 1. März 1994 durch den Zusammenschluß von zunächst drei Gemeinden (Burkhardswalde- Munzig, Garsebach und Miltitz). Am 1. Januar 1999 kam Tanneberg hinzu, zum 1. November 2003 wurde Taubenheim eingemeindet. Schließlich besaß die Gemeinde Triebischtal rund 20 Ortsteile. Im Zuge der letzten Gemeindegebietsreform schlossen sich am 1. Juli 2012 dann die Gemeinden Triebischtal und Klipphausen zu einer neuen Gemeinde unter dem Namen Klipphausen mit nun über 62 km² Fläche zusammen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Geologie des Nossen- Wilsdruffer Zwischengebirges
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Überblick In seinem unteren Abschnitt durchschneiden die Täler der beiden Triebischflüsse das Nossen- Wilsdruffer Schiefer- oder Zwischengebirge bis hinunter zum Meißner Massiv und schufen dabei eine Fülle geologischer Aufschlüsse. Das Schiefergebirge ist gewissermaßen zwischen dem Erzgebirgsgneis und dem Meißner Pluton „eingeklemmt“ und setzt sich vorwiegend aus unterschiedlich stark metamorphen Schiefern vorwiegend altpaläozoischen Alters zusammen. Sie liegen heute als Tonschiefer, Phyllite, Grauwacken, Knotenschiefer oder Fruchtschiefer (Serizit- reiche Tonschiefer) oder Glimmerschiefer vor. Die Edukte der Schiefer wurden im Zuge der varistischen Faltung eingeengt und aufgefaltet. Während der Faltung wurden diese Schichten stark ineinander verschuppt und zudem durch mehrere, meist um NW- SE- Richtungen streichende Störungen versetzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besonders die devonischen Schichten enthalten Diabase und Diabastuffe („Grünstein“), die von submarinem Vulkanismus zeugen. Als eine besondere Bildung wird außerdem 1851 (40003, Nr. 250) ein „Strahlstein“ aufgeführt, womit wohl ein erzmineralreicher Amphibolit bezeichnet wurde. Ein solches lokales Vorkommen wird in im Liegenden des im Munziger Wildermann Erbstolln angefahrenen Kalklagers beschrieben. Das Gestein enthält verschiedene Amphibole (vor allem den grünen Aktinolith), dunkle Glimmer (Biotit) und Pyroxene (vor allem Salit), außerdem das dunkelgrüne Mineral Epidot. In das Silur werden Kiesel- und Alaunschiefer eingeordnet, wie sie zum Beispiel im ehemaligen Steinbruch am Weinberg bei Rothschönberg aufgeschlossen sind. Unterkarbonische Tonschiefer überdeckten ursprünglich das Relief, sind heute jedoch nur noch in Muldenstrukturen erhalten. Alle diese Gesteinsschichten bildeten ursprünglich das „Dach“ der Freiberger Gneiskuppel, der sie im Südwesten an der mittelsächsischen Störung diskordant aufliegen. Im Norden hat sich im Oberkarbon am Ende der varistischen Faltungs- und Hebungsphase der Meißner Syenodiorit *) darunter geschoben. Syenodiorit ist wie der ältere Meißner Granodiorit ein Übergangsgestein zwischen Quarz- und Kalifeldspat (Orthoklas-) reichen Graniten und den Quarz- armen und vorwiegend Ca- Na- Feldspäte (Plagioklas) enthaltenden Dioriten. Die Syenite unterscheiden sich zusätzlich von den Dioriten dadurch, daß sie nie Hellglimmer (Muskovit) enthalten, dafür aber stets einen Anteil an eisenreichen Amphibolen (insbesondere die schwarzgrüne Hornblende). *) Nach jüngeren mineralogischen Untersuchungen ist das Gestein als Monzonit anzusprechen. Monzonite gehören zur Syenit- Gruppe, unterscheiden sich vom Syenit im engeren Sinne aber dadurch, daß der Plagioklas (Kalzium- Natrium- Feldspat) gegenüber den Orthoklas (Kalium- Feldspat) im Mineralbestand deutlich überwiegt. Da in der historischen Literatur diese Unterscheidung aber noch nicht getroffen wurde und stets vom „Syenit“ die Rede ist, verwenden auch wir im Weiteren ebenfalls die ältere Bezeichnung. In der Spätphase des oberkarbonischen Magmatismus intrudierte noch der „Rote Meißner Granit“ in diesen Komplex. Auch in der Umgebung des Magmatitkomplexes treten noch Apophysen des Granitkörpers als kleine Gänge granitischer Gesteine (Turmalingranit) auf. Im Burkhardswalder Grund nahe Munzig durchzieht ein größerer Porphyrgang die Gesteinsserien. Er setzt sich in südwestliche Richtung fort und ist im ehemaligen Steinbruch „Weißer Bruch“ südlich der Autobahnbrücke im Tal der Großen Triebisch nochmals aufgeschlossen. Porphyre liegen als Effusiväquivalent des Granites auch dem Meißner Massiv auf. Weiter südlich bilden sie die Ausfüllung einer mächtigen Caldera im heutigen Tharandter Wald. Als jüngste Bildung des oberkarbonischen Magmatismus sind neben dem Roten Meißner Granit im Zentrum des Meißner Magmatitkomplexes die Pechsteine anzusehen, die bei Garsebach an der linken oberen Talschulter anstehen und aufgrund ihrer Seltenheit als Geotop eingestuft sind. Der äußere Kontakthof des Meißner Plutons, in dem die Gesteine einer thermischen Beeinflussung unterlagen – verbunden mit Mineralneubildungen, wie Andalusit, Chlorit und Serizit – reicht noch mehrere Kilometer (bis nördlich von Rothschönberg) nach Südwesten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im unmittelbaren Kontaktbereich zum Meißner Plutonitkomplex (innerer Konakthof) wurden besonders die schon primär eisenmineralreicheren Diabastuffe in den hangenden Schiefern in schwarze Hornblendeschiefer umgewandelt. Über die Hornblendeschiefer schreibt W. Vogelgesang 1851, dieses Gestein „...bildet theils – und zwar vorherrschend – einen feinen und geradschiefrigen, in dünne ebenflächige Platten geschichteten Hornblendeschiefer, theils einen feinkörnigen, unregelmäßig zerklüfteten Hornblendefels, beide aus sehr festen und zähen Aggregaten von kleinblättriger oder kleinstrahliger, dunkellauchgrüner bis schwärzlichgrüner Hornblende mit sehr wenig Feldspath bestehend.“
Die an mehreren Stellen in der Umgebung (Groitzsch, Burkhardtswalde,
Schmiedewalde) – z. T. in unmittelbarer Nähe der Kalkbrüche – abgebauten
Brauneisensteinlager (Limonit) sind durch Verwitterung dieser eisenhaltigen
Schiefer entstanden. Möglicherweise wirkten die Kalklager dabei als geochemische
Barriere, an der das Lösungsgleichgewicht in den Sickerwässern durch das
Hinzutreten von
Mehrere kleine Eisenerzgruben bauten im Zeitraum 1830 bis 1877 auf diesen Brauneisenlagern, u. a. in Munzig (Frisch Glück Fdgr.), in Groitzsch (Gute Hoffnung Fdgr.), bei Burkhardswalde (Graf Carl Fdgr.) und in Schmiedewalde (Lohse Fdgr.). Nur in Taubenheim seien (nach 40073-1, Nr. 065) auch Eisenerz-Gänge (Unser Glück Stolln) bebaut worden. Beim Ort Robschütz wird im „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikon von Sachsen“, Band 9, 1822, von August Schumann erwähnt, daß dieser Brauneisenstein auch als Ockerfarbe abgebaut wurde: „(Daneben) …setzt noch, gleich in der Nähe von Alt- Robschütz, an der nordwestlichen Seite desselben, in der Schlucht zwischen Alt- und Neu- Robschütz, ein ziemlich bedeutendes Lager von gelber Erde über, das bei einer mehrelligen Mächtigkeit bereits an mehrern Punkten seines zu Tage Austreichens abgebaut und das Gewonnene in einer dicht neben dem Kalkofen erbauten Schlämmerei zu der feinsten käuflichen Gelberde zugerichtet wird, welche ihrer Schönheit wegen sehr gesucht ist.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die intrudierten magmatischen Gesteine dürften auch zur Vererzung einiger Spalten und Klüfte beigetragen haben. In (40003, Nr. 250) werden für die Gänge, die im Wildemann Erbstolln bei Munzig angetroffen wurden, als Erzminerale hauptsächlich Pyrit, Bleiglanz und schwarze Zinkblende, untergeordnet auch Arsenkies angeführt, die von Quarz, Calzit und Ankerit begleitet werden – sie entsprechen also im Wesentlichen der Freiberger kiesig- blendigen Formation. Besonders im östlichen Talhang der Großen Triebisch bei Niedermunzig bauten mehrere Gruben auf diesen Erzgängen (u. a. Wildermann Erbstolln, Neuer Tiefer Hilfe Gottes Stolln, Johanna Erbstolln, Freundlicher Bergmann und Donat). Dieser Bergbau ist schon seit 1514 urkundlich belegbar und ist um die Mitte des 19. Jahrhunderts erloschen. Die Schichtenfolge wurde zuletzt im Zuge der alpidischen Faltungsphasen nochmals tektonisch beeinflußt, erneut emporgehoben und wieder eingeebnet. Während der Elster- Kaltzeit wurde die Hochfläche vom Gletschereis überfahren. Die paläozoische Schichtenfolge ist daher heute mit Lößlehmen, Hanglehmen und Feinsanden und in den Tallagen auch mit holozänen Auesedimenten von bis zu 10 m Mächtigkeit überdeckt. Insbesondere die Kies-Sandlagerstätten waren schon früher Gegenstand lokalen Abbaus und sind es z. T. bis heute (Sönitz, Piskowitz).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Kalkvorkommen In diese wechselvolle Geologie sind nun außerdem eine ganze Reihe meist linsenförmiger Vorkommen von Kalkstein konkordant eingefaltet. Durch die intensive Verkippung der Schollen treten die Kalkvorkommen in mehreren Reihen angeordnet und besonders im Ausstreichen der silurischen und devonischen Schichtenfolgen auf. Die typische Linsen-Form der Kalklager entsteht während der Faltung durch Stauchung, Überschiebung und Auseinanderreißen einer möglicherweise einst bankförmigen Kalksedimentschicht oder primär isolierter Vorkommen (Riffkalke). Stratigraphisch werden die Kalklager in das Oberdevon eingeordnet (Lapp et al., 2021). Die Region fand schon immer großes Interesse bei den Geologen. Schon Petrus Albinus erwähnte 1590 Marmorvorkommen in der Region: „Wir wollen aber andere Arten der Steine / so wir unter die Marmora zehlen können / auch mit nennen / und nach den Farben ordentlich nacheinander erzehlen. Man findet in den Silberbergwercken in Meyssen einen weißen Marmor / fast wie Elfenbein / gleich wie man bey Elbingerode dergleichen grebt / und sonsten am Hartz. …“ (Meyssnische Bergk Chronica, XXI. Tittel: Von Marmoren und andern denselben verwandten Steinen im Lande zu Meyssen.) Nach Albinus‘ Beschreibung müssen die Marmorlinsen im Triebischtal also zuerst in den Stollen der Erzbergwerke entdeckt worden sein. Im nachfolgenden Kapitel XXII: Von den Werckstücken und anderen Felsen und etlichen Arten von mancherley Steinen im Lande zu Meyssen erwähnt Albinus dann, des „Kalcksteins haben wir in Meyssen auch keinen Mangel…“ In diesem Abschnitt führt er jedoch nur Rabenstein und Auerswalde bei Chemnitz, den Pirnaer Raum sowie Wildenfels als Abbauorte in Sachsen auf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Zwischenbericht mit Datum vom 20. August 1818 zu der am Ende des 18. Jahrhunderts begonnenen, geognostischen Untersuchung des Königreiches Sachsen, namentlich über die dabei „aufgefundenen Lagerstätten gemeinnützlicher und besonders brennlicher Fossilien,“ verfaßte „auf allerhöchsten Befehl“ der damalige Obereinfahrer Carl Amandus Kühn (40003, Nr. 59). Darin notierte er im zweiten Kapitel über den zwischen der Elbe und der Freiberger Mulde gelegenen Teil Sachsens (Blatt 63ff) im Abschnitt D. über Lagerstätten nicht brennlicher nutzbarer Fossilien (Blatt 98ff) seines Berichtes über die hiesigen Kalksteinvorkommen (Blatt 103ff): §37. d. Dergleichen im Triebischthale bei Miltitz, Burkerswalde und Kottewitz, Schmiedewalde, Grötzsch, Blankenstein pp. „Eine große Anzahl z. Th. mächtiger Kalklager setzt hiernächst in dem Triebischthale, oberhalb Meißen auf. Zuerst gibt es hier oberhalb Miltitz 2 solcher Lager, von denen das nördlichste wenigstens über 12 Ellen mächtig ist, und einen ziemlich dichten, blaulichgrauen Kalkstein führt, aber zur Zeit nicht bebaut wird, und das 200 Schritt südlicher gelegene, 15 bis 18 Ellen starke, aus reinem und weißen Kalkstein bestehet, auf dem seit 1779 ein wichtiger Bruch im Gange ist. Ein 3tes Lager hat man in Burkerswalde und Kottewitz ausgerichtet. Es wird an beiden Punkten bebaut, jedoch kennt man seine Mächtigkeit noch nicht genau. Ein 4tes Lager setzt bei Schmiedewalde auf. Es ist 4 Ltr. mächtig durchsunken worden, ohne daß noch sein Liegendes erreicht worden ist. Ferner kommt ein 5tes Lager unterhalb und ein 6tes und 7tes sogleich oberhalb Grötzsch vor. Das untere ist 5 – 6 Ellen mächtig, das mittlere 7 und das oberste noch etwas darüber. Alle drei werden vom Triebischtahle aus bebaut und führen, so wie auch das 3te und 4te der gedachten Lager, einen blaulichgrauen, fast schon dichten Kalkstein...“ Auch das Kalktuff- Vorkommen bei Robschütz wurde bereits von Carl Amandus Kühn etwas weiter unten in seinem Zwischenbericht erwähnt (40003, Nr. 59, Rückseite Blatt 109f): §43. d. Kalktuff bei Robschütz und Klosterbuch. „Endlich findet sich bei Robschütz ohnweit Meißen ein ansehnliches Lager von Kalktuff, welches man in neuerer Zeit auch zu benutzen nicht unterlassen hat. Ein ähnliches Lager hat sich aber ohnlängst auch zu Klosterbuch (oberhalb Leisnig, am rechten Ufer der Freyberger Mulde gelegen) im rothen Grunde daselbst vorgefunden. Es hat an einzelnen Punkten eine Mächtigkeit von mehr als 10 Ellen und zieht sich wenigstens 250 – 300 Schritte in gedachtem Grunde fort.“ Das Blatt X der 1845 erschienenen Geognostischen Karte des Königreichs Sachsen zeigt uns dann die damals hier bekannten Kalksteinvorkommen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch Bernhard von Cotta *) besuchte das Triebischtal. Er hinterließ uns in seinem Brief an Dr. C. C. von Leonhard, Professor für Mineralogie an der Universität zu Heidelberg, eine ausführliche Beschreibung und nachstehende Skizze des Kalksteinbruchs bei Miltitz aus dem Jahr 1834. Zur Erläuterung der Zeichnung schreibt er: „Zuoberst sehen Sie ein dunkelfarbiges Schiefergestein (a), welches sich auch in der Mitte wiederholt, und aus Hornblendeschiefer besteht, der jedoch oft in grauen Glimmerschiefer übergeht, ohne dass man irgend eine Grenzlinie zwischen beiden wahrnehmen könnte. Nur aus heruntergefallenen Bruchstücken kann man dieses Phänomen beurtheilen, da die Felswand selbst sich ohne hohe Leiter nicht besteigen lässt. Das erste auffallende Lager von oben herein ist hierauf eine 4 bis 6 Fuss mächtige Granitbank (b), das zweite, am Boden des Bruches, eine 8 bis 25 Fuss mächtige Lager- förmige Kalkmasse (c). (Das Kalklager besaß also im Ausstrich im Tagebau zirka 2,5 m bis 7,5 m Mächtigkeit.) Alle diese Gesteine zeigen theils durch ihre Schieferung im Innern, theils durch ihre äusseren Begrenzungen, ein unter sich paralleles Fallen von etwa 20° gegen NW. Das Gehänge ist mit Schutt und Gerölle bedeckt (d).“ *) Eine Anmerkung: Da der Name Cotta sowohl mit, als auch ohne Adelsprädikat in der Literatur auftaucht, haben wir einmal nachgeforscht. Tatsächlich wurde den Brüdern Friedrich Wilhelm (1796-1874), Friedrich August (1799-1860) und Carl Bernhard (1808-1879) im Jahr 1858 auf ihren Antrag das Adelsprädikat wieder verliehen, so daß die Schreibweise Bernhard von Cotta nicht falsch ist. Der vielleicht adlige Ursprung der Familie von Cotta liegt jedoch tief begraben im Dunkel der Geschichte. Als Ahnherr der Cotta´s gilt Bonaventura Cotta (um 1370-1430), ein aus Mailand stammender Adliger, der als kaiserlicher Rat in Eisenach ansässig wurde. Angeblich habe Kaiser Sigismund 1420 wegen ihrer Treue zum Kaiser und der Tapferkeit in Kämpfen gegen damalige Reichsfeinde die Familie Cotta in den Adelsstand erhoben. Der Adelsbrief soll aber nach einem Stadtbrand 1752 in Ilmenau verschollen sein. Ihr Vater Johann Heinrich Cotta (1763-1844), der insbesondere als Begründer der forstlichen Fachschule in Tharandt bekannt ist, hat den Adelstitel aufgrund seiner bürgerlich- demokratischen Einstellung jedenfalls ganz bewußt nicht geführt. Obwohl schon 1817 dazu aufgefordert, unternahm er nie Schritte zur Wiedererlangung des Adelsprädikates. Friedrich Wilhelm Cotta beschrieb seine Einstellung 1860 so: „Mein Vater, der zwar oft genug Adligen gegenüber kränkende Zurücksetzung erfahren, indeß durch seine Verdienste sich ein großes Ansehen erworben und in eine Stellung gebracht hatte, in welcher er den Adel entbehren zu können glaubte, lehnte ab, weil er meinte, seine Söhne möchten sich doch hervortun, dann würden sie keiner Adelserneuerung bedürfen, weil er sich außerdem für zu wenig wohlhabend erachtete, um einen solchen Schritt zu tun, und weil er überhaupt der Hoffnung lebte, daß es mit den Bevorzugungen des Adels zu Ende gehen werde.“ Durch diese Einstellung und durch seine naturwissenschaftliche Ausbildung (die älteren Brüder arbeiteten wie der Vater an der späteren Kgl.- Sächs. Forstakademie) geprägt, nahm auch Bernhard Cotta an der Märzrevolution 1848 teil, wurde jedoch 1849 begnadigt. Bereits ab 1832 hatte Bernhard Cotta unter Leitung von Carl Amandus Kühn an der Geognostischen Karte von Sachsen mitgearbeitet, ab 1835 übernahm er mit Carl Friedrich Naumann die Leitung dieser Arbeiten. Ab 1842 hatte er den Lehrstuhl für Geognosie an der Bergakademie inne und vollendete 1845 die Geognostische Beschreibung des Königreichs Sachsen. 1862 wurde er aufgrund seiner Verdienste zum Bergrat berufen. Da wir an dieser Stelle aber noch im Jahre 1834 sind, verzichten wir im Weiteren auf das Adelsprädikat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B. Cotta beschreibt weiter den Miltitzer Kalk wie folgt: „Der körnige Kalkstein wurde an dieser Stelle schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts (also um 1750) abgebaut, zuerst steinbruchweise, jetzt unterirdisch durch Pfeilerbau, der bei Fackelschein befahren einen grossartigen Eindruck hervorbringt. Dieser Kalkstein ist nach allen Richtungen zerklüftet, und auf den Klüften stets mit rothem Eisenoxyd überzogen, so dass seine Masse im Ganzen als rother Streif im dunkelfarbigen Schiefer erscheint. Im frischen Bruche aber ist er gewöhnlich rein weiss und vollkommen körnig blätterig, selten ins Röthliche oder Grauliche spielend. Auch Drusenräume, mit skalenoedrischen Krystallen besetzt, finden sich im Innern, doch selten. Seine Grenzen gegen den Schiefer sind stets sehr scharf, im Grossen oft, im Kleinen selten Wellen-förmig, oder, wie es aus umherliegenden Bruchstücken hervorgeht, verzahnt, in der Weise, dass der Kalk Gang- förmig in den Schiefer eingedrungen ist. Merkwürdig sind besonders die manchfachen Kontakt- Erscheinungen, welche an diesen Grenzen sich finden. Gegenwärtig lässt sich am anstehenden Gestein über Tage nur die obere Grenze beobachten; hier ist der Schiefer zunächst dem Kalk gewöhnlich sehr verwittert und, wie es scheint, an sich selbst herumgerieben, ohne jedoch eigentliche Rutschflächen zu zeigen. Braunes Eisenoxyd, kleine Kalkfragmente enthaltend, dient oft als Zwischenlage, und ein anderes ähnlich vorkommendes pulveriges Mineral ist wahrscheinlich Mangan. Noch auffallender und schöner sind die Kontakt- Erscheinungen, die man an ausgeförderten Stücken beobachtet, und die, wie ich vermuthe, von der unteren Grenze herstammen. Der körnige Kalk ist hier dicht mit dem Hornblendeschiefer zusammengeschmolzen, welcher letztere in seiner Nähe gänzlich verändert, viel fester, blasser von Farbe und undeutlich schieferig geworden ist; er verhält sich zum unveränderten etwa so, wie am Harz gewisse Hornfelse zum Grauwackenschiefer. Einige scharfkantige Bruchstücke sind rings vom körnigen Kalksteine umschlossen, der hier an der Grenze zuweilen viel feinkörniger, (fast dicht und Chalzedon- artig) oft mit einem bräunlichen Rande umgeben ist. Besondere Mineralien als Produkte der gegenseitigen Einwirkung linden sich ein: Eisenkies in ziemlicher Menge, kleine schwarze Magneteisenkörner und feine prismatische Krystalle eines bis jetzt nicht näher bestimmten Minerals. …“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vergleich mit dem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit seiner Einschätzung, daß der Miltitzer Weißkalk magmatischen Ursprungs sei, prägte B. Cotta noch lange Zeit den Streit zwischen „Neptunisten“ und „Plutonisten“ mit. Gustav Leonhard führt 1851 in seinen Grundzügen der Mineralogie, Geognosie, Geologie und Bergbaukunde den Miltitzer Kalk als Beispiel an und beruft sich dabei auf Cotta: „Körniger Kalk gilt Manchen als ein metamorphisches Gestein, als ein umgewandelter neptunischer Kalkstein. Lehrreiche Beispiele bestätigen aber, daß wenigstens ein Theil des körnigen Kalkes nicht allein plutonischer Herkunft, sondern auch wahrhaft eruptiver Natur ist. Bei Miltitz unfern Meißen durchsetzt derselbe Hornblendeschiefer, schließt Bruchstücke desselben ein und hat denselben an Berührungsstellen in Hornfels- artiges Gestein umgewandelt. Sehr beachtenswert ist überdieß der Umstand, worauf Cotta besonders aufmerksam machte, daß der Miltitzer Kalk noch Brocken von Granit und von Quarz- führendem Porphyr umschließt, Gesteine, welche gar nicht in der Umgebung von Miltitz zu Tage gehen, demnach in der Tiefe vorhanden sein müssen.“ Doch weiter bei Cotta 1834: „Vergleicht man nun aber die Erscheinungen, unter welchen dieser Kalkstein bei Miltitz auftritt, mit denen, welche man an den anderen körnigen Kalksteinen, weiter oben im Triebischthale, (und in dessen Nähe) bei Schmiedewalde, Burkhardsdorf (er meint sicher Burkhardswalde), Blankenstein, Steinbach und Helbigsdorf beobachtet, und vergleicht man ferner diese Gesteine selbst mit jenem, so ergeben sich eine Menge wesentlicher Unterschiede. Was zunächst das Gestein selbst betrifft, so sind alle jene anderen Kalksteine in hiesiger Gegend mehr grau von Farbe und weniger krystallinisch; nie durchaus weiss, sondern höchstens von weissen krystallinischeren Lagen in der Richtung der Lagerung durchzogen, in der Art, dass oft eine auffallende Streifung dadurch entsteht: ein Wechsel von grauen und weissen Streifen, die auf merkwürdige Weise gebogen, durcheinander gewunden und aneinander abstossend, aber immer der Lagerung mehr oder weniger parallel erscheinen. Diese Kalksteine entsprechen alle in vieler Beziehung dem Tharander, …; nur so viele Drusen und Braunspathadern enthalten sie nicht, wahrscheinlich weil sie von keinen Porphyr- Gängen durchbrochen sind, wie der hiesige. Die fremdartigen Mineralien in den Drusenräumen des hiesigen Kalksteins – Braunspath, Schwerspath, Gyps, Bleiglanz, Eisenkies, Blende u. s. w. – schreibe ich der Einwirkung des später emporgedrungenen Porphyrs zu.“ Von Interesse ist, daß B. Cotta den grauen Kalk an dieser Stelle als nicht für Miltitz eigentümlich beschreibt, woraus man folgern könnte, daß im Jahr 1834 der „Blaue Bruch“ noch nicht existierte. Dagegen vermerkt C. C. Leonhard aber bereits 1808 in seinem Handbuch einer allgemeinen topographischen Mineralogie: „…der Kalk bildet hier ein mehrere Lachter mächtiges Lager, selten erscheinen in ihm Drusen von Kalkspathkrystallen. Über dem Kalk liegt Hornblendeschiefer, in der Mitte desselben trifft man wieder auf ein Lager, das meist aus einem Gemenge von fleischrothem Feldspath, Quarz und Glimmer besteht. Über dem Hornblendeschiefer findet man wieder Kalkstein, der aber von dem der tiefen Lage sehr verschieden und in welchem nicht selten Hornblende fein eingesprengt ist.“ Das Graukalklager oberhalb muß ihm also bereits bekannt gewesen sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über den Kalkstein von Miltitz schreibt W. Vogelgesang 1851: „Der
Kalkstein selbst ist theils schneeweiß oder rötlich weiß und dann mittel-
bis kleinkörnig und ausgezeichnet krystallinisch und Drusenräume
einschließend, die mit großen Kristallen von Kalkspath erfüllt sind,
theils erscheint er gräulich weiß bis licht aschgrau, feinkörnig bis dicht
und mit muschligem und kleinblättrigem Bruch... Hie und da zeigt der
Kalkstein große (Hohlräume), die man nicht so sehr für Drusenräume als für
Auswaschungen durch Wasser halten muß, welches auf den Ablösungen und
Klüften der Lager in ziemlich reichlichen Mengen cirkuliert.“
Zirkulierendes Wasser, das natürlich
irgendwo als Quelle wieder zutage tritt, ist auch für die Entstehung des
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die beiden Varietäten des Kalksteins treten nordwestlich der Triebisch zwischen Miltitz und Roitzschen in voneinander gänzlich getrennten Lagern auf und wurden hier auch als „Weißkalk“ bzw. „Graukalk“ bezeichnet. Der graublaue Kalkstein bildet das hangende Lager. Seine Färbung entsteht durch Gehalte an Kohlenstoff, sowie durch Einschlüsse von Epidot, sowie Kalzium- reichen und bräunlichen Granaten (Grossular, Andradit). W. Gotte nennt im Gutachten von 1952 außerdem das Mineral „Malakolith“ – eine inzwischen ungebräuchliche Bezeichnung für das Mineral Diopsid (Augit) aus der Pyroxengruppe.
Der Weißkalk hingegen enthält keinerlei Kohlenstoff, was auf die
thermische Beanspruchung durch den unweit darunter liegenden Syenodiorit
hinweist. Mit der
Die Gesteine des Nossen- Wilsdruffer Schiefergebirges und mit ihnen auch die Miltitzer Kalksteine wurden nach ihrer Ablagerung im Oberdevon nämlich gleich zweifach metamorph überprägt: Zunächst kam es während der varistischen Faltung im Karbon zu einer relativ geringgradigen, grünschieferfaziellen Regionalmetamorphose. Als in der Spätphase der varistischen Faltung im Oberkarbon dann die Magmatite das Meißener Massivs aufstiegen, kam es in deren Umfeld auch zur thermischen Beanspruchung (Kontaktmetamorphose) der überlagernden Gesteine (Lapp et al., 2021). Besonders der Weißkalk wird häufig als „Miltitzer Marmor“ bezeichnet. Auch in anderen Abbaugebieten werden kontaktmetamorphe und oft farbig texturierte Kalksteine sehr oft vereinfachend unter der Handelsbezeichnung „Marmor“ verkauft. Im petrographischen Sinn sind Marmore Metamorphite, die mindestens 50 Volumenprozent Calcit, Dolomit oder seltener Aragonit enthalten. Fast immer gehören sie zu den Paragesteinen, das heißt, sie sind aus Sedimentiten hervorgegangen. Viele bestehen fast nur aus einem der Karbonate (d. h. sie sind monomineralisch). Die durch Rekristallisation neu gebildeten Kristallkörner des Calcits sind bei einem „richtigen“ Marmor zumeist mit bloßem Auge erkennbar. Damit während der Metamorphose aus dem Kalkstein ein Marmor entsteht, muß der Prozeß isochem (ohne Stoffzufuhr) ablaufen. Ist dies nicht der Fall oder waren die Sedimente schon primär uneinheitlich zusammengesetzt, bilden sich durch chemische Reaktionen der Karbonate mit Aluminiumsilikaten sogenannte Kalksilikatfelse. Findet zusätzlich eine Stoffzufuhr statt (Metasomatose), können sogenannte Skarne entstehen, die abbauwürdige Gehalte von Zinkblende, Zinnstein und anderen Erzen aufweisen können. Rötliche Verfärbungen kommen in Miltitz durch Gehalte von Hämatit (Eisenoxid) und bräunliche Verfärbungen durch Verwitterung der Eisenoxide zu Limonit (Eisenhydroxid) zustande. An den Grenzen zum Schiefer soll außerdem eisenreicher, schwarzer Turmalin (Schörl), Pyrit und Pyrrhotin (Magnetkies) vorgekommen sein (vgl. B. Cotta, 1834). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Autoren
des „Kalkwerksbetriebs in Sachsen“, Wunder, Herbrig und Eulitz, führten
1867 die folgenden Kalkwerke im Gebiete des „Urthonschiefers“
entlang der Triebischtäler auf:
k. A. = keine Angabe. Wie man leicht sieht, sind in der Region Magnesium- (Dolomit-) arme oder nahezu gänzlich Magnesium- freie Kalksteine bzw. Calzit- Marmore vorherrschend. Niedrige Kalkgehalte stehen gewöhnlich mit hohen Anteilen von Silikaten („Unlösliches“) in Zusammenhang. Die Tabelle nennt uns auch einige
Namen, die uns im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Größere Störungen oder Verwerfungen der Kalklager sind eher selten und wurden daher in den Akten festgehalten. So wurde im Neuen Lager bei Miltitz eine näherungsweise parallel zum Tagesfallort (mit 120° Streichen) und 65° bis 70° nach Nordost einfallende Störung (der „Verwerfer“) mit einer Sprunghöhe von 7 m bis 9 m angetroffen. Auch in der Lohse Fundgrube bei Schmiedewalde wurde eine Verwerfung mit ähnlicher Sprunghöhe im Schacht durchteuft. Wie schon von Cotta bemerkt, sind in die Kalklager mehrfach Lagen von Schiefer eingefaltet (vgl. u. a. 40037, I17625). In den Randbereichen werden solche Einlagerungen oft dünnblättrig und treten in zahlreichen Schichten auf, so daß die Qualität des Kalksteins bis zur Bauunwürdigkeit absinkt. Umgekehrt kommt es, besonders stark in den Munziger Vorkommen östlich der Triebisch zu „Inhibitionen“ im umgebenden Schiefer, die so stark sein können, daß man dort das Nebengestein mit hereingewinnen könne (40003, Nr. 250).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich die
Auffassung einer metamorphen Entstehung des Marmors aus Kalkstein durchgesetzt
und im Jahr 1889 ordnet A. Sauer in den „Erläuterungen zur geologischen Specialkarte
des Königreichs Sachsen, Section Meißen“ die
Kalklager der Kontaktzone des Meißner Plutons zu:
„III. Der Contacthof des Syenites der Section Meißen Geologisch und pertographisch zerfallen diese Gesteine in zwei Hauptgruppen: a) in die Lager von krystallinem Kalkstein..., und b) in die das Nebengestein bildenden Schiefergesteine. ... Der krystalline Kalkstein bildet bei Miltitz zwei, in nur 100 m horizontaler Entfernung von einander am Gehänge ausstreichende Lager, von denen das südliche, das Hauptlager, noch gegenwärtig in Betrieb ist, während das nördliche, höher am Gehänge liegende, auch nach der Qualität des Kalksteins weniger werthvolle, nur zeitweise abgebaut wurde. Das untere Hauptlager, von Tage herein durch einen mächtigen Pfeiler- und Weitungsbau zugänglich, besteht in der Hauptsache aus weissem, schwach gelblichem, grünlichem oder graulichem ziemlich grobkörigem oder feinkörnig- krystallinem Kalkstein. Der bestehenden, ... Analyse zufolge besitzt derselbe eine sehr reine Beschaffenheit... Dieser Kalkstein führt zuweilen kleinere... bis über erbsengrosse, allseitig, jedoch mit schwacher Abrundung der Ecken und Kanten, ausgebildete Krystalle von Pyrit, lokal auch Ausscheidungen von sehr grobspätigem Calzit, enthält ferner hier und dort Hohlräume mit Stalactiten, ist ganz unregelmäßig durchklüftet und auf den Kluftflächen mit dünnen Häuten von Eisenoxidhydrat überzogen. Die Mächtigkeit des Lagers schwankt zwischen 1 und 12 m, was daher rührt, daß die hangenden und liegenden Grenzflächen nicht eben, sondern flachwellig gestaltet sind, sich zuweilen gleichzeitig einander nähern und dann die Mächtigkeit des Lagers bis auf ein Geringes zusammendrücken. Auf der Sohle des Lagers von Tage aus einfahrend, kann man sehr gut die unebene Gestaltung desselben... beobachten. Die das Kalklager begleitenden Schiefer, ... stellen einen aus dünnplattigen ebenschiefrigen Gesteinen bestehenden Complex dar, in welchem grau- bis schwärzlichgrüne Hornblendeschiefer entschieden vorwalten. Mit diesen verbinden sich Lagen von weissem krystalliinischem Kalkstein, die in unendlicher Wiederholung mit dem schwarzgrünen Hornblendeschiefer eine ausgezeichnet gebänderte Structur erzeugen, bald dünne Schmitzen bilden oder zu größeren und kleineren linsenförmigen Massen sich aufblähen... Das nördliche, hangende und deshalb höher am Gehänge aufgeschlossene Kalklager verdankt seine technisch minderwerthige Beschaffenheit sowohl der nicht geringen und sehr beständigen Beimischung verschiedener Silikatbestandtheile, als auch der weniger einheitlichen Entwickelung des Kalkflözes, indem dasselbe mehr einen dick- bis dünnbankigen Kalkschiefer darstellt, der mit Hornblendeschiefer und biotitreichen Lagen vielfach wechselt und mit diesen in verworrenster Weise zusammengestaucht und gefaltet erscheint.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die beiden Miltitz'er Kalklager am NW- Hang der Triebisch besitzen jeweils eine streichende Länge von 200 m bis 250 m und fallen in nordöstlicher Richtung mit 16° bis 30° Neigung ein. Die Baue erreichten 15,4 m saigere Höhe, was entsprechend der Neigung eine Mächtigkeit der Lager von bis zu 13 m bedeutet. Zum seitlichen Rand hin wird die Mächtigkeit schnell geringer, der Abbau wurde bei unter 3 m Mächtigkeit gewöhnlich aufgegeben. Ganz ähnlich ist das Kalklager bei Groitzsch aufgebaut, allerdings fällt das Kalklager deutlich steiler in westliche Richtung. Auch hier ging der Abbau vom Ausstrich des Lagers an der Oberfläche aus und erfolgte zunächst im Tagebau. Mit zunehmender Abraummächtigkeit (1884 bis zu 9 m; 1902 bereits bis zu 16 m) war man gezwungen, zum Tiefbau überzugehen. Ab 1900 wurden die ersten Weitungen aus dem Weststoß des Tagebaus heraus aufgefahren und ein Strossenaushieb angelegt (1. Sohle des späteren Tiefbaufeldes). Das noch bis 1955 in Abbau stehende Tiefbaufeld besitzt etwa 150 m Ausdehnung in Nord- Süd- und etwa 100 m Ausdehnung in Ost- West- Richtung. Aufgrund des steileren Einfallens liegen die vier Tiefbausohlen unterhalb der westlichen Tagebausohle teilweise übereinander. Auch hier erreichten die Baue (auf der 3. Sohle) bis zu 11,5 m saigere Höhe, jedoch sind die Abbaue der einzelnen Sohlen untereinander – abgesehen von den Fallorten sowie mehreren Blindschächten zur Wetterführung – nicht durchschlägig. Man ließ Schweben von 3,5 m bis 4 m Mächtigkeit zwischen den Sohlen stehen. Anfang der 1950er Jahre wurde mit dem Fallort West II noch die 5. Sohle ausgerichtet. Abbau erfolgte bis zur Einstellung 1955 jedoch nur noch auf der 4. Sohle, die weitere Aus- und Vorrichtung wurde dann abgebrochen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Kalkvorkommen Unweit südlich von Miltitz am südöstlichen Gegenhang des Triebischtals finden sich bei Munzig (in einem Stollen „200 Schritt oberhalb der Schäferei“) auch steil aufgerichtete Kalklager mit einem Einfallen von bis zu 70°. Bei dieser Grube dürfte es sich um die Frisch Glück Fundgrube handeln, die außer Kalkstein auch Brauneisen hereingewann. Ein im Wildemann Erbstolln bei Niedermunzig angefahrenes Kalklager ist zu einem steil aufgerichteten Körper zusammengestaucht.Diese beiden Vorkommen wurden 1851 von Bergmeister W. Vogelgesang detailliert beschrieben, freilich nur anhand der damals zugänglichen Tiefbauaufschlüsse. Demnach trümert in beiden Vorkommen eine einheitliche und bis zu drei Lachter mächtige Bank in ein hangendes und ein liegendes Lager auf, welches jedes für sich schnell an Mächtigkeit verliert. Die Kalklager folgen weiter südlich in Munzig außerdem recht genau der Grenze zwischen hangendem Fruchtschiefer und liegendem Hornblendeschiefer, wirkten möglicherweise also auch als „thermische Barriere“ gegenüber der Kontaktmetamorphose.Die größten Mächtigkeiten der Kalklager werden in Schmiedewalde erreicht, wo ein mit 20° bis 30° nach NO fallendes Kalklager von bis zu 25 m Mächtigkeit im Tagebau gewonnen wurde. In Burkhardtswalde erreichte das Kalklager im Schmutzler`schen Kalkbruch etwa 6 m Mächtigkeit und ist mit 25° bis 40° nach NO geneigt. In den Akten des Landesbergamtes (40024-12, Nr. 017) werden die im Jahr 1884 in der Region aktiven Kalkwerke im Bezirk der Amtshauptmannschaft Meißen aufgeführt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die südlicher liegenden Kalkvorkommen ordnet K. Pietzsch in der 1916
erschienenen 2. Auflage der „Erläuterungen zur geologischen
Specialkarte des Königreichs Sachsen, zur Section Tanneberg- Deutschenbora“
folgendermaßen verschiedenen geologischen Einheiten zu:
„III. Die phyllitische
Schichtengruppe ... Einlagerungen von Kalkstein sind (in dieser Formation) an zwei Stellen bekannt... Das eine Lager ist mit dem Rothschönberger Stollen bei etwa 320 m nordöstlicher Entfernung vom 1. Lichtloche überfahren worden... Das andere Lager liegt in der Nähe der Kirche von Blankenstein und wurde unterirdisch abgebaut... IV. Das
Altpaläozoikum ... Der als silurisch aufzufassende Kalkstein hat eine feinkristalline bis dichte Beschaffenheit und besitzt graue bis dunkelgraue Farbe. Häufig ist er auch infolge einer mehr oder minder dünnschichtigen Wechsellagerung von helleren und dunkleren Lagen grau und weiß gestreift. Die weiße Farbe und die z. T. grobkristalline marmorartige Beschaffenheit, durch die sich das Burkhardswalder Vorkommen auszeichnet, ist auf kontaktmetmorphe Beeinflussung von Seiten des Meißener Syenits zurückzuführen. Sehr wechselnd ist die Beteiligung von grauen oder schwarzgrauen Tonschieferhäutchen und -flasern. Bald fehlen jene völlig, so daß ein sehr reiner Kalkstein vorliegt, bald stellen sie sich in so beträchtlicher Menge ein, daß sich das Gestein nicht mehr zum Brennen eignet; insbesondere in dem großen Bruche bei Groitzsch lassen sich alle möglichen Übergänge von reinem Kalkstein bis zu einem Kalkschiefer (Kalktonschiefer) verfolgen. Die ... ausgeführten chemischen Analysen von Proben der verschiedenen silurischen Kalksteine des Blattes Tanneberg haben übereinstimmend ergeben, daß diese durchweg nur geringe Mengen Magnesia enthalten... Bei der Verwitterung neigen die silurischen Kalksteine trotz des anscheinend geringen Eisengehaltes zur Verockerung. Namentlich an der oberen Grenze der Kalksteinlager gegen die darüber liegenden Tonschiefer, Alaunschiefer und Diabastuffe stellen sich vielfach Ockerbildungen ein...; höchstwahrscheinlich hängt diese Ockerbildung mit der Zuführung von eisenhaltigen Sickerwässern aus den über den Kalken lagernden Diabastuffen zusammen. Die so entstandenen Brauneisenerzvorkommen wurden früher vielfach bergmännisch abgebaut. Die Mächtigkeit des Kalksteins beträgt in der Regel nur wenige Meter, nur bei dem Groitzscher und Schmiedewalder Lager ist sie bedeutender. ... “
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Unterlagen der Lagerstättenforschungsstelle (40030-1, Nr. 1076) findet sich ein Vergleich verschiedener Kalkvorkommen in Sachsen und der oben von verschiedenen Geologen beschriebenen Varietäten aus dem Jahr 1934. Demnach ist besonders der Miltitzer Weißkalk von ausgesprochen großer Reinheit. Der Gehalt an MgO beträgt ganze 0,06 %. Der Graukalk besitzt diese Güte nicht; zwar enthält auch er kaum MgCO3, dafür aber bis zu 30% SiO2 und Al2O3 (silikatische Akzessorien). Wir haben diese Tabelle mit Angaben aus Pietzsch (1916) und Kersten (1832) für die Kalk- und Dolomitwerke weiter südöstlich ergänzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als geologische Besonderheit in der Region muß schließlich noch das pleistozäne Kalktuffvorkommen bei Robschütz erwähnt werden. Dazu zitiert der Heimatforscher W. Schanze (*1938, †2014) aus dem „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikon von Sachsen“, Band 9, Ausgabe 1822: „Ein Kalkbruch, der im J. 1809 von dem Rittergutsbesitzer angelegt wurde, hat seit jener Zeit eine bedeutende Größe erhalten und gibt während des Sommers mehrern Menschen Nahrung. Er wird durch Keilhauen, Schrammhämmer, Keile und Brechstangen bearbeitet, weil das Bohren und Schießen wegen der vielfachen Klüfte und natürlichen Höhlungen des Kalktuffs ganz unmöglich ist. Aller Tuff wird in Verbindung mit pottschappler Steinkohlen in einem dabei angelegten, sehr großen Kalkbrennofen gebrannt, und giebt dann einen vorzüglich schönen weißen Kalk, den man häufig auch als Dünger benutzt. Der Besitzer, Herr Hause, läßt es sich dabei angelegen seyn, durch Entdeckung und Erhaltung der vorzüglichsten Merkwürdigkeiten seines Bruchs der Mineralogie zu nützen und hat in seinem Gute eine eigne Ausstellung der schönsten Versteinerungen errichtet...“ Um 1853 soll der Betrieb zumindest saisonal noch umgegangen sein, irgendwann danach wurde er wegen Erschöpfung des Vorkommens eingestellt. Als A. Frenzel im Sommer 1867 das Triebischtal herab wanderte, fand er hierzu an die Geognostische Landesuntersuchungskommission zu berichten: „Robschütz ist wegen einer Kalktuffablagerung besonders interessant. Dieselbe liegt am linken Gehänge, wo sie vom Rücken (schwer zu lesen ?) des Gehänges bis unter die Thalsohle sich verzieht. Dieses Frühjahr ist im Thale eine Grube im Kalktuff niedergebracht worden, beiläufig bis 8 Fuß Tiefe, ohne auf festes Gestein gekommen zu sein. Dieser Kalktuff enthält sehr schöne Pflanzenabdrücke... Der Betrieb ist übrigens des Bahnbaus wegen wieder sistiert worden... Unter dem Kalktuff liegt ein fetter Thon, wie in einer alten Grube zu beobachten ist. Jenseits des Dorfes, auf der rechten Seite des zum Rittergute ansteigenden Weges, fand sich unmittelbar unter dem Rasen auch ein Kalktuff...“ (40003, Nr. 285) Demnach dehnte sich das Vorkommen doch noch weiter aus; der Abbau der 1867 noch aufgefundenen Ablagerungen kam jedoch nicht zustande, weil das Lager offenbar unter der späteren Bahntrasse lag.
Herrn Frenzel zitieren wir im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Vorkommen soll bereits 1565 bekannt gewesen sein und wird bereits von Petrus Albinus in seiner Meißnischen Bergchronik erwähnt: „Der Tropffstein / wie ihn die Gelehrten verdeutschen / ist gemeiniglich an Farbe und Härte dem pario marmori*) nicht unehnlich / … In Meyssen bricht ein Tropffstein an der Tribisch dem Wasser zwo Meilen von der Stadt Meyssen im Dorf Rabschütz / auf der linken Handt / wenn man nach Freyberg gehen will / gelegen / in demselben findet man Zapfen / Sewlen / Rören / welche gestalten die Natur also wunderlich formiret. …“ *) Aus dem Lateinischen, sinngemäß „dem gebürtigen“ oder „dem eigentlichen Marmor“. Der Kalktuff war vorallem wegen der zahlreichen Fossilien, wie Schnecken und Blattabdrücke berühmt. Nach B. Cotta soll es 30 Fuß Mächtigkeit (also zirka 10 m) besessen und unmittelbar auf dem Syenit aufgelegen haben. In einer Fußnote vermerkt er: „Mein Vater besitzt eine sehr vollständige Suite der dort vorkommenden Versteinerungen, worunter sich ein Menschen- Schädel besonders auszeichnet. Blätter, Moose, Haselnüsse, Hirschgeweihe, Knochen, vollständige Schlangengerippe, Landschnecken u. s. w. sind alle in grosser Deutlichkeit vorhanden.“ 1836 schreibt er in seinen Geognostischen Wanderungen: „Die Ablagerung dieses höchst porösen Gesteins nimmt nur einen geringen Raum mitten im Triebischthale ein, seine Bildung scheint gänzlich beendigt, die erzeugende Quelle versiegt oder entkalkt zu sein; es wird in einem Steinbruche gewonnen und im Ofen daneben gebrannt; im unteren Theile, zunächst dem Syenit, enthält es oft Bruchstücke desselben.“ Im „Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreiches Sachsen“ und zwar der Zweiten Lieferung, den Dresdner Kreisdirectionsbezirk enthaltend, von Albert Schiffner, gedruckt 1840 in Leipzig, erfährt man unter der Nummer 216 (S. 421f) über das dazumal unter Verwaltung des Amtes Meißen stehende Dorf: „Robschütz… gab vor 500 Jahren einem burggräflichen Vasallengeschlechte seinen Namen, … gehörte lange denen von Miltitz, bis es 1738 durch die Erbschaft an die Grafen von Beuchlingen kam… Im Herrenhause findet man eine starke Sammlung von Petrofacten und Abdrücken (u. a. von Kräutern, Schilf- Strauch- und Baumtheilen, Nüssen, Konchylien, Knochen usw.) die man nebst Kohlen, Menschenschädeln usf. im sogenannten Robschützer Steine, einem starken Kalktufflager, gefunden hat; diesem gehören auch die sogenannten Schneckensteine zu. Ferner giebt es hier Pechstein, bunten Thon, blaue Kiesel, sogenannte Hundsköpfe, Erdglas usw. Unterhalb des Ortes lagert auch Gelberde, die man beim Kalkofen schlämmt und aufbereitet. Letzteren legte 1809 der Gutsherr Haufe an.“ Aus der 1845 erschienenen „Beschreibung der sächsischen und ernestinischen Lande“ von A. Schiffner erfährt man ebenfalls, wenn auch nur kurz erwähnt, über den Ort: „Robschütz (240 E.) nebst dem Vorwerk Roitzschwiese, liegt anmuthig zwischen der Freiberger Straße und der Triebische, besaß eine Burg und nach der Volkssage auch ein Kloster, hat ein großes gethürmtes Gut mit wichtigem Obstbau, 1 Kalkofen und 2 Mühlen, und war burggräfliches Lehn. Man gräbt Ocker, sammelt auch im Tuff des Kalkbruches allerlei seltene Petrofacte.“ Der Bruch ist heute verfüllt und nur noch sehr selten entdeckt man in Trockenmauern in Robschütz Stücke des Kalktuffs. Deshalb zeigen wir hier mal ein paar Beispiele aus Mühlhausen in Thüringen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier auf diesem Stück haben sich Abdrücke Lorbeer- ähnlicher Blätter erhalten, Länge der Blätter zirka 6 cm. (Sammlung Boeck)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die kalkigen Gehäuse von Weichtieren werden eingebettet und sind dann besonders gut erhalten. Hier ein Exemplar der Gemeinen Schnauzenschnecke Bithynia tentaculata (C. v. Linné, 1758), Durchmesser des Gehäuses zirka 0,5 cm. (Sammlung Boeck)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu den bergrechtlichen Besonderheiten des Kalkstein- Bergbaus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Bergbaurecht unterschied seit alters her zwischen sogenannten grundeigenen Rohstoffen und solchen, die dem landesherrlichen Bergregal unterlagen. Das Bergregal umfaßte den Rechtsanspruch des Landesfürsten auf die Gewinnung der Edelmetalle. In der Ronkalischen Konstitution von 1158 ließ Kaiser Friedrich I., Barbarossa das bisherige Gewohnheitsrecht der Regalien und damit auch das Bergregal erstmals schriftlich fixieren. Dadurch war das Recht zur Gewinnung von Bodenschätzen dem Grundbesitzer entzogen und das Abbaurecht mußte spätestens von diesem Zeitpunkt an beim König erworben werden. Unter die Regalrechte fielen auch die Salzgewinnung, was in der Mark Meißen aber mangels Lagerstätten entfiel, sowie der Salzhandel. Der Kleinstaaterei und der Sonderstellung der geistlichen Fürstentümer im Heiligen Römischen Reich geschuldet, war das königliche Bergregal aber in der Praxis kaum durchsetzbar. Vielfach wurde es deshalb an den Territorialherrn verliehen. So verlieh Friedrich, I. dieses Privileg u. a. auch an den derzeitigen Markgrafen von Meißen, Otto, später der Reiche genannt. Die Wettiner beanspruchten darum das Abbaurecht für alle Vorkommen von Gold, Silber und Edelsteinen, später auch für andere Buntmetallerze sowie für das Kobalt in der Mark Meißen und ihren späteren Besitzungen für sich. Demgegenüber verblieben aber „profane“ Rohstoffe, wie Werkstein, Lehm, Ton, Kalk, Kohle und auch Eisenerze im Eigentum des Grundbesitzers. Da diese Rohstoffe außerdem oft im Tagebau gewonnen werden konnten, war zudem bei ihrer Gewinnung auch weniger behördliche Aufsicht und technische Kontrolle erforderlich. Aus diesen Gründen unterlag der Erzbergbau einer strengen technischen und wirtschaftlichen Kontrolle durch die kursächsischen Bergämter. Eine Aufsicht über die (gewerblichen) Gewinnungsbetriebe der Steine- und Erdenindustrie dagegen bestand gar nicht, bzw. oblag später zunächst nur den örtlichen Behörden (Gewerbeaufsicht). Daher finden sich die frühesten Erwähnungen des Kalkbergbaus nicht in Akten des Bergarchives, sondern oft des Finanzarchives in Dresden (z. B. für Miltitz aus dem Jahr 1571 und aus dem Zeitraum 1577 bis 1626, vgl. 40073-1, Nr. 018, historische Übersicht). Diese Zweiteilung und die staatliche Kontrolle über wesentliche Teile des (Erz-) Bergbaus in Sachsen wurden erst 1869 mit der Inkraftsetzung des Allgemeinen Berggesetzes für das Königreich Sachsen aufgehoben. Eine wesentliche Grundlage für diesen Schritt bildete die sukzessive Einführung der Gewerbefreiheit in den Deutschen Staaten, ausgehend von Preußen. Dort wurden unter Federführung von Karl Freiherr von Stein und Karl August Fürst von Hardenberg ab 1810 die sogenannten Preußischen Reformen umgesetzt. Sie waren eine Reaktion auf die Niederlage Preußens gegen Napoleon in der Schlacht bei Jena und Auerstedt im Jahr 1806. Große Gebietsverluste, erdrückende Tributzahlungen an Frankreich und das Bestreben, sich im Kreis der Großmächte zu behaupten, nötigten die preußische Staatsführung ab 1807 zu Modernisierungen, die auf den Ideen der Aufklärung beruhten.
Es dauerte jedoch noch lange, bis am 13. Juli
1868 das Gesetz, betreffend den Betrieb der stehenden Gewerbe
bekanntgemacht wurde. Mit Inkrafttreten der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869
wurde die Gewerbefreiheit auf die Länder des Norddeutschen Bundes ausgeweitet
und mit dem Übergang zum Deutschen Kaiserreich 1871 wurde es auf das neue
Reichsgebiet ausgedehnt. Es folgte der Wirtschaftsboom der
Bereits das Gesetz über den Regalbergbau im Königreich Sachsen vom 22. Mai 1851 löste die bis dahin noch gültige Bergordnung Kurfürst Christians vom 12. Juni 1589 ab, hielt aber noch am Direktionsprinzip fest. Erst das Allgemeine Berggesetz für das Königreich Sachsen, beschlossen am 16. Juni 1868, änderte dies grundlegend. In Zusammenhang mit dem Berggesetz wurden auch die vormaligen Bergämter aufgelöst. Seitdem unterlagen alle Bergbaubetriebe gleichermaßen der bergtechnischen Überwachung durch das neugeschaffene Landesbergamt Freiberg, während alle wirtschaftlichen Belange den Betreibern der Bergwerke überlassen wurden. Damit wurde nun auch dem grundeigenen Bergbau zunehmend behördliche Aufmerksamkeit zuteil. Mit einer Verordnung von 1877 wurden die Amthauptmannschaften beauftragt, „sich von Zeit zu Zeit Kenntnis über Betrieb und Besitzer der Thongruben, Kalkwerke und anderen Gräbereien…“ zu verschaffen (40024-12, Nr. 011). Im Vorwort zur Bestandsgeschichte der Deponierten Risse der Steine- und Erdenindustrie im Bergarchiv Freiberg (Bestand 40037) lesen wir dazu: „Während für den Regalbergbau bereits seit 1667 durch ein von Kurfürst Johann Georg II. erlassenes Dekret für jede Grube die Anfertigung eines Markscheiderrisses für das Bergamt vorgeschrieben war, sowie die bisherigen Bergwerksbesitzer später auch bei der Stilllegung eines Berggebäudes gehalten waren, ihre Zechenrisse nachzubringen und beim Bergamt bis zur Wiederaufnahme der Grube zu deponieren, so galt Abbaugegenständen wie Kohle, Steinen und Erden wenig bergbehördliches Interesse. Eine Ausnahme bildeten hierbei nur fiskalische Gruben. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der zunehmende unterirdische Kohlebergbau einer verstärkten bergamtlichen Aufsicht unterstellt und auch die Rißhaltung und Deponierung in Anlehnung an den Regalbergbau zur Vorschrift gemacht. Steinbrüche, Spat-, Kalk- und Tongruben wurden dagegen als gewerbliche Gruben der Gewerbeaufsicht der Amtshauptmannschaften unterstellt. Erst im Jahre 1900 erfolgte die Übertragung der Aufsicht über unterirdische gewerbliche Gruben an die Berginspektionen. Nachfolgend wurde die Deponierungspflicht für das Rißwerk auch auf diese Gruben ausgedehnt. Da offensichtlich keine Verpflichtung zur Beauftragung eines Markscheiders bestand, erfolgte vor allem bei den kleineren Tongruben die Rißzeichnung durch den Steiger, der während seiner Bergschulausbildung rißzeichnerische Grundkenntnisse erlangt hatte, aber kaum geeignetes Zeichenwerkzeug besaß. So entstanden grobe, oft unsaubere Darstellungen mit z. T. fehlenden Maßstäben und nur vagen Beschreibungen, die mitunter auch stark fehlerhaft waren, wie aus später aufgebrachten Bemerkungen von Markscheidern hervorgeht. Die Überlieferung zeigt, daß die Fertigung solcher „Steigerrisse“ bei den Tongruben bis in die 1930er Jahre praktiziert wurde. Im Oktober 1943 gingen auch die übertägigen Betriebe der Steine- und Erdenindustrie aus der Gewerbeaufsicht in die Bergaufsicht über, so daß (erst) seit dieser Zeit auch Tagebaurisse vorliegen. …“ In den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen liest man aus diesem Grund erst in der Ausgabe vom Jahr 1901 den folgenden, ausführlichen Bericht über die gewerblichen Gruben:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V. Allgemeine Mittheilungen über die unterirdischen gewerblichen 1. Zahl und Art der Gruben. Zu den ganz oder theilweise unterirdisch, betriebenen Brüchen und Gruben, welche nicht unter die Berggesetzgebung, sondern unter die Vorschrift in § 154 a der Gewerbeordnung fallen – den sogenannten gewerblichen Gruben – gehören
Der Betrieb war bei den meisten Werken in der reichlichen ersten Hälfte des Berichtsjahres im Allgemeinen noch als ein ziemlich reger zu bezeichnen; im Herbste jedoch trat ein entschiedener Rückgang ein, der bis zum Jahresschluß anhielt.
2. Die auf die gewerblichen Gruben bezügliche Gesetzgebung. Durch Verordnung, die Aufsicht über die unterirdisch betriebenen Brüche und Gruben betreffend, vom 12. Mai 1900 wurde vom 1. Juni 1900 ab die von den Ortspolizeibehörden bez. Gewerbeinspektionen bisher ausgeübte betriebspolizeiliche Aufsicht über obenbezeichnete Anlagen dem Bergamte übertragen; zur Wahrnehmung derselben ist eine achte Berginspektion, Freiberg III, errichtet worden. Die Gewerbe-Beaufsichtigung im Sinne von § 139b der Gewerbeordnung und § l der Verordnung, die Gewerbe-Beaufsichtigung betreffend, vom 6. April 1892 wurde dieser Berginspektion übertragen. Dagegen verblieben der bisherigen Aufsicht durch die Ortspolizeibehörde die Aufsicht über die Dampfkessel, die Kalköfen, sowie ferner über die Kranken- und Invalidenversicherung.
3. Bergpolizeilich wichtige Vorgänge. Bei den stattgefundenen Revisionen ergab sich, daß bei den Grubenbetrieben noch mancherlei zu vermissen war, was in sicherheitspolizeilicher Beziehung verlangt werden muß. Bei verschiedenen Kalkwerken und namentlich bei den Thon- und Porzellanerdegruben fehlte ein zweiter Tageausgang, welcher es der angefahrenen Mannschaft ermöglicht, beim Unfahrbarwerden des einen Ausganges durch den anderen die Tagesoberfläche zu erreichen; auch war nicht überall der Gewinnungsbetrieb so geführt, daß von jedem Arbeitspunkte aus beide Tageausgänge zugängig waren. … Bei den Kalksteinbrüchen der älteren Gebirgsformationen, in denen der Kalkstein in Weitungsbauen gewonnen wird, war mehrfach zu erinnern, daß die zu belassenden Kalksteinpfeiler und die zwischen den einzelnen Abbausohlen zu belassenden Festen (Schweben) über Gebühr geschwächt waren. Bei einem Werke führten die in dieser Hinsicht früher begangenen Fehler insofern zu einer Katastrophe, als an zwei Stellen die Baue von Tage herein bis zu der 65 m unter Tage gelegenen tiefsten Sohle zusammenbrachen, wobei es nur der Umsicht des Betriebsleiters zu danken war, daß nicht Menschenleben gefährdet wurden. Vielfach wurden auch genügende Absperrungen der Schächte und der Brems- und Haspelberge an deren Kopf und Fuß vermißt. … Der Umgang mit den Sprengstoffen seitens der Arbeiter war im Allgemeinen verständig und gab zu Ausstellungen keinen Anlaß; dagegen war an der Führung der Sprengstoffregister durch die Werksbeamten vieles auszusetzen. Die Berginspektion sah sich mehrfach genöthigt, die Beamten in der Führung der Bücher zu unterrichten und auf die gesetzliche Strafe hinzuweisen, welche die Außerachtlassung der Bestimmungen nach sich ziehen würde. …
4. Das Arbeiterwesen. Es wurden im Berichtsjahre bei den Gruben des Inspektionsbezirkes 819 Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt und zwar:
Jugendliche Arbeiter waren auf den Werken nicht beschäftigt, Arbeiterinnen nur 8, die sämmtlich über 21 Jahre alt, verheirathet, verwittwet oder geschieden waren. Sie arbeiteten auf den Kalkwerken, wo sie das Ausschlagen der Kalksteine besorgten, und in den Porzellanerdeschlämmereien. Die Arbeitszeit ist fast allgemein eine zwölfstündige, in den Wintermonaten theilweise auch nur zehnstündig. Überschreitungen derselben sind nicht beobachtet worden. Nachtarbeit findet so gut wie nicht statt. Sonntagsarbeit ist nur wenig verrichtet worden; sie hat sich auf diejenigen Arbeiten beschränkt, von denen der regelmäßige Fortgang des werktägigen Betriebes abhängig ist. ...“ ... „Im Jahre 1900 betrug die durchschnittliche tägliche Belegschaft bei den unterirdischen gewerblichen Gruben:
Von diesen wurden 525 d. s. 58 % unter Tage beschäftigt. …“ In dieser Jahrbuchausgabe ist auch eine Auflistung der anno 1900 noch in Betrieb stehenden Kalkwerke enthalten („I. Übersicht der unterirdischen gewerblichen Gruben, ihrer Besitzer, Vertreter und Verwaltungsbeamten…“), die wir in Tabellenform zusammenfassen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nebst den beiden Kalkwerken bei Steinbach und Grumbach weiter südöstlich waren in der Region somit im Jahr 1900 bereits nur noch die zwei Kalkwerke in Groitzsch und in Miltitz in Betrieb (vgl. Tabelle weiter oben im Kapitel zur Geologie: 1884 waren es noch sieben). Anmerkung: Diese Aufführung enthält nur die gewerblichen Gruben und nur diejenigen, die ausschließlich auf Kalkstein, Dolomit und Marmor bauten und deshalb nicht solche Gruben, wie zum Beispiel Herkules & Frisch Glück bei Waschleithe, welche als Erzgrube gemutet war und Marmor nur als Nebenprodukt hereingewann. Der oben schon erwähnte Rückgang des Betriebes in der zweiten Jahreshälfte 1900 hielt in der Folgezeit an und verstärkte sich noch infolge des 1. Weltkrieges. Zudem verloren die lokalen Steine- und Erden- Gewinnungsbetriebe durch das bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark angewachsene Eisenbahnnetz sukzessive ihren wesentlichen wirtschaftlichen Standortvorteil der niedrigeren Transportkosten – vor allem gegenüber der Konkurrenz der Importe aus Böhmen und Schlesien. Nach der Aufstellung in der betreffenden Jahrbuchausgabe waren zum Kriegsende 1918 von den oben aufgeführten 30 Kalkwerken nur noch neun übrig, von denen bereits drei in Fristen gehalten wurden:
Während des Nationalsozialismus wurde das Bergwesen im Deutschen Reich neu geordnet. Anstelle des Landesbergamtes wurde erneut ein Oberbergamt in Freiberg geschaffen, dem eine Bergwirtschaftsstelle und eine Lagerstättenforschungsstelle nachgeordnet waren. Während dieser Zeit war der Abbau im Bereich des Nossen- Wilsdruffer Schiefergebirges aber ohnehin praktisch zum Erliegen gekommen. Im Bergwerksverzeichnis von 1941-1942 werden nur noch die folgenden sechs ‒ inzwischen sämtlich staatliche ‒ Kalkwerke aufgeführt.
Von der Bergaufsicht abzugrenzen war immer die technische Überwachung der Maschinen und Anlagen. Die Prüfung von Dampfkesseln, Brennöfen und elektrischen Anlagen war stets Aufgabe der Gewerbeinspektion – früher der Amtshauptmannschaft Meißen, später des Landkreises Meißen. Bis 1926 erteilte die Gewerbeinspektion auch die Genehmigungen für den Umgang mit und die Lagerung von Sprengstoffen. Nach 1946 übernahm diese Kontrollfunktionen die Arbeitsschutzinspektion (ASI) des Landkreises.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Abbau der Kalklager
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beide Lager in Miltitz ähneln sich in ihrer geologischen Struktur sehr. Beide fallen mit flacher Neigung nach Nordosten ein und bilden unsymmetrische, schüsselförmige Linsen von Kalkstein. Nur im Neuen Lager traf man einen größeren Verwerfer, eine tektonische Störung, die das Lager durchtrennte und um 7 m bis 9 m in der Höhe versetzte. Aufgrund der Neigung des Lagers konnte man keinen systematischen Kammerpfeilerbau fahren, sondern entschied sich im Alten Lager für den Weitungsbau. Damit konnte man auch auf wechselnde Qualitäten des Gesteins reagieren und die Sicherheitspfeiler dementsprechend dimensionieren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als Förderschächte legte man sowohl im Alten, als auch im Neuen Kalkwerk im Fallen der Lager Schrägschächte an (Förderbremsberge oder Tagesfallorte). Von diesen ausgehend fuhr man zunächst Sohlengrundstrecken auf und begann dann von den Strecken aus nach oben und unten den Kalkstein auszuhauen. Der Abbau erfolgte bis an die Grenzen des Lagers, obwohl man an der Firste mindestens einen halben Meter Kalk als „Gewölbe“ stehen lassen mußte. Nach einiger Zeit hatten die einzelnen Weitungsbaue zur nächsthöheren oder nächsttieferen Sohle durchgeschlagen und es entstanden die Böschungen zwischen den Stützpfeilern, die eine klare Abgrenzung der ursprünglichen Sohlen voneinander heute kaum noch möglich machen. Die größte Teufe erreichte man im Alten Lager (auf der 8. Sohle) mit etwa 100 m unter Gelände. Die Pfeiler sind im Alten Kalkwerk völlig unregelmäßig verteilt und im Mittel 6 m bis 8 m breit. Der Markscheider Oscar Choulant schreibt 1891 in einem Fahrbericht, daß der maximale Pfeilerabstand bis zu 25 m betragen habe, was nach den überlieferten Unterlagen besonders das flacher liegende Ostfeld nahe der Bahnlinie betraf. Aufgrund der Mächtigkeit des Lagers haben die offenen Abbauhohlräume unter den „Gewölben“ in den mittleren Sohlen dann bis zu 15,4 m saigere Höhe erreicht. 1900 bemerkt der Bergmeister Seemann in seinem Befahrungsbericht, daß die Pfeiler etwa 4 m Durchmesser und 8 m Abstand hätten, was nach den erhaltenen Rißunterlagen vor allem die 7. und 8. Sohle betroffen haben dürfte. In analoger Weise ging man auch im Blauen Bruch beim Übergang zum Tiefbau vor. Auf den tiefen Sohlen und im Ausstreichen des Lagers ging man gelegentlich auch im Örterbau vor. Es ist jedoch anzunehmen, daß im Auskeilen des Lagers sich ein Durchhieb der einzelnen Sohlen einfach nicht mehr lohnte und so die streckenförmigen Örter im Randbereich erhalten blieben. Die Gewinnung erfolgte zumeist schon Ende des 19. Jahrhunderts durch Bohr- und Schießarbeit. Anfangs benutzte man Schießpulver, das in gebührender Entfernung in einem Pulverturm oberhalb des Werksgeländes am Blauen Bruch gelagert wurde. 1895 richtete man im Blauen Bruch ein untertägiges Dynamitlager ein. Im Neuen Lager versuchte man – auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Tagebruch von 1916 – systematischer vorzugehen und legte einen vergleichsweise regelmäßigen Kammerpfeilerbau an. Die Pfeiler wurden (Betriebsplan 1946) mit 6 bis 8 m Breite und ebenso in 6 m bis 8 m Abstand vorgesehen. Auch im Neuen Lager wurden Abbauhöhen bis über 10 m erreicht. Das auch hier im Hangenden nachgewiesene Graukalklager wurde im Gegensatz zum Alten Lager nie bebaut. Die größte Teufe erreichte im Neuen Lager etwa 60 m unter Gelände. Auch wenn man aus dem nördlich liegenden Tälchen (dem Wiesengrund) heraus in wesentlich geringerer Tiefe an das Weißkalklager herangekommen wäre, war der Aufschluß des Neuen Lagers mit einem langen Fallort eine geschickte Lösung. Von dessen Mundloch führte eine Hängeseilbahn in gerader Linie weiter zum Standort des einstigen, von Heynitz'schen Kalkwerkes an der Bahnlinie. Auf diese Weise konnte die Förderung nach übertage und der Transport zur Verladestelle am Bahnhof Miltitz- Roitzschen zu einem Schritt kombiniert werden. Das Profil des Fallortes war jedoch zu gering ausgelegt, um die Seilbahn bis nach Untertage fortzuführen. Daher mußte übertage umgeladen werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In Groitzsch ging man in gleicher Weise vor. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hatte man aus dem Tagebau heraus begonnen, Tiefbaue anzulegen (1. und 2. Sohle). Die Förderung erfolgte zu dieser Zeit über einen Tagesschacht. Wasserlösung schaffte dem Kippe’schen Werk ursprünglich ein zirka 250 m langer Stolln (Rösche), welcher im Niveau der 2. Sohle ansetzte. Nach 1946 legte man zunächst das Fallort West I aus der 2. Sohle heraus an, um die 3. Sohle auszurichten, später das Fallort West II zum Aufschluß der 4. und 5. Sohle. Dabei gab es hier aber nur Blindschächte für die Wetterführung und die Fallorte für die Fahrung und Förderung, sonst aber keine Durchhiebe der Abbaue zwischen den einzelnen Sohlen. Gegenüber den Miltitzer Lagern fällt das Groitzscher deutlich steiler ein, so daß sich die Sohlen abschnittsweise überschneiden. Dabei achtete man aber darauf, daß die Abbaukammern jeweils übereinander zu liegen kommen, damit die Pfeiler nicht ihre Last auf die Schweben darunterliegender Kammern übertrugen. Die größte Teufe erreichte die 5. Sohle mit etwa 70 m unter Gelände. Die Förderung erfolgte über die Fallorte zur 2. Sohle und dann über eine Rampe (Förderbremsberg) aus dem Tagebau heraus, die noch heute im Geländerelief zu erkennen ist. Die Kalköfen und Verarbeitungsanlagen standen in den 1950er Jahren südlich des früheren Kippe'schen Kalkwerkes und wurden nach der Betriebseinstellung komplett abgerissen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der vor Ende des 19. Jahrhunderts eingestellte Abbau in Schmiedewalde entsprach bis dahin dem in Groitzsch. Auch hier hatte man bereits begonnen, aufgrund zunehmender Abraummächtigkeiten Tiefbaue anzulegen. Die Kalklager bei Munzig wurden bei der Suche nach Erzen entdeckt, waren durch Stollen und Schächte erschlossen und wurden ausschließlich von Untertage aus als Nebenprodukt abgebaut. Auch in Burkhardtswalde waren keine übertägigen Tagebaue vorhanden, bzw. blieben nicht erhalten. Man nutzte hier ebenfalls einen Stollen als Wasserlösungs- und Förderstrecke. Ausbau war nur im Deckgebirge und an einzelnen, gebrächen Bereichen (besonders in den Tagesstrecken) erforderlich. Dies betrifft z. B. im Tagesfallort auf das Neue Lager in Miltitz den Abschnitt bis 100 m Entfernung vom Mundloch, der aufgrund zweier Einbrüche 1925 bei 35 m und 85 m Abstand vom Mundloch aus Sicherheitsgründen ausgemauert wurde. Im Alten Lager wurde u. a. der vordere Teil des Adolph Stollens durch schöne, ovale Ausmauerung gesichert. Im Kalklager selbst tragen sich die Firsten bei Beachtung der erforderlichen Mindestmächtigkeiten des Gewölbes und Einhaltung der Pfeilerdimensionierung aus eigener Kraft. Zur Sicherung abgeworfener Grubenbaue dämmte man sie schon in der Vergangenheit mit Mauerwerk oder Trockenmauern ab, um den ZUgang zu versperren, die Last der Firste zusätzlich abzustützen und versetzte sie dann soweit erforderlich und möglich, mit anfallendem Abraummaterial. Die Füllorte der Schächte im Alten Kalkwerk wurden 1948 bis in deren Firste aufgemauert und der obere Teil dann mit Massen verstürzt. Das Ostfeld nahe der Bahnstrecke hat man 1966 bis 1972 durch vollständige Verfüllung dauerhaft verwahrt. Allein für diesen Teilbereich wurden rund 30.000 m³ Material benötigt. Auch das Fallort auf das Miltitzer Neue Lager wurde im tagesnahen Abschnitt komplett verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur
Verarbeitung des „Marmors“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Kalkbrennen (Technischer Kalk- Kreislauf)
Abbauwürdige
Kalksteine und Marmor bestehen zum überwiegenden Teil aus dem Mineral Calcit
(Kalkspat). Beim Brennen des Kalksteins wird ab einer Temperatur von etwa 1000°C der
Kalkspat entsäuert, das heißt
Kohlensäure (das
Kohlenstoffdioxid) wird ausgetrieben und es entsteht Branntkalk,
chemisch das
Kalziumoxid.
Von diesem Vorgang ist die Bezeichnung „Kalzination“ für vergleichbare Prozesse abgeleitet. Zum Brennen müssen unbedingt Stückkalk und stückige Kohle eingesetzt werden, damit in den Zwickeln des Materials von unten genügend Sauerstoff zutreten und das Kohlendioxid nach oben abziehen kann. Der preußische Oberbergrat Kühn berichtet 1837 über das Rüdersdorfer Kalkwerk, daß man dort „...zu den ordinairen Kalksteinen oder Brennsteinen Stücke rechnet, welche 36 Cubikzoll*) bis ½ Cubikfuß Inhalt und 3 bis 75 Pfd. Gewicht**) haben.“ *) Für das Raummaß trockener Schüttgüter wurden bis zur Einführung der Meterkonvention 1875 auch die Einheiten Kubikzoll und Kubikfuß verwendet. Sie beruhten in den Ländern auf verschiedenen Zoll- und Fuß- Maßen und unterschieden sich folglich deutlich. Ein Kubikzoll entspricht in etwa einem Raummaß von 16 cm³ bis 19 cm³ (Pariser Kubikzoll), 36 davon also etwa 684 cm³ oder etwas mehr als einem halben Liter. Ein sächsischer Kubikfuß entspricht zirka 0,0227 m³, respektive etwa 22,7 Litern. Die Korngröße des brennbaren Kalksteins lag demnach bei einer Kantenlänge zwischen mindestens 8 cm und etwa 30 cm. Zu groß durften die Brocken auch wieder nicht sein, damit sie innerhalb der Brennzeit auch „gar“ brannten. **) Also rund 1,5 kg bis 37,5 kg. Für das Gewichtsmaß Pfund gilt das oben Gesagte gleichermaßen, wie für die Raummaße.
Durch die Abgabe des Kohlendioxyds wird auch das spezifische Gewicht des Produktes geringer. Das Massenverhältnis kann man mit dem Periodensystem schnell abschätzen: Die molare Masse des Karbonats beträgt nämlich zirka 40+12+3 ·16 = 100 g/mol; die molare Masse des Oxids dagegen nur 40+16 = 56 g/mol. Ein gegebenes Volumen Rohkalk wiegt demnach fast doppelt so viel, wie der daraus erzeugte Branntkalk. Bezieht man sich also bei der Angabe von Produktionsmengen auf das Gewicht von Fördergut und Produkt, muß man zirka die doppelte (Gewichts-) Menge abbauen, die man als Fertigware verkaufen will.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei der Verwendung relativ reiner Kalkgesteine entsteht der Weißkalk (Fettkalk) mit 90 bis 95 % CaO. Anderenfalls spricht man von Magerkalken. Magnesiumhaltige Kalke mit höheren Anteilen von weißer Magnesia (MgO) ergeben sogenannte Magnesiakalke. Kieselkalke, wie Korallenkalk oder Muschelkalk ergeben Kalke in technischer Nähe zum Zement, also härtere und deutlich wasserresistentere Baustoffe. Kalke minderer Qualität entstehen dagegen bei Verwendung von Kalksandsteinen, die tonige Anteile enthalten (im Wesentlichen Magnesium- und Aluminium- Silikate). Wenn das Ausgangsmaterial höhere Anteile organischer Bestandteile (Kohlenstoff) enthält oder wenn durch die Art der Verarbeitung höhere Anteile organischer Bestandteile im Produkt verbleiben, entsteht Grau- oder Schwarzkalk. Ungünstig ist die Verwendung von Koks als Brennstoff zum Kalkbrennen, da Koks schwefelhaltig ist und bei den hohen Temperaturen der Kalk teilweise zu Gips „verschwefelt“. Gleiche Effekte können auch beim Einsatz von Holz oder Braunkohle als Brennstoff auftreten. Daher werden besonders hochwertige Kalke heute gasgebrannt oder sogar durch Zuführung elektrischer Energie erhitzt.
Die ersten Einrichtungen zum Kalkbrennen waren einfache sogenannte Feldöfen ohne Ummauerung. Solche Brennöfen werden von J. Otto im Jahre 1840 zumindest noch erwähnt: „…Noch muß das Brennen des Kalkes in Meilern*) wenigstens erwähnt werden. In einigen Gegenden Englands, auch Belgiens, werden die Kalksteine mit Steinkohlen oder mit Torf geschichtet, zu Meilern geformt, denen man eine Decke von Erde oder Rasen giebt. In der Mitte befindet sich, wie bei den Kohlenmeilern, ein Schacht, durch welchen das Anzünden bewerkstelligt wird. Die Leitung des Feuers wird, wie bei dem Kohlenbrennen, durch die Erddecke möglich gemacht. Man macht nämlich nach und nach in verschiedenen Höhen Oeffnungen (Räume, Räumlöcher) in die Decke des Meilers und regulirt durch Verschließung oder Vergrößerung derselben den Zug. Zieht sich das Feuer zu stark nach einer Seite, so werden an dieser die Oeffnungen mehr oder weniger verstopft; soll das Feuer nach einer Seite hingeleitet werden, so werden an dieser die Oeffnungen vergrößert, oder so wird hier die Anzahl derselben vermehrt.“ *) Anmerkung: Der Begriff „Meiler“ ist aus technischer Sicht eigentlich falsch. Der Meiler wird unter weitgehendem Luftabschluß, also unter reduzierenden Bedingungen befeuert (vgl. den (Holz-)Kohlen-Meiler). Dabei findet kein „Brennen“, sondern ein „Verschwelen“ statt. Beim Kalkbrennen erfordert bereits die höhere Brenntemperatur (bis zu 1.200°C) eine verstärkte Sauerstoffzufuhr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Weiterentwicklung bildeten die Trichterofen, bei denen innerhalb einer Heizkammer etwa in der Mitte eine Temperatur von 1.100°C bis 1.250°C konstant aufrechterhalten wird. Der Kalkstein wird zusammen mit der Kohle von oben in den Trichter eingefüllt, die chemische Reaktion erfolgt in der Mitte (in der sogenannten „Brennzone“); die aus der Brennzone aufsteigenden heißen Gase wärmen zudem die nachsickernde Kohle vor. Bis zum untenliegenden Abzug des Trichters kühlt der entstandene Branntkalk ab und wird dort entnommen. Dieses Vorgehen ermöglichte gegenüber den Feldöfen bereits einen kontinuierlichen Anlagenbetrieb. Für eine nähere Beschreibung der ersten Trichteröfen zitieren wir wieder zeitgenössische Quellen. J. H. Jung beschreibt sie 1785 so: „Die gewöhnliche und allgemeine Art der Kalköfen ist am bequemsten und lange nicht so kostbar: Man gräbt in einen Hügel eine trichterförmige Grube, und führt von der Seiten her einen Gang dazu, der im Anfang weit, aber gegen die Spitze der Grube immer enger wird; der Trichter endigt sich unten in eine runde Oeffnung, welche etwa anderthalb Schuh im Durchmesser hat, auch der Trichter selbst ist rund; unter jener Oeffnung endigt sich auch der Gang, mit einer ebenso grossen Oeffnung, hier wird das Feuer unterhalten; sowohl der Gang als der Ofen selbst wird mit feuerfesten Steinen dicht ausgemauert. Der trichterförmige Ofen wird mit Kalksteinen dicht ausgemauert; die untere Oeffnung aber mit denselben gewölbt; die dickesten Steine bringt man zunächst an die Wand, und die kleinere in die Mitte. Oben über bedeckt man alles mit kleinem Gesteine, und baut einen Schuppen, oder ein Dach darüber, gegen den Regen. Alsdann macht man zuerst ein gelindes Feuer, verstärkt es allmählig bis zur höchsten Glut, und lässt es ja nicht auslöschen, bis die Steine gar sind; denn man hält dafür, daß sich die Flamme nicht so gern wieder durch die Steine zöge, als wenn sie beständig unterhalten wird. Wenn der Kalk ausgebrannt ist, so lässt man das Feuer auslöschen.“ Über die später gewöhnlich gemauerten Trichteröfen haben wir bei J. Otto 1840 gelesen: „Das Brennen des Kalkes geschieht in unseren Gegenden fast stets in Kalköfen, in einigen Ländern brennt man denselben aber auch in Meilern (siehe Anmerkung oben). Die Gestalt der Oefen ist sehr verschieden. Am häufigsten sind sie cylindrisch oder eiförmig; den Ziegelöfen ähnliche Kalköfen*) finden sich, wenigstens in unserer Gegend, seltner.“ *) Damit
sind sogenannte Hoffmann’sche (Kalk-) Ringöfen gemeint. Ringförmige
Brennöfen mit mehreren Brennkammern wurden bereits früher, u. a. 1839 von
Maurermeister C. Arnold in Fürstenwalde gebaut. Das erst 1858 an den
Berliner Bauingenieur F. E. Hoffmann und den Danziger,
später Leipziger Stadtbaurat
J. A. G. Licht darauf erteilte Patent wurde deshalb nachträglich
wieder aberkannt. Wie diese Öfen aussahen, zeigen wir in unserem Beitrag zum
Dolomitbergbau bei
Doch wieder zurück zu J. Otto anno 1840. Die inzwischen üblicherweise gemauerten Öfen beschreibt er wie folgt: „Man theilt die Kalköfen gewöhnlich in periodische und in continuirliche ein. Jene läßt man nach beendetem Brennen des Kalkes erkalten, um den Kalk auszuziehen; in diesen geht das Brennen ohne Unterbrechung vor sich, indem der gargebrannte Kalk von Zeit zu Zeit theilweise ausgezogen, und in dem Maße, als dies geschieht, der Ofen von oben wieder gefüllt wird. Die periodischen Kalköfen haben entweder keinen Rost, oder sie sind mit einem solchen versehen. … Der in Figur 78 abgebildete Kalkofen ist ein periodischer Kalkofen ohne Rost, und ein Kalkofen der gebräuchlichsten Art. Man baute diese Oefen in einen Hügelabhang oder in den Abhang des Kalksteinbruches hinein, um den Kalkstein bequem zu ihrer obern Oeffnung, durch welche man sie füllt, karren zu können. Gewöhnlich werden mehrere Oefen neben einander angelegt, so daß dann eine Mauer zweien Oefen gemeinschaftlich ist, wie es die Fig. 79 zeigt. Der Durchmesser des abgebildeten Ofens beträgt im Lichten 6 Fuß, die Höhe 10 Fuß; a ist das 3 Fuß starke Mauerwerk; c das Gewölbe von ohngefähr 2 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe, welches in das Innere des Ofens zu dem Heizraume führt, f sind Strebepfeiler.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Soll in dem Ofen Kalk gebrannt werden, so wird zuerst im Innern desselben aus ausgesuchten größeren Kalksteinen das Gewölbe d von 4 bis 5 Fuß Höhe gebildet, welches als Feuerraum dient und daher nach c zu offen ist. Hierauf wird der Ofen durch die obere Oeffnung (die Gicht) mit Kalksteinen vollends angefüllt und mit einer Schicht kleinerer Kalksteinstücke (Grus) gedeckt. Durch die Heizöffnung wird dann mit leicht entzündlichem Brennmaterial, mit Reisigholz oder Wasen, der Ofen langsam angewärmt und dann das Feuer allmählig bis zur vollständigen Gahre der Steine verstärkt. Der Ofen muß langsam angewärmt werden, damit die Kalksteine in Folge des raschen Entweichens der Feuchtigkeit, welche sie enthalten, nicht zerspringen. Beim Beginnen des Heizens, wo die Temperatur des Ofens noch niedrig ist, condensirt sich auf den Steinen der Wasserdampf, welcher beim Verbrennen des Brennmaterials gebildet wird, die Steine werden naß, der Luftzug ist wegen der niederen Temperatur noch schwach, die Verbrennung des Brennmaterials also unvollständig, es setzt sich Ruß auf die Steine ab und es entweicht aus der Gicht dicker schwarzer Rauch. Je höher die Temperatur des Ofens aber wird, desto mehr vermindert sich der Rauch, der Ruß auf den Steinen verbrennt, sie werden wieder hellfarbig, es kommen Flammen an der Gicht zum Vorschein, die, anfangs dunkel und rußend, im weiteren Verlaufe des Brennens immer heller und rußfreier werden. Zeigt sich der Kalkstein unter der Decke als eine weißglühende, gleichsam wollige lockere Masse, so ist derselbe gahr gebrannt, der Proceß kann beendet werden. … Kalköfen mit Rost, ähnlich dem, welcher in Fig. 80 abgebildet ist, …, liefern den meisten Kalk für die Stadt Braunschweig. Sie sind eiförmig, verengen sich indeß nach oben zu nicht so stark, als es die Abbildung zeigt, indem der obere Durchmesser wie der untere ohngefähr 5 Fuß betragt. Ueber dem Aschenfalle n ist ein Rost aus gebrannten Steinen gewölbt gemauert…
Einen speziellen
Ofentyp mit Rostfeuerung, der auch unter der regionaltypischen Bezeichnung
„Geithainer Ofen“ bekannt ist, zeigen wir unserem Beitrag zum
Dolomitbergbau bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Heizöffnung ist 2 Fuß breit, nicht viel breiter setzt man auch das Gewölbe von Kalksteinen im Innern des Ofens über dem Roste. Auch diese Oefen werden in den Abhang des Kalksteinbruches hineingebaut, um bequem zu ihrer Gicht gelangen zu können, und über dieser befindet sich gewöhnlich ein leichtes Haus, gebaut zur Abhaltung des Regens, zum Schutzorte für die Arbeiter und zum Aufbewahrungsorte für die Werkzeuge. Nicht selten liegen zwei dieser Oefen dicht neben einander, wo dann der eine im Brande begriffen ist, während der andere ausgenommen oder eingesetzt wird. … Die periodischen Kalköfen haben den Nachtheil, daß, nach beendetem Gahrbrennen des Kalkes, der Ofen bis zur nächsten Füllung sich vollständig abkühlt, also bei einem neuen Brande wieder mit dem Aufwande einer gewissen Quantität Brennmaterial erhitzt werden muß, und daß die Wärme, welche der gebrannte hellrothglühende Kalk besitzt, gänzlich verloren geht, indem dieselbe von der nach Beendigung des Brennens durch den Ofen ziehenden Luft weggeführt wird… Es giebt nun zwei verschiedene Arten von continuirlichen Oefen, welche den genannten Nachtheil nicht zeigen. Bei der einen Art wird der Kalkstein in abwechselnden Schichten mit dem Brennmaterial, das dann nur Torf, Braunkohle oder Steinkohle sein kann, oben aufgegeben, und der gebrannte Kalk von Zeit zu Zeit unten herausgezogen. Bei der zweiten Art befindet sich die Feuerung in einer gewissen Höhe über der Sohle eines Schachtes, und zwar außerhalb desselben, so daß der Kalkstein in dem Ofen nicht mit dem Brennmaterial selbst in Berührung kommt, sondern nur durch dessen Flamme erhitzt wird. Wird durch, an der Sohle des Ofens angebrachte, Abzugsöffnungen der unterhalb der Feuerungen befindliche Kalk herausgezogen, so sinkt der oberhalb derselben befindliche Kalk nach und es kann Kalkstein wieder durch die Gicht eingeschüttet werden. Fig. 82 zeigt einen continuirlichen Ofen der erstgenannten Art, welcher sich bewährt hat. Derselbe ist trichterförmig und ebenfalls in einen Hügel gebaut, um bequem zu seiner Gicht kommen zu können. Der obere Durchmesser des Trichters i. beträgt 12 Fuß, der untere 5 Fuß, die Höhe desselben 14 Fuß; d ist eine Abzugsöffnung von 2 ½ Fuß Höhe und 2 Fuß Breite. Dieselbe ist während des Brennens mit einer Thür geschlossen; e ist eine Oeffnung von 4 Zoll Höbe und 6 Zoll Breite zum Einströmen der atmosphärischen Luft. Es befinden sich im Umkreise des Ofens 3 Abzugsöffnungen und 3 Zugöffnungen, wie es die Fig. 83 zeigt, in welcher die entsprechenden Theile mit denselben Buchstaben, wie in Fig. 82, bezeichnet sind; a ist das Mauerwerk des Ofens.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man erkennt, daß die Verbrennung des Brennmaterials, welches, wie schon erwähnt, Torf oder Kohle (Holzkohle, Braunkohle oder Steinkohle) sein muß, oberhalb c erfolgt; unterhalb c sammelt sich der gebrannte Kalk an und er wird von Zeit zu Zeit, nachdem seine hohe Temperatur zum Erhitzen des darüber liegenden, noch nicht gahr gebrannten, Kalkes benutzt ist, durch die Abzugsöffnungen aus dem Ofen gezogen, worauf man dann wieder abwechselnde Schichten von Kalkstein und Brennmaterial aufgiebt. Es versteht sich wohl von selbst, daß die Kalksteine für diesen Ofen nicht zu groß sein dürfen, und daß sie möglichst von gleicher Größe genommen werden müssen. Beim
Anheizen des Ofens werden auf der Sohle des selben aus Kalksteinen
Feuergassen gebaut, welche nach den Abzugsöffnungen hin offen sind, dann
wird der Ofen mit Schichten von Kalkstein und Brennmaterial anfangs nur
bis etwas über die Luftzüge hin angefüllt. Hierauf heizt man, bei
geschlossenen Luftzügen, durch die Abzüge, so lange mit leichtem Holze,
bis der unter den Luftzügen befindliche Kalk gahr gebrannt ist, wobei man
von Zeit zu Zeit in dem Maaße, als der Kalk zusammensinkt, neue Mengen von
Kalkstein und Brennmaterial nachgiebt. Hierauf schließt man die
Kalkabzüge, öffnet die Luftzüge und füllt den Öfen mit Schichten von
Kalkstein und Brennmaterial vollends an. So bald ein betrachtlicher Theil
des über dem Zugloche befindlichen Kalkes ebenfalls gahr gebrannt ist,
wird aus den Abzugsöffnungen Kalk gezogen und dies ohngefahr alle 6 bis 8
Stunden wiederholt. …“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die hier beschriebene Bauform dieser niedrigen, meist trichterförmigen Schachtöfen, welche zwar für einen kontinuierlichen Betrieb ausgelegt waren, aber auch „periodisch“ betrieben werden konnten, war in der hiesigen Region, soweit man es an den erhaltenen Fundamentresten noch nachvollziehen kann, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts vorherrschend. Wunder, Herbrig und Eulitz beschreiben diese Öfen etwa 30 Jahre später, im Jahr 1867, wie folgt im Abschnitt: „III. Die Oefen zu continuirlichem Betriebe mit kleiner Flamme sind unter dem Namen „Schneller“ oder „Fix- Oefen“ verbreitet und werden nach ihrer Form auch als „Kessel-“ oder „Trichteröfen“, nach der Art ihrer Beschickung auch als „Schüttöfen“ bezeichnet, unter welchen letzteren Benennungen jedoch zum Theil auch periodisch arbeitende Öfen verstanden werden. Der innere Raum dieser Öfen ist in der Regel trichter- oder kesselförmig, sich nach oben erweiternd; die Beschickung dieser Öfen erfolgt, wie bei den periodisch arbeitenden Öfen mit kleiner Flamme durch abwechselndes Eintragen von Brennmaterial- und Kalksteinschichten. Wenn jedoch die im Ofenraume von unten nach oben sich fortpflanzende Gluth an die Oberrfläche vordringt, wird nur ein Theil des im untern Raum befindlichen, gut gebrannten Kalkes durch an der Sohle angebrachte Ziehöffnungen herausgezogen, was ein Nachsinken des ganzen Ofeninhaltes zur Folge hat, und werden darnach durch die obere Ofenöffnung, die Gicht, neue Schichten von Brennmaterial und Kalkstein aufgegeben. Diese Operationen wiederholen sich, und kann auf diese Weise ein Ofen monatelang in unaufhörlicher Thätigkeit erhalten werden. Vor den Ziehöffnungen bringt man häufig Roste an, über welche man den Kalk beim Ziehen aus dem Ofen hinwegrafft, so dass die Asche des Brennmaterials, der sich Kalkmehl beimengt, die sogenannte „Kalkasche“, von dem Stückkalk getrennt wird… Freilich gestattet die Ungleichmäßigkeit des Absatzes in der Regel nur, dass einige Öfen eines Kalkwerkes in stetem Betriebe erhalten werden, während die übrigen nur während der kurzen Zeit des größeren Absatzes in Gang zu setzen sind.“ Bezüglich der auch 1867 wieder genannten Roste sei noch einmal auf J. Otto zurückgegriffen, wo es 1840 heißt: „Ueber dem Aschenfalle ist ein Rost aus gebrannten Steinen gewölbt gemauert; Fig. 81 zeigt die Zusammenfügung der Steine.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Heizöffnung ist 2 Fuß breit, nicht viel breiter setzt man auch das Gewölbe von Kalksteinen im Innern des Ofens über dem Roste. Auch diese Oefen werden in den Abhang des Kalksteinbruches hineingebaut, um bequem zu ihrer Gicht gelangen zu können, und über dieser befindet sich gewöhnlich ein leichtes Haus, gebaut zur Abhaltung des Regens, zum Schutzorte für die Arbeiter und zum Aufbewahrungsorte für die Werkzeuge. Nicht selten liegen zwei dieser Oefen dicht neben einander, wo dann der eine im Brande begriffen ist, wahrend der andere ausgenommen oder eingesetzt wird.“ Zeichnen wir uns doch einmal auf, was wir gelesen haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Sächs. Staatsarchiv, Bergarchiv
Freiberg, Bestand 40028 (Oberbergamt, Bergwirtschaftsstelle),
Weitere historische Fotos
gehen auf den in Meißen ansässigen Kunstverlag
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein angestrebter, höherer Durchsatz führte auch in der Bindemittelindustrie zum Einsatz von sogenannten Schachtöfen. Als solcher wird allgemein ein Brennofen mit der geometrischen Grundform eines auf seiner Grundfläche stehenden Hohlzylinders, Hohlkegels oder Hohlquaders bezeichnet, wobei die Höhe des Ofenkörpers seine Länge und Breite um ein Vielfaches übertreffen kann. Als Niederschachtofen wird ein Ofen mit geringerer Bauhöhe (bis zu zehn Meter) im Unterschied zum Hochofen bezeichnet. Nach ihrem Arbeitsprinzip stellen die „Schneller- Öfen“ bereits Niederschachtöfen dar. Als Rumford- Ofen oder auch Rüdersdorfer Ofen bezeichnete man einen Brennofen zur Fertigung von Branntkalk, dessen Aufbau Ideen von Sir Benjamin Thompson Graf Rumford folgte. Bei diesem Ofentyp sind getrennte Brennkammern für Kalk und Brennstoff eingerichtet. Der Feuerungsraum befindet sich beim Rumford'schen Ofen an den Seiten und ist komplett vom eigentlichen Brennraum abgetrennt. Ursprünglich verband nur ein einziger Querkanal die beiden Schächte, durch den die heiße Luft aus dem Feuerungsraum in den Brennraum gelangt. Kalk wird von oben in den Brennraum eingefüllt, die Asche aus dem Brennraum fällt in einen separaten Schacht, aus dem sie entnommen werden kann. Im unteren Teil des Feuerungsraumes kühlt der gebrannte Kalk wieder ab, da die Hitze aus dem Feuerungsraum ja nach oben strömt („Gegenstrom-Prinzip“). Der obere Teil des Brennraumes, der nicht direkt am Feuerungsraum anliegt, dient als Vorwärmraum und wird mit Hohlkammern, vom Feuerungsraum isoliert. Die Tagesproduktion eines Ofens stieg dabei auf 25 bis 30 Tonnen Branntkalk (je nach Dimensionen des Ofens) gegenüber zirka 2 Tonnen bei einem Trichterofen deutlich an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei Herrn Oberbergrath Kühn können wir 1837 darüber lesen: „Der Graf von Rumford teilte zu Ende vorigen Jahrhunderts in seinen vermischten Schriften eine Beschreibung zu einem Kalkofen mit, welcher von der bisher gewöhnlichen Form ganz abwich und bei dessen Anlage er nach eigener Angabe folgende besondere Zwecke zu erreichen beabsichtigte: 1) Die Feuerung auf solche Weise wirken zu lassen, dass die Flamme den Rauch verzehrt, und dies dadurch zu erreichen, dass der Rauch niederzusteigen und durch das Feuer zu gehen gezwungen wurde, um so viel Hitze als möglich zu erzeugen. 2) Die von dem Feuer aufsteigende Flamme und den heissen Dampf mit dem Kalkstein durch eine grosse Oberfläche in Berührung zu bringen, um den Wärmestoff zu sparen und sein Entweichen in die Luft zu verhüten, welches dadurch geschehen sollte, dass man dem Bauch des Kalkofens die Gestalt eines hohlen abgestumpften Kegels gab, ihn gegen seinen Durchmesser sehr hoch machte und ihn bis zu seiner Spitze ganz mit Kalksteinen füllte, indem das Feuer unter den Boden des Kegels hineindrang. 3) Den Prozess des Kalkbrennens ununterbrochen fortgehen zu lassen, um die Verschwendung des Wärmestoffes zu verhüten, der bei dem Kaltwerden des Ofens unausbleiblich erfolgt, wenn man beim Einlegen und Herausnehmen des Kalkes jedesmal das Feuer auszulöschen gezwungen ist. 4) Die Einrichtung so zu treffen, dass der soeben fertig gebrannte Kalk, der folglich noch sehr heiss ist, beim Abkühlen seinen Wärmestoff so abgeben müsse, dass er die frische Portion kalter Kalksteine, die von neuem in den Ofen kommt, erhitzen helfe. ... Wenn daher dem Grafen v. Rumford auch die Ehre gebührt, die Bahn zu der dadurch beabsichtigten Verbesserung eines der National- Industrie sehr nützlichen Gewerbes gebrochen zu haben, so hat Herr Rösch*) nicht minder das Verdienst, die Ideen des Grafen richtig aufgefasst, sie ausgebildet und mit Ueberwindung aller der Schwierigkeiten, die sich gewöhnlich jedem Neuen entgegenstellen, ausgeführt und zur Vollkommenheit gebracht zu haben. Derselbe machte nämlich unterm 2. Januar 1802 dem damaligen Staatsminister Herrn Freiherrn v. Heinitz**) den Vorschlag zur Erbauung eines konischen Kalkofens zur Beheizung mit Torf oder Steinkohlen… Unterm 5. März 1803 wurde die Erbauung des oben beschriebenen Kalkofens in Rüdersdorf angeordnet und der erste konische Kalkofen nach den Vorschlägen des Herrn Rösch im April desselben Jahres mit einem Kostenaufwande von beiläufig 1.353 Rthlr. errichtet und im Juli auf Torffeuerung in Betrieb gesetzt.“ Bei der Torffeuerung konnte damals in Preußen nur Lausitzer Braunkohle gemeint sein.
Dieser
erste Rumfordofen kann
heute noch im
*) Bei Herrn Rösch handelt es sich um den preußischen Bergrat und dazumal amtierenden Vorsteher der Königlichen Porzellanfabrik in Berlin. **) Zur Erinnerung: Gemeint ist hier Friedrich Anton von Heynitz, ab 1777 und bis zum Jahre 1802 Königl. Preußischer Oberberghauptmann. Nebenbei war er 1797 auch Vorstand der Königlichen Porzellanmanufaktur- Kommission.
J. Otto beschreibt 1840 diesen Ofentyp wie folgt: „Die zweite Art der continuirlichen Kalköfen ist in den Fig. 84, 85 u. 86 abgebildet; Fig. 85 ist der senkrechte, Fig. 86 der horizontale Durchschnitt, in der Höhe der Abzugsöffnungen. Gleiche Buchstaben bezeichnen gleiche Theile. Seitwärts an dem stehenden Schachte, in einer gewissen Höhe über der Sohle desselben, bei a, befinden sich die Heizöffnungen; sie sind mit dem Roste a versehen, zu welchem die Luft durch den Kanal i gelangt. Von diesen Heizöffnungen sind 3 vorhanden. Zwischen denselben, an der Sohle des Ofens, befinden sich die Abzugsöffnungen e, also ebenfalls drei, mit dem daran gebauten Gewölbe f, in welchem der ausgezogene Kalk bis zum Abkühlen liegen bleibt. Die Sohle des Ofens dacht sich nach den Abzügen hin ab, um das Ausziehen des Kalkes zu erleichtern, indeß nicht ganz so stark, als in der Zeichnung angegeben. Man hat auch Oefen mit vier und fünf Heizöffnungen und Abzügen, indeß werden die mit dreien vorgezogen. d ist der Aschenfall unter dem Roste, aus welchem die Asche durch c herausgenommen wird. Diese Oeffnungen c, so wie die Schüröffnungen a sind während des Brennens geschlossen, so daß die zum Verbrennen des Brennmaterials nöthige Luft nur durch die Kanäle b unter den Rost gelangen kann. Der Rost ist auf die, Fig. 85, gezeichnete Weise aus feuerfesten Steinen construirt, auch der Heizraum und selbst der Schacht ist mit solchen Steinen ausgelegt. Ein Weg muß zu der Gicht führen, auf welchem die Kalksteine zu dem Ofen gekarrt werden. Sehr zweckmäßig ist es, wenn im Mauerwerk des Ofens ein hohler Raum ausgespart wird, den man mit Asche und Sand ausfüllen, aber auch wohl ebensogut leer lassen kann. Die Wärme wird dadurch im Ofen zusammengehalten. Hin und wieder muß natürlich die äußere Mauer, welche von Kalksteinen aufgeführt werden kann, mit der innern durch eingreifende Binder verankert werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehr ausgezeichnete
und berühmte Kalköfen dieser Art sind die zu Rüdersdorf bei Berlin, welche
colossale Baue darstellen. …
Der Schacht
ist bei den Rüdersdorfer Oefen 35 Fuß hoch
(zirka 11,5 m), der
Durchmesser desselben beträgt bei den Feuerungen 8 ½ Fuß, oben an der
Gicht 6 Fuß, unten auf der Sohle 7 Fuß. Die Feuerungen befinden sich 7 ½
Fuß über der Sohle. Die ganze Stärke der Schachtmauer beträgt 7 Fuß. Die
Kalkabzüge sind 2 ¾ Fuß lang, 2 ½ Fuß hoch, 2 Fuß breit und werden mit
eisernen Thüren verschlossen, die man während des Brennens mit Lehm
verschmiert, damit keine Luft durch dieselben in den Ofen gelangen kann.
Auch die Aschenfälle sind, wie schon erwähnt, und zwar auf gleiche Weise
geschlossen; sie müssen so geräumig sein, daß sie innerhalb 4 bis 5 Tagen,
als in welchen Zeiträumen sie geleert werden, sich nicht bis zu den
Zugöffnungen b füllen können. …“
Auch in Meyer´s Großem Konversationslexikon, Ausgabe 1907, 10. Band, haben wir eine Beschreibung der Rüdersdorfer Brennöfen gefunden: „Kontinuierlich brennende Kalköfen sind meist Schachtöfen wie der Steinbrück‘sche und der sehr beliebte Rüdersdorfer (Fig. 4 und 5). Er besteht aus dem Schacht, der durch die Futtermauer d und das von dieser durch einen mit Asche und Schutt gefüllten Zwischenraum getrennte Rauhgemäuer e gebildet wird, und besitzt außerdem eine Umhüllungsmauer c, so daß zwischen dieser und dem Rauhgemäuer ein Raum bleibt, der durch Gewölbe in Zellen geteilt ist. Letztere benutzt man zur Aufbewahrung von Material. Während des Ganges des Ofens ist der untere Teil des Schachtes mit gar gebranntem K. gefüllt, der durch die drei Zugöffnungen a an der Schachtsohle von Zeit zu Zeit gezogen wird. Der Schacht hat eine Höhe von etwa 14 m. Ungefähr 4 m über der Sohle befinden sich die Feuerungen b für Torf und Holz, die zu drei oder fünf um den Ofen herum angebracht und mit Rost u. Aschenfall versehen sind. Um die Arbeiter vor der von dem gezogenen K. ausströmenden Hitze zu schützen, ist ein Kanal angebracht, durch den die Hitze in die Gewölbe gelangt. Der einmal angeheizte Ofen wird so lange im Gang erhalten, bis Reparaturen erforderlich werden. Man verbraucht in diesem Ofen auf 1 Volumen gebrannten K. 1,4 Vol. hartes oder 2–2,25 Vol. weiches Holz oder 1,5–2 Vol. Torf. Mit 1 Vol. Braunkohle erhält man 1–1,5 mit 1 Vol. Steinkohle bis 3,5 Vol. gebrannten K.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leider heute ohne das Einfeuerungshaus,
von dem der eigentliche Ofenschacht umbaut war, ist auch bei
Der wesentliche Unterschied zu den früheren Schachtöfen bestand bei denen nach Rumford'scher Bauart darin, daß Feuerung und Brennschacht voneinander getrennt waren. Durch den Ofenschacht strömten nur die heißen Verbrennungsgase. Dadurch mischte sich der Klarkalk nicht mit Asche und man erzielte gegenüber den Schneller- oder Schüttöfen (in die sowohl Rohkalk, als auch Brennstoff von oben eingefüllt wurde) eine bessere Qualität. Beides waren aber kontinuierlich arbeitende Brennöfen. Trotz einer deutlich höheren
Produktion dieser Ofentypen waren aber bis ins 20. Jahrhundert hinein auch
noch periodisch arbeitende (Kalk-) Brennöfen in Gebrauch,
insbesondere, um in absatzschwächeren Monaten auch geringere Quantitäten ‒
quasi auf Bestellung der Kunden ‒ erzeugen zu können. Periodisch
arbeiteten auch die
Für die zumeist nur kleinen gewerblichen Gruben in unserer Region lohnten sich solche recht aufwendigen Anlagen zumeist nicht. Nur das Miltitzer Werk erbaute um 1900 einen Schachtofen.
Ein Beispiel eines solchen Schachtofens findet man noch in
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Ablöschen des Branntkalks
Der zweite Schritt wurde früher gewöhnlich erst
durch den Anwender selbst durchgeführt, kann aber auch im Kalkwerk
ausgeführt werden. Wird gebrannter Kalk mit
Wasser versetzt, entsteht unter Volumenvergrößerung und starker
Wärmeentwicklung Löschkalk, chemisch das Kalziumhydroxid.
Je nach Menge der Wasserzugabe spricht man von Sumpfkalk, Kalkfarbe oder Kalkmilch. Alle diese Formen werden als weiße Farbe zum Kalken von Wänden und als Bindemittel für Kalkmörtel oder hydraulischen Mörtel verwendet. Eine Zwischenstufe bildet dabei der unvollständig gelöschte Kalk, der ein trockenes Pulver ergibt, das trotzdem abbindefähig ist und unter dem Namen Kalkhydrat gehandelt wird. Dieses bildet die Grundlage für Fertig-Kalkmörtel und Kalkputze sowie für Anmachfarben. Auch für diese Reaktion können wir schnell ausrechnen, daß der Löschkalk wieder ein höheres spezifisches Gewicht gegenüber dem Branntkalk haben muß: Branntkalk besitzt eine molare Masse von 40+16 = 56 g/mol, das Hydroxid dagegen von 40+2 · (16+1) = 74 g/mol – es ist also wieder deutlich schwerer. In früheren Zeiten, in denen der Transport ausschließlich mittels des „1- PS- Hafermotors“ erfolgte, hat man für Bauzwecke daher natürlich lieber den Branntkalk verkauft (und transportiert). Der Maurer konnte sich den benötigten Kalkmörtel dann auf der Baustelle selbst herstellen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Prozeß des Ablöschens beschreibt P. Loeff 1873 folgendermaßen: „Legt man den gebrannten Kalk ins Wasser, so entwickelt sich Wärme, und der Kalk geht mit dem Wasser eine Verbindung ein. Um den Kalk durch das gewöhnliche Verfahren zu löschen, wirft man ihn in eine sogenannte Kalkbank, worin sich, was wohl zu beachten, die nöthige Wassermasse bereits befinden muss. Eine solche Kalkbank, auch Löschbank genannt, besteht aus Brettern, ist 2,5 bis 3 Meter (8 bis 10 Fuss) lang, 1,9 bis 2,5 Meter (6 bis 8 Fuss) breit und 0,5 bis 0,6 Meter (1 ½ bis 2 Fuss) hoch. Erhält der Kalk beim Ablöschen weniger Wasser, als er nach seinen Eigenschaften erfordert, so brennt er an und wird körnig, backt zusammen; ist die Wassermenge, welche zum Löschen des Kalkes angewendet wird, zu gross, so wird er ersäuft. Das Ersäufen erfolgt durch den Mangel an Hitze beim Löschen, welche des zu vielen Wassers wegen den nöthigen Grad nicht erlangen kann. Die Kalktheilchen werden hierbei zu weit voneinander entfernt. In diesen beiden Fällen wird der Kalk untauglich. … Das Löschen des Kalkes geschieht mit Hülfe der Kalkkrücke; das Resultat des Löschens ist eine weisse Flüssigkeit. Diese lässt man in eine Grube, die Kalkgrube, deren Seitenwände aufgemauert oder mit Brettern ausgestellt sind, dadurch abfliessen, dass der in der Kalkbank angebrachte Schieber geöffnet wird. Hier verdunstet das überschüssige Wasser, zieht auch zum grösseren Theil in das Terrain ein, und die beim Löschen noch unaufgeschlossenen Kalktheilchen lösen sich vollständig auf. Der in der Grube sich befindende anfangs dünne Kalkbrei verdickt sich hierdurch und ist, nachdem er gesunken und durchgehende Risse bekommen hat, zur weiteren Bearbeitung als Mörtel geeignet. Die Kalkgruben sind vor dem Eindringen des Regens etc. durch Schutzdach möglichst zu sichern, und werden, damit die der Luft und ihrer Kohlensäure ausgesetzte Oberfläche der Kalkmasse möglichst klein werde, so tief angelegt, dass der Kalkschläger den Kalk bequem ausstechen und in die Kalkbank werfen kann… Gut aufbewahrt kann der gelöschte Kalk lange in Gruben liegen bleiben, was ihm niemals schadet, nur muss man denselben oben etwa 20 Centimeter (8 Zoll) hoch mit frischem Sande überschütten, sobald er genügend eingetrocknet ist. Dieses Bedecken muss erfolgen, weil er sonst Kohlensäure aus der Luft anzieht, wodurch die obere Schicht trocknen und erhärten würde…“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Abbinden An der Luft bindet der Löschkalk unter Aufnahme von Kohlenstoffdioxid wieder zu Kalziumkarbonat ab, womit sich der technische Kreislauf schließt.
Der Vorgang des Abbindens kann durch den geringen CO2- Gehalt der
Luft, die Materialfeuchte sowie die entstehende Sinterschicht sehr lange
dauern.
Dabei binden Grau- und Schwarzkalke mit ihrem hohen Eigengehalt an Kohlenstoff deutlich schneller ab. Hydraulkalke (sogenannte Puzzolane, zementähnliche Kalke, sowie Kalke, die mit porösen Anteilen angereichert sind, welche Luft speichern oder Wasser aufsaugen) härten auch im feuchten Milieu, manche sogar unter Wasser aus. Gibt man zum Löschkalk Sand hinzu, erhält man Kalkmörtel, einen der ältesten Baustoffe überhaupt. Der abgebundene Kalk bildet dabei das Bindemittel zwischen den Sandkörnern, so daß sich die Masse wie in einem Sandstein verfestigt. Der zudem noch weitaus billigere Sand sorgt mit einem Gerüst aus Quarzkörnern für höhere Druckfestigkeit und reduziert zugleich den Bedarf an Bindemittel. Auch das Karbonat besitzt ein höheres spezifisches Gewicht, als der Löschkalk im Mörtel. Dies muß aber nur noch den Architekten und den Statiker kümmern, weil das fertige Mauerwerk ja keiner mehr transportieren will.
Daneben fand und findet Kalk bis heute vielfältige Anwendung. P. Loeff zählt bereits 1873 auf: „Der gebrannte Kalk dient in der Landwirthschaft als Düngemittel... Der Kalk begünstigt und erleichtert die Zersetzung kieselsaurer Thonerde- Verbindungen und beschleunigt den Uebergang der für die Vegetation so wichtigen alkalischen Stoffe aus den Mineralien in den Boden. … Von grosser Wichtigkeit ist ferner der gebrannte Kalk für viele Industriezweige. Er dient als Zuschlag beim Verschmelzen der Erze, ferner zur Glasfabrikation, zur Bereitung von Soda, von Seifensiederlaugen, zur Umstellung von Ammoniakflüssigkeit und Chlorkalk, auch zum Läutern des Rübensaftes, zum Raffiniren des Zuckers, zur Gerberei, zur Fabrikation künstlicher Mineralwässer und als Desinfectionsmittel.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der natürliche Kalkkreislauf Ähnliche Reaktionen können auch unter natürlichen Bedingungen stattfinden und sind für die Verwitterung einerseits und für die Neubildung sedimentärer Kalksteine andererseits verantwortlich. Sie laufen umso schneller ab, je mehr Kohlendioxid im Grundwasser gelöst ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Prozeß der Lösung des Kalziumkarbonats basiert auf folgenden chemischen Reaktionen. Zunächst benötigen wir natürlich das Lösungsmittel Wasser und das Kohlendioxid. Letzteres löst sich wie alle Nichtmetalle mehr oder weniger gut im Wasser und bildet dabei eine Säure:
Die Kohlensäure dissoziiert natürlich in der Lösung. Dabei wird jedoch nur ein Proton abgegeben und es bildet sich das Hydrogenkarbonation:
Genau wie das Karbonation CO32- reagiert auch das Hydrogenkarbonation in wäßriger Lösung wie eine schwache Säure. Da das Kohlendioxid bei veränderten physikochemischen Bedingungen aber jederzeit als Gas aus der Lösung entweichen kann, bildet sich auch ein Lösungsgleichgewicht in die andere Richtung aus:
Deshalb
reagieren Hydrogenkarbonate amphoter und bei Zugabe einer stärkeren Säure (zum Beispiel
Salzsäure) wie eine schwache Base. Mit den Hydroniumionen setzen sie sich sofort wieder
zu Kohlendioxid und Wasser um (Neutralisation):
Diese Reaktion ist im Übrigen ein einfacher Nachweis für Karbonationen, mit Aufschäumen von Gasblasen verbunden und beim Kalkstein besonders heftig. Ein Test mit Salzsäure wird von Feldgeologen nach wie vor zur Erkennung des Gesteins genutzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jetzt trifft solches,
kohlensäurehaltiges Grundwasser auf Kalkstein. Kalziumkarbonat ist in
reinem Wasser sehr schwer löslich. Dabei dissoziiert eigentlich nur ein
kleiner Anteil (Löslichkeit 14 Milligramm pro Liter unter
Normalbedingungen) in die Ionen:
Kommt nun aber
Kohlensäure ins Spiel, wird das Gleichgewicht unter Bildung von
Hydrogenkarbonationen auf die rechte Seite der Gleichung verschoben und
damit der Prozeß der Karbonatlösung verstärkt:
Die Hydrogenkarbonate der Erdalkalimetalle sind im Gegensatz zu ihren Karbonaten allesamt in Wasser gut löslich, stehen aber über das Dissoziationsgleichgewicht der Kohlensäure in Beziehung zu den entsprechenden Karbonaten, die durchweg schwer löslich sind. Um das Löslichkeitsprodukt der Karbonate nicht zu überschreiten, muß der pH-Wert der Lösung hinreichend niedrig sein, was durch die Anwesenheit einer Mindestkonzentration an freier Kohlensäure, also an gelösten Kohlendioxid, gewährleistet ist. Diese bezeichnet man auch als zugehörige Kohlensäure. Es ist daher (unter normalen Laborbedingungen) auch nicht möglich, die Hydrogenkarbonate der Erdalkalien als Feststoffe herzustellen. Beim Einengen der Lösungen werden immer die Karbonate gebildet.
Verschiebt sich
das chemische Gleichgewicht erneut, zum Beispiel wenn das Grundwasser als
Quelle zutage tritt und die zugehörige Kohlensäure als Kohlendioxidgas entweicht, kehrt sich das
Gleichgewicht mit dem schwerlöslichem Karbonat wieder um (Fällung):
Diese Prozesse führen also einerseits zur allmählichen Auflösung von Kalksteinen im Kontakt mit dem Grundwasser (Verkarstung) und andererseits zur Ausfällung des gelösten Karbonats bei veränderten physikochemischen Bedingungen. Das Lösungsgleichgewicht kann sich auch durch biologische Kohlendioxidbindung im Wasser, z. B. durch die Photosynthese von Algen, auf die Seite des ausgefällten Karbonats verschieben. Interessanterweise können bereits kalkgesättigte Lösungen durch Mischungskorrosion von neuem aggressiv werden. Dieser Effekt der Mischungskorrosion erklärt erst, warum die im Karstgebirge beobachteten großen Lösungshohlräume nicht an der Eintrittsstelle des Wassers, sondern im Innern des Gebirges zu finden sind. Es ist ein „Paradoxon der Mischungskorrosion“, daß umso mehr Kalk zusätzlich gelöst wird, je höher die Konzentration des kalkreicheren Ausgangswassers bereits war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durch die Fällung des Karbonats werden verschiedene sedimentäre Gesteine neu gebildet, wie „Seekreide“, „Quell“- oder „Kalk-Tuff“ und der relativ harte, aber sehr poröse Travertin. Auch die Tropfsteine der Besucherhöhlen verdanken ihre Entstehung diesen chemischen Reaktionen. Da sich dieses Gleichgewicht auch beim Erwärmen stark auf die rechte Seite verschiebt, ist es außerdem für die Bildung von Kesselstein verantwortlich.
Bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Produktion und zum Absatz
der Kalkwerke
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Verarbeitung von Kalkstein zu einem formbaren Baustoff gehört zu den ältesten und bis heute bedeutendsten technischen Produktionsverfahren. Die ältesten Zeugnisse der Kalkherstellung für die Verarbeitung in estrichartigen Böden von Kultanlagen stammen aus dem Bergtempel vom Göbekli Tepe in Anatolien und sind 11.000 Jahre alt. Bedarf für Kalkmörtel bestand natürlich auch in unserer Region schon in der Besiedlungsperiode ab dem 12. Jahrhundert, als am Nordrand des Erzgebirges zahlreiche Klöster und Kirchen, Burgen und Stadtmauern errichtet wurden. Aus dieser Zeit existieren jedoch praktisch keine Unterlagen mehr.
Früher als in anderen deutschen Staaten
begann im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts in Sachsen die
Industrialisierung. Nach der bürgerlichen Revolution 1848 / 1849 setzte
eine weitere Gründerwelle ein. Obwohl die nationalstaatliche Zielsetzung der
Revolution mit ihren grundsätzlichen Anliegen noch scheiterte und in eine
Periode der politischen Reaktion mündete, setzte sich mit ihr das
wohlhabende Bürgertum als Machtfaktor neben der Aristokratie aber in
Deutschland mehr und mehr durch. In der Folge kam es auch zu grundlegenden
Modernisierungen des
Die sogenannte Gründerzeit nach dem Deutsch- Französischen Krieg 1870 / 1871 dauerte bis zum „Gründerkrach“ (der große Börsenkrach von 1873) an. Im historischen Sinn werden nur die ersten Jahre nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 als Gründerzeit bezeichnet, in denen Deutschland vor allem auf Basis der französischen Reparationszahlungen einen vorher nicht gekannten Boom erlebte. Das beförderte natürlich auch den Absatz von Branntkalk für Bauzwecke aus den einheimischen Kalk- und Marmorlagerstätten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Aufschwung wurde noch dadurch befördert, daß von 1866 bis 1889 zahlreiche Neben- und Kleinbahnen auch im Erzgebirge gebaut wurden, was den Kalkabsatz wesentlich erleichterte, da viele Werke nun in Bahnnähe zu liegen kamen. Solche (Schmalspur-) Bahnstrecken verliefen auch entlang des Tales der Kleinen Triebisch und verbanden Wilsdruff und Mohorn. Daraus resultierte umgekehrt aber auch ein schwerwiegender Nachteil, denn damit verloren vor allem kleinere Gruben mit komplizierteren Abbaubedingungen nun schnell ihren Standortvorteil der geringeren Transportkosten im näheren Umfeld gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Doch wurden jetzt auch abgelegene, kleine und kleinste Vorkommen genutzt und selbst schon auflässige Werke – teils auch aus spekulativen Gründen – wieder aufgenommen. August Rothpletz beschrieb in Zusammenhang mit dem Steinkohlenbergbau bei Hainichen („Geschichte des Kohlenbergbaues bei Hainichen“ in den Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte des Königreichs Sachsen, Blatt 78, Sektion Frankenberg- Hainichen), die Situation während der Gründerzeit so, daß mit der Reichsgründung 1871 „...sich allerwärts ein reger Unternehmungsgeist nur zu oft in die aussichtlosesten Gründungen stürzte...“ Mit Beginn des 20. Jahrhunderts begann daher eine Schließungswelle, die in erster Linie die kleinen, gewerblichen Gruben betraf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Produktion einzelner Werke im Triebischtal In einem Gutachten stellten Prof. Wunder, Chemnitz sowie die Mitautoren A. Herbrig und A. Eulitz die Gesamtproduktion der sächsischen Kalkwerke im Jahre 1867 zusammen. Demnach hätten im Zeitraum 1863 bis 1864 im Triebischtal zwei übertägige und fünf untertägige Kalksteinbrüche bestanden, welche über insgesamt 13 Kessel- oder Schüttöfen (also Niederschachtöfen vom Schneller- Typ) verfügten. Alle zusammen hätten eine jährliche Förderung von 967 Ruthen Kalkstein aufzuweisen, wovon etwa 300 Ruthen an umliegende Hüttenwerke als Rohkalk abgegeben wurden. Aus den übrigen 667 Ruthen wurden 54.800 Scheffel Branntkalk erzeugt. Im Vergleich mit der Gesamtproduktion Sachsens von 27.156 Ruthen Kalk und 2.105.100 Scheffel Branntkalk im gleichen Zeitraum erweist sich das Triebischtal alsp als eine Region mit einer eher geringen Produktionsmenge. Im Jahrgang 1864, Heft 45, vom 4. November d. J. der Wochenschrift Preußisches Handelsarchiv finden sich im Kapitel „Jahresbericht des Kgl. Sächsischen Handels- und Gewerbekammer zu Dresden für 1863“ ab S. 437 die Angaben, daß die Zahl der Kalkbrennereien 1863 in Sachsen 56 mit 420 Arbeitern betragen habe und „…sind besonders das Triebischthal (Miltitz, Munzig, Groitzsch, Burkhardtswalde), das Müglitzthal (Maxen, Nenntmannsdorf), dann die Pläner und Zechsteinkalke in Weinböhla und Ostrau, endlich Hermsdorf, Blankenstein und Tharandt zu nennen. Für den Export (aus Sachsen) kommen eigentlich nur die Urkalke von Miltitz in Frage, welche von Meißen aus in einem Quantum von jährlich durchschnittlich 108.000 Ctr. (also zirka 5.400 t) für chemische Fabriken, Eisen- und Glashütten stromauf bis Außig (Usti nad Labem), stromab bis Magdeburg verschifft werden.“ Diese uns heute nicht sehr bedeutend erscheinende Menge sollte uns aber auch Folgendes zu denken geben: Zumindest bis zum Anleger am Elbufer mußte diese Menge – vor der Erfindung von Eisenbahn und LKW – nämlich ausschließlich mittels Pferdefuhrwerken transportiert werden. Nun lag die Ladekapazität eines zweispännigen Fuhrwerkes aber kaum höher, als bei anderthalb bis bestenfalls 2,5 Tonnen. Wollte man also die oben genannten 5.400 t von Miltitz nach Meißen „kutschieren“, erforderte dies auch rund 3.600 Fuhren ! Oder anders gerechnet: Täglich mußten bis zu zehn Fuhrwerke schwer beladen das Triebischtal abwärts fahren ! Aus diesem Grund verfügten Kalkwerke gewöhnlich über sogenannte „Ausspannen“, in denen die Fuhrleute ihre Tiere versorgen, essen und trinken und gegebenenfalls auch nächtigen konnten. Oftmals wurden von den Grundherrschaften die eigenen Bauern zu den Spanndiensten verpflichtet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon immer wurde hinsichtlich des Ausbringens geklagt, daß „die Kalkwerke …unter dem Wettbewerbe des böhmischen und schlesischen Kalkes litten.“ (Jahrbuch 1901) „Die Unternehmer dieser Werke haben gegen den außersächsischen Wettbewerb schwer zu kämpfen. Die schwierigere und daher mehr Arbeitskräfte und Löhne erfordernde Gewinnung und Förderung und die in den geologischen Vorkommen beruhende verhältnismäßig enge Begrenzung des abbauwürdigen Kalksteins sind hauptsächlich die Ursachen zu der wenig günstigen Lage.“ (1906) „Die Kalkwerksbesitzer beklagen sich bitter darüber, daß sogar zu sächsischen Staatsbauten fast ausnahmslos ausländischer Kalk verwendet werde.“ (Jahrbuch 1907) Es war deshalb unumgänglich, sich konkurrenzfähige Produkte einfallen zu lassen: „...diesen Erfolg (hat man) trotz des immer noch bestehenden Wettkampfes mit billigem außersächsischem Kalke nur dem Umstände zu verdanken, daß neues Betriebskapital zur Errichtung von mehreren Aufbereitungsanlagen verwendet worden ist. In diesen wird einerseits entweder Rohkalk oder gebrannter Kalk zu Dünge- und Bauzwecken ganz fein gemahlen, andererseits Rohkalk zwecks Herstellung von Terrazzomaterial zu Körnern verschiedener Größe zerkleinert. Diese besser konkurrenzfähigen Erzeugnisse erzielten gegen die Vorjahre einen höheren Verkaufswert.“ (Jahrbuch 1910) Terrazzo- Körnungen wurden zuerst von Böhme’s Kalkwerk in Herold produziert. Einen drastischen Rückgang verursachte dann der Ausbruch des Weltkrieges: „Der ausbrechende Krieg freilich brachte einen Umschwung und verminderte die Gewinnung, teils weil sich durch Einberufung zum Heere bei den meisten Werken die Mannschaftszahl stark verminderte, teils weil die Nachfrage ganz bedeutend nachließ.“ (Jahrbuch 1915) Dies ist auch für die Kalkwerke in Groitzsch und in Miltitz belegt. Insgesamt fielen die Beschäftigtenzahlen der gewerblichen Kalkwerke von 350 bis 430 Personen zwischen 1900 und 1905 auf nur noch 171 Arbeiter im Jahre 1916. Ein weiterer Rückgang wurde z. T. durch den Einsatz von Kriegsgefangenen in den Bergwerken abgefangen. Hinzu kamen aber weitere Kriegsfolgen: „Auch im Berichtsjahre klagten die Werke über zu geringe Absatzmöglichkeit wegen starken Mangels an Arbeitern, Fuhrwerken und Eisenbahnwagen, bei den Kalkwerken überdies noch wegen der Schwierigkeit, Kohlen für die Brennöfen heranzubekommen.“ (Jahrbuch 1917) Einen kurzzeitigen Aufschwung fand der Rohkalkabsatz dann nach dem Weltkrieg: „Die Nachfrage nach Rohkalk steigerte sich infolge Belebung der Eisen- und chemischen Industrie, während die Erzeugung gebrannten Kalkes wegen Minderabsatzes von Düngekalk an die Landwirtschaft einen Rückgang erfuhr.“ (Jahrbuch 1927) Er hielt aber nicht lange an, denn bereits in der Ausgabe 1929 liest man: „…Dieser Rückgang ist in der Hauptsache auf den geringen Rohkalkabsatz zurückzuführen, da besonders die Rohkalk verarbeitende Eisen- und chemische Industrie wegen des gestiegenen Preises je t – 12,32 RM gegen 7,56 RM im Jahre 1927 – ihren Bedarf vorzugsweise aus den schlesischen Tagebauen bezog.“ Ein erneuter Aufschwung in der Bindemittelindustrie war insbesondere der Kriegswirtschaft und dem intensivierten Autobahnbau zu verdanken, wie man im Bericht der Staatlichen Lagerstättenforschungsstelle für das Jahr 1934 / 1935 nachlesen kann: „Eine baldige Vervollständigung der Bestandsaufnahme der für Bauzwecke nutzbaren Gesteine (Hartsteine) liegt im Interesse des durch die Maßnahmen der Regierung stark belebten Straßenbaues (Autobahnen). Auch die Bestandsaufnahme der sächsischen Kalk-, Kaolin- und Tonvorkommen ist geplant und teilweise schon in Angriff genommen.“ Das Brennen des Kalkes erfolgte in Miltitz um die Wende zum 20. Jahrhundert in unterschiedlichen Öfen, darunter ein Schachtofen von 3 m Innendurchmesser und 16 m Gesamthöhe. In (40024-12, Nr. 292) findet sich eine Bauzeichnung für die Rekonstruktion dieser Ofenanlage aus dem Jahr 1909.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktionsmengen konnten bislang nur ansatzweise recherchiert werden. Die umfangreichsten Angaben haben wir dabei bisher für das von Heynitz‘sche Werk in Miltitz gefunden (10384, Nr. 215 bis Nr. 219). Eine Zeitlang führte man hier noch neben der Geldabrechnung auch zusammenfassende „Naturalrechnungen über den Kalkofen in Miltitz“. Schon vor der Einstellung des Faktors Lorenz war man (ab 1832) in der Buchführung dann zu „Reinertragsrechnungen für das zum Rittergute Miltitz gehörige Kalkwerk“ übergegangen. Es erweist sich heute als äußerst mühselig, diese monatlich geführten Abrechnungen (alles in allem etwa 1 lfd. Meter Akten) zu erfassen und es wird auch nicht genauer, will man die darin dokumentierten Erlöse wieder in erzeugte Mengen zurückrechnen. Hinzu kommt noch, daß bis zur Einführung des metrischen Systems teilweise recht ungewöhnliche Einheiten verwendet wurden. Deshalb beschränken wir die nachstehende Aufführung auf diejenigen Jahre, für die wir bislang Zusammenstellungen gefunden haben. Von Interesse für unsere weiter unten noch folgende Umrechnung sind außerdem folgende Angaben aus diesen Unterlagen: 1815 nämlich wird festgehalten, daß man „aus 1 Ruthe Rohkalk 38 Faß und 2 72/77 Kannen Kalk erzielt“ habe; nach dem Wechsel zum Dresdner Scheffel hält man dann im Jahr 1830 fest, daß 1 Ruthe Rohkalk 130 8/13 Scheffel Branntkalk ergeben habe. Nehmen wir also mal kühn an, daß sich
die Technologie und das Faß-Maß in diesen 15 Jahren nicht wesentlich
verändert haben, dann können wir daraus grob abschätzen, daß ein Faß etwa
3,43 Scheffel umfaßte. Da der Dresdner Scheffel seinerseits ein Volumen
von etwa 107,33 Liter faßte, müßte ein „Faß“ demnach eine Menge von zirka
368,14 Liter enthalten haben. Erst 1815 wurden im von Heynitz’schen Werk
die althergebrachten Einheiten „Faß“ und „Kanne“ durch den Dresdner
Scheffel ersetzt; die „Ruthe“ wurde sogar noch bis 1871 verwendet.
*) Wie noch ausführlicher zu lesen sein wird, wurde nicht die gesamte Förderung zu Branntkalk verarbeitet, sondern ein Teil auch als Rohkalk verkauft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dem Jahr 1863 liegt auch eine indirekte Information vor (siehe oben), daß zu dieser Zeit in Miltitz etwa 5.400 t Rohkalk pro Jahr gefördert wurden. Die erhalten gebliebenen Berichte des Gutsverwalters Born aus den Jahren 1863 bis 1865 (10384, Nr. 114) sind hinsichtlich des Kalkwerksbetriebes dagegen wenig aussagekräftig und wurden diesbezüglich erst umfangreicher, nachdem Herr Carl Heinrich Lorenz als Faktor des Kalkwerkes eingestellt wurde. Er rechnete 1864 zusammen, daß in den Jahren 1861 bis 1864 insgesamt 507 Ruthen Kalk gebrochen wurden, wovon 179 Ruthen (zirka 35%) gebrannt, der Rest von 328 Ruthen als „Kalkprodukte“ verkauft wurden. Die Gestehungskosten lagen 1864 in Miltitz je Ruthe für:
Faktor Lorenz vermerkt 1864 auch: „Die Preise des gebrannten Kalkes bei den Nachbarwerken Schmiedewalde, Burkhardswalde und Groitzsch sind durchgängig gleich und betragen pro Scheffel 10,1 Mark.“ Kartellabsprachen gab es zu dieser Zeit gewiß noch nicht...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Jahrbuchausgaben findet man Angaben zu den Produktionsmengen der Kalkwerke in Sachsen aus den oben angeführten, bergrechtlichen Gründen erst ab 1900 (und bis 1937) und nur als Zusammenstellung für alle gewerblichen Gruben. Damit ist die Betriebszeit der Kalkwerke im Triebischtal, die überwiegend vor 1920 zu Ende ging, nur noch zum kleinen Teil erfaßt. Wir haben die Angaben trotzdem einmal in grafischer Form aufbereitet. Eine Aufstellung der Berginspektion III in Freiberg, welche ab 1900 zur Beaufsichtigung der gewerblichen Grubenbetriebe eingerichtet, allerdings bereits 1903 wieder aufgelöst worden ist, für die betreffenden Ausgaben der Jahrbücher für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen nennt uns dann noch die folgenden Zahlen für die Kalkwerke in Miltitz und Groitzsch (40024-12, Nr. 15):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für das Kalkwerk Kippe in Groitzsch gibt es eine Angabe im Bericht zur Fabrikrevision aus dem Jahr 1895, die besagt, daß bis zu dieser Zeit in Groitzsch zwischen 30.000 und 50.000 Zentnern, also rund 1.500 t bis 2.500 t jährlich gefördert wurden (40024-12, Nr. 134).
Für das in dieser Zeit zur Herrschaft
Taubenheim gehörige Kalkwerk in Burkhardswalde sind aus dem Zeitraum 1849
bis 1851 die Berichte des Gutsverwalters Leberecht Ernst Dietze an den damaligen
Daraus wurde Branntkalk produziert in einer Menge von:
Aus dem Verkauf des Branntkalkes, von Rohkalk und Kalkasche erzielte man 1850 in Burkhardswalde einen Erlös von 1.692 Mark, 16 Groschen und 7 Pfennigen bei Kosten von 1.455 Mark und 1 Groschen. In den Kosten waren 1850 auch rund 194 Mark für den begonnenen Stollnbau enthalten. Für den Zeitraum des ersten Halbjahres 1851 weist die Bilanz für den Besitzer Töpolt Einnahmen aus dem Kalkwerk in Höhe von 1.168 Mark, 1 Groschen, 2 Pfennigen bei Kosten von 1.308 Mark, 23 Groschen und 8 Pfennigen aus. In den Kosten dieses Jahres sind aber wieder 354 Mark für den Stollnbau enthalten, den der Verwalter Dietze selbst so einschätzt: „Der für einen künftigen zweckmäßigeren Betrieb unternommene Stollenbau dürfte zu sistieren sein...“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anmerkungen zu den Maßeinheiten Die Fördermengenangaben in der Einheit Ruthe machten uns einiges Kopfzerbrechen. Um es unseren Lesern etwas leichter zu machen, hier ein paar Berechnungen dazu: Die Rute oder Ruthe ist nämlich eigentlich ein Längenmaß, welches je nach Region und Verwendung (Straßenrute, Feldmesserrute) zwischen 12 und 16 Fuß umfaßte. Aufgrund der unterschiedlichen Fußmaße vor der Einführung des metrischen Systems resultieren daraus Längen zwischen 3,5 m und bis zu 7 m, meistens jedoch um 4,6 m für eine Ruthe. Bei Wikipedia haben wir folgende Angaben für Sachsen gefunden:
Letztere ist durchaus in Betracht zu ziehen, denn in den 1860er Jahren war der Besitzer des Miltitzer Kalkwerkes, Rudolph von Heynitz, nicht nur Herr auf Königshain und Miltitz, sondern nebenbei auch Preußischer Leutnant. Als Volumenmaß ist die Ruthe dagegen zumindest ungewöhnlich. Man findet jedoch auch die Begriffe „Steinrute“ und „Bergrute“, welche wiederum zwischen 7 m³ und bis zu 25 m³ fassen können. Unter Verwendung einer preußischen Ruthe hätte eine Kubik-Ruthe sogar ein Volumen von:
Die sogenannte Schachtrute (oder auch Schachtwerk) war dagegen ein im deutschen Raum durchaus gebräuchliches Volumenmaß für Baustoffe, wie Sand, Kies und Steine; sowie ein Maß für den Aushub beim Bau und bei Erdarbeiten – diese Einheit kam hier wohl am wahrscheinlichsten zur Anwendung. Dabei wurden eine Fläche von einer Quadratrute und eine Höhe eines Schachtfußes (oder Schachtschuhes) oder auch eines Schachtzolls angesetzt. Das resultierende Volumen richtete sich natürlich wieder nach der jeweils regional geltenden Längenrute (bzw. den Fußmaßen). Die Schachtrute war deshalb regional genauso sehr verschieden und in der metrischen Umrechnung resultieren Werte zwischen ≈ 4,5 und bis zu 6,5 Kubikmeter. Für Preußen galt beispielsweise:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Dichte von Kalksteinen liegt zwischen 2,45 und 2,90 t/m³ (nach J. Schön, Petrophysik, 1983); im Mittel bei zirka 2,7 t/m³. Metamorphe Kalksteine und Marmore besitzen dabei die höheren Werte. Gebrochen (stückig) besitzt Kalkstein Schüttdichten zwischen 0,96 t/m³ und 1,36 t/m³. Mit dem etwas größeren Wert für den metamorphen Kalkstein aus Miltitz könnten aus den oben angegebenen Volumina für:
für die Menge einer (Kalk-) Ruthe resultieren. Diese Berechnung können wir auch mit den für die Förderung des Miltitzer Werkes aus dem Jahr 1863 vorliegenden Zahlenangaben vergleichen. Der Faktor Lorenz notierte in diesem Jahr eine Förderung von 62 Ruthen und im Jahresbericht des Kgl. Sächsischen Handels- und Gewerbekammer zu Dresden auf das gleiche Jahr konnten wir lesen, daß 108.000 Zentner (unter Verwendung des metrischen Zentners also 5.400 Tonnen) verschifft worden wären. Dividiert man die letzte Zahl durch die erstgenannte, erhält man den Wert von:
...was zwar von den oben ermittelten Werten nochmals abweicht, aber zumindest einigermaßen zum Volumen einer Kubikruthe paßt. Mit diesem, uns am plausibelsten erscheinenden Faktor haben wir auch die Zahlen aus der Tabelle oben in die in der Grafik unten dargestellten Werte umgerechnet. Anmerkung zur Anmerkung: Um die Verwirrung aber noch größer zu machen, sei an dieser Stelle erwähnt, daß wir in den Abrechnungen für das Jahr 1864 (10384, Nr. 218) noch eine weitere, natürlich wieder völlig abweichende Angabe gefunden haben: Faktor Lorenz nämlich bezieht darin in einem Nebensatz „die Ruthe auf 500 Centner“. Wenn dies nun wiederum zuträfe, hätte also – den metrischen Zentner vorausgesetzt –
Noch eine andere Angabe haben wir in Gürtler, 2006, über den Kalkabbau in Hintergersdorf bei Tharandt gefunden. Demnach war in einem Vertrag zwischen dem Grundbesitzer Tamme und dem Bergwerksbesitzer F. Keil im Jahre 1856 der Grundzins mit 4 Taler pro Ruthe Kalk vereinbart und die Ruthe hierin mit 24 Ellen Länge, 3 Ellen Breite und 2 Ellen Höhe (entspricht 144 Kubik- Ellen) festgesetzt. Das entspräche einem Volumen von zirka 26,2 m³ bzw. einer Masse von etwa 34 Tonnen. Bei unseren Rechnungen ist allerdings immer zu bedenken, daß es wohl kaum machbar ist, einen „Quader“ aufzuschütten und man sich wohl eher einen „pyramidenstumpfförmigen Haufen“ vorstellen muß. Bei den Recherchen zu weiteren Beiträgen ist uns dann wieder eine weitere Angabe untergekommen: Von Wunder, Herbrig und Eulitz, 1867, wurde die Ruthe nämlich ‒ jedoch nur auf den fiskalischen Kalkwerken ‒ einheitlich zu 54 Kubik- Ellen berechnet. Das vereinfacht die Umrechnung aber auch nicht wirklich, denn allein die in Sachsen gebräuchlichen Längenmaße einer Elle schwankten zwischen 0,5 m und 0,8 m. Immerhin wurde jedoch 1854 die Dresdner Elle gesetzlich mit 0,56638 m Länge festgelegt. Daraus würde nun für 54 Kubik- Ellen ein Volumen von rund 9,81 m³ und mit o. g. Schüttdichten folglich eine Masse für eine Ruthe Kalk zwischen 9,4 t und 13,3 t resultieren. In einer Akte mit verschiedenen ,Notizen über Kalkbruchbetriebe' aus dem Nachlaß von Carl Hermann Müller haben wir einen Notizzettel gefunden, auf dem Umrechnungen verschiedener Maßeinheiten notiert sind (40024-12, Nr. 15/1, ohne Paginierung, Filmbildnummer 0137 des Digitalisates). Demnach gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeitgleich noch „große“ und „kleine 8-ellige Ruthen“ sowie „kleine 6-ellige Ruthen“. Die hier dafür festgehaltenen Volumina von 288, 96 und 54 Kubik- Ellen finden wir auch in nachfolgender Tabelle wieder, woraus zu ersehen ist, daß auf den fiskalischen Kalkwerken die kleinste davon inzwischen die Regel bildete. Die größte Ruthe dagegen, die aber noch gar nicht die allergrößte gewesen ist, haben wir noch 1799 in Hermsdorf und 1821 in Zitschewig in Benutzung gefunden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Autoren Wunder, Herbrig und Eulitz führten glücklicherweise auch einen Vergleich auf, wie unterschiedlich die Ruthe in den Kalkwerksbetrieben um die Mitte des 19. Jahrhunderts gehandhabt wurde, die uns nun endlich etwas Erleuchtung bringt:
*) Angaben aus dem Jahr 1867 entstammen dem Kalkwerksbetrieb Sachsens von Wunder, Herbrig und Eulitz, zu den Angaben aus anderen Jahren siehe die betreffenden Beiträge zum angegebenen Standort. Die Schwankungsbreite dessen, was man beim Kauf einer Ruthe Kalk erhielt, von reichlich zwei bis über achtzig Tonnen ist unerklärlich und überraschend groß; selbst wenn man bedenkt, daß der Plänerkalk vielleicht eine geringere Dichte besitzt, als ein kristalliner Marmor, wie der Miltitzer, was wir hier nur über die Streubreite der Schüttdichten berücksichtigt haben...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere oben vorgenommen Berechnung von rund 70 bis 80 Tonnen für eine Kalkruthe trifft tatsächlich auch zu, jedoch nach dieser Quelle nur auf die Plänerkalksteinbrüche unweit Meißens. Nun ist Miltitz von Meißen kaum weiter entfernt, als Weinböhla ‒ trotzdem war das Maß ein ganz anderes und kam der Angabe von Faktor Lorenz aus derselben Zeit „die Ruthe auf 500 Centner“ recht nah. Auch die Autoren des Berichtes von 1867 untersuchten sowohl das spezifische Gewicht, als auch die tatsächliche Masse des in den verwendeten Volumenmaßen enthaltenen Kalksteins. Bei einer Dichte der Kalksteine von 2,7 bis 2,8 t/m³ und der Dolomite zwischen 2,8 und 3,0 t/m³ kamen sie auf folgende Gewichtsmaße für lufttrockene, gebrochene Steine.
Nicht umsonst wurden die Kunden des Kalkwerkes Miltitz schon seit 1819 darauf hingewiesen, daß Branntkalk zwar im (immerhin ja schon „normierten“) Dresdner Scheffel abgemessen werde, aber jeder bei Beladung oder Lieferung selbst sofort nachzuprüfen habe; anderenfalls keine Beschwerden angenommen würden. Bei 24 bis 30 Ruthen gebrochenen Kalksteins pro Jahr hätte die Fördermenge des Burkhardswalder Kalkwerkes in den Jahren 1849 und 1850 unter Verwendung der Schachtruthe (rund 6 t) also nur zwischen zirka 144 t und 180 t betragen; unter Verwendung einer Kubikrute mit rund 80 t dagegen zwischen 1.920 t und 2.400 t. Letzteres erscheint uns plausibler, wenn wir dem die Angaben zur Branntkalkproduktion derselben Jahre gegenüberstellen. Diese Mengenangaben erfolgen in den Berichten des Gutsverwalters nun dummerweise wieder in einer anderen Einheit, nämlich in Scheffeln.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Scheffel war im Gegensatz zur Schachtrute ein weit verbreitetes Raummaß, was leider ebenso zur Folge hatte, daß eine Unzahl verschiedener Maße existierten; gleichzeitig galten für den Scheffel auch noch bestimmte Mindestgewichte. So galten z. B. in Preußen folgende Mindestgewichte eines Scheffels:
Der deutschen Kleinstaaterei vor 1871 geschuldet gibt es eine Unmenge verschiedener Umrechnungen der historischen Volumenangaben. Bei Wikipedia haben wir nur allein für Sachsen ein paar Angaben zum Vergleich mit einem Preußischen Reichsscheffel (= 54,91 Liter) herausgesucht:
Nehmen wir für den Dresdner Raum vereinfachend einmal ein Maß von rund 100 Litern für einen Scheffel an. Dieses Volumenmaß erscheint auch deshalb wahrscheinlich, weil bis zur heutigen Zeit Mengenangaben von Schüttgütern oft auch in der Einheit hl (Hektoliter) erfolgen. Auch der Bergmeister Seemann notierte in einer Fabrikrevision zum Werk in Groitzsch im Jahr 1900, daß hier jährlich etwa 19.000 hl gebrannter Kalk produziert würden, also 1.900 m³. Inzwischen haben wir auch herausgefunden, daß bereits mit einer Generalverordnung des Fürstenhauses vom 7. Dezember 1803 in Sachsen das Dresdener Scheffelmaß auf allen Kalkwerken als Volumenmaß für den Branntkalkverkauf verbindlich angeordnet worden ist (10036, Nr. 63333 und 10036, Loc. 35306, Rep. 02, Lit. K, Nr. 0103).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dem Scheffel entsprach wohl ungefähr auch die ältere Einheit der Tonne, welche etwa im 16. und 17. Jahrhundert sowohl für den gebrochenen Kalkstein, als auch für den gebrannten Kalk Verwendung fand. Auch dabei handelte es sich um ein altes Raummaß, welches mit der heutigen, metrischen Gewichtseinheit der Tonne nichts zu tun hatte. Aus einem geognostischen Untersuchungsbericht über das Kalkwerk in Hermsdorf im Osterzgebirge aus der Hand von Sigismund Wolfgang August Freiherr von Herder aus dem Jahr 1799 (40003, Nr. 7A, Blatt 296ff) haben wir erfahren, daß (damals und zumindest dort) eine ,Tonne' 3 Viertel und 2 Metzen enthielt. Eine sächsische ,Metze' wiederum enthielt 6,489 Liter, ein ,Viertel' hielt gewöhnlich 4 Metzen (wikipedia.de); demnach hätte die in Hermsdorf Ende des 18. Jahrhunderts noch als Raummaß für den gebrannten Kalk verwandte Tonne also 14 Metzen oder 90,846 Liter Fassungsvermögen aufgewiesen. Das kommt dem später üblicherweise nur noch für den gebrannten Kalk verwendeten Scheffelmaß recht nahe. Die Schüttdichte ist natürlich von der Körnung des Fertigprodukts abhängig (Die Dichte des festen Kaliziumoxids liegt bei 3,3 t/m³). Bei heutigen Herstellern haben wir in Produktdatenblättern für gemahlenen Branntkalk Werte zwischen 0,88 t/m³ und bis zu 1,20 t/m³ gefunden, woraus sich eine Jahresproduktion zwischen 1.672 t und 2.280 t Branntkalk in Groitzsch ergäbe. Diese Zahlen passen ganz gut zu den 1895 genannten Produktionsmengen zwischen 1.500 und 2.500 t. Der Verkauf an Branntkalk des Werkes in Burkhardswalde betrug in den beiden Jahren 1849 und 1850 zwischen 4.147,0 und 5.200,75 Scheffel; unter Ansetzung einer Schüttdichte vom 1,2 t/m³ demnach also zwischen etwa 498 t und 624 t. Aus diesen Zahlen folgt zwingend, daß die Förderung nicht bei lediglich 180 Tonnen gelegen haben kann, was wiederum unsere oben vorgenommene Abschätzung des Maßes der Kalkruthe von 72 bis 87 Tonnen unterstützt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem wir nun ausführlich erläutert haben, wie wir zu mehr oder weniger fundierten Angaben in metrischen Maßen gekommen sind, stellen wir die Zahlen aus der Tabelle oben für das Miltitzer Werk noch einmal graphisch dar. In die darin ersichtlichen Schwankungen des Ausbringens gehen natürlich neben den historischen Randbedingungen auch andere Unterbrechungen, z. B. durch erforderliche bergmännische Arbeiten, wie etwa die Herstellung neuer Aus- und Vorrichtungsbaue, mit ein. Abgesehen von solchen immerwährenden Schwankungen kann die Angabe zur Förderung von 5.400 Tonnen pro Jahr aus dem Jahre 1863 demnach aber als – durchaus recht stabiler – Mittelwert für den Zeitraum zwischen 1785 und 1890 angesehen werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bleibt uns noch eine Angabe zur Neuzeit: Anhand der mittleren Bauhöhe und der Ausdehnung der Abbaufläche kann man schließlich noch abschätzen, daß das Miltitzer Neue Lager zirka 212.000 t Kalk enthielt; davon abzüglich erwarteter Abbauverluste von 30% etwa 130.000 t gewinnbar wären; wovon wiederum von 1924 bis zur Einstellung 1964 etwa 98.000 t tatsächlich gefördert wurden. Der höchste Wert wurde im Jahr 1947 mit etwa 12.000 t erreicht. Etwa die Hälfte der Jahresförderung wurde in Miltitz zu Branntkalk (bis zu 6.500 t jährlich) verarbeitet, der andere Teil als gemahlener Düngekalk oder als Zuschlagstoff an die Chemische Industrie und an die Stahl- und Eisenindustrie verkauft. Praktischerweise wurde das Kalkwerk zu diesem Zeitpunkt als Betriebsteil direkt den Ziegelwerken, zuletzt dann dem Stahlwerk – also auch den wichtigsten Kunden – angegliedert. Fassen wir zusammen,
was wir ermittelt haben:
*)
Dieses Verhältnis war uns Anlaß für eine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemerkungen zum Absatz Aus den Berichten des Faktors Lorenz des von Heynitz'schen Kalkwerkes sowie des Verwalters Dietze des Burkhardswalder Guts und Kalkwerkes geht auch hervor, wohin damals der Kalk verkauft und geliefert wurde. Diese Aufstellung ist hinsichtlich der Absatzwege der verschiedenen Werke durchaus interessant. Weil wir auch erst mal nach Orten, wie dem Rittergut Raußlitz oder den Ziegelwerken in Karcha suchen mußten, haben wir einfach mal bei Google Earth ein paar Häkchen gesetzt und die folgende Grafik erzeugt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu dieser Zeit bildete
der Transport
– insbesondere bei Massenrohstoffen, wie Kalk oder Kohle
– noch einen
beträchtlichen Kostenfaktor. Deshalb waren natürlich Abnehmer, wie die Potschappler Glaswerke ein
optimaler Handelspartner, konnte das Fuhrwerk auf dem Rückweg doch gleich
Steinkohle für die Kalköfen laden. Auch Burkhardswalde verkaufte
teilweise Kalk unmittelbar gegen Kohlenlieferungen
– gewissermaßen gegen Naturalien.
Das Werk in Burkhardswalde bezog die benötigte Steinkohle aus dem Kgl.
Steinkohlenwerk Zaukerode.
Durch die Lage des Miltitzer Werkes an der 1868 in Betrieb genommenen Bahnlinie Leipzig- Döbeln- Meißen- Dresden resultierten spätestens ab diesem Zeitpunkt natürlich noch weiter erleichterte Fernhandelsmöglichkeiten. Der Nahmarkt konnte dagegen durch die umliegenden kleinen Werke noch lange Zeit abgedeckt werden, bis die Erfindung des LKW´s auch diesem Standortvorteil endgültig den Garaus machte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur
Geschichte des Abbaus
Das von Heynitz'sche „Alte Kalkwerk“ in Miltitz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anhand der bisher durchgesehenen Akten ist nicht sicher belegbar, wann der Bergbau in Miltitz (jedenfalls vor 1571) tatsächlich begonnen hat. Indirekte Anhaltspunkte weisen darauf hin, daß er bereits um 1400 begonnen haben kann. Im Aktenbestand zur Grundherrschaft Miltitz (10384) im sächsischen Staatsarchiv läßt er sich etwa ab 1620 verfolgen. Noch bis 1770 wurde er aber nur als Nebenerwerb saisonal betrieben. Im Jahr 1779 übernahm Carl Wilhelm Benno von Heynitz das Rittergut Miltitz. Wie oben schon zu lesen war, hatte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Familie von Heynitz wichtige Funktionen im sächsischen Montanwesen inne und brachte damit umfangreiches Wissen über den Bergbau in die weitere Abbauführung ein. Zu dieser Zeit soll das Kalkwerk Miltitz das einzige in der Gegend um Meißen in Betrieb stehende gewesen sein. 1782 wurde ein „Akzisefixum“ für den hierin als „neuerrichtet“ bezeichneten Kalkbruch festgelegt (10384, Nr. 211). Bis 1810 war der Bruch zunächst verpachtet (10384, Nr. 205). Im Jahr 1811 übernahm die Familie von Heynitz den Kalksteinbruch dann in eigene Verwaltung (10384, Nr. 212). In der Zeit ab 1781 wurde in Militz nunmehr durchgehend Kalk gebrannt. Im Jahr 1810 wurde Branntkalk u. a. für den Bau der Festung Hartenstein nach Torgau geliefert. Erstmals 1809 nach Vermittlung des Meißner Kaufmanns Dreyßig und mindestens noch bis 1865 wurde ungebrannter Kalk auch als Zuschlagstoff zur Schmelze an die Gräflich Einsiedel'schen Eisenwerke in Gröditz und in Lauchhammer verkauft. Wenn W. Schanze schreibt, daß seit der Übernahme des Rittergutes und des Kalkwerks durch C. W. B. von Heynitz im Jahr 1779 in Miltitz „durchgehend Kalk gebrannt“ wurde, so bezieht sich dies auf die Jahre insgesamt. Tatsächlich wurden die Trichteröfen auch jetzt noch nur während der Sommermonate angefeuert. Im Jahr 1810 wurde z. B. 27 Wochen lang Kalk gebrannt, im Jahr 1815 wurden in 26 Wochen 46 Ruthen Rohkalk gebrannt, im Jahr 1825 brannten die Öfen 33 Wochen lang (10384, Nr. 215 bis Nr. 219). Ab 1815 lesen wir außerdem, daß das Kalkbrechen „im Gedinge“ erfolgte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie W. Schanze herausgefunden hat, verwies früher auch eine am Schachteingang angebrachte Gedenktafel auf einen Besuch Seiner Majestät König Johanns I. nebst sämtlicher Mitglieder des Kgl. Hauses im Bergwerk im Jahre 1856. Der Zeichner hat offenbar dieses Ereignis festgehalten. König Johann I. von Sachsen (*1801, †1873) kam 1854 durch den Unfalltod seines älteren, kinderlos gebliebenen Bruders Friedrich August II. überraschend auf den Thron. Die Justizreform von 1855, der Ausbau des Eisenbahnnetzes und die Einführung der Gewerbefreiheit sind hauptsächlich seiner Anregung und Förderung zu verdanken. Unter ihm wandelte sich Sachsen zu einem der modernsten deutschen Teilstaaten. Neben seiner politischen Arbeit beschäftigte sich Johann besonders mit Literatur. Unter dem Pseudonym Philalethes („Freund der Wahrheit“, daher auch sein Beiname „Der Wahrhaftige“) übersetzte er u. a. Dante's „Göttliche Komödie“ ins Deutsche. Die folgenden, alten Fotos erlauben uns einen Blick nach untertage während der letzten Betriebsphase und zeigen uns auch die Verarbeitungsanlagen des von Heynitz'schen Kalkwerkes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
Ein ähnliches Foto liegt im
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildquelle: Kunstverlag Brück & Sohn, Meißen,
Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Abbau auf dem liegenden Weißkalklager muß nach B. Cotta von der oberen Talschulter ausgehend im Steinbruch begonnen haben. Er schreibt 1834, daß „die 60 bis 70 Fuß hohe Felsklippe... durch einen früheren Tagebau gebildet worden ist und jetzt leider einzustürzen droht.“ Weiter findet sich der Hinweis, daß der Kalkstein an dieser Stelle „schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts (also um 1750) abgebaut (werde), zuerst steinbruchweise, jetzt unterirdisch durch Pfeilerbau...“ Das Weißkalklager muß folglich ursprünglich bis an die Talschulter hinauf angestanden haben; sonst wäre es auch schwer erklärbar, wie die Alten es eigentlich unter der Talsohle entdeckt haben konnten. Um 1800 muß man dann im Weißkalklager zum Tiefbau übergegangen sein, denn bereits 1817 war die Rösche bis zur Großen Triebisch angelegt und folglich stand mindestens die 2. Sohle schon in Abbau. Im 1819 erschienenen Band 6 des „Vollständigen Staats-, Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ wird der „Steinbruch nicht weit vom Dorfe“ erwähnt, der bereits eine „Höhle von 100 Schritt Länge und 12 Schritt Breite“ bilde und, wie B. Cotta 1834 schreibt: „...bei Fackelschein befahren einen großartigen Eindruck hervorbringt.“ Der Steinbruch liefere „eine Art Marmor, den man aber zu Kalk verbrennt. Doch bedient man sich seiner auch zum Bauen, da er sehr rein und fest ist.“ Aus dem „Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreiches Sachsen“ und zwar der Zweiten Lieferung, den Dresdner Kreisdirectionsbezirk enthaltend, von Albert Schiffner, gedruckt 1840 in Leipzig, erfährt man unter der Nummer 132 (S. 402) über das dazumal unter Verwaltung des Amtes Meißen stehende Dorf: „Miltitz… (unterm dasigen von Heinitzschen Rittergute, kirchlich unter Meißener Ephorie und herrschaftlicher Collatur, 1834 = 55 Häuser, wobei 1 Schule und 1 an der Triebsche isolirt stehende Mühle und 335 E.) hat bei 7 Gütern 15 ½ Hufen, trefflichen Obst- und Nußbau, und liegt anmuthig in einer Senkung der hohen Gegend 1 Meile südwestlich von Meißen am Freiberger Richtwege… Erwähnung verdienen… ein Hain von uralten Kastanienbäumen, und die lange schmale Höhle*), die sich vom Brechen des marmorartigen Kalksteines gebildet hat; dieser wird verbaut oder im Kalkofen gebrannt. Das auf Glimmerschiefer ruhende Kalklager, worüber man Hornblendeschiefer antrifft, enthält mitunter rothen Feldspath, Hornblende, Fettbol, Ochtan und asbestartigen Tremolit. Auch brechen in der Nähe Pechstein, Dach- und Fruchtschiefer…“ In der Fußnote liest man darüber hinaus nur: „*) Nicht selten wurde sie von Fremden mit Fackeln besucht.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnitt aus den Freiberger Gangkarten, welche im 19. Jahrhundert im Oberbergamt zu Freiberg zu Übersichtszwecken geführt wurden. Etwa derselbe Stand ist auch in deieser Quelle eingezeichnet. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044-2 (Generalrisse, Gangkarten), Nr. K19, Ausschnitt, Norden ist rechts oben. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im August 1867 bereiste der spätere
Lehrer für Mineralogie und Geognosie an der Bergschule zu Freiberg
(1881-1889), Friedrich August Frenzel, das Triebischtal und
berichtete darüber an die Geognostische Landesuntersuchungskommission in
Freiberg: „Im Triebischthale weitergehend, kommt man nun an das
Kalkwerk Miltitz. Dieses Kalklager ist höchst interessant in mehreren
Hinsichten, zunächst schon wegen der mit auftretenden anderen Gesteinen,
den Einschlüssen (schwer lesbar ?) Bruchstücken derselben im
Kalkstein und der dadurch und noch anderen (schwer lesbar ?) wegen
bedingten rätselhaften Entstehungsgeschichte.
Der Kalkstein wird unterirdisch und nach der Methode des Pfeilerbaues abgebaut, doch kann man schon am Tage die Gesteinsverhältnisse in drei Brüchen studieren. Im ersten und größten, nicht mehr gangbaren Tagebruch lassen sich die Lagerungsverhältnisse folgendermaßen darstellen (siehe nächste Seite).“ (40003, Nr. 285). Auf der Folgeseite hat A. Frenzel diese Skizze eingefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
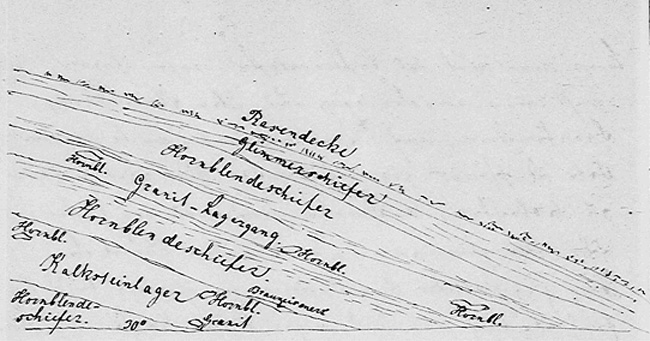 Skizze von A. Frenzel zum geologischen Aufbau des Hangenden des Miltitzer Kalksteinlagers, aus seinem Bericht über seine Reise im August 1867. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003 (Geognostische Landesuntersuchungskommission beim Oberbergamt), Nr. 285, Blatt 7, Rückseite. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiter schrieb er: „Aus was die Sohle
des Kalksteinlagers besteht, war lange Zeit eine offene Frage, es ist
Hornblendeschiefer, dessen Schichten ungefähr 30° einfallen. Darauf folgt
das Kalksteinlager mit Einschlüssen von Hornblendeschiefer und
Granitbruchstücken.
Das Kalklager hat eine mittlere Mächtigkeit von 30 Fuß. Der Kalkstein ist von graulich- gelblich- bläulicher oder röthlichweißer Farbe und kommen in ihm, Eisenkies ausgenommen, sonst keine Mineralien vor, sogar Kalkspathdrusen sind Seltenheiten. Über dem Kalkstein, gleichsam die Decke bildend, findet man wenig mächtige Lagen von Brauneisenerz, dasselbe ist meistentheils nur lehmig (schwer lesbar ?). Es folgt der Hornblendeschiefer, welcher im Großen (schwer lesbar ?) Lager bildet und eine Mächtigkeit bis zu 20 Fuß erhält. Derselbe ist von bräunlicher bis grünlicher Farbe... Im zweiten Bruche hat der (Kalkstein) die Gneisschichten nicht geradezu durchbrochen, wohl aber in nahezu verticale Stellung gebracht und theilweis, wo dieselben Widerstand leisten wollten, ohne Weiteres geknickt und verbogen. Nachstehende Zeichnung ist der Natur möglichst getreu entnommen. Was giebt man hierauf zur Antwort ? Der sedimentäre Kalkstein muß entweder durch eine plutonische Gewalt in diese Stellung gekommen sein, oder er hat bei seiner Umwandlung... sein Volumen vermehrt und an dieser Stelle seine Decke gehoben (haben)...“ (40003, Nr. 285).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verwunderlich ist auf den ersten Blick,
daß Frenzel von drei Brüchen sprach. Vermutlich meinte er mit dem „ersten
und größten, nicht mehr gangbaren Tagebruch“
denjenigen Steinbruch, aus dem heraus der Tiefbau angelegt worden ist. Mit
dem zweiten Bruch kann A. Frenzel eigentlich nur den Blauen
Bruch auf der Talschulter gemeint haben, welchen es demnach schon zu
dieser Zeit gegeben haben müßte.
Seine in obiger Skizze niedergelegten Vorstellungen zur Bildung des Lagers im Blauen Bruch oberhalb des im Tiefbau abgebauten Kalklagers erscheinen uns allerdings nicht zutreffend, zumal er hier von Gneis als Deckgebirge sprach, während er in der anderen Skizze ja Hornblendeschiefer als Liegendes und Hangendes des Kalklagers verzeichnet hat...
Da Herr Frenzel im Sommer 1867 das Triebischtal talabwärts
wanderte, kam er zuvor auch an den Kalkbrüchen weiter oben im Tal entlang,
zu denen es einen zweiten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anlaß zur Anlage des Adolph Stollens waren die schon von Cotta erwähnten gelegentlichen Funde von Magnetkies (Pyrrhotin) und – allerdings sehr selten – auch Drähten von gediegen Silber. Im Zeitraum der Geognostischen Landesuntersuchung besuchte 1868 auch der bekannte Paläontologe, Geologieprofessor und Hofrat Hanns Bruno Geinitz den Kalkbruch zu Miliitz, wobei ihm der Faktor Heinrich Lorenz ein Gesteinsstück mit Eisennickelkies (Pentlandit) übergab. In den Folgejahren achtete man verstärkt auf die Erzminerale in der liegenden Kontaktfläche des Kalklagers und fand Rotnickelkies (Nickelin), Speiskobalt (Skutterudit), Kobaltblüte (Erythrin) und Malachit sowie Pyrit, Fahlerz (Tetraedrit) und wiederholt in geringen Mengen gediegen Silber. Im Protokoll zur 5. Sitzung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden unter dem Vorsitz von H. B. Geinitz ist dann zu lesen: „Die erste Mittheilung des Vorsitzenden betrifft das neue Vorkommen von gediegenem Silber in dem Urkalk von Miltitz im Triebischthale, wo es mit erdiger Kobaltblüte zusammen auf einer geognostischen Excursion der Studirenden des Dresdener Polytechnikums am 13. Juni 1874, wenn auch nur in bescheidenen Spuren, haarförmig und später durch Herrn Factor Lorenz krystallinisch entdeckt worden ist.“ Daraufhin mutete im Jahr 1874 der damalige Besitzer Carl Christian Rudolph von Heynitz (der Vater von Adolph von Heynitz) ein Abbaufeld im Liegenden des Alten Kalklagers in Miltitz (40040, Nr. B1143 und 40174, Nr. 898). Das Feld wurde durch die Auffahrung des Adolph Stollns erschlossen. Als Erzbergwerk unterlag dieser Grubenteil den üblichen bergrechtlichen Regelungen und die Mutung wurde deshalb im Lehnbuch des Bergamtes Freiberg, datiert auf den 7. Oktober 1874 eingetragen. Bereits 1875 wurde dem Bergamt aber mitgeteilt, daß versucht werde, die geringen Erzanteile zusammen mit dem laufenden Kalksteinabbau zu gewinnen. Ein Erzabbau allein wäre nicht lohnend. Der Schlußstein über dem Stollnmundloch trägt die Jahreszahl 1884. Etwa halber Länge dieses Stollns findet man eine Jahrestafel von 1886. Das letzte bergamtliche Befahrungsprotokoll datiert auf den Dezember des Jahres 1887, worin es schon heißt, daß der Erzabbau bereits seit vier Jahren eingestellt wäre, da der verfolgte Gang ausgekeilt sei. Der Stolln wurde aber als Wetter- und Winter-Abbaustrecke weiter durch das Kalkwerk genutzt. Im Stolln sind heute noch im Bereich der an der Nordwestseite steil aufgerichteten, liegenden Kontaktfläche schmale Trümer mit erdigem, ockerfarbenem Brauneisenstein und tiefschwarzem Manganmulm (Braunstein) zu sehen. Anhand historischer Kartenwerke kann man die weitere Entwicklung gut veranschaulichen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst seit 1891 gibt es nahezu vollständige Unterlagen über den Kalkbergbau in Miltitz im Bergarchiv. Der Markscheider Oscar Choulant berichtet 1891 dem Landesbergamt, daß der Bergbau bereits „seit vielen Jahrzehnten“ betrieben werde und „mächtige Höhlungen“ ergeben habe. Ferner gehe die Rösche „in ein Drittel Höhe des Förderbremsberges“ ab, was – da sie von der 2. Sohle ausgeht – nichts anderes heißt, als daß das Tagesfallort 1891 bereits bis auf die 6. Sohle geteuft war. Der Heynitz Stolln (eigentlich unter dem Namen Adolph Stolln 1874 als Erzbergwerk gemutet) werde „als Flucht-, Ventilations- und Winterabbaustrecke“ genutzt. Die „tiefen Sohlen“ seien abgesoffen gewesen. Zwei Jahre später habe man diese tiefen Sohlen gesümpft und den Hauptabbau dorthin verlagert. Die Belegschaft lag im von Heynitz`schen Kalkwerk zwischen 1891 und 1896 zwischen 33 und 53 Arbeitern, 1902 noch bei 30 Mann und in der Zeit des 1. Weltkrieges 1916 nur noch bei 14 bis 18 Arbeitern; davon 12 untertage.
Nach einer nur teilweise veröffentlichen
Zusammenstellung der Berginspektion
III für die Jahrbuchausgaben von
1902 und 1903 hat das von Heynitz'sche Kalkwerk in den genannten Jahren
9.478 t bzw. 9.413 t Rohkalk ausgebracht (40024-12, Nr. 15).
Damit war dieses Kalkwerk zu dieser Zeit in jedem Falle das größte der
ganzen Region. Zur Erzeugung gebrannten Kalks in Miltitz ist darin leider
keine Angabe aufgeführt, doch wurde ‒ wie auch in unserem Abschnitt zu den
Produktionsmengen und zum
Aus dem Jahr 1892 ist eine gedruckte Arbeitsordnung erhalten (40024-12, Nr. 291). Danach begann die tägliche Arbeitszeit um 6.00 Uhr und endete um 18.00 Uhr, abzüglich einer Mittagspause von einer Stunde. Am Samstag war immerhin schon um 17.00 Uhr Feierabend. Erst 1905 wurde übertage für die Belegschaft auch eine Mannschaftsstube errichtet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach 1900 findet man, wie oben erläutert, dann auch Angaben zu den gewerblichen Gruben in den Jahrbüchern für das Bergwesen im Königreich Sachsen. So können wir 1904 im Kapitel: VI. Wichtige Ausführungen und Betriebsvorgänge auf den gewerblichen Gruben. im Abschnitt: 2. Schacht- und Maschinenanlagen. unter Nr. 9. über das Kalkwerk lesen: „Auf Kalkwerk Miltitz ist Bohrmaschinenbetrieb (Bauart „Little Jap") eingeführt und zur Erzeugung der erforderlichen Preßluft ein Luftkompressor aufgestellt worden, der durch eine ebenfalls neu angeschaffte Heißdampflokomobile von Wolf, Magdeburg, angetrieben wird. Mit dem durch den Bohrmaschinenbetrieb erzielten Erfolge ist man recht zufrieden.“ Auch auf den flacheren Sohlen ging der Abbau aber offensichtlich weiter, denn 1905 hatte man dort einen Überbau festgestellt, d. h. daß der untertägige Abbau die festgelegten Feldesgrenzen überschritten hatte und zwar in Richtung auf den Sicherheitspfeiler der Bahnlinie. Bereits 1908 erfolgten daher erste Verwahrungsmaßnahmen (Aufmauerung von Dämmen und Teilverfüllung). Trotzdem mußte Herr von Heynitz 1909 eine Sicherheitsleistung von 3000,- Mark an die Köngl. Sächs. Bahngesellschaft zahlen. Bis dahin liefen die Geschäfte offenbar noch einigermaßen, denn man konnte auch in neue Technik investieren, wie wir im gleichen Abschnitt wie oben in der Jahrbuchausgabe von 1908 unter Nr. 12. nachlesen können: „Zur Erzeugung elektrischen Stromes für Beleuchtungszwecke ist auf dem Kalkwerke Miltitz in Miltitz eine kleine Dynamomaschine aufgestellt worden.“ Das Tagesfallort wurde noch kurz vor dem 1. Weltkrieg noch einmal verteuft, wie man aus der Ausgabe des Jahrbuchs von 1910 erfährt: „Auch beim Kalkwerke Miltitz in Miltitz ist eine neue tiefere Abbausohle angelegt und zur Förderung der Massen aus dieser der Haspelberg entsprechend verlängert worden.“ Damit war nun auch die größte Teufe (8. Sohle) erreicht. Wann man eigentlich den „Blauen Bruch“ im hangenden Graukalklager in Angriff genommen hat, ist dagegen urkundlich nicht belegt. Er taucht erstmals eindeutig erkennbar in der Ausgabe der Topographischen Karte von 1911, in älteren Kartenwerken (siehe oben) dagegen nicht auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vergrößerter Ausschnitt aus der Topographischen Karte, Blatt 48, Meißen, Ausgabe 1911: Jetzt ist auch der Blaue Bruch und die zu ihm hinaufführende Rampe deutlich zu erkennen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
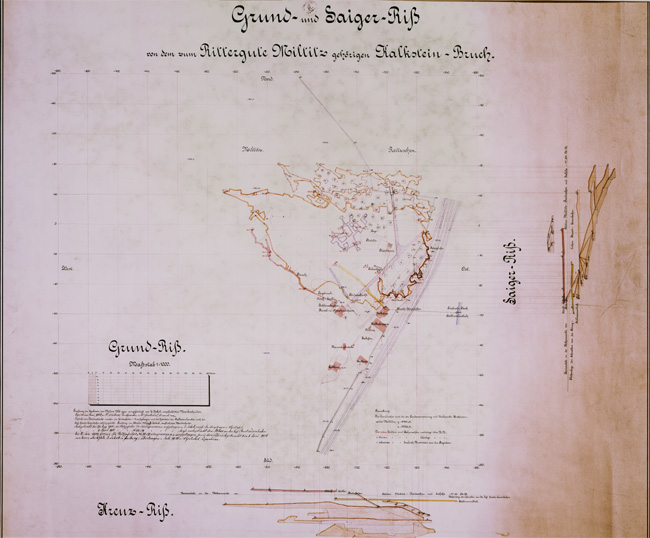 Grund- und Saigerriß von dem zum Rittergute Miltitz gehörigen Kalksteinbruch, ...im März 1903 neu gefertigt von E. Jakob, verpflichteter Markscheider, nachgebracht bis 1911. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044-1 (Generalrisse), Nr. 17589, Gesamtansicht, Norden ist oben. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ausschnitt aus obigem Riß: Grundriß und Tagesanlagen. Rechts - etwas dunkler umgrenzt - der Überbau im Bereich der Gleisanlagen. Rot (im Südwesten) der Adolph- Stolln, hellblau das alte Tagesfallort zur zweiten Sohle, gelb der Entwässerungsstolln zur Großen Triebisch (rechts angerissen) und grau: der Förderschacht. In den oberen, alten Bauen hat der Markscheider die Pfeiler nicht mehr eingezeichnet. Violett sind hier auch die Tiefbaue in der Sohle des Blauen Bruchs vergezeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ausschnittsvergrößerung aus obigem Riß mit den Tagesanlagen. Ganz links unten das Kalkhaus, daneben das Huthaus und die Mannschaftsstube. An den Bahngleisen weiter nordöstlich: der alte Kalkofen, ein Aufzug zu den Förderbrücken, der große Kalkschuppen und der neue Kalkofen. Am Südwestrand des Tagebruches ein Kohlenschuppen und das Kessel- und Dampfmaschinenhaus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ausschnittsvergrößerung aus obigem Riß mit den (violett umrandeten) Tiefbauen aus dem Blauen Bruch heraus. Die Förderung vom Blauen Bruch hinunter zu den Ofenanlagen erfolgte über eine schiefe Ebene, die von oben, vom einem „Bremshaus“ aus angetrieben wurde. Neben der schiefen Ebene stand außerdem das Pulverhäuschen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon 1916 findet sich in einem Fahrbericht der Hinweis, daß der Besitzer die Einstellung des Werkes „in Aussicht genommen habe“ – wohl aufgrund fallender Erträge. Überhaupt scheint der Kalkabbau auch für die Familie von Heynitz immer nur ein Nebenerwerb mit schwankendem Ertrag gewesen zu sein und die Geschäfte erscheinen ab und an doch von Geldmangel geprägt. So mußte die Gewerbeinspektion 1902 fordern, daß die (übertägige) Pulverkammer endlich mit einem Blitzableiter versehen werde und das Landesbergamt bemängelte noch 1913 die fehlende Nachtragung der Grubenrisse. 1914 mußte der Betrieb aufgrund der Mobilmachung im 1. Weltkrieg schon einmal kurzfristig ganz eingestellt werden. Schließlich ereignete sich dann am 25.5.1916, morgens um 7:45 Uhr der große Tagesbruch, dem der Häuer Bartsch und die russischen Kriegsgefangenen Bolkow, Saitzkow, Rewa und Ryshenkow zum Opfer fielen. Sie hatten zu dieser Zeit im Blauen Bruch gearbeitet. Der Unfall ist natürlich in der betreffenden Jahrbuchausgabe von 1917 unter der Rubrik:
IV.
Tödliche Unfälle vermerkt: „25. Mai 1916. Kalkwerk Miltitz in Miltitz. Häuer Max Bartsch war bei der Kalksteingewinnung über Tage beschäftigt. Plötzlich brach die Decke des darunter befindlichen Grubenbaues durch und Bartsch stürzte mit in die Tiefe. Er wurde von den nachstürzenden Massen verschüttet; wegen weiterer Bruchgefahr konnte seine Leiche nicht geborgen werden.“ Daß dabei auch vier Kriegsgefangene zu Tode kamen, hielt man der Erwähnung nicht für wert… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Blick auf den heutigen
Zustand ermöglichen wir
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu den Ursachen des Tagesbruchs muß es bereits damals große Diskussionen gegeben haben, denn der Bruch sei ohne vorherige Anzeichen schlagartig eingetreten. Als Ursachen wurden vor allem die langjährige Durchdringung und Auswaschung des Zwischenmittels der beiden Lager aus Hornblendeschiefer durch Sickerwässer – in Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Starkregenperiode – ins Feld geführt. Erst mehrere Jahre später wird auch ein wenige Tage zuvor zu Bruch gegangener Sicherheitspfeiler erwähnt... Dieser Unglücksfall jährte sich 2016 zum einhundertsten Mal.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1917 hatte man sich mit der Eisenbahn darauf geeinigt, das Bergwerk nicht wieder aufzuwältigen und die Verwahrung des dem Bahngleis am nächsten liegenden Abbaufelds nicht fortzuführen. 1919 stellt (inzwischen der Sohn) Gottlob Adolph von Heynitz selbst noch einmal einen Antrag beim Landesbergamt auf Wiederaufnahme des Bergwerksbetriebes, jedoch offenbar nur, um Abbauanträge der Nachbarn abzuwehren. Im Jahr 1916 hatte nämlich der Kaufmann Max Schneider die Nachbargrundstücke gekauft und beim Bergamt einen Abbauantrag gestellt. Die Verhandlungen mit Herrn Schneider zogen sich bis 1922 hin und endeten mit der Abtretung seiner Ansprüche.Im Jahr 1923 fanden nochmals Untersuchungen im Alten Kalkwerk statt. Der Landvermesser R. Schwarzbach aus Meißen hatte erneut einen Abbauantrag gestellt, um im Auftrag der Eisenwerke Lauchhammer Analysenmaterial zu gewinnen und die Möglichkeiten weiterer Kalkgewinnung zu prüfen. Das Bergamt hatte seinen Betriebsplan für die Gewinnung von ca. 50 t genehmigt, das Bergwerk wurde noch einmal gesümpft, aber der Abbau in Ermanglung bauwürdiger Vorräte dann doch nicht wieder aufgenommen.Im Monatsbericht vom 14.10.1924 findet sich schließlich der Satz, daß „das vollständige Ersaufen (der Grube) nur noch eine Frage von Wochen wäre“.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während des 2. Weltkrieges nahmen mit der zunehmenden Luftüberlegenheit der Alliierten seit etwa 1942 die Bombenangriffe in Deutschland und damit die Gefährdung kriegswichtiger Produktionsstätten drastisch zu. Dabei wurden neben eindeutig militärischen Zielen bald auch systematisch Zivilziele und produzierende Betriebe von den alliierten Bombern angegriffen. Zugleich drang von Osten die sowjetische Armee auf polnisches Gebiet vor. Die daraus resultierenden Schäden führten zu empfindlichen Produktionsausfällen und diese wiederum zu erheblichen Materialproblemen an der Front, so daß die Aufrechterhaltung des Güternachschubes aus dem Kernreich an die Fronten zu einer mehr und mehr kriegswichtigen Aufgabe wurde. Ab 1943 begann man daher im Rahmen des Mineralölsicherungsprogramms des Ministers für Bewaffnung und Munition des III. Reiches (auch Geilenberg- Programm genannt) geeignete Stellen für die Untertageverlagerung zu suchen. Neben dem Ausbau vorhandener unterirdischer Räumen wie Höhlen, Bergwerken, Kellern, Kasematten und Tunnelanlagen wurde dabei auch eine Vielzahl gänzlich neuer Anlagen geplant und teilweise auch realisiert. Die Baumaßnahmen selbst wurden im Allgemeinen durch zivile Ingenieurbüros geplant und durch private oder staatseigene Baufirmen durchgeführt. Hierbei ist insbesondere die Organisation Todt zu nennen, die bis in die letzten Kriegswochen hinein eine fast schon unglaublich leistungsfähige Bauorganisation war und blieb. Die hierbei erzielten Baugeschwindigkeiten waren trotz Materialengpässen im Allgemeinen sehr hoch, was nicht zuletzt auch an der rücksichtslosen Ausnutzung des eingesetzten „Menschenmateriales“ lag. Neben der Organisation Todt traten jedoch auch andere reichseigene Baufirmen auf, so zum Beispiel verschiedene Unterorganisationen der SS. Nach Erstellung oder Aufgewältigung einer Untertageanlage im Rohbau wurde diese einer oder mehreren Firmen angeboten und mit einem Sperrvermerk versehen. Die betreffende Firma hatten dann vier bis sechs Wochen Zeit, die Anlage zu bewerten und weitere Ausbaumaßnahmen zu veranlassen, beziehungsweise ihre Ablehnung zu begründen. Unter den Decknamen Molch III und Molch IV wurde in diese Vorhaben auch das Kalkwerk in Miltitz einbezogen. Hierhin sollten Anlagen zur Produktion Flugzeugbenzin der I. G. Farben u. a. aus Monowitz bei Auschwitz verlagert werden. Außerdem sollten Ventile und Kolbenringe für die Flugzeugindustrie produziert werden. Dazu waren jedoch umfangreiche Einbauten nötig. Deshalb begann 1943 die Arbeitsorganisation Todt mit dem Bau des sogenannten Arbeitserziehungslagers III. Während der Arbeiten waren dort die Zwangsarbeiter untergebracht. Die Konstruktion oblag der Firma Uhde aus Dortmund, einem Betrieb für chemisch-technischen Apparatebau. Die Anlagen wurden in Monowitz demontiert und per Bahn nach Miltitz transportiert. Der gesamte Außenbereich zwischen Bahnhof und Schachteingang wurde mit Tarnnetzen überspannt, um ihn vor der alliierten Luftaufklärung zu verbergen. Untertage wurde auf der 1. und 2. Sohle eine Maschinenhalle mit Schornstein (-Schacht) sowie Fundamente für die Benzintanks gebaut. Die dafür genutzte Fläche war mit 10.000 m² angegeben. Trotz intensivem Einsatz von Material und Menschen kam es bis Kriegsende jedoch nie zur Produktion von Flugzeugbenzin. Lediglich Kolben und Ventilringe wurden gefertigt. Am 7.8.1944 wurden die Arbeiten aufgegeben und die Anlage gesperrt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von den im Arbeitserziehungslager III untergebrachten, insgesamt etwa 100 Zwangsarbeitern – vorwiegend „deutsche und polnische jüdische Mischlinge“ – kamen während dieser Arbeiten 17 um Leben, darunter auch drei Kinder. Sie wurden durch die SS an der Friedhofsmauer in Miltitz verscharrt. Die Torturen der Häftlinge endeten erst am 6. Mai 1945. Im Jahr 1951 erfolgte dann eine Umbettung der Gebeine in den Kastanienhain am Friedhof. Seit dem 8. September 1951 erinnert dort ein Ehrenmal an dieses dunkle Kapitel der Geschichte (R. Müller).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Kalkwerk Miltitz zunächst als GmbH neugegründet und später verstaatlicht. Bis 1954 gehörte es als Betriebsteil 6 mit den Werken I und II (Kalkwerk Groitzsch) zum VEB (K) Meißner Ziegelwerke. 1957 übernahm das Stahl- und Walzwerk Riesa das Kalkwerk und führte es als Betriebsabteilung 6 noch bis zur endgültigen Stillegung 1966 weiter. Abbau erfolgte jedoch im Bereich des Alten Lagers nicht mehr. Letzte Verwahrungsmaßnahmen währten bis 1972.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das K. Jurisch'sche
„Neue Kalkwerk“ in Miltitz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während der Abbau im „Alten Kalkwerk“ eingestellt wurde, begann ab 1923 der Leipziger Kaufmann Karl Jurisch mit der Erkundung des Neuen Lagers, offenbar ausgehend von der Annahme, daß sich das Lager im Streichen fortsetze. Dies wurde dadurch gestützt, daß der nordwestlich auf Roitzschener Flur ansetzende Wiesenstolln ebenfalls ein Graukalklager angefahren hatte. Dort begann man auch – parallel zu Erkundungsbohrungen auf der Hochfläche – mit Untersuchungsarbeiten, längte den Stolln um 8 m aus und teufte bei etwa 20 m Entfernung vom Mundloch ein 9,2 m tiefes Gesenk, jedoch ohne dabei auf das Weißkalklager zu stoßen. Stattdessen erbrachten aber die insgesamt zehn Bohrungen den Nachweis, daß sich hier unter dem Graukalk ebenfalls ein Weißkalklager befindet. Im Jahrbuch für das Bergwesen in Sachsen auf das Jahr 1924 ist dazu im Kapitel Wichtige Ausführungen und Betriebsvorgänge bei den gewerblichen Gruben vermerkt: „Beim Kalkwerk Miltitz zeigte sich nach der Sümpfung der seit dem Jahre 1916 ersoffenen Tiefbaue, daß keine wesentlichen Mengen Kalkstein auf dem Lager mehr abzubauen sind. Es wurde deshalb beschlossen, in der verlängerten Streichlinie des Lagers nach Nordwest Tiefbohrungen in 200 bis 400 m söhliger Entfernung vorzunehmen. Es ist zu vermuten, daß in dieser Richtung eine weitere Kalksteinlinse vorkommt, die mit der ersten, nahezu abgebauten Linse in keinem Zusammenhang steht, sondern wahrscheinlich nur das gleiche Streichen und Einfallen hat. Man entschied sich für das Diamantersatz-Tiefbohren. Die Vorbereitungsarbeiten dazu, wie Abstecken der Bohrlöcher, Herbeischaffen und Aufstellen der Bohrgeräte usw. waren am Jahresschlüsse 1923 beendet, so daß zu Anfang des Jahres 1924 sofort mit den Tiefbohrungen begonnen werden konnte.“ Außerdem wurden „Beim Kalkwerke Miltitz … die beiden alten Kalkschachtöfen instandgesetzt, so daß vom Oktober bis Ende Dezember 1923 wieder Kalk gebrannt werden konnte.“ Im Folgejahr kann man dann nachlesen, daß „…die Tiefbohrarbeiten, mit deren Vorarbeiten bereits 1923 begonnen worden war (vgl. vorjährigen Bericht), durchgeführt (wurden). Es wurden 10 Tiefbohrlöcher niedergebracht, die den Beweis für das Vorkommen einer zweiten mächtigen Kalksteinlinse lieferten. In streichender Erstreckung (Nordost- Südwest) wurden auf 200 m Länge und im Einfallen (von Südost nach Nordwest) auf 150 m flacher Länge weißer Kalkstein festgestellt. Außer weißem wurde noch blauer Kalkstein durch 3 Bohrlöcher erschlossen. Auch das Blaukalkvorkommen zeigte eine ausgesprochene Linsenform. In einem Bohrloch stehen einschließlich einiger unreiner Schichten von zusammen etwa 4 m Mächtigkeit 20 m, in einem anderen Bohrloch 40 m mächtiger reiner blauer Kalkstein an.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Anfang 1925 bis etwa September 1925 teufte man dann das zunächst 120 m lange Tagesfallort auf das Neue Lager. Bei 98 m Länge wurde das Weißkalklager erreicht. Zu dieser Zeit befand sich die Sprengstoffniederlage im Adolph Stolln. Die Jahrbuchausgabe von 1926 beschreibt weitere Details der Aus- und Vorrichtungsarbeiten: „Für die neue Anlage wurde ein elektrisch zu betreibender Förderhaspel und ein Kompressor mit einer Leistung von 8,5 cbm in der Minute und 7 at Druck aufgestellt. In der Nähe des Füllorts wurde ein Flucht- und Wetterschacht durch Überhauen hergestellt. Er steht in Bolzenschrot- Zimmerung und ist 42 m hoch. … Bei der Gewinnung von Kalkstein haben sich die Flottmann-Schnellbohrhämmer. Type N. sehr gut bewährt. Als Sprengstoff dient bei nassen Löchern Dynamit I. bei trockenen Gesteinsammonit I. Um große Stücke bei der Sprengarbeit zu erhalten und um Sprengstoff zu sparen, werden Kruskopfsche Sparbesatzpatronen verwendet. … Das Tagefallort wurde mit 20 ° Neigung bis zu 205 m weiter vorgetrieben. Von da ab schließt sich das 23,5 m lange, 8,5 m breite und 5 m hohe Füllort an, von dem aus das Kalksteinlager zum Abbau vorgerichtet wird. Wegen der großen Mächtigkeit wird das Lager in Weitungen abgebaut, zwischen denen zur Stützung des Hangenden genügend starke Pfeiler stehen gelassen werden. … Von der Allgemeinen Transportanlagen G. m. b. H. in Leipzig wurde eine Hängeseilbahn von der neuen Anlage (Tagefallort) bis zum Verladebunker am Verladegleis der Eisenbahn errichtet. Gegen Ende des Jahres wurde sie in Betrieb genommen. … Zur Hebung der Grubenwässer dient eine dreistufige Schleuderpumpe der Firma Weise Söhne, Halle, die mit einem 9,5 PS-Motor unmittelbar gekuppelt ist und 300 l je Minute leistet.“ Im darauffolgenden Jahr wurde noch „das Tagefallort … auf eine Länge von 75 m ausgemauert und gewölbt.“ Die Euphorie über die Erfolge ließ jedoch schnell nach. Während man einerseits mit technischen Problemen (zwei schwere Brüche im Tagesfallort, starke Wassereinbrüche) zu kämpfen hatte, versiegte andererseits bei Herrn Jurisch das Geld. Im Oktober 1927 hatte sich der Lehnsgerichtshof in Dresden noch immer nicht über die Rechtmäßigkeit des Verkaufs des Grundstücks einschließlich der Abbaurechte vom Heynitz`schen Adelshaus an den Herrn Jurisch entschieden und keinen Grundbucheintrag vorgenommen. Hinzu kam der Einbruch des Absatzes, weil spätestens ab 1928 „besonders die Rohkalk verarbeitende Eisen- und chemische Industrie wegen des gestiegenen Preises je t ihren Bedarf (wieder) vorzugsweise aus den schlesischen Tagebauen bezog.“ Bereits 1926 hat daher nach einem Fahrbericht Herr Jurisch Verkaufsabsichten geäußert. Im Oktober 1927 wurde dem Bergwerk tatsächlich der Strom abgestellt und schließlich wurden sogar die Maschinen gepfändet, weil Rechnungen nicht bezahlt werden konnten. Sehr schnell stieg daraufhin das Grundwasser an und die Abbaue ersoffen so weit, daß an eine Fortführung nicht ohne weiteres zu denken war. 1928 mußte Jurisch die Zwangsversteigerung beantragen, die nach mehreren Anläufen aber erst 1930 erfolgte. Schließlich wurde aus dem noch existierenden Depot auch noch Sprengstoff gestohlen und dies am 1.12.1931 zur Anzeige gebracht. In diesem Moment wollten weder der verarmte Besitzer, noch die Gewerbeinspektion, noch das Landesbergamt Schuld gewesen sein und so zog sich der Schriftwechsel bis vor das Sächs. Ministerium für Arbeit und Wohlfahrt... Die Berichte der Lagerstättenforschungsstelle des Oberbergamtes aus den Jahren 1936 und 1937 sprechen ebenfalls davon, daß der Abbau im Kalkwerk in Miltitz bereits seit 1928 ruhe, obwohl noch rund 200.000 t Kalk vorrätig seien. Jedoch sei das Material zu rein für die Herstellung von Portlandzement. Lediglich im früheren Tagebau in Schmiedewalde könne man kurzfristig noch vorhandene, größere und geeignete Kalkvorräte erschließen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vergrößerter Ausschnitt aus der Topographischen Karte, Blatt 48, Meißen, Ausgabe 1939: Zwischen Blauem Bruch und Altem Kalkwerk hindurch führt die Förderseilbahn zum Neuen Kalkwerk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die „Talstation“ der Hängeseilbahn mit Bunker und Verladeeinrichtungen um 1926. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40176 (Sammlungen des Bergarchivs), Nr. 014, Bild 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Zustand des von Heynitz’schen Kalkbruchs um 1935. Oberhalb des Steilhangs ist das hölzerne Ständerwerk der Hängeseilbahn zu sehen. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40073-1 (BSA), Nr. 065 (Kalk- und Eisensteinabbau in den Kreisen Meißen, Freiberg und Freital), S. 32, Bild 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein zweiter und etwas besser erhaltener Abzug derselben Fotographie findet sich noch in einer zweiten Akte; Bildquelle: Sächs. Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40028 (Oberbergamt, Bergwirtschaftsstelle), Nr. 3-1085: Fotos von Anlagen der Kalksteinindustrie, Miltitz- Roitzschen, Kalkwerk, undatiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die „Bergstation“ der Hängeseilbahn vor dem Mundloch des Tagesfallortes des Neuen Kalkwerks um 1926. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40176 (Sammlungen des Bergarchivs), Nr. 014, Bild 5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Rechts im Vordergrund das überwölbte Mundloch des Fallortes, zwischen den Betriebsgebäuden die „Bergstation“ der Hängeseilbahn, davor die Einhausung des Haspelantriebs. Zustand um 1935. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40073-1 (BSA), Nr. 065 (Kalk- und Eisensteinabbau in den Kreisen Meißen, Freiberg und Freital), S. 32, Bild 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karl Jurisch beschäftigte 1923 zunächst 40 Arbeiter, 1927 noch 17, 1928 waren noch 3 verblieben. Der Wiederbeginn nach 1945 war unproblematischer, weil natürlich beim Wiederaufbau nach dem Weltkrieg der Bedarf an Baustoffen besonders groß war. Zwar mußte für jede Grubenlampe ein Dringlichkeitsantrag gestellt werden, nur um dann Bescheid zu bekommen, daß es keine gäbe, und selbst die Treibstoffmenge für die Pumpen zum Sümpfen der Grubenbaue wurde akribisch nachgerechnet. Doch die Vorarbeiten im Neuen Kalkwerk durch K. Jurisch haben sich als erfolgreich erwiesen. Der Oberingenieur K. Behr aus Miltitz und der Maschinenbaumeister H. Hellwig aus Radebeul waren die Geschäftsführer der neuen GmbH. Bereits 1946 wurde ihr Betriebsplan genehmigt und die Förderung aufgenommen. Der Betriebsplan für 1946 sah für das Neue Kalkwerk eine Belegschaft von 58 Mann in Dritteln vor, tatsächlich waren es etwa 40. 1953 wies der Arbeitskräfteplan noch 37,5 Beschäftigte aus (inklusive einer halben Putzfrauenstelle), 1961 waren es noch 30, 1962 nur noch 20. In dieser Zeit oblag die bergbehördliche Aufsicht der Technischen Bergbauinspektion (TBBI) Dresden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
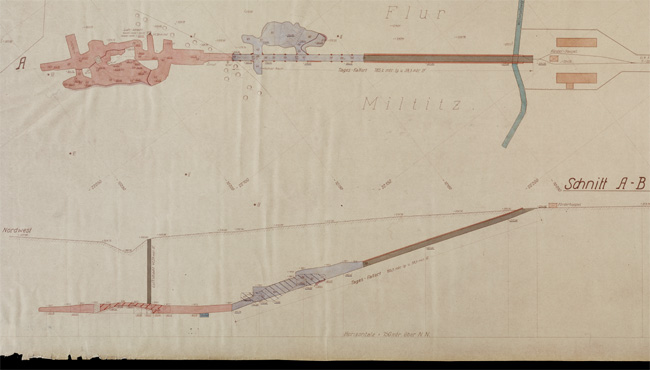 Ausschnitt aus obigem Riß mit Grundriß (oben) und Saierriß (unten) des Fallorts des Neuen Kalkwerkes und dem Abbaustand im Jahr 1948.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
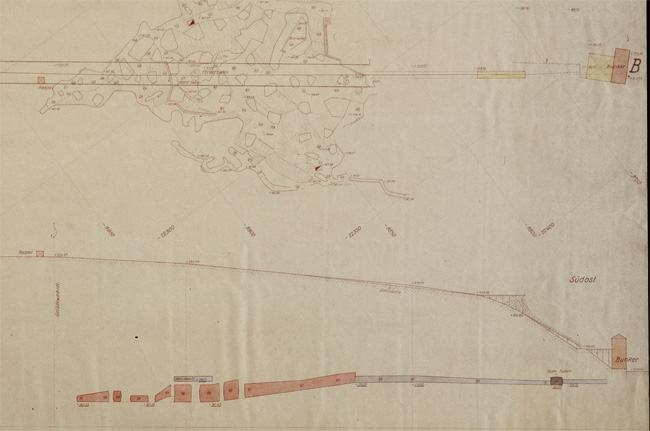 Ausschnitt aus obigem Riß mit einem Schnitt durch das alte Kalkwerk im Streichen der Förderbahn. Die Seilbahn hatte man offenbar nach dem Krieg abgerissen und durch eine Gleisbahn ersetzt, die durch eine zweite Haspelmaschine auf dem Scheitelpunkt des Geländes angetrieben wurde. Sie entleerte deshalb auch nicht mehr direkt in die Bunkeranlage am Bahnhof Miltitz- Roitzschen, sondern zunächst in eine offene Rutsche, aus der der Kalkstein mittels Hunten über eine Förderbrücke in die Bunker geschafft worden ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Verstaatlichung gehörte das Kalkwerk Miltitz als „Werk I“ zusammen mit dem „Werk II“ (Kalkwerk Groitzsch) dem Betriebsteil 6 des VEB (K) Meißner Ziegelwerke an. 1948 begann man parallel auch, die Schächte A1, A2, B (Schornsteinschacht), C und D, die die Organisation Todt im Alten Kalkwerk hinterlassen hatte, zu verschließen und zu verfüllen. Ein neues Sprengstofflager wurde jetzt „im Hauptstolln des alten Schachtes“ angelegt – dies ist die heutige Pulverkammer im Besucherbergwerk. 1955 wurde mit Beschluß Nr. 144 der 32. Ratssitzung des Kreises Meißen entschieden, das Kalkwerk stillzulegen, da eine Bewertung durch Dipl.-Geol. W. Gotte, Berlin, keinen rentablen Betrieb mehr in Aussicht stellte. Dies betraf auch das Werk II in Groitzsch. Im Zeitraum 1956 und 1957 ruhte daraufhin der Betrieb. 1957 beantragte dann das Stahl- und Walzwerk Riesa die Übertragung des Kalkwerkes Miltitz und stellte einen neuen Betriebsplan auf. Bereits 1962 mußte aber eine Verlängerung des Betriebsplans beantragt werden, da „die Belegschaft für 7,5 Monate ins Stabwalzwerk abgezogen wurde“. Dies wiederholte sich: Daraufhin wurde das Bergwerk 1964 und 1965 jeweils für das erste Quartal gestundet. Für 1964 wurde zwar noch einmal ein neuer Betriebsplan erarbeitet, dessen mehrfache Verlängerung jedoch erst unter Auflagen genehmigt und endlich doch abgewiesen wurde. Diesem letzten Betriebsplan stimmte die TBBI schließlich nur noch als Sonderbetriebsplan für die Verwahrung und nur in Teilen zu. So endete 1966 endgültig der Kalkbergbau in Miltitz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impressionen vom Abbau im Neuen Kalkwerk Miltitz um 1950. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40176 (Sammlungen des Bergarchivs), Nr. 014, Bild 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impressionen vom Abbau im Neuen Kalkwerk Miltitz um 1950. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40176 (Sammlungen des Bergarchivs), Nr. 014, Bild 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impressionen vom Abbau im Neuen Kalkwerk Miltitz um 1950. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40176, (Sammlungen des Bergarchivs), Nr. 014, Bild 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die bereits seit 1948 im alten Kalkwerk parallel erfolgende Verwahrung und die Verfüllung des Ostfeldes des Alten Kalkwerkes in der Nähe der Bahnlinie wurde schließlich mit der Verfüllung des Wetterüberhauens und des Fallortes im Neuen Lager fortgesetzt und 1972 beendet. Allein in das Ostfeld des Alten Kalkwerkes wurden 30.000 m³ Verfüllmaterial eingebracht. Die Bewertung der Bergschadenkundlichen Anlayse von 1974 und 1975 kommt zu dem Ergebnis, daß bei einer Tiefenlage der Abbaue von mehr als 60 m unter Gelände „keine nennenswerte Beeinflussung der Tagesoberfläche“ zu erwarten ist. Die flacher liegenden Hohlräume seien „zeitlich unbegrenzt standsicher hinsichtlich größerer Verbrüche... lokale Brüche (seien) jedoch nicht auszuschließen“. Um 1981 wurde vom Wiesenstolln aus eine Bohrung in das Neue Lager gestoßen und das Wasser danach in das Trinkwasserversorgungsnetz eingespeist. Gegenwärtig ist diese Anlage nicht mehr in Betrieb, da dieses Wasser natürlich sehr kalkhaltig ist und die Nutzer besonders viel Calgon brauchten...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das
Kalkwerk Groitzsch (Kippe & Pietzsch)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über den Beginn des Kalkabbaus in Groitzsch liegen noch wenige Kenntnisse vor. Im 1816 erschienenen, dritten Band des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ wird bei Groitzsch noch kein Kalksteinbergbau erwähnt. Auch unter Perne bzw. Bernshäuser findet sich dazu kein Vermerk. Bekannt ist aber, daß bereits 1820 ein Wasserstolln vom Dorfbach aus angelegt war, der den damaligen Kalkstein- Tagebau entwässerte. Ab 1837 wurde die „Gute Hoffnung gevierte Fundgrube“ verliehen und im Hangenden des Kalklagers Brauneisenerz abgebaut. Dazu wurde der zirka 7 m tiefe „August Tagesschacht“ nordöstlich des Kalkbruchs bis auf das im Hangenden des Kalklagers bestehende Brauneisenstein- Vorkommen geteuft. Ab 1851 war diese Grube Beilehn der Graf Carl Fundgrube in Burkhardswalde. Deren Betrieb währte noch bis 1862. Im „Kalkwerksbetrieb Sachsens“ wird von den Autoren Wunder, Herbrig und Eulitz dann im Jahr 1867 ein Kalkwerk im Besitz eines Herrn Kippe in Groitzsch angeführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Grundriß von August Fundgrube zu Groitzsch mit den dazugehörigen Fundgrube und Maaßen, aufgenommen von Wilhelm Zähler, Mrksch. 1833. Voller Optimismus hatte die Gewerkschaft neben der Fundgrube auch gleich 10 Maße im Umfeld des Kalkbruches hinzugemutet. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. I2327, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß rechts unten. Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
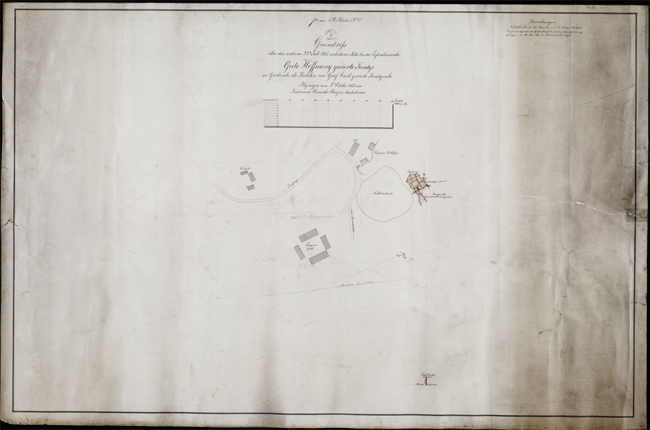 Grundriß über das unterm 28. Juni 1837 verliehene Feld bei der Eisensteinzeche Gute Hoffnung gevierte Fundgrube zu Groitzsch, als Beilehn von Graf Carl gevierte Fundgrube. Abgezogen am 8. October 1851 von Ferdinand Heinrich Steeger, Markscheider. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. K2333, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß rechts oben. Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
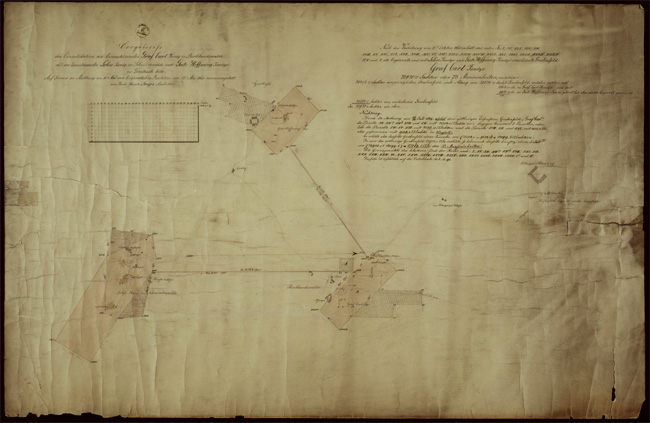 Croquisriß die Consolidation der Eisensteinzeche Graf Carl Fundgr. zu Burkhardswalde mit der Eisensteinzeche Lohse Fundgr. zu Schmiedewalde und Gute Hoffnung Fundgr. zu Groitzsch betreffend. Aufgrund der Muthung vom 10. Mai und bergamtlicher Resolution vom 13. Mai 1865 zusammengestellt von Ferd. Heinr. Steeger, Markscheider. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. K2335, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß rechts. Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
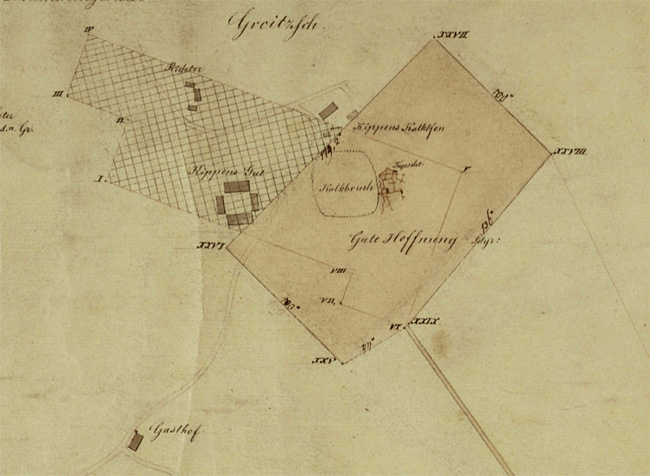 Ausschnitt aus obiger Croquis mit den Eintragungen der neuen Feldgrenzen der Eisensteingrube Graf Carl bei Groitzsch, im Vergleich mit denen der vormaligen Gute Hoffnung Fundgrube. Wie auch im vorigen Riß hat der Markscheider sowohl „Kippen’s Kalköfen“, als auch „Kippen’s Gut“ eingezeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Akte 40024-12, Nr. 017 findet man einen Bericht über die „Revision der im Bezirk der Kgl. Amtshauptmannschaft Meißen gelegenen Kalkwerke“ vom 26. August 1885, ausgefertigt von Carl Heinrich Lorenz, Factor in Miltitz, und darin eine kurze Beschreibung derjenigen Kalkwerke, die zu dieser Zeit im Zuständigkeitsbereich der Amtshauptmannschaft Meißen lagen. Dort liest man, daß das Kalkwerk Groitzsch 1884 im Eigentum von Otto Theodor Kippe, Gutsbesitzer daselbst, war und weiter: „Das hiesige Kalksteinlager ist 12 bis 18 m mächtig und wird gegenwärtig zutage durch Abräumung der darüber liegenden, 6 bis 9 m mächtigen Bedeckung, die nur aus mehr oder minder zersetztem Thonschiefer besteht, abgebaut.“ Die Wasserlösung des 18 m bis 27 m tiefen Tagebaus sei durch einen „250 m langen Zugstollen“ gelöst. Unterhalb der Tagebausohle sei das Lager noch unverritzt, seine Mächtigkeit daher unbekannt. In Betrieb standen „1 continuierlicher und 2 periodische Kalköfen“. Die durchschnittliche Belegung betrage 9 Mann. Noch 1892 wurde der Kalkbruch als „Tagebau mit Höhlungen“ und als „nicht unterirdisch“ eingestuft. Weitere Beschreibungen aus dem Jahr 1893 gehen auf den zu dieser Zeit auch für Miltitz zuständigen Markscheider Oscar Choulant zurück, der bereits einen 26 m tiefen Schacht bis zur damaligen Tagebausohle erwähnt. Später findet man Beschreibungen dann in den „Fabrikrevisionen“ in 40024-12, Nr. 134. Darin wird 1895 notiert, daß der Absatz von gebranntem Kalk in den letzten 25 Jahren jährlich zwischen 30.000 und 50.000 Centner (also zirka 1.500 bis 2.500 t) betragen habe, seit drei Jahren aber rückläufig sei. Berginspektor Borchers notierte 1899: „Der Abbau des Kalksteins findet zur Zeit noch im Tagebau, die Förderung der gewonnenen Massen dagegen schon im Schacht bzw. in einer das Füllort desselben mit dem Tagebau verbindenden Strecke statt. Der bauliche Zustand des Schachts, zumal in seinem oberen Theile, läßt viel zu wünschen übrig.“ Die Förderanlage werde mit einer „eincylindrigen Fördermaschine“ angetrieben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch etwas detaillierter ist die Beschreibung des ab 1900 zuständigen Bergmeisters Seemann: „Das Kalklager ist von Thonschiefer umschlossen und von sehr unregelmäßig linsenförmiger Gestalt. Der Kalkstein zieht sich theilweise in das Nebengestein hinein, theilweise ist das Lager aber auch von Thonschiefer durchzogen. Es besitzt ein sehr flaches nordwestliches Einfallen. Die Farbe des Kalksteins ist meist dunkelblau-grau, an einigen Stellen aber auch …reinweiß, die Struktur ist körnig-schiefrig. Der Gehalt an kohlensaurem Kalk ist über 90%. Das Lager wird in einem Tagebruch mit zwei Sohlen und anschließendem unterirdischen Bruch abgebaut. In letzterem sind bis jetzt erst einige Weitungen aufgeschossen und ein Strossenaushieb angelegt. Die Förderung erfolgt durch einen 1892 / 1893 niedergebrachten, 40 m tiefen Schacht. Die (zusitzenden) Wasser müssen bis zu dem in der oberen Bruchsohle liegenden und in den Dorfbach mündenden Stolln gehoben werden. Der Schacht ist nicht durch ein Haus überbaut und enthält zwei Fördertrümer und ein Fahrtrum. Zur Fahrung dient er im Allgemeinen nicht; die Leute nehmen ihren Weg durch den Tagebruch. Zum Heben der auf das Gestell aufgeschobenen, 2 hl (Wir übersetzten das Kürzel mal mit Hektoliter, d. h. also 200 Liter) fassenden Wagen dient eine 1893 von Münzner in Obergruna bezogene, vierzylindrige Dampfmaschine. Über dem Schacht ist ein hölzerner Seilscheibenstuhl aufgestellt, welcher zugleich das Gerüst für ein Windrad bildet, das ein Kunstgezeug zur Hebung des Wassers bis zur Stollnsohle in Bewegung setzt. Um bei Windstille das Wasser aus dem Bruch zu fördern, ist auf der untersten Sohle in demselben ein Pulsometer eingebaut, der den benöthigten Dampf aus dem Kessel übertage durch eine Rohrtour… zugeleitet erhält.“ Anmerkung: Ein Pulsometer ist eine aus der Dampfpumpe von Thomas Savery abgeleitete, kolbenlose, mit Dampf betriebene Pumpe, die zum Heben von Flüssigkeiten benutzt wurde. Dazu gibt´s einen Wikipedia- Artikel. „Zum Brennen dienen drei Kesselöfen, von denen jetzt zwei in Feuer sind und davon jeder einen Fassungsraum von 150 bis 200 hl Kalkstein (respektive rund 20 m³ oder etwa 50 t) besitzt. Es werden Steinkohlen von Zauckerode benutzt…“ Die Belegschaft betrage 10 Mann. Jährlich werden etwa 19.000 hl gebrannter Kalk produziert, die als Bau- und Düngekalk überwiegend ab Werk für 1,20 Mk / hl verkauft würden; ein Transport zur etwa 6 km entfernten Bahnstation finde nur in geringem Umfang statt. Auch dieses Werk war also zum größten Teil von lokalen Abnehmern abhängig. In der Fabrikrevision 1902 wird dann erwähnt, daß der Weiterbetrieb das Abräumen von nun schon 16 m Abraum erfordere, wovon die unteren 6 m Brauneisen seien, welches heute aber nicht mehr gewonnen werde. Erst 1903 wurde das Bergwerk betriebsplanpflichtig und seitens des Bergamtes die Anlage eines Rißwerks gefordert. Zu dieser Zeit erzeugte das Kippe'sche Kalkwerk nach einer nur teilweise veröffentlichen Zusammenstellung der Berginspektion III für die Jahrbuchausgaben von 1902 und 1903 in den genannten Jahren 1.800 t bzw. 1.400 t Branntkalk (40024-12, Nr. 15).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
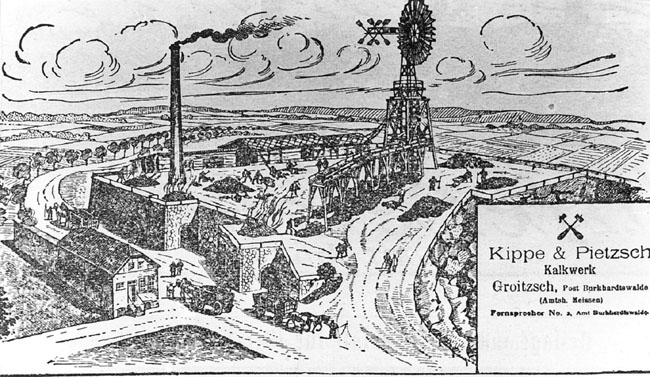 Historische Darstellung des Kalkwerks Kippe & Pietzsch in Groitzsch auf einer Postkarte, aus: „Unsere Heimat“, Sept. 1912, Foto: Mühlenarchiv, G. Rapp. Gut zu sehen ist der offene, „hölzerne Seilscheibenstuhl“ über dem Schacht, der zugleich das Windrad für den Antrieb der Wasserkunst trägt. Der damalige Tagebau ist leider durch die Namenstafel verdeckt. Das Kalkhaus links steht noch heute und ist bewohnt. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Link zur Originaldatei: Eine ähnliche Anlage
bestand vermutlich auch am Krumbiegel'schen Kalkwerk in
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1907 stellte der Eigentümer Kippe den Ingenieur Otto Pietzsch als Betriebsleiter ein. Er wurde ab 5. April 1907 auch Geschäftspartner; seitdem gehörte das Kalkwerk der gemeinsamen Firma Kippe & Pietzsch. Zwischen 1911 und 1914 lag die Belegschaft bei 9 bis 12 Mann. Ähnlich wie in Miltitz kam es aufgrund der Einberufungen während des 1. Weltkrieges fast zum gänzlichen Erliegen, von 1914 bis November 1916 wurde der Betrieb gestundet. Daraufhin soff der Tagebau ab und wegen Kohlenmangels kam auch die Wasserhaltung zum Stillstand. Der Holzausbau im nicht überdachten Schacht wurde wandelbar und gänzlich unfahrbar. Nur noch die obere Bruchsohle war fahrbar, auf der aber schon lange nicht mehr abgebaut wurde. Noch 1923 vermerkt der Revisionsbericht, daß „an eine Wiederaufnahme bei dem Verfall der Anlagen …nicht zu denken (sei), bevor nicht bessere Zeiten kommen.“ Kippe trägt sich wohl mit Verkaufsabsichten und so ist 1927 festgehalten, daß „der Besitzer Kippe … sagte, daß noch mächtige Kalksteinvorräte anständen, sich jedoch niemand wegen der ungünstigen Lage für sein Kalkwerk interessiert habe.“ 1931 wird die Akte geschlossen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Blick auf den heutigen
Zustand ermöglichen wir
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst 1947 kommt es zur Wiederaufnahme, zunächst durch die Ulbricht & Korb KG. Der Tagebau wird gesümpft und zunächst durch das Fallort West I die 25-m-Sohle (2. Sohle) ausgerichtet. 1954 wird die Gesellschaft in Volkseigentum überführt und zunächst eigenständig unter dem Namen VEB (K) Kalkwerk Groitzsch geführt.
Anmerkung: Die Ulbricht & Korb KG hatte 1946 auch die Wiederaufnahme des
vormals Facius’schen Kalkwerks in
Über das Fallort West II wird später noch eine 4. und 5. Sohle erschlossen, so daß das Grubengebäude nun eine Teufe von 72 m unter Gelände erreichte. Die Sohlenabstände lagen zwischen 8 m (zwischen 1. und 2. und 4. und 5. Sohle) und bis zu 16 m (zwischen 2. und 3. Sohle). 1956 wurde der Betrieb eingestellt. Bereits vor 1950 wurden Teile des Tagebaus mit Kalkschotter und Abraum verfüllt. Auch die Tiefbaue wurden teilweise mit Haldenmaterial und Kalkabfällen verfüllt. Der Tagesschacht war schon bei der Wiederaufnahme durch die Fallörter ersetzt, wurde also in den 1950er Jahren nicht mehr benötigt und deshalb ebenfalls verfüllt. Da der Altausbau nicht geraubt wurde, muß mit Schachtbrüchen während der Verfüllung gerechnet werden. Bei der Erstellung der BSA um 1973 wird eine zirka 1,5 m große Einmuldung am Schachtstandort erwähnt. Die Fallörter wurden lediglich abgemauert und sind dahinter abgesoffen. Am 30.7.1959 ereignete sich ein Tagesbruch über dem Tiefbaufeld, wobei eine 16 m in Ost-West- und 22 m in Nord-Süd-Richtung breite sowie 18 m tiefe Pinge entstand. Sie ist heute komplett verfüllt. Wie uns Herr Zschoche aus Schmiedewalde informierte, war Otto Pietzsch in den 1950er Jahren noch als Standesbeamter in Burkhardswalde tätig.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ranft'schen
und Geißler'schen Kalkwerke bei Schmiedewalde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Abbau bei Schmiedewalde sei nach W. Schanze seit 1723 urkundlich belegbar. Schon 1790 wird auch eine Wasserkunst erwähnt (40073-1, Nr. 065). Wenig später, im Jahr 1796 berichtet der Dresdner Arzt Christian Friedrich Schulze in einer Zeitschrift unter dem Titel Nachricht von den in der dreßdnischen Gegend vorhandenen Mineralien und Foßilien über diese Kalksteinvorkommen: „Wenn wir zu den auf dieser Seite (der südwestlichen der Elbe) etwas entlegenen Gegenden fortgehen, so haben wir insonderheit die eine Stunde hinter Wilsdruf vorhandene Steinbrüche in einige Betrachtung zu ziehen, welche einen sehr feinen schwarzen Marmor mir weißen Adern und Streifen enthalten, der aber, da man denselben (als Baumaterial) nicht weiter zu nutzen weis, in den bey Schmiedewalde errichteten Kalköfen gebrannt wird. Sonst findet man auch auf den um und hinter Wilsdruf vorhandenen Feldern sowohl einen röthlichen, als auch kirschbraunen Marmor in ziemlich großen Stücken, welche vermuthen lassen, daß in der dasigen Gegend ein Flötz von gleicher Beschaffenheit liegen müsse.“ Ein Rechtsstreit um einen Schadensanspruch von Franz Emil Ranft, der hierin bereits als „Kalkwerksbesitzer in Schmiedewalde“ genannt wird, gegen das Gräflich Einsiedel'sche Eisenwerk als Besitzer des Berggebäudes Lohse Fundgrube zu Schmiedewalde, datiert auf das Jahr 1807 (40001, Nr. 0856). Zur Familie Ranft haben wir noch nicht viel ermitteln können, zumal der Name auch im Staatsarchiv mehrfach auftritt und Namensgleichheiten folglich nicht einfach auszuschließen sind. Den Namen Carl Gottlob Ranft haben wir erstmals 1829 und 1831 in Akten des Bestandes Grundherrschaft Bieberstein (10145) gefunden, worin jener als Viertelhüfner in Hohentanne genannt wird (Nr. 271) und wegen der Frondienste Beschwerde führt (Nr. 282). Etwa zeitgleich amtierte offenbar eher schlecht als recht auch ein Johann Georg Ranft unweit von Schmiedewalde in Blankenstein als Dorfrichter (10527, Nr. 252).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinsichtlich der Lohse Fundgrube sind wir dagegen fündig geworden, wie nachfolgende Risse ‒ wenn auch erst ab den 1850er Jahren ‒ illustrieren. Dabei handelte es sich ‒ ebenso wie bei der Graf Carl Fundgrube ‒ um eine Erzgrube, die im Auftrag der Gräflich Einsiedel'schen Lauchhammerwerke bei Schmiedewalde und bei Burkhardswalde Braunsteinlager im Hangenden des Kalksteins abbaute. Zu den Erzbergwerken gab es natürlich schon immer Akten in den Bergbehörden, während dies auf die grundeigenen (Kalk-) Steinbrüche nicht zutraf. Nach den Eintragungen auf dem ersten Riß ist die Lohse Fundgrube am 18. Juni 1837 auf Eisenstein verliehen worden. Auf dem Riß aus dem Jahr 1851 wurde sie von Markscheider F. H. Steeger dann bereits als „Beilehn von Graf Carl gevierte Fundgrube“ bezeichnet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
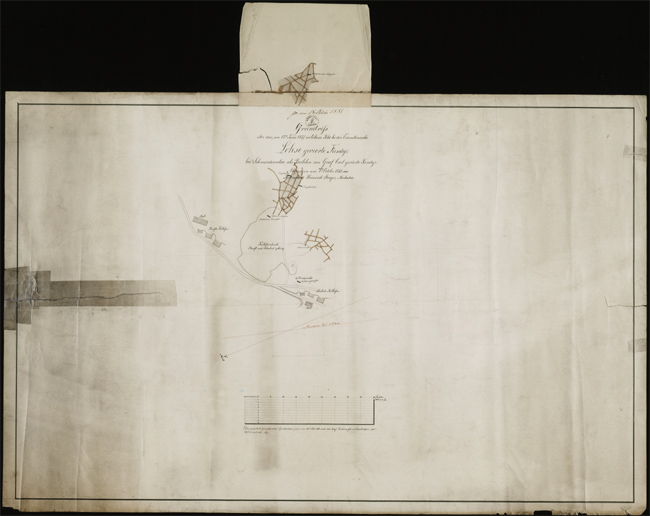 Grundriß über das am 18. Juni 1837 verliehene Feld bei der Eisensteinzeche Lohse gevierte Fundgrube bei Schmiedewalde als Beilehn von Graf Carl gevierte Fundgrube. Abgezogen am 7. October 1851 von Ferdinand Heinrich Steeger, Markscheider. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. K2334, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß links unten. Die Erweiterungen des Abbaus fanden auf dem ursprünglichen Blatt keinen Platz mehr, so daß der Markscheider oben ein Stück Papier ansetzen mußte... Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
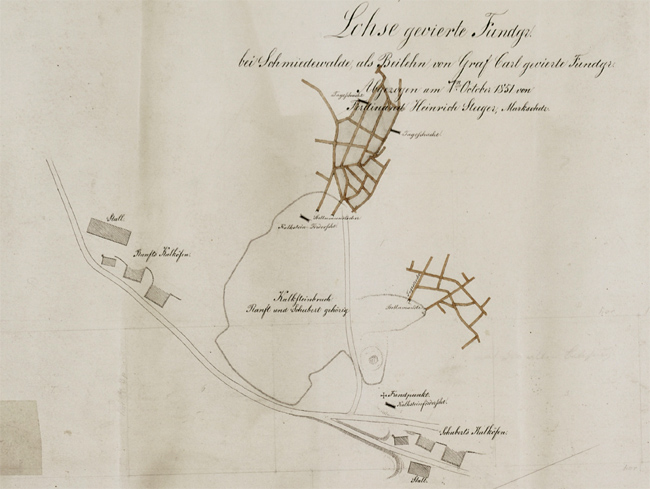 Ausschnitt aus dem obigen Grundriß: Für unser Thema von Interesse ist, daß nordöstlich des Kalkbruchs hier wenigstens zwei - evtl. sogar drei - Öfen als „Ranft’s Kalköfen“ bezeichnet wurden, südwestlich wenigstens zwei weitere als „Schubert’s Kalköfen“. Letzterer muß ebenfalls Gutsbesitzer in Schmiedewalde gewesen sein, denn es gibt noch Gerichtsakten über Grenzstreitigkeiten zwischen Carl Gottlob Ranft und Johann Adolph Schubert, namentlich im Kalkbruch (siehe weiter unten im Text).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obwohl der Beginn des Kalksteinbergbaus bei Schmiedewalde also auch schon auf das Ende des 18. Jahrhunderts oder noch früher datiert, wird im 1823 erschienenen Band 10 des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ bei Schmiedewalde kein Kalksteinbergbau erwähnt. Dagegen berichtet A. Schiffner in seiner 1845 erschienenen „Beschreibung der sächsischen und ernestinischen Lande“ unter dem Stichwort (Roth-) Schönberg: „Schönberg, Rothschönberg (320 E.) an und über einem Nebenwasser der Triebische malerisch gelegen, hat eine ansehnliche Burg mit 3 Thürmen, Kapelle und Kunstwerken, Stammhaus des begütertsten aller sächsischen Adelsgeschlechter… es giebt hier ferner eine der edelsten Schäfereien auf Erden, starke Brauerei und Obstzucht, Ziegel- und Kalköfen, … Das nahe Schmiedewalde hat 200 E. und 1 Kalkofen.“ Der oben schon erwähnte Gutsverwalter Dietze, der 1849 bis 1851 für Herrn Karl Gottlob Töpolt auf Taubenheim Gut und Kalkwerk Burkhardswalde verwaltete, besaß selbst ein Halbhufengut in Schmiedewalde, wo er sich mit Carl Gottlob Ranft und Johann Adolph Schubert auch schon zwischen 1816 und 1847 um Grenzziehungen und um den Abbau von Kalkstein auf seiner Flur stritt (10527, Nr. 301 und 302). Der Name Schubert taucht auch auf dem einen der Risse als Besitzer des südlichen Kalkwerkes wieder auf. Nach dem folgenden Riß aus dem Jahr 1865 war das südliche Werk zwischendurch an einen Herrn Ludwig gekommen. 1867 wird im „Kalkwerksbetrieb Sachsens“ von den Autoren Wunder, Herbrig und Eulitz wieder nur noch ein Kalkwerk bei Schmiedewalde im Besitz des Herrn Ranft in Schmiedewalde angeführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
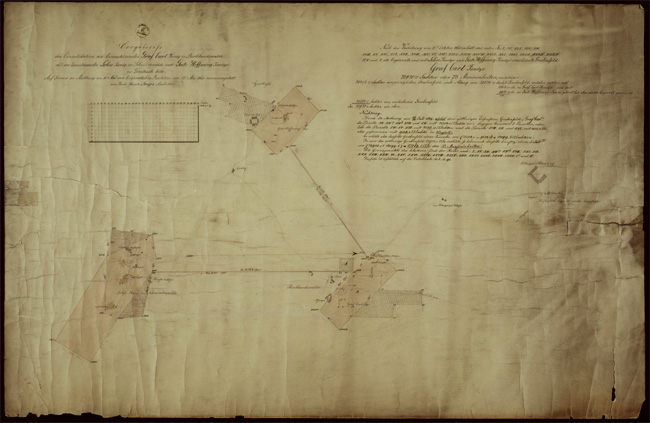 Croquisriß die Consolidation der Eisensteinzeche Graf Carl Fundgr. zu Burkhardswalde mit der Eisensteinzeche Lohse Fundgr. zu Schmiedewalde und Gute Hoffnung Fundgr. zu Groitzsch betreffend. Aufgrund der Muthung vom 10. Mai und bergamtlicher Resolution vom 13. Mai 1865 zusammengestellt von Ferd. Heinr. Steeger, Markscheider. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. K2335, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß rechts. Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ausschnitt aus obiger Croquis mit den Eintragungen der Feldgrenzen der Eisensteingrube Graf Carl bei Schmiedewalde. Es sind hier jetzt wieder auch an der Südwestseite des Kalkbruches mehrere Kalköfen dargestellt; jedoch werden sie nun als „Ludwig’s Kalköfen“ bezeichnet. Zu diesem neuen Besitzer des zweiten Kalkwerkes haben wir noch nichts herausfinden können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Bergschadenkundlichen Analyse (40073-1, Nr. 065) wird ein Pfarrer Böhme zitiert, welcher 1902 mitteilte, daß das größere der beiden aneinander angrenzenden Kalkwerke (das Ranft'sche) bereits 1887 außer Betrieb gegangen sei, weil „man nicht mehr Herr des Wassers geworden sei“. Das Geißler'sche Werk an der Südseite des Tagebaus sei dagegen noch bis 1898 weiter betrieben worden. Geißler besaß zunächst die beiden Kalköfen westlich des Tagebaus. Der bereits zitierte Bericht von Faktor Lorenz in der Akte zur Überwachung des Kalkwerksbetriebes im Bezirk der Amtshauptmannschaft Meißen (40024-12, Nr. 017) enthält auch eine Beschreibung des Schmiedewalder Kalkbruchs von 1884. Demnach wäre der Tagebau samt Kalköfen zu diesem Zeitpunkt bereits ausschließlich im Besitz von „Theodor Geißler, daselbst“ gewesen. Über einen Herrn Geißler in Schmiedewalde haben wir in den Archivakten noch keine näheren Daten finden können. Wie uns Herr A. Zschoche dankenswerterweise hierzu informierte, findet sich dieser Name aber noch in alten Grundbuchblättern für das heute im Besitz der Familie Zschoche befindliche Zweihufengut in Schmiedewalde, zu dem auch der Tagebau und wenigstens einer der Kalköfen gehörte. Die Grundbuchauszüge reichen bis in das Jahr 1844 zurück. Damals wechselte das Gut noch für 6.100 Thaler den Besitzer. Am 24. Juli 1865 hat Herr Clemens Theodor Geißler das Gut von dem Vorbesitzer Carl Ernst Uhlemann für die schon recht beachtliche Summe von 25.000 Thalern erworben. Zum gleichen Datum im Jahr 1891 kaufte es Paul Theodor Geißler „von seinen Miterben“ für die dann schon beträchtliche Summe von 180.000,- Mark, was rund 60.000 Thalern entsprochen hätte. Ob diese Wertsteigerung nur auf Inflation und steigende Grundstückspreise zurückzuführen ist, oder ob die eigene Kalkproduktion dazu beigetragen hat, ist heute wohl nicht mehr nachzuvollziehen. 1912 kaufte das Bauerngut dann zunächst Herr Otto Emil Lorenz, von dem wiederum es im Jahr 1917 schließlich Herr Bernhard Arwed Zschoche erwarb. Ob es sich bei dem oben angeführten Besitzer Otto Emil Lorenz um einen Nachfahren
des uns als Kalkwerksfaktor in Miltitz wohlbekannten Herrn Carl Heinrich
Lorenz handelt, wissen wir auch noch nicht. Aber interessanterweise
kennen wir von anderem Ort auch den Familiennamen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über den Abbau in Schmiedewalde jedenfalls liest man 1884 bei Faktor Lorenz, daß „das Kalksteinlager, dessen Mächtigkeit bis zur jetzigen Abbausohle ca. 25 m beträgt, zutage abgebaut (werde), jedoch hat vor Jahresfrist der Abbau auch unterirdisch im Weitungs- oder Pfeilerbau stattgefunden.“ Dieser Abbau stehe aber zur Zeit unter Wasser. „Das 6 – 9 m mächtige Deckgebirge besteht aus zersetztem Thonschiefer, Eisenstein, Kalksteinfragmenten und Kalkmergel. … Der Kalkbruch ist durch einen 480 m langen Zugstolln gelöst, dessen Sohle ca. 15 m über der Bruchsohle liegt. … Das Kalkbrennen erfolgt in zwei continuierlichen Öfen.“ Die mittlere Belegung betrage 8 Mann. Ein Croqius über den Bruch sei nicht vorhanden. Aus den Kartenbeilagen zur Bergschadenkundlichen Analyse (40073-1, Nr. 065) ist ersichtlich, daß aus dem Schmiedewalder Bach eine Aufschlagrösche abgezweigt war, über die eine Radstube, wohl als Antrieb einer Wasserkunst, beaufschlagt wurde. Der Wasserlösestollen führte von der Radstube in westliche Richtung (etwa parallel zum Tal des Schmiedewalder Bachs) und führte das Wasser noch oberhalb der Triebisch wieder in den Bachlauf zurück. 1936 / 1937 interessierte sich die Lagerstättenforschungsstelle des Oberbergamtes (40030-1, Nr. 1077) noch einmal für den Tagebau in Schmiedewalde. Das Gutachten umfaßt eine Beschreibung der Aufschlüsse im noch vorhandenen Tagebau und zitiert eine chemische Analyse von 1867. Zu einer Wiederaufnahme kam es jedoch schon damals nicht, obwohl dieser Kalkstein für die Herstellung von Zement besser geeignet sei, als der Miltitzer Marmor. Die Rösche sei zwar vorhanden, aber zu hoch angesetzt, um den Bruch zu entwässern. Auch die Öfen seien (1936) schon vollständig verfallen gewesen. Der Wasserlösestolln muß zum Zeitpunkt der Erstellung der BSA (1969) noch fahrbar gewesen sein. Er soll vom Tagebau nach Westen ein Profil von etwa 1,0 m x 1,7 m haben, die Stollnrösche ab dem 2. Lichtloch dann nur noch von 0,4 m x 0,8 m.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnitt aus den Freiberger Gangkarten, welche im 19. Jahrhundert im Oberbergamt zu Freiberg zu Übersichtszwecken geführt wurden. Unterhalb von Schmiedewalde sind hier Kalkbrüche und Öfen sowie die Lohse Fundgrube verzeichnet. Unterhalb am Südhang des Seitentales ist auch das Stollenmundloch eingezeichnet. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044-2 (Generalrisse, Gangkarten), Nr. K19, Ausschnitt, Norden ist rechts oben. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meilenblätter von Sachsen, Freiberger Exemplar, Handzeichnung, ab 1792, Nachträge und Ergänzungen bis in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts, Ausschnitt aus Blatt No. 198 mit der Darstellung der damaligen Bruchkontur, eines Kalkofens und - weiter talabwärts Richtung Triebischtal (am linken Bildrand) - des Ansatzpunktes des Wasserlösestollens. Außerdem wurde eine Eisensteingrube (Lohse Fdgr.) nachgetragen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch im Dresdner Exemplar ist die Lohse'sche Eisensteingrube eingezeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Derselbe Ausschnitt im Berliner Exemplar der Meilenblätter: Darin fehlt die Eisensteingrube noch. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Reste der Ranft'schen Kalköfen am Schmiedewalder Kalkbruch, Aufnahme P. Schulz, 1950.
Einen Blick auf den heutigen
Zustand ermöglichen wir
Link zur Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Töpolt´s, später Schmutzler´s
Kalkwerk in Burkhardswalde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In Burkhardswalde sei nach dem historischen Ortsverzeichnis von Sachsen schon 1723 ein Kalkofen erwähnt. In der Datenbank des Staatsarchives haben wir einen Hinweis auf die geplante Errichtung eines Kalkbrennofens „beim zum Schenkgut in Taubenheim gehörenden Kalksteinbruch“ aus dem Jahr 1792 gefunden (10079, Loc. 12141/02). Der Kalkabbau begann nach W. Schanze aber erst, nachdem 1834 der damalige Pfarrer Bauer das Vorkommen unter den Pfarrfeldern entdeckt hatte. Der schon 1814 erschienene Band 1 des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ erwähnt vermutlich aus diesem Grund bei Burkardswalde noch keinen Kalksteinbergbau. Im gleichen Grubenfeld war etwa ab 1837 die Graf Carl Fundgrube auf Brauneisenstein verliehen, jedenfalls trägt eine Croquis über das Gevierte Feld auf den Eisensteinzechen Graf Karl bei Burkhardswalde, Lohse Gevierte Fundgrube bei Schmiedewalde und Gute Hoffnung Fundgrube bei Groitzsch das Datum 4. Oktober 1837 (40040, Nr. B2331). Vermutlich war die Grube Graf Carl von Beginn an im Besitz der Grafen von Einsiedel, die das Erz in ihrer Eisenhütte in Gröditz verarbeiteten. Der Name der Grube kann auf Carl Friedrich Graf von Einsiedel (*1791, †1872) aus der Wolkenburger Linie derer von Einsiedel zurückgehen, vielleicht auch auf Detlev Carl Graf von Einsiedel (*1737, †1810), welcher 1776 die damaligen Lauchhammerwerke erbte. In den Folgejahren erwarb sich unter seiner und seiner Nachfahren Leitung insbesondere die Eisen- Kunstgießerei in Lauchhammer Weltruhm. 1840 gründete Detlev von Einsiedel (*1773, †1861) die „Gewerkschaft der Gräflich Einsiedelschen Eisenhütten“, welche neben dem Hauptwerk in Lauchhammer nun auch Eisenhütten in Berggießhübel, Riesa und Gröditz umfaßte. Trotz aller Bemühungen gestaltete sich die Geschäftsführung der Eisenhütten aber nach 1850 immer schwieriger, da alle Standorte weit entfernt von den nötigen Erz- und Steinkohlevorkommen lagen und insbesondere der Hauptstandort in Lauchhammer verkehrstechnisch damals noch nur schwer erreichbar war. Nach dem Tod von Detlev Graf von Einsiedel war die Hüttengewerkschaft 1871 / 1872 daher wegen Überschuldung zum Verkauf der anderen Betriebsteile gezwungen (wikipedia.de).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schon infolge des Wiener Kongresses 1815 war Gröditz an Preußen gefallen und ‒ zumindest für die „rechts der Elbe gelegenen Raseneisenerzvorkommen“ ‒ hatte 1840 auch Carl Friedrich August Freiherr Dathe von Burgk Mutung beim Bergamt Altenberg eingelegt (40006, Nr. 1871). Auch die Abbaurechte der Graf Carl Fundgrube in Burkhardswalde könnten auf gleichem Wege zwischenzeitlich an die Freiherren von Burgk gelangt sein (40010, Nr. 3167). Die Freiherrlich von Burgk'er Herrschaft geht auf Carl Gottfried Dathe zurück, welcher das Rittergut Burgk im heutigen Freital 1767 erwarb. Dessen Neffe, Carl Friedrich August Krebß (*1791, †1872), übernahm nach dem Tod seines Onkels 1819 das Rittergut, kaufte 1829 ein Adelsdiplom und nannte sich fortan Freiherr Dathe von Burgk. Die Familie ist vorallem als erfolgreiche Bergbauunternehmer im Steinkohlenbergbau des Plauenschen Grundes bekannt. Nach Unterlagen des Ritterguts Munzig
sei das Kalklager jedenfalls im Jahr 1840 von Bergleuten des Barons von Burgk in der
Eisensteingrube Graf Carl angetroffen worden. Am 3. Januar 1841
begann man dort mit dem Abbau des Kalksteins und teufte dazu auch einen neuen
Tagesschacht ab, der bis 1858 schon eine Teufe von 54 Ellen (rund 27 m)
erreicht hatte. In dieser Zeit wurde auch der Kalkofen neben dem Huthaus
der Graf Carl Fundgrube errichtet. Der heute stark verwitterte
Die Grubenakten des Bergamtes Freiberg führen dagegen die Graf Karl Fundgrube ‒ seit 1865 konsolidiert mit Gute Hoffnung Fdgr. bei Groitzsch und Lohse Fdgr. bei Schmiedewalde ‒ noch bis 1866 als „...im Besitz der Gräflich Einsiedel'schen Eisenwerke Gröditz“ auf. In einer Beschreibung mehrerer Eisensteingruben der Region aus dem Jahr 1862 (40003, Nr. 295, Blatt 22, Rückseite) heißt es dazu im allgemeinen und speziell unter Bezug auf die Lohse Fundgrube bei Scmiedewalde: „Von den im Laufe der beiden vorigen Betriebsperioden entstandenen und im Vorstehenden oben aufgezählten Grubenbauen sind viele schon längst wieder ausgesetzt, davon noch vorhandene sowie die in den jüngsten Zeiten noch hinzugekommenen sind auf dem beiliegenden Riß zu ersehen, der aber eben nur für den Augenblick einen Werth hat, da sich in Folge des schnellen Fortschreitens des Betriebes, wobei man die überflüssig gewordenen Strecken so bald als möglich wieder aussetzt, das Bild der Grube oft schon nach sehr kurzer Zeit bedeutend verändert...“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
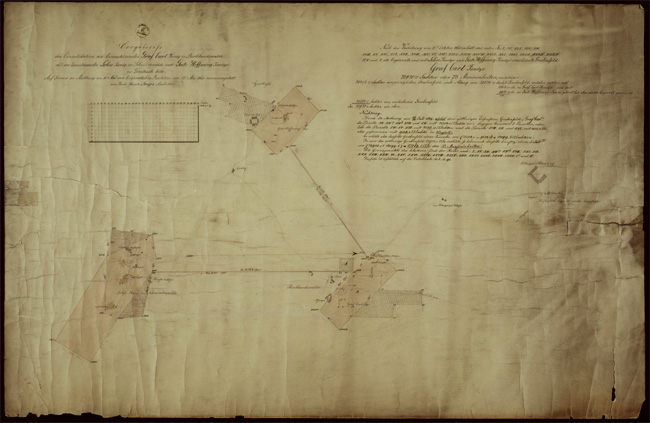 Croquisriß die Consolidation der Eisensteinzeche Graf Carl Fundgr. zu Burkhardswalde mit der Eisensteinzeche Lohse Fundgr. zu Schmiedewalde und Gute Hoffnung Fundgr. zu Groitzsch betreffend. Aufgrund der Muthung vom 10. Mai und bergamtlicher Resolution vom 13. Mai 1865 zusammengestellt von Ferd. Heinr. Steeger, Markscheider. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. K2335, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß rechts. Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
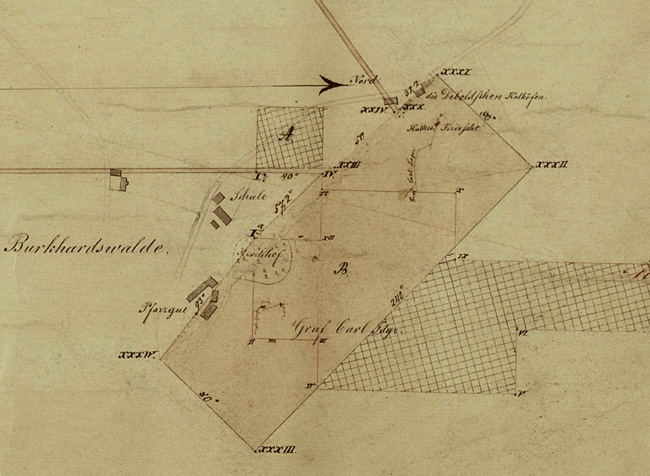 Ausschnitt aus obiger Croquis mit den Eintragungen der Feldgrenzen der Eisensteingrube Graf Carl bei Burkhardswalde. Talwärts in Richtung Munzig ist hier noch immer ein Kalkofen dargestellt; dieser wird hier als „Debold’scher Kalkofen“ beschriftet. Ob diese Bezeichnung auf den Namen Töpolt zurückgeht, haben wir noch nicht herausfinden können. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etwas genauer als die obige Croquis,
welche relativ großmaßstäblich in erster Linie die zur Verleihung
gekommenen und ab 1865 konsolidierten Baufeldgrenzen der drei vorher
eigenständigen Gruben abbildet, stellt die Situation in Burkhardswalde der
folgende „Grundriß über das … verliehene Feld bei der Eisensteinzeche
Graf Carl gevierte Fundgrube bei Burkhardswalde“ dar. Er wurde zwar
erst 1851 aufgenommen, nennt uns aber als Datum der Verleihung (und
folglich auch der Aufnahme des Eisensteinbergbaus durch die Graf Carl
Zeche) nun genauer den 5. April 1837.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Grundriß über das am 5. April 1837 verliehene Feld bei der Eisensteinzeche Graf Carl gevierte Fundgrube bei Burkhardswalde, abgezogen am 6. October 1851 von Ferdinand Heinrich Steeger, Markscheider. Zuletzt nachgebracht am 15. März 1853 von F. H. Steeger. Unter dem Titel ist außerdem vermerkt: „Die punctirt gezeichneten Grubenbaue und Tagesituation sind von dem betreffenden Zechenrisse aufgetragen, am 26. Februar 1862, C. W. Weinhold.“ Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. C2332, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß rechts. Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnitt aus obigem Riß mit der Lage der letzten Tageschächte der Graf Carl Fundgrube bei Burkhardswalde. Beim Schacht mit der Kaue unten – nördlich des Pfarrgutes gelegen – ist vermerkt: „Tageschacht eingeebnet 23. IX. 07.“ – gemeint ist dessen Verfüllung im Jahr 1907. Rechts oben im Ausschnitt ist auch eine „Kalkbruch- Pinge“ verzeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein weiterer Ausschnitt aus dem obigen Grundriß mit der Lage des unterirdisch bebauten Kalkbruchs und des Stollens „im Streichen des Graf Carl Lagers.“ Weiter westlich (im Bild oben) an dem Weg in Richtung Munzig sind auch hierin wieder die „Deboldschen Kalköfen“ wieder eingezeichnet; diese sind jedoch nur „punctirt“ gezeichnet, also von einem anderen Riß übertragen. Grau unterlegt wurde der „Kalkabbau“ am Stolln. Am Hang oberhalb von den Öfen sieht man außerdem den „Kalkstein Förderschacht.“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Blick auf den heutigen
Zustand ermöglichen wir
Wir
verwenden das Digitalisat aus der Deutschen Fotothek. Link zur
Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die letzte Rißnachbringung für die Graf Carl Fundgrube erfolgte 1872 (40036, Nr. K11891), vermutlich ist also der Eisensteinabbau auch in Burkhardswalde spätestens am Ende der Gründerzeit endgültig zum Erliegen gekommen. Die Eisenbahn hatte längst den Import ausländischer Erze billiger, als die Gewinnung geringhaltiger Erze aus kleinen Lagerstätten im eigenen Land, gemacht... 1877 wurde das gesamte Abbaufeld dieser drei konsolidierten Gruben dann noch einmal an eine Kommanditgesellschaft G. Müller & Co. in Berlin verkauft, die es aber bald darauf lossagte. Zur Verfüllung der infolge des Kalksteinabbaus entstandenen Pingen wurde 1907 Haldenmaterial verwendet (40174, Nr. 1273). Auf dem oben gezeigten Grundriß ist dieses Datum ebenfalls vermerkt: Der Tageschacht war demnach bis zum 23. September 1907 vollständig verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahr 2011 kam es bei Munzig zu einem
Tagesbruch im Baufeld der ehemaligen Eisensteingrube Graf Carl. Unser Beitrag
widmet sich zwar eigentlich dem Kalkstein- und Marmor- Abbau und nicht dem
Erzbergbau, aber da sich Kalkstein und Brauneisensteinlager sehr oft in
unmittelbarer Nähe fanden, freuen wir uns, daß uns folgendes Bildmaterial von
der Sanierung dieses Tagesbruches zur Verfügung gestellt wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahr 1835 hatte Karl Gottlob Töpolt das Rittergut Taubenheim samt zugehörigen Gütern in Birkenhain und Sora bei einer Versteigerung „wegen der Schulden der Besitzerin Johanna Wilhelmine Tauchnitz, geb. Kees“ erworben (10057, Nr. 2050). Die Familie Töpolt stammt eigentlich aus Schletta bei Meißen. Hier war Johann Gottlob Töpolt wenigstens seit 1811 als Landschöppe, seit 1847 als Landrichter bestellt. Da sowohl Kalkstein, als auch
Eisenerze nur unter das niedere Bergregal fielen, konnten die
Grundbesitzer über solche, auf ihrem Grund und Boden vorhandenen Rohstoffe
frei verfügen. So verkaufte auch das Pfarramt 1837 die
Abbaurechte am Kalkstein in Burkhardswalde für 2.700 Thaler an Herrn Töpolt. Aus
den
Der Abbau erfolgte nur noch Untertage, ausgehend von dem inzwischen rund 450 m lang gewordenen und am Göpelschacht in etwa 30 m Tiefe einkommenden Stolln. Der Stolln war unweit des noch erhaltenen Kalkofens angesetzt und verlief in Richtung der Burkhardswalder Kirche (nach Südosten). Bereits am Göpelschacht brachte er etwa 13,5 m Teufe ein. Das Lager sei 3 m bis 6 m mächtig und nach Westen auskeilend. Die Überdeckung wird durch Tonschiefer, Kiesel- und Alaunschiefer gebildet; darin das Lager von Brauneisenocker mit bis zu 3,5 m Mächtigkeit, auf dem bereits die Graf Carl Fundgrube abbaute. Im Hangenden fand sich stellenweise ein zweites Lager (BSA, Nr. 065).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berichtet wird auch, daß „hinter der Schmiede“ Kalk abgebaut worden sei (W. Schanze). Auch A. Schiffner berichtet in seiner 1845 erschienenen „Beschreibung der sächsischen und ernestinischen Lande“ unter dem Stichwort (Roth-) Schönberg: „Schönberg, Rothschönberg (320 E.) an und über einem Nebenwasser der Triebische malerisch gelegen, hat eine ansehnliche Burg mit 3 Thürmen, Kapelle und Kunstwerken, Stammhaus des begütertsten aller sächsischen Adelsgeschlechter… Der Marktflecken Burkhardswalde (230 E.) in ähnlicher Lage, mit Freigut, Gasthof, Eisen- und Kalkbau, zeigt 1 schöne gothische Kirche mit 2 Thürmen, und ist zum Theil Taubenheimisch...“ An gleicher Stelle heißt es ferner auch über Taubenheim: „Taubenheim ( 540 E.), dessen gethürmtes Bergschloß die Stammburg eines sonst wichtigen Geschlechtes war, liegt an der kleinen Triebisch, und hat starke Wirthschaft, edle Schäferei, Kalk - und Ziegelöfen, 3 Mühlen… Der hiesige Pfarrer Maucke ist als Naturforscher bekannt.“ 1851 ist Karl Gottlob Töpolt verstorben, woraufhin die Güter und der Kalkbruch zunächst an den vormaligen Gutsverwalter Leberecht Ernst Dietze verpachtet wurden (10057, Nr. 2057). In der Folgezeit wechselten die Besitzer mehrfach. Aus einem Schreiben des Königlichen Gerichtsamtes zu Meißen geht hervor, daß wenigstens noch bis 1867 die unmündigen Kinder von Herrn Töpolt formal im Besitz des Rittergutes Taubenheim gewesen sind. Darin heißt es „In dem Kalkbruche zu Burkhardswalde, welcher Eigenthum meiner Mündel, der Geschwister Töpolt auf Taubenheim und von Herrn Rittergutsbesitzer Roßberg auf Taubenheim mitgepachtet ist, ist vor einiger Zeit ein Pfeiler eingestürzt, der auch die Hauptstrecke verschüttet (hat) und ein weiteres Abbauen für jetzt ohnmöglich geworden (ist). Da nun mit dem ...Pächter bezüglich der Aufbringung der Wiederherstellungskosten eine Differenz entstanden ist, so ist die Kgl. Vormundschaftsbehörde des Kgl. Gerichtsamtes Meißen ersuchtt worden, die Sache ins Verhör zu nehmen, vorher aber müßte ... noch ein anderweites sachverständiges Gutachten ermittelt (werden). Das kgl. Gerichtsamt hat daher beschlossen, das Kgl. Oberbergamt ein solches abgeben zu lassen...“ Der Verfasser dieses Schreibens vom 2. April 1867, dessen Unterschrift leider völlig unleserlich ist, bat um die Mitteilung des Termins des Eintreffens eines Sachverständigen, um seinerseits die nötigen Vorkehrungen treffen zu können. Was dabei herausgekommen ist, erfahren wir aus dieser Akte leider nicht (40001, Nr. 2976). Den hier genannten Familiennamen Roßberg
kennen wir auch schon als Besitzer von Gütern und Kalkwerken in Münchhof bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Grundriß über das am 5. April 1837 verliehene Feld bei der Eisensteinzeche Graf Carl gevierte Fundgrube bei Burkhardswalde, abgezogen am 6. October 1851 von Ferdinand Heinrich Steeger, Markscheider. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. K2332, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß rechts. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ausschnitt aus obigem Riß: Außer dem Vortrieb einiger weniger Untersuchungsstrecken, ausgehend von mehreren kleinen Untersuchungsschächtchen, ist im ursprünglichen Feld der Garf Carl Fdgr. nicht wirklich viel passiert. Grün markiert (unten im Ausschnitt) der bis zum 23. September 1907 endgültig verfüllte Tageschacht und dessen wieder eingeebnete Bergehalde. Nördlich vom Friedhof (etwa Bildmitte) ist hier eine „Kalkbruch- Pinge“ verzeichnet, die der Stolln aber noch längst nicht erreicht und unterfahren hatte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Uns interessiert hier natürlich der Kalkstolln, der vom Mundloch hinter den „Debold'schen Kalköfen“ ausging und in südöstlicher Richtung vorgetrieben war. Ob diese Bezeichnung auf den Namen Töpolt des Gutsbesitzers auf Taubenheim zurückgeht, haben wir noch nicht herausfinden können. Zwischendurch schwenkte der Stolln auch abschnittsweise auf das „Streichen des Graf Carl Lagers“ ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Revision des Faktors Lorenz im Auftrag der Amtshauptmannschaft Meißen (40024-12, Nr. 017) benennt dann im Jahr 1885 als Besitzer einen Herrn R. Schmutzler, daselbst, und erwähnt, daß „behufs besserer Wettercirculation …in der Nähe des gegenwärtigen Abbaus vom Tage nieder bis in die Stollnsohle ein 35,68 m tiefer Wetterschacht niedergebracht worden“ sei. Die Belegung habe nur 5 Mann umfaßt. Immerhin sei (wohl aufgrund der Mitbenutzung des Stollens durch die Eisenerzgrube Graf Carl) „über die Lage und Ausdehnung der Kalkbruches ein vollständiger Grund- und Saigerriß vorhanden.“ Bereits 1866 sei nach Lorenz' Angaben das Brauneisensteinlager aber vollständig abgebaut gewesen. Besagten Herrn R. Schmutzler haben wir bisher noch nicht ausfindig machen können. Möglicherweise handelt es sich aber um einen – gewissermaßen fachlich vorbelasteten – Nachfahren jenes Johann Gottlieb Schmutzler, welcher bereits zwischen 1816 und 1831 Kalkbrenner im Kalksteinbruch Hermsdorf gewesen ist (vgl. 10050, Nr. 1647 und 40174, Nr. 1401). Vermutlich blieb diese Familie Schmutzler aber beim fiskalischen Kalkwerk ansässig, weil hier auch noch im Jahr 1879 ein Christian Gottlieb Schmutzler als Gutsbesitzer und Kalkwerksverwalter in Hermsdorf genannt wird (10036, Loc. 32349). Interessanterweise taucht ein Herr Schmutzler aber außerdem im Jahr 1846, ausgerechnet in einer Akte der Grundherrschaft Burgk auf, welcher nämlich in diesem Jahre „auf Zahlung rückständigen Schreiberlohnes“ vor dem Justizamt Dresden gegen den Baron von Burgk Klage erhob, anschließend aber von demselben entlassen wurde (10168, Nr. 0166). Ob hier Zusammenhänge mit dem von Burgk'schen Engagement im Eisenerzbergbau von Burkhardswalde bestanden, müssen weitere Recherchen klären...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Akte 40024-12, Nr. 007 findet sich unter dem 14. Juli 1892 dann die Mitteilung, daß „das Kalkwerk gegenwärtig außer Betrieb (sei), da der Besitzer flüchtig geworden ist.“ Als Besitzer wird in diesem Zusammenhang ein Herr Starke genannt. Möglicherweise hatte dieser in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Gründerzeit das Werk von Schmutzler erworben, mangels Kapital aber keine Wiederaufnahme zustandegebracht. Danach muß es im Zuge einer Enteignung an einen Herrn Friedrich Oswald Ferdinand Irmscher gekommen sein, wohnhaft in Liebenwerda, welcher aber ebenfalls in Ermanglung von Betriebskapital den Abbau nicht wieder aufnahm. Das Bergamt einigte sich schließlich 1905 mit dem Pfarramt als Grundbesitzer, daß dieses die Verwahrung der noch offenen Schächte übernehmen solle. So richtig zahlungswillig war man dort aber auch nicht und so zogen sich die Verhandlungen hin. 1907 wurde dann erstmals Haldenmaterial von der Eisensteingrube zur Verfüllung der infolge des Kalksteinabbaus entstandenen Pingen verwendet (40174, Nr. 1273). 1912 wurde dann noch einer der Kalköfen abgebrochen und das Material z. T. für die weitere Schachtverfüllung genutzt. Ursprünglich muß das Töpolt'sche und dann Schmutzler'sche Kalkwerk demnach sogar drei Kalkbrennöfen besessen haben, von denen aber nur einer bis heute erhalten geblieben ist. Weil das noch vorhandene Halden- und Abbruchmaterial aber immer noch nicht ausreichte, wurden die anderen Schächte überwölbt und nur deren tagesnaher Abschnitt verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meilenblätter von Sachsen, Freiberger Exemplar, Handzeichnung, ab 1792, Nachträge und Ergänzungen bis in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts, Ausschnitt aus Blatt No. 198 mit der Eintragung der "Kalksteingrube", der "Graf Carl Eisensteingrube" sowie zweier Kalköfen am nordwestlichen Ortsrand von Burkhardswalde. Auch dieser Ortsname wies in der Vergangenheit verschiedene Schreibweisen auf: Hier "Burckertswalde".
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der tiefe Stollen wurde noch lange zur Wasserentnahme genutzt und ist jedenfalls Anfang der 1970er Jahre (40073-1, Nr. 065) noch bis an die untertägigen Weitungsbaue heran fahrbar gewesen. Zu dieser Zeit mußte die damalige Bergsicherung Dresden, heute Bergsicherung Freital GmbH, einen Damm im Stollen instandsetzen. Freilich war das Wasser sehr kalkhaltig und unter heutigen Kriterien eigentlich gar nicht als Trinkwasser verwendbar (Informationen von Herrn G. Mehler). Eine Kopie des Befahrungsberichtes der Bergsicherung an den Wasserversorger, VEB WAB, Betriebsbereich 5 in Radebeul, vom 20. Mai 1971 ist erhalten geblieben und im Besitz der Heimatfreunde im Triebischtal. Diesem Bericht sind die folgenden Aufnahmen entnommen, die uns heute noch einmal einen kleinen Eindruck von diesem Kalkabbau vermitteln können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Kalksteinvorkommen im unteren
Triebischtal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalksteinabbau
existierte
ferner auch
im Pfarrholz bei
Tanneberg, am Südrand von
Kottewitz sowie im
Steinbruch
am Weinberg bei Rothschönberg.
C. F. Naumann erwähnte im Heft 5 der Geognostischen Beschreibung des Königreiches Sachsen neben den bekannten und oben beschriebenen noch weitere Vorkommen von Kalksteinen im Umfeld des Triebischtals: „Bei Kottewitz ist durch einen Tagebruch ein 5 bis 6 Ellen mächtiges Kalksteinlager aufgeschlossen, dessen Gestein bläulichgrau und weiß gestreift und sehr feinkörnig ist; über dem Kalksteine liegt ein an Hornblendschiefer erinnernder Grünsteinschiefer, welcher in der Nähe der Auflagerungsfläche sehr reich an Eisenoxydhydrat ist.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferner nennt Naumann: „Oestlich von Rothschönberg im Triebischthale am südlichen Fuße des sogenannten Weinberges liegt ein unbedeutender Kalksteinbruch in einem Lager von theils schwärzlichgrau und weiß gestreiftem, theils graulich weißem, mit gelben Thonschiefer-Lamellen durchzogenen Kalkstein; der ihn einschließende Thonschiefer zeigt eine äußerst verworrene Schichtung. Oberhalb des Lagers steht dunkelbläulichgrauer Thonschiefer an, welcher zuletzt, dicht vor dem Kalksteine, hor. 9,4 streicht und 40 bis 60° in Nordost fällt; unterhalb des Lagers folgt grünlichgrauer Thonschiefer, der hor. 4 streicht und 20° in Nordwest einschießt.“ Und auch „Südlich von Groitzsch befindet sich auf dem rechten Ufer der Triebisch, Alt-Tanneberg gegenüber, ein Kalksteinlager, welches gegenwärtig nicht mehr bebaut wird; dasselbe ist in grünlichgrauem Thonschiefer eingelagert, welcher im Hangenden des Lagers sehr gewunden und reich an Kalkspathadern ist; er streicht hor. 4,4 bis 5 und fällt 30° in Nordwest.“ Im Jahr 1789 hatte Rudolph Christoph von Schönberg auf Tanneberg mit der dortigen Schule ein Grundstück „wegen Anlegung eines Kalksteinbruches“ getauscht (10588, Nr. 042). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu dem Steinbruch am Weinberg ist bei Pietzsch 1914 zu lesen: „Am Weinberg bei Rothschönberg ist am rechten Gehänge des Triebischtales ein Steinbruch angesetzt, durch welchen nach Naumann ein Lager von teils schwärzlichgrau, teils graulich-weißen, von Tonschieferhäutchen durchzogenen Kalkstein abgebaut worden ist.“ Und weiter: „Südlich von Groitzsch geht am rechten Gehänge des Triebischtales ein Kalksteinlager zutage aus, das jedoch bis auf die Talsohle hinab fast völlig abgebaut ist...“ Bereits 1905 sollen hier zwei tiefe Stollen verwahrt worden sein, die schon von denen von Heynitz, früher auch Besitzer des Rittergutes Groitzsch, aus dem Triebischtal heraus nach Osten angesetzt wurden. Sie hatten wohl dem Abbau dieses kleinen Kalkvorkommens gedient, welches 1846 in der geognostischen Karte noch vermerkt ist und auch von Pietzsch 1914 noch erwähnt wurde. Die Stollnmundlöcher waren schon im Zeitraum der Erstellung der BSA in den 1970er Jahren nicht mehr auffindbar (40073, Nr. 065).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Außer diesen Kalksteinbrüchen bauten auch einige Erzgruben untertägig angefahrene Kalklager mit ab. Kalkstein wurde auch mit dem Wildemann Stolln sowie im Hilfe Gottes Stolln (40003, Nr. 250) in Niedermunzig angefahren und zeitweise als Nebenprodukt gefördert. Auch die Frisch Glück Fundgrube in Obermunzig gewann das bei der Suche nach Erz angefahrene Kalklager mit herein. Das Niedermunziger Lager beschrieb W. Vogelgesang im Jahr 1851 in einem Bericht für die Geologische Landesuntersuchung (40003, Nr. 250). Auf dessen Bericht griff 1914 auch K. Pietzsch zurück: „Das Kalklager von Munzig, welches am Wege von Burkhardswalde nach Munzig gelegen ist, fällt auch bereits in den Kontakthof des Meißener Syenites. Über die näheren Verhältnisse dieses Lagers, welches früher durch einen in der Talsohle etwa 200 m oberhalb der Munziger Schäferei angesetzten Stollen erschlossen und auch mit einem Tagesschacht durchsunken war, gibt ein ausführlicher Bericht von Bergmeister Vogelgesang Auskunft. Westlich vom Stollen streicht das Lager südöstlich (hora 9) und ist gegen 6 m mächtig. Östlich davon hingegen biegt das Streichen nach hora 7 um; gleichzeitig zerschlägt sich das Flöz in zwei durch ein Zwischenmittel von metamorphem Diabastuff getrennte Teile ... Der Kalkstein ist vorwiegend mittel- bis feinkörnig, sowie von krystallinischem Gefüge, teilweise jedoch auch dicht und splitterig oder muschlig brechend. Im ersteren Falle erscheint er durchweg weiß oder rötlichweiß, im letzteren lichtgrau. In den nordwestlichen Teilen des Lagers beeinträchtigen nicht selten Eisenocker führende Klüfte und Drusen seine Reinheit. Im Hangenden wird das Lager von Tonschiefern, im Liegenden von Hornblendeschiefern (kontaktmetamorphem Diabastuff) begrenzt. In der unmittelbaren Nähe des Kalksteins erweist sich sowohl der Tonschiefer, wie der Hornblendeschiefer reich an Augen, Nestern und Trümern von Kalkspat.“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
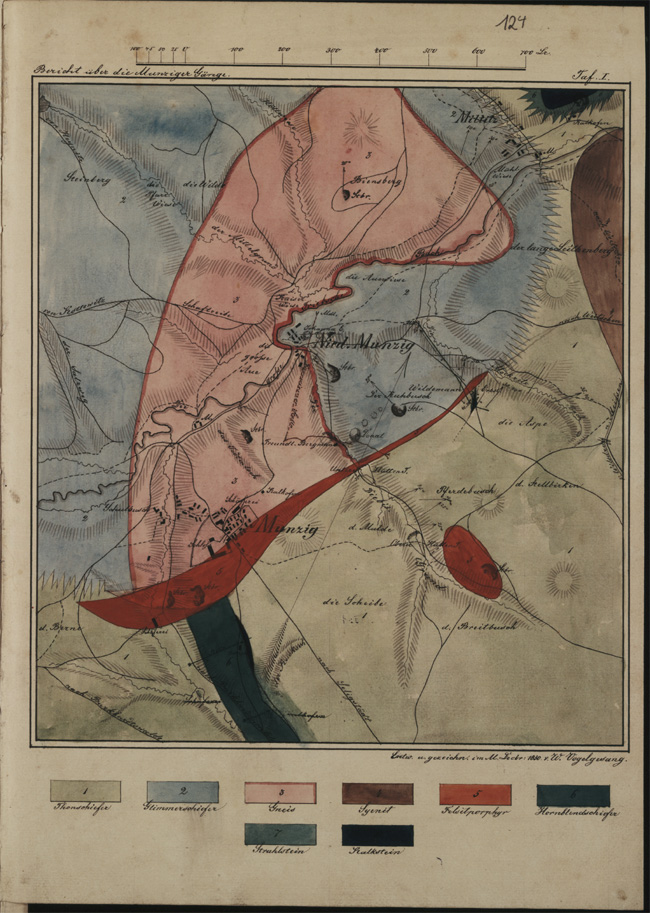 Karte zur geologischen Beschreibung der Region von Miltitz (rechts oben) bis Obermunzig aus seinem Bericht über die Munziger Gänge von A. Vogelgesang aus dem Jahr 1851. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003 (Geognostische Landesuntersuchungskommission beim Oberbergamt), Nr. 250, Blatt 124, Gesamtansicht, Norden ist oben. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im Ausschnitt rechts oben ist der Wildemann oder Tiefe Hilfe Gottes Stollen zu sehen, mit dem südöstlich des Porphyrganges (rot) das Grünstein- und Kalklager angefahren wurde. An der Straße von Ober- nach Niedermunzig ist hier auch noch ein weiterer Kalkofen eingezeichnet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
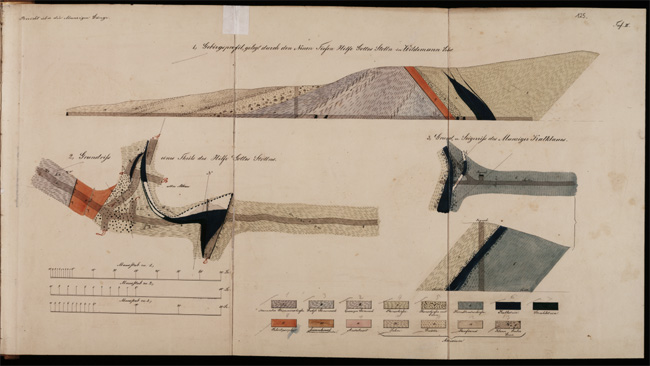 Der zum Bericht über die Munziger Gänge von A. Vogelgesang aus dem Jahr 1851 gehörige Profilschnitt. Rechts unten der Grund- und Saigerriß des Munziger Kalkbaues. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003 (Geognostische Landesuntersuchungskommission beim Oberbergamt), Nr. 250, Blatt 125, Gesamtansicht. Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
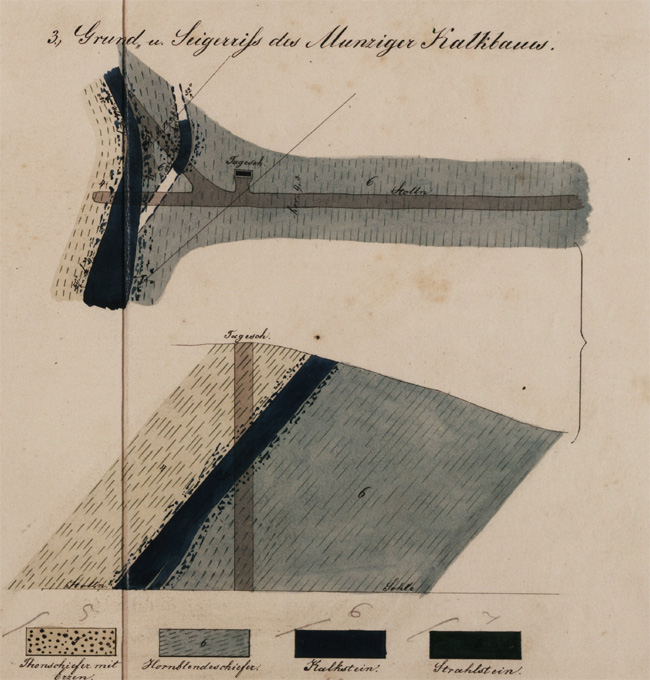 Ausschnittsvergrößerung aus den obigen Schnittdarstellungen. Leider sind die verwendeten dunklen Farben für den Kalk- bzw. Strahlstein durch die Alterung kaum noch zu unterscheiden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Kalkbruch und Kalkofen wird
bereits 1838 auch
in den Akten des Rittergutes Munzig erwähnt, jedoch in das
benachbarte
Unsere Nachsuche in den Archiven ergab, daß in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (zwischen 1860 und 1869) das Rittergut Munzig von der Familie von Könneritz an einen Herrn Herrmann Gruhle übergegangen ist (10396, Nr. 007). 1886 war das Rittergut dann im Besitz der vier Brüder Eigen, Georg, Alexander und Arthur Gruhle. Letzterer klagte einige Jahre nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Rothschönberger Stollens, im Jahr 1886 nämlich, gegen den Sächsischen Staatsfiskus wegen „Fischereischäden“ durch die in die Triebisch eingeleiteten Grubenwässer aus dem Freiberger Revier (40026, Nr. 146). Die Verhandlungen um Schadensansprüche „auf Grund der Verunreinigung des Triebisch durch den Abfluß der Grubenwasser aus dem Rothschönberger Stollen“ zogen sich bis 1889 hin (10036, Loc. 39270, Rep. 33, Spec. Nr. 7887). Auch im „Kalkwerksbetrieb Sachsens“ wird von den Autoren Wunder, Herbrig und Eulitz noch im Jahr 1867ein Kalkwerk im Besitz eines Herrn Gruhle in Munzig angeführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
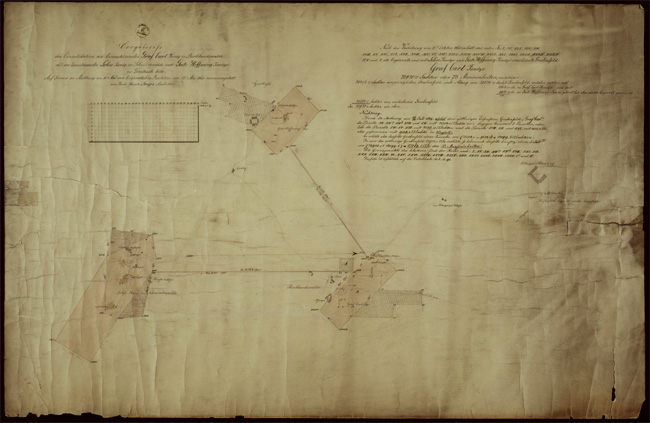 Croquisriß die Consolidation der Eisensteinzeche Graf Carl Fundgr. zu Burkhardswalde mit der Eisensteinzeche Lohse Fundgr. zu Schmiedewalde und Gute Hoffnung Fundgr. zu Groitzsch betreffend. Aufgrund der Muthung vom 10. Mai und bergamtlicher Resolution vom 13. Mai 1865 zusammengestellt von Ferd. Heinr. Steeger, Markscheider. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040 (fiskalische Risse zum Erzbergbau), Nr. K2335, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß rechts. Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ausschnitt aus obiger Croquis mit der Eintragung zweier weiterer Kalköfen (linker Bildrand) südlich unterhalb der ehemaligen Grube Frischglück gelegen, welche nach der Beschriftung hier dem Rittergut Munzig zugehörten. Das Grubenfeld von Frisch Glück Fdgr. (rechter Bildrand) wurde bei der Konsolidation unter Führung von Graf Carl Fdgr. im Jahr 1865 aufgegeben und fiel ins Bergfreie.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link
zum Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Huthaus dieser Grube steht noch
nördlich am Weg von Munzig nach Seeligstadt, ist bis heute nur wenig
verändert und noch immer bewohnt (Information von G. Mehler).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir
verwenden wieder ein Digitalisat aus der Deutschen Fotothek. Link zur
Originaldatei:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bergbauzeugnisse Übertage
Groitzsch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die weitere Geschichte kennen wir nun schon: Nur das Neue Lager bei Miltitz und das Groitzscher Lager wurden von 1946 bis in die 1960er Jahre hinein noch weiter abgebaut. Die anderen kleineren Vorkommen fielen dem Vergessen anheim…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausschnitt aus der Äquidistantenkarte, Section Tannenberg, Ausgabe 1881: Hier sind die Kalkbrüche bei Groitzsch und Schmiedewalde sowie der Kalkofen (K.O.) und die Graf Karl Eisensteingr. bei Burkhardswalde noch eingetragen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etwa derselbe Ausschnitt aus der Topographischen Karte, Blatt 64, Deutschenbora, Ausgabe 1937: Südlich verläuft jetzt bereits die Autobahn 4 durch das „Tanneberger Loch“, der Tagebau des Kalkbruchs zwischen Perne und Groitzsch ist noch eingetragen, aus dem Ranft’schen Bruch bei Schmiedewalde ist aber bereits der „Grüne See“ entstanden und auch von der Eisensteingrube Graf Carl nordöstlich von Burkardswalde ist nichts mehr zu sehen. Der Kalkbruch in Groitzsch besitzt aber noch erheblich größere Ausdehnung als das Restloch heute.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir besuchen im Weiteren einige noch vorhandene Aufschlüsse und Zeugnisse des Bergbaus und beginnen unseren Rundgang im mittleren Triebischtal nördlich von Tannenberg an der Damm- Mühle unter der Autobahnbrücke. Von dort aus kann man zunächst die geologischen Aufschlüse im Triebischtal erwandern oder bergan nach Groitzsch marschieren. Weil das Unterholz im Sommer sonst Vieles verdeckt, machten wir unsere erste Wanderung schon im zeitigen Frühjahr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
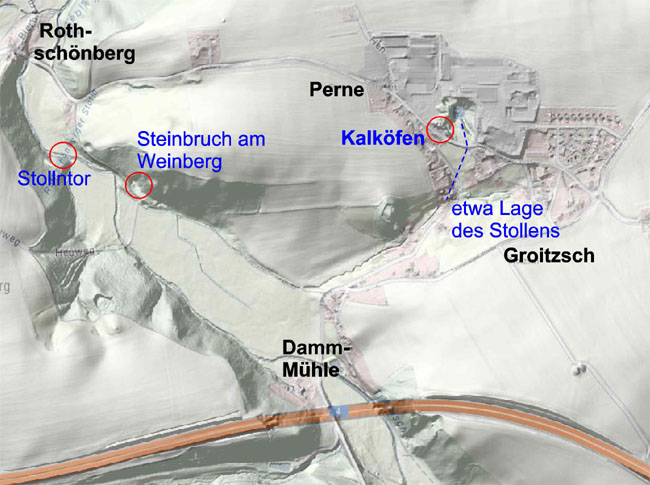 Der Kalkbruch Groitzsch auf den hochauflösenden Reliefkarten vom Geoportal Sachsen: Westlich der Ortslage erkennt man auf der kegelförmigen Anhöhe nördlich des Seitentälchens den Rest des slawischen Burgwalls.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blick von Süden auf die Großbrücke der BAB 4, die das Tal der Großen Triebisch überspannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Knapp 1 km nördlich der Brücke befindet sich der heute stark verwachsene Steinbruch am Weinberg. Auch hier soll Kalkstein abgebaut worden sein. Der Steinbruchrest bildet auch ein geschütztes Biotop, in dem sich besonders im Frühjahr kalkreiche Böden liebende Pflanzen, wie der Hohle Lerchensporn zeigen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Am Fuß des nördlichen Bruchstoßes steht hier noch ein silurischer Alaunschiefer an. Wer möchte, kann schon von hier aus dem Geopfad durch das Triebischtal folgen. Wir dagegen drehen um und wandern bergauf nach Groitzsch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Gleich gegenüber befinden sich noch die Kalköfen des ehemaligen Kalkwerks Kippe. Hier der südliche…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 …und die beiden nördlichen. Die mächtigen Mauern der Trichteröfen sind zwar durch neuzeitliche Bebauung etwas „eingehült“, aber noch gut erhalten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Innenmauerung wurde zu späterer Zeit herausgebrochen, damit sie von den Anwohnern als Lagerräume nachgenutzt werden konnten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein wenig Schmuck durch Sandsteinblöcke an den Ecken gönnte man sich auch früher schon und auch bei profanen Betriebsgebäuden…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Und wir können einen kleinen geologischen Exkurs machen und finden zwischen den überwiegend als Baumaterial verwendeten „tonschieferartigen Phyllit“- Brocken auch den Porphyr aus dem Gang bei Munzig wieder.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das Restloch des früheren Tagebaus ist heute umzäunt, aber man kann hinter den Kalköfen zumindest von oben noch einen Blick hineinwerfen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir greifen mal auf unser Bildarchiv und eine Exkursion aus dem Jahr 2003 zurück und können uns den nördlichen Stoß des Tagebaus etwas näher anschauen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Blick vom Zugang auf den Nordweststoß des Kalkbruch- Restloches in Groitzsch, Aufnahme 2003. Das Kalklager ist an der hellgrauen Farbe gut zu erkennen, darüber findet man Limonit- führenden Schieferzersatz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unmittelbar über dem Wasserspiegel erkennt man noch die Firste eines der Zugänge zur 1. Sohle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Durch die schon von Cotta erwähnte Bänderung des Kalksteins ist die intensive Faltung des Gesteins im Anstehenden gut zu erkennen. Aufnahme ebenfalls noch von 2003.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Zum Abschluß noch ein Blick auf die drei Brennöfen des Kippe'schen Kalkwerks im Sommer, diese Aufnahme von 2004.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schmiedewalde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Groitzsch aus erreicht man in südöstliche Richtung Schmiedewalde und kann unter der anderen Autobahnbrücke hindurch wieder zurück zur Damm- Mühle ins Triebischtal hinunter wandern. Deshalb machen auch wir mit unserer kleinen Bildergalerie in dieser Richtung weiter.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
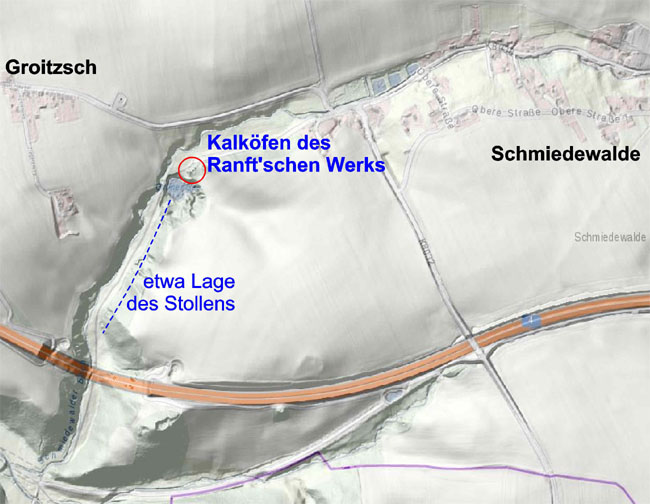 Der „Grüne See“ bei Schmiedewalde auf den hochauflösenden Reliefkarten vom Geoportal Sachsen: Das Triebischtal und der Schmiedewalder Dorfbach werden heute mit zwei Großbrücken überspannt. Am unteren Bildrand erkennt man noch gut den Verlauf der alten Trassenführung der BAB 4 durch das „Tanneberger Loch“.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Eine Aufnahme des Grünen Sees im Sommer 2004 zeigt uns, warum er so heißt…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und nach Süden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vom Ranft’schen Kalkwerk sind noch Reste der beiden Brennöfen erhalten. Ungefähr an dieser Position könnte auch P. Schulz 1950 gestanden haben.
Zurück
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von nahem erkennt man hier noch die Innenausmauerung des „Brenn-Trichters“ hinter der Außenmauer unter dem Schutt späterer Zeiten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der nördliche der beiden Kalköfen. Auch dieser ist stark verwachsen und fast völlig eingestürzt. Bei dichtem Unterholz im Sommer hätten wir ihn wohl gar nicht bemerkt…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf dem Weg zurück unterqueren wir die Triebischseitentalbrücke, die über den aus Richtung Schmiedewalde der Triebisch zufließenden Bach verläuft. Diese Spannbetonkonstruktion ist das östlichste der drei Großbauwerke und 330 Meter lang sowie an der höchsten Stütze 43 Meter hoch. Uns fällt noch das Pumpenhäuschen am Wegrand auf, welches den Endpunkt des Wasserlösestollns markiert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Burkhardswalde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biegen wir von Groitzsch aus nach Nordosten ab, erreicht man nach kurzem Weg Burkhardswalde. Schon von der Anhöhe zwischen den Orten aus sieht man als Wahrzeichen des Ortes die gotische Kirche. Am Gasthof kann man parken und einkehren und das Seitental ein Stück in Richtung Munzig und zur Großen Triebisch talwärts wandern.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Standorte der Kalköfen bei Burkhardswalde. Der Abbau erfolgte hier - zumindest in der letzten Betriebsphase - nur untertägig. Das Geviertfeld der Eisensteingrube Graf Carl hat ebenfalls nordwestlich der Kirche gelegen - davon ist leider nichts mehr erhalten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von der Straße von Groitzsch nach Burkhardswalde aus begrüßt uns das Wahrzeichen des Ortes, die gotische Kirche. Auf den Feldern, die von diesem Standort aus hinter der Kirche zu sehen sind, lagen die Kalk- und Eisensteingruben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der gut erhaltene Kalkofen in Burkhardswalde steht als Technisches Denkmal unter Schutz, die uralte Eiche daneben ist als Naturdenkmal eingestuft. (Aufnahme im Sommer 2003)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch dieser ehemalige Kalkofen wird von den Anwohnern als Holzschuppen nachgenutzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hier noch einmal die Ostseite des mächtigen Bauwerks.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das ältere der angrenzenden Wohngebäude hat gewiß früher zu den Kalkwerksanlagen dazugehört. Der Hügel neben diesem Gebäude könnte der Rest eines der abgebrochenen Öfen sein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf dem Weg in Richtung Munzig nehmen wir noch diesen Blick zur Burkhardswalder Kirche mit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An der Straße nach Obermunzig haben wir hier auch dieses einstige Huthaus wiedergefunden. Unsere Aufnahme entspricht nicht ganz dem Standort von P. Schulz 1928. Im Nachgang sind wir uns aber nicht mehr ganz sicher, ob Paul Schulz hier tatsächlich das Huthaus der Grube Graf Carl fotografiert oder die SLUB das Foto vielleicht falsch beschriftet hat. Warum sollte die Gewerkschaft, die in Burkhardswalde baute, ihr Huthaus in Obermunzig errichten? Warum sollte eine Grube, die auf Eisenstein baute, einen Kalkofen errichten? Schließlich war auch zum Zeitpunkt der Fotografie 1928 der Abbau schon rund 60 Jahre eingestellt und wenn P. Schulz nicht noch den Schlußstein im Ofengewölbe lesen konnte, könnte er sich vielleicht auch geirrt haben. Möglicherweise handelte es sich hier doch eher um das Huthaus der Grube Frisch Glück.
Zurück
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinter diesem Gebäude findet sich ein zweiter Brennofen, der wohl zur Grube Frisch Glück gehört haben wird.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Er ist ungefähr genauso groß, wie der einen knappen Kilometer östlich in Burkhardswalde. Der Schlußstein im vorderen Gewölbebogen ist leider stark verwittert und nicht mehr lesbar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etwas herangezoomt: Der Schlußstein über dem vorderen Gewölbebogen ist leider stark verwittert und die Inschrift heute nicht mehr zu entziffern.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein letzter Blick von oben zeigt uns, daß der Ofen einst von der Bergseite aus über die noch sichtbare Rampe beschickt wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf dem weiteren Weg weiter talwärts passieren wir linkerhand die im Text mehrfach erwähnte „Alte Schäferei“ – ein mächtiger Vierseithof.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Ortseingang von NIedermunzig aus Richtung Burkhardswalde finden sich zwei Steinbrüche. Im östlichen wurde der hier ausstreichende Porphyrgang als Baumaterial gebrochen, das wir auch im Mauerwerk der Groitzscher Kalköfen gefunden haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Porphyr ist eigentlich rotviolett, weist aber eine ausgeprägte Bleichung (Kaolinisierung), gelegentlich auch Fluidaltexturen auf. Auf Kluftflächen finden sich schwarze, dendritische Manganoxidablagerungen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im westlichen Steinbruch steht bereits der Munziger Gneis an. Auf einer vielleicht mit Brauneisen vererzten Kluft ist hier (hinter dem Standort unseres mobilen Größenvergleichs) ein vermauertes Stollenmundlocoh zu finden, welches vermutlich zur Grube Frisch Glück gehört hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Ausmauerung ist ein Einflugloch unter der Stollnfirste über Hangschutt und Laub gerade noch zu sehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wirklich weit hineinschauen kann man nicht - ist nur was für Fledermäuse...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das fast verschüttete Mundloch war früher noch offen; die Strecke führte aber nicht weit in den Berg - maximal 15 m - wo eine Seitenstrecke nach links abzweigt, die ebenfalls nur wenige Meter lang war. Vermutlich handelte es sich nur um einen kleinen Versuchsstollen, der ohne Erfolge wieder liegengelassen wurde (Information von G. Mehler).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miltitz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wahlweise kann man von
Munzig aus nun dem
Wir beginnen unseren Rundgang in Miltitz übertage am Blauen Bruch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Tagebaue bei Miltitz auf den hochauflösenden Reliefkarten vom Geoportal Sachsen: Oberhalb des östlichen Talgehänges (am rechten Bildrand) liegen die Sönitzer Kiesgruben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auf halber Höhe des Haspelbergs sind auch noch einige Fundamente des Ständerwerkes der Jurisch’schen Hängeseilbahn im Wald zu finden. Oben auf der Hochfläche ist wieder Feld – dort wurden alle beseitigt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Fast ganz oben stehen auch noch ein paar Mauerreste des einstigen Haspelmaschinen-Gebäudes. Von hier aus wurden die leeren Hunte vom Kalkwerk hinauf zum Blauen Bruch gezogen und die beladenen hinuntergelassen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Von der Rampe, auf der die Hunte gezogen wurden, ist durch die späteren Umbauten allerdings nicht mehr viel zu sehen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir gehen mal davon aus, daß sich die Bruchmassen 100 Jahre nach dem großen Tagesbruch wieder hinreichend stabilisiert haben und uns tragen und schauen uns die Pinge und das Restloch dieses Tagebaus etwas näher an. Dieser Blick könnte der historischen Ansicht von 1916 nahekommen...
Zurück
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ganz sicher sind wir uns aufgrund der von Hangschutt überrollten und stark verwachsenen Konturen aber nicht. Der Fotograf könnte auch diesen, ähnlich V-förmigen Einschnitt abgelichtet haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Am Nordostrand des Restlochs haben die Alten diese Kerbe zwischen Talhang und Tagebausohle angelegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir klettern den Hang wieder hinunter und werfen vom Eingang zum Besucherbergwerk aus...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...noch einen Blick auf das einstige Kessel- und Fördermaschinenhaus…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 …und auf die 1834 von B. Cotta so eingehend beschriebene Klippe oberhalb des Tagesfallortes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Untertage
im Alten Kalkbergwerk Miltitz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damit hätten wir unseren Rundgang Übertage komplettiert und wenden uns jetzt dem heutigen Besucherbergwerk zu. Dem Alten Kalkbergwerk erging es nach der Stillegung nicht anders, als den schon besuchten Anlagen. Die Tagesanlagen wurden abgerissen und nur das Maschinenhaus der Förderanlage wurde als Wohnhaus weiter genutzt. Die folgenden Aufnahmen aus den Beständen des Bergarchives illustrieren die eher notdürftige Sicherung der Tagesöffnungen und den langsamen Verfall in den 1970er Jahren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Zustand des westlichen Tagesfallortes zum Zeitpunkt der Erstellung der Bergschadenkundlichen Analyse in den 1970er Jahren. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40073-1, Nr. 028: Miltitz bei Meißen, Kalkbergwerk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Zustand des Tagesfallortes zum Zeitpunkt der Erstellung der Bergschadenkundlichen Analyse in den 1970er Jahren. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40073-1, Nr. 028: Miltitz bei Meißen, Kalkbergwerk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Zustand des Mundlochs des Adolph Stollns zum Zeitpunkt der Erstellung der Bergschadenkundlichen Analyse in den 1970er Jahren. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40073-1, Nr. 028: Miltitz bei Meißen, Kalkbergwerk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits am 24.7.1953 fragte die Betriebsleitung das erste Mal bei der TBBI an, wie man sich verhalten solle; denn „in letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen Schülergruppen mit ihren Lehrern das Kalkwerk besichtigen wollen“. Die Bergbehörde stellte zwar Bedingungen hinsichtlich der Sicherheit, ließ es aber zu. Es bestand folglich schon immer Interesse an den untertägigen Anlagen, zumal hier – nördlich des Erzgebirges – Schaubergwerke eher dünn gesät sind. Die damalige Gemeinde Triebischtal entschloß sich deshalb, die Bergwerksanlagen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und eröffnete im Juli 2000 das „Alte Kalkbergwerk“ als Besucherbergwerk. Besonders die Konzertveranstaltungen sowie die Vorstellungen des Marionettentheaters untertage haben inzwischen viele Liebhaber gefunden. Daneben entwickelte sich das Alte Kalkbergwerk aber auch zu einem Treffpunkt der Höhlentaucher. Im Jahr 2007 konnte ein modernes Empfangsgebäude übergeben werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
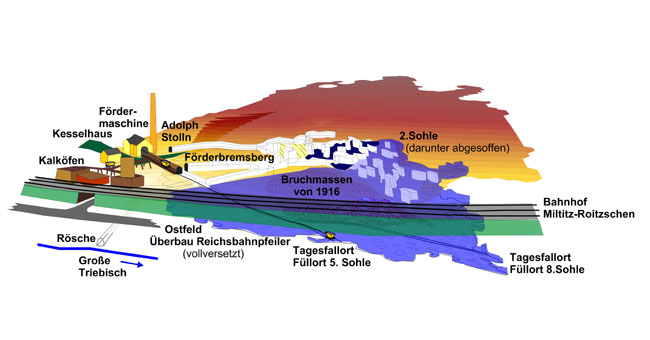 Schematische Darstellung des Alten Kalkbergwerks in Miltitz um 1920. Die Haspelbahn zum Blauen Bruch hinauf haben wir der Übersichtlichkeit halber weggelassen. Vom Tagesfallort aus konnten die vollen Hunte über erhöhte Förderbahnen direkt bis zu den Beschickungsanlagen der Kalköfen geschoben werden. Hier geht ein Von den damaligen Förder- und Ofenanlagen ist praktisch nichts erhalten geblieben, lediglich das Fördermaschinenhaus steht noch und wird heute durch die DB im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen als Fledermausquartier genutzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Schematische Darstellung des Alten Kalkbergwerks in Miltitz um 1935. Den Standort für die Brecher- und Verladeanlagen hatte K. Jurisch transportgünstig in der Nähe zur Landstraße und zum Bahnhof gewählt. Hier geht ein Diese Anlagen wurden noch bis in die 1960er Jahre genutzt, danach aber ebenfalls komplett abgerissen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
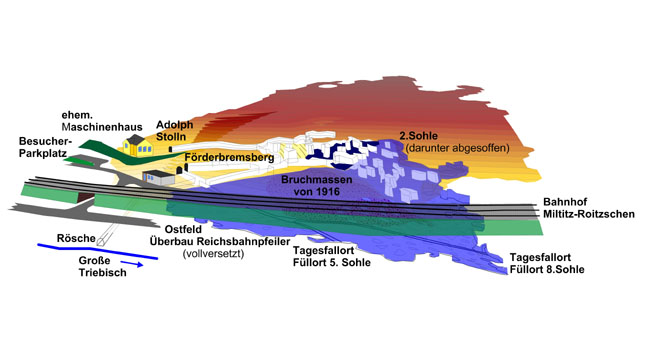 An deren Stelle ist westlich der Zufahrt von der Talstraße aus ein Besucher- und Wanderparkplatz entstanden und östlich davon wurde 2006/2007 von der Gemeindeverwaltung (als Betreiber des Besucherbergwerkes) ein neues Empfangsgebäude für die Besucher errichtet. Die Befahrung für Besucher erfolgt über den Förderbremsberg bis zur 2. Sohle, ausgefahren wird gewöhnlich über den Adolph Stolln.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An der Talstraße zeigt uns ein Hinweisschild die Zufahrt zum Besucherbergwerk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im Jahr 2007 wurde das neue Besuchergebäude eingeweiht. Am linken Bildrand ist hinter dem ersten Häuschen gerade noch die Lage des ehemaligen Tagesfallortes unterhalb der Felsklippe zu erkennen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im modernen Wartebereich für die Besucher des Alten Kalkbergwerks wurde mit der Holzbauweise bergmännischer Türstockausbau nachempfunden (Aufnahme 2007).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hier finden wir in der Vitrine auch die angeschliffenen Handstücke, die wir in unserem geologischen Kapitel schon von Nahem zeigen durften.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dahinter bestanden bis zur Errichtung des neuen Empfangsgebäudes nur beschränkte Aufenthaltsmöglichkeiten unter einem kleinen Schutzdach direkt am Mundloch des Förderbremsberges.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Gleich rechterhand sieht man hier das Mundloch des Tagesfallortes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Blick von oben durch das Gittertor hinunter bis zur Röschensohle (2. Sohle).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Den Zugang für die Besucher bildet der einstige Förderbremsberg, der im Fallen des Kalklagers zur 2. Sohle hinunter verläuft.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Abbaue beiderseits des Förderbremsbergs zwischen dem Niveau des Adolph Stollns, dem Förderbremsberg selbst und der Röschensohle sind heute weitgehend mit Abraum verfüllt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Gegenüber unserem mobilen Größenmaßstabs sind die Dimensionen der Abbaukammern durchaus noch zu erkennen und man kann erahnen, wie eindrucksvoll die „100 Schritt lange Höhlung“ in den 1830er Jahren im Fackelschein ausgesehen haben mag. Die Pfeiler sind übrigens durchnummeriert: Im Bild die Nr. 10.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Nur wenig oberhalb der 2. Sohle zweigt nach rechts der Röschenstolln ab.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir folgen dem üblichen Besucherrundgang und biegen ebenfalls zur Rösche ab. Rechts oberhalb unseres Fotos verläuft jetzt der Förderbremsberg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unter unseren Füßen liegt im Fallen des Kalklagers die Bruchmasse des Tagesbruchs von 1916 und bis zum Niveau der Rösche ist die Grube abgesoffen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Jetzt stehen wir kurz vor dem Tagesfallort. Links am Streckenstoß ist die Wasserüberleitung für das Jahnbad verlegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unterhalb liegt hier das komplett versetzte „Ostfeld“ in der Nähe der Bahngleise. Wir schauen von Untertage aus auf das Mundloch des Tagesfallortes…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 …und bewundern die Reste der Elektrotechnik aus den 1920er Jahren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Mehr oder weniger geradeaus führt der Röschenstolln weiter in Richtung Triebisch. Der erste Teil ist noch aus dem Fels herausgeschlagen. Hier dürfen Besucher normalerweise nicht hinein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Daß wir der Tagesoberfläche näherkommen, sieht man am erforderlichen Ausbau im verwitterten Gestein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hinter diesem schönen Ziegelgewölbe auf Bruchsteinmauern wird es dann richtig eng und auch wir kehren hier um.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Zurück zum „normalen“ Rundgang: In der ehemaligen Pulverkammer ist heute ein Raum für Veranstaltungen eingerichtet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 In den Stößen können die Geologen wieder eingefaltete Schlieren Hornblendeschiefers entdecken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Vor der Tür der Pulverkammer liegt die Attraktion dieses Besucherbergwerkes: Die große Weitung, die zwischen 1. und 2. Sohle und fast bis hinauf zum Niveau des Adolph Stollns durchgehauen ist und daher über 15 m lichte Höhe besitzt… Von dieser riesigen, pfeilergestüzten und dadurch einem Kirchenschiff nicht unähnlichen Weitung war bereits B. Cotta fasziniert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Zunächst der Blick im Fallen des Lagers nach Nordwesten. Hier zieht die Firste des Gewölbes allmählich ein…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Mittelteil der riesigen Weitung...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 …mit einer auffälligen „Brücke“ zwischen zwei Pfeilern – vielleicht ein Rest der Sohle des oberen Niveaus der 1. Sohle, der beim Schießen nicht mit abgegangen ist oder eine bewußt stehengelassene Schieferscholle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Und der Blick nach Südwesten mit den höchsten Pfeilern. Die Aufnahmen gelingen nur dank der hier installierten Beleuchtung, unsere 500 Watt hätten zum Ausleuchten bei weitem nicht gelangt…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Um den Eindruck auf die Besucher noch zu erhöhen, wurde 2007 wechselnd farbige Beleuchtung eingebaut. (Bildquelle: Gemeinde Triebischtal, 2007)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Noch ein Blick rückwärts mit farbiger Beleuchtung. (Bildquelle: Gemeinde Triebischtal, 2007)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das blaue und rote Lichtspiel gefällt uns auch ganz gut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 An der Nordseite gelangt man auf der Abraumhalde dann hinauf zum Adolph Stolln.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auf der „Seebühne“ finden gelegentlich auch Konzerte oder Marionettentheaterspiele statt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wir entdecken hier außerdem dieses „Planschbecken“: Hier haben die Höhlentaucher ihren Startplatz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unterwasser
im Alten Kalkbergwerk Miltitz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An dieser Stelle unterbrechen wir unsere Befahrung, da nämlich die wenigsten Besucher über Ausrüstung und Ausbildung verfügen dürften, um einen Tauchgang untertage im 8°C kalten Wasser wagen zu können. Weil rund vier Fünftel des Grubengebäudes aber heute abgesoffen sind, müssen wir an dieser Stelle die Hilfe der Höhlentaucher in Anspruch nehmen, um einige Impressionen vom heutigen Zustand der Sohlen unterhalb des Wasserspiegels zeigen zu können.
Die Aufnahmen wurden uns dankenswerterweise von Herrn F. Wieland zur
Verfügung gestellt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unterwasser im Alten Kalkbergwerk Miltitz... Höhlentauchen ist wahrlich nicht jedermanns Sache, erfordert akribische Vorbereitung und erlaubt faszinierende Eindrücke.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Mancherorts geht es auch ziemlich eng zu... Nichts für schwache Nerven!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein Fundstück: Das „Fahrgestell“ eines eisernen Huntes aus der letzten Betriebsperiode.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Wüßte man nicht, daß man hier bereits einige Meter unter Wasser ist, könnte man glatt denken, die Arbeiter kämen gleich zurück...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein Blick "von unten" auf die 1944 errichteten Fundamente für die geplanten Chemieanlagen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wer es auch einmal
probieren möchte: Anmeldungen über
Wir rubbeln uns jetzt gedanklich wieder trocken und setzen unsere Besichtigung fort...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 …und entdecken unterwegs noch den Pfeiler Nummer 37 mit ausnahmsweise eingeschlagener Nummerierung und einer Jahrestafel von 1827.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Oben angekommen. Das Lager steigt an seiner Südflanke deutlich steiler empor.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 An dieser Stelle können wir von unten auf die Abmauerung des verfüllten „Schachts D“ blicken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Jetzt stehen wir im Adolph Stolln oberhalb der großen Weitung und fahren in Richtung Ortsbrust nach Westen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Diese Ausmauerung auf einem kurzen Stollnabschnitt oberhalb der großen Weitung erregte unser Interesse, scheint hier doch ursprünglich eine Überwölbung vorgesehen oder sogar vorhanden gewesen zu sein, bevor man auch hier die Brauneisenvorkommen im Hangenden mit hereingewann. Deshalb beleuchten wir den Abschnitt noch einmal andersherum, um die schrägen Auflager für das Gewölbe gut sichtbar zu machen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein paar Meter weiter steht der Stolln wieder ohne Ausbau im Anstehenden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das erlaubt uns interessante geologische Einblicke, u. a. auf diese mit ockerfarbenem, erdigem Brauneisenstein und grauschwarzem, fast metallisch glänzendem Manganmulm ausgefüllte Kluftfläche…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 … oder auf diese Kalkbrekzie im hier steil aufgerichteten Südostkontakt zwischen dem Kalkstein (links) und dem liegenden Hornblendeschiefer (rechts im Bild).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Das „reichlich cirkulierende Wasser“ hat im Kalkstein in den Stößen und in der Firste vielfach solche kleinen oder großen, rundpolierten Hohlformen hinterlassen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Noch ein Stück weiter nach Westen hat man dann noch einmal einen kleinen Durchblick hinunter in die große Weitung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Am Endpunkt des Stollens finden sich in extra angeleuchteten Höhlungen auch kleine Tropfsteine, wohl die kleinste Tropfsteinhöhle der Welt...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auch wir nehmen jetzt den Weg nach Übertage...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Auf dem Weg hinaus entdecken wir noch ein paar alte Einritzungen…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...und diese Jahrestafel im Adolph Stolln (Aufnahme 2002).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der östliche Abschnitt des Stollens verläuft unter alten, längst mit Abraum verschütteten Tagebauen und besitzt deshalb eine schöne, ovale Ausmauerung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der letzte Abschnitt ist dann schnurgerade durch die alten Abbaue getrieben, so daß man hier im Bild schon wieder Tageslicht von vorn hat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein Durchbruch im Mauerwerk verrät, daß auch oberhalb des Stollens noch Abbaue liegen, wurde der Stolln doch auch als „Winter-Abbaustrecke“ genutzt. Heute dienen sie Fledermäusen als Winterquartier.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dann sind wir auch schon ausgefahren. Kleines Gruppenbild mit unserem freundlichen Bergführer zum Schluß.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Inschrift im Gewölbeschlußstein über dem Stollnmundloch erklärt sich nach dem Lesen unserer Kapitel zur Abbaugeschichte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Daß die überhängende Klippe - wie schon von Cotta befürchtet - doch bis heute nicht eingestürzt ist, verdankt sich ziemlich mächtigen Beton- und Ziegelmauerpfeilern, die man von hier oben gut erkennen kann.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vom Neuen Kalkwerk ist dagegen nichts erhalten geblieben. Durch den stillen Wiesengrund führt ein Wanderweg von Miltitz hinunter nach Roitzschen ins Triebischtal.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier markiert nur das alte Pumpenhäuschen des Wasserwirtschaftsverbandes noch den Ansatzpunkt des Wiesenstollns. Das Areal ist als mögliches Bergschadensgebiet jedoch bis heute weitläufig eingezäunt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neben dem viel berühmteren Erzbergbau im Erzgebirge und seinem Vorland sind auch eine ganze Reihe von Zeugnissen der Steine-, Erden- und Bindemittelindustrie auf unsere Zeiten überkommen. Mit diesem recht ausführlichen geratenen Beitrag wollen wir an dieses Kapitel der Montangeschichte Sachsens erinnern.
Wer noch nicht genug gesehen hat, kann diese Wanderung Triebisch- aufwärts
noch fortsetzen:
Wir haben dazu einen weiteren
Im Übrigen ist das Triebischtal ein noch wenig durch neuzeitliche Bebauung verschandeltes Wandergebiet und zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert... Glück Auf! J. B.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Erinnerung an den Geologen, Heimatforscher und Publizisten Wolfgang Schanze (*1938, †2015), der sich um die Erforschung und Bewahrung der Geologie und der regionalen Montangeschichte im Triebischtal bleibende Verdienste erworben hat, wurde am 16. September 2017 am Geopfad in Miltitz ein Gedenkstein im Beisein der Witwe und weiterer Familienangehöriger enthüllt. Der Findling aus skandinavischem Granit stammt aus der Kiesgrube im benachbarten Sönitz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Quellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wo wir
außerdem schon nach der Geschichte des Kalkbergbaus und der Kalkverarbeitung
recherchiert haben, haben wir einmal in einem
Wer selbst einmal in Originalquellen blättern will, oder uns auch durch weitere Hinweise unterstützen kann, für den im Folgenden eine Auswahl der von uns schon ermittelten Quellen. Wir würden uns darüber hinaus sehr freuen, wenn sich unsere Leser an uns wenden, falls sie weiteres historisches Material finden.
Hinweis: Die verwendeten Digitalisate des
Sächsischen Staatsarchives stehen unter einer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Quellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||