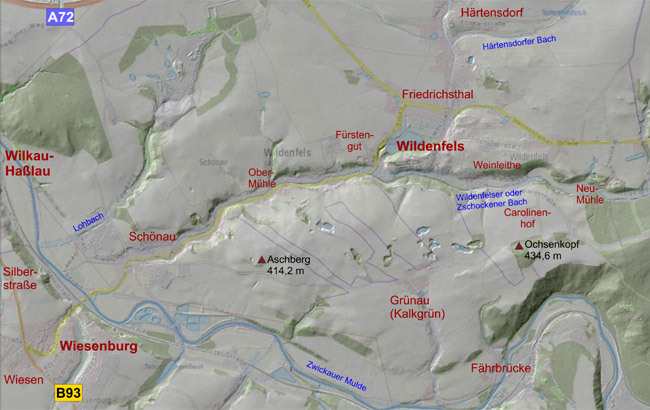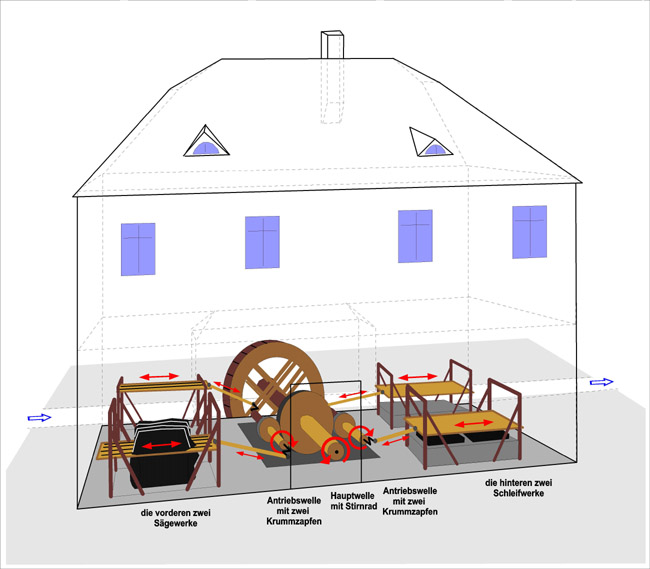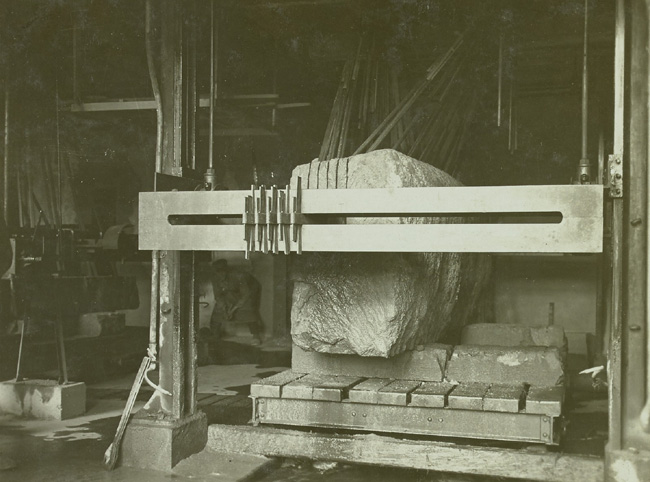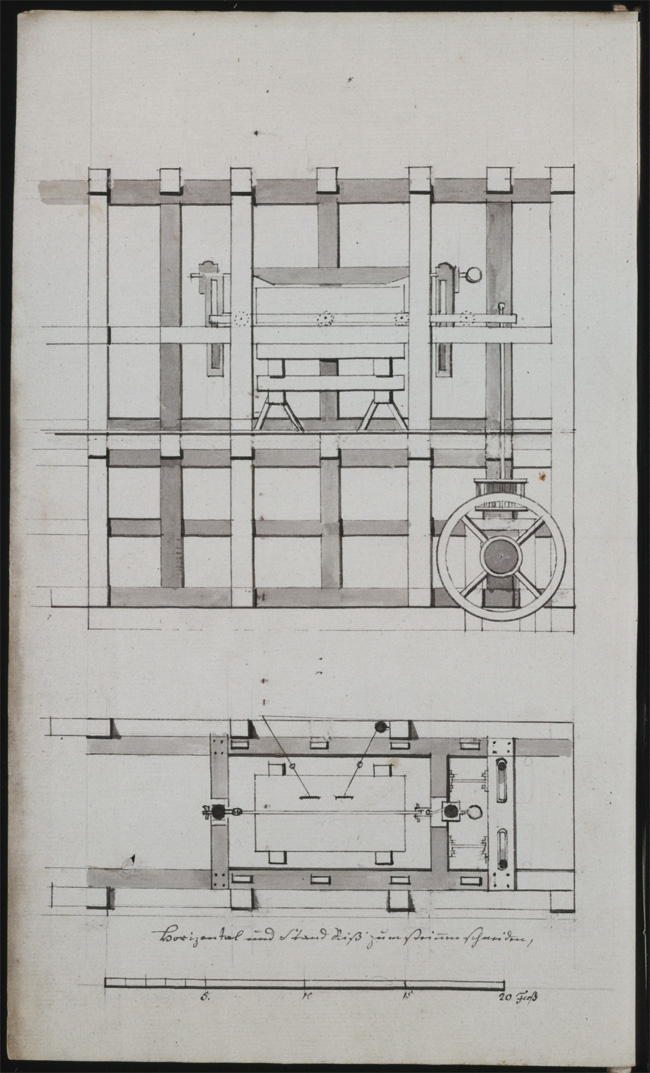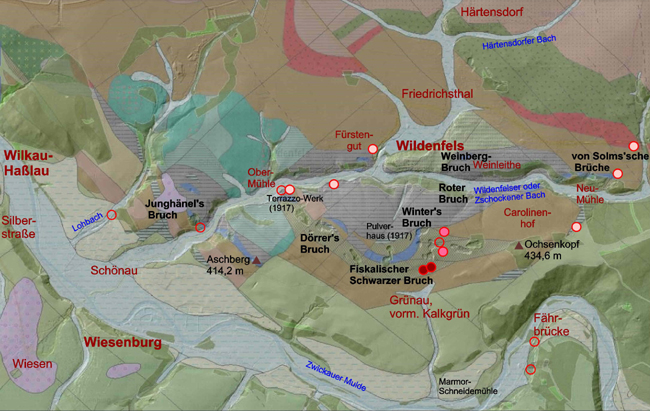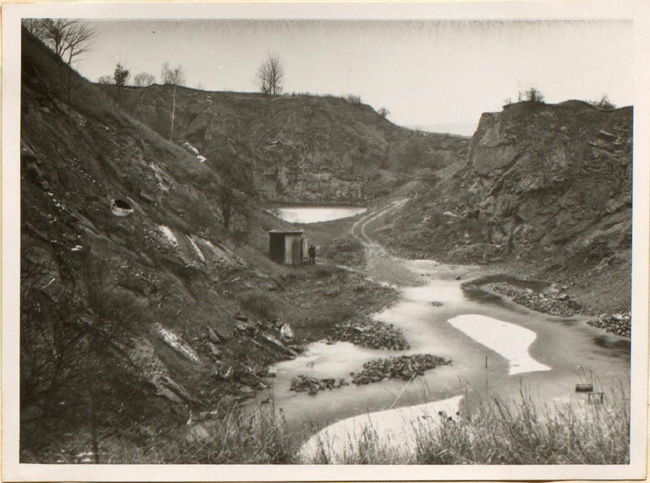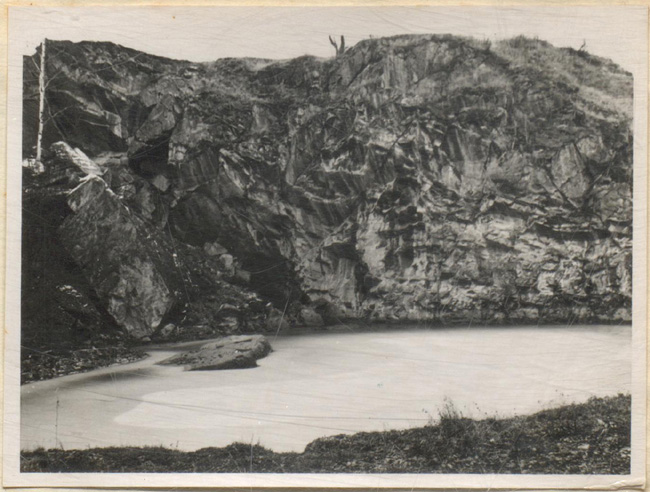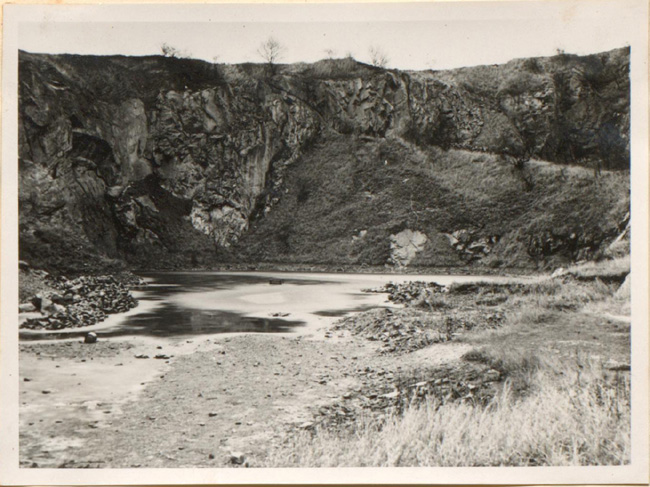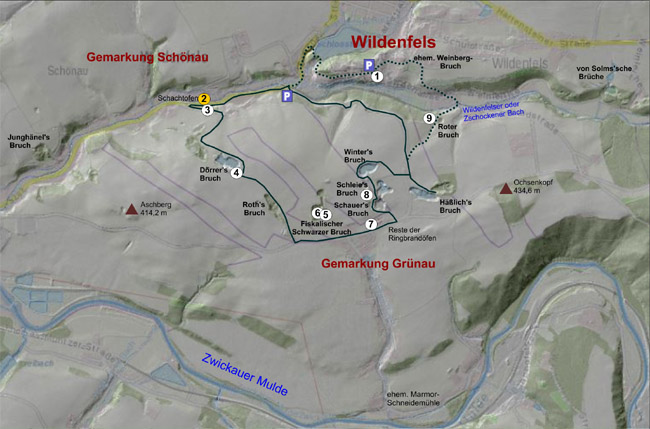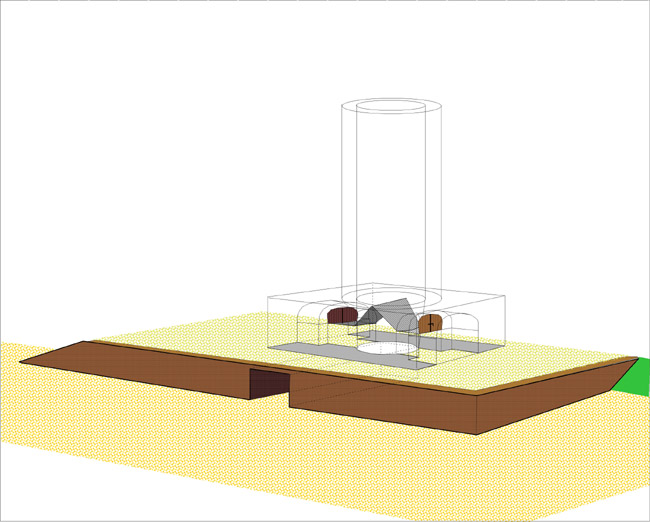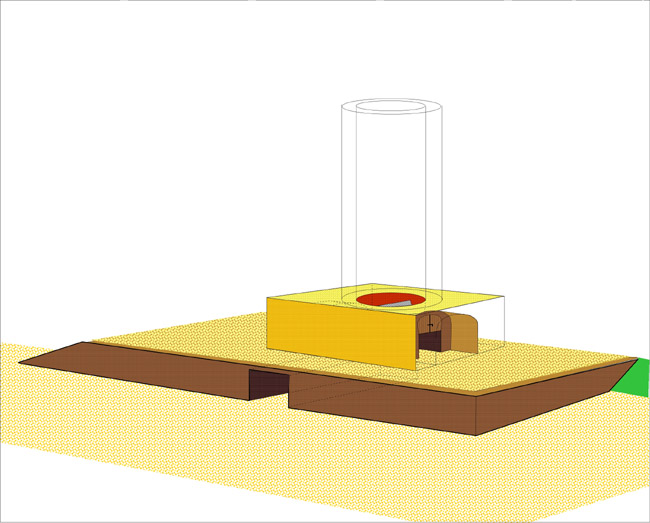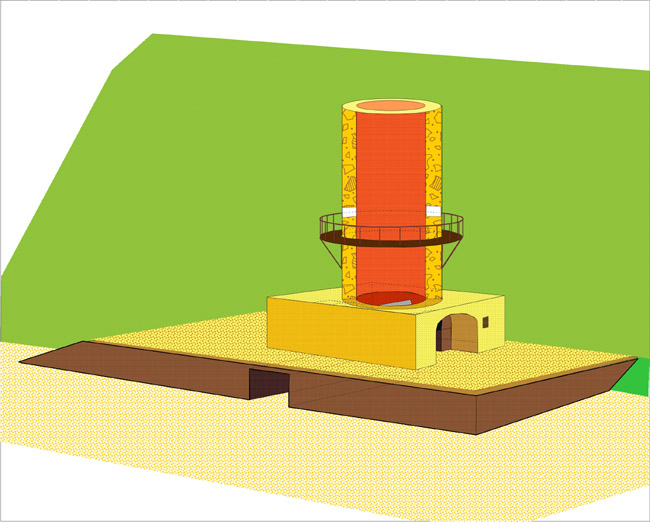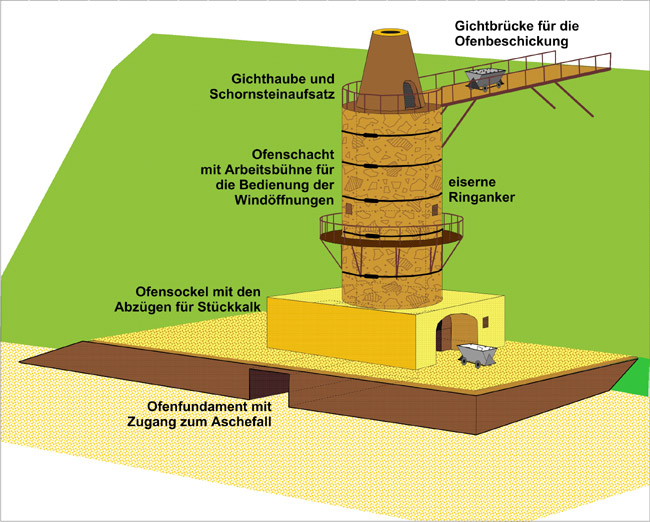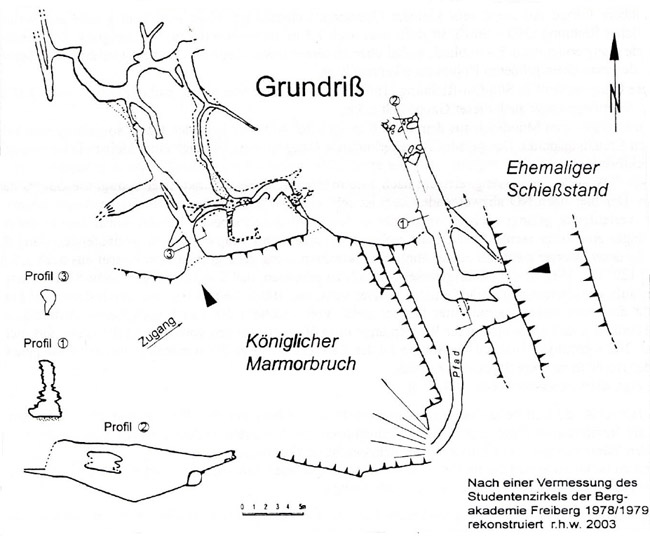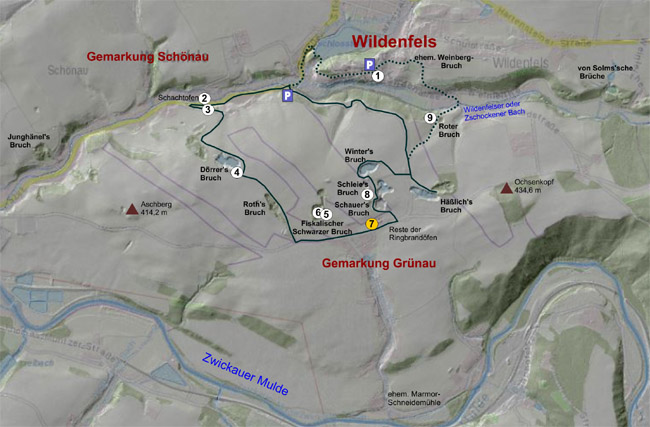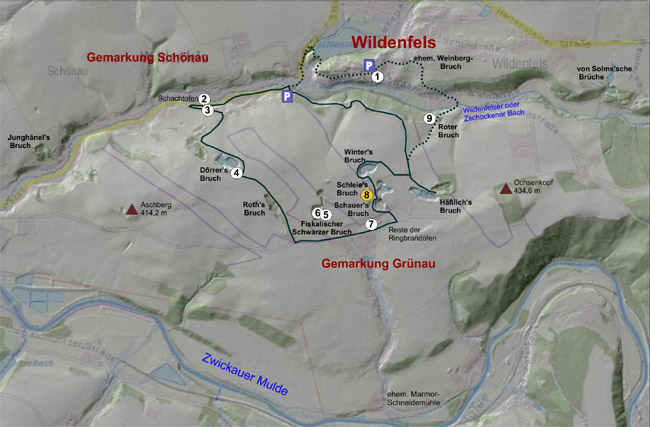|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Kalksteinabbau um Wildenfels
Online seit November
2017, Wir bedanken uns bei den Kirchberger Natur- und Heimatfreunden, namentlich bei Herrn W. Prehl, für die Bereitstellung von Material zur Ergänzung unseres Beitrages sowie für das Ermöglichen einer Befahrung der Marmorbruch- Höhle. Außerdem danken wir Herrn A. Gerstenberger für das Foto einer historischen Mineralstufe aus den Wildenfelser Kalkbrüchen. Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom Januar 2018 vom Qucosa- Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF- Format herunterladen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Lage und regionalen Geschichte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir sind mal wieder im Westerzgebirge unterwegs, genauer gesagt, an dessen Nordrand, wo es an die Erzgebirgische Senke angrenzt. Hier erstreckt sich das Wildenfelser Zwischengebirge über maximal etwa 1,5 km Breite in Nord- Süd- Richtung und über etwa 5,5 km Länge in Ost- West- Richtung. Es nimmt also nur wenige Quadratkilometer Fläche ein und stellt ein Gewirr aus kleinen Falten- und Bruchstrukturen dar. Unterlagert von einer Scholle kristalliner Gesteine streicht hier eine altpaläozoische Schichtenfolge zutage aus. (landkreis-zwickau.de) Im Umfeld gab es auch Erzbergbau und nach Norden sind es nur ein paar Kilometer bis zu den Zwickauer Steinkohlengruben. Wir sind aber auf den Kalksteinabbau aufmerksam geworden und widmen diesem unseren folgenden Bericht. Die Region liegt am Nordrand der erzgebirgischen Pultscholle und die markantesten Geländehöhen liegen mit dem Aschberg und dem Ochsenkopf nur noch bei reichlich 400 m Seehöhe. Das Schloß Wildenfels wurde auf dem Bergsporn an der Einmündung des Härtensdorfer in den Zschockener Bach auf zirka 360 m Höhe errichtet. Westlich von Wildenfels, bei Wiesenburg, liegt das Tal der Zwickauer Mulde bereits auf nur noch 290 m Höhe. Der Mulde fließt, am südlichen Stadtrand von Wildenfels vorbei, der Zschockener Bach zu und nimmt in Wildenfels noch den Härtensdorfer Bach auf. Während die Täler östlich von Wiesenburg noch steilwandig und tief in den teils kontaktmetamorphen Schiefer des Westerzgebirges eingeschnitten sind, werden sie nach Nordwesten, auf Wilkau- Haßlau und Zwickau zu, zunehmend breiter und flacher. Sehr schön hat G. A. Poenicke, Herausgeber der Alben der Rittergüter und Schlösser im Königreich Sachsen (fünf Bände, gedruckt zwischen 1856 und 1860), den Ort Wildenfels beschrieben: „Von einem schmalen, halbinselförmigen Bergvorsprunge blickt stolz und stattlich das Schloß Wildenfels herab auf das umliegende Thal, das freundlich, fruchtbar und reichbevölkert ist, wie wenige in dem schönen Sachsenlande, und dessen Gauen beinahe durchgängig Besitzthum der Herren von Wildenfels sind, der Grafen von Solms- Laubach- Wildenfels, oder Solms- Wildenfels, eines der ältesten und berühmtesten Dynastengeschlechter Sachsens nicht nur, sondern Deutschlands überhaupt. Die Lage von Wildenfels ist ungemein lieblich, wenn auch still und verborgen. Beschränken auch umliegende Höhen den Blick in die Ferne, so vergißt man das gern über der durch Kunst verschönerten reichen Natur. Zu beiden Seiten von Höhen gegen die rauhere Witterung geschützt, die das benachbarte Hochland heimsucht, erwacht der Frühling in dem freundlichen Thale von Wildenfels früher als ringsumher…“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Täler im Einzugsgebiet der Mulde wurden vermutlich schon seit dem Ende der letzten Kaltzeit als Zugänge in das von dichten Urwäldern bedeckte Erzgebirge genutzt, was Reste von Niederlassungen altsteinzeitlicher Jäger, sowie bronze- und eisenzeitliche Funde bis in das obere Erzgebirge hinein belegen. Archäologische Funde deuten darauf hin, daß auch die Seitentäler der Zwickauer Mulde bei Wildenfels schon früh besiedelt waren. Ausgrabungen, die 1958-1959 im Bereich des „Schönauer Ringwalles“ vorgenommen wurden, sowie Funde keramischer Gegenstände an der alten Grünauer Straße lassen darauf schließen, daß schon um 1200 vor unserer Zeitrechnung (!!) zumindest zeitweise Menschen in dieser Gegend siedelten. (wikipedia.de) Später zählte das Westerzgebirge zunächst zum Siedlungsgebiet germanischer, ab dem 6. Jahrhundert dann elbslawischer Stämme. Die mittelalterliche Gaugrafschaft Chutizi mit Siedlungszentren bei Schkeuditz und Zwickau gelangte 974 durch Schenkung König Ottos, II. an das Bistum Merseburg. Pfade, Handelswege und Heerstraßen verbanden schon lange die alten Siedlungsräume um Leipzig und Altenburg mit Böhmen. Diese Saumpfade mieden jedoch zumeist die sumpfigen Flußauen zugunsten der Höhenrücken. Die Wegekapelle zu den Drei Marien am böhmischen Steig im heutigen Ortsteil Härtensdorf wurde bereits 1150 geweiht. Die erste urkundliche Erwähnung von Wildenfels datiert dann auf das Jahr 1233. Im Jahr 1321 wird ein castrum erwähnt, 1445 ein Herrensitz und ein Rittergut. Dieses Rittergut übte auch die Grundherrschaft in Wildenfels aus. Das alte Schloß, jahrhundertelang der Sitz der Herrschaft Wildenfels, liegt auf einem Bergsporn, der vom Zschockener und Härtensdorfer Bach eingerahmt ist. Wildenfels gehörte verwaltungsmäßig zur Pflege Zwickau, später zur Amtshauptmannschaft Zwickau. Besitzer der Grundherrschaft waren zuerst die Herren zu Wildenfels und von 1602 bis 1945 die Grafen zu Solms- Wildenfels. Besonders unter Friedrich Magnus I. zu Solms- Wildenfels (*1743, †1801) und seiner wohlhabenden Gattin Caroline Sophie von Leiningen- Hardenburg, welche einer Linie des weitverzweigten Grafen- und Fürstenhauses der Leininger aus dem Pfälzer Raum entstammte, entwickelte sich die kleine Residenz zu einem kulturellen Zentrum in der Region. Das Grafenpaar war der freigeistigen Gesinnung und den schönen Künsten zugetan und widmete sich daher intensiv dem Umbau der Anlage, des Schlossparks und der zeitgemäßen Ausgestaltung der Räume. Da der Graf den Grundsätzen des Humanismus und dem aufgeklärten Absolutismus verpflichtet war, gründete er 1776 die Freimauerloge „Zum goldenen Apfel“. Dichter, Denker und Maler wurden auf das Schloß eingeladen und es entstand ein „Musenhof“. Die Söhne Friedrich Magnus I. hielten an diesem kulturellen Schwerpunkt ihrer Familie fest. Der letzte auf Schloß Wildenfels residierende Graf, Friedrich Magnus V., wurde 1940 von den Nationalsozialisten verhaftet und verstarb fünf Jahre später in der Nervenheilanstalt Großschweidnitz. Mit dem Kriegsende verließ die Familie zu Solms- Wildenfels das Schloß. (schloss-wildenfels.de)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das benachbarte Wiesenburg links der Zwickauer Mulde war mit der 1251 erstmals erwähnten Höhenburg Stammsitz der Herrschaft Wiesenburg und wie der Nachbarort Wildenfels zeitweise lokaler Verwaltungssitz. Zur Herrschaft Wiesenburg gehörte immer auch der Ortsteil Wiesen. Das heutige Schloß entstand aus einer mittelalterlichen Burganlage, die vermutlich um das Jahr 1200 errichtet wurde. Im 14. Jahrhundert erfolgten Erweiterungen. Von der romanischen Burganlage sind daher heute nur noch ein Teil des runden Bergfrieds, Reste der Ringmauer und ein Graben erhalten. Erste Besitzer waren die Vögte von Weida, die von hier aus die Besiedlung des Kirchberger Beckens und des Muldegebietes südöstlich von Zwickau überwachten. Später wechselten die Eigentümer mehrfach; 1350 gelangte die Burg unter wettinische Hoheit. 1412 bis 1591 war die Familie von der Planitz aus Zwickau Eigentümer der Burg; 1591 kaufte die Stadt Zwickau Burg und Herrschaftsgebiet, 1618 erwarb sie der sächsische Kurfürst. Der heutige Innenhof der Burg
Wiesenburg mit seinen Fachwerkbauten sowie der achteckige Torturm entstanden
während des Wiederaufbaus nach dem Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1664. Von 1663
bis 1724 war Wiesenburg an die Herzöge von Holstein- Sonderburg verlehnt. Am
14. Juni 1676 heiratete Herzog Moritz von Sachsen- Zeitz
(*1619, †1681) auf der
Wiesenburg in
dritter Ehe Sophie Elisabeth von Schleswig- Holstein- Sonderburg-
Wiesenburg,
die Tochter des Herzogs Philipp Ludwig von Schleswig- Holstein- Sonderburg-
Glücksburg aus dessen Ehe mit Anna Margarete von Hessen- Homburg. Da diese Ehe
kinderlos blieb, fiel die Herrschaft 1724 wieder an den Kurfürsten. August, der
Starke, ließ im gleichen Jahr das Amt Wiesenburg und ein Kammergut
einrichten. Das Grabmal von Moritz erster Gattin, Sophia Hedwig von
Schleswig- Holstein- Sonderburg- Glücksburg, befindet sich heute in
1843 wurde der Sitz des Amts Wiesenburg dann nach Kirchberg verlegt. 1856 kamen beide Orte zum Gerichtsamt Kirchberg und 1875 zur Amtshauptmannschaft Zwickau. (wikipedia) Schönau rechts der Zwickauer Mulde wurde erstmals 1322 erwähnt und gehörte zu einem Teil zum Amt Wiesenburg, zum anderen zur Herrschaft Wildenfels und ein dritter Teil zum schönburgischen Amt Hartenstein. Es kam erst 1880 vollständig zur Amtshauptmannschaft Zwickau.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In August Schumann's Vollständigen Staats-, Post- und Zeitungslexikon von Sachsen, Band 13, gedruckt 1826, haben wir zu den Orten die folgende Beschreibungen gefunden: „Wiesenburg, ein Amtsbezirk im obern Theile des königl. sächs. erzgebirgischen Kreises, gränzt südlich und östlich an das Kreisamt Schwarzenberg, östlich und nördlich an die Herrschaft Wildenfels (auch für sehr geringe Ausdehnung an die Herrschaft Stein), nördlich und westlich an das Art Zwickau, westlich auch an das voigtländische Amt Plauen und an dasselbe auch wieder in Südwesten… in Schönau sind 2, bei Grüna 1 große Kalkbrennerei, und beim letztern wird der in Wildenfels zu bearbeitende Marmor gebrochen; …“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wildenfels findet im Postlexikon gleich
zweifach Erwähnung, nämlich einerseits die Herrschaft, andererseits das
Städtchen:
„Wildenfels, eine Standesherrschaft im Königr. Sachsen, im Umfange des erzgebirgischen Kreises, und in einigen Beziehungen als ein Theil des Amtes Zwickau zu betrachten, gehört dem Grafen von Solms- Laubach- Wildenfels… unter den Bächen nennen wir den Zschockenbach und den bei Wildenfels hineinfallenden Härtensdorfer Bach… Obgleich in der Herrschaft, den Steinkohlenbau beim untern Ende von Reinsdorf abgerechnet, kein Bergbau betrieben wird, so ist sie doch hinsichtlich der Mineralproducte nicht ohne Interesse. Denn man bricht bei Schönau und Wildenfels marmorähnlichen und andern Kalkstein, Grauwacke und mandelsteinartiges Gestein, …“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch unter dem Stichwort der Stadt Wildenfels wird von Schumann auf den Kalkbergbau verwiesen: „Wildenfels, ein Vasallenstädtchen im Königreiche Sachsen; im Umfange des erzgebirgischen Kreises, der Amtssitz für die zuvor beschriebene Standesherrschaft der Grafen zu Solms- Wildenfels; und gewöhnlich die Residenz des Besitzers… Kalkbrüche sind auf mehreren Punkten zu finden. Kalköfen aber theils östlich über der Stadt, theils ¼ Stunde südlich, bei den großen Kalkgrüner Marmor- und Kalkbrüchen, theils im Südwesten bei Oberschönau… Die Papiermühle steht oberhalb der südöstlichen Vorstadt, das Schießhaus aber in letzterer, wo auch die Werkstätte des hiesigen Bildhauers steht. Es haben sich immer recht kunstreiche Bildhauer hier niedergelassen und theils den herrschaftlichen schwarzem, theils den königlichen bunten Marmorbruch auf dem in Süden gegenüberliegenden Gebirge von Kalkgrün benutzt. So arbeitete z. B. Gebert hierselbst das Monument für die Begräbnißkapeile zu Altzelle, und sein Nachfolger stand ihm wenig nach. Man bricht den Marmor bei Grüna in Bank- ähnlichen Stücken bis zu 4 Ellen Lange und darüber. Auf Verlangen muß jeder zur Bildhauerei taugliche Block an den Meister verabfolgt werden; alles uebrige aber wird zu Kalk gebrannt. Die Schönauer Brüche benutzt der Bildhauer gar nicht, da sie nur Brocken liefern. Der größte Bruch bei Grüna, an welchem der Hauptkalkofen steht, liefert einen gelblichweißen Marmor, der weniger taugt, als der Crotendorfer, und daher auch vom Bildhauer wenig benutzt wird…“ Kalkgrün ist das heutige Grünau. Bereits auf den Meilenblättern von Sachsen, entstanden ab 1780, werden beide Ortsnamen nebeneinander angeführt. Ursprünglich gehörte auch der Südhang von Aschberg und Ochsenkopf bis hinunter zur Mulde zur Herrschaft Wildenfels. In einer Urkunde vom 17. Dezember 1402 bestätigt dann Burggraf Heinrich, I. von Meißen (*vor 1381, †1423) als damaliger Lehnsherr der Grafschaft Hartenstein den schon am 23. April 1401 getätigten Verkauf von Gütern in Zschocken und Thierfeld sowie das „gantze Dorf Grün unterm Wildenfels, an der Mulde gelegen, mit allen Zugehörungen und Rechten“ für 402 Schock und 16 Groschen von Wenzel von Wildenfels an den Abt Nikolaus des Klosters Grünhain (No. 48 in G. Chr. Kreysig, 1755, S. 545, siehe auch E. Herzog, 1869, S.78, die dort in der Fußnote erwähnte Abschrift ist vermutlich heute im Bestand 30570, Nr. 4). Seitdem gehörte Grünau zum Besitz des 1236 von den Meinheringern gestifteten Klosters und nach dessen Sequestation 1533 und endgültiger Säkularisation 1536 zu dem aus den klostereigenen Gütern gebildeten Amt Grünhain mit Schlettau. Mit dem Tod Heinrichs, II. 1426 war die Linie der Meinheringer als Burggrafen auf Meißen und Besitzer der Grafschaft Hartenstein erloschen und diese Herrschaft gelangte in der Folgezeit an die von Schönburg- Hartenstein. 1843 kam Grünau dann zum Amt Kirchberg und 1856 zum Gerichtsamt Wildenfels. Ab 1875 gehörte es wie Weißbach zur Amtshauptmannschaft Zwickau, deren Nachfolger heute der Landkreis Zwickau ist.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Beschriftung der Zeichnung stellen das kleinere Gebäude etwa in der Bildmitte (5) des Bruchmeisters Wohnung, das große daneben (6) die Königliche Marmor Schneidemühle und die Gebäude beiderseits des großen, qualmenden Schornsteins eine Mahlmühle (7) und eine Brettmühle (8) dar. Links hinter den Gebäuden ist (3) der Muldenfluß eingezeichnet – da der Mühlgraben noch existiert, können wir rekonstruieren, daß der Zeichner hier von Norden auf den im Muldental gelegenen Ortsteil blickt. Die Marmor- Schneidemühle muß natürlich auch in Flußnähe gestanden haben, da man das Wasser des Flusses für den Maschinenantrieb brauchte, während die Kalksteinbrüche oberhalb des Ortes lagen und hier leider nicht dargestellt sind.
Link zur Deutschen Fotothek
Was davon noch geblieben ist, zeigen wir weiter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Herrschaft Wildenfels wird im 4. Band des
Albums der Rittergüter und Schlösser Sachsens 1856 vom Herausgeber
ausführlicher beschrieben, als im Postlexikon. Wir haben eingangs bereits aus
dieser Quelle zitiert und fahren hier fort:
„Das Städtchen Wildenfels, das theils am Abhange des Schloßberges, theils am Fuße desselben erbaut ist, zählt etwa 300 Feuerstellen mit nahe an 3.000 Einwohnern, deren Hauptnahrungszweige Leinen- und Cattun- Weberei und Strumpfwirkerei sind. Im Ganzen ist die Bevölkerung arm, denn der größte Theil des Grundbesitzes ist in den Händen des Grafen von Solms; außer diesem hat Wildenfels kaum 12 begüterte Bürger… Der Name des Ortes soll nach der Behauptung Einiger daher entstanden sein, daß man in dem wilden Felsengrunde vergebens nach Erzschätzen gesucht habe. Diese Behauptung ist aber jedenfalls unbegründet, denn offenbar ist Wildenfels und dessen Benennung älter als der sächsische Bergbau, der allerdings hier nur wenig Ausbeute gewährte, als er bis Mitte des 17. Jahrhunderts auf Kupfer und Blei betrieben wurde. Jedenfalls verdankt Wildenfels seinen Namen nur seiner wilden felsigen Lage… So viel steht indes fest, daß Wildenfels einer der ältesten Rittersitze des Landes ist, und daß auch das Städtchen schon früh erbaut wurde; denn schon im Jahre 1233 wurden in dem Stiftungsbriefe, den Herrmann von Schoinburch (Schönburg) dem Kloster Geungiswalde ausstellte, als Zeugen Goncelinus, Ludolfus und Sifridus, Urbani de Wildenfels genannt. Schloß und Herrschaft Wildenfels werden noch früher erwähnt und zwar durch ihre Besitzer in einer thüringischen Urkunde vom Jahre 1119. Diese nennt die Brüder Christian und Unarg, indes läßt sich nicht genau bestimmen, ob sie nun von Wildenfels oder nur von Wilden hießen… Hans und Heinrich von Wilden oder Wildenfels, Brüder, trugen im Jahre 1356 die Herrschaft Wildenfels mit allen Zubehörungen dem Kaiser Karl, IV. zu Lehen an und seitdem war sie eigentlich böhmisches Lehen geblieben, indes wurde davon später keine Notiz mehr genommen… 1408 begaben sich Unarch und Heinrich von Wildenfels aller Ansprüche an das Kloster zu Zelle, wenn der Probst zu St. Moritz in Naumburg sie vom Banne lossprechen wolle. Dies ist die letzte Nachricht von der ersten Wildenfelser Dynastie auf Wildenfels… So viel scheint ausgemacht, daß Wildenfels früher zu der Reichsgrafschaft Hartenstein gehörte, und daß die Grafen es ihren Vasallen, denen von Wildenfels, zu Lehen gaben, darauf einige Zeit selbst benutzten und endlich nicht gleich anderen Besitzungen an Veit von Schönburg abtraten. Wildenfels kam daher als Reichsherrschaft in den Besitz der Vögte von Weyda und später an den Grafen von Schwarzburg. Zwar gelangten die von Wildenfels nach längerer Zeit wieder in den Besitz der Herrschaft, allein die Landeshoheit wußten die Kurfürsten Moritz und August, so wie deren Nachfolger, zu gewinnen, obgleich darüber vor dem Reichskammergerichte über 100 Jahre lang ein Process geführt wurde. Erst die Grafen von Solms erkannten 1706 die Landeshoheit förmlich an, in dem sie sich zur Leistung einer unbedeutenden Abgabe verstanden. Seitdem ist Wildenfels dem Amte Zwickau als Mittelbehörde überwiesen, doch muß dasselbe alle königlichen Rescripte vesiegelt an den Standesherrn gelangen lassen...“ Diese Anerkennung der Oberhoheit des wettinischen Fürstenhauses erfolgte ‒ ganz ähnlich wie 1740 bei den Schönburgern ‒ durch einen Vergleich, auch als „Rezeß“ bezeichnet, welcher am 13. April 1706 ratifiziert wurde. Der Vergleich wurde am 18. Februar 1846 nochmals bestätigt (vgl. 30861, Nr. 2286). Die seit 1706 als „Standesherrschaft Wildenfels“ bezeichnete Herrschaft, seit 1602 im Besitz der Grafen von Solms, wurde dann dem Amt Zwickau zugeordnet. „Zu den Nebenbesitzungen von Wildenfels gehören die Vorwerke Charlottenhof und Carolinenhof, eine Schäferei bei Friedrichsgrün, der sehr schöne Schloßteich, der 500 Ellen lang und 300 Ellen breit ist, und einige Mühlen… Die Stadt Wildenfels, …liegt zwischen dem Zschockenbache und dem Härtensdorfer Wasser, 2 ¼ Stunde westlich von Zwickau, 2 ¼ Stunde nordöstlich von Schneeberg, 1 Stunde nordnordwestlich von Hartenstein… und ¾ Stunde von Wiesenburg entfernt. Sie hat zwar im Osten ein Thor, auch zwei Vorstädte, ist aber sonst ganz offen. Gebaut ist das Städtchen zwar nett, aber keineswegs schön; auch hat es nur wenige erwähnenswerthe Gebäude; dahin gehören eine Papiermühle… und eine Bildhauerwerkstatt. Denn Wildenfels hat seit vielen Jahren einen Bildhauer gehabt, und darunter den nicht unberühmten Gebert, der 1809 das Monument für die Begräbniskapelle in Altzelle fertigte. Diesem Bildhauer müssen, wenn er es verlangt, alle größeren, in den hiesigen Marmorbrüchen gewonnenen Marmorblöcke überlassen werden… Bei Reinsdorf gräbt man Steinkohlen; außerdem wird kein Bergbau betrieben, die Mineralprodukte aber sind interessant, denn außer den verschiedenen Marmorarten findet man Grauwacke und Mandelstein; bei Weißbach fand man ehemals Kupfer, vermuthet daselbst auch Eisenstein; Malachit kommt bei Zschocken vor, Basalt bei Ortmannsdorf und Härtensdorf… Die Landwirthschaft beschäftigt sich besonders mit Klee- und Hopfenbau, viel mit Obstbau …, weniger mit Flachs- und Hanfanbau… Die Viehzucht ist nicht unbedeutend und die zahlreichen Kalkbrennereien geben den Bewohnern Gelegenheit zum Verdienst.“ Uns interessiert hier natürlich der Kalksteinabbau besonders und darüber können wir bei G. A. Poenicke lesen: „Die reiche Flora dieser Gegend bietet dem Botaniker eben so reiche Ausbeute, wie für den Geognosten und Mineralogen die Berge durch Formation und Producte von hohem Interesse sind. Sie gewähren reiche Kalk- und Marmorbrüche, und die Menge verschiedenartiger Muschelthiere legt unwiderlegliches Zeugnis dafür ab, daß einst des Meeres Fluthen hier rauschten. Unter den zahlreichen Marmorbrüchen verdient besondere Erwähnung der dem Staate gehörige schwarze Marmorbruch, der einzige in Sachsen. Er liefert nicht nur sehr schönes Material, welches bei dem Bau der katholischen Kirche zu Dresden verwendet wurde, sondern ist auch merkwürdig durch eine vielverzweigte Höhle mit Tropfsteinbildungen. Der Marmor der Gegend von Wildenfels ist aschgrau, bläulichgrau, gelblichweiß, fleischfarben und schwarz mit weißen Adern und Punkten. Er ist zwar von schöner Zeichnung und Qualität, wird aber dennoch größtentheils zu Kalk verbrannt, denn nicht in allen Brüchen eignet er sich für Bildhauer- Arbeiten und nur selten finden sich größere Stücken. Dennoch ist er zu einem Mausoleum in Zelle bei Nossen vorzugsweise verwendet worden…“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unter der Bezeichnung „Wildenfelser Marmor“ wurden besonders die dunkel gefärbten, zum Teil durch reichliche Fossilführung ausgezeichneten Varietäten als Werkstein abgebaut. Schwarzen und roten Wildenfelser Marmor findet man noch heute in vielen repräsentativen Gebäuden in Sachsen, wie etwa an dem 1606 von der Witwe Kurfürst Christian, I. (*1560, †1591), Sophie von Brandenburg (*1568, †1622), gestifteten und 1607 von J. M. Nosseni geschaffenen Hauptaltar der 1945 zerstörten Sophienkirche in Dresden (der rekonstruiert werden konnte und seit 2002 in der Loschwitzer Kirche steht), oder in der Eingangshalle der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, als Grabmale im Zisterzienserinnen- Kloster St. Marienstern sowie am Hochaltar der Kirche in Bautzen (10036, Loc. 34975, Rep. 02, Gen. 65, Nr. 1318 und 1413).
Wildenfelser Marmor wurde, wie oben auch schon
von Pönicke angeführt, für die 1595 von J. M. Nosseni vollendete
Begräbniskapelle im Sogar im Mausoleum des Grafen Ernst von Schaumburg- Holstein in Stadthagen in Niedersachsen fand er Verwendung (opencaching.de). Diese Verbindung in den Norden resultiert wohl noch aus den verwandtschaftlichen Beziehungen der Wiesenburger Herrschaft im 17. Jahrhundert.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits 1837 war der Ortsteil Friedrichsthal nach Wildenfels eingemeindet (vgl. 30861, Nr. 1967). Erst 1995 wurde auch Härtensdorf nach Wildenfels eingemeindet. Wiesen wurde 1961 nach Wiesenburg eingemeindet; 1974 wurde auch Schönau nach Wiesenburg eingemeindet. Der Zusammenschluß von Wildenfels mit Wiesenburg trat 1999 in Kraft. Bereits 1952 wurde Grünau nach Langenbach eingemeindet. Am 1. Juli 1996 wurde im Rahmen der Gemeindegebietsreform dann die Gemeinde Langenweißbach gegründet, welche die drei Ortsteile Langenbach, Weißbach und Grünau in sich vereinigt. Heute gehören alle genannten Orte zum Landkreis Zwickau.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Geologie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe von
nur etwa 7,5 km² erhält das Gebiet des Wildenfelser Zwischengebirges besondere
geologische Bedeutung durch die hier zu Tage tretende, bei etwa 2 km Länge und
mehreren hundert Metern Breite bis zu 20 Meter mächtige Platte mit
oberdevonischen Knotenkalken und unterkarbonischen Kohlenkalken, die reich an
Fossilien sind und viele Erkenntnisse zur paläontologischen
Entwicklungsgeschichte gaben. In nahezu allen Altsteinbrüchen fand man zudem
Verkarstungserscheinungen, die teils bedeutende Ausmaße erreichen. Die
Marmorbruch- Höhle ist mit einer erkundeten Länge von 110 m, nach der
Drachenhöhle in Syrau, das zweitgrößte natürliche Karsthöhlensystem Sachsens. (landkreis-zwickau.de)
Bereits Petrus Albinus erwähnt in seiner Meißnischen Bergchronica, gedruckt 1540, den Kalksteinabbau bei Wildenfels. Im XXII. Titel: Von den Werckstücken und andern Felsen und etlichen Arten von mancherley Steinen im Lande zu Meißen (S. 166ff), schreibt er: „Kalcksteins haben wir in Meißen auch keinen Mangel…“ Danach führt Albinus folgende Orte an:
...und: „Umb Wildenfels in derselben Herrschafft, zwischen Schneeberg und Zwickaw, hat man des Kalcksteins die Menge, daraus der beste Kalck gebrannt wird.“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Johann Friedrich Wilhelm Charpentier
beschreibt im Zweiten Teil, V.
Abschnitt: Die Gegend zwischen dem Kaffbach, Grünhayn, Zwönitz, Stein, der
Zwickauer Mulde, bis Planitz, an der voigtländischen und bdhmischen Grenze, um
Johann Georgenstadt, Eybenstock und Schneeberg, in seiner Mineralogischen
Geographie der Chursächsischen Lande, 1778 gedruckt, die Wildenfelser
Kalklager:
„Zu den Merkwürdigkeiten des Gebürges, und zu den Abänderungen der Steinarten gehört hier noch der Marmor, so bey Kalkgrün, einem Dorfe ohnweit Wildenfels, befindlich ist, und welcher, da er der einzige buntfarbige unter den vielen vorherbeschriebenen ist, eine eigene Seltenheit im sächsischen Erzgebürge ausmachet. Der Marmor liegt auf der Höhe des Schiefergebürges bey Kalkgrün und ziehet sich, so viel man aus den daselbst angelegten Brüchen, worunter jetzt noch fünfe vorzüglich bekannt sind, sehen kann, aus Osten nach Westen bis an das Dorf Schönau und in die Gegend von Wildenfels. Er ist in Lager getheilet, so unter verschiedenen Winkeln von 20 bis 60 Grad gegen Norden und Nordwest einschießen. Oben sind die Lager, besonders in den so genannten Bauerbrüchen, einige Linien bis einige Zoll stark, sie werden aber in der Tiefe stärker. Die schönsten und stärksten findet man in dem churfürstlichen Bruche, ohnweit des Dorfes Kalkgrün, die eine und anderthalb Lachter Stärke haben, und mit senkrechten Klüften, die sich in den übrigen häufig finden, am wenigsten getrennet sind. Es können aus diesem Bruche die größten Massen gewonnen werden. Auf dem Bruche ist der Marmor von feinem fast unkenntlichem Korne. Die Farbe ist abwechselnd hell- und dunkelgrau, roth, auch zuweilen, jedoch seltner, gelb. Der in dem churfürstlichen Bruche ist schwarz, mit weißen Adern und Flecken, und die ganze Masse scheinet hier am reinsten zu seyn. Denn in den übrigen findet man außerdem noch durchgängig, zwischen den dünnsten Blättern des Marmors, den grauen Thonschiefer des dasigen Gebürges in den feinsten Blättchen eingemischt, die aber, da sie so dünne und zart sind, der Politur und dem schönen äußern Ansehen nicht schaden. Versteinerungen habe ich nicht darinnen gefunden. Es liegen zwar cylinderförmige Stücken von verschiedener Größe in dem schwarzen Marmor, die man für Versteinerungen ausgeben wollte; ich konnte sie aber mit keiner bekannten Art vergleichen, sondern halte sie vielmehr für besonders gebildete Theile des Marmors... An einigen Orten will man auf darunter liegendes Schiefergebürge gekommen seyn, es läßt sich aber die Stärke der Lager hierdurch noch nicht genau bestimmen. Jetzt arbeitet man in den Brüchen, ohngefähr in einer Tiefe zwischen 30 und 50 Fußs noch in lauter Marmor. Ich habe Stücken mit inliegendem Schwefelkiese gesehen, der zugleich mit dem Marmor eine feine Politur angenommen hatte, und dem Ganzen ein vorzüglich schönes Ansehen gab. Es wäre überhaupt zu wünschen, daß dieser Marmor mehr zum Bauen und andern Verzierungen benutzet würde, da der meiste jetzt nur zu Kalk gebrannt wird...“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Zuge der ersten geognostischen
Landesuntersuchung bereisten Absolventen der Bergakademie zu Freiberg auch diese
Region und dokumentierten erstmals systematisch deren geologischen Aufbau. Aus
dieser Zeit haben wir einen Reisebericht gefunden, der im Jahr 1816 und von
Markscheider Carl Christian Martini, später als Markscheider in Altenberg
tätig, verfaßt wurde (40003, Nr. 50 und 304).
Der Autor vermerkte darin (Blatt 13 der Akte): §17. Lager von Kalckstein (im Urthonschiefer) „Unter den so eben aufgestellten Verhältnissen nun finden sich a) Lager von Kalckstein, und dies vorzüglich bei Kalckgrün, Wildenfels, in Schönau, im Bohrgraben ohnweit Friedrichsgrün, im Muldenthale zwischen Wilkau und der Cainsdorfer Mühle … im Dorfe Planitz und am Kreutzberge bei Planitz, welche fast alle durch Steinbrüche entblößt und 4 bis 10 Lachter mächtig sind. Der Kalkstein ist bei weitem zum größten Theil dicht, selten dem körnigen sich nähernd, und bei einem Farbenwechsel aus dem grünlichschwarzen ins bläulich und aschgrau, gelblichgrau und gelblichbraun, von vielen Kalkspathtrümern durchzogen, gefleckt, geflammt, geädert und gestreift kommt er vorzüglich bei Wildenfels vor, weshalb er auch dort bearbeitet, und als Marmor zu mancherlei Verzierung gebraucht wird. Versteinerungen sah ich nicht in ihm, jedoch will man deren zum öfteren gefunden haben.“ Diese ersten geologischen Beschreibungen flossen dann die ab 1836 gedruckten geognostischen Übersichtskarten von Sachsen und die zugehörigen Erläuterungshefte ein.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum Digitalisat:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einem Zwischenbericht mit Datum vom 20. August
1818 zur geognostischen Untersuchung des Königreiches Sachsen, namentlich über
die dabei „aufgefundenen Lagerstätten gemeinnützlicher und besonders
brennlicher Fossilien,“ verfaßt „auf allerhöchsten Befehl“ vom
damaligen Obereinfahrer in Freiberg, Carl Amandus Kühn (40003, Nr. 59),
kann man Folgendes entnehmen: Im dritten Kapitel ist darin über den zwischen der
Zwickauer und der Freiberger Mulde gelegenen Teil Sachsens (Rückseite Blatt
112ff), im Abschnitt D. über Lagerstätten nicht brennlicher nutzbarer
Fossilien (Rückseite Blatt 176ff), unter Punkt b. über die Vorkommen des „Übergangskalksteins“
(Rückseite Blatt 149ff) festgehalten:
§76. „Nicht unbeträchtlich sind aber auch die Lager von Übergangskalkstein, welche die jetzt überblickte Landesabtheilung, und zwar in der Gegend von Kalkgrün, Schönau und Wildenfels enthält. Man kennt zuförderst 3 dergleichen Lager bei Kalkgrün und Wildenfels. Das unterste setzt auf der Mittag Abend Seite von Kalkgrün auf, das mittlere nordöstlich von diesem Dorfe, das obere aber nördlich von dem 2ten Lager und östlich von Wildenfels. Alle schießen ohngefähr in Std. 10 gegen NNW ein. Noch hat man aber 2 Kalksteinlager im Dorfe Schönau und ein 3tes im sogenannten Eichgraben ohnweit letzteren Dorfes aufgefunden. Von denselben ist ersteres wahrscheinlich die abendliche Continuation des mittleren, letzteres dagegen die des obersten von den 3 erwähnten Lagern. Der Kalkstein dieser Lager ist theils grau, theils schwarz, theils auch bunt. Sämtliche vorerwähnten Lager haben eine Mächtigkeit von 6, 8 bis 10 Lachtern.“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine weitere, schon sehr detaillierte geologische Beschreibung der Kalklager finden wir in der Geognostischen Beschreibung des Zwickauer Schwarzkohlengebirges von Christian August von Gutbier, der 1838 über den Bezirk von Wildenfels und Schönau schrieb: „Der dichte Kalkstein dieser Gegend ist besonders zwischen dem Grauwackenschiefer eingelagert… Dessen Hauptdepots sind auf der Höhe von Kalkgrün, im Schönauer Thale und auf dem Bergrücken von Wildenfels. Im Allgemeinen halten die Lager das Streichen der Gegend; fast jedes einzelne hat aber Anomalien aufzuweisen, und fällt sattel- oder muldenförmig nach zwei Seiten, wobei das Streichen entweder allmälig sich herumbiegt oder unter verschiedenen Winkeln sich bricht. Im Streichen besonders vermengt sich der Schiefer 8elur häufig mit dem Kalkstein, um so mehr fallen kleine Abweichungen der Lagerung des Dachs auf, so dass z. B. die übrigens unverwitterten Schiefer oft wellenförmig gebogen sind, während der Kalkstein in geradschiefrigen Platten darunter liegt. Das Fallen der Kalksteine wechselte von 10 bis 50°. Ein Versuch, den durch Brüche entblössten Kalkstein in grössere Lagermassen zusammen zu ordnen, scheint nur bei den nahe an einander liegenden Entblössungen denkbar; im Uebrigen wird man nur sich meist schnell auskeilende liegende Stöcke treffen. Die Mächtigkeit derselben ist sehr verschieden und schwer zu bestimmen, da selten Liegendes und Hangendes zugleich entblösst ist. Nach der Färbung, Durchziehung mit Kalkspath und Schiefer, bilden die Kalksteine die verschiedensten bunten Marmorarten. Der königliche Bruch bei Kalkgrün enthält den bekannten schwarzen Marmor. Dessen Masse scheint am reinsten zu seyn, ist von gräulichschwarzer Farbe, und mit vielen rundlichen Partien und cylinderformigen Stücken, von eben so gefärbtem Kalkspath durchzogen… Seine Bänke sollen bis 1 ½ Lachter stark gefunden werden, er ist am wenigsten von unregelmässigen Kalkspathtrümmern von weisser und wachsgelber Farbe durchsetzt… Der Bruch ist sehr ausgebaut und verschüttet… Nordöstlich von Kalkgrün, folglich östlich vom königl. Bruche trifft man auf eine Gruppe Brüche, welche am meisten bebaut werden. Im südlichsten derselben fallt das deutlich geschichtete Gestein mit 50° in h. 3. N. und nur am westlichen Ende hält es das Fallen der Gegend h. 12,4, N. Der Kalkstein ist hier vorzugsweise in 2 bis 6 Zoll starke Platten spaltbar, welche durch Thonschieferlagen von einander getrennt sind. Zwischen diesen stärkern Schichten des Schiefers legen sich zartere Blättchen desselben um die Mandel- und Nieren- förmigen Partien des dichten Kalksteins herum, so dass man auf dem Hauptbruche fast nur Thonschiefer, auf dem Querbruche hingegen den grau oder lichtfleischroth gefärbten Kalkstein, oft mit dunkelrothem Kern, zwischen dem grauen, grünen oder rothen Schiefer bemerkt. Letzterer erscheint in dieser Verbindung mit dem Kalke gewöhnlich etwas talkig und glänzender als ausserdem… In mächtigeren Gängen findet sich auch ein wachsgelber blättriger Kalkspath ein. Mit krystallisirtem Kalkspath sind endlich die Wände der grössern Gangspalten, von denen wieder mehrere in h. 12. zu streichen scheinen, besetzt. Die Krystalle sind theils gelblichweiss, theils lichtfleischroth und undurchsichtig, oder gräulichweiss und undurchscheinend. Eine grosse Anzahl der gewöhnlichen Kalkspathkrystallformen scheint hier vorzukommen; auffällig ist aber eine Neigung zu doppelter Bildung, so dass über vielen Skalenoedern ein zweiter Ueberzug, bei dem jedoch weder Spitze noch Endflächen ausgebildet sind, stattfindet, über andern sich ein Rhomboeder mit konvexen Seitenflächen gebildet hat, in dessen längerer Axe die Spitze des darin eingeschlossenen Skalenoeders noch sichtbar ist.“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„Kalksinter
hat sich häufig in einer Kluft des westlichen Bruchs in kleintraubigen
Gestalten, wahrscheinlich auf zerstörten Kalkspathdrusen angesetzt.
Eisenglanz in kleinen Krystallen, sowie eine Art Braunsteinmulm sind bisweilen den Kalkspathdrusen beigemengt. Diese Hauptgruppe des Kalkgebirges auf der Höhe von Kalkgrün, ist von allen Seiten, besonders auch am Hange gegen Wildenfels, von Brüchen eingefasst, die genau den nämlichen Charakter wie die beschriebenen zeigen, jedoch so, dass nach den äussern Grenzen hin die Mengungen mit Schiefer häufiger vorkommen; der Kalkstein ist von grauen oder rothen Farben. An den steilen Seitenwänden des Schönauer Thales, und in der Thalsohle, finden sich, wie schon berührt, ähnliche Kalkeinlagerungen. Dem an der Kirche von Schönau streichenden gelblichgrauen Grauwackenschiefer und dickplattigem Grünstein folgt wenig weiter aufwärts an der westlichen steilen Bergwand ein mächtiger Kalkstock… Das Gestein ist lichtaschgrau, mit Kalkspathadern durchtrümmert… An der östlichen steilen Bergwand und, den Kalkgrüner Hauptbrüchen nach dem Streichen entsprechend, findet sich wieder in mehreren .Brüchen und bis in die Thalsohle herab Kalkstein anstehend, wo er im obersten h. 8. W., h. 11. N. 9 h. 4,2. O. wannenförmig einfällt; der schwärzlichgraue Kalkstein ist dickschiefrig, zeigt keine Spur fremdartiger Körper, dagegen Beimengung von Kohlenstoff, der sich in schwachen Lagen eines unreinen Zeichnenschiefers ausscheidet, auch sind hier und im nächst tiefern Bruche die Schichtungsklüfte regelmässig mit Eisenocker überzogen. Unterhalb des Zusammenflusses des Härtensdorfer mit dem Zschokner Bache, ebenfalls an der westlichen Bergwand, trifft man auf ein Kalklager von dunkelaschgrauem Gestein, welches in h. 12. N. und h. 3. O. einfallt, und welches fast das einzige ist, bei dem man die Mächtigkeit auf 10 Ellen bestimmen kann , da der anstehende Grauwackenschiefer im Liegenden und Hangenden deutlich entblösst ist. Dem beschriebenen Bruche im Streichen westlich, und von ihm durch den Grünstein, worauf das Städtchen \Vildenfels steht, getrennt, befindet sich auf dem schmalen Bergrücken, oberhalb des Kirchhofs der sogenannte herrschaftliche Bruch (wohl der „Weinberg- Bruch“, der folglich, wie die Brüche an der Neumühle später auch, schon im Besitz der von Solms’schen Standesherrschaft gewesen ist), dessen Kalkstein mit 10° h. N. fällt und sich in 4 bis 6 Zoll mächtige Platten spaltet. Er ist ohne Schieferbeimengung, schwärzlichgrau, und enthält ebenfalls die cylindrischen, aus Kalkspath bestehenden, Körper. Die federartig zertrümmerten Gangsysteme von Kalkspath streichen hier h. 4. und fallen steil h. 1. N. Die Mächtigkeit des Kalkes dürfte etwa 20 Ellen betragen… Auf der Fortsetzung dieses Rückens bei der Neumühle findet sich die nordöstlichste Entblössung des Kalksteins, der hier h. 3. NW. fällt, aschgrau, und sehr mit Schiefer vermengt ist. So reich an andern Orten das Grauwackengebirge an thierischen Versteinerungen seyn mag, so unbedeutend sind deren Spuren bei Wildenfels. Dagegen enthält der Kalkstein, wie schon erwähnt ungemein häufig in Kalkspath verwandelte cylindrische und konische Körper, von denen ich bemüht war, von geschliffenen und Verwitterungsflächen des Gesteins, - aus Hunderten - die Deutlichsten abzuzeichnen. Herr Professor Reich bestimmte dieselben nach Goldfuß als Stielstücke von Stylasteriden.“ Anmerkung: Der taxonomische Begriff Stylasteridae bezeichnet eine Familie der Filligrankorallen. Wir fanden den Begriff in der Brockhaus- Ausgabe von 1911 und lesen dort: „Stylasterīden (Stylasterĭdae), trop. Familie der Hydrocoralliae (siehe Hydroidpolypen), mit festen, verzweigten Kalkgehäusen von oft lebhaften Farben.“ Folgen wir auch dem Verweis, finden wir außerdem noch heraus: „Hydroīdpolypen und Saumquallen (Hydroidĕa, Hydrozōa, Craspedōta), Ordnung der Ploypomedusen, festsitzende Polypen und Polypenstöcke, meist von Bäumchenform, und freischwimmende Medusen (Hydroidquallen, Saumquallen), letztere mit einem echten Randsaum (Velum) versehen…, festsitzende, korallenähnliche Polypenstöcke, die ein dichtes Netzwerk verkalkter Röhren darstellen.“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ergebnisse der Geognostischen Landesuntersuchung Sachsens Anfang des 19. Jahrhunderts sind auf dem Blatt XV der geognostischen Karte zusammenfassend dargestellt. Im Heft 2 der Geognostischen Beschreibung des Königreichs Sachsen, gedruckt 1845, beschreibt C. F. Naumann das Wildenfelser Zwischengebirge:
Fünftes
Capitel, Das Wildenfelser Uebergangsgebirge, (S.293ff)
Verbreitung und Gränzen. Die Massen, welche dasselbe zusammensetzen, sind einestheils Grauwackenschiefer, Grauwacke, Kieselschiefer und Kalkstein als wesentliche Bildungsglieder; anderntheils Grünstein, Hornblendschiefer und Glimmerschiefer als accessorische und wahrscheinlich später eingeschobene und aufgelagerte Glieder…
Wildenfelser Uebergangsgebirge; Kalkstein. (S. 299ff) Die Kalksteine der Gegend von Wildenfels zerfallen, nach ihrer Gesteins- Beschaffenheit, in zwei Arten, welche zwar in einander überzugehen scheinen, in ihren Extremen aber so verschieden hervortreten, daß man sie nothwendig sondern muß. Die eine derselben mag als schieferiger, die andere als massiger Kalkstein aufgeführt werden. Der schieferige Kalkstein erscheint von gräulichweißer, aschgrauer, bläulichgrauer, röthlichgrauer bis fleischrother, meist lichter Farbe, dicht und von ebenem oder flachmuscheligen, sehr feinsplitterigen Bruche. Er bildet wellenformig eingedrückte, oder auch aus an einander gereihten linsenförmigen und wulstartigen Partien bestehende, 1 bis 2 Zoll starke Lagen, zwischen welchen dünne Membranen eines grünlich oder gelblichgrauen Thonschiefers ausgebreitet sind, die eine deutliche dickschieferige und plattenförmige Structur hervorbringen. Diese dem Kalksteine eingeflochtenen Thonschieferlamellen haben gewöhnlich ein etwas talkiges und glänzendes Ansehen, so wie eine, wahrscheinlich auf chemische Bildung hindeutende feine Fältelung. Die wellenförmige Oberfläche der dünnen Kalklagen bedingt sehr häufige Verdrückungen und Auskeilungen derselben, wodurch die Thonschieferlamellen von beiden Seiten zur Berührung gelangen, so daß die Steinplatten auf dem Querbruche ein Netz von Thonschiefer darstellen, dessen langgezogene Maschen mit Kalkstein erfüllt sind. Aehnlich netzartige Zeichnungen kommen auch auf dem Hauptbruche zum Vorschein, wenn die Oberfläche der Platten durch die Verwitterung benagt worden ist, weil solche den Kalkstein weit stärker angreift, als den Schiefer, daher der letztere an der Oberfläche alter Felsenwände in netzartig verbundenen Zellen hervor steht. Diese verflochtene oder verschlungene Structur zwischen Kalkstein und Thonschiefermasse ertheilt bekanntlich dem Uebergangskalksteine so häufig ein marmorartiges Ansehen, welches ihn zu architektonischen und anderen Ornamenten umso geeigneter macht, je schöner und abstechender die Farben der sich umschlingenden Gesteinsmassen sind. Dieses ist auch hier bisweilen der Fall, indem der Kalkstein in einigen Brüchen, besonders aber in dem, bei dem Wildenfelser Schießhause gelegenen Königlichen Marmorbruche, eine schöne fleischrothe Farbe zeigt, welche mit der Farbe des Thonschiefers sehr angenehm contrastirt. Der schieferige Kalkstein hat immer eine ausgezeichnet deutliche und regelmässige Schichtung, wird aber zuweilen nach oben von Klüften durchsetzt, welche gewöhnlich mit Kalkepath allein, und nur wenn sie stärker sind, mit Quarz und Kalkspath zugleich erfüllt sind. Versteinerungen sind sehr selten wahrzunehmen; doch finden sich z. B. im gräulichweißen Kalkschiefer des Fuchsberges bei Schönau einzelne, in schwärzlichgrauen Kalkspath verwandelte Stielglieder von Stylastriten. Der schieferige Uebergangskalkstein bildet stockförmige Lager von 10 bis 20 und mehr Ellen Mächtigkeit, welche, obwohl nicht unmittelbar zusammenhängend, doch großentheils in zwei Züge gruppirt sind, die bei Grünau nahe an der liegenden Gränze des Uebergangsgebirges und im Hangenden der beiden höchsten Grünsteinkuppen auftreten. Außerdem finden sich noch einzele Lager, gleichfalls an der Gränze des Uebergangsgebirges und unmittelbar über Grünsteinkuppen am Fuchsberge bei Schönau, im Rentgraben bei Ober- Haßlau, so wie am südlichen Abhange der hohen Bergkuppe zwischen Wildenfels und Wiesenburg. Der massige Kalkstein hat dunkel bläulichgraue, schwärzlichgraue und gräulichschwarze Farbe, ist zwar dicht, erhält aber gewöhnlich durch sehr reichlich eingesprengte schwarze Kalkspathkörner ein krystallinisch- körniges Ansehen. Er ist mehr oder weniger deutlich, jedoch nie so ausgezeichnet und immer viel mächtiger geschichtet, als der schieferige Kalkstein; die Schichtung erscheint oft deutlicher in den oberen, als in den unteren Theilen der Kalkstöcke; zuweilen verschwindet aber auch jede Spur derselben, und das Gestein steht ohne alle Structur, als eine rudis indigestaque moles – was heißt: „eine rohe und ungeordnete Masse“ – an, wie z. B. in dem Königlichen und dem Winter‘schen Kalkbruche bei Grünau. Die, schon in den oberen Schichten des Kalkschiefers zuweilen wahrnehmbare Durchtrümerung mit weißem Kalkspath findet hier durchgängig und im hohen Grade statt. Kalkspathadern von haarfeiner Dünne bis zu mehrzelliger Stärke durchschwärmen, sich vielfaltig verzweigend, das Gestein nach allen Richtungen, und zwar oft so dicht und zahlreich, daß es das Ansehen gewinnt, als sei die schwarze Gesteinsmasse in lauter fuß- bis zollgroße Fragmente zerstückelt, dieses Haufwerk von Bruchstücken durch einander gerüttelt, und wiederum durch Kalkspat h zu einem Ganzen verbunden worden. Daß auch in der That etwas Aehnliches stattgefunden haben müsse, lehren die hierbei vorkommenden Durchsetzungen und Verwerfungen, indem z. B. die vorerwähnten schwarzen Kalkspathkörner (welche nichts Anderes als veränderte Enkrinitenglieder sind) nicht selten von feinen weißen Kalkspathadern durchschnitten und in ihren beiden Hälften verschoben sind. Diese Durchtrümerung mit weißem Kalkspathe verleiht auch dem massigen Kalksteine eine marmorartige Beschaffenheit, welche ihn besonders dann werthvoll macht, wenn das Gestein sehr dunkelfarbig und die Schichtung sehr mächtig oder gar nicht vorhanden ist. — Außer den, sich vielfältig verzweigenden und verschlingenden Kalkspathadern setzen aber auch größere, gangähnliche Spalten in diesem Kalksteine auf, welche mit röthlich- und gelblichweißem bis wachsgelben Kalkspathe erfüllt sind. Auch kommen bisweilen Drusen und Sinterbildungen von Kalkspath vor, sowie Eisenglanz und Braunsteinmulm, nach v. Gutbier. Charpentier erwähnt auch Schwefelkies im Marmor. (Das haben wir oben ja schon gelesen.) Die, dem Begüterten Winter gehörigen Kalkbrüche, so wie der Königliche schwarze Marmorbruch bei Grünau, der Kalkbruch bei Wildenfels, jener bei der Neumühle, sowie einige in Schönau, oberhalb der das Thal durchsetzenden Grünstein- Glimmerschiefer- Masse liegende Kalkbrüche lassen die hier erwähnten Erscheinungen mehr oder weniger vollständig beobachten. Dieser schwarze massige Kalkstein ist sehr reich an thierischen Ueberresten, namentlich von Krinoiden oder Stylastriten, deren Stielglieder ihn oft dermaaßen erfüllen, daß sie wohl mehr als die Hälfte der Gesteinsmasse ausmachen. Da sie alle in dunkelgrauen oder schwarzen Kalkspath verwandelt sind, und der sie umgebende Kalkstein gleichfalls eine dunkle Farbe hat, so ist ihre organische Form im frischen Gesteine nur selten erkennbar; sie tritt aber deutlich hervor, wenn die Oberfläche eine Zeit lang der Verwitterung ausgesetzt war, indem der dichte Kalkstein der Zerstörung etwas mehr unterliegt, als der Kalkspath. Daher sieht man besondere an alten Steinbruchswänden und an den Wänden der Höhlenräume die Stylastritenglieder zu Tausenden hervorragen, in allen Größen von mikroskopischer Kleinheit, bis zu mehren Linien Durchmesser, und oft so dicht gedrängt, als ob das ganze Gestein aus ihnen bestehen müsse. Weit seltner sind Cyathophyllen; Cotta fand ein ausgezeichnetes Exemplar von Cynthophyllum caespitosum in dem Kalkbruche bei der Neumühle, und auf den Wänden der alten Höhlen und Spalten sitzen zuweilen ganz einzelne Exemplare einer andern Species, welche am meisten Aehnlichkeit mît С. helianthoides besitzt. Auch sind zweischalige Muscheln (wahrscheinlich aus der Familie der Terebrateln) gefunden worden. Anmerkung: Auch bei den Cyathophyllen handelt es sich um Korallen. In Pierer´s Universallexikon haben wir dazu diesen Eintrag gefunden: „Cyathophyllum (C. Goldf., Kragenkoralle, Petref.), Gattung der Familie Ocellina, Ordnung Phytocorallia, kreiselförmige od. verkehrt kegelförmige Polypenstöcke mit becherförmigen Endzellen, außen längsgestreift mit ring- od. kragenförmigen Runzeln, im Längsquerschnitt zeigen sich parallele Querscheidewände; am häufigsten sind sie in der Grauwacke, doch treten sie auch in den jüngeren Formationen auf; nur eine Art lebt noch…“ Der hier erneut angeführte, deutsche Paläontologe Georg August Goldfuß (*1782, †1848) benannte diese Gattung als „Becherkorallen“ und beschreibt die Art C. caespitosum in seinen Petrefacta Germaniae so: „Ihre walzigen Aeste proliferiren in größeren Zwischenräumen, wachsen nur kurze Strecken aneinander gedrängt in die Höhe, divergiren vielmehr sogleich an ihrem Ursprunge, und beugen sich nicht selten hin und her. Die Endzellen stehen daher an der Oberfläche eines Rasens, durch größere oder geringere Zwischenräume von einander gesondert, empor, und haben, da sie sich nicht drängen, eine kreisrunde Mündung. Ihre Vertiefung ist glockenförmig, und von ihren zarten Lamellen wechseln größere und kleinere mit einander ab… Findet sich… in der Eifel und bei Bensberg.“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zurück zu Naumann: „Das Merkwürdigste aber ist, daß sich der den Kalkstein unmittelbar bedeckende Schiefer der höchst unregelmäßigen Oberfläche dieses Reliefs in allen Theilen anschmiegt, so daß er über jedem Pfeiler einen Sattel, aber jeder Kluft eine Mulde bildet, woraus hervorgeht, daß dieses Kalksteinriff schon vor der Ablagerung des Grauwackenschiefers den zerstörenden Einwirkungen ausgesetzt gewesen sein müsse, welche dasselbe zur Ruine umgestalteten. Ueber die Verhältnisse des hellfarbigen schieferigen zu dem dunkelfarbigen massigen Kalksteine läßt sich dermalen etwas Bestimmtes nicht beobachten, obgleich der Königliche schwarze Marmorbruch und die Winter‘schen Kalkbrüche sehr nahe bei einigen Stöcken des Kalkschiefers gelegen sind. Eine Art von Uebergang ist jedoch nicht abzuleugnen, indem der schwarze Kalkstein bei einer deutlicheren Schichtung und einer weniger dunklen Farbe Thonschiefer- Membranen auf den Schichtungsflächen, und selbst eine ähnliche Structur entwickelt wie sie dem schieferigen Kalksteine zukommt; während wiederum dieser in den hangendsten Schichten bisweilen einige Aehnlichkeit mit dem massigen Kalksteine gewinnt. Der hellfarbige schieferige Kalkstein scheint im Allgemeinen etwas älter zu sein, und seine Existenz dürfte zum Theil eine wesentliche Bedingung für die nahe bei oder selbst auf ihm, nach Art der Corallenriff'e erfolgte Ausbildung des schwarzen massigen Kalksteines gewesen sein. Der dunkelfarbige Kalkstein bildet keine weit fortsetzenden Lager, sondern einzelne liegende Stöcke und Klötze, deren Formen, vereint mit der oft erstaunlichen Menge von Stylastritengliedern auf die Vermuthung führen, daß man es wohl hier mit den Ueberresten vorweltlicher Krinoiden- Bänke zu thun habe. Diese Stöcke haben eine Mächtigkeit von 10 bis 40 und mehr Eilen, und werden gewöhnlich von Grauwackenschiefer bedeckt. Das Liegende derselben ist selten entblöst; im Dürr‘schen Kalkbruche ist es Grauwackenschiefer, im untersten Bruche am linken Gehänge des Schönauer Thales Grünsteinschiefer und in dem, am rechten Gehange unterhalb dem Einflusse des Härtensdorfer Baches liegenden Bruche conglomeratartige Grauwacke. Außer den bereits erwähnten ganz schmalen Thonschieferlagen kommen nur selten fremdartige Massen vor. Sehr kohliger Alaunschiefer findet sich in einem, ganz nahe bei dem Dürr'schen Bruche, etwas höher am Gehänge liegenden Kalkbruche. Im oberen Theile vom nördlichen Stoße des Königlichen schwarzen Marmorbruches ist ein 18 Zoll mächtiges Lager von feinkörnigem, feldspathreichen Diorit den 15° in NNO. einfallenden Schichten regelmäßig eingelagert, ohne daß irgend eine Veränderung des Kalksteines zu erkennen wäre. Eine mehr gangartige Masse desselben Diorites findet sich am östlichen Stoße des großen Kalkbruches im unteren Theile von Schönau. Die vorhin angedeuteten Form- Verhältnisse des dunkelfarbigen Kalksteines beurkunden sich nicht nur durch eine oft recht verschiedene Schichtenstellung innerhalb eines und desselben Kalkbruches, sondern auch durch die Art und Weise, wie die Kalkstöcke zuweilen begränzt sind. So fallen z. B. in dem großen Kalkbruche, welcher im unteren Theile von Schönau am rechten Gehänge unmittelbar im Hangenden des dasigen Grünsteines eröffnet ist, die Schichten am östlichen Stoße 50° in O., während sie am nördlichen Stoße 30° in NNO. einschießen. Besonders merkwürdig aber sind die Verhältnisse desjenigen Kalkstockes, in welchem die Winter‘schen Brüche betrieben werden. Diese Masse wird nämlich auf der Westseite durch eine steil aufgerichtete, nordsüdlich streichende und 70° in West fallende Schieferwand begränzt, während sie auf der Nordseite an Grauwackenschiefer und Grauwacke abschneidet, deren Schichten hor. 6. streichen und 30 bis 50° in Nord fallen. Auch dicht an der Ostseite des Bruches steht sogleich körnige Grauwacke an, wogegen im Liegenden auf der Südseite der Kalkschiefer nicht weit entfernt ist, so daß das Ganze einen klotzförmigen Stock bildet, dessen Umrisse kaum in einigem Zusammenhange mit den allgemeinen Schichtungs- Verhältnissen des umgebenden Gebirges zu stehen scheinen. Die Lage dieses Stockes ist auf der Charte durch die, unter den Buchstaben F und E des Wortes WILDENFEIS angedeutete rundliche Partie bezeichnet; was südlich daran stößt und sich nach Osten ausbreitet, ist lauter Kalkschiefer.“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Schrift über den Kalkwerksbetrieb in
Sachsen, führen die Autoren Wunder, Herbrig und Eulitz
im Jahr 1867 eine Reihe von Statistiken an, denen zu entnehmen ist, daß Anfang
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Raum Wildenfels 17 Tagebrüche in
Betrieb waren. Unterirdischer Kalksteinabbau fand hier nirgends statt.
Die Förderung belief sich auf etwa 1.200 Ruthen Rohkalk (etwa 4,5% der Gesamtproduktion Sachsens). In 7 periodischen und 6 Kessel- oder Schüttöfen wurden dazumal 70.800 Scheffel Branntkalk erzeugt (3,4% der sächsischen Produktion). Zu den damals üblichen Maßeinheiten siehe
unseren Beitrag zum Kalksteinabbau im Die 1867 ausgeführten chemischen Analysen des Kalksteins werden auch später mehrfach wieder zitiert. Wir fügen sie hier ein:
Auch aus dieser Quelle erfahren wir wieder einige Namen von Kalkwerksbetreibern und hören erneut, daß einer der Brüche, nämlich der sogenannte „Schwarze Bruch“, in staatlichem, dazumal also königlichem Besitz gewesen ist.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Geologe K. Dalmer bearbeitete die Geologische Specialkarte von Sachsen, Blatt 125: Section Kirchberg ‒ Wildenfels. Dazu erschien 1884 die 1. Auflage der zugehörigen Erläuterungen zur geologischen Karte. Die Einleitung gibt uns zunächst noch einmal eine schöne Beschreibung des Zwischengebirgscharakters: „Die obere Phyllitformation (das untere Cambrium) ist hier in gleicher Ausdehnung und Mächtigkeit entwickelt und weist auch im grossen Ganzen ein ähnliches Streichen und Fallen der Schichtung auf, wie auf der anderen Seite der NW.- Diagonale. Desgleichen wird sie längs einer ostwestlich streichenden Linie, die ungefähr in der Fortsetzung der Phyllit- Cambriumgrenze der anderen Hälfte liegt, regelrecht von dem Obercambrium überlagert. Von letzterem sind jedoch nur die liegendsten Theile entwickelt; - kaum ein Kilometer von ihrer unteren Grenze entfernt wird diese Formation, in der Gegend von Grünau, plötzlich durch eine mehrfach gebogene im Allgemeinen jedoch ostnordöstlich verlaufende Verwerfung abgeschnitten, jenseits deren sich ein wirres Durcheinander von Silur-, Devon- und Culmschichten sowie überraschender Weise auch von zweifellos archäischen, der Glimmerschieferformation zugehörigen Gesteinen einstellt. Dieser Complex lässt sich nördlich bis zu einer von der Neumühle über FriedensthaI nach dem Fürstengut und dem oberen Lohethale gezogenen Linie verfolgen, längs deren er unter dem discordant sich auflagernden Rothliegenden verschwindet. Die Neumühle bezeichnet zugleich den östlichsten Punkt seiner Verbreitung indem hier Nord- und Südgrenze unter spitzem Winkel zusammenstossen, oder mit anderen Worten, indem von hier ab das Rothliegende über die Grünauer Bruchspalte hinweg bis auf die cambrischen Schiefer übergreift. In westlicher Richtung erstreckt sich der vorliegende Schichtencomplex bis fast zum Muldethal, woselbst er mit den liegendsten cambrischen Schiefern der Südwesthälfte der Section, in deren Streichen er liegt, in seitlichen Contact tritt. Die Silur- und Devonschichten dieses Gebirgstheiles stehen also mit den jenseits der Nordwest- Südostdiagonale bei Niederhasslau und Wilkau auftretenden in keinem Zusammenhang, erscheinen vielmehr mit Bezug auf letztere um fast drei bis vier Kilometer südöstlich in das Liegende zurückgeschoben…“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die bereits früher als unterschiedlich geartet beschriebenen Kalksteine in Wildenfels werden von K. Dalmer in zwei verschiedene geologische Zeitphasen gestellt, zum ersten in die: VIII. Die Devonformation. 3. Das Oberdevon. „Das Oberdevon besteht auf vorliegender Section fast ausschliesslich aus einem grauweissen, aschgrauen oder auch röthlichgrauen bis fleischrothen, sehr feinkörnigen, muschelig brechenden Kalkstein, der stets sehr deutlich die sogenannte Kramenzelstructur aufweist, d. h. er wird durch ein Netz von bald sehr dünnen, fast hautartig feinen, bald etwas stärkeren Flasern einer gelblichgrauen oder grünlichen Schiefermasse in lauter flache, mit ihrer Breitseite der Schichtung parallel liegende Knollen zerlegt, die meist seitlich mit einander verschmolzen sind, mitunter aber auch durch die Schieferflasern völlig von einander geschieden werden. Besonders deutlich pflegt diese Structur auf angewitterten Flächen sichtbar zu werden, indem die Verwitterung bald den Kalk stärker angreift als die Schieferflasern, so dass letztere reliefartig hervortreten, bald umgekehrt die Schieferflasern in höherem Grade zernagt als den Kalk, so dass der Verlauf der ersteren durch ein Netz von Vertiefungen auf der Gesteinsoberfläche kenntlich gemacht wird.“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„Der oberdevonische Kalk findet sich insbesondere in der Gegend nordöstlich und nordwestlich von Grünau durch zahlreiche bedeutende Brüche aufgeschlossen und erscheint ausserdem noch in isolirten Partieen am Westabhange des Aschberges, sowie bei der Schönauer Obermühle. In sämmtlichen Aufschlüssen weist der Kalk eine stets deutlich ausgesprochene, dünnplattige Schichtung auf deren Verlauf allerdings ein häufig wechselnder, und in Folge zahlreicher Stauchungen und Dislocationen sehr unregelmässiger ist. Versteinerungen finden sich sehr spärlich und sind nur auf angewitterten Schichtflächen zu bemerken. Es liegen vor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die fossilreichen Kalksteine ordnet K. Dalmer
dagegen stratigraphisch ein in die:
IX. Culmformation und Kohlenkalk. „Ueber den oberdevonischen Kramenzelkalken folgt ein System von Thonschiefern, Grauwacken, Conglomeraten und Kalklagern, welche vollständig mit den entsprechenden Gesteinen des thüringisch- fichtelgebirgischen Culms übereinstimmen… Der Kohlenkalk unterscheidet sich vom oberdevonischen Kalk schon durch seine dunkele, fast schwarze Farbe, sowie durch seinen Reichthum an in Kalkspath umgewandelten Crinoidenstielgliedern, deren auf frischem Bruche deutlich hervortretende glänzende Spaltßächen dem an und für sich feinkörnig dichten Gesteine fast ein krystallinisches Aussehen verleihen. Das Gestein bildet innerhalb der Culmschiefer und Grauwacken einestheils ziemlich bedeutende, über 20 m Mächtigkeit und 200 m Längsausdehnung besitzende Lager, die entweder fast massige Structur oder nur eine durch bankartige Absonderung angedeutete Schichtung aufweisen; andemtheils tritt es aber auch in kleineren linsenförmigen Massen oder in Gestalt von zahlreichen mit Schiefer innig vergesellschafteten und wechsellagernden Lagen und Bänken auf: Die letztere Ausbildung des Kohlenkalkes, die sich öfters im Hangenden oder Liegenden oder im Streichen von massigeren Kalklagern einstellt, liesse sich noch am ehesten mit Devonkalken verwechseln, indessen unterscheidet auch sie sich dadurch deutlich von den letzteren, dass sie nie eine. gut ausgeprägte Kramenzelstructur, wie sie für die Devonkalke so characteristisch ist, aufweist. Bei massigerer Structur pflegt der Kohlenkalk von zahlreichen Trümern weissen Kalkspathes durchzogen zu sein, welche von der dunkelen Gesteinsmasse sich scharf abheben. Adern von haarfeiner Dünne bis zur Stärke von einigen Centimetern durchschwärmen, sich vielfach verzweigend und verästelnd, theilweise auch sich gegenseitig durchsetzend und verwerfend das Gestein nach allen Richtungen und zwar mitunter so dicht und zahlreich, dass die schwarze Gesteinsmasse in ein Haufwerk von "grossen und kleinen Fragmenten zerstückelt wird und somit eine wahre Breccie entsteht. Diese Erscheinungen sind insbesondere schön in dem Winter'sehen Kalkbruche bei Griinau, sowie in demjenigen bei der Neumühle zu beobachten. Der Culmkalk ist, wie bereits bemerkt, sehr reich an thierischen Ueberresten und zwar insbesondere an Crinoidenstielgliedern. Letztere sind in der frischen Gesteinsmasse nur selten als solche zu erkennen, sehr deutlich tritt ihre Form aber hervor, sobald die Gesteinsoberfläche eine Zeit lang der Verwitterung ausgesetzt war, indem der Kalkspath, in den sie umgewandelt sind, schwieriger verwittert als die Kalksteinmasse, in der sie liegen. Daher sieht man insbesondere an den Wänden von das Gestein durchziehenden grösseren Spalten die Stielglieder zu Tausenden hervorragen in allen Grössen von fast mikroskopischer Kleinheit bis fast 1 cm Durchmesser, z, Th. so dicht gedrängt, als ob das ganze Gestein daraus bestände. Eine nähere Bestimmung dieser Reste ist meist nicht möglich. Doch steht soviel fest, dass dieselben verschiedenen Arten zugehören. Diejenigen Stielglieder, welche sich durch einen weiten runden Kanal auszeichnen, sowie feinstrahlige etwas vertiefte Gelenkflächen und eine glatte, ebene oder schwach gewölbte Oberfläche besitzen, dürften nach GEINITZ (Verstein. der Grauw. Sachsens, S. 71) auf Melocrinus laevis GOlLDF. zu beziehen sein. Weit seltener als Crinoiden sind Korallen. Dergleichen sind zuerst von COTTA und sodann von WANKEL in dem Kalkbruche bei der Neumühle entdeckt worden… Ein wichtiger paläontologischer Beweisgrund für die Zugehörigkeit der vorliegenden Kalke zum Kohlenkalk ist das Vorkommen von Foraminiferen in denselben. Dieselben wurden insbesondere in Dünnschliffen von Proben des am oberen Ende von Schönau, sowie beim Friedhofe von Wildenfels gelegenen Kalklagers, recht häufig beobachtet. Doch konnten sie vereinzelt auch in Proben von fast sämmtlichen übrigen Kalklagern nachgewiesen werden. Leider ist eine nähere Bestimmung derselben, da nur Durchschnitte nach unbekannten Richtungen vorliegen, nicht thunlich. Einige Formen könnten möglicherweise zu Endothyra Bowmanni gehören. Ausser Foraminiferen wurden in mikroskopischen Präparaten auch noch ziemlich häufig Bruchstücke von Bryozoën beobachtet…
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An diese allgemeine
Schilderung des Wildenfelser Kohlenkalkes mögen sich noch einige speciellere
Bemerkungen über die einzelnen Vorkommnisse desselben anschliessen. Wir beginnen
mit den beiden auf der Höhe zwischen Wildenfels und Grünau befindlichen Lagern,
von denen das eine, westlichere durch den königlichen Marmorbruch, das
andere, östlichere durch Winter's Kalkbruch abgebaut wird. Das erstere
liegt in einer spitzwinkeligen, durch Verwerfungen bedingten Einbuchtung der
Oberdevon- Culmgrenze und wird, wie durch Einschläge erwiesen, sowohl östlich
und westlich als auch südlich von oberdevonischen Knotenkalken begrenzt, während
nach Norden zu, wie im königlichen Bruche zu sehen, Culmthonschiefer und
Grauwacken sich auflagern. Der Bruch ist schon sehr alt und war früher
beträchtlich grösser. Seine gesammte ehemalige Westhälfte ist jetzt mit Schutt
ausgerollt. Der Kalk zeichnet sich durch seine sehr regelmässige Absonderung in
zu unterst bis über 2 m mächtige, weiter oben meist 0,5 bis 0,3 m starke Bänke
aus und wird daher nicht zum Brennen, sondern zur Gewinnung von grossen Platten
und Werkstücken gebrochen. Eine von G. WUNDER ausgeführte chemische Analyse des Gesteines ergab, dass es fast keine Magnesia und nur 1,2% Thonerde, Eisenoxyd und unlöslichen Rückstand enthält und im übrigen aus reinem kohlensaurem Kalk besteht. Die in der oben erwähnten bankförmigen Absonderung sich aussprechende Schichtung besitzt im Allgemeinen ost- westliches bis westsüdwestliches Streichen sowie 15-20° nördliches Fallen. In dem oberen Theile des Lagers bemerkt man im Bruche eine etwa 0,3 m mächtige Schicht eines hellgraugrünen körnigen Gesteines, welches, wie die Untersuchung mit Lupe und Mikroskop lehrt, aus eckigen Feldspathkömchen, ferner scharfen Quarzsplitterchen sowie einer diese Bestandtheile verkittenden, schmutziggrünen, chloritischen Substanz sich zusammensetzt. Die sedimentäre Natur dieses Gesteines wird durch das spärliche Vorkommen von Crinoidengliedern in demselben erwiesen. Das KaIklager wird local von steilen, fast saigeren Klüften durchsetzt, welche sich mitunter in Folge der auflösenden Thätigkeit der auf ihnen circulirenden kohlensäurehaItigen Tagewässer zu bauchigen oder schlauchartigen Hohlräumen, stellenweise sogar zu bedeutenden, weithin fortsetzenden Höhlen erweitern. Die Wände derselben zeigen eine wellige, sichtlich ausgenagte, raube Oberfläche. Desgleichen ist auf nachträgliche Erweiterung von Spalten durch Sickerwasser noch eine andere, ehemals in dem westlichen, jetzt zugeschütteten Theile des Bruches gut zu beobachtende Erscheinung zurückzuführen, welche NAUMANN wie folgt beschreibt: „…Das Merkwürdigste aber ist, dass sich der, den Kalkstein unmittelbar bedeckende Schiefer der höchst unregelmässigen Oberfläche dieses Reliefs in allen Theilen anschmiegt, so dass er über jedem Pfeiler einen Sattel, über jeder Kluft eine Mulde bildet, woraus hervorgeht, dass dieses Kalkriff schon vor der Ablagerung des Grauwackenschiefers den zerstörenden Einwirkungen ausgesetzt gewesen sein müsse, welche dasselbe zur Ruine ausgestalteten.“ Letzterer Schluss dürfte wohl kaum als zwingend anzuerkennen sein, vielmehr ist anzunehmen, dass die Einschnitte in späterer Zeit, lange nach Ablagerung der hangenden Schiefer, durch allmähliche Erweiterung von Spalten entstanden sind und dass der Schiefer durch den Druck der überlagernden Gebirgsmasse in jene Vertiefungen hineingepresst worden ist, sich gewissermaassen „gesetzt“ hat. Ganz analoge Erscheinungen wiederholen sich an den von bunten Letten überlagerten Plattendolomiten des oberen Zechsteines von Crimmitzschau und Meerane. Das östlichere der Grüna'er Culmkalklager, welches durch den Winter'schen Bruch aufgeschlossen wird, weist sehr gestörte Lagerungsverhältnisse auf: Das Gestein stellt namentlich an der Nordwand des Bruches eine völlig ungeschichtete, jedoch von zahllosen Klüften und Kalkspathtrümem durchsetzte Masse dar. Westlich wird das Lager durch eine nordsüdlich streichende 70° W. fallende Kluft abgeschnitten, jenseits welcher man sehr dünnbänkigen, mit viel Schiefer gemengten Culmkalk antrifft. Im Osten endet der Kalk gleichfalls an einer Verwerfung, durch welche mitteldevonische Tuffwacke in das Niveau des Culms gerückt wird. Ob der ein wenig weiter südlich von dem Winter'schen Bruche aufgeschlossene oberdevonische Knotenkalk den Culmkalk regelrecht unterteuft oder aber durch eine Verwerfung von demselben getrennt wird, lässt sich in diesem Falle nicht ermitteln. Ferner ist in der Gegend der Neumühle, innerhalb des schmalen, hier zwischen der Alluvialaue des Zschockener Baches und dem Rothliegendterritorium sich hinziehenden Culmstreifens der Kohlenkalk durch eine Reihe von Brüchen aufgeschlossen, in welchen er theils ausgesprochen massig entwickelt, theils sehr mit Schiefer gemengt erscheint. Bei dem etwa 200 m thalabwärts von der Neumühle gelegenen Vorkommniss ist die liegende Grenze gut zu beobachten. Man sieht hier, wie der Kalk in eine theilweise Gerölle von Kieselschiefer und Quarz führende, kalkige Grauwacke übergeht, welche mit Bänken eines graugrünen, schieferigen, diabastuffähnlichen Gesteines wechsellagert. Letzteres besteht, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, aus zahlreichen Plagioklasleisten, unregelmässig vertheilten Augitkömern, secundärem Chlorit sowie Titaneisen. Ob dieses Gestein noch mit zur Culmformation gehört oder vielmehr das hangendste Glied des Oberdevons repräsentirt, muß dahingestellt bleiben. Einem etwas höheren Horizont als die eben besprochenen Vorkommnisse von Kohlenkalk gehören wahrscheinlich, - wie später nachzuweisen versucht werden soll, - die in der Nähe des Wildenfelser Friedhofs sowie im obersten Ende von Schönau durch Brüche aufgeschlossenen Lager an. Bei beiden bildet mächtig entwickeltes Culmconglomerat das Liegende, und Culmthonschiefer das Hangende. In Bezug auf organische Reste unterscheiden sie sich von sämmtlichen übrigen Kohlenkalkvorkommnissen durch ihren verhältuissmässig bedeutenden Reichthum an Foraminiferen und an Bryozoenbruchstücken. Das Gestein beider erscheint meist in fussstarke Bänke abgesondert und ist ziemlich rein, insbesondere frei von schieferigen Beimengungen und daher zum Kalk- Brennen wohl geeignet. Das Schönauer Lager wird westlich durch eine Verwerfung abgeschnitten; vielleicht ist die unten am Thalgehänge, hinter der Brauerei ehemals abgebaute, jetzt nicht mehr sichtbare kleine Kalksteinpartie als die verworfene Fortsetzung des erst erwähnten aufzufassen. Auch das am Friedhof von Wildenfels gelegene Vorkommniss wird, und zwar sowohl östlich als auch westlich, von Verwerfungen begrenzt, von denen die erstere am Ostende des Bruches direct sichtbar ist. Durch dieselbe ist der hangende Thonschiefer in das Niveau des Kalklagers gerückt worden, so dass die Fortsetzung des letzteren jenseits der Verwerfung in einiger Tiefe zu suchen sein würde. Die beiden ausserdem noch vorhandenen mächtigeren Lager von Kohlenkalk, von denen das eine bei der Schönauer Obermühle neben der Wiesenburger Strasse, das andere im unteren Theile von Schönau, am rechten Gehänge, etwa 600 m oberhalb der Schönauer Kirche sich befindet, bieten nichts bemerkenswerthes dar. Das Gestein des letztgenannten Vorkommnisses, welches durch den Junghändel'schen Bruch abgebaut wird, enthält nach WUNDER: 95,6% kohlensauren Kalk, 0,9% kohlensaure Magnesia, 1% Eisenoxyd und Thonerde und 2,7% unlöslichen Rest. Diese Zusammensetzung besitzt jedoch nur der Kalk in dem unteren Bruche, in dem weiter oben am Gehänge gelegenen Bruche erscheint er dünngeschichtet und vielfach mit z. Th. in Alaunschiefer übergehendem Thonschiefer verwoben…“
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die 1901 erschienene, von C. Gäbert
revidierte 2. Auflage der Erläuterungen zur geologischen Karte wiederholt den
Text zum Kalkstein nahezu wörtlich. Nur die bisher als Culm- bzw. Kohlenkalk
angesprochenen Kalksteine haben jetzt die Bezeichnung „Flaser- oder
Knotenkalk“ erhalten.
Heute wird genauer zwischen dem chronostratigraphischen System (hier dem Unter- Karbon) und der lithologischen Fazies (in diesem Fall Kulm oder Culm) unterschieden. Die Kulm- Fazies schließt sich südlich an die Kohlenkalk- Fazies an und stellt eine synorogene Sedimentation dar, also Ablagerungen, die gleichzeitig mit der Gebirgsbildung der variszischen Orogenese erfolgten. Das abgelagerte klastische Material wurde dabei von der Mitteldeutschen Kristallinschwelle, damals ein Inselbogen, abgetragen. Das Sedimentationsbecken, in welchem die Kulm- Fazies zur Ablagerung kam, war durch diese Schwelle grob in einen nördlichen und einen südlichen Bereich geteilt. Der nördliche Bereich bildet heute das Rheinische Schiefergebirge. In diesem Beckenbereich kamen hauptsächlich Tonschiefer (mit der bivalven Muschel Posidonia becheri) und Radiolarien führende Kieselschiefer (Lydite) zur Ablagerung. Im südlichen Bereich herrschte dagegen eine Flyschfazies mit turbiditischen Sandsteinen, Grauwacken und Olisthostromen vor. Die Sedimente der Kulm- Fazies in diesem südlichen Becken erreichten Mächtigkeiten von bis zu 3.000 Meter.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine kleine Kollektion von nebenbei am Wegesrand aufgesammelten Lesesteinen. Rechts der gelblich- graue, leicht geschieferte Kulm- Kalk aus Dörrer’s Bruch, links der schwarzgraue, devonische Knotenkalk. Calzit- Adern finden sich häufig in den dunklen Kalksteinen (ganz links).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jüngere Untersuchungen erklären uns die
stratigraphische Abfolge und die geologische Geschichte natürlich noch genauer.
So lesen wir bei A. Schreiber 1967:
2.4. Das Oberdevon „Während dieses Zeitraumes ist für das Varistikum eine starke Faziesdifferenzierung charakteristisch; spätere Großsättel zeichnen sich vielfach bereits als Schwellen ab. In den Zwischengebirgen lassen sich aus den Sedimenten ebenfalls Schwellen ableiten. In den zentralen Bereichen dieser Gebiete werden paläozoische Gesteinsserien abgetragen. Im Wildenfelser Zwischengebirge kommt es (im Oberdevon)… zu tektonischen Bewegungen und einem intensiven basischen Vulkanismus, der zur Bildung von Diabasgesteinen führt. In den Ruhepausen werden Tonschiefer und untergeordnet Sandsteine und Kalksteine abgelagert. Konglomerateinschaltungen, die vor allem im oberen Bereich der Diabasgesteine auftreten, weisen auf stärkere Hebungen im Liefergebiet hin. Im Oberdevon erfolgt der Übergang von der vulkanisch- klastischen zur kalkigen Fazies, die mit dem Brachiopodenkalk einsetzt. Das häufige Auftreten von Brachiopoden und Korallen im Kalkstein ist durch geringe Wassertiefe zu erklären. Nach dem Kohlenstoff- und Schwefelkiesgehalt und der dunklen Farbe entstand der Brachiopodenkalk unter reduzierenden Verhältnissen. Derartige Bedingungen müssen vor allem bei der Ablagerung des Kellwasserkalkes geherrscht haben, der eine besonders hohe Kohlenstoff- und Schwefelkiesführung aufweist. Im unteren, dunkelgrau gefärbten Bereich des Knotenkalkes klingt diese „Schwarzschieferfazies“ allmählich aus…“ 2.5. Unterkarbon „Im Wildenfelser Zwischengebirge wird vom Verfasser eine Schichtlücke in der Zeit des Oberdevons und des untersten Unterkarbons angenommen. Bei den ältesten unterkarbonischen Sedimenten – Tonschiefer mit Kalksteinen – ist bisher allerdings eine sichere Einstufung nicht möglich. Auf epirogene Bewegungen (Hebung) führt der Verfasser die Ablagerung des Unteren Kohlenkalkes zurück. Durch weitere starke epirogene oder schwache orogene Bewegungen entstehen die Rutschmassen des Geröllführenden Tonschiefers. Die über dem Geröllführenden Tonschiefer folgenden Wechsellagerungen von Tonschiefern, Grauwacken und Kalkgrauwacken geben die allgemeine Bodenunruhe im Unterkarbon wieder. Stärkere Hebungen im Liefergebiet führen bei Wildenfels zur Ablagerung des mächtigen Kulm-Konglomerates. Korallen und Crinoidenstielglieder des Oberen Kohlenkalkes weisen auf eine geringe Wassertiefe während der Bildung dieses Karbonatgesteins hin. Die wechselvollen Ablagerungen in seinem Hangenden zeigen ebenfalls die unruhigen Sedimentationsverhältnisse des Unterkarbons im Wildenfelser Zwischengebirge an (Tonschiefer, Grauwacken, Gerölltonschiefer). Nach ihnen setzt wahrscheinlich erneut vulkanische Tätigkeit ein. Das Unterkarbon weist erhebliche Unterschiede gegenüber der thüringischen Fazies, z. B. der Ziegenrücker Mulde, auf. Auffallend ist bei Wildenfels die geringe Mächtigkeit dieser Sedimente. Daher muß man mit Schichtlücken rechnen. Abweichend von der thüringischen Entwicklung sind auch das häufige Auftreten von Karbonatgestein (Kalksteine, Kalkgrauwacken) und die große Mächtigkeit des Unteren Kohlenkalkes. So hatten Teile dieses Zwischengebirges im Unterkarbon mehrfach Schwellencharakter…“ Neben den hier angeführten Fossilien ist Wildenfels außerdem einer von nur zwei Fundorten von Cladoxyleen, der ältesten Nadelholzfossilien, auf der Welt (zeit.de). Da der Abbau seit 1950 nicht wieder aufgenommen wurde, bestehen heute kaum noch Fundmöglichkeiten. Lesesteine kann man auf den Äckern natürlich immer finden und auch zum Wegebau ist nicht ofengängiger Kalksteinabfall gern verwendet worden.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur
Montangeschichte
Die Anfänge
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wann genau der Kalksteinbergbau bei Wildenfels begonnen hat, ist unbekannt. Auf
der Informationstafel an der ehemaligen Marmormühle in Grünau steht zu lesen,
daß das „Dorf im Grünen“ bereits 1402 als „Kalkgrün“ bezeichnet worden
sein soll. Daraus kann man folgern, daß schon zu dieser Zeit hier Kalkstein
gebrochen wurde.
Zumindest in den Urkunden des Klosters St. Nikolaus Grünhain aus dieser Zeit (siehe unseren einleitenden Abschnitt zur Regionalgeschichte) haben wir diesen Vermerk noch nicht auffinden können. Es ist jedoch völlig klar, daß die Zisterziensermönche schon für den Bau des Klosters Grünhain bis 1236 Baukalk benötigt haben und es ist durchaus möglich, daß sie diesen auch aus Kalkgrün bezogen und die Abtei deshalb 1402 „das gantze Dorf mit allen Zugehörungen“ selbst erworben hat. Der Abbau des Kalksteins fiel bekanntlich nicht unter das höhere Bergregal. In der Anfangsphase lag dieser grundeigene Bergbau daher in den Rechten der Landbesitzer, also begüterter Bürger oder Bauern (10036, Loc. 35930, Rep. 08, Grünhain, Nr. 0010) und natürlich der Grundherrschaft selbst. Wie u. a. im Kalkwerksbetrieb in Sachsen nachzulesen ist, waren spätestens ab 1867 auch die Grafen von Solms auf eigenen Ländereien im Kalkabbau zugange. Die erste urkundliche Erwähnung eines „Stück Kalksteinbruch uff Junghinns Gütern gelegen“ in einem Lehnbrief des Ernst von Schönburg- Glauchau, ausgestellt an Rudolf Edler von der Planitz, datiert auf das Jahr 1533 (Beierlein, 1963). Wie im Kapitel zur Geologie einleitend schon zu lesen war, führt dann im Jahre 1540 den Raum um Wildenfels auch Petrus Albinus als ein Abbaugebiet für Kalkstein auf. Bereits im Zeitraum ab 1645 tritt die Familie von Nicol Junghänel zu Schönau als Kalkbruchbesitzer in Erscheinung (30572, Nr. 2149). Ob dies dieselbe Familie ist, die in oben zitiertem Lehnbrief „Junghinns“ geschrieben wurde, ist zwar nicht mehr aufzuklären, aber durchaus möglich. Vermutlich betrieb diese Familie auch eine Gastwirtschaft, denn 1727 streitet ein Georg Junghänel gegen den Rat zu Schneeberg „wegen des Brauens und Schenkens“ (10084, Nr. 09159); 1744 wird in einem anderen Rechtsstreit dann ein Adam Gottlieb Junghänel genannt (30572, Nr. 2806). 1746 bewirbt sich Johann Junghänel erneut um ein Prädikat (10036, Loc. 35301, Rep. 02, Lit. K, Nr. 0049). Die Familie Junghänel muß über viele Generationen in der Region ansässig gewesen sein, denn 1827 gibt es wieder einmal einen Rechtsstreit, diesmal um einen Zufahrtsweg, mit einem Herrn Friedrich Wilhelm Junghänel (30861, Nr. 1472). Zwischen 18058 und 1904 war das Friedrich Wilhelm Junghänel'sche Gut zeitweise verpachtet (30861, Nr. 98). 1832 tritt dann noch ein Herr Christian Gottlieb Junghänel in Erscheinung (30572, Nr. 3606). K. Dalmer schreibt 1884 den Namen „Junghändel“. Wie uns Das Örtliche schnell verrät, ist eine Familie Junghänel noch heute in Wildenfels ansässig. Daneben haben wir oben schon den Namen Dörrer (oder 1845 bei Naumann „Dürr“) als Kalkwerksbesitzer in Schönau kennengelernt. Zur Familie Dörrer haben wir zumindest einen Hinweis in den Akten gefunden, daß sie ebenfalls schon seit dem 18. Jahrhundert in der Region ansässig war; 1793 nämlich taucht der Name Johann Georg Dörrer in einer Akte auf (30861, Nr. 1558). Auch den Namen Dörrer findet man noch heute im Telefonbuch von Wildenfels. Zu dieser Zeit stand die Gewinnung von Bau- und Düngekalk im Mittelpunkt des gewerblichen Interesses. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erst in der Regierungszeit von Kurfürst August, I. (*1526, †1586) stieg der Bedarf an Dekorationssteinen für die repräsentativen Schloßbauten erheblich an, wohingegen der Import von edlen Werksteinen, wie Marmor, natürlich sehr teuer war. Daher hatte der Kurfürst am „Marmelstein“ aus dem eigenen Lande natürlich besonderes Interesse und 1573 mußten thüringische Stuckateure und Steindrechsler versprechen, sich nach Marmorstein- und Kalkbrüchen im Lande umzusehen. Im Jahr 1575 erhielt dann der italienische Steinmetz, Bildhauer und Architekt Giovanni Maria Nosseni das kurfürstliche Privileg, im Lande nach Marmor zu suchen. In diesen zeitlichen Zusammenhang fällt auch eine weitere urkundliche Erwähnung des Marmorabbaus in Wildenfels, da es „wegen eines zu Schönau gebrochenen Stücks schwarzen Marmors“ anno 1613 „zu Differenzen“ kam... (10024, Loc. 04514/06) Wie oben auch schon zu lesen war, mußten die Kalkwerksbesitzer geeignete Stücke des farbigen Kalksteins ja auf deren Wunsch an die Bildhauer abgeben. Giovanni (Johann) Maria Nosseni (*1544, †1620) war Bildhauer aus Lugano im Tessin, Schweiz. Auf ein Ersuchen des Kurfürsten an Freiherrn Hans Albrecht von Sprintzenstein, man habe Alabaster und Marmor im Land entdeckt und er brauche einen „artlichen Meister, der diese Gesteine kunstfertig zu bearbeiten versteht“, sandte ihm dieser Nosseni mit einem in Linz an der Donau am16. Januar 1575 ausgestellten Empfehlungsschreiben, worin zu lesen ist, er sei ein „Meister und Künstler, dessen Profession nicht einer, sondern mancherlei trefflicher Art“, nach Sachsen. Seit Ende Januar 1575 wirkte Nosseni daraufhin in Dresden. Am 5. Mai 1585 wurde ihm der von ihm entdeckte Marmorbruch bei Lengefeld im Erzgebirge auf 20 Jahre verschrieben. Bei Reisen durch das Erzgebirge in den Jahren 1586 und 1587 entdeckte er danach in alten Kalkbrüchen schwarzen Marmor bei Kalkgrün, roten am Schießhaus bei Wildenfels sowie weißen bei Crottendorf.
Ob auch der Marmor in den Skarnlagern des Fürstenberges bei Waschleithe von ihm
erschlossen wurde, ist nicht absolut sicher. Möglich ist auch, daß anstelle
dessen die
Marmorgewinnung bei
Jedenfalls entstanden neben den älteren grundeigenen Brüchen auf Kalkgrüner Flur nun der „Schwarze Bruch“ und bei Wildenfels der „Rote Bruch“. Nosseni erwies sich in der Folgezeit nicht nur als fähiger Architekt und Künstler, sondern entwickelte auf Grundlage seines Privileges auch kaufmännischen Geschäftssinn. Das Grundstück, auf dem der erste lag, gehörte einem Bauern namens Peter Zschicke. Nosseni kaufte es ihm kurzerhand für 138 Gulden ab. Der Rote Bruch lag auf dem Grund des Christoph Erler aus Wildenfels. Auch dieses Grundstück erwarb Nosseni 1587 für 172 Gulden und 6 Groschen selbst (Beierlein, 1963), womit er sich ein Monopol auf den farbigen Wildenfelser Marmor sichern konnte. Aus einer Akte der Standesherrschaft Wildenfels geht außerdem der Name Jacob Gruhner als Besitzer eines der Grundstücke im Jahre 1589 hervor, auf dem der kurfürstliche Marmorbruch gelegen habe (30861, Nr. 1714). Als Aufseher über die Brüche bestellte Nosseni David Blüher, der dieses Amt auch nach Nosseni‘s Tod und während des Dreißigjährigen Krieges weiterhin versah. Von Kurfürst Christian, I. (*1560, †1591) erhielt Nosseni 1590 ein erneutes Privileg auf 20 Jahre, das ihm 1609 nochmals verlängert wurde, so daß er es bis zu seinem Ableben innehatte.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Tod Nosseni's 1620 erlosch auch sein Privileg. Ein solches erhielt nach ihm kein anderer erneut und die Marmorbrüche wurden stattdessen unter direkte kurfürstliche Aufsicht gestellt, die der Fürst natürlich nicht persönlich wahrnahm; vielmehr war die Finanzbehörde (die Kammer) damit beauftragt. Infolge des 1618 ausgebrochenen Dreißigjährigen Krieges verfielen die Brüche, zumindest die Marmorgewinnung, in der Folgezeit aber wieder. Nach dem Kriegsende hatte Kurfürst Johann Georg, I. (*1585, †1656) als Architekten Wolfgang Kaspar von Klengel (*1630, †1691) nach Dresden geholt. Für seine Bauten benötigte natürlich auch dieser Baumaterial und dieser weitgereiste und weltkundige Mann entsann sich daher erneut der Marmorbrüche. Johann Georg, II. (*1613, †1680), der 1659 die Regierung übernommen hatte, beauftragte ihn schließlich, umgehend die „nunmehr über 40 Jahre erlegenen Marmorbrüche …in Augenschein zu nehmen“. Die Berichte Klengel‘s über seine Bestandsaufnahme in den Marmorbrüchen sind erhalten geblieben (vgl. 35930, Rep. 08, Nr. 11 und Beierlein, 1963). Über seinen Besuch in Kalkgrün berichtete er: „Den 5. Octobris bin ich nach Gruna gereiset, … habe den Richter nahmens David Blüher, einen geruhigen Mann von 88 Jahren am Leben gefunden. Dieser hat zu G. M. Nosseni’s Zeit die Marmor Brüche dieser Orten in Aufsicht gehabt… Ohnweit von Gruna auf der Höhe bey Hans Kuchen’s jetzigen Besitzers Feldern ist ein schwartzer Marmor Bruch mit eintzeln weißen Adern sehr gantz und gar von reinem Granito (Korn)… Zur Seiten, wo diese Stücke gebrochen worden, ist anietzo die Wandt mit Rasen und Moos überwachsen. In diesem Bruch können Stücken, so groß man überall will, gebrochen werden. Und weichet dieser Marmor keinem andern seiner Art nach… Etwa 300 Schritte von Ihro Churf. Durchl. schwartzem Bruche auf George Francken’s Grunde ist ein schwartzer Marmor Bruch, so schön voll weißer Adern und brechen große Stücke, gehöret ins Amt Wiesenburg, ist schade, daß er also mit Pulver zersprenget wird, brennen itzo Kalck daraus… Gleich neben diesem ist ein schwartzer Marmor Bruch mit sehr viel weißen Adern, hat soviel Weißes als schwartzes, ist ein köstlicher Stein. Ich kann sagen, daß ich keiner Orten zeitlebens einen schönern gesehen und ist zu bejammern, daß bereits so viel von diesem edlen Steine zu Kalck gebrennet und der Bruch so gantz am Tage lieget, also mit abschießen zersprenget wird… Der rothe Marmor Bruch, so auf Wildenfelßischem Boden gelegen, bey Georg Todt's von Wildenfelß Äckern, ist überaus mächtig… In diesem Bruche finden sich auch viel gebrochene Stücke, welche durch die lange Zeit verfallen und mit Rasen bewachsen… Von diesem Bruche aus ist eine Rösche, das Wasser ins Thal abzuleiten, getrieben worden, welche sich aber durch die Länge der Zeit verstopfet…“ Letzteres ist von Interesse, da wir bisher davon ausgegangen sind, daß der Kalksteinabbau hier ausschließlich übertägig erfolgte. Außerdem gibt dies einen Hinweis darauf, welche Tiefe der Rote Bruch schon damals erreicht haben kann: Der südliche Talhang im Bereich des heutigen Restloches liegt auf einer Meereshöhe von zirka 343 m, während die Talsohle – in dessen Höhenniveau man die hier genannte Rösche sicherlich angesetzt haben wird – rund 20 m tiefer liegt. Klengel berichtet auch, „daß Johann Maria Nossenius in den Brüchen, als das Freybergische Churf. Begräbniß erbaut worden, allezeit im Sommer bis 8 Steinbrecher und auch so viele Arbeiter alda gehabt. Item 4 Steinmetzen… Ein Steinmetz hätte 2 Thaler, eine Steinbrecher aber… 1 Thaler 6 Groschen und ein Abräumer oder Handarbeiter 18 Groschen wöchentlich gehabt… Die Steine sind von den… Grunischen Unterthanen nachher Dresden geführet und aus der Churf. Cammer nach vorig gemachtem Gedinge bezahlet worden, …hätten auf eine Fuhre 30 bis 54 Centner… fortgebracht und hätten solches mit 8 Pferden gezogen, auf 30 Centner hätten sie allzeit 4 Pferde gespannt. Sonsten hätten Churf. Durchlaucht J. M. Nosseni den Centner Marmor, ausgeschlagen vor dem Bruche, auf der Stelle umb 2 Thaler 6 Groschen bezahlt… an Tafeln aber, wäre eine so etwa nur 3 Ellen lang und 1 ½ bis 2 Ellen breit gewesen, nicht unter 50 bis 60 Thaler gegeben worden…“
Um den Marmorabbau in Kalkgrün wieder zu beleben, wurde auf Vorschlag Klengel’s
und auf fiskalische Kosten 1665 eine erste „Marmorschneidemühle“
errichtet. Wie uns bereits die historische
Darstellung
Zugleich konnten Rohsteine und Zwischenprodukte, wie Säulen oder die oben schon erwähnten „Tafeln“ auf der Mulde verschifft werden. Nur die Herstellung der Polituren wurde dann in Dresden durchgeführt. Der Pfarrer von Scheibenberg, Christian Lehmann (*1611, †1688), berichtete in seinem erst 1699 posthum erschienenem Historischen Schauplatz des Meißnischen Erzgebirges, cap. VI.: Vom Marmel-Stein, über diese Mühle: „Ferner finden sich zu Kalchgrün, eine Stunde von Schneeberg gegen Zwickau, auch unterschiedene Marmor- Brüche, derer Marmor ist schwarz mit weissen Adern, roth mit weissen Adern, grau mit schönen rothen Tropffen eingesprenget, und brechen daselbst sehr grosse Stücken zu 200 bis 300 Centner schwer, ist auch in grosser Menge zu haben. Darumb ist daselbst verwichene Jahre eine Chur- Fürstliche schöne Marmor- Schneide- Mühle mit vier Wercken erbauet worden, worinnen 32 Sägen gespannet, und mit einem Wasser- Rad 32 Schnitte auff einmahl gethan werden können. Liegt gar bequem an der Mulda, mit der Zeit einige Commercien daraus zu schaffen.“ Die Kenntnisse Klengel’s, die er von seinen Reisen nach Italien, Belgien und Holland mitgebracht hatte, waren also in eine für ihre Zeit hochmoderne Anlage eingeflossen. Diese erste Mühle brannte jedoch schon 1682 wieder ab. Erst 1692 ging an gleicher Stelle eine neue Schneidemühle in Betrieb (10036, Loc. 35929, Rep. 08, Grünhain, Nr. 0001). Für diese wurde um 1750 auch ein „kleines Schleifwerk“ konstruiert, mit dem Hohlformen ausgearbeitet werden sollten (10036, Loc. 35930, Rep. 08, Grünhain, Nr. 0008). Wir versuchen mit unserer folgenden Skizze, die Funktionsweise dieser „Marmor- Mühle“ zu veranschaulichen: Das unterschlächtige Wasserrad trieb die Hauptwelle an und über die Stirnräder wurde die Drehzahl der kleineren Antriebswellen erhöht. Auf den beiden kurzen Wellen saßen außerdem je zwei Schwungräder. Krummzapfen und Pleuelstangen setzten die Drehbewegung dann in die Schwingbewegungen der Sägegatter und der Schleifplatten um. Gatter und Schleifplatten waren vermutlich an Kettenzügen verstellbar aufgehängt. Wenn mit den beiden Sägegattern „32 Schnitte auff einmahl gethan werden“ konnten, mußten in jedem also 16 Sägeblätter eingespannt sein. Im Obergeschoß waren sicherlich Verwaltungsräume untergebracht.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1694 trat Friedrich August, der Starke (*1670, †1733), die Regierung in
Dresden an. Für den Innenausbau des Dresdner Residenzschlosses bestellte er 400
Zentner Marmor in Kalkgrün und war von der Schönheit des Materials begeistert.
1708 besuchte er höchstselbst die Marmorbrüche in Kalkgrün.
Friedrich August war es bekanntlich auch, der den Architekten Daniel Pöppelmann (*1662, †1732) und den Bildhauer Balthasar Permoser (*1651, †1732) nach Dresden holte. Der Ausbau Dresdens zur barocken Residenzstadt führte in der Folgezeit in Kalkgrün zu einer Intensivierung des Abbaus. Permoser weilte selbst mehrfach in Kalkgrün, um Stücke vor Ort auszuwählen. Er beschwerte sich 1713 aber auch: „Es wären in Kalchgrün schöne Brüche, so die Unterthanen besäßen, alleine Ihro Majestät würden nach ietziger Beschaffenheit der Arbeiter in Ewigkeit keine große Tafel bekommen, weil diese die schönsten Stücke von 6 bis 7 Ellen hoch mit Pulver sprengten, nur damit sie Stücken zum Kalchbrennen bekämen, den sie hernach sonderlich nach Leipzig verkauften, daselbst er nicht zum Mauern, weil er zu gut, sondern nur zum Weißen gebraucht würde… Mit den Bauern auff ihren Feldern würde man sich wohl vergleichen müssen, weil die Brüche auff ihren Feldern wären und sie überdies wohl die Abgänge zum Kalchbrennen behalten müssen.“ Der 1700 als Aufseher über die kurfürstlichen Marmorbrüche eingesetzte Marmorinspektor Johann Zellmann hatte auch die Aufsicht über die grundeigenen Betriebe. Aus dem Jahr 1705 sind daher die bäuerlichen Kalkbruchbesitzer Christian Kuntze und Hans Tröger aus Kalkgrün sowie Michael Junghänel aus Schönau bekannt (35930, Rep. 08, Nr. 11).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Jahr 1702 kaufte der Steinmetz Johann Maria Fossati auf Rechnung des Domkapitels Bautzen Marmor aus dem Bruch in Kalkgrün für den Hochaltar der Kirche in Bautzen (10036, Loc. 34975, Rep. 02, Gen. 65, Nr. 1318 und 1413). Auch Giovanni (Johann) Maria Fossati (*um 1690, †nach 1750) entstammte einer Künstlerfamilie aus Morcote im Kanton Tessin.
Spätestens Anfang des 18. Jahrhunderts hatte
sich in Wildenfels selbst ein Steinmetz oder
„Steinschmied“ niedergelassen (30861, Nr. 1900).
Was die Bildhauer aus dem Material so alles geschaffen haben,
kann man sich noch heute
Ab 1741 hatte die Funktion des „Vizemarmorwerksmeisters“ in Kalkgrün dann Herr Johann Gottlieb Hergert inne (40017, Nr. 63). Die Familie Hergert blieb über viele Jahre Aufseher über die Schneidemühle und erwarb sich viele Verdienste um ihren Betrieb. 1741 wurde die Mühle ausgebessert und 1742 erhielt sie ein neues Wasserrad. 1746 ist J. G. Hergert zum Marmor- Werksmeister ernannt worden (10036, Loc. 35301, Rep. 02, Lit. K, Nr. 0049). Die Oberaufsicht über die Marmorbrüche im „Kalkgrüner Revier“ lag jedoch weiterhin bei der Finanzverwaltung (10036, Loc. 36302, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 4037). Daher machte man sich 1750 und 1754 auch in Dresden Gedanken über „die Steigerung des Ertrags an geschnittenem Marmor“ und „die dafür anzulegenden Marmorschleif- und Poliermaschinen“ (10036, Loc. 35930, Rep. 08, Grünhain, Nr. 0008 und Loc. 36043, Rep. 08, Wiesenburg, Nr. 0015). Bei dieser Quellenbezeichnung fällt nebenbei auf, daß in derselben Zeit das Örtchen Kalkgrün vom Amt Grünhain (in der östlich benachbarten, Schönburgischen Grafschaft Hartenstein gelegen) zum Amt Wiesenburg gekommen sein muß. Die ortsansässigen Kalkbruchbesitzer hatten im Gegensatz zu den Bildhauern an der weit aufwendigeren Werksteingewinnung freilich auch weiterhin nur wenig Interesse und zogen – wie schon früher – aus der Erzeugung von Branntkalk schnelleren Gewinn, worüber schon 1659 W. C. von Klengel und 1713 erneut B. Permoser verärgert waren. Um die Förderung von ofenfähigem Kalkstein zu steigern, waren die privaten Kalkbruchbesitzer nämlich allerorten zum Abbau mittels Bohren und Schießen übergegangen, was die Gewinnung brauchbarer Werksteine aber nahezu unmöglich machte. Ein Herr Johann Schwalbe, eigentlich Fährmann auf der Mulde in Kalkgrün, hatte 1746 mit dem Kalksteinbruchbesitzer Georg Tröger in Schönau über Kalksteinlieferungen zum Brennen verhandelt; aus steuerlichen Gründen hatte er seinen Brennofen nämlich bei Fährbrücke, am linken Muldenufer und auf dem Grund der schönburgischen Herrschaft Stein errichtet. Wo wir einmal dabei sind, prüfen wir auch das und finden tatsächlich noch heute eine Familie Schwalbe im Telefonverzeichnis von Schönau und von Wiesen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In Dresden wurde lange über die Errichtung eines eigenen Kalkofens gestritten,
in dem
die Abfälle der Werksteingewinnung
gewinnbringend verwertet werden könnten (10036,
Loc. 36302, Rep. 09, Sect. 1, Nr.
4039 sowie Loc. 35930, Rep. 08, Grünhain, Nr. 0012 und 0013). Am Ende wurde aber
entschieden, einen Vertrag mit Gottfried Junghänel abzuschließen, der zu
dieser Zeit in Schönau bereits einen Kalkofen betrieb. Daraufhin
belieferte der Marmorwerkmeister J. G. Hergert dann tatsächlich aus den
fiskalischen Kalkbrüchen Herrn
Junghänel
„mit dem für seinen Kalkofen benötigten
Gestein.“
Um 1766 muß der Abbau von Marmor im fiskalischen Bruch infolge des Siebenjährigen Krieges mit Preußen nahezu zum Erliegen gekommen sein, denn in diesem Jahr legte man im Oberbergamt zu Freiberg eine neue Akte mit dem Titel „Marmorgebirge und Wiederinbetriebnahme des kurfürstlichen Marmorwerkes Kalkgrün“ an (40001, Nr. 2982 und 2983). Berghauptmann Carl Wilhelm von Heynitz (*1738, †1801) erhielt dazumal den landesherrlichen Auftrag, sich persönlich um die Angelegenheiten des Marmorbruches in Kalkgrün zu kümmern. Über die Schneidemühle dagegen kann man in einem Bericht an den Dresdner Hof aus dem Jahr 1766 lesen, „von der Marmormühle ist nichts mehr vorhanden als einige Überbleibsel von einem elenden Rade und des dazugehörigen Getriebes“. In der Nacht vom 3. zum 4. Juli 1778 vernichtete ein Muldehochwasser diese Reste samt dem Wohnhaus des Werksmeisters Hergert endgültig.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir schweifen kurz ab: Schon 1852 hatte der
Oberberghauptmann Friedrich Constantin von Beust mit seiner Schrift
Die Eisenbahnverbindung zwischen Zwickau und dem Obererzgebirge als
Mittel gegen den Verfall der dasigen Eisenindustrie für den Bau einer
Eisenbahn bis nach Schwarzenberg geworben. Am 7. August 1855 hatte der
Sächsische Landtag daraufhin den Bau der „Obererzgebirgischen
Staatsbahn“ zwischen Schwarzenberg und Zwickau genehmigt. Zwischen
Cainsdorf und Zwickau wurde die schon seit 1854 bestehende „Zwickau-
Cainsdorfer Staatskohlenbahn“ integriert. Der Bau der
Streckenverlängerung nach Süden durch das Muldental begann am 15. Oktober
1855. Am 11. Mai 1858 wurde die Strecke feierlich mit einem Festzug
eingeweiht. Der reguläre Zugbetrieb begann am 15. Mai 1858. (wikipedia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Ende des
Marmorabbaus
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1785 wurde der Schwarze Bruch dann an den Gräflich Solms’schen
Hofverwalter in Wildenfels, Johann Wilhelm Braun, verpachtet.
Eine Akte dazu findet sich im Bestand des Amts Zwickau (30023, Nr. 547).
Dieser intensivierte zwar nicht die Gewinnung von Werkstein und
Marmor, initiierte jedoch die Lieferung von Kalkstein als Zuschlagstoff an
die Eisenhütten in Blauenthal und Schönheide. Das brachte zumindest dem
Kalksteinabbau einen neuen Aufschwung. 1787 sollen mehrere tausend Fuder
Flöße aus den staatlichen Brüchen geliefert worden sein.
Die Hammerwerksbesitzer muteten später beim Bergamt Schneeberg selbst eine Fundgrube in Wildenfels unter dem Namen „Immer streitbare Fundgrube“ (Beierlein, 1963). Aktenkundig ist u. a. die Mutung einer Frau von Stieglitz auf Eisensteinflöße beim Schwarzen Marmorbruch zu Grünau (40015, Nr. 128). Der in diesem Zusammenhang in den alten Akten meist verwendete Begriff „Eisensteinflöße“ meint weder Eisenerz noch Flußspat – wie in manchen Quellen fälschlicherweise zu lesen ist – sondern tatsächlich den Kalkstein, der bei der Roheisenverhüttung zugesetzt wurde, um die Zähigkeit der Schlacken herabzusetzen. Das beschreibt übrigens Pfarrer Christian Lehmann schon anno 1699 im cap. III.: Von Kalck- Brüchen: „Wenn man diese Kalck- Art dem Eisenstein im Schmelzen zusetzet, wird das Eisen schmeltzig und flüssig, wie denn von Alters (her) viel davon zum Zerrenn- Feuer verkauft worden (ist)…“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ab 1787 wurde aber auch wieder Marmor in
Wildenfels abgebaut und für die Errichtung des Hochgrabs in der
Begräbniskapelle zu
In den Akten haben wir den folgenden Auszug aus dem Bauvertrag mit J. G. Gäbert finden können (30016, Nr. 1943):
Extract „Das Monument wird nach der gnädigst genehmigten Zeichnung, und zwar die Säulenschäfte vom Fußgesimse bis an das Capitäl aus ganzen Stücken schwarzen Marmors, die Inscriptions- Tafeln aus mehr nicht als zwey Stücken, die halbgetheilt genau wieder aufeinander paßen, die Architrav und Corniche des Hauptgebälkes von dergleichen schwarzen Marmor, die Capitäler der Säulen, die Fußgesimse und der Fries von Crottendorfer weißen Marmor, die Friese und die Tafeln, die Würfel unter den Säulen und die Zacken auf dem Hauptgebälk von Brocatell, die Todtenköpfe an letzteren aber von weißen Marmor, die Zacken zwischen den Würfeln oder Postamenten der Säulen von grauem und weißem, desgleichen der obere Aufsatz mit der Schlange von grauem und weißem, die Bande mit den Übergängen (?) aber von schwarzem Marmor, wie die Übergänge (?) polirt, das übrige matt gelaßen wird, gefertiget, die Wappen in den Frontons werden en bas relief nebst den übrigen Verzierungen gearbeitet und zum Theil vergoldet, keine Inschriften aber nicht eingehauen, sondern nur die Zirbellöcher zu deren anzusetzenden metallenen Buchstaben gemacht. Diese gesammte Arbeit incl. aller Brecher (?) und Fußlöcher bis zur Werkstadt, die Emballage der einzelnen Stücken, wie (?) jedoch die Kästen vom ganzen Transport wieder mit zurückgebracht werden sollen, incl. der Mitsendung eines geübten Gesellens, der die Verpackung besorgt und auf die Fußleute unter Weges Acht hat, ferner die Versetzung des Monuments, wozu jedoch die nöthigen Männer und Handlanger nebst erforderl. Eisen Werk gegeben werden, ist obgedachten Herrn Gäbert überhaupt für die Summe von Viertausend Thaler verdungen worden.“ Gäbert starb jedoch 1799 und erst sein Nachfolger, Dominicus Joseph Hermann richtete das Grabmal in Altzella bis 1802 tatsächlich auf. Mit der Errichtung des Grabmals in Altzella hatten beide Bildhauer verschiedene Probleme, die nicht nur aus Geldmangel herrührten. So verweigerten nach 1800 die „spannpflichtigen Nossener Amtsuntertanen“ mehrfach auch Transportleistungen für Baumaterial (20014, Nr. 5436, 5453 und 5455). Als Bildhauer hatte auch Gäbert, wie vor ihm auch schon W. C. von Klengel und B. Permoser, große Sorge, daß nicht nur in den privaten Kalkbrüchen, sondern auch in den fiskalischen Brüchen wertvoller Werkstein durch Schießen zerrüttet und nur zum Kalkbrennen genutzt werde. Auf Drängen Gäbert’s hatte daher 1799 das Bergamt Schneeberg den Fiskalischen Marmorbruch befahren und ein Gutachten verfaßt, in dem es allerdings heißt, daß „der annoch anstehende Kalkstein nach einem ungefähren Überschlage wohl noch halb soviel als seit Bestehen des Kalkbruches gewonnen worden ist, betragen dürfte“, obwohl man seit einigen Jahren auch schon Eisensteinflöße für die umliegenden Eisenhütten hier gewonnen habe. Dem widersprach Gäbert aber auf’s heftigste und schrieb: „Ich kann heilig versichern, daß wenn in diesem Bruche …nur drey Jahre lang Marmor zum Kalkbrennen gebrochen wird, von dem …noch vorhandenen Marmorschatze auch nicht die mindeste Spur mehr anzutreffen seyn muß“ (40015, Nr. 717). Auch sein Nachfolger bei der Errichtung des Bauwerkes, J. Herrmann, hatte so einige Probleme mit der Materialbeschaffung. Er schrieb deshalb (30016, Nr. 1943): „An
ein hohes Geheimes Finanz Collegium, Da bey Versetzung des Monuments in der fürstl. Begräbnis- Capelle zu Altenzella die Arbeit bereits dahin gediehen, dass es nunmehro um so nothwendiger wird, daß die zu diesem Monument erforderliche Kuppel in dem Marmorbruche zu Crottendorf (bald) möglichst aufgearbeitet werde, in so ferne ich mit diesen Arbeiten continuieren soll; so unternahm ich drum in dieser Hinsicht unterm 26ten vorigen Monats von Wildenfels aus eine Reise über Crottendorf, um in dem dasigen Marmorbruche die nunmehro äußerst nöthigen Arbeiten zu veranstalten; alleine da der ganze Bruch dermaaßen von Waßer angefüllet, daß es unmöglich war, Arbeiten darinnen anzulegen, sahe ich mich genöthiget, unverrichteter Sache wiederum zurückzufahren. So wie nun aber das in gedachten Bruche befindliche Waßer, in Ermangelung der Gelegenheit einiger anzubringenden Abzüge, sich unmöglich versickern dürfte, sondern diese Steine über kurz oder lang mittelst Anlegung einer oder mehrerer Stein- Haspeln durch Erbauung einer Brücke herausgezogen werden muß; als(o) habe (ich) solches einem hohen Geheimen Finanz Collegio hierdurch unterthänigst fürstellen, und zugleich auf dem Fall, wenn ich mit meinen Arbeiten continuieren soll, dafür submit fest antragen wollen, wegen Erbauung einer Brücke über gedachten Marmorbruche zu Crottendorf und Anlegung ein oder mehrerer Haspeln auf selbiger, des fördersamsten an das Amt Schwarzenberg gemeßenste Verfügung gelangen zu laßen.
Dresden, am 6ten
October 1801. Die Finanzbehörde verwies Herrmann's Ansinnen wunschgemäß an das zuständige Amt Schwarzenberg und diesem wurde aufgegeben, „sich in den Bruch zu Crottendorf führen zu laßen, und sodann einer… Local- Inspection beyzuwohnen.“
Daraufhin wurde wahrscheinlich noch im Jahre 1802 auch mit dem Bau eines Wasserlösestollns in
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1804 ersuchte dann der Bildhauer
Christian August Hesse aus Crottendorf um Konzession zur Benutzung
„der
weißen und bunten Marmorbrüche“
und plante, eine neue
„Marmorfabrik“
am
„Roten
Bruch in Grünau“ und ein
neues Schneidwerk in Crottendorf zu errichten (40001, Nr. 2984).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Bau des Schneidwerkes ist es zwar nicht gekommen, doch sind in einer etwa gleichaltrigen Akte der Maschinenbaudirektion beim Oberbergamt in Freiberg Abschriften zum Marmorwerk Kalkgrün überliefert (40005, Nr. 16). Auf das Ersuchen Hesse’s hin kam es nämlich zu neuen Untersuchungen, die diesmal von der Königlichen Bergakademie zu Freiberg durchgeführt wurden. Beteiligt waren Oberbergrat Sigismund August Wolfgang von Herder, Bergmeister Johann Carl Schütz und der Annaberger Bergmeister Bergner (vgl. 10036, Loc. 35930, Rep. 08, Nr.0015). Sie beschreiben die geologischen Verhältnisse so: „Die Marmorbrüche bei Wildenfels und Kalkgrün concentriren sich auf das Gebirgsstück, welches zwischen dem Wildenfelßer und dem Muldenthale liegt… In diesem Thonschiefergebirge ist ein ansehnliches und mächtiges Kalkstein- Depot vorhanden, auf welchem die beyden Churfürstlichen als auch mehrere Privatbrüche liegen. Der churfürstliche schwarze Marmorbruch zu Grüna befindet sich auf einem zu diesem Bruche schon früher gekauften Stücke Feld, welches nach den aufgefundenen Rainsteinen ohngefähr 170 Ellen lang und 150 Ellen breit seyn dürfte. (Also etwa 90 m x 80 m oder 170 m² Fläche besaß.) Zwar ist dieser Bruch …bereits abgebaut. Allein noch stehet ein 5 Lachter langer und 4 Lachter breiter ganzer Felß (...also zirka 80 m².) auf der mitternächtlichen Seite des Bruches an, welcher zu einem großen Kunstwerke gebraucht werden könnte, da die verhältnismäßig nur wenigen Schichtungs- und zufälligen Klüfte die Gewinnung großer Marmorstücke keineswegs behindern. Noch größere Massen dürften in mehrerer Teufe wegen der alsdann noch selteneren Zerklüftung zu erwarten seyn, da die gegen Mitternacht anstehenden und einschießenden Kalksteinschichten… die weitere Fortsetzung derselben fast mit Gewißheit hoffen lassen… Weniger bedeutend ist der churfürstlich rothe Marmorbruch ohnweit Wildenfelß auf dem Löffler’schen Grund und Boden. Bereits im Jahre 1589 wurde durch Ausweisung der Grünhainer Amtsakten dieser Bruch von Churfürstlicher Durchlaucht erkauft und zu den Intraden des Amtes Grünhain geschlagen… Bey der Local Expedition fanden wir diesen Bruch ziemlich verraaset und war von anstehendem Marmor nur wenig zu sehen. Außerdem sind auf den Kalkstein Depot der Gegend von Grüna und Wildenfels noch verschiedene Brüche vorhanden, auf welche bey Marmor Aushaltungen mit zu rechnen seyn würde, unter welche wir die drey Kreuz’schen Brüche, den Gräflich Solms’schen Kalksteinbruch bei Wildenfelß und die Schönauer Brüche namentlich aufführen…“ Die 1806 ausgebrochenen Napoleonischen Kriege verhinderten aber erneut, daß es zu einer Wiedererrichtung einer Schneidemühle in Grüna und zu einem Weiterbetrieb des Marmorabbaus kam.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalksteinabbau
im 19. Jahrhundert
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem Ende der Befreiungskriege und dem Wiener Kongreß 1815 taucht im Jahr 1822 erstmals ein Herr Heinrich Winter aus Oberhohndorf in den Akten des Staatsarchives auf, allerdings zunächst als Besitzer eines Steinkohlenschachtes in Reinsdorf bei Zwickau (30861, Nr. 1582). Vermutlich ist dies aber derselbe, der später den „Winter'schen Kalkbruch“ besaß. Ganz gewiß machte sich der Besitz eines eigenen Kohlenwerkes in Zeiten allgemeiner Brennstoffknappheit nämlich auch beim Betrieb eines Kalkwerkes bezahlt... 1854 gründete sich auf Initiative von Gustav Adolph Oberreit auch ein Wildenfels- Härtensdorfer Steinkohlenaktienverein (30051, Nr. 2774 und 2775). Seit 1827 hatte das Amt Zwickau die Aufsicht über die staatlichen Marmorbrüche inne, welches seinerseits den Amtsmaurermeister Herrmann zum Aufseher bestellte. Aus Zwickau schreibt man 1830 nach Dresden: „Eine blos für die Kunst beabsichtigte Benutzung des Marmorbruchs dürfte noch sehr zu bezweifeln seyn… denn obschon der innere Werth des Marmors weit höher als der daraus gewonnene Kalkstein stehet, so ist doch nicht zu erwarten, daß in hiesiger Gegend und unter den jetzigen Zeitumständen die Kunstarbeiten so viele Abnehmer finden werden, als nöthig wäre, um den nötigen Kostenaufwand zu decken und einen höhern als den durch Bearbeitung des Marmors zu Kalkstein zu hoffenden Gewinn zu sichern…“ Dennoch legte ein Nachfahre des C. A. Hesse 1838 noch einmal eine neue Marmorschneide- und Schleifmühle in Zwickau an. In dieser Zeit wurde auch die erste geognostische Landesuntersuchung abgeschlossen (vgl. 40003, Nr. 174 und 252 und unser Kapitel zur Geologie). Mit der Gründung des Deutschen Zollvereins 1833 und dem Fallen der innerdeutschen Handelsschranken war der Niedergang des Abbaus in den erzgebirgischen Lagerstätten jedoch besiegelt. Aus größeren Lagerstätten in anderen Regionen konnte gleichartiges Material nun weit billiger beschafft werden; die keramische Industrie entwickelte sich weiter und Fliesen ersetzten zunehmend Natursteinbeläge. Auch der Geschmack der Käufer veränderte sich und beständigere Werksteine, wie Granit und Syenit, ersetzten allmählich den Marmor. 1838 wurden die Kalkgrüner Steinbrüche dem Rentamt Wiesenburg unterstellt. Dem Amt wurde 1839 die Eröffnung eines weiteren Kalkbruches am Fuchsberg angezeigt (30020, Nr. 177). Albert Schiffner erarbeitete in den 1830er Jahren ein „Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreiches Sachsen“, dessen „Erste Lieferung, den Zwickauer Kreisdirektionsbezirk enthaltend“, uns das Folgende über das Dorf im Amt Wiesenburg zu dieser Zeit berichtet (S. 171): „7) Grüna, Kalkgrün (Amtsdorf; und zwar, als ehemaliges Grünhainisches Closterdorf, bis 1821 im Amte Grünhain; gepfarrt und geschult nach Schönau; 1834 = 20 H. und 126 E.) liegt ungemein reizend in stark coupirter Gegend ¾ Std. östlich von Wiesenburg, … in einer vom rechten Ufer der Mulde steil ansteigenden Schlucht… Abgesondert stehen 1 Haus am größten der Kalkbrüche, also in NW., und die Mühle nebst Säge in O., unfern der… Flußbrücke. Zwischen Mühle und Brücke hat auch Sachsens einzige, vor etwa 130 Jahren von der Kammer angelegte Marmorschneidemühle gestanden, welche 32 Sägen enthielt, unter das Amt Zwickau gehörte, und im 7jährigen Krieg verfiel. Von den 5 oder 6 hiesigen Marmorbrüchen giebt der schon erwähnte oberste (und eigentlich zwiefache) einen grauen, guter Politur fähigen Stein, obwohl ihm häufig Schwefelkies und Thonschieferblättchen eingesprengt sind. Noch feiner und minder zerklüftet ist der schwarze weißgeäderte Stein des königl. Bruches. Ein 3ter giebt rothen Stein. Die Aufsicht über diese Brüche führt der Marmorirer zu Wildenfels. Bei weitem der meiste Stein – dem von Charpentier dasselbe Alter zutraut mit dem ihn umschließenden Urthonschiefer, welcher auch Chloritschiefer enthält – wird zu Kalk gebrannt. Vor 300 Jahren trieb man hier auch Bergbau. Das Closter kaufte den Ort 1401 der Frau Jutta von Wildenfels ab.“ Auf S. 175 liest man über den Nachbarort: „21) Schönau (= Schilfheim, unter königl. Collatur und Zwickauer Ephorie, 1834 = 71 Häuser, wobei 1 Schule und die etwas isolirte rothe Mühle, und 503 E.), gehört mit 17 H. ins Amt Stein, mit 7 H. ins Wildenfelsische, hinsichtlich der Erbgerichte über 6 H. auch unter das Zwickauische Rathsgut Vielau, …dehnt sich 2.000 Schritte lang am Zschockenbache aus der überaus reizenden Muldenaue bei Wiesenburg hinauf bis in die Nähe von Wildenfels, und ist durch gute Viehzucht, Kalkgewinnung und Fabrication recht wohlhabend. … Das zum Wiesenburger Kammergut gehörige, kleine, sogenannte niedere Vorwerk unterhalb des Dorfes mag wohl das im 15. Jahrhundert erwähnte Zschocherische Rittergut gewesen sein; dabei sind Ziegel- und Kalköfen. Aber auch zwei Bauern haben Öfen für den marmorartigen Kalkstein, dessen Flötze, reich an Trochiten, dünne Thonschieferlagen einfassen…“ Erst auf S. 227f findet man unter der Standesherrschaft Wildenfels auch folgende Angaben zur Stadt Wildenfels: „Es giebt in Wildenfels … 1 Kalkofen (auf der Höhe in O.), mehrere Kalk- und Klingerbrüche1) … Auch wohnt hier ein Bildhauer, der als königl. Marmorirer die Grünaischen Marmorbrüche beaufsichtigt, und jeden Block aus denselben an sich zu nehmen befugt ist. Die damit längst beauftragte Familie Gebert hat u. a. die schönen Arbeiten zu Altzella geliefert.“ In der Fußnote vermerkte A. Schiffner noch: „1) Klinger oder Pochwacke nennt man hier den dunklen Hornblendeschiefer, der im Schloßberge mit dem Schneebergischen Glimmerschiefer zu gränzen scheint.“ Diese Arbeiten waren auch Grundlage der 1845 bereits in 2. Auflage erschienenen „Beschreibung der sächsischen und ernestinischen Lande“, worin A. Schiffner die Orte aber nur noch zusammenfassend erwähnt: „Grüna bei Wildenfels, oder Kalkgrün (150 E.), am Südhange des Aschberges, hat Kalk - und Marmorbrüche (darunter der bunte dem Staate gehört); 1 Kalkofen, 1 Mühle, und an der Fährbrücke, welche den Wildenfels- Schneeberger Weg über die Mulde bringt, ein Gasthaus. Unterhalb des Letztern stand sonst, in reizendem Thalgrunde, Sachsens einzige, aber sehr große Marmorschneidemühle, die nach etwa 70jährigem Bestande im 7jährigem Kriege einging…“ In der gleichen Quelle liest man noch über den Nachbarort Schönau: „Schönau (= Schilfheim; 380 E.), gehört theilweise auch dem Zwickauer Rathe, sowie nach Stein und Wildenfels, dehnt sich aus in des Letztern Nähe am Zschockenbache fast bis zur Mulde herab, hat daher in Südosten den hohen steilen Aschberg, und liegt ungemein schön… Der Ort hat 2 Mühlen, 2 Kalköfen und Kalkbrüche mit Versteinerungen, genoß auch ehemals städtische Rechte…“ Noch aus dem Jahr 1847 liegen Abrechnungen der Verwaltung des „königlichen Marmorbruches in Grünau“ vor (10036, Loc. 36345, Rep. 09, Sect. 1, Nr. 4433). Zu dieser Zeit wurde für den Bau der Gemäldegalerie in Dresden durch Gottfried Semper (*1803, †1879) nämlich auch wieder schwarzer Marmor aus Kalkgrün verwendet, was noch einmal eine letzte „Konjunktur“ auslöste. Bis 1870 hielt man danach den Betrieb nur noch mühsam im Gange; dann lag der Marmorabbau gänzlich still. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den nachfolgenden Jahren begannen auch
private Unternehmer und Grundeigentümer wieder damit, den Kalkstein
wirtschaftlich zu nutzen. Aus dem Jahr 1855 haben wir in den
Gerichtsbüchern des Amtsgerichte Kirchberg (12613, Nr. 155) eine
Konzession gefunden, die der uns bereits bekannten Bauernfamilie
Junghänel in Schönau ausgestellt worden ist.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Faksimile aus dem Gerichtsbuch mit dem Concessions Schein aus dem Jahr 1855. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, Bestand 12613 (Gerichtsbücher, Amtsgericht Kirchberg), Nr. 155, Blatt 34, Ausriß.
Link zum Digitalisat:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Text lautet:
Concessions- Schein. Nachdem der Guthsbesitzer Christian Gottlieb Junghänel zu Schönau Auf darum beschehenen Ansuchen zur Anlegung einer Kalkbrennerei mit zwei Öfen auf seinem daselbst gelegenen Grund und Boden in einer Entfernung von 87 Ellen von seinem ebendaselbst gelegenen Malzhause und 125 Ellen von dem Hause der Wittwe Chemnitzer allda, und zum Betriebe derselben auf diesfalls erstatteten Bericht von Seiten des Königlichen Finanzministeriums Concession ertheilt worden ist, so wird Junghäneln hierüber gegenwärtiger Concessions- Schein unter legaler Vollziehung ausgestellt. Kirchberg und Wiesenburg, den 20ten April 1855. Das Königliche Landgericht und das Königliche Rentamt allda.
Gottfried August Mann,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1869 trat dann das Allgemeine Berggesetz
für das Königreich Sachsen in Kraft. Es dauerte aber ziemlich lange, ehe
es auch für bestehende gewerbliche Bergwerksbetriebe umgesetzt war. Erst ab der
Ausgabe 1901 werden die gewerblichen Kalkwerke in den Jahrbüchern für das
Berg- und Hüttenwesen in Sachsen erfaßt und eigentlich auch nur dann, wenn
sie untertägig abbauen. Das war hier bei Wildenfels jedoch nie der Fall.
Nur ein – natürlich nicht genau zu datierender – Stempel ist von einer Grünauer Kalkstein- und Marmor- Abbau- Gesellschaft im Staatsarchiv zu finden (12880, Nr. 2303 und 2304). Diese stellte 1860 einen Bauantrag „zur Aufführung der Gebäude“ und ersuchte um Erlaubnis zur Aufstellung einer Dampfmaschine (30584, Nr. 2070). Wie uns die Informationstafel an der einstigen Marmorschneidemühle verriet, entstand während der Gründerzeit 1870/1871 außerdem eine Gesellschaft zur Gewinnung und zum Vertrieb von Kalk mit Sitz in Grünau. Ihr gehörten Landbesitzer und Gewerbetreibende der Region an. Gemeinsam wurde das Kapital für den Bau der Ringbrandöfen aufgebracht. Nach der Informationstafel 7 auf dem Lehrpfad wurden diese beiden Ringbrandöfen bei Grünau 1880 gebaut und waren noch bis 1931 in Betrieb; auf der unweit stehenden Tafel des Fördervereins Wildenfelser Zwischengebirge e.V. wird als Betriebszeit jedoch 1872 bis 1928 angegeben. Auf den Äquidistantenkarten sind sie aber noch nicht verzeichnet und erst auf den Meßtischblättern von 1917 eingetragen – die Jahreszahl 1872 kann daher nicht stimmen; die Ringbrandöfen müssen nach der um 1876 erfolgten Drucklegung der Äquidistantenkarten gebaut worden sein – die Jahresangabe 1880 dürfte also zutreffen. Wie diese Brennöfen funktionierten,
haben wir in unserem Beitrag zu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 hatte ein Nachfahre der
Steinmetzfamilie Gäbert aus Wildenfels, Carl Gäbert, den
staatlichen Marmorbruch gepachtet und eine Wiederaufnahme versucht. In den
ersten Jahren darauf waren allerdings gar keine Einnahmen zu verbuchen,
nur 1879 wurden 84 m³ Marmor für gerade einmal 126 Mark verkauft. Erst
1883 weisen die Abrechnungen größere Einnahmen auf. Die Verteilung dieser
Einnahmen zeigt aber schon deutlich, daß die Werksteingewinnung gegenüber
der Branntkalkerzeugung jetzt endgültig in den Hintergrund getreten ist:
Als „wilder Kalkstein“ wurde ein aufgrund zu hoher Quarzgehalte zum Brennen untauglicher Kalk bezeichnet (Wunder et al., 1867). Die zu Kunstarbeiten untauglichen Marmorabgänge kaufte schon seit 1879 der Gasthofbesitzer Winter zu Kalkgrün auf (Beierlein, 1963), wahrscheinlich ein Nachkomme des oben erwähnten Heinrich Winter aus Oberhohndorf. Eine Akte des Gräflich Solm'schen Rentamtes belegt indirekt, daß der Kalkabbau und die Brennerei durch Herrn Winter und Genossen 1910 im Gange war, sonst wäre es nicht nötig gewesen, um die Regulierung von Rauchschäden zu streiten (32870, Nr. 6). Vom Lehrpfad durch das „Museum in der Landschaft“ kennen wir außerdem die Namen Roth, Schürer, Schauer, Schleie und Häßlich neben den schon mehrfach genannten Dörrer und Junghänel als Kalkbruchbesitzer aus jüngerer Zeit. Auch die von Solms besaßen noch Kalkbrüche an der Neumühle östlich von Wildenfels (wildenfels.de). Auf den Meßtischblättern der Ausgabe von 1917 taucht dann bei Dörrer’s Bruch auch ein Terrazzo- Werk auf. Auf dieser Kartenblattausgabe findet man außerdem erstmals ein Pulver- Haus nördlich des ehemals fiskalischen Bruches, was nochmals unterstreicht, daß man während des 1. Weltkrieges von der Werksteingewinnung auch dort endgültig Abstand genommen hatte und nur noch für die Brennöfen Gestein abbaute. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der als Lehrer an den Technischen Staatslehranstalten zu Chemnitz tätige Dr. O. Herrmann verfaßte 1899 eine Schrift zur Steinbruchindustrie und Steinbruchgeologie, unter eingehender Berücksichtigung der Steinindustrie des Königreiches Sachsen. Dieses Werk widmet sich nicht nur dem Abbau und der Verarbeitung von Kalkstein. Die dies betreffenden Kapitel können aber durchaus in einer Fortsetzung zur rund 30 Jahre früher erschienenen Kalkwerksbetrieb Sachsens von Wunder, Herbrig und Eulitz gesehen werden. Bezüglich der Gewinnung von Marmor in Sachsen heißt es darin: „Marmor für Bildhauerarbeiten haben besonders in früheren Jahrhunderten die Gegenden von Crottendorf, Fürstenberg, Herold, Wildenfels und Maxen produziert. Heute kann von einer Industrie in sächsischem Marmor nicht mehr gesprochen werden, da nur bei Crottendorf gelegentlich von den Bildhauern der Umgebung ein Block entnommen und bei Wildenfels ebenfalls nur ab und zu von einer Zwickauer Firma einmal ein Block des schwarzen Marmors verarbeitet wird. Außerdem liefert das Königl. Kalkwerk zu Hermsdorf bei Frauenstein etwas Marmor zu kleinen Gegenständen, wie Briefbeschwerer etc. … Die Industrie beim Königl. Kalkwerk bei Crottendorf, beim Kalkwerk am Fürstenberge, bei Grünau (früher Kalchgrün) unweit Wildenfels und bei Maxen ist zeitweise bedeutend gewesen und hat mit Schneidewerken und Bildhauerwerkstätten gearbeitet, während bei Herold nur versuchsweise Marmor in Verarbeitung genommen worden ist. Die Gründe für das Scheitern… liegen in der Beschaffenheit des Materials, von dem nur unzuverlässig bis etwa 1 cbm große, rissfreie Blöcke und bloß bei Wildenfels umfangreichere Klötze, die aber auch meist mit Rissen durchsetzt sind und deren schwarzes Material nur zur Verwendung im Innern geeignet ist, gewonnen werden können…“ Italienischer oder belgischer Marmor war längst ‒ wo er denn noch gebraucht wurde ‒ einfach billiger zu haben. Mit der Abdankung des letzten albertinischen Wettiners, Friedrich August, III. (*1865, †1932) im Jahr 1918 fand der staatliche Marmorabbau dann auch im Wildenfelser Zwischengebirge sein endgültiges Ende.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits
zwischen 1907 und 1911 ist eine erste geologische Erkundungsbohrung bei Härtensdorf
dokumentiert (40024, Nr. 16-30).
1928
hat Herr Dörrer den noch heute erhaltenen
Schachtöfen größerer Höhe (daher – vorallem in den Eisenhütten – auch als „Hochöfen“ bezeichnet) gab es schon seit längerer Zeit vorher. Wunder, Herbrig und Eulitz beschreiben bereits 1867 verschiedene Typen: IV. Oefen zu continuirlichem Betriebe mit großer Flamme „Diese sind Schachtöfen von wesentlich größerer Dimension als die bisher besprochenen. Man bezeichnet sie insgesammt wohl auch als Cylinderöfen oder Rumford’sche Oefen… Von den hierher gehörenden Öfen sind auf den sächsischen Kalkwerken drei Arten angetroffen worden:
Der Rüdersdorfer Ofen hat überall, wo man ihm in Sachsen begegnet, z. B. auf vielen fiskalischen Werken, drei Feuerungen, die, unter sich einen Winkel von 120° bildend, etwa 4 Ellen über der Ofensohle in den Schacht einmünden… Der Hoffmann’sche Ofen ist als eine Modification des ersteren anzusehen… Er unterscheidet sich hauptsächlich in zwei Punkten von dem Rüdersdorfer: erstens dadurch, daß die Feuerungen und Ziehöffnungen …in einem Niveau liegen; zweitens dadurch, daß die Gicht des Ofens, um Steinkohlenfeuerung möglich zu machen, überwölbt und die Überwölbung mit einer hohen, den Zug wesentlich befördernden Esse in Verbindung gesetzt ist… Der Siemens’sche Gasofen wurde in Sachsen nur einmal, nämlich auf dem fiscalischen Werke zu Hermsdorf bei Frauenstein angetroffen…“ „Die Cylinderoefen gestatten, sehr hohe Temperatur hervorzubringen und qualifiziren sich daher besonders zum Brennen von Steinen, die sehr starkes Feuer erfordern, ja sie setzen sogar insgesammt das Vorhandensein eines Kalksteins voraus, der an sich fest ist und auch einen einigermaßen festen, gebrannten Kalk liefert; da stark zerklüftete und leicht zerreibliche Steine bei der ansehnlichen Höhe des Schachtes, die häufig 20 Ellen (also rund 11 m) beträgt, leicht unter der auf ihnen ruhenden Last zerdrückt werden und somit zu Verstopfungen und nachtheiliger Beeinträchtigung des Zuges Anlaß geben. Im Übrigen vereinigen die Cylinderöfen die Nachtheile und Vortheile der Oefen zu continuirlichem Betrieb mit denen der Oefen mit großer Flamme. Sie setzen einen flotten Betrieb voraus und produciren nicht am billigsten, gestatten aber eine starke Produktion und liefern Kalk von bester Qualität…“ „Die Cylinderöfen empfehlen sich daher da, wo flotter Absatz stattfindet und ein fester Kalkstein zum Brennen vorliegt, hauptsächlich zur Gewinnung eines zu Bauzwecken verwendenden guten Weißkalkes, …während den Schnelleröfen der Vorzug gebührt, wo es sich um die Beschaffung eines billigen Düngekalkes handelt.“ Aufgrund der in einem Schachtofen erreichbaren, hohen Temperaturen war diese Ofenbauweise natürlich besonders für Eisenhütten prädestiniert, da für die Herstellung von Roh- und Gußeisen dessen Schmelztemperatur von 1.450°C erreicht werden mußte. Der
von den Autoren hier beschriebene Hoffmann’sche Ofen ist nicht mit den
Hoffmann’schen Ringbrandöfen zu verwechseln. Den hier gemeinten Hofmann’schen
Schachtofen
haben
wir in
Ein 18 m hoher Schachtofen wurde 1938 von den Kalk- Sand-
und Ziegelwerken, vormals Kalkwerk Lehmann, in
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie er heute aussieht,
zeigen wir
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kein neuer
Aufschwung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits vor dem zweiten Weltkrieg hat es Untersuchungen zu den Perspektiven des Fortbetriebs der Kalksteinbrüche durch die Lagerstättenforschungsstelle des Sächsischen Oberbergamtes gegeben. Inzwischen waren in Dresden die Staatlichen Kalk- und Hartsteinwerke in Dresden gegründet worden. Deren amtierender Direktor, Herr Altenkirch, fragte bei der Bergbehörde nach den Perspektiven und um Rat bezüglich einer möglichen Wiederaufnahme an (40030, Nr. 1-1067). Am 23. und 29. November 1937 schickte die Lagerstättenforschungsstelle daraufhin Herrn Dr. Teuscher nach Wildenfels, um sich die Sache vor Ort anzuschauen. Der berichtete dann, daß der letzte in Betrieb gewesene Bruch im Besitz des Bauern Dörrer sei, der ihn aber an eine Gesellschaft verpachtet hatte, die Konkurs angemeldet habe (in einem Bericht aus dem Jahr 1948 (40030, Nr. 1068) fanden wir den Namen Vereinigte Kalkwerke Grünau- Schönau, welche vermutlich aus der vormaligen Grünauer Kalkstein- und Marmor- Abbau- Gesellschaft hervorgegangen ist). Von dieser seien noch in jüngster Zeit geringe Mengen von weniger als 10 t pro Jahr abgebaut worden. Seinem geologischen Gutachten entnehmen wir außerdem, daß in dem zirka 150 m langen und 30 m bis 50 m breiten Bruch auf 12 m bis 18 m Bauhöhe Kalkstein anstehe. Die Bruchsohle läge noch 3 m tiefer, stünde aber unter Wasser, so daß sie einer Bemusterung nicht zugänglich sei. Die Hauptabbaufront weise nach Südosten, läge jedoch schon nahe der Flurgrenze, so daß sich eine Fortsetzung des Abbaus nur lohne, wenn auch die angrenzenden Flächen von der Gesellschaft mit erworben würden. Der anstehende Kalk sei teils kompakt, teils „deutlich in Knoten zerteilt, die von einer intensiver gefärbten Zwischenmasse flaserig umgeben werden.“ Jedenfalls seien genügend Reserven vorhanden. Außerdem wurden Schlitzproben entnommen, die folgende Ergebnisse erbrachten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
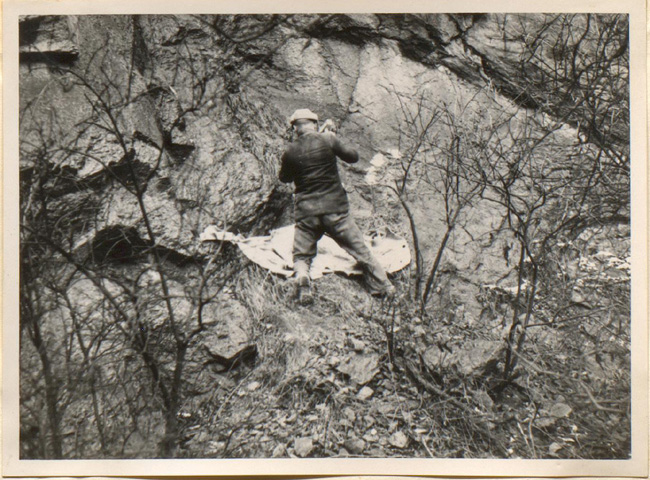 Arbeiter bei der Entnahme eines Schlitzmusters im Dörrer'schen Steinbruch 1937, an der Südostwand. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40030-1, Nr. 1067, Blatt 4-6, Bild 6.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1944
veranlaßte Herr Treppschuh, inzwischen Direktor der Kalk- und
Hartsteinwerke in Dresden geworden, weitere Untersuchungen in Wildenfels, die nun auch
benachbarte Steinbrüche einschlossen.
Zum Dörrer'schen Steinbruch kann man diesem neuen Bericht der Lagerstättenforschungsstelle entnehmen, daß er 1846 eröffnet worden sei und bis 1935 in Betrieb gestanden habe. Der Besitzer heiße Paul Dörr und will noch 70 m unter der Bruchsohle Kalk nachgewiesen haben. Im Hangenden stünden teils bituminöse Konglomerate, im Liegenden Grauwacke an. Früher sei der Kalk nach Grünau gefahren und in den dortigen (Ring-) Öfen gebrannt worden. 1934 habe man dann den Schachtofen in Betrieb genommen und seitdem den Kalk „mit Geschirr“, also mittels Pferdefuhrwerk, zur Rampe oberhalb der Gichtbühne gefahren und dort verladen. „Aus Kapitalmangel“ habe der Besitzer den Betrieb aber eingestellt. Ein weiterer Bruch wird in der Akte beschrieben als „...der größte, der auf den oberdevonischen Kalk baut... (Er) befindet sich nördlich der Straße, die von Hartenstein kurz vor dem Schießhause in westliche Richtung abzweigt und teils durch Wald nach dem Städtchen Schönau führt. Der Steinbruch liegt unmittelbar nördlich des Städtchens Grünau.“ Dieser Bruch sei 50 m lang, 25 m breit und zirka 20 m tief. So richtig können wir die Beschreibung nicht zuordnen, vermuten aber, daß vielleicht der Winter'sche Bruch gemeint sein könnte. „Nach Angaben eines früheren Arbeiters sei der Betrieb 1910 eingestellt worden, weil die Güte des Kalkes nachgelassen habe“, heißt es weiter. Dem letzten widerspricht aber der Gutachter: „Wahrscheinlicher ist, daß in der Gegend ein regelrechter Raubbau betrieben wurde. Man hat ...gearbeitet, so lange man die zusitzenden Wässer mittels Heber ableiten konnte. Wenn dies nicht mehr möglich war, wurde der Bruch verlassen und an anderer Stelle ein neuer eröffnet.“ Das stimmt so nicht ganz, da dieser Gutachter dabei nicht berücksichtigt hat, daß der Kalkabbau ja grundeigen, d. h. quasi „an die Scholle gebunden“ war. Seine Ansicht hat sich jedoch in späteren Planungen fortgesetzt, bei denen vermutet wurde, daß ein größeres, zusammenhängendes Lager nur unplanmäßig abgebaut wurde. Erst spätere geologische Untersuchungen bewiesen das Gegenteil. Aus montanhistorischer Sicht ist noch die Angabe von Interesse, daß einer der 1871 erbauten Ringbrandöfen (im Jahr 1944) „bereits abmontiert“ gewesen sei. Der Gutachter der Lagerstättenforschungsstelle kommt im Ergebnis jedenfalls zu der Einschätzung, daß man mit Vorräten in einer Größenordnung von 2,2 Millionen Tonnen rechnen könne. Man könne an einen untertägigen Abbau, ausgehend von den tief eingeschnittenen Tälern denken, müsse aber bei weiteren Planungen die geringe Standsicherheit des Hangenden und die Klüftigkeit des Kalksteins selbst berücksichtigen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurden diese Ideen erneut aufgegriffen. Natürlich mangelte es nach dem Krieg an allem, auch an Bau- und Düngekalk, weshalb ab 1947 neue Planungen für ein „Bindemittelwerk Wildenfels“ aufgenommen wurden (vgl. u. a. 40030, Nr. 1-1068 sowie 11384, Nr. 2081: Sonderplan 09/2 Erschließung Kalkvorkommen Wildenfels). Am 10. Dezember 1947 tagte dazu das Dezernat Steine und Erden in der Planökonomischen Abteilung des Landes Sachsen und entschied, daß das Vorhaben der Plankommission vorgetragen werden solle. Parallel hatte man aber schon die Bestellung von Maschinen eingeleitet. Es dauerte ja ohnehin lange, ehe man das Material wirklich erhielt... So sollte u. a. einer der Schachtöfen aus Oberscheibe nach Grünau umgesetzt werden und eine geeignete Seilbahn „aus dem Lande Hessen“ für den Transport vom Steinbruch nördlich von Grünau zum Standort des Kalkwerks beschafft werden. Für das Werk hatte man einen Standort an der Zwickauer Mulde ins Auge gefaßt, weil es dort den Bahnanschluß gab. Zunächst aber wurden glücklicherweise neue Erkundungsbohrungen unter Begleitung der Bergakademie in Freiberg sowie der Geologischen Landesanstalt in Berlin veranlaßt; eine erste „im Schneller'schen Bruch“ (noch ein neuer Name, den wir bisher nicht kennen, der aber vielleicht richtiger Schauer oder Schleie heißen muß), die zweite im Winter'schen Bruch und die dritte „auf dem Winter'schen Haferfeld“. Mit der ersten Bohrung hat man gleich einmal gespannte Grundwässer angetroffen, so daß das Wasser 5 m hoch aus dem Bohrloch gedrückt wurde, was umso verwunderlicher erschien, als im benachbarten Steinbruch der Wasserstand etwa 10 m tiefer lag. Hier zeigten sich gleich zu Beginn systematischer geologischer Untersuchungen Indizien für die kleinschollige Zerlegung des Kalklagers... Parallel zu den Erkundungsbohrungen wurden aber auch schon die Pläne für das Kalkwerk ausgefeilt. Man errechnete für eine monatliche Produktion von 9.000 t eine erforderliche Investitionssumme von 4,5 Millionen Reichsmark für Planung, Bau, Geländeerwerb usw. Für die Vorbereitungs- und Erkundungsarbeiten wurden von Minister Selbmann aber zunächst nur 500.000,- Mark bewilligt. Die Bohrergebnisse fielen dann auch weiterhin recht widersprüchlich aus: Während die erste Bohrung unter etwas mehr als 20 m Abraum Kalkbrekkzie erreichte und anschließend bis 132 m Kalksteine durchteufte, stieß man mit der zweiten nur noch bis 54 m Teufe auf Kalksteine, fand darunter Tonschiefer und ab 73 m Diabastuff. Das Erkundungsprogramm wurde daraufhin erweitert, aber auch die vierte Bohrung traf keinen hochwertigen Kalk an. Es verwundert nicht, daß die übergeordneten Behörden einerseits zwar an einer Verbesserung der Versorgungslage großes Interesse hatten, andererseits schon aufgrund der Investitionshöhe das Vorhaben aber genau beobachteten. So besuchten im September 1948 auch Oberstleutnant Kusnezow und Oberleutnant Anochin von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) anläßlich einer Rundreise, wie es hieß, den Standort. Ihr Begleiter, Prof. Dr.- Ing. Beyer vom Sächsischen Ministerium für Arbeit und Soziales schrieb anschließend in seinem Bericht: „Es darf daran erinnert werden, daß die Leistungsfähigkeit der Zementfabriken der Ostzone in den Ländern Thüringen und Sachsen- Anhalt in jüngster Zeit insbesondere durch den Mangel an Ersatzteilen nicht unerheblich zurückgegangen ist, so daß es sich im Interesse der Bauwirtschaft empfehlen dürfte, diese Mängel abzustellen, bevor große Geldmittel und Material in neu zu gründende Unternehmungen des Landes Sachsen investiert werden.“ Mit dieser Ansicht hatte er sicher recht, löste aber damit auch heftige Diskussionen in der Plankommission aus. Auf der Sitzung des Referats Sonderpläne in der Hauptabteilung Wirtschaftsplanung der Landesregierung Sachsen vom November 1948 vertrat Herr Beyer recht drastische Ansichten, wenn er formulierte: „Alle Leute, die dort Kalk gewonnen haben, sind pleite gegangen!“ Jedenfalls äußerte sich auf der Sitzung im Februar 1949 auch der Vertreter der Hauptverwaltung Steine und Erden dann dahingehend, es sei „unzweckmäßig, zur Zeit ein Zementwerk in Sachsen zu errichten.“ So einigte man sich letztlich darauf, diese Pläne zurückzustellen. Die durch die Bohrungen gewonnenen, geologischen Erkenntnisse könne man ja unter günstigeren wirtschaftlichen Bedingungen verwerten...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parallel zu diesem Vorhaben hatte man in Schönau ab 1946 weiter Kalkstein abgebaut. Das Werk war den kommunalen Wirtschaftsunternehmen des Landkreises Zwickau zugeordnet (30411, Nr. 736). In oben schon zitierten Bericht des Herrn Prof. Dr. Beyer fanden wir außerdem die Beschreibung eines „Kalkwerkes Hilarius in Schönau“ ‒ wieder ein neuer Name. Die Beschreibung dieses Werkes ähnelt aber sehr den früheren des Dörrer'schen Werkes: „Das Werk ist in Betrieb und erzeugt Stückkalk für Bau- und Düngezwecke. Die Produktion beträgt 10 t pro Tag. Schwierigkeiten ergeben sich durch ungenügende maschinelle Einrichtungen und Transportleistungen, da Bruch und Ofen zirka 300 m entfernt sind und gegenwärtig nur mit Pferdegeschirren überwunden werden...“ 1948 war beabsichtigt, die technische Leitung an die VVB Steinkohle abzugeben, wozu es aber nicht mehr gekommen ist (40098, Nr. 1-1403). Vielmehr wurde die bergtechnische Aufsicht dem Technischen Büro des Bergbaus und der Brennstoffindustrie des Landes Sachsen übertragen (40064, Nr. 1-694). 1950 wurde der Abbau dann endgültig eingestellt. Letztmalig wurde 1952 noch einmal Marmor zu Restaurationszwecken für den Freiberger Dom gebrochen. Danach wurden die zum Teil abgesoffenen Steinbrüche für die Anwohner zu beliebten Badestätten. In den Jahren 1954 und 1955 wurden auch im Gebiet Wildenfels geologische Erkundungsarbeiten seitens der SDAG Wismut durchgeführt. Sie hatten zum Ziel, die Fortsetzung der für eine Uranvererzung günstigen, geologischen Strukturen und insbesondere die Fortsetzung der großen erzkontrollierenden tektonischen Störungszone „Roter Kamm“ im Nordwesten der Lagerstätte Schneeberg- Oberschlema zu erkunden. Dazu wurde das Gebiet mit einer Emanations- sowie einer radiohydrogeologischen Aufnahme überzogen.Im Jahre 1958 wurden im Südostteil des Gebietes die Arbeiten zur Erkundung des Verlaufs der Störungszone „Roter Kamm“ weitergeführt. Dafür erfolgten auf einer Fläche von etwa 12 km² Emanationsaufnahmen sowie eine Geoelektrische Kartierung. Die dabei angetroffenen, anomalen Bereiche sind durch Schürfgräben und Schürfe weiter untersucht worden. Im Nordteil – dem Wildenfelser Zwischengebirge – wurden weitere Schürfgräben und Schürfe zur Klärung der geologischen Situation geteuft. Im Ergebnis dieser Arbeiten wurde eine geologische Karte im Maßstab 1:10.000 erarbeitet, nach der im Wildenfelser Zwischengebirge Silur und Unterdevon fehlen, was aber durch A. Schreiber 1965 widerlegt worden ist. Aufgrund des Fehlens eines wesentlichen Anteils „produktiver Gesteine“ und der veränderten bruchtektonischen Verhältnisse wurde das Arbeitsgebiet Wildenfels insgesamt als nicht höffig – zumindest jedenfalls nicht für Uranerze – eingeschätzt. Nachdem in den Jahren nach 1959 der Uranerzbergbau in vielen kleineren Ganglagerstätten des Erzgebirges zum Erliegen kam und lediglich noch Niederschlema- Alberoda als ergiebiges Abbauzentrum übrigblieb, versuchte die SDAG Wismut durch weitere Such- und Erkundungsarbeiten neue Lagerstätten aufzufinden. Ausgehend von den gewonnenen Erfahrungen und dem wissenschaftlichen Kenntnisstand der bis dahin schon durchgeführten Erkundungs- und Gewinnungsarbeiten wurden dafür neue Untersuchungsprogramme und Richtungen festgelegt. Schwerpunktmäßig wurden im Zeitraum von 1958 bis 1970 im Erzgebirge die Gebiete Lößnitz- Zwönitzer- Zwischenmulde, Wildbach, Geyer, Pöhla- Globenstein und Tellerhäuser ausgewählt. Im Wildenfelser Zwischengebirge fanden dagegen nach 1959 keine Erkundungsarbeiten durch die SDAG Wismut mehr statt. (Chronik der Wismut)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Wende gab es erneut das Vorhaben, den
Gesteinsabbau wieder aufleben zu lassen. Da die oberflächennah ausstreichenden
Kalklager allerdings bereits weitgehend abgebaut waren, hätte man sicherlich den
Lagern in die Tiefe folgen und untertägig abbauen müssen.
Grundlage dafür war die umfangreiche geologische Erkundung in der Zeit zwischen 1948 und 1971, die hauptsächlich im Zeitraum 1965-1970 seitens des VEB Geologische Forschung und Erkundung in Freiberg weitergeführt wurde (40131-1, Nr. 355, 357 und 574). Von über 150 Bohrungen bis zu 300 m Tiefe profitieren noch heute aktuelle Forschungsarbeiten (vgl. u. a. A. Schreiber, 2012). Das Oberbergamt hatte jedenfalls 1991 zusätzlich zum Bergwerkseigentum in Wildenfels auf einem weiteren Bewilligungsfeld in Grünau den Abbau von Kalkstein und Grauwacke durch die Hans Deuerlein GmbH & Co. KG mit Sitz in Gräfenhein in Bayern auf einer Gesamtfläche von 62 Hektar genehmigt. Das hätte erhebliche Umwelteingriffe zur Folge haben können. Ein moderner Steinbruch schafft nun aber nur wenige Arbeitsplätze. Im Tourismus und im Bau von Reha- Einrichtungen sahen die Bewohner des Wildenfelser Zwischengebirges daher eine bessere wirtschaftliche Zukunft. Die Bürgerinitiative „Der Berg bleibt“ klagte deshalb gemeinsam mit Bürgermeistern und Landräten gegen die bereits erteilte Bewilligung bei der Treuhand, dem Wirtschaftsministerium und vor dem Verwaltungsgericht und erreichte nach neun Jahren schließlich im Jahre 2000 die Zurücknahme dieser Genehmigung. (zeit.de, opencaching.de) Parallel wurde schon 1994 eine Fläche von etwa 640 ha des Wildenfelser Zwischengebirges unter Landschaftsschutz gestellt. Fünf Teilflächen mit einer Ausdehnung von insgesamt 14 ha wurden darüber hinaus 2011 zum FFH- Gebiet erklärt (revosax.sachsen.de). Auch wurden Maßnahmen zur Sanierung des Gebietes unter kalklandschaftstypischen Gesichtspunkten ergriffen. Dadurch sollte besonders der Fortbestand einiger seltener, hier vorkommender kalkliebender Pflanzenarten, die bereits auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten stehen, gesichert werden. So ist das Gebiet der einzige verbliebene Standort des Milzfarns (Asplenium ceterach, syn. Ceterach officinarum) in Sachsen. Die Steinbrüche sind auch Lebensraum des Europäischen Edelkrebses (Astacus astacus) der vom Aussterben bedroht ist. (wikipedia.de) Bereits vor mehreren Jahren hatte der Förderverein „Wildenfelser Zwischengebirge" Wanderwege zwischen der Mulde und dem Wildenfelser Bach ausgeschildert. Auf Informationstafeln wurden die Entstehung des Zwischengebirges, seine Pflanzen und Tierwelt sowie die Kalk- und Marmorgewinnung erläutert. Zusammen mit dem Lernhof Langenbach entstanden 20 Tafeln, die bei den Wanderern regen Zuspruch fanden. Leider sind die interessantesten von Vandalen zerstört worden. Im Zeitraum von 2003 bis 2004 hat der Museumsverbund Ecomuseum Zwickauer Land im Auftrag des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloß Blankenhain einen neuen Weg erschlossen, der alle historischen, technischen und Naturdenkmale verbindet. Es entstand ein „Museum in der Landschaft", das in einem Rundweg, der von Wildenfels über Langenweißbach (den Ortsteil Grünau) und zurück führt, erlebt werden kann. An insgesamt neun Stationen wurden neue Informationstafeln angebracht, welche interessierten Wanderern die kultur- und naturhistorischen Denkmäler näher bringen. (wildenfels.de) Leider liegt an einigen Plätzen immer noch Müll, der schon früher gerne hier abgeladen wurde, aber die Gemeinden bemühen sich und es wird Jahr für Jahr weniger. Auch die Einrichtung des Lehrpfades „Museum in der Landschaft“ hat sicher viel dazu beigetragen, daß es dort um vieles sauberer geworden ist, als es das vor Jahren noch war. (opencaching.de)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erhaltene Zeugnisse
Der Dörrer'sche Schachtofen in Schönau
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Zeugnis der aktiven Bergbauphase habe ich schon öfter im Vorbeifahren gesehen – den Schachtofen in Schönau nämlich – nun wird es endlich einmal Zeit zum Anhalten... Der Parkplatz direkt am Schachtofen ist allerdings sehr klein und wahrscheinlich gar nicht als solcher gedacht, weil unbefestigt und bei nassem Wetter eher gar nicht nutzbar. Als Startpunkt der folgenden Wanderung nutzt man daher besser die Freifläche am Abzweig der Straße nach Kalkgrün bzw. Grünau ein paar hundert Schritte weiter oberhalb und läuft dann die Straße entlang bis zum Kalkofen wieder zurück. Der Abschnitt des Rundwanderweges, dem wir dann ausgehend von der Tafel 2 des Lehrpfades am Schachtofen gefolgt sind, bis hinauf zur Tafel 7 in Kalkgrün bzw. Grünau ist nur etwa 1,7 km lang, führt dafür aber zunächst ziemlich steil bergan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Um besser zu verstehen, wie dieser
Brennofen eigentlich funktioniert hat, malen wir uns das Ganze nun mal mit
ein paar schematischen Skizzen auf.
Das flache Podest, auf dem der Ofensockel steht, ist ungefähr 1,80 m hoch und bei etwa 8 m Breite vor dem Hangfuß etwa 25 m lang. Der Ofen selbst steht nicht genau in dessen Mitte; die westliche Seite des Podestes ist mit einer Rampe versehen und etwas länger. In der Frontmauer befindet sich der 1,60 m breite und kaum höhere Zugang, der unten hindurch 6,5 m geradeaus bis zum Aschefall unter die Roste führt. Auf diesem Podest steht der etwa 2,2 m hohe Ofensockel mit einem quadratischen Grundriß und etwa 5 m Seitenlänge. An der Ost- und Westseite des Sockels befindet sich je ein Abzug in zirka 1 m Höhe, so daß man auch unter die seitlichen Roste bequem einen Karren schieben konnte, um den Stückkalk aufzuladen. Zwei schräge Bleche unter den seitlichen Rosten sorgten dafür, daß sich hier noch vom Stückkalk lösender Abrieb direkt hinunter in den Aschefall rutschte. Der Abrieb kam so zur Kalkasche und wurde mit ihr zusammen als Düngemittel verkauft, während der Stückkalk zu Löschkalk und später auf der Baustelle zu Mörtel weiterverarbeitet werden konnte. In der Mitte des Ofenschachtes sind zwei Gitterroste keilförmig aufgerichtet eingebaut. Über diese rutschte der gar gebrannte Stückkalk zur Seite und zu den dortigen Abzügen. Da wir die Höhe des Schachtofens nur von innen mit dem Distomaten und dies durch den Rost hindurch messen konnten, sind wir uns bei dem angezeigten Messwert nicht ganz sicher, ob wir oben auch die Bühne getroffen haben. Von außen kann man aber schätzen, daß der Ofenschacht etwas mehr als dreimal so hoch ist, wie der Sockel, also knapp 8 m. Hinzu kommt noch die Gichthaube obenauf, die für den Rauchabzug sorgte und dafür, daß niemand von der oberen Bühne in den brennenden Ofen stürzte. Den Innendurchmesser des Brennschachtes haben wir unterhalb der Roste im Aschefall zu ungefähr 1,6 m gemessen. Im mittleren Teil baucht der Schacht aber etwas aus, so daß man dort sicher von etwa 2 m Durchmesser ausgehen kann. Rechnen wir mit dem letzten Maß und einer Höhe von 8 m, dann kann man den Ofeninhalt zu zirka 12,5 m³ abschätzen oder mit einer Schüttdichte für Stückkalk von etwa 1,3 t/m³ zu reichlich 16 Tonnen. Wie uns die Informationstafel Nummer 2 vom Rundweg verraten hat, wurde der Schachtofen 1928 errichtet und war danach nur acht Jahre bis 1936 in Betrieb. Nach dem 2. Weltkrieg wurde er nochmals drei Jahre lang (von 1948 bis 1950) zum Kalkbrennen genutzt. Er ist also gegenüber anderen Technischen Denkmalen ein vergleichsweise junges und modernes Bauwerk. Von den übrigen Betriebsgebäuden, die sicher zum Kalkwerk dazugehört haben, ist außer ein paar Mauerresten am Weg oberhalb des Talhanges, wo die Gichtbühne auflag, nichts erhalten, so daß der Schachtofen heute quasi „für sich allein“ von der Branntkalkherstellung in Schönau zeugt. Alles in allem ist er noch sehr gut erhalten, nur die eisernen Bauteile sind altersentsprechend etwas rostig geworden. Im Mauerwerk, vorallem aber oben auf der Gichtbühne, haben sich auch hier Birken angesiedelt, die unbedingt regelmäßig entfernt werden müssen, um das Bauwerk noch lange als Denkmal der Industriegeschichte erhalten zu können.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
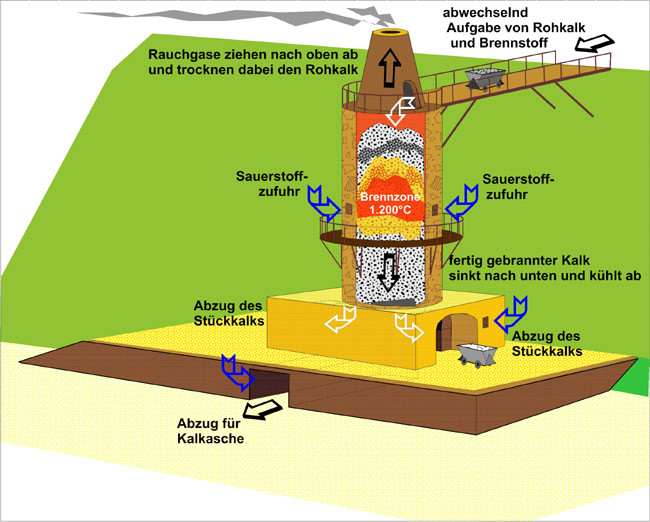 Jetzt können wir ihn anfeuern. Das von der Gichtbühne aus aufgegebene Material rutscht sukzessive nach unten durch die Brennzone hindurch, so wie der gar gebrannte Kalk unten abgezogen wird. Der Transport im Ofen erfolgt also allein durch die Schwerkraft. Die von unten zutretende Luft erwärmt sich bereits und kühlt dabei den fertigen Branntkalk ab. Die oben ausströmenden Rauchgase wärmen dagegen den Rohkalk vor. Das nennt man Gegenstromprinzip.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einige Dutzend Schritte die Straße hinab zweigt dann spitzwinklig nach Südosten ein Fahrweg ab, der zu den höher am Hang liegenden Grundstücken führt. Hier stehen wir direkt oberhalb des Schachtofens, wo die Pferdegeschirre vom Dörrer’schen Steinbruch ankamen und der Kalk umgeladen wurde. Links ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...steht die Tafel 3 des Lehrpfades. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unterhalb am Hang findet man noch das Widerlager der Gichtbrücke… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und durch das Geäst sieht man den Kopf des Schachtofens. Dort wurden Rohkalk und Kohle aufgegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das folgende Wegstück ist offenbar privater Grund und wird wohl gelegentlich auch für den Durchgang gesperrt. Heute zum Glück nicht… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberhalb vom Hangwald kann man über die Felder schon bis zum Schloß Wildenfels hinüber schauen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nochmal mit Zoom… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiter oben führt ein kurzer Stich vom Wanderweg aus in den Dörrer’schen Bruch hinein. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gleich rechts vom Zugang steht noch etwas vom – hier dickbankig erscheinenden – Kalkstein an. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus der Nähe sieht man die eher gelblich- graue Farbe und die deutliche Schieferung. Es handelt sich hier wohl um Kulm- Kohlenkalk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier in der Hanglage ist das Grundwasser aufgegangen und hat diesen Steinbruch gefüllt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dabei ist ein recht idyllisches Plätzchen entstanden… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der Bruch setzt sich nach Südosten noch fort, was aber von hier aus nicht einsehbar ist. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Stattdessen entdecken wir am Ufer noch ein paar alte Betonfundamente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An ein paar herumliegenden Schieferkalk- Stücken können wir auch die von K. Dalmer als „die sogenannte Kramenzelstructur“ beschriebene, durch herauswitternde Tonlagen zellig zerlegt wirkende Textur wiederfinden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf dem weiteren Weg außen herum kann man von oben durch das Astwerk hindurch dann auf den Südostteil der Sohle des Dörrer- Bruchs hinunter schauen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Kletterei an der Oberkante der Bruchwand sollte man besonders bei nassem Wetter tunlichst lassen. Heute geht es aber und so erhaschen wir noch einen schönen Blick auf den ebenfalls wassergefüllten Südostteil des Dörrer’schen Bruches. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann haben wir endlich auch den Anstieg geschafft und den Standort der 4. Tafel erreicht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
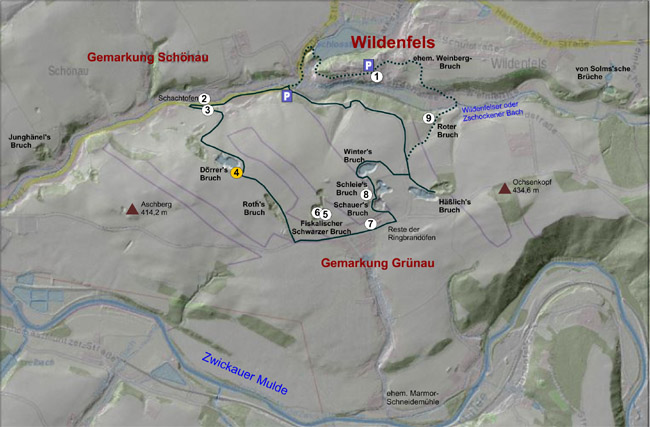 An dieser Stelle ist der steile Anstieg geschafft: Wir sind jetzt bei Nummer 4 angekommen. Unsere Exkursion wieder in der Reliefdarstellung vom Geoportal.Sachsen.de; von uns ergänzt um den Verlauf des Ringwanderweges – so, wie wir ihn gewandert sind – und die Standorte der Informationstafeln.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erzählt uns vom Lebensraum in den Steinbrüchen… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch den privaten Wegabschnitt hat man nun hinter sich gelassen. Wir folgen der Markierung… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Waldstücke vor uns markieren die Lage weiterer Kalksteinbrüche. Dahinter ragt der Ochsenkopf heraus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf den Wegen unter den Füßen findet man jede Menge des aschgrauen Kalksteins. Nicht ofengängiges Material wurde offenbar auch zur Befestigung der Wirtschaftswege verwendet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…gelegentlich auch mal dunkelgrauen Knotenkalk mit hübsch verfalteten Calzit- Adern darinnen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann liegt der Roth’sche Bruch vor uns. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Steinbruch bildet eigentlich nur eine enge Schlucht, die wohl den uralten Flurgrenzen folgte. Von oben sieht man durch den Bewuchs nicht allzu viel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nur ab und an kann man bis auf den Grund hinunter schauen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann finden wir dieses „Insekten-Hotel“ am Wegrand... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…und gleich neben diesem Orientierungspunkt führt ein schmaler Pfad in den Bruch hinein. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rechts des Pfades findet man noch eine Kalksteinklippe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dem Pfad kann man ein Stück weit hinunter folgen und sich die Bruchwände von unten anschauen… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Abbautiefe ist (Übrigens bei fast allen Steinbrüchen, die wir hier besucht haben) ganz beeindruckend. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zurück auf dem Feldweg haben wir dann schnell das untere Ende dieses Steinbruches erreicht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach Südosten sehen wir jetzt auch die Häuser von Kalkgrün bzw. Grünau vor uns… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Östlich vom Weg liegt der fiskalische Schwarze Bruch. Über die Koppel laufen wir heute nicht... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…sondern folgen dem Wirtschaftsweg nach Kalkgrün, bzw. heute Grünau. Im Hintergrund ragt wieder der recht markante Ochsenkopf auf. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Lehrpfad- Logo weist uns auch hier den Weg… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dann haben wir schon den Standort der Tafel 7 erreicht.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
Marmorbruch- Höhle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevor wir nun aber dem Lehrpfad weiter folgen,
fügen wir an dieser Stelle noch einige Bilder von unserem Besuch in der Marmorbruch- Höhle
im vormals fiskalischen Schwarzen Bruch zu Grünau ein. Die Befahrung wurde
von den Kirchberger Bergbrüdern ermöglicht, die als Mitglieder im NABU hier die
Fledermauspopulation beobachten.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
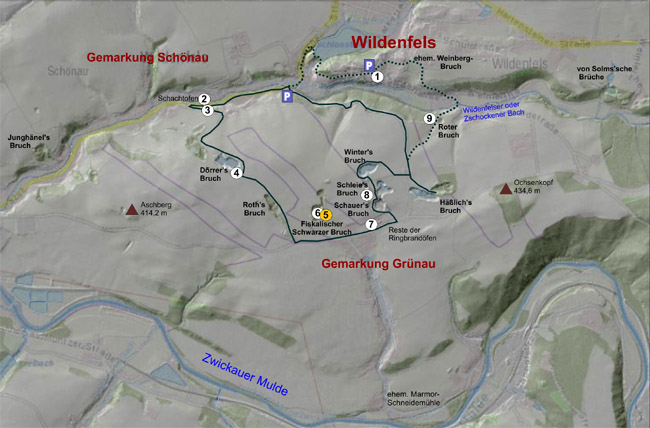 Der einstige Schwarze Bruch liegt mitten auf dem Feld. Zum Schutz der seltenen Tier- und Pflanzenarten wurde er nicht in den Rundwanderweg integriert.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Beschreibung der Höhle greifen wir auf eine Publikation von A. Arnold aus dem Jahr 1977 zurück, welche uns von den Kirchberger Bergbrüdern dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurde. Demnach sei unbekannt, wann eigentlich diese natürliche Karsthöhle entdeckt wurde. Sehr wahrscheinlich wurde die Höhle aber im Zuge des Abbaus angetroffen. Erwähnt wird sie jedenfalls erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den Geologen August von Gutbier und Carl Friedrich Naumann. Gutbier beschreibt die Karsterscheinungen im Schwarzen Bruch als erster im Jahre 1838 so: „Von diesem Bruche ist endlich eine Höhlenbildung im Kleinen zu erwähnen, die ungefähr in der mitternächtlichen Ecke beginnt, indem von einem Eingangspunkte drei Klüfte, in h. 6. in W. h. 11. und 11,4. in N. auslaufen, von denen die erstere gegen 70 Schritt ins Gebirge führen soll, aber nur eine kurze Strecke vom Eingange herein von den Arbeitern ausgeschüttet, weiterhin schwieriger zu befahren ist, da sie auch gegen die Tiefe fortsetzt. Diese grössere Spalte ist 2 Ellen breit und bis zu einer Höhe von 6 Ellen wiederholt bauchig ausgeweitet. Die zwischen den verschiedenen Ausbauchungen vorstehenden Zacken, sowie die rauhe und näthige Oberfläche der Wände, beweisen die nagende Wirkung des Wassers, obschon jetzt die Spalten völlig trocken sind.“ In dem in unserer geologischen Beschreibung ebenfalls bereits zitierten Heft 2 zur Geognostischen Landesuntersuchung beschreibt auch Naumann 1845 die Karsterscheinungen näher: „Erwähnenswerth sind die in einigen dieser Kalkbrüche aufgeschlossenen Höhlenräume, deren Bildung in eine sehr alte Zeit fallen dürfte. Spaltenartige Räume erweitern sich bauchig und schlauchartig, und bilden da, wo sie zusammentreffen, Höhlen von vielen Ellen Durchmesser, welche gewöhnlich mit gelbem Letten erfüllt sind. Die Wände derselben sind buchtig oder wellenförmig ausgenagt und haben eine rauhe, unregelmäßig gefurchte Oberfläche. Außerdem kommen noch cylindrische Canäle von etwa einem Fuß Durchmesser vor, welche eine ziemlich horizontale Richtung haben und mit den spaltenartigen Höhlen in Verbindung stehen. Endlich finden sich, besonders im westlichen Stoße des Königlichen Marmorbruches, noch tiefe und breite Einschnitte, welche den Kalkstein von seiner Oberfläche herein in einzeln stehende Klippen von verschiedenen Formen und Dimensionen absondern, so daß die Oberfläche ein sehr unregelmäßiges Relief von pfeilerartigen Erhöhungen und sackartigen Vertiefungen darstellt. Diese sackartigen Räume sind zum Theil ebenfalls mit einem gelben Letten erfüllt.“ Wie im Kapitel zur Geologie schon zu lesen war, erwähnte schließlich auch K. Dalmer in der ersten Ausgabe der Erläuterungen zur geologischen Karte, Blatt 125, im Jahr 1884 die Höhlen: „Das KaIklager wird local von steilen, fast saigeren Klüften durchsetzt, welche sich mitunter in Folge der auflösenden Thätigkeit der auf ihnen circulirenden kohlensäurehaItigen Tagewässer zu bauchigen oder schlauchartigen Hohlräumen, stellenweise sogar zu bedeutenden, weithin fortsetzenden Höhlen erweitern. Die Wände derselben zeigen eine wellige, sichtlich ausgenagte, rauhe Oberfläche…“ und zitiert im Weiteren aus der Beschreibung von C. F. Naumann. Als Karsthöhle muß sie natürlich schon immer Verbindungen zur Tagesoberfläche besessen haben, durch die Wasser zirkulieren konnte. Ein annähernd rechtwinklig zueinander orientiertes Kluftsystem, welches den Grundwasserlauf im Kalkstein selbst ermöglichte, wird anhand der nachfolgenden Kartenaufnahme sichtbar. Durch den Abbau wurden vermutlich größere Abschnitte der ursprünglichen Karsthöhle zerstört. An den nördlichen und östlichen Stößen des Steinbruches befinden sich aber noch weitere „Kleinsthöhlen“, was dafür spricht, daß einerseits noch weitere Abschnitte ihrer Entdeckung harren könnten und andererseits, daß ursprünglich wohl ein größeres, zusammenhängendes „Netz“ von kluftgebundenen Höhlungen bestanden hat. Heute existieren noch zwei größere, aber voneinander getrennte Abschnitte, die als „Marmorbruch- Höhle“ und „Schießstand-Höhle“ bezeichnet werden. Die Zugänge befinden sich an der Nordwand des ehemaligen Steinbruches in unterschiedlichen Höhenniveaus. Sie wurden u. a. durch Mitglieder des örtlichen GST- Tauchsportklubs in den 1970er Jahren untersucht und von einem „Studentenzirkel der Bergakademie Freiberg“ 1978/1979 vermessen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die „Enden“ der Höhlenstrecken sind in der Kartenaufnahme bewußt „offen“ gezeichnet. Es existieren – teils ganzjährig unter Wasser stehende – Fortsetzungen, die u. a. von den Höhlentauchern erkundet wurden. Die meisten davon stellen nur schmale Auslaugungsspalten entlang von Klüften dar, die nicht fahrbar sind. Da die Höhlen Fledermäusen als Winterquartier dienen, wird auch vonseiten der Speläologen von Freilegungsarbeiten weiterer Gänge abgesehen. Alles in allem wurden in den 1970er Jahren knapp 110 m Strecken dokumentiert und vermessen. Infolge der Auslaugungsprozesse besitzt insbesondere die Marmorbruch- Höhle meist typische, aufrecht elliptische Profile; durch stärkere Strömung bedingt finden sich aber auch sehr enge „Schlüsselloch- Profile“ (vgl. Profile 1 und 3 oben). Ein Teil dieser Gänge ist daher einfach zu befahren, die meisten Abschnitte sind aber auch nur kriechend zugänglich. Entsprechende bergbautaugliche Ausrüstung ist daher bei einem Besuch unbedingt erforderlich. Wir haben die Möglichkeit natürlich genutzt und sie uns angeschaut…
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir gehen erstmal geradeaus. Also, d. h. das Verb „gehen“ ist dafür eigentlich der falsche Ausdruck... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier geht es zumindest noch im Entengang hindurch... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durch dieses Loch geht´s nur noch auf dem Bauch. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Gänge scheinen durch spätere Brüche stark überformt zu sein. Man findet nur relativ selten Strömungskehlen oder Auslaugungskessel... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…wie etwa an dieser Stelle. Auch dieser Durchschlupf ist nicht gerade bequem fahrbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Abgang nach Osten ist mit gelbem Lehm fast ganz verschüttet... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jetzt sind wir am nordöstlichen Ende angekommen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier befindet sich ein kleiner, wassergefüllter Kessel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Pfeiler zwischen zwei Durchschlüpfen macht Seitenlicht auf die Wasserfläche möglich. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaum vorstellbar, daß hier die Taucher rein gegangen sind. Für uns wär´s nichts ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir machen uns auf den Weg zurück, um den hinter dem Höhlenzugang nach rechts abzweigenden Gang zu erkunden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch nicht gerade geräumig... Aber hier findet man mehr gerundete Formen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und ein typisches Schlüsselloch- Profil. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Firste über uns sieht man ein paar schöne „Strudeltöpfe“. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier kann man sich direkt mal wieder aufrichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber da durch wird´s gleich wieder eng... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach oben öffnen sich weitere Klüfte... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entlang der Hauptkluft sieht man in der Firste schmale Lösungskavernen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An den Stößen finden wir auch schicke Kalkspat- Adern. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kontrollieren wir noch schnell das Wetter in der Höhle... Heute haben wir +8°C und 80% Luftfeuchte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...und dann sind wir froh, daß wir das Kreuz wieder strecken können. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieder zurück und außen herum gelangt man in den angrenzenden Bruch, der als Schießstand „nachgenutzt“ wurde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von der Klippe dazwischen hat man noch einmal einen schönen Rückblick in den Schwarzen Bruch. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Zugang zur Schießstand- Höhle aber erwies sich als durch Laub und Lehm soweit verschüttet, daß zumindest wir nicht mehr hindurch paßten. Hier braucht es Höhlenforscher und keine Bergleute... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch ein Stück weiter oberhalb findet sich dieser Hügel. Nach den alten Karten befand sich hier kein Kalkofen, sondern mindestens seit 1917 ein Pulverhaus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein paar Mauerreste davon finden wir ganz oben auf der Kuppe noch. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach Norden hat man von hier aus wieder einen schönen Ausblick auf´s Wildenfelser Schloß. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach Westen blickt man auf die flache Kuppe des Aschberges. Die Baumgruppe links im Bild markiert Roth`s Bruch, rechts schaut Dörrer's Bruch noch herüber.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
frühere Marmorschneidemühle in Kalkgrün
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevor wir von Kalkgrün aus dann wieder in Richtung
Wildenfels wandern, machen wir vom Königlichen Marmor- Bruch noch schnell einen Abstecher hinunter ins Muldental,
um zu schauen, ob denn auch von der Königlichen Marmor- Schneidemühle noch etwas auf
unsere Tage überkommen ist.
Zumindest stehen am selben Ort noch
heute drei Gebäude nebeneinander, wie wir es oben auf der historischen
Das heute hier stehende Gebäude ist die nach ihrem Besitzer C. F. Scheffel als „Scheffel- Mühle“ bezeichnete, 1880 erbaute Holzschleiferei. Wie uns die Informationstafel davor noch verriet, wurde der hier produzierte Holzschliff an verschiedene Papierfabriken in der Umgebung geliefert, u. a. auch an R. Knorr in Fährbrücke. Der erwarb 1907 die Scheffelschleiferei. Bis 1942 war sie noch in Betrieb.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Tafel davor verrät uns aber, daß ein Brand im 18. Jahrhundert und danach ein Hochwasser die einstige Mühle völlig zerstört hätten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
östlichen Kalkbrüche in Kalkgrün und Wildenfels
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nun zurück auf dem Lehrpfad: Von Kalkgrün bzw. Grünau aus wanderten wir anschließend um die drei Steinbrüche von Schauer, Schleie und Winter herum, machten noch einen Abstecher zu Häßlich’s Bruch auf der anderen Straßenseite und liefen dann die Straße entlang wieder zum Schachtofen in Schönau zurück. Auf diesem Weg geht es zunächst noch einmal nur kurz bergauf, dann nur noch bergab. Der Rückweg entlang der Wildenfelser Straße (K 9306 bzw. im Tal die S 282) ist so – ohne Abstecher – rund 2,5 km lang. Wir machen weiter am Standort der Tafel 7...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein letzter Blick auf die Bruchwand mit Größenmaßstab oben auf dem Wanderpfad.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den an dieser Stelle eingefügten Abstecher
zum früheren Roten Bruch haben wir ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt
im Herbst einmal nachgeholt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
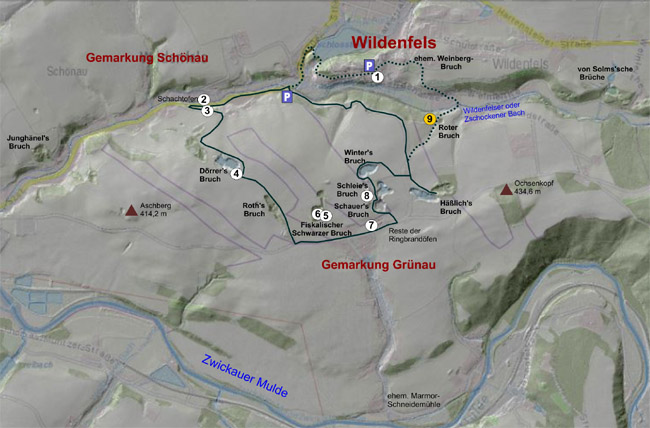 Mit ein wenig mehr Ortskenntnis fanden wir beim nächsten Besuch in der Region auch die Fortsetzung des Weges in Richtung Roter Bruch (dunkelgrün punktiert der eigentliche Lehrpfadverlauf).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oben an der Straße fehlt tatsächlich ein Wegweiser, aber beim zweiten Besuch im Herbst haben wir den Abzweig dann gefunden und die Tafel 9 entdeckt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erzählt uns etwas über die Verwendung des polierten Kalksteines als Werkstein und macht uns auf einen Kamin im Wildenfelser Schloß aufmerksam. Wäre auch verwunderlich, wenn man das schöne Material vor der Haustür nicht auch dort benutzt hätte... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vom Roten Bruch ist allerdings nur noch ein ‒ im Vergleich zu den übrigen, die wir hier schon gesehen haben, recht winziges, sicher auch zum Teil rückverfülltes ‒ Restloch zu sehen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberhalb liegt noch eine Geländemulde, ist aber inzwischen genauso verfüllt und bewaldet. Der Hohlweg rechts im Bild führt wieder hinauf zur Straße zwischen Grünau und Wildenfels. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wildenfelser Marmor als Werkstein
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem wir uns umgeschaut haben, wo das Gestein herkam, interessieren wir uns nun auch noch für einige, an ganz anderer Stelle erhalten gebliebene Zeugnisse des Wildenfelser Bergbaus. Es ist tatsächlich Künstlern, wie Giovanni Maria Nosseni zu verdanken, daß farbige Kalksteine aus Sachsen Eingang in das Kunsthandwerk fanden. Es handelt sich dabei freilich nur in einigen Fällen tatsächlich um Marmor im petrographischen Sinne, sondern oft um farbig gemaserte, dichte Kalksteine, die sich gut polieren ließen und daher für Bildhauerarbeiten geeignet waren. Wir haben im Staatsarchiv die folgende Darstellung der „Kalckgrüner Marmor- Sorten“ aus dem Jahr 1767 gefunden (12884, Loc. 35776, Gen. Nr. 229).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
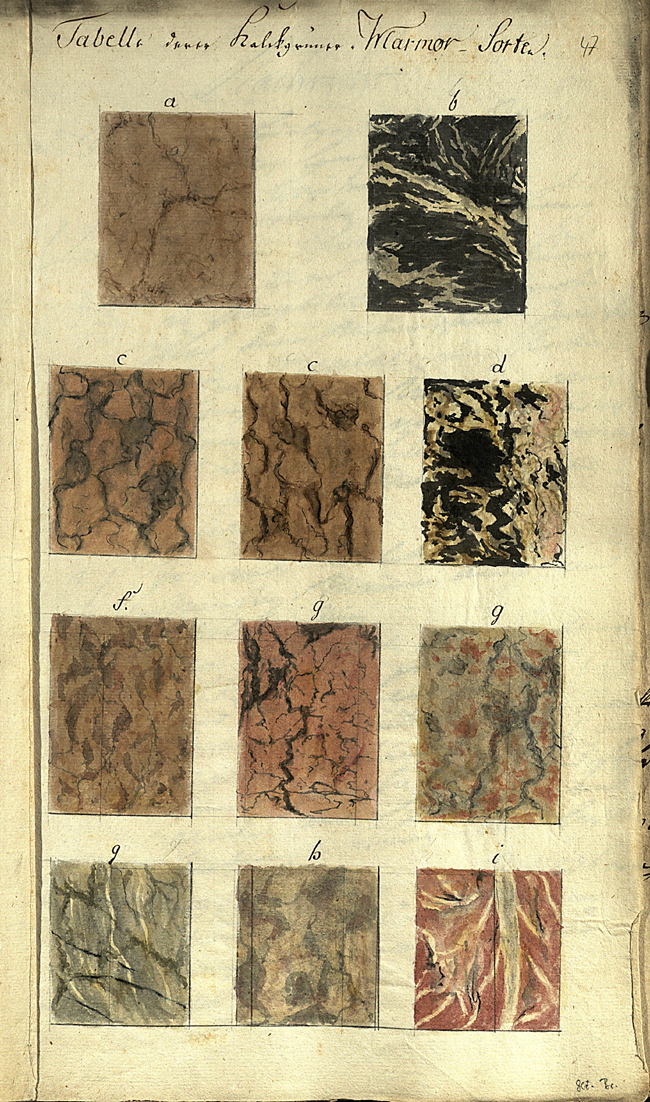 Bildliche Darstellung der Marmorsorten der Brüche bei Kalkgrün- Langenbach. Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, Bestand 10036 (Finanzarchiv), Loc. 35776, Gen. Nr. 229, Bd. 2: Nachricht wegen der Marmor- Brüche, Blatt 47, dat. 1767. Dieselbe Quelle ist auch im Bestand 12884 (Karten und Risse) des Staatsarchives verzeichnet.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Erläuterungen zu obiger Zeichnung stehen
auf den Blättern 40ff der genannten Akte und sind leider nicht unterzeichnet, könnten
aber ihrer Datierung wegen aus der Feder der Kommission unter Leitung von Berghauptmann
Carl Wilhelm von Heynitz stammen. Zur Herkunft der oben dargestellten
Marmorproben kann man dort lesen (Auszüge):
a) Ein rother Marmor Bruch, Johann Christian Scheffel´n zu Schönau und unter Schönburgischer Jurisdiction gehörig. Dieser Bruch wird dermalen gar nicht betrieben… b) Der Churf. Schwartze Marmorbruch… liegt einen theils in Grünhayner Jurisdiction. Er hat noch keine Tiefe und man ist fast zulänglich verführet, hier einen imposanten Vorrath zu finden… Der Werkmeister will hier einen Einschlag in die Tiefe verführen, um desto sicherer zu erfahren, wie mächtig der Bruch ist. c) George Tröger´s von Schönau Bruch unter Schönburgischer Jurisdiction, daselbst brechen meistens Platten von ansehnlicher Größe, die man zu Pflaster- Platten verkauft. d) George Tröger´s von Schönau schwartzer Bruch, halb unter Schönburgischer, halb unter Grünhaynischer Jurisdiction… e) Christian Adam Kuntzen´s auf Kalkgrün Bruch. Dieser hält die nemliche Sorte, wovon noch gantze Trümmer, die recht schön ausfallen, am Tage stehen… Der Graf Solms auf Wildenfels hat diese Brüche auf 12 Jahr vor 400 Groschen gepachtet und einen Kalkofen dabey erbaut. f) Auch Christian Adam Kuntzen gehörig. In demselben bricht nebst dem schwarzen Marmor zum Kalkbrennen auch die Sorte sub. f), ohngefähr 200 Schritte davon, die man zu Pflaster- und Bruchsteinen verkauft. Dieser Bruch ist an den Fährmann Schwalbe´n verpachtet. g) Der Churf. rothe … Marmorbruch, worinnen … rother brocatel (eine aus dem italienischen stammende Sortenbezeichnung) und grauer Marmor, auch noch mehrer Sorten brechen. Die Jurisdiction ist wildenfelsisch. h) Der Königliche Marmorbruch, Wildenfelser Jursidiction, worinnen noch ein großes Stück Marmor, 6 Ellen lang, unten 2 ½, oben 1 ½ Ellen breit und 5/4 Ellen stark, seit langem gebrochen lieget. Diese Sorte ist die dauerhafteste… auch August, II. soll sie denen übrigen vorgezogen haben. i) Außer diesen auf der Skizze bemerkten Brüchen findet sich noch ein Bruch in dem Dorfe Schönau, welcher die Sorte sub. i) giebt und von dem Churfürsten wirklich erkauft worden seyn soll. Der Verkäufer aber hat solchen wiederum verschütten und eine Scheune darauf bauen lassen. Es brechen überdies in den Dörfern Schönau, Wildenfels und Kalckgrün noch allerley Marmor, indem vermutlich der gantze Berg (etwas unleserlich) voll Marmor steckt… Begeben wir uns einmal auf die Suche, wo wir heute diese Werksteine noch wiederfinden...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein ganz berühmtes Baudenkmal, in dem dieses Material Verwendung fand, steht direkt vor unserer Haustür und mitten in Freiberg: Der Dom St. Marien. Nach einem verheerenden Stadtbrand 1485 war dessen romanischer Vorgängerbau so stark beschädigt, daß seine Reste abgetragen werden mußten. Nur wenige Teile, wie die berühmte „Goldene Pforte“, wurden damals bewahrt. Ab 1488 wurde eine neue, nun gotische Hallenkirche errichtet und bereits 1501 geweiht ‒ eine schier unglaublich schnelle Bauzeit im späten Mittelalter... Die spätere Erhebung dieser Kirche zum Dom ist eigentlich nicht so ganz gerechtfertigt gewesen, denn Freiberg war nie eine eigene Diözese, sondern immer Teil des Bistums Meißen. Jedoch war diese Kirche vom 16. Jahrhundert bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 150 Jahre lang Grablege für insgesamt neun der evangelisch- lutherischen Albertiner und ihre Familien. Die Reihe der hier bestatteten Mitglieder der wettinischen Fürstenfamilie beginnt mit Herzog Heinrich, dem Frommen (*1473, †1541), welcher die Reformation in Sachsen einführte. Nicht minder bekannt ist dessen Sohn Kurfürst Moritz (*1521, †1553), der die Kurwürde ab 1547 endgültig für die albertinische Linie der Wettiner sicherte. Die Reihe der Bestattungen endet mit Johann Georg, IV. (*1668, †1691).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Kurfürst Moritz am 11. Juli 1553 an den Wunden einer Schußverletzung bereits im Alter von nur 32 Jahren verstorben war, wurde er wie sein Vater, Herzog Heinrich, der Fromme, in schlichter Weise zur Erde im Dom bestattet. Kurfürst August (*1526, †1586), der jüngere Bruder von Moritz, der nach dessen Tod die Herrschaft in Sachsen übernahm, war sich der Rolle seines Bruders für die albertinischen Wettiner bewußt und veranlaßte deshalb die Errichtung eines Monumentes zu seinem Andenken in Freiberg. Bereits zwei Jahre nach Moritz' Tod, 1555, wurden daher die beiden „welschen Maler“, die Gebrüder Benedict und Gabriel Thola nach Freiberg gesandt, um einen Plan für ein Grabmonument anzufertigen. Veränderungen während der Planung und Verzögerungen in der Bauzeit führten letztlich dazu, daß das Monument erst im Jahr 1563 fertiggestellt wurde. Das Moritzmonument im Freiberger Dom feiert den ersten albertinischen Kurfürsten. Es gilt als eines der ersten Freigräber in Deutschland und nimmt auch in Hinblick auf Typologie und Ikonografie eine herausragende Stellung ein: Moritz erscheint hier als charismatische Gründerfigur einer neuen Dynastie. Über drei Stufen erhebt sich das Moritzmonument als zweigeschossiges, in rotem, schwarzem und weißem, belgischem Marmor gearbeiteter Kenotaph (ein Leergrab). Auf dem mehrgeschossigen Sockelbau stehen Greifenfiguren, die mit ausgebreiteten Flügeln die sarkophagähnliche Deckplatte tragen, auf dem ganz oben die Figur des Kurfürsten vor einem Kruzifix kniet. Der gesamte Chorraum der Kirche wurde etwas später zu einer Begräbniskapelle für die albertinischen Kurfürsten umgestaltet (10024, Loc. 4454/6, Bl. 93). August's Sohn und Nachfolger in der Herrschaft, Christian I. (*1560, †1591), folgte den Ideen seines Vaters und ließ den Chor diesem Zweck angemessen umbauen. Die Ausstattung wurde von Giovanni Maria Nosseni zusammen mit dem aus Florenz stammenden Bildhauer und Bronzegießer Carlo di Cesare del Palagio (*1538, †1598), welcher die Bronzeplastiken schuf, ab 1588 ‒ nun schon im manieristischen Stil der späten Renaissance ‒ entworfen und 1595 vollendet. Die ursprüngliche Ausstattung des Raumes, die der früheren Nutzung als Standort des Hauptaltars entsprochen haben muß, wurde dabei von einer prächtigen Architekturkulisse aus sächsischem Marmor überblendet. Trotz Geldmangel und notwendiger Einsparungen während der Ausführung entstand (nach H. Magirius) eine „höchst opulente und farbige spätmanieristische Architekturszenerie“, für die sich im ganzen deutschen Raum nichts Vergleichbares findet. (vgl. u. a. Löffler, 1980 und freiberger-dom-app.de)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die massigen Türme an der Westfront des Freiberger Domes tragen noch den Charakter einer romanischen Kirche. Sie sind nie vollendet worden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tritt man ein, blickt man auf den Lettner, der den Chor vom Langhaus trennt. Die Seitenschiffe besitzen dieselbe Höhe wie das Gewölbe des Langhauses. Die schlanken und hohen, achtseitig gekehlten Säulen aus Grillenburger Sandstein, die das Netzrippengewölbe tragen, öffnen den Raum und machen ihn hell und licht. Der Dom gilt als eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen Mitteldeutschlands, als architektonisches Vorbild für weitere Kirchen in Sachsen und enthält eine Vielzahl bedeutender Kunstwerke. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vom Lettner herab blickt man in die Begräbniskapelle der lutherisch reformierten Wettiner. Die Auskleidung mit farbigem, dunklem Marmor verändert den optischen Eindruck gegenüber dem hellen Kirchenschiff ganz deutlich. Der gerade stattgefundenen Restauration halber, ist der Boden hier noch abgedeckt (Foto von 2008). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nur im Rahmen einer Domführung darf man heute ein paar Schritte hinter den Lettner treten. Für das Monument des Kurfürsten Moritz interessieren wir uns heute nicht, ist es doch aus belgischem Marmor gearbeitet. Dahinter aber liegt dann die eigentliche Begräbniskapelle im Chorraum des Domes. Nach Abschluß der Sanierung erstrahlt dieser Raum wieder in seinen Farben von 1595. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lebensecht wirken besonders die Bronzeplastiken von Carlo di Cesare. Die Bodenplatten und die Sockel an den Seitenwänden kommen uns bekannt vor: Sie sind tatsächlich aus Wildenfelser Marmor gearbeitet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier finden wir Nosseni's „Tafeln“ wieder: Die Marmorierung des dunklen Knotenkalks mit weißen Adern aus Kalkspat ist typisch für dieses Material. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch in den Säulen der Epitaphe findet man den schwarzen und den rötlich marmorierten Knotenkalk aus Wildenfels wieder. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses prächtig rot marmorierte Material eine Etage höher dagegen ist gar kein Marmor, sondern farbiger Stuck. Es wurde wohl zu teuer... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber auch das Portal der sogenannten „Schwesterngruft“ in der Südkapelle, der Begräbnisstätte für Anna Sophia von Dänemark (*1647, †1717), Gemahlin Johann Georgs, III. (*1647, †1691) und Mutter August's, des Starken (*1670, †1733), sowie deren Schwester Wilhelmina Ernestina (*1650, †1706) ist aus diesem Werkstein gefertigt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Man darf zwar zum Schutz der Grabplatten aus Messing im Boden davor nicht näher heran, aber da die Türflügel geöffnet sind, sieht man, daß auch die Sarkophage dahinter aus schwarzem Wildenfelser Marmor bestehen. Die beiden Schwestern waren ursprünglich auf der Lichtenburg bei Prettin bestattet und wurden erst 1811 in den Freiberger Dom überführt. Die Plastiken wurden von Balthasar Permoser zwischen 1703 und 1715 für den ursprünglichen Standort dieses Grabmals geschaffen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch hier ist die charakteristische weiße Äderung des grau-schwarzen Gesteins gut zu sehen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und der Zoom macht's möglich: Auch der quaderförmige Sockel dieser schönen Bronzeplastik der Herzogin Sophia Hedwig von Schleswig- Holstein- Sonderburg- Glücksburg (*1630, †1652), Gemahlin des Herzogs Moritz von Sachsen- Zeitz (*1619, †1681), ebenfalls aus der Dresdener Sophienkirche stammend, besteht aus demselben Gestein aus dem fiskalischen Schwarzen Bruch zu Kalkgrün bei Wildenfels. Die Beziehung zu diesem Material ist naheliegend:
Ihre Heirat fand auf Schloß
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weil das vor dem Winter noch geöffnet ist, fahren wir dann schnell noch einmal in das frühere Kloster Altzella bei Nossen. Dieser Ort und das Denkmal, in dem wir den schwarzen Marmor aus Wildenfels ebenfalls wiederfinden, hat auch eine lange Geschichte... Das ehemalige Zisterzienserkloster, Cella Sanctae Mariae, nach Errichtung weiterer Filialklöster dann „Altzella“ genannt, wurde bekanntlich von Otto, dem Reichen (*1125, †1190), um 1160 als Grablege für seine Familie gestiftet und 1162 von Kaiser Friedrich I., Barbarossa mit 800 Hufen Land dotiert. Das Grab Otto's Vaters, Konrads, des Großen (*um 1098, †1157), befindet sich dagegen noch auf dem Petersberg in der Nähe des Stammsitzes der Familie von Wettin nördlich von Halle. 1339 wurde in Altzella die St. Andreas Kapelle errichtet, die noch bis 1397 als Begräbnisstätte der Fürstenfamilie diente. Nach der Reformation wurde das Kloster 1540 säkularisiert und in ein Kammergut umgewandelt. Die Klosterkirche samt der Andreaskapelle verfielen oder wurden zur Gewinnung von Baumaterial abgerissen. Schon 1586 wurden sogar die fürstlichen Grabstätten aufgebrochen. 1599 brannte die Kapelle dann gänzlich aus. Daher plante das Herrscherhaus bereits 1612 die Errichtung einer neuen Kapelle, was aber nicht mehr zur Ausführung kam ‒ ein paar Jahre später brach bekanntlich der Dreißigjährige Krieg aus. Kurfürst Johann Georg, II. (*1613, †1680) veranlaßte 1675 Grabungen, um die Gebeine der Vorfahren wieder angemessen umbetten zu können. 1677 wurde mit dem Bau einer neuen, barocken Begräbniskapelle am früheren Standort des Hochaltars im Chor der Klosterkirche begonnen. Auch dieser Bau blieb zunächst unvollendet. 1785 erhielt dann der Oberlandfeldmesser Christian Adolf Franck den Auftrag zum Umbau der unfertigen Begräbniskapelle, die zudem im Siebenjährigen Krieg von den Preußen stark beschädigt worden war (10036, Loc. 35590, Rep. 08, Nr. 0011). Daraufhin entstand das „Mausoleum“ in seiner heutigen Form, die einem antiken Tempel nachempfunden wurde. Der Geschmack hatte sich erneut gewandelt und der klassizistische Baustil Einzug gehalten.
In A. Schumann's Vollständigen Staats-, Post- und
Zeitungslexikon von Sachsen, Band 13, gedruckt 1826, haben wir unter dem
Stichwort der Stadt Wildenfels den Namen Gebert (oder richtig Gäbert,
vgl. auch
Beierlein, 1963) als in Wildenfels zu
dieser Zeit ansässigen Bildhauer und Schöpfer dieses Grabmals gefunden. Kurz vor
seinem Tod 1799 hatte dieser Bildhauer das
eigentliche Grabmal in der Kapelle in Form einer Tumba (eines Hochgrabs)
vollendet. Im 4. Band des Albums der Rittergüter und Schlösser Sachsens von
G. A. Poenicke fanden wir denselben Namen, lesen jedoch, daß Gäbert das
Grabmal erst 1809 fertiggestellt habe; was aber sicher darauf zurückzuführen
ist, daß Gäbert es nicht mehr selbst in Altzella aufrichten konnte (vgl. unser
Kapitel zur
Der Verfasser der Texte auf der Erläuterungstafel in Altzella
scheint sich dagegen hinsichtlich des Baumaterials geirrt zu haben, denn es
steht dort zu lesen, daß das Denkmal „aus rotem Crottendorfer und weißem
(...?) Wildenfelser Marmor“ bestehe. Wie uns die historische
Darstellung der Marmor- Sorten aus Kalkgrün oben zeigte, muß es genau
andersherum sein. Weißen Marmor gab es in Wildenfels nicht, der kam aus
1786 fand der von Friedrich August, III., dem Gerechten (*1750, †1827), mit gezielten Ausgrabungen im Klostergelände beauftragte Freiberger Oberstadtschreiber Klotzsch dann auch die Grundmauern der Andreaskapelle wieder. Die dort aufgefundenen Gebeine von Friedrich II., dem Ernsthaften (*1310, †1349), seiner Gemahlin Mechthild (*1313, †1346), Tochter König Ludwigs von Bayern, sowie von Friedrich III., dem Strengen (*1332, †1381), dessen Gemahlin Katharina von Henneberg (*1334, †1397) und seines jung verstorbenen, ersten Sohnes überführte man 1804 in die Gruft unterhalb des Grabmals. Das Mausoleum wurde 1991 bis 1994, teils mit Mitteln der Messerschmitt Stiftung, grundhaft saniert. Leider mußte man aber selbst an einer solchen Stätte schlechte Erfahrungen mit Vandalismus machen, weswegen auch diese Kapelle normalerweise verschlossen ist und nur im Rahmen von Führungen besichtigt werden kann.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier dürfen wir auch mit dem Fotoapparat näher herantreten: Im Anschliff heben sich die von weißem Kalkspat erfüllten Klüfte als wirklich schöne Maserung hervor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damit sind wir nun endlich am Ende dieses Beitrages angelangt und haben wieder einige Bildungslücken geschlossen. Wem unsere Wandertouren um Wildenfels gefallen haben, der kann sie ja gern einmal nachmachen... Der Schachtofen in Schönau ist zwar bei weitem nicht der einzige noch existierende Kalkofen in Sachsen (wie man das in einzelnen Quellen lesen kann), aber auf jeden Fall einer der ganz wenigen, uns bekannten, noch nicht abgerissenen Hochöfen für die Branntkalk- Produktion (Ein weiterer ist z. B. in Crottendorf noch zu finden). Die meisten hat man ‒ wohl vorallem aus Gründen nachlassender Standsicherheit ‒ inzwischen abgerissen. Damit steht hier bei Wildenfels ein tatsächlich seltenes und sehenswertes Technisches Denkmal. Glück Auf ! J. B.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein kleiner Nachtrag:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob wir nun mit unserem Beitrag zum Kalkbergbau
ein wenig dazu beigetragen haben oder nicht, daß das Interesse an diesem Bauwerk
nicht verloren gegangen ist: Ein Leser aus Crimmitschau machte uns auf diesen
Artikel aufmerksam und es freut uns natürlich sehr, wenn dieser Ringbrandofen
nun vielleicht doch erhalten wird. Von außen sah er
Ganz einmalig ist er aber (noch) nicht: Ob aber
der Ringbrandofen in
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Quellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wo wir
außerdem schon nach der Geschichte des Kalkbergbaus und der Kalkverarbeitung
recherchiert haben, haben wir einmal in einem
Hinweis: Die verwendeten Digitalisate des
Sächsischen Staatsarchives stehen unter einer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Quellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|