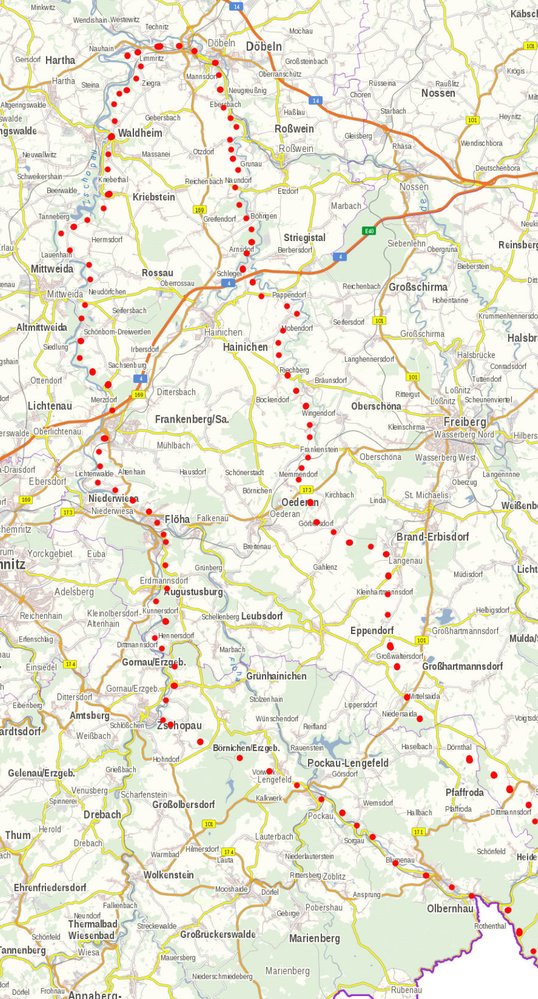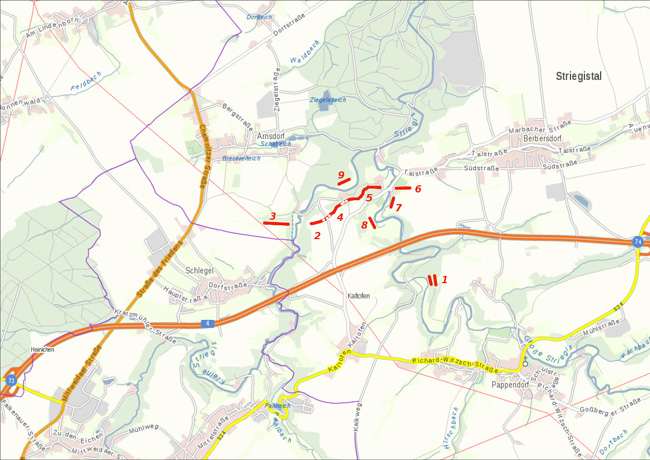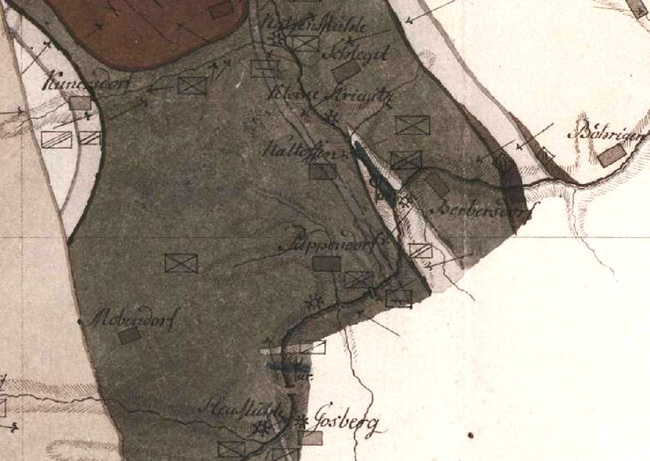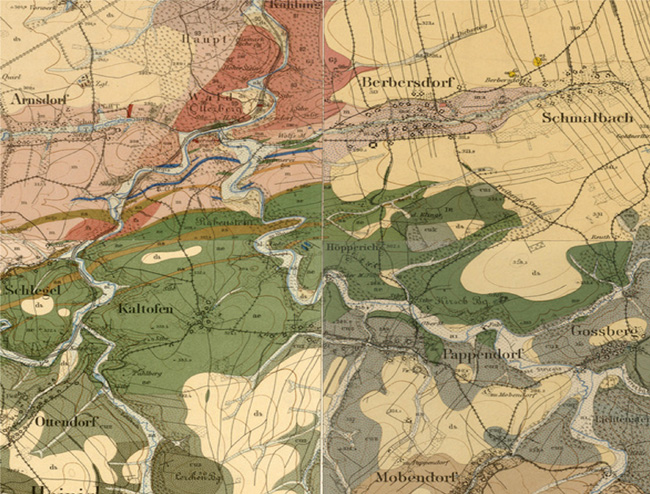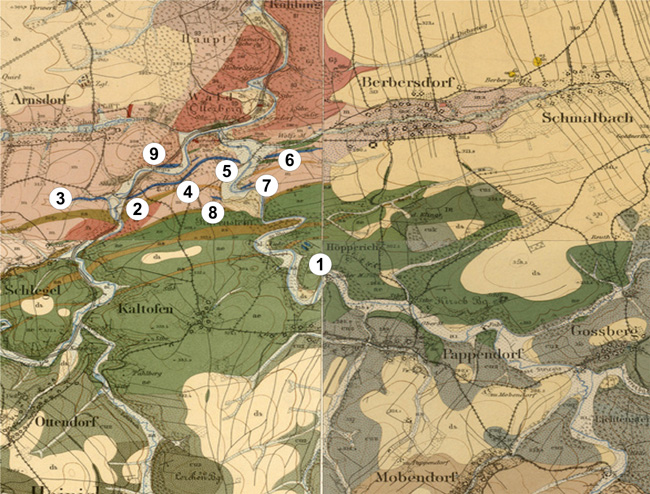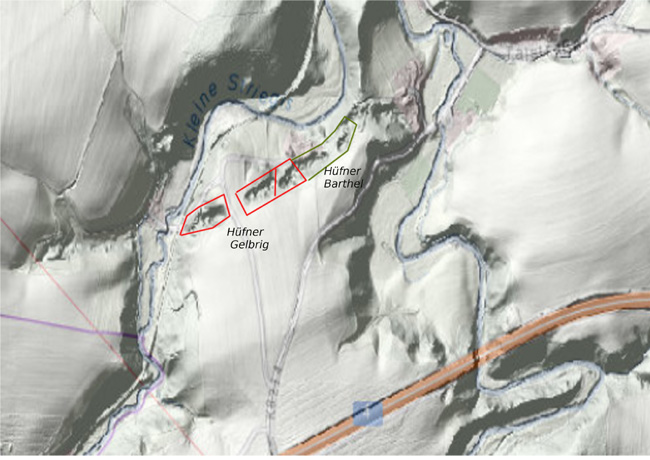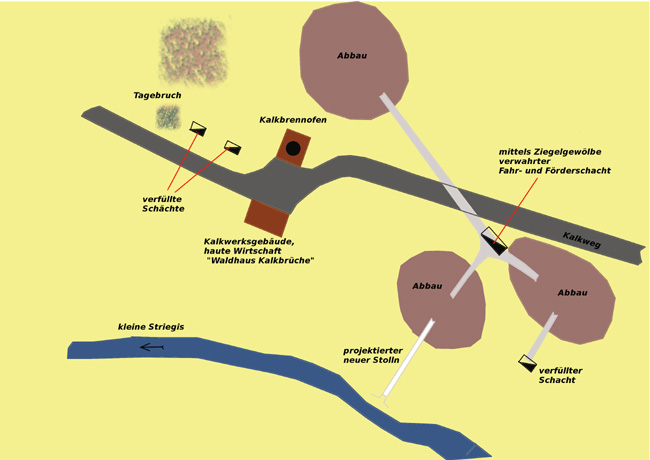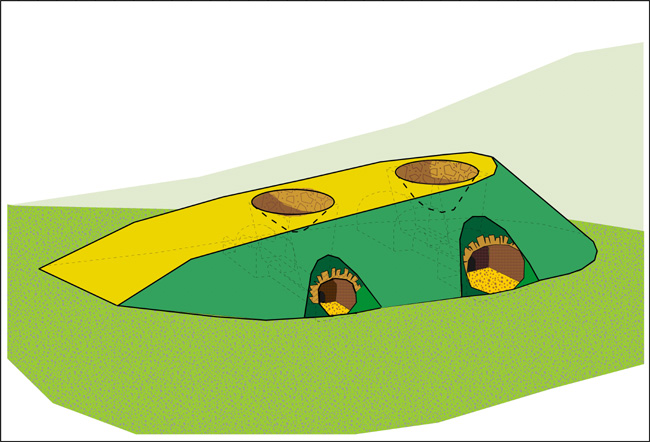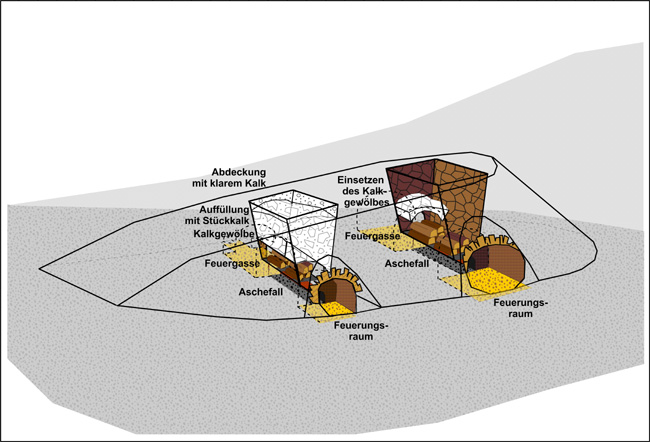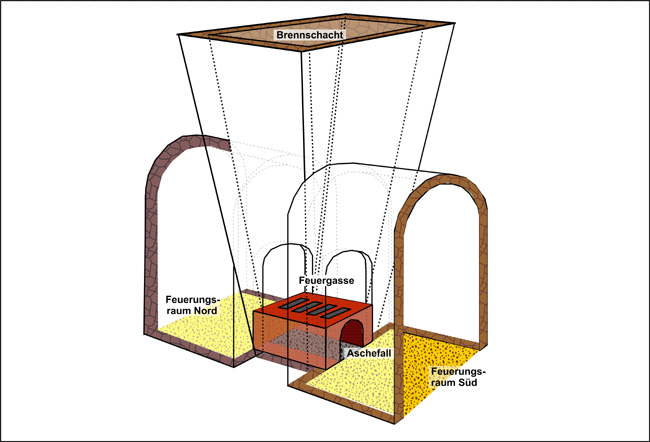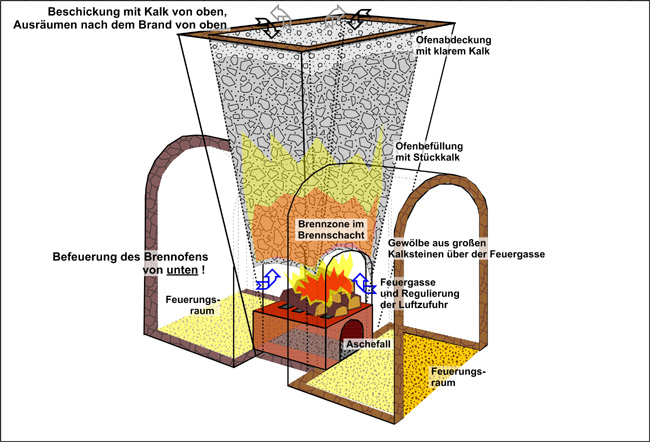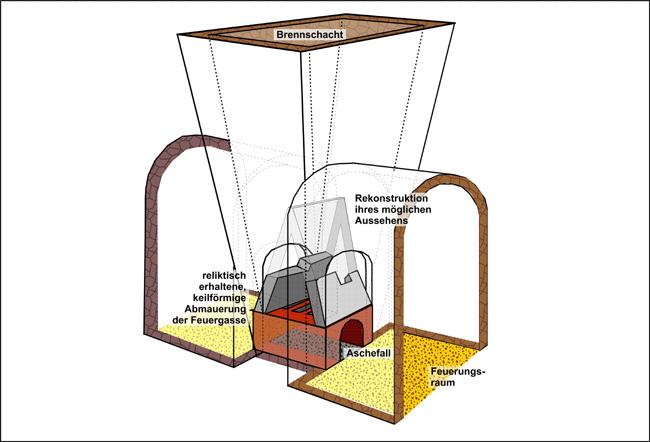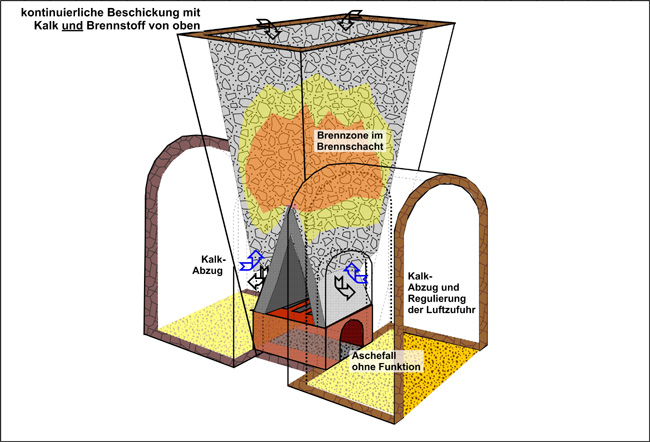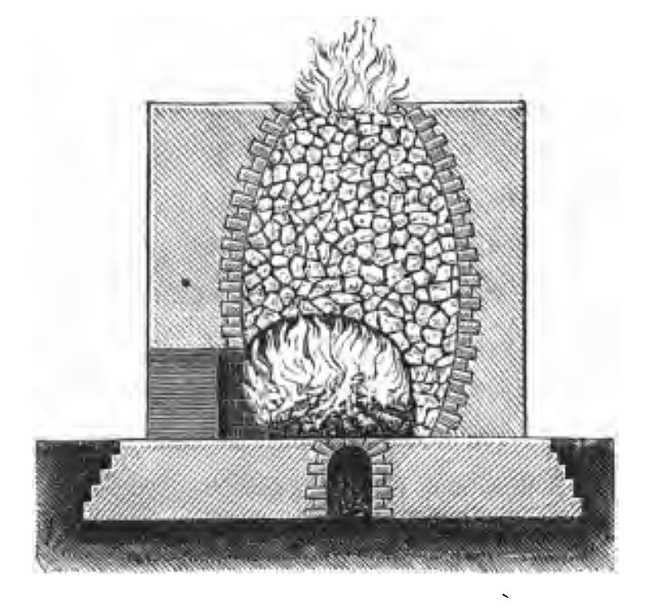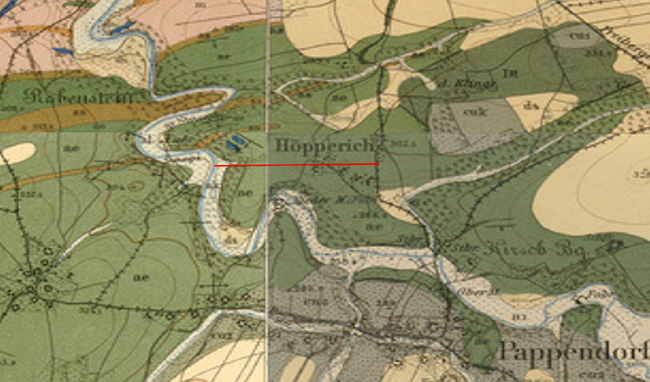|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum
Kalksteinabbau im Striegistal bei Kaltofen und Berbersdorf
Erstellt im September
2019.
Letzte
Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom September 2019 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur regionalen Geschichte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die
Heimat- und Montangeschichte dieser Region müssen wir etwas ausholen und uns
erst einmal mit grundsätzlichen Dingen befassen, wie mit dem Anfang der
deutschen Besiedlung und der Christianisierung slawischer Gebiete in diesem
Gebiet. Diese Region spielt schon in der älteren sächsischen Geschichte, zu
Zeiten der ersten Stadtgründungen, die mittlerweile urkundlich belegbar über 800
Jahre zurück liegen, eine interessante Rolle: Zu einem Teil liegt das
Kalkvorkommen – ein kleiner Teil – nämlich im Bereich des Stiftungsbesitzes des
Klosters Altzella, während andere Teile – das Hauptlager - zum sogenannten „Hersfelder
Eigen“ gehörten, das auch als „Hersfelder Lehen“ (praedium
hersfeldense) bekannt ist. Beide Besitzungen benötigten den Kalkstein
natürlich schon damals für die Errichtung von Bauwerken für unterschiedlichste
Zwecke. Die Kalkvorkommen von Kaltofen- Berbersdorf müssen dabei eine wichtige
Rolle gespielt haben.
Für die Heimat- und Montanforschung in unserer Region stellt das Hersfelder Eigen einen der wichtigsten Punkte in der Siedlungsgeschichte dar. Dieses Besitztum geht auf eine Urkunde zurück, die am 21. Juli 981 zu Wallhausen ausgestellt wurde. Darin wird die Schenkung der Burgwarde Döbeln und Hwoznie im Daleminzergau an der Mulde durch Kaiser Otto II. an das Kloster Memleben beschrieben. Um 1015 kam der Memlebener Besitz an das Kloster Hersfeld und ging später als Lehen an den Markgraf von Meißen. Ein Kloster in der hessisch-thüringischen Grenzregion wurde damals also vom Kaiser noch mit Besitzungen in der Markgrafschaft Meißen ausgestattet! Nur wenige Jahre später (986) wurden die Bistümer Merseburg, Zeitz und Meißen begründet, was die Landkarte neu ordnete (Börner). Die Beschreibung der Grenzen des Hersfelder Eigens ist als Randnotiz auf einer Urkundenseite im Kopialbuch des Hersfelders Klosters erhalten. Dieses Gebiet ist später in den Lehnbriefen von Markgraf Friedrich, den Freidigen 1292 und noch im Jahr 1454 bei Kurfürst Friedrich, dem Sanftmütigen dargestellt. 1485 kam der „Rest“ des Hersfelder Eigens aufgrund der Leipziger Teilung zum Teil zur albertinischen Markgrafschaft Meißen und mit der Region um Döbeln zum ernestinischen Kurfürstentum Sachsen- Wittenberg. Die Lehnbriefe sind in lateinischer Sprache abgefaßt und geben heute in Übersetzung und Deutung viel Spielraum für Interpretationen. Dieses slawische Siedlungsgebiet muß also für die Administrationen im Altsiedelland bekannt und vor allem von recht großer Bedeutung gewesen sein, um eine dauerhafte deutsche Besiedlung dort abzusichern!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das
Hersfelder Eigen im späteren Sachsen benutzte im Gegensatz zum Klosterbezirk
Altzella hier im Arbeitsgebiet die Flußverläufe als Grenze für eine eindeutige
Abgrenzung ihres Besitztums. Wobei die Angaben über den Verlauf des „böhmischen
Steigs“, der in beiden Besitzungen erwähnt wird, heute nur noch schwer
nachvollziehbar sind. Viele Arbeiten und Veröffentlichungen hierzu, insbesondere
aus dem Bereich der Heimat- und Montanforschung, werden durch die Wissenschaft
bislang negiert.
Die lateinische Beschreibung des Hersfelder Eigen im Originaltext haben wir samt Übersetzung bei Kästner & Schiller entnommen: „Predium Hersveldensis ecclesie incipit a loco, ubi major Striguz fluvius oritur et tenditur secundum cursum illius amnis in Mulda fluvium et per decursum Mulde usque Scapha et Scapham sursum usque ad antiquam semitam Bohemorumque secernit proprietam Kem- nitz et Hersveldensem et per semitam illam usque Pachowe, Pachowe sursum usque Nidperc, quod wernherus edificaverat, et ab amne qui preterfluit Nidperk usque in Amnem Striguz...“ „Der Besitz der Hersfeldischen Kirche fängt an, wo die Große Striegis entspringt, entlang dem Laufe jenes Flusses bis zur Mulde und muldenabwärts bis zur Zschopau aufwärts bis zum alten böhmischen Fußsteig, der das Besitztum (der Klöster) Chemnitz und Hersfeld trennt, und jenem Fußsteig entlang bis zur Pockau, die Pockau aufwärts bis nach Nidberg, das Werner gebaut hatte, und von dem Fluß, der vor Nidberg vorbeifließt bis zur Striegis...“ (Max Kästner und Johannes Schiller, Zwischen Chemnitz und Freiberg, 1928) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
Entstehung des Klosterbezirkes Altzella können wir heute gesichert in die zweite
Kolonisationsphase einordnen. Eine teilweise dauerhafte slawische Besiedlung war
ja bekannt und die Namen der Gaue ebenfalls. Hinzu kommen noch slawische Namen
von Siedlungsplätzen und Fluren, die ebenfalls den Hinweis auf dauerhafte
Besiedlung geben. Eine Kolonisation eines Landstriches erfolgt nie zufällig,
sondern sehr sorgfältig vorbereitet über längere Zeit und vor allem alte
Siedlungsplätze nutzend. Schließlich wollten die neuen deutschen Siedler (die
Vorfahren saßen in Sachsen und Franken) ihre slawischen Nachbarn aus diesem
Gebiet verdrängen, was aber wohl eher eine Vermischung beider Volksgruppen nach
sich zog, wie es die Sprachforscher anhand von überlieferten Namen belegen
können. Hinweise auf eine frühe Besiedlung lieferte da schon die
Flußnamenforschung zur Zschopau (Hengst).
Das Zisterzienserkloster Altenzella, später Altzella, wurde von Markgraf Otto dem Reichen gestiftet und 1162 von Friedrich I. bestätigt. Zum Stiftungsbesitz des Klosters Altzella um 1162, welcher 800 Hufen Land umfaßte, gehörten auch schon Siedlungsplätze, aus denen schon kurze Zeit später die uns heute bekannten Ortschaften hervorgingen, ohne daß diese namentlich bereits direkt genannt wurden. Der älteste namentlich benannte Ort war „Bor“ oder auch „Bore“ (slawisch) und steht für das spätere Böhrigen, wo ursprünglich das Kloster angelegt werden sollte, was sich aber als ungeeignet herausstellte! Der Stiftungsbesitz läßt sich anhand einer Beschreibung von 1185 wie folgt umgrenzen: Marbach, Schmalbach, Berbersdorf (Kalk!), Reichenbach, Groß- und Kleinvoigtsberg, Großschirma, Fürstenhof, Halsbrücke, Loßnitz, Kleinwaltersdorf, Kleinschirma, Bräunsdorf, Riechberg, Langhennersdorf, Seifersdorf, Mobendorf, Gosberg, Pappendorf (Kalk!), Böhrigen, Etzdorf, Gersdorf und Kummersheim. Kaltofen (Kalk!) und Arnsdorf (Kalk!) sowie zwei weitere Orte kamen erst ab 1297 zum Klosterbesitz. All diese Orte liegen innerhalb einer „Tagesreise“ vom Kloster Altzella entfernt auf wohl sehr überlegt ausgesuchten, schon vorhandenen, temporären oder sogar verlassenen slawischen Siedlungsplätzen, die die Anlage einer dauerhaften Siedlung als Waldhufendorf zuließen. Dabei können wir heute die „Tagesreise“ mit maximal 29,6 km definieren. Diese Angabe hat ihren Ursprung im römischen Militärwesen, ist wohl vielfach erprobt worden und auch für das damalige Verkehrswesen unabdingbar. (Der Einzelschritt – gradus – mit 0,74 m, Doppelschritt – passus – mit 1,48 m, 1000 Doppelschritte – mille passus – 1,48 km = 1 römische Meile, 20 milia passuum = 29,6 km – Anm. d. Red.) Laut einer Arbeit der Historikerin Martina Schattkowsky lagen alle genannten Zubehörungen des Klosters innerhalb dieser Entfernung. Eine Entfernung von maximal 23 km entsprach außerdem einer Klosterregel der Zisterzienser und war wohl dem bergigen Erzgebirgsvorland angepasst!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
genaue Grenzziehung des Klosterbezirkes wird bei Beyer wie folgt wieder gegeben:
„Der Grenzzug dieses Landstriches ging, nach der 1185 gelieferten Beschreibung von der Mulde bei dem Sitze des Klosters die Pietzschbach hinauf bis zu einem Hügel, der an der Quelle eines in diese fallenden Bächlein aufzuwerfen war, dann von einem Hügel zu dem anderen bis in und durch ein nach der Mulde sich senkendes, mit Kiefern bestandenes Thal, welches daher slawisch Smolidol, deutsch aber Harzthal genannt wurde. Von da bildete die Mulde die Grenze bis an die gegen Mittag gelegenen Fluren von Berthelsdorf und von diesen eine Linie nach den Fluren von Langenau und bis zu den Ursprung der Striegis. Dieses Flüßchen herunter mit Umgehung der vier Dörfer eines gewissen Eckardt bis nach Frankenstein, von wo die Grenze von einem Hügel bis zum andern und bis zu dem bei Bockendorf, weiter über die alte böhmische Straße abermals über mehrere Hügel bis zu dem bei Gruna (Roßwein) ging. Von da nahm sie die Richtung nach dem großen Steine an der Striegis, diese herab bis zu dem nächsten Berge, wo ein Hügel nach der Mulde zu stand, und dann diese wieder herauf bis zum dem Einfall der Pietzschbach in solche…“ Damit haben das Hersfelder Eigen und der Klosterbezirk Altzella eine gemeinsame Grenze im Arbeitsgebiet, in dem die von uns nachstehend betrachteten Kalkvorkommen liegen, und teilen diese auf zwei Herrschaftsbereiche auf. Allerdings müssen wir an dieser Stelle auf eine Einschränkung aufmerksam machen: Zur Zeit der Klosterstiftung kam nur Land in Frage, das nicht bereits vorher verlehnt gewesen ist. Der Meißner Markgraf konnte deshalb seinem Hauskloster nur solche Gebiete stiften, die ihm auch gehörten. Deshalb unterschieden sich vielleicht auch die Grenzverläufe im Arbeitsgebiet recht deutlich, wie die Beschreibungen belegen (Schwabenicky).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Zeit
der Klostergründung gab es im Bereich des Hersfelder Eigens zumindest in unserem
Arbeitsgebiet auch schon die ersten Stadtgründungen. Sakrale und weltliche
Gebäude wie Kirchen, Befestigungen und Burgen, sind kaum aus Lehm und Stroh
errichtet worden, sondern waren feste Bauwerke aus Stein mit einem gewissen
Schutzfaktor. Neben dem Baumaterial Bruch- und Backstein (Ziegel) wurde auch
Sand und Kalk für das Bindemittel Mörtel und Kalk für die Herstellung von Putz
und Farben benötigt. Doch gab es in Nähe dieser neuen Städte auch Kalkvorkommen,
die wesentlich näher lagen als das von Kaltofen- Berbersdorf. Auch das Kloster
Altzella ist in seiner ursprünglichen Bausubstanz als sehr aufwendiges, massives
Bauwerk (Gurlitt) ausgeführt worden und hatte deshalb über die ganze Zeit seines
Bestehens einen für die damalige Zeit enormen Bedarf an Baumaterialien. Die
Kalkvorkommen von Kaltofen- Berbersdorf müssen demzufolge auch für den
Klosterbezirk von besonderer Bedeutung gewesen sein, da diese in unmittelbarer
Nähe und innerhalb einer Tagesreise erreichbar waren!
Im
Klosterbezirk lag aber noch ein weiteres Kalkvorkommen: Die Kalksteinvorkommen
im Triebischtal bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaltofen
kam wohl durch eine geschickte „Aufkaufspolitik“ in Klosterbesitz. Vermutlich
spekulierte das Kloster Altzella schon lange auf Kaltofen und dessen Kalklager
und nutzte die Gelegenheit eines „Notverkaufes“ durch gute Vorbereitung sehr
geschickt aus.
Der in finanziellen Schwierigkeiten lebende Ritter Ulrich von Maltiz mußte seinen Besitz „Kaldovevene“ an zwei wohlhabende Freiberger Bürger abgeben (Gläubiger?) und diese übereigneten es dem Kloster Altzella. „In diesem Jahre (1297 Anm. d. Red.) übertrugen Heinrich von der Schope (Zschopau, Anm. d. Red.) und aus der Apotheken, Bürger zu Freiberg, das Gut zu Albertitz und den Kaldovene, das Sie vom Ritter Ulrich von Maltitz zu Lehn gehabt, von Ihm aber frei gekauft hatte, dem Gotteshaus in Zelle und empfingen es von dort wieder als Erbe“. (Knauth) Die Vermutung, daß es sich bei diesem „Zukauf“ von Kaltofen über 100 Jahre nach Klostergründung eigentlich um den gezielten Erwerb der Kalkvorkommen gehandelt haben könnte, liegt nahe. Das Kalkvorkommen zieht sich von der kleinen Striegis bis hinauf auf Arnsdorfer Fluren und der Hauptteil des Kalklagers liegt nun einmal eindeutig auf der Flur von Kaltofen. Mit diesem „Zukauf“ kam der Klosterbezirk in den Besitz des gesamten Kalkvorkommens und konnte dort ohne großen Aufwand sämtliche tagesnahen Bereiche auf eigene Kosten abbauen ohne von einem Preisdiktat – die Nachfrage regelt ja den Verkaufspreis – abhängig zu sein. Diesen Umstand sollte man nicht aus den Augen verlieren. Das Kloster hatte bis zu seiner Auflösung mit Beginn der Reformation einen großen Bedarf an Baumaterialien für seine doch sehr aufwendigen Bauprojekte und deren Erhaltung. Denn innerhalb des Klosterbezirkes lag bis zum „Zukauf“ nur auf den Berbersdorfer Fluren das östliche Ende der Lagerstätte und auf den Fluren von Pappendorf in Nähe des böhmischen Steiges nur ein unbedeutendes, kleines und eher minderwertiges Kalkvorkommen, das sich nur für Düngerkalk eignete. Letzten Endes muß davon ausgegangen werden, daß die Kalkvorkommen von Kaltofen-Berbersdorf schon im 12. Jahrhundert umfassend bekannt waren und seitdem – wenn auch mit größeren Unterbrechungen – im Abbau gestanden haben! Damit ist der Kalkbergbau dieser Region mindestens genauso alt wie der Erzbergbau um Freiberg, vielleicht sogar noch älter! Doch fehlen hierzu leider noch eindeutige Belege. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
zweite Besiedlungsphase im 12. Jahrhundert kann man mit Fug und Recht als neue
Landaufteilung durch den deutschen Adel bezeichnen. Nach dem Tod Wiprecht von
Groitzsch´s war die Markgrafschaft Meißen endgültig an das Haus Wettin
gefallen. Die Wettiner forcierten nun die Kolonisation, gestützt auf die in der
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eingetretenen Silberfunde in Freiberg.
Der überwiegende Teil der Zins entrichtenden Bevölkerung war aber noch immer slawisch und erst nach und nach entwickelten sich die uns bekannten Dörfer zu ihrer heutigen Größe. Auch für unser Arbeitsgebiet trifft dieser Umstand zu. Die nächstgelegene Stadt zu unserem Arbeitsgebiet dem Kalklager von Kaltofen- Berbersdorf war Hainichen. In weiterer Entfernung lag nur noch Freiberg als nächste Stadt. Da eine Stadt eine zentrale Funktion hatte und besondere Rechte besaß, gingen von ihr auch Einwirkungen auf die umliegenden Dörfer aus, zum Beispiel in der politischen und kirchlichen Verwaltung. Das Zentrum der Nahmärkte war immer eine Stadt mit der entsprechenden Bannmeile in Sachen Marktrecht, was aber für Hainichen nie zutreffend war (Schwabenicky). Die Kirchen und ihr Besitz waren immer Eigentum der Grundherren und werden als „Patronat“ oder „Eigenkirchenrecht“ bezeichnet. Der zuständige Pfarrer wurde vom Grundherrn bestimmt und vom Bischof oder dessen Vertreter eingesetzt. Diese kirchliche Verwaltung wurde auch als Pfarrsprengel bezeichnet. Dabei hatte nicht jedes Dorf eine Pfarrkirche, sondern konnte einem anderen Dorf mit solcher Kirche zugewiesen werden. Außerdem bestand für die Bewohner der Dörfer der sogenannte Pfarrzwang. Man konnte sich also nicht seine Kirche aussuchen. Die Pappendorfer Kirche mußten z. B. auch die Riechberger Kirchgänger besuchen. Diese Kirche unterstand bis zur Reformation dem Kloster Altzella. So verhielt es sich auch mit den kirchlichen Abgaben, die sowohl an die zuständige Pfarrkirche zu erbringen waren als auch an den besitzenden Grundherrn (Schwabenicky).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
Fluren, auf denen das Kalklager verlief und abgebaut wurde, gehörten zu den
Ortschaften Arnsdorf, Kaltofen, Berbersdorf und Pappendorf. Den Ortsnamen „Kaldovevene“
deuten Hans Walther (Onosmatiker) und Ernst Eichler (Linguist) als: "Vermutlich
Siedlung am Ofen, der nicht mehr in Betrieb ist". Zu den Ortsfluren des
Kalklagers sind folgende urkundlichen Schreibweisen überliefert:
1428 Kaldoffin, 1497 Kaldofen und 1539 Kaldoffen. 1428 Berbirsdorff, 1449 Berwerstorff, 1510 Berbistorff, 1814 Berbersdorf sowie Berbsdorf. 1230 Poppendorf, 1377 Popindorf, 1414 Puppendorf, 1428 Papindorff, 1436 Poppendorff, 1447/48 Poppindorf, 1495/1555 Pappendorff, 1791 Pappdorf (Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen) Arnsdorf wird urkundlich 1348 als „Arnoldisdorf“ erwähnt. Ob diese Namensgebung auf einen deutschen Lokator zurückzuführen ist, kann heute niemand mit Sicherheit bestätigen. Die Ortschaft gehörte ab 1297 zum Klosterbezirk und kam einige Jahre nach der Reformation und Auflösung des Klosters in den Besitz der Familie Mordeisen (Zedler). Zum Besitz von Ulrich von Mordeisen (*1519, †1572) gehörten aus dem Klosterbesitz noch folgende Ortschaften: Berbersdorf, Pappendorf, Kaltofen, Goßberg, Bräunsdorf, Großschirma, Großvoigtsberg, Kleinvoigtsberg, Kleinschirma, Kleinwaltersdorf, Reichenbach, Seifersdorf, Mobendorf, Loßnitz und Langhennersdorf. Ab 1572 erbten die drei Söhne von Mordeisen zu gleichen Teilen diese Dörfer; hatten aber kein Interesse daran. Lediglich Rudolf Mordeisen behielt sein Erbe bis 1587. Dieses Erbe bestand aus den Ortschaften mit dem Kalklager wie Pappendorf, Kaltofen und Berbersdorf, sowie zwei weiteren Orten. Vermutlich war der Kalkbergbau doch ein einträgliches Geschäft für diesen Grundherrn. Sämtlicher Besitz an Ortschaften wurde an den sächsischen Kurfürst Christian (?) veräußert und dem Amt Leisnig (1696), später dann dem Amt Nossen (1843), zuletzt dem Gerichtsamt Roßwein (1856) zur Verwaltung unterstellt, bis zur Gründung der Amtshauptmannschaft Döbeln (1875). Vermutlich blieb der Abbau dieser Kalklager schon mit dem Verkauf an Kurfürst Christian liegen. Erst ab 1674, deutlich nach dem Ende des 30jährigen Krieges, setzen wieder Nachrichten zur Wiederaufnahme der seit langem still liegenden Kalkbrüche ein.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu
Arnsdorf: (Schumann, Band 1, 1814)
„Arnsdorf, bei Hainichen, oder bei Greifendorf; Dorf im Leipziger Kreise, im Amte Leißnig, 1 Stunde nördlich von Hainichen, auf dem linken Ufer der Striegnitz gelegen. Der Ort liegt mitten im Amtsbezirk Nossen, hat 4 ½ Hufe und ein altschriftsätziges Rittergut. Zu letzterem gehören noch schriftsätzig die Dörfer Falkenau, Gersdorf, Irbersdorf und Ottendorf. In sämtlichen Orten sind 1100 Einwohner.“ 1817 wird Kaltofen folgendermaßen beschrieben: (Schumann, Band 4, 1817) „Kalkofen, oder Kaltofen, ein unmlttelbares Amtsdorf im Königreich Sachsen, im Erzgebirgischen Kreis, im Amte Nossen, 1 Stunde westl. von Nossen, an der Straße nach Waldhelm gelegen. Es hat 15 Einwohner, und erhielt seinen Namen von den nahe dabei im Striegnitzlhal gelegene Kalksteinbrüchen und Kalköfen.“ Zu Berbersdorf wird zur gleichen Zeit folgendes beschrieben: (Schumann, Band 1, 1814) „Berbersdorf, Berbsdorf, unmittelbares Amtsdorf im Erzgebirgischen Kreise, im Amte Nossen, am Klein-Striegesbache, südl. von Roßwein gelegen. Es hat 328 Einwohner und eine Mühle mit 3 Gängen.“ Zu Pappendorf wird folgendes berichtet: (Schumann, Band 8, 1821) „Pappendorf, ein mittelmäßiges Pfarrkirchdorf im Königreich Sachsen, in dem, in mancher Hinsicht zum Meißnischen, in andrer zum niedern Erzgebirgischen Kreise zu rechnenden Amte Noßen, ist demselben unmittelbar unterworfen. Es liegt 2 ½ Stunden südwestlich von Noßen, 1 Stunde nordöstlich von Haynichen, 1 1/3 Stunde südlich von Roßwein, theils am linken Ufer und in der breiten, sanften und sehr anmutigen Aue der, in schönen Krümmungen, aber mit häßlich- grauem, durch die Bränder Bergwerke gefärbten Wasser dahin fließenden großen Striegiß, theils am geringen Steinbache, der in nördliche Richtung in jene fließt. Durch den Ort führen die Straßen von Freiberg nach Roßwein und von Haynichen über Nossen nach Dresden, und machen denselben ziemlich belebt, wozu die etwas enge Bauart auch viel beiträgt. Die Meereshöhe geht von 950 bis zu 1050 pariser Fuß, und das Klima darf man, bei so starker Meereshöhe, mild nennen. Den Namen Pappendorf hält man häufig für gleichbedeutend mit Pfaffendorf, und zwar auch deshalb, weil die hiesige Kirche ehedem eine Erzpriesterkirche war, die unmittelbar unter dem Meißnischen Bischof stand. Aber wohl mit Anrecht, da es schon in den ältesten Urkunden unter dem Namen Pappendorf (auch Papindorf) vorkommt, und Pfaffe (oder Pope) sonst nie mit zwei pp geschrieben gefunden wird; der Name scheint vielmehr von Poppo hergeleitet werden zu müssen. Pappendorf gehörte unter die 45 Oberdörfer des Klosters Altzelle, und kam nach dessen Säcularisirung mit an des Kurfürst Moritz berühmten Canzler, Mordeisen; 1587 schlug man es zum Amte Nossen. Diesem kaufte der Oberste Pflugk auf Gersdorf 1603 die Dienste des Dorfes ab, und noch jetzt haben die hiesigen Bewohner mancherlei Frohnen in Gersdorf aufzuwarten. Pappendorf enthält in etwa 90 Häusern, nahe an 500 Bewohner; 1801 gab man freilich nur 342 Consumenten an (ohne Erblehngericht und geistliche Gebäude) aber theils ist die Bevölkerung in hiesiger Gegend vorzüglich stark gestiegen (im hiesigen Kirchspiel zum zählt man gemeinjährig 78 Geburten und nur 49 bis 50 Begräbnisse), theils wurden gerade in dieser Gegend sehr viel Köpfe bei jener Zählung verschwiegen. Die Bewohner nähren sich von Ackerbau, der sehr guten Viehzucht, der Weberei und Baumwollspinnerei für die Haynicher Cattunfabriken, vom Kalkbrechen und Kalkbrennen, mit Land- und Steinkohlenfuhrwesen u.s.w. Außer der Kirche und Schule zeichnen sich noch das sehr einträgliche, mit guter Gastwirtschaft versehene Gerichte (eines der vier alten Zellischen Erblehngerichte) und die 3 Mühlen aus, welche nebst 3 Sägemühlen an der Striegiß liegen. Die alte, sehr ansehnliche, durchaus maßiv und mit Schiefer gedeckte Kirche hat 2 Thürme, war schon 1411 vorhanden und wurde 1424 erweitert, bald nachher aber vom Meißnischen Weihbischof Nicolaus von Gardin eingeweiht. Ihr Inneres zeigt 2 Altäre, davon der gegen Osten gerichtete kleinere der Hauptaltar war, über diesem sieht man Christum mit den 12 Aposteln, über dem gegen Nord gekehrten größeren Seitenaltar hingegen die Maria nebst 4 anderen Frauen in vergoldeter Bildhauerarbeit dargestellt. Zur hiesigen Parochie, welche unter der Noßener Adjunctur der Ephorie Freiberg steht, und bei welcher der Kirchenrath die Collaturen übt, gehören noch die 5 Dörfer, deren Fluren das Pappendorfer Gebiet rund umgeben, nämlich Berbersdorf, Goßberg, Kaltofen, Mobendorf und Ottendorf; das Kirchspiel befaßt gegen 2000 Seelen, ungeachtet es wenig über ¼ Quadratmeile sich ausdehnt. Über die Striegis führt eine schöne Brücke von Kalkstein, die vor dem J. 1720 erbaut wurde. Wichtig und bekannt ist Pappendorf vorzüglich durch seine Kalkgewinnung. Das Kalkflötz liefert einen recht reichhaltigen, sehr festen und dichten, grauen Stein, und streicht – in mehrere Bänke aufgetheilt, zwischen welchen jedesmal ein glimmerreicher Gneus lagert – unter einem Lager von Lettenschiefer, welches von der oberflächlichen Dammerde nur schwach bedeckt wird. Es streicht in westlicher Richtung bis jenseits des nahen Dörfchens Kaltofen, wie es jetzt, oder Kalkofen, wie es ehedem genannt wurde; wo es aber in Osten anhebe, ist nicht hinlänglich bekannt; mit Sicherheit läßt sich seine Länge wenigstens auf ¼ Stunde angeben, da noch am rechten Ufer der Striegiß, im Busche bei der Neu Mühle (zu Mobendorf gehörig) ein Bruch bearbeitet wird, dessen Stein aber weniger dicht ist, als der Pappendorfer. Die wichtigeren Brüche liegen hinter einander in einer Reihe von Ost nach West, theils auf hiesigem, theils auf Kaltofener Gebiet, sind meist schon 40 bis 50 Ellen tief ausgehauen, und gehören theils zum hiesigen Erblehngericht, theils den Pappendorfer und Kaltofener Bauern, welche entweder die Brüche vermiethen, oder auch selbst bauen, und das Produkt an die Kalköfen zu Pappendorf, Kaltofen, Mobendorf, Berbersdorf, Schmalbach und Goßberg verhandeln, wo mittelst der, in großer Menge hierher kommenden Steinkohlen aus Fiedler's beiden großen Gruben zu Berthelsdorf (von welchen man die geringste Sorte benutzt) ein guter Kalk gebrannt wird, den man zum Theil aus großer Ferne zur Felddüngung holt.“ Zum Steinkohlenabbau durch Herrn Fiedler
bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Lage des Bergbaugebietes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaltofen
wie auch Berbersdorf bilden zusammen mit weiteren Dörfern seit 2008 durch
Zusammenschluß mit der Gemeinde Tiefenbach die Gemeinde
Striegistal und diese liegt im Landkreis Mittelsachsen. Die zentrale
Lage an der BAB 4 mit der Autobahnausfahrt Berbersdorf machen die Region schnell
und gut erreichbar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Hauptteil des Kalklagers von Kaltofen- Berbersdorf liegt im Bereich der
Wasserscheide zwischen den beiden Striegis- Flüssen. Hier mündet auch die kleine
Striegis, an welcher der Arnsdorfer und Kaltofener Bereich des Kalklagers liegt,
in die große Striegis ein. Weitere kleinere Bäche geben ihr Wasser ebenfalls in
das Striegis- Flußsystem ab.
Das ehemalige Bergbaugebiet ist heute ein zentraler Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Striegistäler“ und erstreckt sich über die Fluren der Gemeinden Arnsdorf, Kaltofen, Berbersdorf und Pappendorf. Die auflässigen, nicht fahrbaren Grubenbaue und auch die vielen höhlenartigen Öffnungen, Gewölbe und Spalten an den teilweise frei liegenden Bruchwänden bilden für etliche Fledermausarten das Sommer- und Winterquartier. Dies gilt natürlich auch für Reptilien, die ein solches natürliches Milieu sehr gern bevorzugen. In diesem Flächennaturdenkmal gibt es natürlich auch die typische Kalkflora zu finden, wie in anderen still gelegten Kalkstein- Brüchen auch. Sehr auffällig sind da die Bestände von Alpen-Ziest, Leberblümchen, Rote Heckenkirche, Christophskraut, Frühlings- Platterbse und Wald-Trespe, um nur einige Vertreter zu nennen. Das ganze Areal ist durch Wanderwege recht gut erschlossen und bietet einen sehr interessanten Einblick in die Montanwirtschaft unserer Altvorderen, wenngleich sie in diesem Bergbaugebiet nie den Stand der Industrialisierung erreicht hat, sondern über ein eher mittelalterliches Niveau nicht hinaus kam.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Geologie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das
Arbeitsgebiet mit den Kalkvorkommen liegt im Randbereich der Granulitformation,
die vom Glimmerschiefer relativ gleichmäßig und großflächig überlagert wird. Die
Taleinschnitte von Kleiner und Großer Striegis bilden hier bedeutende südliche
Nebentäler der Freiberger Mulde. Der Zusammenfluß mit der Freiberger Mulde liegt
unweit der ehemaligen Bahnstation von Berbersdorf bei Niederstriegis.
Die Kalkvorkommen in dieser Region gliedern sich in zwei Teilbereiche: Zum einen ein recht kleines Kalklager im Tal der Großen Striegis im dortigen Epidot- Amphibolschiefer. Ein recht großes Lager, das Hauptlager, ist im rechten Berggehänge der Kleinen Striegis, mit einer Fortsetzung auf dem linken Ufer in Richtung Arnsdorf, im Glimmerschiefer eingebettet. Das Hauptlager erstreckt sich bis in das Tal der Großen Striegis und setzt sich dort am gegenüberliegenden Talgehänge fort. Es stellt ein recht großes und bedeutendes Kalkvorkommen ähnlich dem von Memmendorf- Frankenstein dar. Vermutlich wurden nicht alle geologisch bekannten Vorkommen auch bergmännisch abgebaut, zumindest sind heute entsprechende Spuren im Gelände nicht mehr sichtbar. Mitunter wurden solche Vorkommen nur verritzt oder als Ergebnis geologischer Untersuchungen bekannt und daraufhin im einschlägigen Kartenmaterial vermerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine frühe geologische Beschreibung des
Gebietes entstammt einem Bericht aus der Anfangszeit der Geognostischen
Landesuntersuchung (40003, Nr. 9). Ernst Friedrich Wilhelm Lindig
berichtete darin über seine geologische Revisionsreise in der Gegend von Oederan,
Flöha, Frankenberg und Hainichen im Jahr 1802. Aus diesem Bericht ist auch die
nachfolgende Kartendarstellung entnommen. Wir zitieren hier gern, was Herr
Lindig damals über die hiesigen Vorkommen des
„Urkalks“
für bemerkenswert hielt (Rückseite Blatt 72ff):
§123. „½ Stunde von Kaltofen gegen Mitternacht werden an dem südlichen Abhange des Kleinen Striegitzthals 4 Kalkbrüche auf einem Std. 6,6 streichenden Urkalklager, welches in Glimmerschiefer aufsetzt, betrieben. Drei dieser Kalkbrüche gehören dem, im vorigen § mehrmals gedachten*) Hüfner Gelbig, und der 4te, welcher nach Morgen zu liegt, dem Hüfner Barthel aus Kaltofen. Der erste, welcher nach Abend zu liegt, ist verbrochen und zur Zeit nicht gangbar. Im 2ten wird der Kalkstein unterirdisch gewonnen. Man nämlich in dem 18 bis 20 Ellen mächtigen und 20 bis 25 Grad gegen Mittag fallenden Kalklager einen saigeren Schacht, ungefähr 1 Fahrte tief, abgesunken, und von selbigem aus, nach dem Streichen des Lagers, sowohl gegen Abend, als Morgen, einige Lachter weite Örter getrieben, mittelst deren Betriebes der Kalkstein gewonnen wird. Im dritten, dem Hüfner Gelbig zugehörigen Kalkbruche, wird der Kalkstein mittelst Steinbruchsbau und in vierten, welchen der Hüfner Barthel besitzt, zwar unterirdisch, aber sehr unregelmäßig gewonnen. In all diesen Brüchen ist der Kalkstein durch ziemlich parallele Klüfte gespalten, welche 50 bis 60 Grad gegen Mitternacht fallen. Bei der Gewinnung desselben unterscheidet man vorzüglich zwei Sorten, wovon man die eine den weißen, und die andere den grauen Kalkstein nennt. Ersterer, welcher auf der Sohle des Kalklagers liegt und 3 bis 4 Ellen mächtig ist, hat eine rauchgraue und graulich weiße Farbe, und ist feinkörnig, das ins splittrige übergeht. Letzterer hingegen, welcher feinkörniger als ersterer ist und ebenfalls splittrigen Bruch zeigt, hat eine dunkelgraue Farbe, welche bloß an den Splittern ins graulich und gelblich weiße übergeht. In beiden, besonders aber in letzterem, kommt etwas eingesprengter Schwefelkies vor. Der Glimmerschiefer, in welchen das beschriebene Kalklager aufsetzt, ist etwas dünn und krummschiefrig. Der Kalkstein wird mit Berthelsdorfer Steinkohlen, wozu man einen geringen Theil Holz nimmt, und zwar jede der oben beschriebenen Sorten besonders, gebrannt. Der Scheffel von gebranntem weißen Kalk wird für 16 Gr. und vom grauen für 9 Gr. verkauft. Ersteren wendet man zum Bauen und letzteren zur Verbesserung der Felder an.“ *) Im vorangegangenen Paragraphen beschrieb Lindig einen beim Dorfe Schlegel durch denselben Hüfner Gelbig auf Steinkohle getriebenen, dort freilich erfolglos gebliebenen Versuchsstollen. Daß der Kalkbruchbesitzer sehr an eigener Brennstoffversorgung interessiert war, anstatt die Kohle für seine Brennöfen in Berthelsdorf kaufen zu müssen, ist nur allzu einleuchtend. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei genauem Hinschauen findet man nördlich von
Goßberg in dieser Karte noch eine gleichartige, wenn auch nur kleine Eintragung
und hierzu in Lindig's Bericht aus dem Jahr 1802 das Folgende (40003,
Nr. 9, Blatt 79):
§134. „In einem, 25 Schritt über dem letzteren Beobachtungspunkte*) am rechten Abhange des oftgenannten Thals befindlichen Kalkbruche baut man ein Urkalklager ab, welches Stunde 12,4 streicht, 1 bis 1 ½ Ellen mächtig ist und 75 bis 80 Grad gegen Abend fällt. Die Gebirgsart, in welcher dieses Lager aufsetzt, ist sowohl Thonschiefer, der sich dem Glimmerschiefer nähert, als auch Hornblendeschiefer, welcher oft in ersteren übergeht. Der Urkalk ist von einer grauen, graulich und gelblich weißen Farbe, ist sehr mit Thon- und Hornblendeschiefer gemengt und führt an einigen Stellen vielen Quarz bei sich.“ *) In dem diesem voranstehenden Paragraphen wird eine aus Tonschiefer bestehende Felsgruppe am rechten Striegishang, etwa 1.000 Schritt flußaufwärts von der bei Pappendorf über die Große Striegis führenden Brücke beschrieben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In einem Zwischenbericht von C. A. Kühn, damals noch Obereinfahrer in Freiberg, über erste Ergebnisse der geognostischen Landesuntersuchung, namentlich über die dabei „aufgefundenen Lagerstätten gemeinnützlicher und besonders brennlicher Fossilien,“ aus dem Jahr 1818 (40003, Nr. 59) findet man im Kapitel III. Zwischen der Freyberger und Zwickauer Mulde gelegener Theil des Königreichs Sachsen (Rückseite Blatt 112ff) nur eine kurze Notiz über die hiesigen Kalksteinvorkommen unter dem Anstrich a) Urkalkstein (Blatt 149f): §74. „Ein paar sehr wenig bedeutende Kalksteinlager finden sich ferner im Thonschiefer bei Pappendorf ohnweit Haynchen im Striegisthale. Nur das, etwa 800 Schritt oberhalb des Dorfes aufsetzende, hat man in neuerer Zeit bebaut.“ §75.
„Sehr wichtig ist dagegen endlich wieder dasjenige Kalksteinlager, welches in derselben Gegend zwischen Kaltofen und Berbersdorf im Glimmerschiefer vorkommt. Dieses Lager ist 12 – 18 Ellen mächtig, und einerseits bereits bis fast nach Berbersdorf, andrerseits aber beinahe bis Schlegel aufgefunden worden. Es schießt 20° – 30° in SO ein und führt einen guten, vorzüglich reinen Kalkstein.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Hauptlager wird dann später in den Erläuterungsheften zu den Geognostischen Karten von Sachsen von Carl Friedrich Naumann im Jahr 1845 so beschrieben: „Bei Arnsdorf und Berbersdorf ist dem Glimmerschiefer das bedeutende Kaltofener Kalklager eingelagert, in dessen Hangendem und Liegenden jedoch auch etwas Hornblendschiefer vorkommt. Dasselbe erreicht seine größte Mächtigkeit auf dem Joche zwischen bei den Striegisthälern, wo es eigentlich zwei, durch ein 16 Ellen mächtiges mit Kalklagen durchzogenes Zwischenmittel abgesonderte Lager bildet. Das obere Lager oder hangende Trum ist bis 12 , das untere Lager oder liegende Trum bis 8 Ellen mächtig, und beide führen blaulich- weißen bis blaulich- grauen, krystallinisch körnigen Kalkstein. Früher wurde derselbe durch Tagebau gewonnen, jetzt aber werden die Baue unterirdisch betrieben. Das mittlere Streichen bestimmt sich nach dem Hauptzuge der alten Baue zu hor. 5, das Fallen ist 30° in S.; in den Kalkbrüchen kommen jedoch ziemlich abweichende Specialstreichen (besonders hor. 3 — 4) vor, weil das Lager sehr viele Wannen und Bäuche wirft. Auf seiner östlichen Fortsetzung bei Berbersdorf scheint das Lager hor. 5,4 und auf seiner westlichen Fortsetzung, südlich von Arnsdorf (wo gleichfalls ein Kalkbruch betrieben wird) hor. 6 zu streichen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
geologische Beschreibung entnehmen wir wieder der bekannten Literatur:
„Krystallinischer Kalkstein Ausser in seinem Berbersdorf- Kaltofener Hauptlager stellt sich krystalliner Kalkstein in der Glimmerschieferformation von Section Waldheim- Böhrigen noch in Gestalt zweier kleiner Lager ein, von denen das eine am linken Ufer der kleinen Striegis dem Hangenden jenes Hauptlagers angehört. Der Kalkstein des letzteren ist von blaugrauer oder bläulichweisser Farbe, erhält aber oft durch zu Häuten vereinigte Graphitblättchen eine ausgezeichnete Schieferung und ein schwarz und weiss gestreiftes Aussehen, ja in manchen Lagen eine vollständig schwarze Färbung. Minimale Graphitblättchen in feinster Vertheilung sind es auch, welche die blaugrauen Nuancen des Kalksteines verursachen. Mit dem Graphit vergesellschaftet sich regelmäßig mehr oder wenig minder reichlich Eisenkies in kleinen Kryställchen, Körnchen und Blechen, während andere accessorische Mineralien durchaus fehlen. Zahllose Kalkspathadern pflegen den schiefrigen Kalkstein zu durchziehen, so dass manche Schichten das Aussehen von Breccien erhalten. Auf gewissen Klüften haben sich Kalkspath- Rhomboeder angesiedelt. Das Hauptkalklager, welches früher sowohl übertage, wie auch unterirdisch abgebaut wurde, erstreckt sich von der östlichen Sectionsgrenze südwestlich von Berbersdorf in einer im Ganzen westsüdwestlichen Richtung bis an das linke Gehänge der kleinen Striegis. Auf dem Joche zwischen ihr und der großen Striegis erlangt dasselbe seine größte Mächtigkeit, theilt sich jedoch hier in zwei, durch dickbauchige Kalklinsen verbundene Lager, von denen das hangende ungefähr 10 m mächtig ist. Was die beiden dieses Hauptflötz begleitenden schlank linsenförmigen kleineren Kalksteinlager betrifft, so ist dasjenige im Liegenden des ersteren bis 4 m mächtig und besteht aus einem sehr kieseligen Kalk, der mit Graphitschiefern abwechselt, während der Kalkstein des anderen hangendsten, nur 1 m mächtigen Lagers mit dunkelem Glimmerschiefer verbunden und durch Quarzkörner verunreinigt ist.“ (Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen, Sektion Frankenberg- Hainichen, Blatt 78)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus der
geologischen Karte ist ersichtlich, daß es sich um zwei Lokalitäten mit
Kalklagern handelt. Jedoch ist nur das im Glimmerschiefer anstehende Hauptlager
mit einer genaueren Beschreibung bedacht worden. Doch es gibt noch ein weiteres,
kleineres Vorkommen von kristallinem Kalkstein in diesem Gebiet. Es befindet
sich unweit des Kalkweges, früher der böhmische Steig, östlich der heutigen
Ortschaft Kaltofen.
Interessant und völlig unbekannt ist dieses Kalkvorkommen im Epidot- Amphibolschiefer im Tal der großen Striegis – siehe Punkt 1 in der Topografischen Karte oben – das im Gegensatz zu weiteren Vorkommen im selben Tal auch über längere Zeit im Abbau stand. Aufgrund der Lage des Vorkommens in unmittelbarer Nähe des böhmischen Steiges könnte es sich um einen sehr frühen Kalkbergbau handeln. Doch fehlen hierzu jegliche wissenschaftliche Untersuchungen.
Während der Geognostischen Landesuntersuchung im 18./19. Jahrhundert hat dieses
Vorkommen offenbar schon keine Rolle mehr gespielt und ist daher in den
Beschreibungen nicht benannt. Vielleicht hat aber Herr Lindig auch ein
zweites Kalklager einfach nur auf der falschen Seite von Pappendorf (südlich in
Richtung
In den Erläuterungen zur geologischen Specialkarte Blatt 78 wird diese Lokalität jedenfalls folgendermaßen beschrieben: „Ein unregelmäßiges, wenig mächtiges Lager von weißem, grauem oder gelblichem, dichten Kalkstein ist, wie drei verfallene Brüche beweisen, in früheren Zeiten am rechten Gehänge des Tales der großen Striegis in der äußersten NO.- Ecke der Section abgebaut worden.“ (Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen, Sektion Frankenberg-Hainichen, Blatt 78)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur
Montangeschichte
Allgemeines
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur
Montangeschichte der Region sind nur wenige Daten bekannt. Der hiesige
Kalkbergbau war nie fiskalisch und unterstand deshalb immer nur der
grundherrschaftlichen Verwaltung.
Wie auch in anderen Regionen Sachsens üblich, kam dieser private Kalkbergbau erst um die 1880er Jahre unter bergamtliche Aufsicht. Deshalb sind kaum Akten zu diesem Thema in den staatlichen Archiven auffindbar. Eine Recherche im Zusammenhang mit den entsprechenden Grundherrschaften konnte von uns nur in kleinem Maße durchgeführt werden, wenn die Recherche in den jeweiligen Staatsarchiven die erforderlichen Treffer zu Tage brachte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
Nummerierung bedeutet:
Im Tal der Großen Striegis: 1) Kalkvorkommen im Epidot- Amphibolschiefer unweit der heute nicht mehr vorhanden Wolllspinnerei an der großen Striegis unweit des Kalkweges am „Höpperich“ gelegen. (nicht im obigen Kartenausschnitt) 8) In der Landschaft waren heutzutage keine Spuren sichtbar. Vermutlich nur ein geologischer Nachweis für Kalkstein. 7) Von diesem Vorkommen ist nur ein verwischter Schurf am rechten Ufer der großen Striegis sichtbar. Auf dem anschließenden Feld sind keine Spuren mehr zu sehen. Das Kalkvorkommen ist wohl beim Bau des noch vorhandenen Mühlgraben aufgefunden worden. 6) Von diesem Kalkvorkommen waren keine Spuren mehr in der Landschaft sichtbar. Im Tal der Kleinen Striegis: 3) Der westlichste Zipfel des Hauptlagers als Fortsetzung am linken Ufer der kleinen Striegis in einem Nebental zeigte Spuren großer Halden und die Ruinen von zwei noch vorhandenen, kleineren Kalköfen! Dieses Vorkommen ist mit großer Sicherheit mittels Tiefbau abgebaut worden, da die Strukturen eines Tagebaues eher fehlen. 2) Die westlichste Ausdehnung des Hauptlagers reicht bis an das Bergehänge zur Striegis. Das Gelände ist durch große tagebauähnliche Steinbrüche und Pingen gezeichnet. 4) Der mittlere Bereich des Hauptlagers zeigt sich zum einen mit verfüllten Tagebau- und Bruchbereichen und zum anderen durch die offenen Zugänge zu den beiden Abbausohlen oberhalb der kleinen Striegis. Hier sind neben einem alten Ofenkomplex auch noch der zuletzt errichtetet neue Ofen als Fragment vorhanden. Es handelt sich hier um die Lokalität des Kalkwerkes von Barthel. 5) Der östliche Bereich des Hauptlagers ist durch sehr große übertägige Abbaue und einige verwischte Zugänge zu den tieferen Bausohlen gekennzeichnet; ferner existiert ein Stollnmundloch am Gehänge zur Aue der Großen Striegis. Hier lag das ehemalige Kalkwerk von Beyer und Hähner. 9) Im Bereich des Durchstichs für die ehemalige Bahnlinie Niederwiesa- Roßwein ist der geologische Nachweis für ein Kalkvorkommen erbracht worden und entsprechend im geologischen Kartenwerk vermerkt. Ein Abbau fand dort nicht statt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frühe
Nachrichten zum Kalkbergbau von Kaltofen- Berbersdorf (ab 1674)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interessant ist, daß die Kalkbrüche von Kaltofen- Berbersdorf nicht bei
Petrus Albinus in seiner „Meißnische Land- und Bergchronik“ von
1590 erwähnt werden. Auch sind die Brüche nicht bei Matthias Oeder
in der „1. Kursächsischen Landesaufnahme“ verzeichnet.
Als frühe Nachrichten können wir nur auf diverse Aktenbestände in den Sächsischen Staatsarchiven zurückgreifen. Der Zeitraum dieser Bestände beginnt dabei im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts. Wiederum handelt es sich bei den Akten größtenteils um Streitfälle und auch die Wiederaufnahme des Kalkbergbaus nach dem 30jährigen Krieg war von Streitereien begleitet. Die Wiederaufnahme des Kalkbergbaus in dieser Gegend ist der Stadt Freiberg geschuldet! 1674 ist als Jahr der Wiederaufnahme des Kalkbergbaus in hiesiger Gegend überliefert. In einem „Contract“ werden die genaueren Umstände geschildert: „Die vornehmste ursache und veranlassung zur Wiedererhebung dieses Kalkwergs bestand darinne, daß eintheils gemeine Stadt und Bürgerschaft, inmaßen an seiten der Churfürstlichen Sächsischen in des Raths Credit und Administrationssachen hoch verordneter Kommision zum öfteren erinnert worden, bei vorhabenden Stadt- und Privatgebäuden guthes tüchtigen Kalcks umb einen befindlichen und geringeren Preiß, als selbiger etwa von Lengefeld oder Pirna anzuschaffen, fähig gemacht; anderstheils aber das Churfürstliche Schmelzwesen durch erlangung besserer und tüchtiger Triebeasche von denen Seifensiedern, als welche zeithero nicht wenig über den Kalck geklaget haben, dadurch befördert, sowohl dem Landmanne in wiederanbauung derer Felder und wiesen gerathen werden möge.“ (Delater)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus
heutiger Sicht gab es im Freiberger Land nach dem 30jährigen Krieg große
Probleme beim Wiederaufbau der Städte und Dörfer durch großen Mangel an
Baumaterialien. Dies betraf nicht nur das Holz, sondern auch die
Zuschlagsstoffe für den Mörtel zum Bau fester Häuser im privaten und
weltlichen Bereich. Aber auch die Landwirtschaft, das Hüttenwesen und
kleine Handwerker benötigten Kalk oder Kalkasche.
Doch Kalk und Kalkasche waren nur von den zwei am nächsten liegenden, noch produzierenden Kalkwerksstandorten zu beziehen. Diese lagen im Raum Pirna und im oberen Gebirge um Lengefeld. Der weite Transportweg verteuerte natürlich den Preis und war sicher auch für Spekulationsgeschäfte gut! Kleinere Kalkgruben, wie bei Ottendorf unweit Mittweida oder bei Auerswalde, versorgten schon die dort liegenden Gemeinden und Städte. Es waren auch nur sehr kleine Kalkwerksstandorte. Aus diesem Grund lag eine Wiederaufnahme der Kalkbrüche um Kaltofen- Berbersdorf wohl nahe, zumal die Entfernung nach Freiberg wesentlich geringer war, als nach Pirna oder hinauf in das Gebirge nach Lengefeld oder auch nach Auerswalde westlich von Chemnitz. Also entstand 1674 eine Gewerkschaft oder Gesellschaft, die sich der Wiedererschließung der Brüche annahm und mit bedeutenden Persönlichkeiten besetzt war. Auch as den Beteiligten läßt sich die Wichtigkeit dieser Angelegenheit herauslesen: Die Nachfolgende Auflistung (Delater) kann uns den Personenkreis näher bringen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im
Frühjahr 1675 begann die Arbeit und bis September waren gut 150 Taler
verbaut worden. In der von Delater zitierten Akte heißt es weiter: „Auff
Beräumung des Bruchs, gewinnung des Kalcksteins und erbauung eines ganz
neuen offens auf vorige alte Rudera:“ Dies heißt natürlich, daß die
Kalkbrüche schon längere Zeit ohne Betrieb waren und es eine
prädestinierte Stelle einer Kalkofenruine für den Wiederanfang gab, welche
uns heute wohl bekannt ist. Zumal der Eigentümer des Grund- und Bodens der
Hüfner Barthel war. Damit kann man die Familie Barthel als
Kalkwerksunternehmer über einen Zeitraum von mindestens 226 Jahren
nachweisen!
Weiter heißt es in der von Cornelius Delates zitierten Akte: „bereits über 150 Thaler bahres geldes gewendet in Hoffnung, weil dergleichen Kalckbergwerg auffzurichten an sich selbst de genere permissorwa (Erzeugungserlaubnis - Anm. d. Red.) und nirgends verbothen, auch oben an diesem orthe schon vor alters her gewesen und solcher ganzen gegend nützlich und verträglich sey.“ Doch mit Aufnahme der Arbeiten begannen auch die Probleme. Was für die einen gut und recht erschien, war für andere nur ein rechtes Übel. So beschwerte sich der Landjägermeister des Erzgebirgischen Kreises, Georg Carl von Carlowitz auf Arnsdorf in einem Brief vom 11. September 1675 an den regierenden Kurfürsten Johann Georg, der Andere, über die Unternehmung. Er sah da die kurfürstliche Jagd gefährdet durch die Tag und Nacht lodernden Feuer in den Kalköfen und befürchtete, daß das Wild vertrieben würde. Daher hätten die Gewerken von ihrem Vorhaben so lange abzulassen, bis der Churfürst eine Entscheidung trifft. Carlowitz wurde in seiner Beschwerde noch von diversen Forstbediensteten und dem „Wildmeister von Siebenlehn“ unterstützt. Auch die Gewerken verfassten am 24. September 1675 einen Brief an selbigen Churfürsten und legten ihren Standpunkt dar: „…mit Bitte zur Genehmigung des Brennens von Kalckstein unterthänigst und gehorsamst, ihrem angeregten Berichte copram (an Ort und Stelle – Anm. d. Red.) wiederfahren zu lassen, mittlerer Zeit aber durch gnädigste Signatur oder Verordnung die Verlängerung zu thun, daß sie an vorhabender Anzündung und brennen eines ofenkalcks zur Probe nicht gehindert werden möchten.“ (Delater) Wie lange diese Streitereien währten, ist für uns nicht mehr genau nachvollziehbar. Der Churfürst muß jedoch seinen Segen erteilt haben und der Kalkbergbau kam wieder in ordentlichen Umgang. Mit der Familie Carlowitz gibt es noch einige Streitfälle zum Thema Kalkbergbau, die uns weitere Details aus dieser Zeit übermitteln. 1685 wurde am 29. September ein weiterer „Contract“ zum Abbau von Kalkstein vor dem Amtsgericht Nossen geschlossen. Diesmal stand ein Vertragsabschluß zwischen Hanns Carl von Carlowitz auf Arnsdorf als „Hochbestellter Vice Berghauptmann“ zusammen mit Baltzer Liebe, Martin Liebe und Jacob Gelbricht (des Schreibens nicht kundig, weshalb für ihn Baltzer Liebe unterschrieb) vor dem Gerichtsschöppen Baltzer Lehmann, zusammen mit weiteren Zeugen wie Christoph Lehmann als Zeuge für die stellvertretende Unterschriftsleistung, weitere Vertragszeugen wie George Lehmann, Peter Müller und wieder Christoph Lehmann im Amtsgericht Nossen. Sie vereinbarten die Erschließung eines weiteren Kalkbruches zu Kaltofen. Den hauptsächlichsten Vertragsinhalt wollen wir hier wieder als Auszug einfügen und so dieses Stück Bergbaugeschichte ein Stück näher bringen: „Wir Endesbenannte, für uns, und unsere Erben und Erbnehmer und mit Vollwort meines Schwagers, Martin Liebens, bekommen hiermit uhrkundten: Demnach auf unseren Güthern allhier, nachfolgende Gewerken, als der Hochwohlgeborene Herr Herr Hanns Carl von Carlowiz auf Arnsdorf, Churfürstliche Durchlaucht zu Sachßen Hochbestellter Vice Berghauptmann zu Freyberget, und Christoph Lehmann Richters daselbst, ingleichen Jacob Gelbricht und Baltzer Liebe, als Besitzer derselben Güther einen Versuch thun wollen, ob etwas von Kalck Steinen hinwiederum zu entblößen, und außer Zweifel ohne große Unkosten nicht abgehen dürften; Als reversiren und verpflichten wir uns hiermit und Kraft dieses nicht allein das Räumen und Einschlagen zu erstatten, sondern auch im Fall gedachten Herrn Berget Hauptmann und Gewerken, oder diejenigen, wenn Sie sich solches zueignen wollen, an Kalckstein oder dergleichen entweder entblößen oder beräumen möchten, Ihnen allso bald und jederzeit freystehen sollte, solchen auch soviel als Ihnen bleibet gewinnen und brennen zu lassen, einen bequemen Kalck Ofen und andere nöthige Gebäude, auf unsere Güther hierzu zubauen, solchen nebst nöthigen Wegen, Stegen und Plätzen, und was sonst dem anhängig darauf, ohne einzige unserer oder derer Unserrichen oder jemand andere Hinderniß und Wiederspruch, sich jederzeit geruhig zu gebrauchen, und aufs beste zunutzen; Hingegen soll für jedes und alles von einer Ruthe Kalcksteine 6 gl. ... die Besitzer der Güther, als wie endesbenannte gleichfalls unser ratum darzu geben, Bergkzinß von Ihn und anders nicht gewärtig seyn, und soll gemeßen werden, wie viel Ruthen das erstemahl an Kalcksteinen in Ofen gehet, und nicht wieder in Ruthen gesezet werden, Zu mehrer Uhrkundt haben wir diesen Contract und Revers in Beyseyn der Gerichten allhier gebührend vollzogen, und uns aller Exceptionen so uns hinwieder schützen können, Wießendt und wohlbedachtig begeben, und versprochen, das Churftl. Sächß. Löbliche Amts Noßen Consens zu verschaffen. Sigl. Kaldt Ofen den 29. Septbr.1685 …“ (20014, Nr. 1513)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrachten wir diesen Vertrag etwas genauer. Dieser räumt das unbegrenzte
Abbaurecht auf Kalkstein und dessen Verarbeitung für alle Beteiligten ein.
Dem Besitzer der Güter ist lediglich ein sogenannter Bruchzins zu zahlen,
der einmalig auf die erste Ofenbefüllung festgelegt wurde. Als Beteiligte
werden im „Contract“ keine direkten Namen genannt. Nur Titel –
Berghauptmann – und Gewerken. Hier liegt die Annahme nah, das man das
Vertragswerk als erblich ausführte und auch die Nachkommen sich daran
beteiligen konnten und sollten. Probleme und Streitereien entstanden wohl
bei Nichtbeteiligung oder Unlust, wie zum Beispiel seitens des Herrn
Berghauptmann von Carlowitz.
Doch schon 1695/96 gab es wieder Streit. Diesmal zwischen Hüfner Jacob Gelbrich und dem Herrn von Carlowitz. Der Hüfner Gelbrich hatte 1694 und 1695 Kalkstein auf eigene Rechnung abgebaut, gebrannt und anschließend verkauft, ohne Herrn von Carlowitz direkt zu beteiligen. Gelbrich hatte jedoch von seinen Aktivitäten umfangreiche Rechnungsunterlagen angelegt und diese wurden auch vom Verwalter und auch dem Advokaten von Carlowitz als richtig betrachtet und akzeptiert. Carlowitz forderte nur seinen Anteil am Gewinn aufgrund seiner vertraglichen Bindung – dem „Contract“ von 1685 – und monierte, daß er nicht gefragt worden sei, ob gebrannt wird oder nicht. Wohl interessierte sich dieser hohe Herr nicht mehr für die Unternehmung. Für die anderen Gewerken war aber der Weiterbetrieb der Kalkbrüche und Öfen eine Notwendigkeit. Deshalb kümmerten sie sich wenig um die Befindlichkeiten des hohen Herrn und bauten und brannten Kalkstein, so wie es erforderlich war. Dies führte natürlich zu großen Unmut seitens des adligen Herrn. Der Streit an sich ist für uns nur wenig interessant. Doch erscheinen in den Gerichtsakten sehr viele aufschlussreiche Details zum Kalkbergbau und diese wollen wir uns in einer Teilabschrift eines Briefes von Hannß Carl von Carlowitz genauer anschauen. „…und in seiner (Jacob Gelbrich) Schrift eingeräumet, daß er 2 Brände gethan, und daß mir, vermöge des Contracts die Helfte des Kalkbruchs und Ofens zustehe, er geständig, denselben ich doch auch zu brennen befugt seyn muß. So ist nach ausweiß beygefügter Rechnung, so Gelbricht meinen Verwalter heute übergeben, gedachter Gelbricht mir auch Rechnung zuthun, solche zuinstifiziren schuldig. Und weil er solche Rechnung nie eingehändigt, so fället ja alles sein nichtiges und unwahres ... hinweg, daß ich tacite` von Kalckofen nich loßgesaget, und was er an Unkosten, oder an Kalck gegeben gerechnet hat
Anno 1694 Von diesen Vier Offen Kalck sind ausgemessen
Unt am gelde
bekommen also 2. Theil 7 Thl. 12 gl. 5 pf. …“
Aus diesem Abschnitt können wir entnehmen, das „1 Brand“ aus 4 in Betrieb befindlichen Kalkkesseln besteht. Auffällig ist dabei, daß sich das Ausbringen an gebrannten Kalk vom 1. zum 4. Kessel sukzessive geringfügig reduziert. Dabei waren die Kessel sicher nicht gleichzeitig in Betrieb, sondern nacheinander, um so wiederum die Kosten für den anstehenden Brand im nächsten Kessel zu finanzieren und die nächsten Kessel auch ausräumen oder beschicken zu können. Damit war eine sukzessive Kalkproduktion möglich. Die Berechnung des gebrannten Kalkes erfolgte in Tonnen. Damit ist hier nicht die heutige, metrische Gewichtseinheit, sondern ein Raummaß gemeint, das in Sachsen mit einem Inhalt von 98,238 Liter definiert war, aber je nach Region auch sehr abweichen konnte. Zum besseren Verständnis verwenden wir das „offizielle“ Maß. Nunmehr können wir uns auch ein genaueres Bild von einem „Ofenbrand“ eines einzelnen Brennkessels machen. Damit erbrachte ein einzelner Brennkessel gut 30 m³ gebrannten Kalk. Doch beim Vermessen des Kalkes in Tonnen gibt es noch einen „Pferdefuß“! Wir wissen nicht genau, ob die Tonne als Raummaß gestrichen oder mit einer Aufhäufung versehen befüllt wurde. Schauen wir weiter im Brief von Carlowitz, im Weiteren sind einzelne Posten angegeben. „ …Einzelne Unkosten, so zum Kalckoffen angewendet 1694
Unter den üblichen Lohnkosten sind die einzelnen, für das Brennen erforderlichen Gewerke aufgeführt und auch der Bruchzins. Dieser ist immer gleich mit 1 Thl. und 2 gl. vermerkt. Laut Vertrag von 1684 sollte von jeder Ruthe Kalkstein 6 gl. an den Besitzer der Güter, auf denen der Brennofen steht, gezahlt werden. Demzufolge sind in jedem Brennkessel 5 Ruthen zu 54 Scheffel eingebracht und gebrannt worden. Dies läßt aber noch keine exakte Aussage über die Größe des Brennkessels zu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„Anno 1695 Ist zu Vier offen Kalck zu räumen, brechen und brennen an Unkosten aufgegangen, in allen, als
Hierzu ist Holz verbrennet
240 Klafter, jede zu 1 Thl.
444 Thl. 18 gl. Hiervon ist Kalck ausgemeßen worden als
oder gerechnet zu 9 gl. hat am Gelde 460 Thl. 3gl.
die Ausgaben sind 444 Thl. 18 gl. die Einnahme
460 Thl. 3 gl.
_________________________
15 Thl. 9 gl.
bekomme also 2. Theil 7 Thl. 9 gl. 6 pf. …“ (Bestand 20014, Nr. 1112)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterhin erfahren wir aus dem Brief von Carlowitz, daß der Kalkstein 1695 ausschließlich mit Holz gebrannt wurde und eine Menge von 240 Klaftern für 1 Brand (1 Klafter etwa 3 rm Holz – Anm. d. R.), also für den Betrieb aller 4 Kessel erforderlich war. Eine schon sehr beachtliche Menge Holz. Ab wann die heimische Steinkohle in Kaltofen zum Brennen des Kalkes mit verwendet wurde, ist momentan nicht genau bekannt. Der Kalkofen selber verfügte über 4 einzelne Brennkessel, wie in der Rechnung deutlich beschrieben steht: „Ist zu Vier offen Kalck zu räumen, brechen und brennen…“ Diese Ofenbauart ist auch als Bienenkorbofen in späteren Zeiten bekannt geworden. Das Ofenprinzip selber entspricht wohl einem sogenannten „Harzer Ofen“. Um 1710 gibt es wieder Streit und Ärger. Hans Carl von Carlowitz, mittlerweile Oberberghauptmann, untersagte George Gelbrich den Neubau eines Kalkofens auf seinen Gütern. Gelbrich wollte zusammen mit Martin Liebers, also dem Besitzer des benachbarten Kalkwerks, den dort gewonnenen Kalkstein mit in seinem neu zu errichtenden Ofen brennen und bildete daher eine „Consortschaft“ mit Baltzer Liebe und Baltzer Lehmann. Zumal die erforderlichen Kosten für einen Kalkbruchbetrieb mit Brennerei nicht unerheblich sind und besser gemeinsam aufgebracht werden können. Außerdem will die Consortschaft weitere Kalkbrüche einrichten und auch die zugehörigen Öfen erbauen. Wie der Konflikt endete, war aus den Akten nicht ersichtlich. Jedoch muß ein positiver Ausgang angenommen werden, da aus den Schriften der Sächsischen Landesuntersuchungskommission um 1800 allein vier Kalkbrüche bekannt waren. (Bestand 20014, Nr. 1112)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frühe
Nachrichten zum Kalkbergbau von Pappendorf- Höppericht (ab 1695)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es handelt sich hierbei um das Vorkommen im Epidot- Amphibolitschiefer, das wir schon im Abschnitt zur Geologie beschrieben haben. Es bildete auch den ersten Punkt, den wir im Rahmen unserer Exkursionen ein Augenschein genommen haben. Doch auch zur Montangeschichte sind in den Archiven einige interessante Details zu diesem Teil des Kalkvorkommens aufgetaucht. Erwähnung findet auch dieser Kalkbergbau wieder in diversen Streitfällen und daraus resultierenden Contracten. Dabei ist wieder recht auffällig, daß die Aufnahme des Kalkabbaus gegen Ende des 17. Jahrhunderts in derselben Zeit, wie bei den Kalkvorkommen von Kaltofen liegt. Vermutlich gab es zu dieser Zeit einen größeren Bedarf an Kalk in allen gesellschaftlichen Bereichen des Kurfürstentums Sachsen. Wir haben ja dazu oben schon berichtet und einen zeitgenössischen Bericht zitiert. Erstaunlicherweise ist zu diesem Kalkabbau sogar ein Riß angefertigt worden, was recht ungewöhnlich ist. Dieser Riß befindet sich inmitten der Akte 20014, Nr. 860 und stammt aus dem Jahr 1710. Die Einordnung der Darstellung war anfänglich nicht so einfach. Obwohl der Kalkabbau am Gehänge zur Großen Striegis liegt, ist diese weder im Riß eingezeichnet, noch im Begleittext auf dem Riß oder in der Akte erwähnt. Lediglich der Flurname „Höpperich“ war auf der geologischen Karte verzeichnet und im Begleittext zum Grubenriß fanden wir auch den Namen „Hörfrigksberge“, was nur eine andere Schreibweise war und sich wohl später zu „Höpperich“ gewandelt hat. Was dieser Flurname eigentlich ursprünglich bedeutete, konnten wir bisher noch nicht in Erfahrung bringen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doch fangen wir am Anfang an. Am 19. Mai 1695 erschienen im Amtsgericht Nossen Augustin Fromhold, Jacob Engelmann, Donat Folgner, Hannß Wolffen und Herr Adam Michael Opiz, um einen Vergleich mit Samuel Bartheln, Bauer zu Pappendorf, zu schließen. Barthel wollte auf seinem sogenannten Höprichtsberge einen Kalkbruch anlegen und brauchte hierzu Gesellschafter. Es sollte der Kalkbruch erschlossen und ein Kalkbrennofen gebaut und alles zu je 6 Teilen finanziert werden; es war also ein gesellschaftlicher Betrieb des Bruches vorgesehen. Der geschäftliche Betrieb ist durch eine Art „Satzung“ geregelt, die als separater Teil an den Vergleich mit angefügt wurde. Sie sah auch eine jährliche Hauptversammlung der Gewerken vor. Es gab einen Rechnungsführer, Jacob Engelmann, der dafür sorgte, daß alle Gewerken rechtzeitig und vollständig die Gelder für den Brand des Kalkes bei ihm einzahlten und somit die Grundlage für den Kauf des Brennmaterials, Bezahlung der Bau- und Fuhrlöhne und sonstiger Kosten legten. Für die Erschließung des Bruches und die Offenlegung des Kalksteins zahlte jeder Gewerke 5 Thaler und für den Ofenbau nochmals 15 Thaler in die gemeinschaftliche Kasse ein. Letztendlich wurde das Vorhaben umgesetzt und der Kalkbruch erschlossen und betrieben. (20014 Nr. 860 und 745) Die Verträge und Vergleiche sind für uns deshalb besonders Interessant, weil sie diverse Details zum Kalkbergbau enthalten. So geht auch hervor, daß bereits 1705 in Pappendorf am „Höpperich“ der Kalkstein mit Steinkohlen (!) gebrannt wurde und Holz nur zum Entfachen des Kohlefeuers diente. (20014 Nr. 1296) Die Frage ist nun: Wo kam diese Steinkohle her? Um 1705/06 ist durch den Freiberger Schichtmeister Daniel Flemming in Hainichen die erste Steinkohle gefördert worden. (Mühlmann) Sollte diese dann auch schon zum Kalkbrennen in Pappendorf Verwendung gefunden haben? Momentan sind diese Fragen nicht zu klären. Da Samuel Barthel um 1720 verstorben ist und sein Besitz an Herrn Christian Heinzen ‒ wohlverdienter Pachtinhaber ‒ aus dem Amt Mügeln verkauft. Heinzen, der das Gut von Barthel besaß, wollte auch gerne Teilhaber am Kalkbruch werden. Doch das ging nicht so einfach. Das Vorkaufs- oder Übernahmerecht besaßen die Gewerken und erst, wenn diese es ausschlugen, konnte eine Außenstehender oder „Fremder“ die Anteile erwerben. Heinzen überredete deshalb Augustin Fromhold, einen armen alten Mann, zum Verkauf seines 6. Teiles an dem gesellschaftlich geführten Kalkbruch. So war Heinzen nunmehr mit am Kalkgeschäft beteiligt. (20014 Nr. 860) Weitere Nachrichten zu diesem Kalkbruch sind nicht bekannt. Vermutlich ging auch der Abbaubetrieb weiter, denn es ist ein Grubenriß vom Kalkbruch am Höpperich überliefert, der weiteren abbauwürdigen Kalk darstellte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„Erklärung deren Littern (gemeint sind die Lettern = Buchstaben, Anm. d. Red.) Lit. A Dieser Bruch ist an vielen Orthen mit Schutte ausgefüllt. B Allhier findet sich noch geringer Kalckstein, C Hier sezet eine faule mächtige Kluft über, welche Ihr fallendes gegen Abend hat, D Allhier ist mit Consens des Grundherrens zu etlichen mahlen nach frischen Kalcksteine geschürffet, E Umb diese Gegend ist unter vorbesagter fauler Kluft wieder guter Kalckstein erschürffet worden, F Hier streichet wieder eine faule Kluft zu Tage aus, so den Kalckstein vertrücket G Herizo wird allhier guter Kalckstein gebrochen, H An dieser Klufft sezet der Kalckstein wieder ab, fällt selbiger gegen Abendmahl J Der Kalckofen. K Die Reinung von dem Heinzischen Guthe.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Textteil unter dem Riß hat folgenden Inhalt: „Grund=Riß, über einen Kalckbruch, welcher zu Pappendorf an Hörfrigksberge, sonst auf Samuel Barthels, anjezo aber auf Johann Christoph Heinzens Guthe gelegen ist. So auf Verlangen derer intressirenden Herrn Gewerken abgezogen worden, umb zu sehen was der Kalckstein vor streichens und fallens und ob selbiger in der Quere, Länge, Höhe und Tiefe wieder auszurichten sey. Ist demnach befunden worden, Daß besagter Kalckstein sey fallend Flözweise auf 25. gradt, von Mitternacht gegen Mittag hatt und also gar wohl in mehrer und größerer Teuffe und Länge, so ferne Er von den durchsezenden faulen Klüffften nicht verhindert wird, auszurichten sey. Die Quere belangent, so ist selbiger in so weit als sich dieses Feldt erstrecket, erschürffet und entblößet worden; Abgezogen den 13. Octb. Anno 1710. von Johann Heinrich Keyhler (?) Marckscheider“ Die Unterschrift des Markscheiders ist leider nicht einwandfrei zu deuten, was aber aus unserer Sicht nicht allzu schlimm erscheint. Dafür ist der Rest des Textes recht verständlich und bedarf keiner weiteren Erklärung, außer den Hinweis, daß man mit solch einem Rißwerk – was natürlich auch richtig Geld gekostet hat – einschließlich der Darstellung der geologischen Verhältnisse, eine Übersicht über den zukünftigen Abbau verschafft hat. Für den privaten sächsischen Kalkbergbau war diese kostenintensive Maßnahme eher eine Ausnahme und wird ihren Ursprung in einer gerichtlichen Auflage haben!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Kalkbergbau in der Zeit der Geologischen Landesuntersuchung um 1800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die 1786 vom Bergrat Abraham Gottlob Werner geforderte, genaue Untersuchung Sachsens und speziell der erzgebirgischen Lagerstätten wurde 1788 durch weitere Forderungen des Sächsischen Oberbergamtes endlich anberaumt und die Untersuchung noch auf sämtliche mineralische und fossile Rohstoffe ausgedehnt. In diesem Zusammenhang sind auch die Kalkvorkommen von Kaltofen- Berbersdorf dokumentiert worden. Um 1800 gab es in Kaltofen 4 in Betrieb stehende Kalkbrüche. Davon betrieb der Hüfner Gelbrig aus Kaltofen allein 3 Brüche. Den 4. Kalkbruch betrieb der Hüfner Barthel. Die Kalkbrüche wurden in der Landesuntersuchungsdokumentation in der Reihenfolge von Abend (West) nach Morgen (Ost) betrachtet. Dabei ist aber nur das Hauptlager am rechten Talgehänge untersucht worden. Daher ist die Fortsetzung des Kalklagers linksseitig der Kleinen Striegis und rechtsseitig an der Großen Striegis – die Nr. 3, Nr. 6 und Nr. 7 in unserer topografischen Karte – nicht berücksichtigt. Die genaue Formulierung lautete: „…an dem südlichen Abhange des kleinen Striegitzthals...“ Wir gehen davon aus, daß diese Kalklager außerhalb des Hauptlagers zwar noch bekannt waren, aber um 1800 nicht mehr in Betrieb standen und daher für die – ansonsten sehr genau arbeitende Landesuntersuchungs- Kommision – nicht mehr wichtig erschienen. Es könnte sich durchaus in diesem Fall um recht frühen Kalkbergbau handeln, der besonders bei Punkt 3 – der Fortsetzung des Hauptlagers auf der linken Seite der Kleinen Striegis – eine wissenschaftlich- archäologische Betrachtung verdienen würde, zumal noch Reste zweier Kalköfen an unterschiedlichen Standorten vorhanden sind. Der ganz westlich liegende, 1. Kalkbruch war zu Zeiten der Landesuntersuchung schon verbrochen und nicht mehr in Betrieb. Dieser Kalkbruch gehörte zu Hüfner Gelbrig. Heute sind hier noch einige Pingen am Gehänge zur Striegis und ein verfüllter Tagebau bzw. Steinbruch zu sehen. Der 2. Kalkbruch, ebenfalls vom Hüfner Gelbrig betrieben, stand durch unterirdischen Betrieb im Abbau. Das Kalklager hatte hier eine Mächtigkeit von 18 bis 20 Ellen und fiel mit 20° bis 25° nach Süd ein. Das Lager war durch einen saigeren Schacht erschlossen, der eine Teufe von gut einer Fahrt (12 Ellen = 6,87 m lang und hat 24 Sprossen – Anm. d. Red.) erreichte. Von diesem Schacht aus waren Abbauörter im Streichen gegen West und Ost des Lagers aufgefahren. Diese Abbauörter hatten „einige Lachter Weite“. Wir verlegen diesen Bruch in den Bereich des weit oberhalb der Restauration „Kalkbruch“ nach Westen gelegenen, heute gänzlich verfüllten Abbaufeldes. Im 3. Kalkbruch, der dem Hüfner Gelbrig gehörte, wurde der Kalkstein übertägig im Steinbruchbetrieb gewonnen. Auch hier läßt sich nur der Bruch im oben schon erwähnten Baufeld vermuten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der 4. Kalkbruch liegt in Richtung der östlichen Lagerstättengrenze zum Tal der Großen Striegis, grenzt an das spätere Kalkwerk Beyer in Berbersdorf und wurde vom Hüfner Barthel betrieben, dem der Bruch wohl auch gehörte. Der Abbaubetrieb ging hier unterirdisch vonstatten, jedoch sehr unregelmäßig. Aus heutiger Sicht hat Barthel wohl bevorzugt den weißen Kalkstein, der für Bauzwecke geeignet ist und somit den höchsten Gewinn beim Verkauf erzielt, abgebaut. In diesem Teil des Kalklagers ist der Kalkstein durch mit 50° bis 60° nach Norden fallende Klüfte gestört. Generell hat Barthel den anstehenden Kalkstein nach zwei Sorten unterschieden. Weißen Kalkstein für Bauzwecke und grauen Kalkstein als Düngekalk. Die als „weißer Kalkstein“ bezeichnete Qualität stand in der Sohle des Lagers als 3 bis 4 Ellen mächtige Schicht an. Dieser Kalkstein war von rauchgrauer und gelblichweißer Farbe und sehr feinkörnig bis „splittrig“ ausgebildet. Mit „splittrig“ war der Bruch des Gesteins gemeint. Der „graue Kalkstein“ war dagegen feinkörniger als der vorherige, wies jedoch ebenfalls einen „splittrigen“ Bruch auf. Dieses Gestein war dabei von dunkelgrauer Farbe, welche nur in den „Splittern“ in grauweiß oder gelblichweiß überging. Hier war auch etwas Schwefelkies eingesprengt. Generell wurde zu dieser Zeit der Kalkstein mit Berthelsdorfer Steinkohlen und etwas Holz gebrannt. Dabei wurden die Öfen sortenrein beschickt und Baukalk oder Düngekalk hergestellt. Je Scheffel gebrannten „weißen Kalkstein“ für Bauzwecke erzielte Barthel 16 gr während der Scheffel „grauen Kalkstein“, also der Düngekalk, nur 9 gr. einbrachte. (Bestand 40003 Nr. 09) Aufgrund der recht genauen Angaben in den Akten der Landesuntersuchung ist eine relativ gute Zuordnung der Brüche im Gelände möglich. Wobei dies selbstverständlich nicht zu 100% gelingt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interessant ist noch ein anderer Umstand. Die Betreiber werden als „Hüfner“ in den Unterlagen geführt und dies belegt den Umstand, daß diese Kalkbrüche auch im Besitz des Betreibers sind und nicht verpachtet waren. Hier liegt jetzt auch ein wichtiger Grund, warum bei der Recherche keine weiteren Akten der grundherrschaftlichen Verwaltung aufzufinden sind, da weder Verpachtungen, noch Verkäufe erfolgten und nur Streitfälle aufgezeichnet wurden. Weitere Recherchen erscheinen daher nahezu aussichtslos! Später erscheint zum Beispiel der Name Barthel – als Betreiber eines Kalkwerks – nur als Gutsbesitzer, was die vorherige Annahme wohl untermauert. Erfahrungsgemäß wäre im Falle einer Verpachtung dies auch in der Dokumentation der Landesuntersuchung- Kommission so erwähnt. Anm. d. Red.: Hüfner ist die andere Bezeichnung für einen Bauern, der mitsamt seiner Familie von der von ihm bewirtschafteten Nutzfläche auch leben konnte und eben die Stellung in der bäuerlichen Gesellschaft darstellte. Die „Hufe“ hatte als Flächenmaß in Sachsen eine Größe von 19,9 ha. 1780 sind während der Landesaufnahme des Kursächsischen Ingenieurkorps und 1835 erschienen „Oberreit'schen Atlas“ die Kalkbrüche als Kalköfen dargestellt. In der Sächsischen Kirchengalerie finden wir folgende Bemerkung: „Mehrere Begüterte besitzen in dem nach Arnsdorf zu gelegenen, schöne Ansichten darbietenden Thale bedeutende Kalkbrüche, die mit ihren weit ausgehauenen Höhlen, ihren rauchenden Oefen und dem regen Leben der Arbeitenden des Beschauens sehr wert sind.“ So kommen wir zum Schluß, daß anhand der angeführten Nachrichten aus der Zeit der beginnenden Industrialisierung der Kalkbergbau von Kaltofen- Berbersdorf damals eine Blütezeit erlebte und erst durch das Aufkommen des Eisenbahntransportwesens und den sukzessiven Streckenausbau nach 1860 ausgebremst wurde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link zum
Digitalisat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Kalkbergbau unter beginnender Bergaufsicht ab 1880
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der beginnenden Bergaufsicht für die Kalkwerke von Kaltofen- Berbersdorf zeigt sich wieder eine Verbindung zur Landesuntersuchung von 1800. Wieder werden 4 Kalkwerke erwähnt und in den Bergakten des Amtes geführt. Dennoch ist die Zuordnung der Kalkwerke nur in einem Fall auf den ersten Blick eindeutig. Bei tiefgreifender Beschäftigung kristallisieren sich anschließend nur noch 3 Kalkwerke heraus. Weiterhin werden die Begehungen und Kontrollen der Werke anfangs noch im Auftrag des Bergamtes durch die Kontrolleure der zuständigen Amtshauptmannschaft (AH Chemnitz, Berginspektoren) und erst später dann durch die Berginspektion III des Oberbergamtes in Freiberg durchgeführt und umfassend dokumentiert. Diese mitunter recht aufschlußreichen Dokumentationen dienen uns heute dazu, etwas Licht in das Dunkel der Montangeschichte zu bringen!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Kalkwerk von Wilhelm Hummitzsch in Kaltofen Dieses Kalkwerk gehörte wohl früher (um 1800) zum Besitz von Hüfner Gelbrig. Die genaue Lage ist momentan nicht bestimmbar. Vermutlich handelt es sich um den westlichen Teil des Kaltofener Kalksteinlagers. Es muß sich nach den Ausführungen in der Bergakte auch um einen unterirdischen Betrieb gehandelt haben. In den Bergakten taucht dieses Kalkwerk erst 1880 auf. Doch eine namentliche Benennung erfolgte schon früher. Überliefert ist für das Kalkwerk von Wilhelm Hummitzsch eine Kalkanalyse von 1867.
(aus Wunder/Herbrig/Eulitz)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Um 1880 ist der Hummitz‘sche Kalkbruch von einem Beamten der Amtshauptmannschaft Döbeln befahren worden und hat erhebliche Mängel festgestellt und mittels Frist auf deren Beseitigung gedrängt. Der Betriebsleiter des Werkes, Friedrich Ehregott Ketschke, nahm die vier Forderungen entgegen und wollte sich für deren Abstellung beim Werksbesitzer einsetzen. Festgestellt wurden:
Der Beamte schätzte den noch durchführbaren Abbaubetrieb aufgrund des sehr schwachen Kalksteinkörpers auf einen Zeitraum von maximal 1 bis 1 ½ Jahren ein. Der Eigentümer Wilhelm Hummitzsch entschloß sich deshalb, den Grubenbetrieb zum Januar 1881 einzustellen und teilte dies auch der Amtshauptmannschaft mit. Vermutlich hat Hummitzsch das Werk so wie es war, zu verkaufen versucht ohne irgendwelche Verwahrungs- oder Sicherungsarbeiten durchzuführen. (Bestand 40024-12, Nr.7)
Anmerkung: Die Familienname Hummitzsch ist uns als Guts- und
Kalkwerksbesitzer auch schon in Münchhof bei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses Kalkwerk ist zwischen 1881 und 1900 wohl in den Besitz von Gustav Schubert gekommen. Dieser betrieb um 1900 eine Wirtschaft in Nähe des Kalkbruches auf Kaltofen'er Flur und er beschwerte sich beim Bergamt, daß die Besucher seiner Wirtschaft immer in die „Grotten“ hinab stiegen. Diese Tagesöffnungen zu den Grubenbauen waren nur mit Barrieren abgesperrt. Als Antwort bekam Schubert die Auflage, die Zugänge mit einem hohen „Plankenzaun“ zu sichern und diesen auch instand zuhalten! Ob dies dann auch geschehen ist, wissen wir nicht. (Bestand 40024-12, Nr. 185)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Kalkwerke von Beyer und Hähner in Berbersdorf Aufgrund der Berichte der Amtshauptmannschaft und des Oberbergamtes konnten wichtige Details geordnet werden. Es handelte sich dabei um ein Kalkwerk, das in den 1880er Jahren des öfteren den Besitzer wechselte. Als Grund dieser Besitzerwechsel ist das nahezu vollständig abgebaute Vorkommen, die Auflagen der Behörden und die Hoffnung, noch einen Gewinn aus dem alten Werk zu schlagen, anzusehen. 1880 wird ein Kalkwerk des Herrn Beyer aus Berbersdorf erstmalig in den Bergakten mit einem Schacht für die Fahrung und zwei Tagesstrecken erwähnt. Wobei dieses Werk seit mindestens 1867 im Besitz von Beyer ist. Eine Analyse des Kalksteines ist überliefert.
(aus Wunder/Herbrig/Eulitz)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1882 verkauft Beyer das Werk an Rechtsanwalt Sieber aus Frankenberg
und Herrn Schuster aus Meerane. Aus diesem Jahr ist auch ein
Revisionsprotokoll des Beyer‘schen Kalkwerkes erhalten und wir wollen
seinen Inhalt wiedergeben.
Die Grubenbaue des Kalkwerkes besäßen eine hohe Festigkeit, sowohl hinsichtlich des Kalksteins als auch des Nebengesteines, was keine sonderlichen Ausbauten erforderlich mache. Die Weitungsbaue und die Sicherheitspfeiler seien in ordentlicher Dimension und Abstand und in gutem Zustand. Als Bausohle stehe die tiefste Sohle kurz über dem Niveau der Großen Striegis im Abbau. Alle oberen Bereiche waren bereits erschöpft. Die tiefe Abbausohle ist nicht mehr ohne Wasserhaltung weiter abbaubar, deshalb wurde das Kalkvorkommen hier auch als erschöpft bezeichnet. Aber es war auch Kritik in den Berichten vorhanden, die auf Mängel im Bereich der allgemeinen Sicherheit hindeuten. So gab es für das Mundloch der Tagesstrecke keine abschließbare Kaue, um den Zutritt von Unbefugten zu verhindern. Die im Fahr- und Förderschacht schräg eingestellten Fahrten waren nicht gesichert. Hier fehlten die Fahrtenhaspen. Auch der saigere Förderschacht besaß keine Kaue oder Absperrung und war ohne jeglichen Schachtverschluß für jedermann zugängig. Die Fahrtenbühnen im Schacht besaßen weder eine Vertonnung noch ein einfaches Geländer. Auch gab es kein Verbot für die Mannschaft, den Schacht während der Förderung zu befahren!! Die Abspreizung und Sicherung der Bruchkanten von der Fahrstrecke zum „alten Mann“ (abgeworfene Grubenbaue) war faul und „wandelbar“. Hier sollte eine trocken aufgesetzte Bruchsteinmauer in entsprechender Dimension Abhilfe schaffen. Auch Übertage sollten die Bereiche der alten Grubenbaue entsprechend sicher abgesperrt werden. Außerdem sollte von einem Markscheider ein Grubenriß nachgebracht werden, welcher angeblich schon 1860 gefertigt worden sei und momentan – 1882 – unauffindbar war! All diese Maßnahmen verursachten Kosten, die damals jeder Unternehmer scheute, weil die noch in Betrieb stehenden Kalkwerke aufgrund billiger Bahntransporte von Bau- und Düngekalk aus Böhmen oder Polen sonst schnell völlig unrentabel geworden wären. Zur Ausführung und Umsetzung der angedachten Auflagen ist nichts Näheres bekannt. Meistens umgingen die Alteigentümer solche Auflagen durch den Verkauf eines „intakten“ Werkes! Um 1884 verkauften Rechtsanwalt Sieber aus Frankenberg und Herr Schuster aus Meerane das Kalkwerk wieder. Von 1884 bis 1886 war das Werk im Besitz einer Gesellschaft Kolbe, Auerbach und Hingst. Im Jahre 1899 erwarb dann ein Herr Wätzig das Werk und verkaufte es wohl sogleich wieder. (Bestand 11384 Nr. 2081) Anmerkung: Der Familienname Wätzig
ist uns auch als Kalkwerksbesitzer in
Später um 1899 erwarb der Holzhändler August Hähner das Kalkwerk und verpachtete es weiter. (Bestand 40024-12, Nr. 035)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pächter und Betreiber des Werkes um 1899 ist der jetzt als Steinbrecher
benannte August Bernhardt aus Berbersdorf. August Bernhardt war
schon beim früheren Besitzer des Kalkwerkes, dem Herrn Beyer, als Steiger
und Grubenaufseher beschäftigt. Als jetziger Eigentümer des Kalkwerkes
wird der Holzhändler August Hähner aus Berbersdorf genannt. Das schon eine
Weile nicht mehr im Betrieb befindliche Kalkwerk wurde durch den Beamten
der Berginspektion
III
des Oberbergamtes im August 1899 in einem Bericht dargestellt, welchen wir
hier nur inhaltlich wiedergeben möchten.
Der Gewinnungsbetrieb war seit 1888 eingestellt. Die Einstellung des Betriebes erfolgte, weil die Grubenbaue wegen ungeeigneter Wasserhebungseinrichtungen abgesoffen und die oberen Bereiche Kalklagers hier schon abgebaut waren. Ein unterhalb des neuen Kalkofens liegender Entwässerungsstolln war verbrochen und nicht mehr wasserwegsam. Unweit des neuen Kalkofen befand sich ein offener Schacht von gut 15 m Teufe, welcher nur teilweise eingezäunt war. In unmittelbarer Nähe lag noch ein offenes Tagesfallort mit schwachen Wetterzug, das früher der Fahrung und Förderung mittels Haspel diente und mit einem Bretterverschlag versehen war. Die Gichtbühne des neuen Kalkofens wurde von der im Huthaus wohnenden Familie als Lagerplatz für alles Mögliche genutzt. Die Befüllöffnung des Kalkofens in 5 m Höhe auf der Gichtbühne war nur „trügerich“ mit Latten und Reisig abgedeckt und die Gichtbühne besaß kein Geländer. Der Beamte veranlaßte natürlich für den Eigentümer entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung der Mißstände. Ob diese danach auch bereinigt worden, ist nicht mehr vermerkt. Auch ist dieses Kalkwerk nicht mehr in Betrieb gegangen. 1901 erfolgte der Verkauf des ehemaligen Kalkwerkes von August Hähner an den Steinbrecher August Bernhardt. Der neue Besitzer führte weiterhin Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten auf eigene Rechnung durch, was sich im Fahrbericht des Bergbeamten 1902 wiederfindet. So hat Bernhardt etliche Pingen eingeebnet und den Förderschacht teilweise verfüllt. Zur Lage des Kalkwerkes haben wir aus den Berichten der Berginspektion einige Hinweise herauslesen können. Zumal die Rede von Berbersdorf als Ortsangabe mehrfach erscheint, ist es naheliegend, daß es sich hier um den östlichsten Bereich des Kalkvorkommens zum Tal der Großen Striegis gehandelt hat und der in unserer Topografischen Karte mit Nr. 5 versehen ist. Dieses Areal ist heute wieder mit neuen Wohnhäusern bebaut und recht markant in der Aue der Großen Striegis ist eine alte Wassernutzung sichtbar, welche das Mundloch des früheren Kalkwerksstollns gewesen ist. (Bestand 40024-12, Nr. 035)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Kalkwerk der Hüfner- und Gutsbesitzerfamilie Barthel in Kaltofen
Beim Sichten der Archivalien wurde deutlich, das der Name Barthel von etwa 1800 an (Bestand 40003 Nr. 09) bis zum Jahr 1902 (40024-12 Nr. 186) mit der Kalkgewinnung eng verbunden ist und wohl als eine Art Familienbetrieb betrachtet werden kann. In der Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert besuchte im November 1880 erstmals ein Beamter der Amtshauptmannschaft Chemnitz, Berginspektor Schultze, das Kalkwerk von Karl Friedrich Louis Barthel in Kaltofen und fertigt einen kurzen Bericht an. Demnach hatte Barthel den Kalksteinabbau über den Stollnbetrieb aufgegeben, einen alten Schacht wieder aufgewältigt und mit Zimmerung und Fahrung versehen. Über diesen Schacht lief die vollständige Förderung des Werkes. Als Mangel bemerkte Inspektor Schultze das Fehlen eines 2. Fluchtweges. Barthel vermeldete im Dezember 1880 die Fertigstellung eines 2. Fluchtweges für die Belegschaft der Grube. Im Januar 1882 befuhr Berginspektor Böhmer von der Amtshauptmannschaft Chemnitz die Grube und befand das Berggebäude mit allen Einrichtungen nebst der Tagesöffnungen in einem „guten Zustand“. Solch eine Beurteilung war für private sächsische Kalkwerke schon ziemlich selten!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In
einem Bericht vom 21. November 1886 werden wieder einige Details der
Kalkgrube von Barthel bekannt. So hatte der in Betrieb befindliche Fahr-
und Förderschacht eine Dimension von 1 m x 2,4 m bei einer Teufe von 28 m,
war von Tage herein in Zimmerung gesetzt und steht dann weiter im festen
Gestein. Die Kammerpfeiler der Weitungsbaue hatten eine Dimension von 4 m
x 4 m und die freie Abbaufläche im Geviert von 4 m bis 5 m bei gut 3,5 m
bis 4,0 m in der Höhe. Die Gewinnung des Kalksteins erfolgte durch Bohren
und Schießen mit Schwarzpulver.
Der Transport des Kalksteins erfolgte auf den Strecken mittels Radkarren und über den Förderschacht mit einem Handhaspel. Derzeit gehe der Abbau unmittelbar über der Wassersohle (Niveau der Kleinen Striegis) um, welcher durch 20 m langen Querschlag vom Fahr- und Förderschacht aus erreichbar ist, um. Doch der Abbaubetrieb war hier nur noch bedingt möglich, da die Abbausohle schon im Grundwasserwechselbereich lag und nur jahreszeitabhängig nutzbar gewesen ist. Die Grube war mit 4 Arbeitern und einem Steiger belegt. Der Steiger Karl Friedrich Reissig, nunmehr schon 68 Jahre alt, wohnte in Kaltofen und arbeitete schon seit 1866 auf dem Werk von Barthel. Zuvor war er 8 Jahre auf einem Kalkbruch von Gelbrig tätig. 1893 wird letztmalig seitens der Amtshauptmannschaft Chemnitz von einem Grubenbetrieb im Kalkwerk von Louis Barthel berichtet. Der Abbaubetrieb bewegte sich mittlerweile nur noch in oberen Bausohlen im Bereich von Kalksteinresten. Der Kalkstein selber war hier als linsenförmige Einlagerung im Glimmerschiefer ausgebildet und keilte auch aus. Eine Erweiterung der Kalksteingewinnung war nur durch Tiefbau mit Wasserhaltung oder durch eine neue, tiefe Tagesstrecke von der Striegis her möglich. Außerdem wurde die Erstellung eines Grubenrisses dringend angemahnt, da sich die jetzigen Abbauörter in der Nähe der Tagesoberfläche und dem „alten Mann“, abgeworfenen alten Abbaubereichen, lägen. Das benötigte Pulver für die Bohr- und Schießarbeit wurde in einer maximal genejmigten Menge von 50 kg in einem verschließbaren Schuppen in einem alten Tagebruch verwahrt und durch Steiger Reissig tagtäglich in der benötigten Menge an die Arbeiter ausgereicht. Um 1896/97 kommt die Kalkgewinnung gänzlich zum Stillstand. Das über Grundwasserniveau erreichbare Kalkvorkommen ist im Bereich des Kalkwerkes von Louis Barthel vollständig abgebaut. Aufgrund der Preisentwicklung auf dem Bau- und Düngekalkmarkt durch preiswerte Einfuhren mittels Eisenbahn aus Böhmen und Polen lohnten sich keine neuen Investitionen in die hiesige Grube mehr. Damit endeten mehrere hundert Jahre Kalkbergbau im Striegistal!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doch die Geschichte ging noch weiter.
Da der Grubenbetrieb eingestellt ist und auch nicht wieder ohne Weiteres wieder in Umgang kommt, wies das Oberbergamt die Verwahrung der Schächte und Tagesöffnungen an. Eine durchaus auch damals schon übliche Auflage an Bergbautreibende, auch heutzutage. Barthel hing wohl mental an dem Kalkwerk, wollte dieses auch nicht verkaufen und beginnt mit der Verwahrung der Grube auf eigene Kosten. Barthel ließ den tiefen Förderschacht in 3 m Teufe unter Rasen mit einem Ziegelbogen verschließen. Alle anderen Schächte sind mit Haldenmaterial ausgestürzt worden. All diese Arbeiten hat Barthel mit seinen 4 Arbeitern verrichtet und im Dezember 1901 dem Bergamt bei dessen Begehung gezeigt. Im August 1902 verkauft Louis Barthel letztendlich das Kalkwerk an seinen Schwiegersohn Paul Otto Roßberg. Der neue Besitzer wollte das Kalkwerk wieder in Betrieb nehmen, dazu einen neuen Stolln von der Kleinen Striegis aus in Richtung des verwölbten Fahr- und Förderschachtes treiben und von dort die in der Sohle noch anstehenden Kalksteinvorräte abbauen. Hierzu fertigt Roßberg einen Betriebsplan, der vom Oberbergamt allerdings abgelehnt wird, weil dieser erhebliche Fehler enthielt. Nach längeren Hin und Her mit diversen Briefwechsel erhielt Roßberg die Genehmigung für die Anlage des Stollns unter Auflagen. Der frühere Steiger Reissig übernahm dabei die Betriebsleitung des Vorhabens. Im März 1903 wurde der Schurf für das Mundloch angelegt und nach 5 Tagen das Gebirge erreicht. An diesem Punkt machte Roßberg aufgrund von erheblichen Zweifeln einen Rückzieher und beendete das Projekt der Wiederinbetriebnahme der Kalkgrube. Irgendwann verkaufte Roßberg das Anwesen mit der alten Kalkgrube.
Anmerkung: Auch der Familienname Roßberg ist uns als Guts- und
Kalkwerksbesitzer schon in Münchhof bei
Im Mai 1919 taucht wieder ein Versuch zur Wiederaufnahme des Kalkbergbaus in den Akten auf. Der Besitzer der Watte- und Kunstbaumwollefabrik in Kaltofen bei Hainichen, Oscar Drope, wollte das Kalklager zusammen mit dem derzeitigen Besitzer des Kalkwerkes, Otto Meyer, sowie weiteren Beteiligten, wie Arthur Walther und Bruno Junghans mittels Pachtvertrag über 30 Jahre an ein „Dresdner Consortium“ von Interessenten verpachten. Der hier genannte Herr Otto Meyer war auch der Betreiber der Gastwirtschaft „Kalkbruch“. (40024-12, Nr. 186)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Kalkgewinnung in der Lagerstätte Kaltofen-
Berbersdorf
Abbau und Förderung des Rohkalksteins
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses Thema spiegelt eine Entwicklung wider, an der die Industrielle
Revolution des 19. Jahrhunderts vollkommen und wohl unbemerkt vorbei
gegangen ist. Die „mittelalterlichen“ Produktionsweisen sind in diesem
Bergbaugebiet bis zum Schluß erhalten geblieben. Man könnte auch aus
heutiger Sicht von einem „produktiven Museum“ sprechen!
Der untertägige Kalksteinabbau folgte in Berbersdorf wohl eher der jeweiligen Lagerschicht des Kalksteins als einer bergautechnologischen Denkweise. Wo Kalkstein anstand, wurde dieser abgebaut. Eine Unterscheidung erfolgte nur in den Kalksteinqualitäten, wie das schon die Landesuntersuchungs- Kommision in ihren Akten bemerkt hat. Sicherheitspfeiler in den Weitungsbauen waren vorhanden, auch ordentlich dimensioniert und gaben keinen Anlaß zur Kritik bei einsetzender Bergaufsicht. Dennoch kann der Abbau dort bis auf einige Ausnahmen als eher „recht wild“ eingeordnet werden. Zu Bruch gegangene Wasserlösestolln, wie bei Barthel und auch bei Beyer, sind dafür genauso Anzeichen wie auch das völlige Fehlen von Rißwerk zur Darstellung der Grubenbaue. Seit der Einführung des Schießens mit Sprengpulver im sächsischen Bergbau fand diese Gewinnungsmethode auch auf den Kalksteingruben bald Anwendung. Deshalb nehmen wir auch für Kaltofen- Berbersdorf das 18. Jahrhundert als Beginn der Anwendung von Bohren und Schießen als Gewinnungstechnologie an, ohne einen Beleg für den genauen Beginn aufgefunden zu haben. Das Schwarzpulver blieb aber hier bis in das beginnende 20. Jahrhundert unverändert als „Sprengstoff“ in Verwendung. Versuche zur Einführung damals weit verbreiteter und effektiverer Chloratsprengstoffe oder gar Dynamit sind nie unternommen worden. Ebenso ist das Setzen der Bohrlöcher bis zum Schluß von Hand erfolgt. Versuche zur Nutzung von Bohrmaschinen sind hier nicht bekannt. Wie die Gewinnung, so erscheint auch die Förderung eher von mittelalterlichen Charakter geprägt. Über den Einsatz von maschinengetriebenen Fördereinrichtungen sind keine Hinweise bekannt oder überliefert. Die Kalk- und Bergeförderung auf den Schächten erfolgte ausschließlich mittels Handhaspeln. Ob diese Handhaspeln wenigstens ein Vorgelege zur Erleichterung der Muskelarbeit des Bergmanns besaßen, ist in den erhaltenen Archivalien nicht angegeben. Man kann da wohl annehmen, daß die schon von Georg Agricola beschriebenen Konstruktionen einer Handhaspel hier das modernste technische Niveau der Fördereinrichtungen darstellte. Die horizontale Förderung ist durch den Einsatz von Schubkarren geprägt. Die Anlage von einer effektiveren gleisgebundenen Förderung auf den „Hauptstrecken“ ist ebenfalls nicht erfolgt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ebenso ist zu einer maschinellen Aufbereitung des Kalksteins keine Angabe
vorhanden. Aufgrund der Art der eingesetzten Kalköfen war eine
Verarbeitung unterschiedlich großer Stücke möglich. Jedoch ist aufgrund
der Handhaspelförderung sowieso nur eine in den Kübel passende Korngröße
des Kalksteins förderbar gewesen und somit die Zerkleinerung und Selektion
schon untertage erfolgt. Auch diese Arbeit ist von Hand mittels schwerer
Hämmer oder auch bei sehr großen Brocken durch Schießarbeit bewerkstelligt
worden.
Die Wasserhaltung wurde durch Handpumpen betätigt. Solche Wasserhaltungsarbeiten waren in diesem Bergbaugebiet zumindest auf Sohle der beiden Striegis- Flüsse oder auf einzelnen Gesenken oder tief liegenden Lagerschichten erforderlich und wurden natürlich auch angewandt. Ein Einsatz von Wasserkraft für einen Pumpenbetrieb für tiefer liegende Abbaubereiche wurde dagegen nie angestrebt. Zu Verunfallungen der Bergarbeiter gibt es keine Angaben oder Hinweise in den Archivalien der Bergaufsicht, was eher etwas verwunderlich ist, da dies immer der Auslöser für amtliche Überwachung und Untersuchungen war. Eine Sichtung der Kirchenbücher ist unsererseits aufgrund des Mangels an Zeit allerdings noch nicht erfolgt. Die allgemeinen Sicherheitseinrichtungen auf den Kalkwerken waren nur sehr notdürftig ausgebildet, was von den Bergbeamten sehr ausführlich mit Kritik versehen und eine terminliche Abstellung derselben dringend angeraten wurde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Brennen
des Kalksteins
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
wohl wichtigste und teuerste Teil bei der Kalkgewinnung war früher das
energieaufwendige Brennen des Kalksteins, also die Erzeugung von mit
Wasser löschbaren Kalk für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke.
Heutzutage ist dagegen die Renaturierung der übertägigen Abbauflächen und
der Rückbau und die Verwahrung einer untertägig betriebenen Kalkgrube
mitunter der größte Kostenfaktor, neben der eigentlichen Gewinnungs- und
Aufbereitungsarbeit allgemein. Ein Punkt, über den sich unsere Vorfahren
nur in sehr seltenen Ausnahmen Gedanken gemacht haben.
Wie wir schon aus den vorherigen Abschnitten erfahren haben, ist bei Wiederinbetriebnahme der Kalkgewinnung 1674 in Kaltofen das Kalkbrennen mit Holz erfolgt. Die erforderlichen Mengen dieses Brennstoffs waren auf keinen Fall unerheblich und vor allem Kostenintensiv! Hinzu kam noch die Größe der Brennöfen. Für den Betrieb eines Kalkbrennofens mit vier Brennkesseln, wo je Kessel etwa 30 m³ Kalk gebrannt werden konnten, wurden 240 Klafter Holz benötigt. Eine aus heutiger Sicht wirklich sehr große Menge Holz! Die Größe der Öfen war wohl dem Kalkbedarf der Gesellschaft in dieser Zeit und dem verfügbaren Brennmaterial Holz geschuldet. Dieser Umstand beflügelte die Betreiber der Brüche und Öfen, auch nach alternativen Brennstoffen zu suchen und diese auch zu nutzen.
Holz war über Jahrhunderte der üblichste Baustoff für die Häuser und auch
Brennstoff zugleich. Die Knappheit des Holzes und das Fehlen eines
effektiven Brennstoffes für Hausbrand und Wirtschaft in großen Mengen
veranlaßte den Sächsischen Staat schon 1743 zu einem ersten
Kohle, besonders Braunkohle, war aber damals nur in Notzeiten als Brennstoff interessant und deren Gewinnung wurde zum Teil bis in das 20. Jahrhundert eher als „Notzeitbergbau“ angesehen. Doch war die Verwendung von Stein- und Braunkohle als Brennstoff für die verschiedensten Nutzungen schon lange bekannt, erforderte aber gewisse technische Voraussetzungen für den Abbrand in den Öfen, wie luftdurchlässige Roste aus massivem Eisen oder sogar Gußeisen. Diese Voraussetzungen waren aber nicht immer gegeben, da Holz als Brennstoff bevorzugt blieb. Erst nach und nach setzten sich solche Öfen für den Hausbrand gegenüber den gemauerten Holzöfen ohne Brennrost durch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
früheste Nachricht über den Einsatz von Steinkohle zum Brennen des Kalkes
ist für Pappendorf für das Jahr 1705 in Akten des StA Leipzig belegbar.
Jedoch können wir aus heutiger Sicht nur mutmaßen, wo die Kohle dazu
herkam. Für Hainichen gibt es einen ersten Beleg für das Jahr 1705. Das
wäre auch aufgrund der Entfernung möglich ‒ und erschwinglich ‒ gewesen.
(Mühlmann)
Aber auch Flöha käme in Betracht. Denn ab 1700 sind auch hier Mutungen für Kohlegruben beim Oberbergamt in Freiberg eingelegt worden. (Kleinstäuber) Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß die Kohle schon lange vor 1700 von den Grundbesitzern genutzt und auch verhandelt wurde. Verbrieft ist der Einsatz der Steinkohle zum Brennen des Kalksteins erst durch den Bericht der Landesuntersuchungs- Kommission und damit für das Jahr 1800. Der genaue Beginn einer dauerhaften Nutzung von Kohle zum Kalkbrennen im Raum Kaltofen- Berbersdorf ist somit nicht genau belegbar. Fest steht jedoch, daß mit dem Aufkommen des Steinkohlenabbaus von Hainichen und Flöha eine Nutzung dieses Brennstoffes durch die Kalkwerksbetreiber auch in dieser Region einher ging. Gebraucht und verwendet wurde dafür minderwertige, harte und schwefelreiche Kohle der geringsten Qualität. Diese oft auch als „Kalkkohle“ bezeichnete Steinkohle brennt ohne große Flamme, sie glimmt mehr, qualmt recht stark, ist aber langaushaltend in der Glut und erzeugt daher dennoch eine große Hitze, wie sie für das Brennen von Kalkstein benötigt wird. (Kleinstäuber)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Brennöfen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im
Arbeitsgebiet sind noch mehr oder weniger gut erhaltene Reste von sieben
Kalkbrennöfen erhalten oder zumindest in rudimentären Elementen erkennbar.
Dabei handelt es sich in fünf Fällen um Ofenanlagen, die wohl schon im 19. Jahrhundert vor Beendigung der Kalkgewinnung außer Dienst gestellt und dem Verfall überlassen wurden. Genauer betrachtet befinden sich bei der „Waldgaststätte Kalkbrüche“ zwei Befunde als Komplex und der Rest eines Schneller- Ofens, auf Arnsdorfer Flur zwei einzelne Ofenbefunde, ein weiterer einzelner Ofenbefund an der Großen Striegis bei Pappendorf am Höpperich und vermutlich zwei weitere einzelne Öfen bei Berbersdorf auf dem Gelände vom ehemaligen Kalkwerk Beyer.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ofenanlage unweit des „Waldhaus Kalkbrüche“ in Kaltofen
Unweit der heutigen Gaststätte „Waldhaus Kalkbrüche“ im früheren Kalkbrennerhaus des Kalkwerkes Barthel liegen die Reste einer Ofenanlage. Markant ist dabei, daß es sich bei dieser Anlage um nebeneinander stehende, einzelne Kesselöfen in zwei Größen handelt! Der um 1674 aufgebaute Brennofen mit 4 Kesseln ist nicht mehr erhalten bzw. sein Standort nicht mehr eindeutig nachweisbar. Vermutlich stand dieser an derselben Stelle, wo heute die Reste dieser zwei Öfen sichtbar sind. Die Größe der Kalkbrennöfen war immer dem Kalkbedarf der Region und auch dem möglichen Brennstoffeinsatz geschuldet und angepaßt. Es waren ja in Sachsen im aufkommenden Industriezeitalter sehr viele Kalkgruben in Betrieb und teilten sich die regionalen Absatzmärkte ihrer Produkte auf. Dabei spielte sicher auch der in der Region vorhandene Brennstoff – hier war es die Steinkohle aus der Umgebung von Hainichen und später auch Braunkohle aus der Gegend von Mittweida – eine wichtige Rolle für die Größe der Öfen. Ebenso setzte die Landwirtschaft Aspekte für den Kalkbedarf. Sie bildete einen der wichtigsten Abnehmer, bestimmte damit die Zeitpunkte für die einzelnen Ofenbrände im Betriebsjahr eines Kalkwerkes und wohl auch die Größe der Brennöfen mit. Für den Betreiber eines Kalkbrennofens – hier waren es selbst auch Hüfner – war auch der Aufwand für Errichtung und Unterhaltung, sowie Betrieb ein wichtiger Aspekt. Zum anderen gab es hier eine über etliche Generationen hinweg vererbte Kalkbrennertätigkeit. Auch die Brenntechnologie des Kalkes wurde von Generation zu Generation weiter gegeben und kann als fest manifestiert betrachtet werden. Modernere Ofenkonzepte erforderten den Neubau von Brennöfen, die sich aber diese Kleinunternehmer nur in Ausnahmefällen überhaupt leisten konnten. Der Erhalt eines alten Kalkbrennofen war für diese Kalkwerksbetreiber dagegen bei Weitem kostengünstiger, als ein Neubau! Aus diesem Grund waren nicht immer die hocheffizienten Brennofentechnologien – kontinuierliche Brennöfen – erforderlich, sondern althergebrachte Ofenkonzepte – periodische Öfen – blieben mitunter sinnvoller für den Betreiber. Wir denken, daß eine solche Situation am Beispiel der Lagerstätte Kaltofen-Berbersdorf vorliegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
hier nahe dem Waldhaus erhaltene Ofenkomplex ist vollkommen mit
Haldenmaterial ummantelt. Ob sie früher auch eine Einfassung mit
Bruchsteinmauern besaß, ist nicht mehr nachvollziehbar, aber auch nicht
ausgeschlossen. Zur Ofengicht hinauf führte eine flache Rampe.
Die Ummantelung des Ofenkomplexes spricht jedenfalls für einen nur halb über der Erde errichteten Erdofen und ersparte die aufwendige Einmauerung der Kessel. Es ist sicherlich die einfachste Ofenbauart. Heute sind auch die eigentlichen Brennkessel weitgehend mit Haldenmaterial verfüllt. Dieser Umstand trägt momentan zur Erhaltung der Reste des Ofenkomplexes aus denkmalpflegerischer Sicht für die Zukunft bei. Allerdings ist die Zerstörung durch den Wurzeldruck der aufwachsenden Gehölze langfristig fast unvermeidlich. Freigelegt sind bei den beiden Öfen nur die seitlichen Gewölbe für die Brandregulierung unter dem Brennkessel. Bei dem größeren Ofen ist auch die Verfüllung des Brennkessels etwas abgerutscht und man kann den Querschnitt des Brennkessels recht gut sehen. Dabei ist bei diesem größeren Ofen der Brennkessel nicht zylinderförmig ausgebildet, sondern rechteckig. Dies weist auch auf eine recht alte und einfache Ofenbauart hin. Für den kleineren Ofen läßt sich ebenfalls eine viereckige Bauart des Brennkessels erkennen. Beide Öfen haben je zwei aus Bruchstein gesetzte Gewölbeöffnungen als Zugang zum Brennkessel. Errichtet sind die beiden Brennöfen vollständig aus Bruchsteinen. Eine Ausmauerung des Ofeninneren mittels feuerfester Ziegel oder ähnlichem Material ist nicht erkennbar und mit Sicherheit nie vorhanden gewesen. Die Brennkessel besitzen keine Roste, zumindest sind diese nicht mehr sichtbar. Wahrscheinlich waren auch früher keine eisernen Roste vorhanden, da dann entsprechende Auflager vorhanden sein müßten. Am Brennkessel des kleineren Ofens sind allerdings mittels Ziegel keilförmige Abzüge gemauert worden, was recht ungewöhnlich erscheint. Dabei sind die Ziegel auf einer eingelegten Betonplatte pyramidenartig aufgerichtet und bilden nach den beiden Seiten der Ofengewölbe eine Art schrägen Rost. Vermutlich liegt hier ein Umbau vor, der dem Prinzip eines kontinuierlichen Schneller- Ofens nahe kommt und wohl auch so betrieben wurde. Zumindest läßt sich dieser Befund so deuten. Barthel hatte ja noch kurz vor Betriebseinstellung einen Schneller- Ofen gegenüber dem Brennmeisterhaus errichtet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere
Rekonstruktion der
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
Grundmaße der viereckigen Brennkessel betragen beim größeren Ofen gut 3 m
x 3 m und beim kleineren Ofen noch immerhin 1,5 m x 1,5 m. Die heutige
Höhe ist wohl einem teilweisen Abriß der Brennkessel geschuldet und
beträgt noch gut 2 m. Zu Betriebszeiten sind sicher eine Höhe von 3 m bis
4 m möglich gewesen.
Das Fassungsvermögen des Brennkessels würde bei dieser angenommenen Höhe daher beim kleineren Ofen bis 9 m³ und beim größeren Ofen um die 27 m³ betragen. Man könnte das Fassungsvermögen auch mit fast 1 Ruthe für den kleineren und mit 3 bis 4 Ruthen für den größeren Ofen angeben. Dabei sind die abgenommenen Maße freilich eher Schätzungen, da aufgrund der Situation keine genaueren Daten ohne substanzschädliche Freilegungen möglich sind. Auch ist hier natürlich die Menge der Brennstoffe nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, daß beide Öfen eher deutlich weniger Kalkstein gefaßt haben. Anmerkung: 1 Ruthe Kalkstein wurde (aber nur auf den fiskalischen Kalkwerken) um die Mitte des 19. Jahrhunderts einheitlich zu 54 Kubikellen = 9.811,1 dm³ = 9,811 m³ berechnet. Dies sind alles Merkmale, die zur Bestimmung des Ofentyps herangezogen werden können. Da in den Gewölberäumen der beiden Öfen weder Brand- noch Rauchspuren zu finden sind, handelt es sich dabei mit großer Sicherheit nicht um Feuerungsgewölbe, sondern vielmehr um Öffnungen zur Regelung des Luftzuges für den gesamten Brennvorgang.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aufgrund des Befundes am kleineren Ofen kann hier auch von einem Kalk- und Ascheabzug gesprochen werden. Vermutlich wurde dieser Ofen wohl als Schneller- Ofen umgebaut und versuchsweise betrieben. Demnach handelt es sich bei dem größeren Ofen um einen sogenannten „Harzer Ofen“ der ältesten Bauart und nicht um einen moderneren und effektiveren „Schnellerofen“. Ein solcher wird im Jahr 1867 für Kaltofen- Berbersdorf angeführt (Wunder, Herbrig, Eulitz) und gehörte zum Kalkwerk Beyer. Erst später ‒ vielleicht nach erfolgreichem Versuchsbetrieb ‒ ist auch von Barthel ein solcher Ofen errichtet worden, welcher heute noch als Kellerraum auf dem Hof der Gastwirtschaft „Waldhaus Kalkbrüche“ erhalten, aber kaum noch als solcher zu erkennen ist. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erhaltenen Öfen im Richtung Arnsdorf gelegenen Abbaufeld
Die Kalkbrennöfen sind hier nur noch in rudimentären Elementen vorhanden. In ihrer Art und Aufbau sind diese den vorher beschriebenen Brennöfen von Kaltofen gleichzusetzen, zumindest mit dem größeren Brennofen. Beide Kalkbrennöfen sind als einzelne Ofenanlagen vorhanden und liegen zum einen direkt an einem nach Arnsdorf führenden, ehemals für Fuhrwerke befahrbaren alten Weg, welcher heute fast verwachsen ist und zum anderen an einer großen Halde in der Mitte des Taleinschnittes, gut 40 m vom Weg entfernt. Beide Öfen sind größtenteils abgerissen und verfüllt und nur noch an den aus Bruchstein gesetzten Gewölbeunterbau wahrnehmbar. Der im Taleinschnitt liegende Ofen ist in seiner Grundfläche etwa so groß wie der unweit der Waldgaststätte Kalkbrüche liegende, größere Brennofen, ist ebenfalls als Erdofen konzipiert und mit Haldenmaterial ummantelt. Der viereckige Grundriß des Brennkessels ist ebenso erkennbar, wie ein völlig desolates Gewölbe inmitten der Haldenschüttung in das Tal. Der Brennkessel selber ist mit gut 3 m x 3 m noch zu sehen und ist bis zum Gewölbe abgetragen. Die ursprüngliche Höhe kann hier auch mit 3 m bis 4 m vermutet werden. Demzufolge war dieser Ofen von etwa demselben Fassungsvermögen, wie der größere Ofen unweit der Waldgaststätte Kalkbrüche. Vom Gewölbe ist nur der obere, stark deformierte Teil anhand einer Einsenkung noch sichtbar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Reste des größeren Kalkbrennofen liegen an einer mächtigen Haldenschüttung und sind von weitem an einer markanten Einkerbung der Halde gut zu sehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
zweite Kalkbrennofen liegt direkt am Gehänge einer Halde, auf der der
vorher erwähnte Weg verläuft. Der Brennofen liegt keine 20 m vom Weg
entfernt und war wohl zu Betriebszeiten für die Beschickung mit
Brennmaterial und Kalkstein nahezu ebenerdig vom Weg aus zu erreichen.
Von diesem Ofen sind zwei gegenüberliegende Gewölbe noch sichtbar und der bis auf die Gewölbe abgetragene Brennkessel ist erhalten. Dieser Ofen ist wesentlich kleiner als der vorher erwähnte und entspricht in etwa dem kleinen Brennofen unweit der Waldgaststätte Kalkbrüche. Zu den Dimensionen des Ofens sei folgendes zu bemerken: Das hangseitig liegende Gewölbe – wie im Bild oben – hat eine Spannweite von gut 1,8 m und der Querschnitt des Brennkessels ist mit gut 2 m x 2 m anzusehen. Der Kalkbrennofen liegt etwas unterhalb der Haldenkante und könnte ursprünglich eine Brennkesselhöhe von gut 3 m oder auch mehr besessen haben. Bis zur Haldenkante sind es heute noch etwa 2 m.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ofenanlage am Höpperich bei Pappendorf
Ein weiterer Befund eines Kalkbrennofens befindet sich am Höpperich unweit von Pappendorf an der Großen Striegis. Es handelt sich hierbei um den wohl ältesten, noch erhaltenen Ofen des Bergbaugebietes. Zu Zeiten der Landesuntersuchung war das Vorkommen zwar noch bekannt, aber schon nicht mehr im Abbau. Zum Ofen selber können wir keine genauen Angaben machen, da dieser vollständig von Haldenmasse ummantelt ist und einer Freilegung bedarf, die aber aus Sicht des Denkmalschutzes zumindest schwierig wäre. Der Befund ist nur an einem Gewölbe erkennbar, das wohl durch im Ofen lebende Tiere frei gegraben wurde. Von der Größe her kann es sich um die Dimension des großen Ofens an der Waldgaststätte Kalkbrüche handeln. Auch wird es mit großer Sicherheit ein Harzer-Ofentyp sein. Der Ofen selber ist wohl ebenfalls als Erdofen konzipiert, aber nicht eingetieft, sondern mit Gesteinsmaterial ummantelt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie
schon vorher bemerkt, handelt es sich bei den vorgestellten Befunden um
einen Ofentyp der als „Harzer Ofen“ bezeichnet wird und wohl in mehreren
Variationen im sächsischen Kalkbergbau über sehr viele Jahrhunderte weit
verbreitet gewesen ist. Auch als „bäuerlicher Ofen“ ist er in der
Literatur zu finden.
Dieser Ofentyp hatte etliche Nachteile und wird nach späteren Erkenntnissen und mit der Möglichkeit, Vergleiche mit neueren Ofentypen anzustellen, als ineffizient und umständlich bezeichnet. Solche Vergleiche waren aber erst möglich, nachdem neuere Ofentypen auch entwickelt und gebaut wurden. Diese Entwicklung ist erst in der Zeit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert möglich gewesen. Doch mußte der „Harzer Ofen“ auch entscheidende Vorteile besessen haben, sonst hätte er sich nicht so lange im sächsischen Kalkbergbau halten können. Dieser zu den periodischen Öfen gehörende Typ war für den Brand einzelner, kleinerer Kalkmengen ideal. Er war auf den ländlichen und regionalen Bedarf zugeschnitten und konnte somit weit bis in die Zeit der Industrialisierung überleben! Außerdem konnte in diesem Ofentyp Kalkstein jeglicher durch Menschenhand beweglicher Größe gebrannt werden. Noch viel wichtiger ist aber, daß in diesem Ofentyp auch die sogenannte „klare Bank“, das feine Gesteinsmaterial mit eingebracht werden konnte, das sonst auf die Halde gewandert wäre. Diese Vorzüge machten diesen Ofentyp besonders für den privaten Kalkbergbau unabdingbar. Zum „Harzer Ofentyp“ haben wir die Beschreibung eines solchen von Wunder, Herbrig und Eulitz aus dem Jahr 1867 herangezogen. Die Sichtweise dieser Beschreibung entspricht aber eher einer unternehmerisch- ökonomischen Denkweise des Industriezeitalters und übersieht die eigentlichen Vorzüge dieses Ofentyps: „Zu den Oefen zu periodischem Betrieb mit großer Flamme gehören: a) die sogenannten Harzer Oefen, meist auf Steinkohlenfeuerung berechnet, mit vierseitigem, meist quadratischem Querschnitt von etwa 6 Ellen Seite, gestatten in der Regel einen Einsatz von von 2-3 Ruthen Steinen, finden sich aber auch mit anderen Dimensionen; sie sind meist mit Tonnengewölbe versehen. In dem eingesetzten Kalkstein wird ein als Feuergasse dienendes Gewölbe aufgespart, das mit einer in der Vorderwand des Ofens befindlichen verschließbaren Öffnung communicirt, durch welche die Einführung des Brennmaterials erfolgt. Unter der Feuergasse läuft ein Rost hin, wenn der Ofen zur Kohlenfeuerung bestimmt ist; derselbe kann fehlen, wo Holzfeuerung stattfindet. In Oefen von großen Dimensionen werden mehrere Feuergewölbe aufgespart. Eine Anzahl verschließbarer Oeffnungen im Gewölbe gestattet die Regulierung des Zugs. Bisweilen wird dieser durch Anbringen einer Esse vermehrt. Bei diesen Oefen treten die Schattenseiten der Oefen zu periodischem Betriebe am grellsten hervor: sie producieren sehr langsam; die Ausführung eines Brandes von 2-3 Ruthen nimmt incl. Des Beschickens und Ausfassens 2-3 Wochen Zeit in Anspruch, so daß während der Brennzeit im Jahre (8-10 Monate) höchstens etwa 12-15 Brände bewerkstelligt und mittelst dieser nur gegen 50 Ruthen Urkalkstein gebrannt werden, was einer Production von etwa 3000 Scheffel Kalk entspricht. Die Bedienung dieser Öfen ist eine umständlichere als die der meisten anderen – denn es können zwar große Steine gebrannt werden und ist deshalb ein Schlagen derselben nicht nöthig, aber die Steine sind nicht einzuschütten, sondern müssen eingesetzt werden, und diese Arbeit des Einsetzens ist besonders dann für den Arbeiter höchst lästig, wenn die neue Beschickung des Ofens erfolgen soll, bevor derselbe vollkommen erkaltet ist. Vollständiges Erkaltenlassen aber bedingt, da der Ofen geschlossen und überwölbt, beträchtliche Zeitverluste. Der Brennmaterialaufwand ist bei diesen Oefen größer als bei allen anderen, die üblich sind. In Niederrabenstein bei Chemnitz, wo ein Vergleich der Leistungen des Harzer Ofens mit denen anderer Art sehr gut angestellt werden kann, hat sich ergeben, daß die nacher zu besprechenden Rüdersdorfer Oefen nur Dreiviertel und der gewöhnliche Schneller-Ofen nur die Hälfte des Brennmaterialaufwandes bedingt als der Harzer, um die gleiche Menge desselben Kalksteins zu brennen. Die eckige Form, welche der gleichmäßigen Verbreitung der Wärme offenbar nicht günstig ist, mag hiervon eine wesentliche Ursache sein; die Anlage und Unterhaltungskosten sind bei den Harzer Oefen ebenfalls erheblich größer als bei den Schneller-Oefen. Daher muß es befremden, die Harzer Oefen so vielfach in Anwendung gebracht zu sehen. Namentlich in der Gegend von Wildenfels, auch im oberen Erzgebirge und auch auf den fiscalischen Werken begegnet man ihnen.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
hier beschriebene Ofentyp stellt auch den ältesten bekannten Ofentyp dar,
der zudem noch übertage aufgestellt war und in verschiedenen
Konstruktionen – auch als Erdofen – betrieben wurde, obwohl er noch nach
diesem Prinzip funktionierte. Das Arbeitsprinzip des sogenannten „Harzer
Ofens“ ist eben mehrere tausend Jahre alt und war schon bei längst
vergangenen Hochkulturen zu finden.
Befunde zu diesem Ofentyp sind schon öfters aufgetaucht und in Sachsen gibt es zum Beispiel Belege für den Zeitraum 1350/1450 im Stadtgebiet von Plauen. In der dortigen Burg der Vögte wurde ein nach dem Harzer Prinzip arbeitender und übertägig aufgestellter Ofen aufgefunden, umfassend untersucht und beschrieben. (Wicke, Krabath) Im Vergleich mit den Befunden von Kaltofen- Berbersdorf werden auch hier die Variationen und wohl auch Entwicklungsstufen sichtbar, die beim Betrieb von den Kalkbrennmeistern erkannt und angewandt wurden, zu einer Weiterentwicklung dieses Typs führten und sich später im Schneller- Ofen, dem Trichterofen oder im Geithainer Ofen bis hin zu den modernen Ofenkonstruktionen widerspiegeln.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gab
es bei den von Wunder, Herbrig und Eulitz sowie von Feichtinger
beschriebenen Ofen, wie auch bei dem von (Wicke, Krabath) noch eine
zentrale seitliche Öffnung am Brennkessel für die Beschickung und
Zugregelung, so gab diese bei den Öfen im Gebiet von Kaltofen-Berbersdorf
überhaupt nicht. Die Brennkessel der Harzer Öfen von Kaltofen- Berbersdorf
konnten nicht während des Betriebes mit Brennmaterial beschickt werden, so
wie in der Beschreibung oben erwähnt. Brennkessel und der
Luftregelungsraum waren durch ein Tonnengewölbe abgeteilt, welches von
zwei Seiten aus zugängig war. Es war möglich, diese Öfen mit Holz oder
Kohle oder einem Gemisch aus beiden zu betreiben. Für die
Kalkwerksbetreiber wohl ein entscheidender Vorteil. Diese Entwicklung
entstand sicher aus den ersten Versuchen mit dem Brennmaterial Kohle und
stellt eine recht simple, aber äußerst funktionale Konstruktion dar.
Die Beschickung und Entleerung des Ofens mit Brennmaterial und Kalkstein erfolgte aber nach wie vor von oben und stellten einen großen Nachteil für den Betrieb dieser Öfen dar. Um keine Zeit zu verlieren, mußte solch ein Kalkofen im noch heißen oder wenigstens sehr warmen Zustand beräumt und wieder beschickt werden. Um die Wärme im Ofen kontinuierlicher nutzen zu können, erfolgte bei diesen Öfen eine Abdeckung des zu brennenden Kalksteins mit einem Belag aus Lehm oder Dammerde unter Beibehaltung von Rauch- und Feuerungsgassen, die aus eingebrachten Astwerk zwischen den Kalksteinen gebildet wurden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erhaltene Zeugnisse
Der Kalkbergbau unweit des Kalkweges an der Großen Striegis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses Vorkommen liegt abseits des Hauptzuges der Kalksteinlager und am weitesten südlich. Es handelt sich hierbei um das Vorkommen im Epidot- Amphibolitschiefer und ist auf den Kartenwerkenn kaum zu entdecken. Es bildete auch den ersten Punkt, den wir im Rahmen unserer Exkursionen ab 2016 ein Augenschein genommen haben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Doch sind wir mittlerweile solche Halden in den Kalkabbaugebieten gewohnt und werden dann besonders aufmerksam: Es handelt sich dabei wieder einmal nicht um eine Halde, sondern um den Rest eines Kalkbrennofens!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die in der Erde lebenden Bewohner des Waldes haben uns hier etwas geholfen und ein noch erhaltenes Gewölbe des Kalkbrennofens freigelegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dies ermöglichte es uns auch, einen kleinen Blick in das Ofeninnere zu nehmen. Vermutlich handelte es sich um einen einfachen Harzer bzw. Erdofen. Jedoch müßte zur genaueren Bestimmung der komplette Ofen archäologisch freigelegt werden. Daß es sich hierbei um einen einfachen Erdofen handelt, ist fast sicher. Nach dem Rumford- Prinzip arbeitende Kalkbrennöfen sind jedenfalls für die Region, wie auch für Pappendorf, nicht bekannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Noch eine Ansicht des unter Haldenmasse versteckt liegenden Rest eines Kalkbrennofens aus dem 17./18. Jahrhundert aus nördlicher Richtung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Kalkbergbau an der Großen Striegis bei Berbersdorf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu den
in unserer topografischen Darstellung eingetragenen und aus der
geologischen Spezialkarte übernommenen Punkte der Kalkvorkommen waren bei
unseren Besichtigungen der Lokalitäten nur bei Punkt 7 noch Hinweise auf
einen Aufschluß zu finden. Die Punkte 6 und 8 waren vollkommen verwischt
und wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt, so daß keinerlei
Spuren oder Hinweise auf den früheren Kalkbergbau mehr aufgefunden werden
konnten. Wir haben deshalb auch kein Bildmaterial von diesen Orten
angefertigt und hier eingearbeitet.
Zum Punkt 7 läßt sich nur so viel sagen, daß schurfartige Vertiefungen im Gelände an der Großen Striegis noch vorhanden waren. Es könnte sich dabei wirklich um einen versuchsweisen Abbau oder einfachen „Bauernbergbau“ gehandelt haben. Eindeutige Befunde oder dem Hinweis auf Kalkstein im Geröll haben wir allerdings nicht gefunden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Kalkbergbau am linken Talgehänge der Kleinen Striegis in Richtung Arnsdorf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine unserer Exkursionen (Punkt 3 in unserer Karte) führte uns auf das
linke Talgehänge der Kleinen Striegis. Inmitten der landwirtschaftlich
genutzten Flächen zwischen Schlegel und Arnsdorf befindet sich hier ein
Taleinschnitt, in dem noch Spuren, wenn auch schon stark verwischt, des
früheren Kalkbergbaus auffindbar waren.
Zu diesem Areal haben wir in keinem Archiv direkte Hinweise finden können. Nur während einer Recherche zum Kalkwerk Neunzehnhain im Mittelerzgebirge ist in einer Akte des Rentamtes Augustusburg ein Hinweis auf den Kalkbergbau bei Arnsdorf aufgetaucht. Die Kalkgewinnung hier ist bis 1838 von Kammerherrn von Beschwitz auf Arnsdorf betrieben worden. Der Bruch ist aufgrund der zusetzenden Wassers und fehlender Möglichkeiten zur Wasserhebung eingestellt. Weiterhin sollen starke Bewegungen und Druck das Berggebäude destabilisiert haben. (Bestand 30007, Nr. 2753) Der Kalkabbau in diesem Gebiet ist auf jeden Fall nicht immer im Tagebau, sondern auch untertägig erfolgt. Dies ist an verschiedenen Stellen anhand der Geländekonturen sichtbar. Das Kalkvorkommen hier ist sicher als ein separates Vorkommen zu betrachten. Eine Verbindung mit dem Hauptlager auf dem rechten Berggehänge der Kleinen Striegis ist nicht bekannt. Untersuchungsschächte oder gar eine Kalkgewinnung in der Aue der Kleinen Striegis ist aufgrund des Grundwassers wohl nie in Betracht gekommen. Während der Geländebegehung sind wir aber auf zwei interessante Punkte gestoßen. Zum einen haben wir den Rest eines einzeln stehenden Kesselofens aufgefunden. Der Unterbau mit dem Gewölbe war noch erhalten, nur der eigentliche Ofenaufbau fehlte. Außerdem fiel eine Art Halde auf, die aber nach genauerer Betrachtung ebenfalls den Rest eines Kalkbrennofens verbarg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Zuwegung vom Mühlweg, der von Kaltofen nach Arnsdorf führt... Die Spuren des Menschen und seiner Arbeit sind unverkennbar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Diese Halde am Waldrand läßt den Schluß auf einen ehemaligen Kalkbrennofen zu. Tatsächlich fanden wir einen solchen am anderen Ende dieser Halde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Senke auf der Haldenoberfläche markiert den ehemaligen Brennschacht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Und auf der Hangseite ist auch ein Ofengewölbe noch recht gut erhalten. Lediglich die Aufsattelung des Ofens fehlt vollkommen und mußte wohl der Gewinnung von Bruchstein für andere Bauzwecke dienen. Der darüber gewachsene Baum spricht Bände für das Alter dieses Brennofens.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...nicht weit von dem alten Weg nach Arnsdorf entfernt liegt - sehr unscheinbar - der Rest eines weiteren Brennofens. In diesem Fall wohl ebenfalls ein Harzer Ofen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der westliche
Teil des Hauptkalklagers im rechten Talgehänge der Kleinen Striegis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den
geologischen und auch bergbaulichen Anfang des Hauptkalklagers können wir
heute am Talgehänge zur Kleinen Striegis finden. Hier müssen schon in sehr
früher Zeit die am Gehänge ausstreichenden und sichtbaren Kalksteine zu
ihrer Gewinnung angeregt haben. Denn in den Unterlagen der
Landesuntersuchung 1800 ist hier schon kein Abbau oder anstehender
Kalkstein mehr erwähnt.
Die Gewinnung des Kalksteins an dieser Stelle als Bruchwand am Talgehänge wäre sicher die einfachste Gewinnungsmöglichkeit gewesen und ist sicher auch genutzt worden. Nachweislich ist, daß sich generell der Kalkabbau bis zu seinem Ende im ausgehenden 19. Jahrhundert als Tiefbau in die Mitte und an das östliche Ende des Kalklagers verlagert hatte, also die Erschließung der aufwendig zu gewinnenden und tief liegenden Partien des Kalksteinlagers auch das Ende des hiesigen Kalkbergbaus bedeuteten. Das Abbauareal ist heute von Pingen, Halden und verfüllten Tagebauen geprägt, ohne daß man ein eindeutiges Muster erkennt. Eine Zuordnung zu Abbauzeiten oder Phasen, oder auch Besitzern ist nicht mehr möglich. Große Teile auf der Anhöhe sind auch verfüllt und renaturiert und der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zugeführt worden. Diese Bereiche sind durch ihre Geländeform und der eindeutigen scharfen Abgrenzung zu den erhaltenen Abbauflächen noch erkennbar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
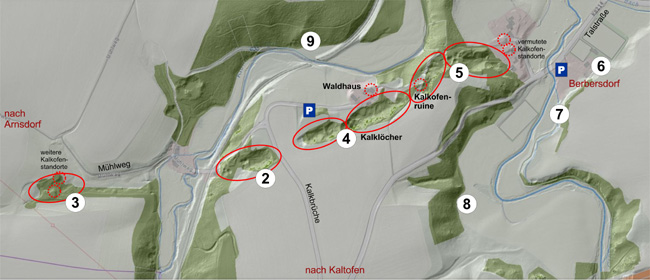 Das nun von uns begangene Areal liegt bei Punkt 2 in der Kartendarstellung. Der Kalkbergbau zieht sich hier von der Verbindungsstraße von Kaltofen nach Arnsdorf bis hinunter zur Kleinen Striegis.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Über einen Waldweg, der von der Verbindungstraße nach Arnsdorf abzweigt, gelangen wir in das frühere Abbaugelände. Das Gelände ist hier größtenteils durch Verfüllung der vormaligen Tagebaue und durch Brüche untertage liegender Abbaue geprägt. Zu DDR- Zeiten nutzten der Zivilschutz und die Kampfgruppen der Betriebe das Areal auch für Trainingszwecke.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ganz in der Nähe dann diese große Pinge, die auf einen verbrochenen Abbau hinweist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im Gelände fanden wir auch einige Stellen, die man als verschüttetes Mundloch deuten könnte. Der markante Geländeeinschnitt und leider auch die Ablagerung von Müll sind sehr typisch für solche Lokalitäten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 In diesem Bereich des Kalklagers finden sich noch sehr große Tagebaurestlöcher mit zahlreichen Pingen, die auf eine untertägige Gewinnung hinweisen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Obwohl große Teile der Steinbrüche verfüllt wurden, sind noch die Kanten der früheren Bruchwände an einigen Stellen sichtbar. Die landwirtschaftlichen Flächen reichen oberhalb bis hier heran, was die Verkippung des Kalkbruches vereinfachte. Im Bild ist noch ein „verwischter“ Teil eines solchen Bruchstoßes zu sehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der mittlere
Teil des Hauptkalklagers im Bereich der „Kalklöcher“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Bereich des Hauptkalklagers unweit des Waldgasthauses „Kalkbrüche“ ist über 200 Jahre eng mit dem Familiennamen Barthel verbunden. Wie schon in den vorherigen Abschnitten erwähnt, hat diese Familie hier den Kalkabbau geprägt und ihn auch als letzte Unternehmer aufgegeben. Heute finden sich hier in einem schönen Naturschutzgebiet die wohl bekanntesten Sachzeugen des Kalkbergbaus der gesamten Region. In der nachfolgenden Bildergalerie wollen wir näher darauf eingehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
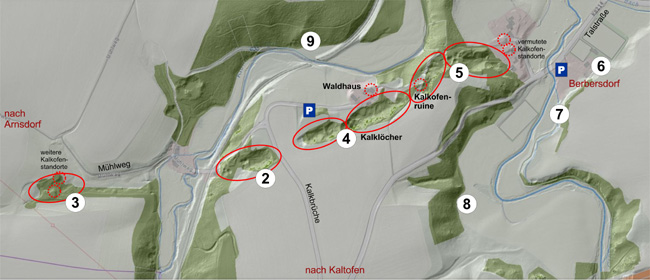 Wir wandern in nordöstliche Richtung am Kalklager entlang. Dieser Teil des Hauptkalklagers ist von uns mit Punkt 4 versehen worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Von diesem markanten und schönen Baum an der Straße „Kalkbrüche“ aus hat man einen guten Überblick über das größtenteils wieder bewaldete Bergbaugebiet. Ein großer Abschnitt des früheren Abbaufelds des Hüfners Barthel ist heute wieder renaturiert und wird als Grünland genutzt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Vom kleinen Wanderparkplatz aus blickt man in die Talaue der Kleinen Striegis zur Waldgaststätte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Große Teile des Abbaufeldes hier sind wieder landwirtschaftliche Nutzfläche. In diesem Bereich lagen grenzten wohl die Kalkbrüche der Hüfner Gelbricht und Barthel aneimamder. Rechts hinter dem Waldrand liegt ein noch erhaltener, aber schon recht weitgehend verfüllter Tagebau.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im verfüllten Bereich des Tagebaus wächst mittlerweile schon Stammholz. Die früheren Konturen des übertägigen Kalkbruches sind aber noch sehr deutlich zu sehen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Daß hier der Kalk nicht nur im Tagebau gewonnen wurde, ist bekannt. Hier liegen auch die untertägigen Abbaue der Hüfner Gelbricht und Barthel. Doch wissen wir heute nicht mehr, wo die Rainung dieser Grundstücke verlief. Wir folgen dem Kalklager durch die ehemaligen Tagebaue bis zu einer sehr bekannten und markanten Stelle…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unterhalb dieser offenen Bruchwand liegt auch der einzige Zugang zu den abgesoffenen Weitungsbauen des Barthel‘schen Bruches.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ein erster Blick in die „Kalklöcher“. Ob dieser Bereich auch der Zugang zu den Weitungsbauen des Barthel‘schen Kalkbruches war, darf angezweifelt werden. Es gab zu Betriebszeiten des Kalkbruches mehrere Schächte und einen Stolln auf Niveau der Kleinen Striegis, der aber schon zu Betriebszeiten des Kalkwerkes zu Bruch ging. Deshalb auch der recht hohe Wasserstand in den Weitungsbauen. Die untertägigen Baue sind also nicht mehr fahrbar. Lediglich Höhlentaucher besuchen zu Trainingszwecken gelegentlich diesen Abbaubereich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Lokalität begeisterte schon viele Fotografen... Dieses Foto nahm G. Bödke im Jahr 1992 auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Etwas näher... Foto: G. Bödke, 1992.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...und der Blick hinein. Foto: G. Bödke, 1992.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Fotograf und Datierung dieser Aufnahme sind nicht bekannt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Dieser umso mehr: Diesen Blick in die „Kalklöcher“ nahm Max Nowak bereits 1930 auf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Damit kein Besucher abstürzt, ist heute ein Geländer angebracht.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Noch ein paar (fast) aktuelle Einblicke...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Bruchwand oberhalb dieses Bereiches bietet der Natur heutzutage einen einzigartigen Lebensraum und man kann als Besucher diesen Aufschluß des Kalklagers sehr schön anschauen. Trotzdem ist diese Bruchwand nicht ungefährlich, was wohl auch einige schon schmerzlich erkennen mußten. Deshalb die Absperrungen beachten!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Links im Bild der ausgebaute Wanderweg vom Waldhaus in Richtung des Tagebaus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Der nach Nordosten angrenzende Abschnitt der Reihe der Tagebaue zeigt sich als sehr stark verwachsen und teilweise auch verfüllt. Man kann die eigentliche Größe dieses Abbaus nur noch erahnen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unweit östlich der Gaststätte „Waldhaus Kalkbrüche“ liegen -versteckt im Wald neben dem Wanderweg - auch die Reste der schon im Abschnitt zur Brennofentechnik beschriebenen Ofenanlage. Die hohen starken Bäume, die sich heute unmittelbar im Bereich des Ofens angesiedelt haben, belegen natürlich sehr eindrucksvoll das Alter dieser technischen Einrichtung. Diese war wohl schon zum Ende des hiesigen Kalkbergbaus nicht mehr in Betrieb und durch einen neueren Ofen im Bereich der heutigen Gaststätte ersetzt worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Einer der freigeräumten Zugänge hat ein provisorisches Schutzdach erhalten, damit Laub und Unrat ihn nicht bald wieder füllen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...und in den anderen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unmittelbar hinter der Ofenanlage liegt noch ein interessanter, aber nicht ganz ungefährlicher Aufschluß des Kalklagers an einer mittleren Tagebruchwand.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Hier steht noch etwas Kalkstein an und zeigt auch die recht komplizierte Vergesellschaftung des Kalksteins mit dem umgebenden Nebengestein. Die Abbauverhältnisse waren in diesem Kalklager eher suboptimal und schwierig aufgrund vieler Verwerfungen und der unregelmäßigen Zerlegung des Lagers in einzelne kleine, linsenförmige Körper.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Unterhalb der Klippe führte einst wohl auch ein Förder- oder Wetterschacht in die Tiefbaue, der heute aber weitgehend verfüllt ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der östliche
Teil des Hauptkalklagers bei Berbersdorf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wo genau die Rainungen zwischen den Bergbaugrundstücken der Hüfner Barthel, Gelbricht und Beyer, sowie anderen Beteiligten verliefen, können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Um uns zu orientieren, reichen uns markante Punkte, wie der große Kalkbrennofen aus. Vielmals erfolgte der Kalkabbau sowieso in gesellschaftlicher Form, um die finanzielle Belastung auf mehrere Schultern zu verteilen. So ist die von uns angenommene Grenze eine virtuelle und wird durch den Standort des Kalkbrennofens unweit der Waldgaststätte bestimmt. Das Gelände zeigt sich hier als ein sehr großer, jetzt von der Natur zurückeroberter, teilweise schon zu Betriebszeiten verfüllter Tagebau. Hier ist der Kalkstein bis hinab auf das Niveau der Striegisflüsse und abgesehen von einigen Sicherheitspfeilern vollständig abgebaut. Der letzte Gewinnungsbetrieb verlief auch in diesem Bereich. Die dem letzten Tiefbau zugehörigen Schächte und Stolln sind verfüllt und verwahrt und auch für den Montanforscher nur anhand von dem überlieferten spärlichen Kartenmaterial nur ungefähr noch auffindbar, ansonsten im Gelände nicht mehr sichtbar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
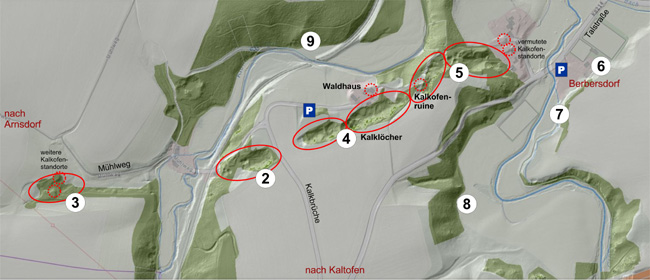 Weiter geht es in nordöstlicher Richtung am Kalklager entlang. Wir befinden uns jetzt bei Punkt Nr. 5 unserer Exkursionsreihe, die wir freilich nicht an einem Tag zurück legen konnten. Das Gelände mit den Resten des Kalkbergbaus ist dafür zu groß!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Grenze zum östlich benachbarten Baufeld bildet diese sehr auffällige Störung des Kalklagers durch eine mächtige Kluft. Inwiefern sie Auswirkungen auf Abbau, Qualität und Lagerung des Kalksteins hatte, ist für uns heute nicht mehr nachvollziehbar. Die Baue der Kalkgrube sind ja leider nicht mehr fahrbar und wurden nie durch Grubenrisse dokumentiert...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Zu Betriebszeiten standen hier mächtige Tagebaue im Abbau. Heute hat sich die Natur das Gelände zurückgeholt und eine typische Flora und Fauna hat sich wieder ausgebreitet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Im Gelände zeigen sich auch Pingen, die auf zu Bruch gegangene untertägige Abbaue zurückzuführen sind und später für die Verkippung tauber Berge genutzt wurden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Bruchwände des Tagebaus sind nicht ganz ungefährlich und man sollte sie besonders nach dem Winter meiden. Für die Tierwelt ist diese Wand mit den vielen kleinen Klüften, Vorsprüngen und Ritzen dagegen ein Paradies und für uns eine bemerkenswerte Landschaft!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ansicht der oberen Bruchwand mit unreinen Kalksteinresten, die wohl als nicht mehr tauglich für die Gewinnung angesehen wurden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Darunter befindet sich eine Art Abbauort, das eher untypisch für die Kalkgewinnung ist...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ...und deshalb vielleicht als eine Niederlage für Gezähe und Habseligkeiten der Bergleute anzusehen ist.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Nur die im oberen Bild sichtbare und überschüttete Abbruchkante bildete eine Art größere Bergfeste zum westlich angrenzenden Kalkabbau. Wir befinden uns hier in dem von Berbersdorf ausgehend erschlossenen Teil des östlichen Hauptkalklagers der Lagerstätte Kaltofen- Berbersdorf. Auch hier ist der Kalk nicht nur im Tagebau gewonnen, sondern auch untertägig abgebaut worden. Es handelt sich hier um das Abbaufeld des Kalkwerkes von Beyer, später Hähner.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Die Bruchwand des früheren Kalktagebaus von Herrn Beyer, später des Holzhändlers Hähner aus Berbersdorf. Der Abbaubetrieb ging damals schon lange nur noch untertage vonstatten, da die Tagebaubereiche vollständig abgebaut und schon teilweise mit Abraum verfüllt waren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 In den Kalktagebau durchgefahrene Abbau im Kalkwerk Beyer, später Hähner. Das Abbaufeld war durch einen Stolln erschlossen, der in die Große Striegis entwässerte, aber schon zu Betriebszeiten zu Bruch gegangen war.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Später fand der Stolln noch als Flachbrunnen mit Wasserfassung Verwendung. Am Westrand der Talaue der Großen Striegis unterhalb der Kalkbrüche bei Berbersdorf ist eine solche noch zu entdecken.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die meisten Besucher passieren die beiden Striegistäler einfach auf den beiden Großbrücken der A4. Dabei bilden bilden die noch wenig unverbauten, oft steilwandigen und einsamen Täler der Kleinen und der Großen Striegis zu jeder Zeit ein schönes Wandergebiet, auch, wenn man sich nicht unbedingt (oder wenigstens nicht nur) für den historischen Bergbau interessiert... Glück Auf! Das Team vom „u. b.“
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Quellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wo wir
außerdem schon nach der Geschichte des Kalkbergbaus und der Kalkverarbeitung
recherchiert haben, haben wir einmal in einem
Hinweis: Die verwendeten Digitalisate des
Sächsischen Staatsarchives stehen unter einer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Quellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||