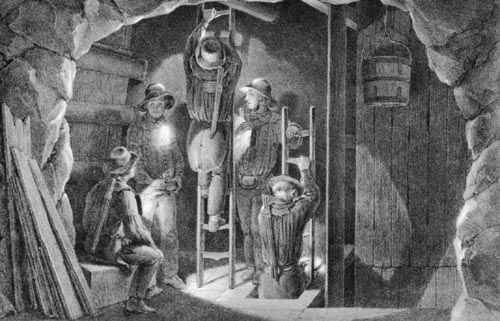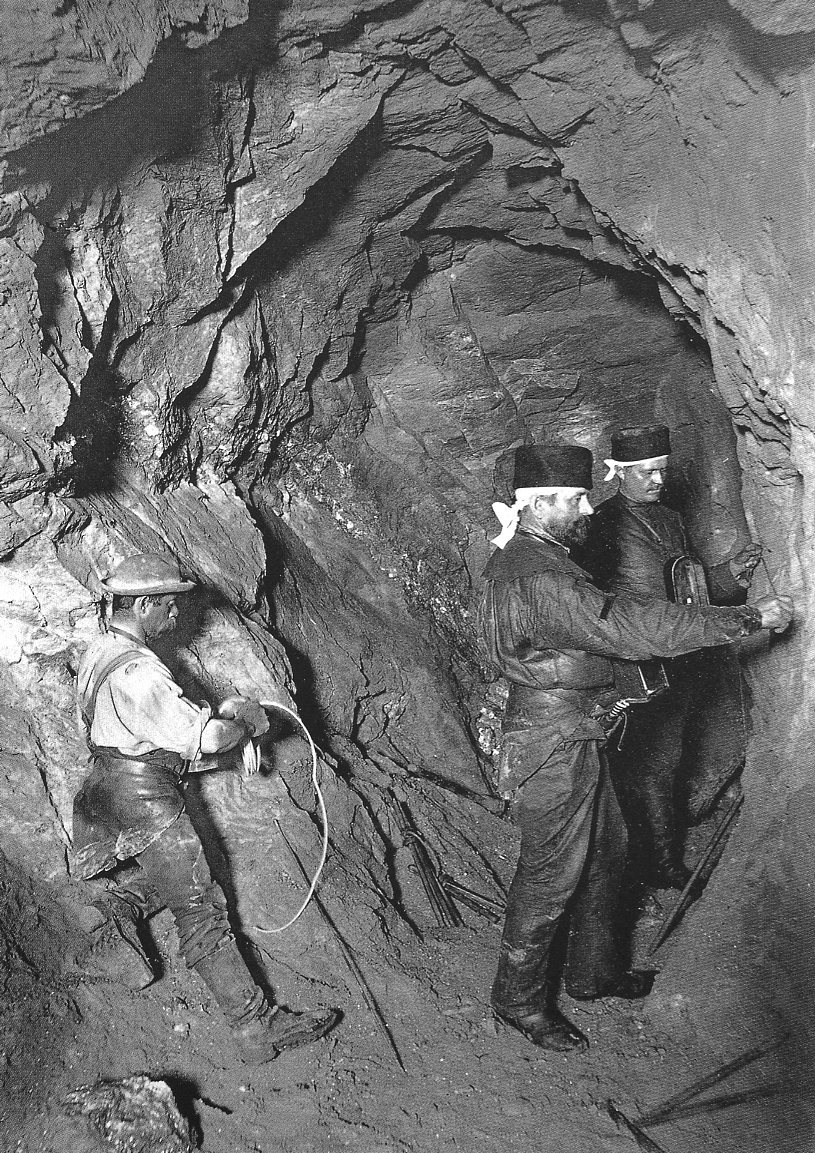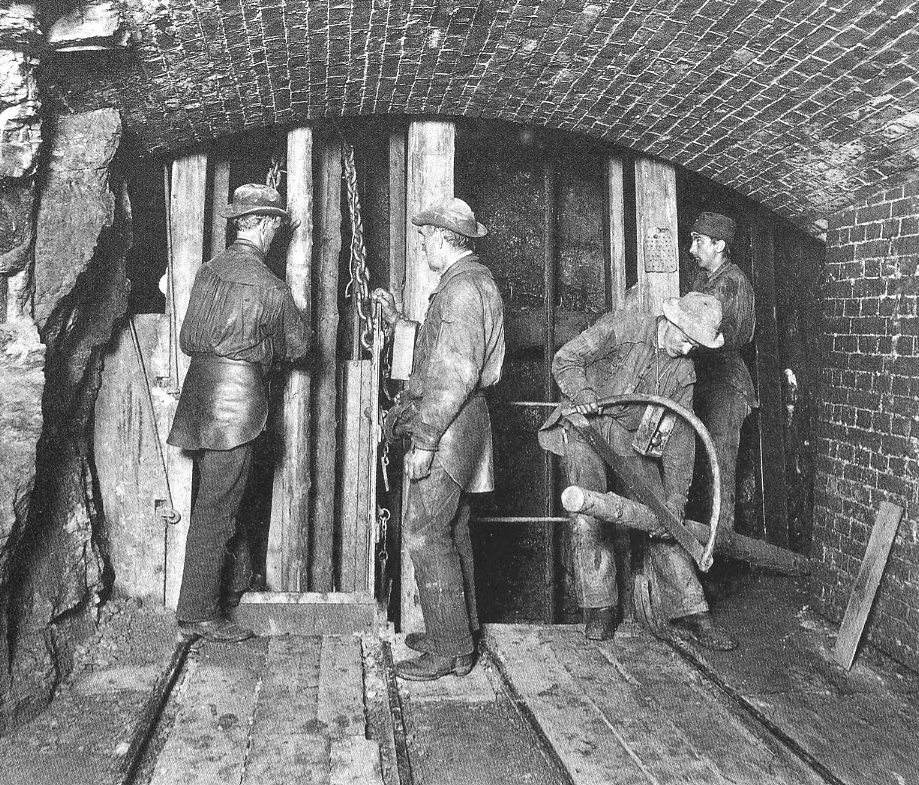|
Ein
anderer, alljährlich mehrfach sichtbarer Bestandteil der Traditionspflege sind
die regelmäßig stattfindenden
Bergparaden in den bedeutenden, oder auch in den weniger bedeutenden,
verschiedenen Berg-Städten unserer sächsischen Heimat und in der
Landeshauptstadt. Hier soll nun dem Bürger und auch dem ahnungslosen Touristen,
die erfreulicherweise immer sehr zahlreich zu solchen Paraden jubelnd anwesend
sind, die tiefe Verbundenheit der jeweiligen Region zum Bergbau der Altvorderen
vermittelt werden.
Na,
zugegeben: Wer feiert nicht schon gern und im Erfinden von Anlässen waren die
Sachsen durchaus schon immer kreativ. Viele Bergaufzüge haben auch kirchliche
Feiertage zum Hintergrund oder einen Dankgottesdienst zum Bestandteil. Und wer
geht schon am Sonntag in Arbeitskleidung in die Kirche...
Doch
wird hier nicht auch ein Trugschluß vermittelt ?
Die
Bergarbeit unserer Vorfahren war auf keinen Fall schön und romantisch, wie die
Atmosphäre an solch einer Bergparade egal wo diese stattfindet ! Sollte
die bergmännische Traditionspflege in Sachsen nicht doch etwas mehr Inhalt und
Saft haben ?
Ja
und ob, schon seit einigen Jahren oder besser schon seit gut einem Jahrzehnt
existiert ein Projekt, daß sich mit der realistischen Darstellung des Bergmanns
in der Öffentlichkeit befaßt. Als Grund für dieses Projekt sehen die Macher -
alles sächsische Bergbaufreunde aus dem Freiberger Land, die selber auch aktiv
Montanforschung und Traditionspflege in praktischer Art und Weise betreiben - in
der angesprochenen derzeitigen Traditionspflege diverser Verbände und Vereine
mit den von ihnen organisierten Veranstaltungen. Dabei werden die sozialen Verhältnisse
bei solchen „Berg“-Paraden vollkommen ausgeklammert. Der Bergmann wird als
immer schön saubere Lichtgestalt mit schlohweißen Hosen und viel uniformierter
Farbe - so wie man die Leuchter kennt, die zur Weihnacht vom Boden geholt werden
- in seinem feinen Zwirn und immer lächelnd und wohlgenährt, dem am Straßenrand
applaudierenden Bürger vorgeführt. Ein Bild das sich fest und kaum
korrigierbar in die Köpfe der Bürger und Touristen eingebrannt hat.
Doch
wie sah der „arbeitende“ Bergmann überhaupt aus ?
Gibt
es denn auch Darstellungen außerhalb der berühmten Bildbände mit den
Paradeuniformen ?
Das
sind Fragen, die sich im Laufe der Zeit zu diesem Thema ergaben. Es gibt
Darstellungen, doch wird hier schon früh eine Korrektur sichtbar, da man schon
in früheren Jahrhunderten lieber die Paradeuniform sehen wollte, als einen
schmutzigen, ausgemergelten Bergmann, dem man seinem gesellschaftlichen Stand
und seine sozialen Verhältnisse ansah. Die Zahl realistischer, bildlicher
Darstellungen ist stark begrenzt.
Dabei
soll aber nur auf allgemein bekannte Werke zurück gegriffen werden, welche auch
publiziert wurden. Die älteste allgemein bekannte bildliche Darstellung finden
wir in einem Bildband, der 1830 von G. E. Rost in Freiberg mit dem Titel
„Trachten der Berg- und Hüttenleute im Königreich Sachsen“ herausgegeben
wurde. Es findet sich nur eine Zeichnung zum Bergmann in Arbeitskleidung und
keine Beschreibung dieser, aber äußerst ausführliche Beschreibungen der
Paradeuniformen nebst den Unterschieden der einzelnen Bergreviere.
|
|

Sächsischer Bergmann in Arbeitstracht aus G. E. Rost, „Trachten der Berg- und
Hüttenleute im Königreich Sachsen“ Freiberg 1830
|
|
Auch
hier wird der Bergmann als „schön“ und „wohlgenährt“, entgegen den
eigentlichen Lebensverhältnissen, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Doch sehen wir hier auch eine der ältesten farbigen bildlichen Darstellungen
der Arbeitstracht des Bergmanns aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In „Geschichte
und Beschreibung des sächsischen Bergbaus nebst 22 colorierten Abbildungen der
sächsischen Berg- und Hüttenleute in ihren neuesten Staatstrachten“ von
1827 ist wenigstens eine Erwähnung der Arbeitskleidung enthalten:
„Die
Kleidung der Bergleute besteht aus einer kurzen Jacke oder Kittel mit weiten Ärmeln,
wozu das sogenannte Berg- oder Fahrleder kommt. Vorn am Leibe tragen sie ein
Bergtäschchen, worin sich das Feuerzeug befindet, und wenn sie eine gewisse
Rangstufe erreicht haben, ein oder zwei Messer, sogenannte Tscherper. Ihre Jacke
in der Arbeit ist von grober Leinwand, außer derselben von schwarzer Leinwand,
oder dergleichen Tuch. Zum Arbeitskittel gehört die Blende, eine Laterne, welche
beim Ausfahren hinten über dem Fahrleder, beim Einfahren aber vorn an der Brust
befestigt ist. Alle, zum Berg- und Hüttenwesen gehörige Arbeiter (Bergvolk)
müssen diese Kleidung an Fest- und Lohntagen, und wo sie in Gegenwart ihrer
Vorgesetzten erscheinen, tragen“.
Beim
ersten Lesen ist man verdutzt bei der Vorstellung,
daß das Geleucht „...beim
Ausfahren hinten über dem Fahrleder“ getragen werde. Auch dabei
brauchte man schließlich „vorne“ Licht, damit man die Sprossen der Fahrt sicher
greifen konnte... Im Jahr 2018 hat uns unser Leser A. Weiß aus Dippoldiswalde aber
Fotos einer geschnitzten Figur zur Verfügung gestellt, die tatsächlich die
Blende „am Heck“ - über dem Arschleder - trägt. Es muß also wirklich Momente
gegeben haben, in denen man sie so trug.
Anfang 2019 hat uns Herr
C. Beier aus Zschopau darauf aufmerksam gemacht, daß die Signatur am Sockel der
Figur richtig Constantin Bach zu lesen ist. Dies war der Schnitzer dieser
Figur, der von 1858 bis 1934 lebte und in Elterlein zu Hause war. Wahrscheinlich
ist diese Figur also zwischen 1920 und 1934 entstanden, wie die meisten seiner
Arbeiten.
|

Eine 22 cm hohe, geschnitzte Bergmannsfigur. Der Sockel ist mit „Const. Bach“ signiert,
der Name des Schnitzers. Foto:
A. Weiß.
|
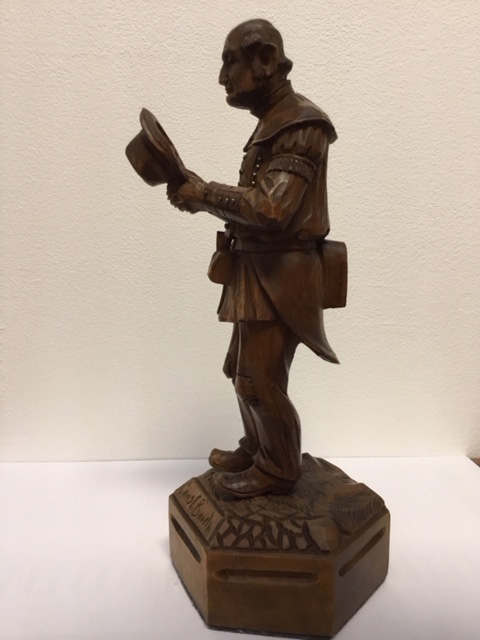
Die Figur scheint ein Gebet aus dem Hut zu lesen... Ganz sicher hat der
Schnitzer einen Moment der Andacht dargestellt, in dem es nicht auf das äußere
Licht ankam...
Foto: A. Weiß.
|

Dreht man sie ganz herum, ist es deutlich zu sehen: Diese Figur trägt die Blende
„hinten über dem Fahrleder“ - genau so, wie oben im Textzitat
beschrieben.
Foto: A. Weiß.
|
|
Der
Ursprung dieser Arbeitstracht ist aber wesentlich älter und geht auf einen
Gedanken
des sächsischen Oberberghauptmanns Abraham von Schönberg zurück.
Dieser äußerte die Ansicht, daß die sächsischen Bergleute nach militärischem
Vorbild eine uniformähnliche Kleidung tragen sollten. Danach sollte der Rang
der Berg- und Hüttenarbeiter sowie der dazugehörigen Beamten im Bergwesen
(schon 1668) anhand ihrer Kleidung sofort erkennbar sein. Dies sollte auch dem
Berufsstand einen erheblichen öffentlichen Respekt verschaffen. Erst 1719
wurden erstmals diese Gedanken umgesetzt und die Bergsänger mit einer uniformen
Berufskleidung ausgestattet.
Ab
1769 wurde die uniforme Berufskleidung durch das Oberbergamt durchgesetzt und
verbreitet. In diese Zeit fällt auch die Entstehung unseres Bergkittels für
den untertage arbeitenden Bergmann mit den schon oben erwähnten Utensilien.
Unter S. A. W. v. Herder ist um 1827 das Tragen durch ein königliches Gesetz
zur Pflicht geworden. Die Mißachtung dessen wurde „als Verleugnung
des Standes und bergmännischen Geistes“ mit Abzug eines Wochenlohnes
bestraft.
|
|


|
|
Dieser
Arbeitskittel bestehend aus bräunlichen Leinen mit Fahrleder, Tzscherpertasche,
Blende und Hut, sowie schweren Stiefel mit Holzsohlen und langen Hosen. Sie
blieben bis zum Ende des Bergbaus in den 1910er Jahren, teilweise aber noch bis
in die 1930er Jahre die Berufskleidung des Bergmanns in Sachsen.
Man
kann aus unserer Sicht also von einer über gut 150 Jahre entstandenen - zwar
zunächst als zwangsläufig verordnete Berufskleidung - bergmännischen Tracht
sprechen. Diese symbolisiert heute den eigentlichen Bergmann, der den Reichtum
Sachsen erwirtschaftete und selber karg und arm sein Leben fristete.
|
|
Weitere
Darstellungen der Arbeitstracht finden sich auch bei Eduard Heuchlers
Zeichnungen in „Album für Freunde des Bergbaus“ aus dem Jahr 1851.
Auch hier ist wieder die starke romantische Verklärung der Verhältnisse des
Berufsstandes Bergmann zu sehen und paßt somit gut in unsere heutige Zeit. Dafür
stellen sie aber auch einen Beleg über das Aussehen des „arbeitenden“
Bergmannes dar, zumindest nach seiner Kleidung, die als einheitlich und
gewachsen, ja sogar traditionell dargestellt wird und sich so mit der o. a.
Beschreibung von 1827 deckt.
|
|
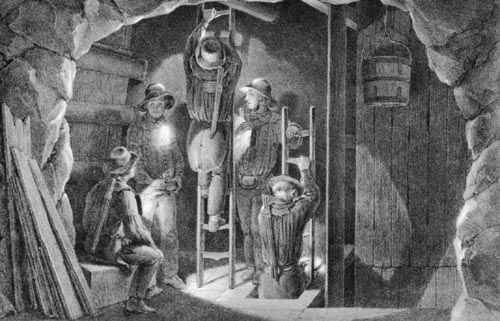
„Die Einfahrt“ aus „Album für Freunde des Bergbaus“ von Eduard Heuchler
von 1851.
|
|

„Die Heimkehr“ aus „Album für Freunde des Bergbaus“ von Eduard Heuchler
von 1851.
|
|
Das
Aufkommen der bildlichen Darstellung in Form der Fotografie um die Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnete neue Möglichkeiten der Dokumentation. Einer der
bekanntesten Fotografen bergbaulicher Motive war der akademische Maler und
Fotograf Heinrich Börner aus Freiberg. Er hinterließ einige bemerkenswerte
Bilddokumente, die Ende der 1990er Jahre durch die Initiative von Jens Kugler in
einem Bildband wieder veröffentlicht wurden. Börner zeigt hier erstmals die
Arbeitswelt des Bergmanns so, wie sie wirklich war, ohne die Möglichkeit stilistischer
Veränderungen an den Motiven wahrzunehmen. Auffällig ist jedoch die Präsenz
der Steiger in einzelnen Bildern. Hier entsteht der Eindruck eines
„gestellten“ Bildes. Doch war es sicher nur reine Selbstdarstellung der
Steiger, sich in ihrer beruflichen Stellung auch bei diesem neuem Medium in den
Vordergrund zu rücken. Dennoch bleibt der einfache Bergmann und seine Arbeit
Mittelpunkt der Bilder. Gut zu sehen auch die unveränderte Arbeitskluft der
Bergleute wie sie 1827 weiter oben beschrieben wurde.
|
|
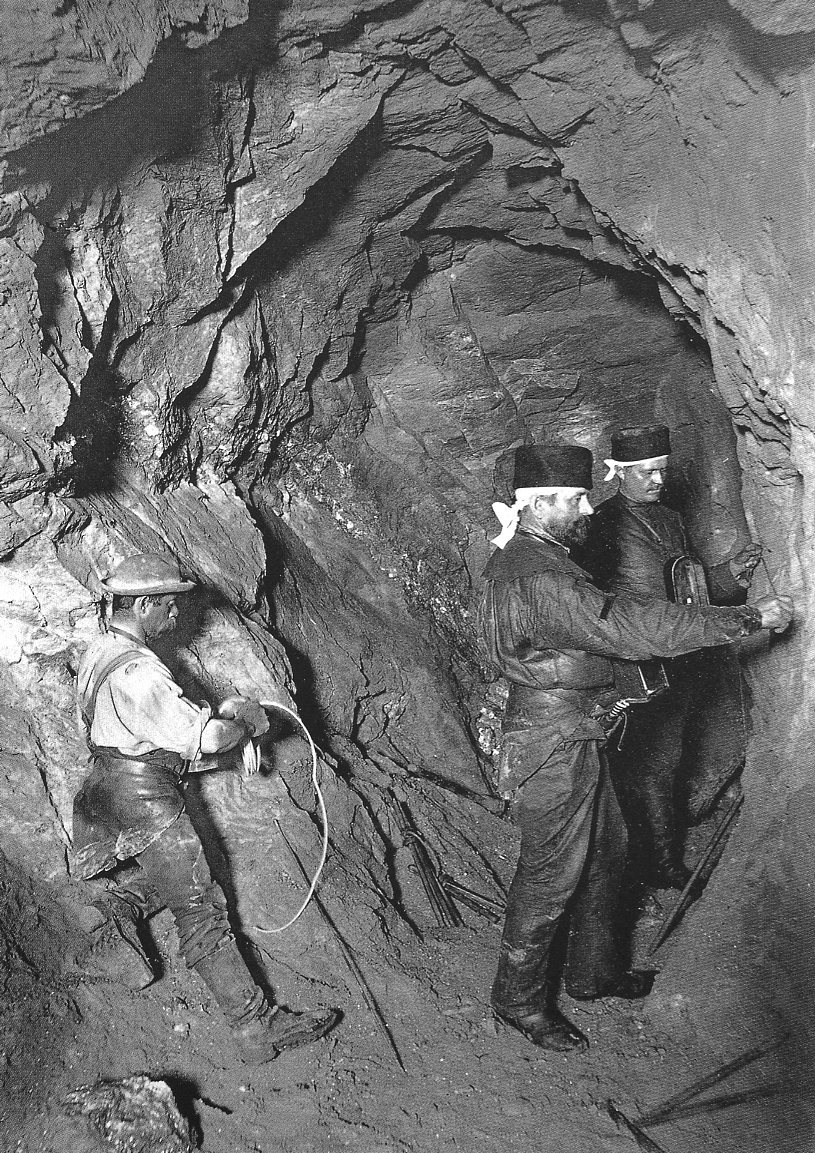
Gedingeabnehmen vor Ort auf dem „Selig Trost Stehenden“ bei Alte
Elisabeth. Fotografie von Heinrich Börner aus dem Bildband „Der
Bergmann in seinem Beruf“ von 1892. 1999 im Jens-Kugler-Verlag neu aufgelegt.
Auffällig bei diesem Bild sind die schweren Stiefel mit hölzerner und
genagelter Sohle, sowie die Nutzung des Fahrleders (im Volksmund auch Arschleder
genannt) als Schutz gegen die Widrigkeiten des Berges.
|
|
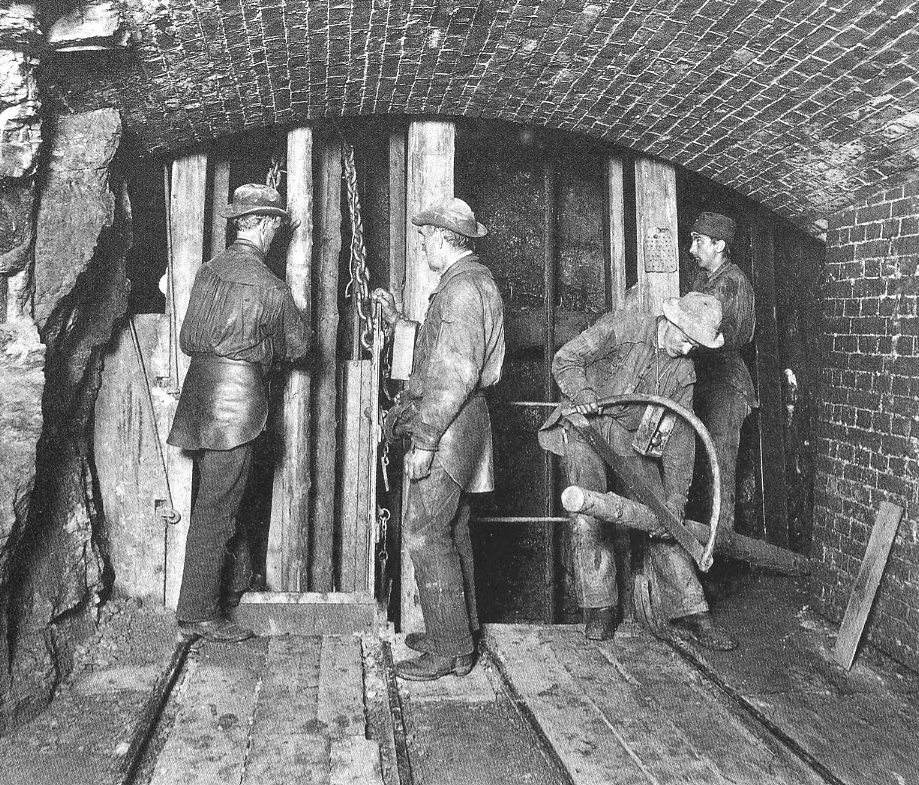
Holz hängen im Abrahamschacht. Fotografie von Heinrich Börner aus dem
Bildband „Der Bergmann in seinem Beruf“ von 1892. 1999 im Jens-Kugler-Verlag
neu aufgelegt. Kleidung und die Handhabung der Blende bei verschiedenen Tätigkeiten
in einem durch Magnesiumblitz nur für Bruchteile einer Sekunde erhelltem Füllort.
Auch hier ist die unveränderte Arbeitskleidung vordergründig.
|
|
Auch
die Freiberger Fotografenfamilie Reimann hinterließ - heute im Besitz des
Stadt- und Bergbaumuseums - einen immensen Fundus an historischen Fotodokumenten
zur Stadt und Umgebung Freibergs, wie auch zum Bergbau selbst. Auch hier finden
sich Darstellungen des Bergmanns in seiner Berufskleidung bis weit in die 1920er
Jahre hinein. Auch hier ist ersichtlich, daß sich die einst per Gesetz
verordnete Arbeitskleidung unverändert erhalten hat. Trotz vieler Neuerungen
wie dem Karbidlicht oder einer Kopfbedeckung in Form eines ledernen Helmes mit
kurzem Schild.
|
|

Konstantinschacht 3. Gezeugstrecke, Fotografie von Karl August Reymann,
Entstehungsjahr nicht bekannt.
|
|

Vertrau auf Gott Schacht. Fotografie von Karl August Reymann,
Entstehungsjahr nicht bekannt. Ein wohl typisches Bild in der sächsischen
Bergbaulandschaft. Der Bergmann auf dem Heimweg und die Stiefel über die
Schulter gehangen. Auffällig hier, daß die schweren Bergstiefel mit Holzsohle
auf dem Heimweg getragen werden und die leichteren Stiefel mit lederner Sohle lässig
über der Schulter hängen (siehe Bildausschnitt unten).
|
|

|
|


|
|
Arbeitsgemeinschaft
"Bergkittel"
In den letzten zehn Jahren
kristallisierte sich eine neu Einstellung in der Bevölkerung heraus. Durch die
zaghaft öffentlich werdende Montanforschung seit 1989 und die zunehmende
Akzeptanz durch die Behörden, besonders durch das sächsische Oberbergamt
Freiberg, wird auch nach den Hintergründen von Bergaufzügen- und Paraden
gefragt.
Die Beantwortung solcher
Fragen erfolgt in der letzten Zeit auch durch die öffentliche Präsenz einiger
Bergbaufreunde aus dem Landkreis Mittelsachsen - zwar nicht bei den
weihnachtlich- festlichen Bergparaden
in den großen Städten, aber bei vielen Heimatfesten in ehemaligen, meist
kleineren Bergbaustandorten. Diese Bergbaufreunde fertigten sich nach den
originalen Vorlagen aus dem Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg die Arbeitskittel
der Bergleute des 19. Jahrhundert nach und tragen diese auch öffentlich zu den
entsprechenden Anlässen, wie Heimatfesten und Jubiläen ehemaliger
Bergbauorte.
Dieses Projekt
„Bergkittel“ ist im Verein Altbergbau
Freiberger Land e.V. organisiert und steht
neben dem Ausbau der Bergwerksanlage an vorderer Stelle. Bei den Festumzügen
der letzten Jahre bewies der Applaus der Zuschauer die Richtigkeit und
Lehrhaftigkeit des Projektes. Denn der Berufsstand des Bergmannes war auf keinen
Fall romantisch und schön, wie es mit den weihnachtlichen Bergparaden
vermittelt wird.
Die
nachfolgenden Bilder zeigen das akribische Vorgehen bei der
Nachfertigung der heute fast vergessenen Berufskleidung des Bergmanns aus der
Zeit der 18. bis zum 1. Drittel des 20. Jahrhunderts. Die im Bild zu sehende
Freiberger Blende ist ein Original, ebenso die im Gehänge mitgeführten
Bergeisen. Sämtliches Lederzeug wurde nach originaler Vorlage nachgefertigt.
Die schweren Stiefel mit Holzsohlen stammen aus dem letzten Weltkrieg und sind
ein Fund auf dem Trödelmarkt, passen aber ganz genau zur Arbeitstracht des
Bergmanns.
|
|

Die Bergeisen sind originale Stücke, ebenso die Blende, nur das Lederzeug wurde
nachgefertigt, Foto: Robert Brückl
|
|

Ansicht von der Seite.... Foto: Robert Brückl
|
|

...und von hinten, das neue Leder ist noch etwas steif und knittrig, aber das
ist nur noch eine Frage der Zeit ! Foto: Robert Brückl
|
|

Seltene Stücke. Stiefel mit hölzernen Sohlen und entsprechender Nagelung
sind heute äußerst selten aufzutreiben. Diese hier stammen wohl aus der
Notzeit nach dem 2. Weltkrieg, passen aber hervorragend dazu. Foto: Auch Robert
Brückl
|
|

Zwei weitere Frankensteiner Bergbaufreunde in Arbeitstracht.
|
|

Die Frankensteiner Bergbaufreunde vor Ihrer Kaue am Tiefen Anweisung Gottes
Stolln 2008.
|
|

Könnte doch glatt als Original-Postkarte von 1900 durchgehen: Mitglieder des
Bergbauvereins „Altbergbau Freiberger Land e.V.“ in einer etwas gealterten
Darstellung.
|
|
Die Kleidung der im Projekt „Bergkittel“
Mitwirkenden wird durch teilweise originale Accessoires ergänzt. Vor über
Hundert Jahren gefahrene Freiberger Blenden, nachgefertigte Tonpfeifen und
teilweise originale Bergeisengehänge über der Schulter
vermitteln
ein realistisches und nachvollziehbares Bild von den gerade aus der Grube
ausfahrenden Bergleuten.
Im
Laufe der Zeit vergrößerte sich der Kreis derjenigen, die einen Beitrag zur sächsischen
Bergbautradition leisten wollen und sich dem Projekt Bergkittel anschlossen.
Inzwischen sind es fast 30 Mitstreiter, die aus weiteren Bergbauvereinen wie
Biensdorf, Schönborn, Wolkenburg oder auch ohne Vereinsmitgliedschaft sich dem
Projekt angeschlossen haben. Jährlich zwei bis viermal ist das Projekt in der
Öffentlichkeit durch Beteiligung an Veranstaltungen wahrnehmbar.
|
|

Anläßlich der 850 Jahrfeier von Großvoigtsberg ein Gruppenbild vor der Ruine
der Tagesanlagen der Grube Christbescherung.
|
|

Dieses Gruppenbild entstand anlässlich einer Feierlichkeit in Frankenstein vor
dem „Tiefen Anweisung Gottes Stolln“ im Jahr 2010.
|
|

Fast 30 Mitwirkende vor Beginn des Festumzuges anlässlich
der 850-Jahrfeier in Freiberg am 1. Juli 2012 , Foto: Frau Karabinski
|
|
Zur
850-Jahrfeier in Freiberg gibt es aufgrund der von mehreren Fotografen
vorliegenden Bildmenge noch einen separaten
 Bildbeitrag... Dabei haben die
"Dreckkittel" nicht nur ein Bild des Festumzuges gestaltet, sondern
außerdem zwei Vormittage lang die Bergstadt erfolgreich gegen die im
Dreißigjährigen Krieg anrückenden Schweden verteidigt ! Bildbeitrag... Dabei haben die
"Dreckkittel" nicht nur ein Bild des Festumzuges gestaltet, sondern
außerdem zwei Vormittage lang die Bergstadt erfolgreich gegen die im
Dreißigjährigen Krieg anrückenden Schweden verteidigt !
|
|

|
|
|